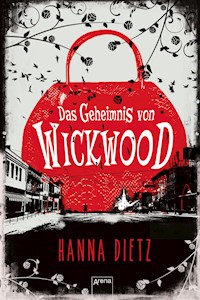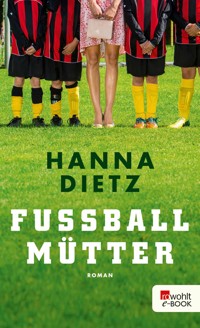9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Natascha. Gefährlich blond
- Sprache: Deutsch
Neue Schule (Mädchen-Elite-Gymnasium), neuer Bodyguard (sexy, aber nervig) und immer noch nicht die perfekte Frisur. Eigentlich dachte Natascha, das wären ihre größten Probleme. Weit gefehlt! An der neuen Schule wimmelt es von Zicken, und dann stolpert sie über eine Leiche im Biolabor. Natürlich kann Natascha ihre Finger nicht von der Sache lassen und ahnt nicht, in welch gefährliches Wespennest sie stößt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Die Autorin
Hanna Dietz, geboren 1969 in Bonn, studierte an der Deutschen Sporthochschule Köln. Seit 1993 arbeitet sie als freie Journalistin für Fernsehen und Hörfunk, darüber hinaus veröffentlicht sie erfolgreich Frauenromane.Gefährliche Gedanken ist der erste Band einer Reihe rund um die jugendliche Hobbydetektivin Natascha Sander. Hanna Dietz lebt mit ihrer Familie in Bonn.
Impressum
Erste Veröffentlichung als E-Book 2013© 2013 Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Covergestaltung: Frauke Schneider ISBN 978-3-401-80212-1www.arena-verlag.de Mitreden unter forum.arena-verlag.de
Titel
Hanna Dietz
Gefährliche Gedanken
Zu schön zum Sterben
1
Damit das mal von Anfang an klar ist: Ich habe zwei Fehler. Ich bin notorisch neugierig. Und ich kann meine Klappe nicht halten. Ach ja und ich bin ziemlich impulsiv. Das wären dann also drei Fehler. Wenn man gnadenlose Ehrlichkeit auch noch dazuzählt, dann sind es vier. Vier Fehler von 759 möglichen, die ein Mensch haben kann, ist eigentlich eine gute Quote. Damit müsste man doch prima zurechtkommen. Könnte man meinen. Aber irgendwie scheine ich mir ausgerechnet die Fehler ausgesucht zu haben, mit denen man sich garantiert am meisten Ärger einhandelt.
Zum Beispiel heute. Es war mein erster Tag auf der neuen Schule. Ein exklusives Mädchengymnasium. Privatschule, versteht sich von selbst. Und katholisch! Versteht sich überhaupt nicht von selbst, schließlich ist keiner in unserer Familie katholisch. Geld ist unsere Konfession. Und das reicht, um an einer katholischen Privatschule mit offenen Armen empfangen zu werden. Selbst mitten im Schuljahr. Und selbst dann, wenn man sich von der anderen Schule nicht gerade mit den besten Empfehlungen verabschiedet hat. Danke übrigens an dieser Stelle an meine ex-beste Freundin Silvy! Du bist wirklich großartig mit deinem falschen Grinsen. Und deinen Intrigen. Und deiner Petzerei. Und deiner… ach, egal. Wo war ich stehen geblieben: Also, ich wurde gefeuert. Sagt man das so? Das Vertrauensverhältnis sei gestört. Auf dieser Basis ließe sich nicht mehr zusammenarbeiten und aus Rücksicht auf die anderen Schüler, die ihre Noten ehrlich erarbeiten… blablabla. Dass ich nicht lache! In Latein hatten alle ihre Smartphones unter dem Tisch und ließen sich die Texte online übersetzen. In Biologie schleuste Caren immer ihren Bruder ein, der gerade seine Doktorarbeit über Mikroben schrieb und dann während der Klausuren in der Besenkammer neben den Toiletten hockte und ihr die Lösungen verriet. Und in Kunst erst! Da lieferten die Zwillinge Susi und Sonja immer fantastische Arbeiten ab, die ihre ehrgeizige Mutter zu Hause fabriziert hatte. Und dann gaben sie mit ihren Einsen auch noch an wie zehn nackte Paviane. Ist das zu glauben?
Ich merke gerade, ich schweife ab. Passiert mir ab und zu. Ist das auch ein Fehler? Könnte sein. Dann wären es also fünf. Fünf ist auch noch eine ganz gute Zahl. Zurück zum Thema: Ich fing also auf der neuen Schule an. Mein Vater brachte mich hin, was ich ziemlich nett fand, weil er ja immer alle Hände voll zu tun hat. Die Schule ist in einem dieser alten, pompösen Gebäude vom Ende des 19.Jahrhunderts untergebracht, man nennt es auch Jugendstilvilla – und bei einer teuren Privatschule trifft das den Kern ziemlich gut. Denn die Jugend, die darin unterrichtet wird, hat einen ganz besonderen Stil, was Kleidung und Verhalten angeht.
Aber ich greife mal wieder vor. Also, die Schulleiterin Meinhilde von Cappeln stand am oberen Ende der breiten Steintreppe mit der weißen Balustrade. Rot gefärbte Haare, zu einem Dutt verknotet, grauer Rollkragenpullover, der ihren langen, dünnen Hals nicht verbergen konnte, ein Schal um die schmalen Schultern gegen die Novemberkälte, blauer Bleistiftrock, straff gespannt an den breiten Hüften, blaue Pumps. So alleine vor dem großen Gebäude stehend erinnerte sie mich an einen Kontrabass, den jemand im Orchestergraben vergessen hatte.
»Willkommen an der Liebfrauenschule, Natascha«, rief sie und streckte mir die Hand hin, noch während ich die Stufen erklomm. »Sie werden sich bei uns wohlfühlen und sicher eine Menge Freundinnen finden!«
Und wie sie mich so von oben bis unten musterte, wurde mir klar, dass sie das nur deshalb gesagt hatte, weil man das eben so macht als Schulleiterin. Aber natürlich würde ich mich nicht wohlfühlen. Und schon gar keine Freundinnen finden. So jemand wie ich findet keine Freundinnen. Seit Silvy halte ich es jedenfalls so: Alle, die nicht meine Feinde sind, sind die besten Freunde, die ich habe. Das reicht mir. Mit dem Thema Freundinnen bin ich durch.
Ich stieg die letzten Stufen hoch und ergriff ihre schmale Hand. »Sicher«, sagte ich und lächelte sie an. Ich überragte die Schulleiterin um mindestens einen Kopf und schaute nun, da ich neben ihr stand, von oben auf sie runter. Sie schien geradezu winzig. Direktorin von Cappeln wandte sich an meinen Vater. »Ich freue mich sehr, Ihre Tochter als Neuzugang begrüßen zu dürfen, Herr Sander.« Sie schüttelte meinem Vater eifrig die Hand. Der goldene Kreuzanhänger, der sich glänzend von dem Grau ihres Pullovers abhob, wackelte dabei im Takt.
»Die Freude ist ganz unsererseits«, antwortete mein Vater, als ob es sich um eine Einladung zur Cocktailparty handeln würde.
»Sie wissen ja, Herr Sander«, sagte von Cappeln vertraulich, »normalerweise hätten wir ja gar keine Schülerin mehr aufnehmen dürfen, wegen der in unserer Satzung festgelegten Obergrenze von zweihundertfünfzig Schülerinnen.« Sie versuchte es beiläufig klingen zu lassen, aber so wie sie meinen Vater dabei anschaute, war klar, dass sie eine umfassende Dankesbezeugung erwartete. Doch ihre Erwartung verpuffte an der natürlichen Autorität meines Vaters.
»Können wir dann?«, fragte er ungerührt und zeigte auf die Eingangstür. Ich vermutete mal ganz stark, eine Dankesbezeugung war auch überflüssig. Denn für die Liebfrauenschule dürfte es sich gelohnt haben, dass die Tochter des alleinigen Eigentümers von L&S Genuss-Fleisch nun hier ihr Abitur ablegen wird.
»Oh ja, aber natürlich«, sagte von Cappeln hastig und hielt uns beflissen die weiße, mit Holzschnitzereien verzierte Eingangstür auf. »Kommen Sie schnell herein, bevor Sie sich auch noch erkälten.« Sie schob ein Bonbon im Mund herum. »Bitte entschuldigen Sie das Hustenbonbon, ich bin sehr anfällig für Bronchitis.« Sie hüstelte und hatte es plötzlich eilig.
Die Eingangshalle der Schule war ungefähr so groß wie die bei uns zu Hause. Wenn man zwei Körbe links und rechts aufstellen würde, könnte man auf kleinem Feld Basketball spielen. Die zwei breiten Marmortreppen mit gusseisernem Geländer und messingverziertem Handlauf, die in geschwungenem Bogen rechts und links nach oben führen, gibt es bei uns allerdings nicht, wir haben nur eine Angebertreppe.
»Das Klassenzimmer der Oberstufe liegt im Caroline-Herschel-Flügel«, dozierte die Direktorin, als sie vor uns her über das blank polierte Parkett stöckelte. »Wir haben unsere Gebäude nach berühmten Wissenschaftlerinnen benannt, um unsere jungen Damen zu motivieren.« Sie mied meinen Blick und fixierte meinen Vater. »Und das gelingt uns auch«, verkündete sie stolz, als wir zu einem Schwarzen Brett kamen, auf dem verschiedene Fotos von lächelnden Mädchen hingen.
»Ich muss mich jetzt leider verabschieden«, sagte mein Vater plötzlich mit Blick auf die Uhr. Er drehte sich zu mir und sah mich mit seinen faszinierenden Augen an. Seine Iris ist karamellfarben und mit dunklen Punkten gesprenkelt, was an grobkörnigen Flusssand erinnert. Seine Haare sind trotz seiner neunundvierzig Jahre immer noch hellbraun. Nur an den Schläfen sieht man einige graue Haare, aber insgesamt wirkt er immer noch sehr jugendlich. Er umarmte mich mit einer lässigen Bewegung.
»Püppchen«, flüsterte er mir ins Ohr, »Erfolg kommt nicht von selbst. Also, streng dich an.«
»Mach ich, Paps«, sagte ich. Er ließ mich los und hatte schon das Handy am Ohr. Er nickte der Schulleiterin zum Abschied zu und eilte mit schnellen Schritten davon. Als ich ihm in seinem schwarzen Armani-Anzug hinterherschaute, ganz der erfolgreiche Geschäftsmann, spürte ich eine kurze, aber heftige Attacke von Heimweh. Papa, geh nicht, wollte ich rufen, als wäre ich sieben und nicht siebzehn.
»Nun«, unterbrach Direktorin von Cappeln meine Gedanken. Ihre Stimme klang anders, jetzt wo mein Vater weg war. Lauter. Herrischer. »Sehen Sie, Natascha. Dies sind die Jahrgangsbesten.« Ich fand schnell das Bild meiner Jahrgangsstufe, der Jahrgangsstufe 12.
»Das ist Ihre Mitschülerin Nora Brandt. Auf sie sind wir sehr stolz. Sie ist eine unserer Stipendiatinnen.« Von Cappeln machte eine Pause und schob dann nach: »Sie hat es sich durch eigene Leistung verdient, hier zu sein.«
Beim ersten Hinsehen wirkte Nora unscheinbar. Braune kurze Haare, blaugraue Augen, eine breite Nase. Doch etwas an ihr war anders. Anders als die anderen Mädchen lächelte sie nicht auf dem Foto. Ihr Gesichtsausdruck war trotzdem nicht unfreundlich. Eher entschlossen.
»Ja, Natascha, nehmen Sie sich Nora ruhig als Vorbild«, sagte von Cappeln spitz. »Aber dafür sollten Sie Ihre wertvolle Zeit wohl besser nicht mit Rumstehen vergeuden.«
Ich wollte ihr einen vernichtenden Blick zuwerfen, aber die Direktorin war schon weitergeeilt. Ich folgte ihr zu einem Torbogen, hinter dem ein langer Gang begann, durch dessen Sprossenfenster auf der linken Seite das fahle Novemberlicht hereinfiel. Die Direktorin deutete auf den Namen, der in goldenen Lettern über uns prangte. »Wissen Sie, wer Caroline Hersch…«
»Eine deutsche Astronomin des 19. Jahrhunderts«, unterbrach ich. »Anfangs hat sie ihren Bruder Wilhelm unterstützt, der den Uranus entdeckt hat, später hat sie eigenständig geforscht und mehrere Kometen entdeckt.«
»Na, sieh mal einer an!« Sie drehte sich erstaunt zu mir um. »Vielleicht können Sie es mit unserer Hilfe doch noch schaffen, dass Ihr Vater stolz auf Sie ist.« Sie sah mich mit herablassendem Lächeln an und ich merkte, wie die Wut in mir hochstieg. Ich bin nämlich… Moment mal, sollte ich tatsächlich sechs Fehler haben? Sieht ganz so aus. Mist. Na ja. Hab ich mir nicht ausgesucht. Ist eben so. Also, Fehler Nummer sechs ist: Ich bin allergisch gegen Arroganz. Extrem allergisch. Wenn mich jemand so von oben herab behandelt wie diese eingebildete Schulleiterin, die sich dazu noch in Familienangelegenheiten einmischte, dann bringt mich das in null Komma nix auf die Palme. Und dort oben kann ich überhaupt nicht mehr klar denken!!! Ganz dumme Eigenschaft von mir.
Ich trat einen Schritt näher an sie heran. »Nur zu Ihrer Information«, sagte ich und versuchte, den hochnäsigen Tonfall einer Freundin meiner Mutter zu imitieren, die sich ständig über ihr Personal empört (und die ich deswegen überhaupt nicht leiden kann). »Mein Vater ist immer stolz auf mich, dafür habe ich Ihre Hilfe nun wirklich nicht nötig.«
Von Cappeln lächelte knapp. Meine gespielte Überheblichkeit prallte an ihrer echten Aufgeblasenheit total ab. Sie sah mir in die Augen und schüttelte mitleidig den Kopf. Jetzt, wo sie so nah vor mir stand, nahm ich einen schwachen Hauch Alkoholfahne unter dem Eukalyptusgeruch wahr. Na, sieh mal einer an!
»Natascha«, sagte sie abfällig, »Sie wissen doch sehr genau, wie ich das meine.«
»Nein, weiß ich nicht.« Klar wusste ich es.
»Na, der Vorfall!«
Ich funkelte sie stumm an.
»Der Vorfall, der Ihnen den Schulverweis eingebracht hat. Der Ihren armen Vater in diese Situation ...«
Klick!, machte es in meinem Kopf. Sicherung rausgesprungen, Verstand ausgeschaltet.
»Wissen Sie, Frau von Cappeln«, hörte ich mich sagen. »Ich könnte die Arroganz, mit der Sie mich behandeln, zu einem Vorfall machen. Ich könnte Ihre eigenen Probleme zu einem Vorfall machen. Wollen Sie das, Frau von Cappeln?«
Ihre Kinnlade fiel runter, sie wich vor mir zurück, als wäre ich der Teufel persönlich. Klick! Verstand wieder eingeschaltet. Und ich ärgerte mich augenblicklich über mich selbst. Verdammt noch mal, reiß dich doch zusammen! Der Schulleiterin drohen, also wirklich, Sander, du tickst ja wohl nicht richtig. Du musst hier keine Freunde finden. Aber du solltest es echt vermeiden, dir Feinde zu machen. Und das nach gerade mal einer Viertelstunde! Noch bevor du überhaupt deine neuen Klassenkameradinnen kennengelernt hast.
Schweigend stiegen wir die breite Treppe hinauf bis in den zweiten Stock, wo mein Klassenraum lag. Die letzten Meter herrschte eiserne Stille und meine Nervosität stieg, als wir die Tür zu meinem neuen Klassenzimmer erreicht hatten. Ich mag nach außen hin cool wirken. Aber das bin ich natürlich nicht immer. Auch für mich ist es nicht leicht, vor einen Haufen neuer Leute zu treten. Zwar fühlt sich der Mensch gerne wie die Krone der Schöpfung, die mit den niederen Instinkten der Tierwelt gar nichts mehr am Hut hat. Doch wenn ein neues Mitglied zu einer Gemeinschaft stößt, ist alles, was im ersten Moment abläuft, reine Biologie. Besonders unter rivalisierenden Geschlechtsgenossinnen. Da wirbelt ein neues Mitglied die Hackordnung kräftig durcheinander. Und wenn ich auftauche, schrillen erfahrungsgemäß bei sämtlichen Alphaweibchen die Alarmglocken. Denn – jetzt kommt’s, nicht erschrecken! – ich sehe gut aus. Ist eben so. Glück gehabt. Ich bin nicht perfekt, aber trotzdem – ich weigere mich einfach, mein Aussehen zu leugnen, denn das wäre albern. Dass ich damit gegen jede Norm verstoße, ist mir natürlich klar. Manchmal scheint es mir nämlich so, als ob das Jammern über das eigene Aussehen oder das eigene Können irgendeine perverse weibliche Pflicht wäre. Dieser Logik zufolge müsste ich den ganzen Tag über meine abstehenden Ohren und zu kräftigen Oberschenkel und die kleine Lücke zwischen meinen Schneidezähnen stöhnen. Mach ich aber nicht. Ich habe beschlossen, mich klasse zu finden, genau so, wie ich bin. Und deswegen fühlen sich die anderen angegriffen und noch unsicherer. Diese Unsicherheit ist dann der perfekte Nährboden für Neid. Und Neid verführt die Menschen zu den gemeinsten Taten. Nicht wahr, Silvy?
Direktorin von Cappeln klopfte an die Tür und öffnete sie fast zeitgleich. Die Köpfe von einem Lehrer und zweiundzwanzig Schülerinnen drehten sich zu mir. Stille. Was jetzt folgte, nenne ich Check and Classify, Abchecken und Einordnen. Das dauert immer nur wenige Sekunden, dann weiß man, an welchem Ende der Nahrungskette man gelandet ist.
Ich musste zweiundzwanzig andere Schülerinnen anschauen, sie eine. Was die Schülerinnen sahen, war ein schlankes Mädchen mit blauen Augen in schwarzen Stiefeln von Blumarine und kurzem Missoni-Strickkleid in einem Wellenmuster in Hellviolett und Grau. Meine blonden Haare hatte ich zu einem Pferdeschwanz gebunden, der hoch am Hinterkopf wippte und mir leider gar nicht so toll gelungen war. Ich versuche nämlich schon seit ein paar Wochen, den perfekten 1960er-Jahre-Pferdeschwanz hinzukriegen, bei dem die Haare am oberen Hinterkopf etwas auftoupiert werden, um ihn zu betonen, und die Haare dann darunter mit einem breiten Gummi so gebunden werden, dass sie wie von der Klippe eines breiten Wasserfalls herunterfallen. Das finde ich so was von schick! Hatte ich aber leider noch nicht einmal hingekriegt. Vielleicht sollte ich doch mal eines dieser Haarkissen benutzen? Ach, verflixt. Wenn es um Haare geht, komme ich immer schnell vom Thema ab.
Ich ließ den Blick über die Reihen schweifen. Zweiundzwanzig neue Klassenkameradinnen. Mein Hirn registrierte beim ersten Check natürlich nur die auffälligsten. Klick machte es beim Anblick eines schmalen kichernden Mädchens mit pinken, abstehenden Haaren und Kulleraugen, die direkt aus einem Manga entsprungen sein könnte. Sie saß in der letzten Reihe neben einer sommersprossigen Brünetten, die auf dem Finger einen Bleistift balancierte und dabei eine Grimasse zog. Ich steckte die beiden fürs Erste in die Schublade Humorabteilung. Zwei Plätze weiter im Mittelgang fläzte sich ein gelangweiltes Mädchen mit praktischer Kurzhaarfrisur und Kapuzenjacke, aus dem Rucksack neben ihrem Pult ragte die Spitze eines Skateboards. Ganz klar, die Sportskanone. An der Fensterseite der ersten Reihe bemerkte ich überraschenderweise noch eine Lehrerin, die das altmodische Kostüm aus einem Hollywoodschinken der 1940er trug, inklusive Haarwelle und makellos eleganter Sitzhaltung. Das konnte doch keine Schülerin sein, oder? Komisch. Aber der Lehrer stand ja schon vorne. Mmmh. Entweder besuchte tatsächlich eine seiner Kolleginnen den Unterricht oder eine meiner neuen Klassenkameradinnen sah so aus wie Dita von Teese.
Ganz vorne rechts saß ein Mädchen mit glatten rötlichen Haaren, die ihren Finger in den Mund steckte und begann, an den Fingernägeln zu kauen. Ihre Sitznachbarin, eine etwas pummelige Blonde, schaute schnell weg, holte ihr Handy unter dem Tisch heraus und tippte eine SMS. Ich suchte weiter. Dann entdeckte ich sie. In der Mitte der zweiten Reihe. Zentraler ging es nicht. Eine Dunkelhaarige in einem knallroten Mohairpullover und passend geschminktem Schmollmund. Sie richtete sich unmerklich in ihrem Stuhl auf, lehnte sich zurück, mit gestrafften Schultern und hochgerecktem Kinn, warf in einer minutiösen Bewegung ihre Locken hin und her und fixierte mich. Das ist sie also, dachte ich. Das Alphaweibchen. Sie thronte auf dem Holzstuhl wie eine Prinzessin, die es gewohnt war, von allen Seiten Aufmerksamkeit und Respekt zu bekommen, und selbst auf unbequemen Stühlen nicht die Haltung verlor. Die Sitznachbarin zu ihrer Rechten, ein hellbrauner Pagenkopf, beugte sich zu ihr und flüsterte ihr leise etwas zu. Die Prinzessin ließ mich nicht aus den Augen und musterte mich kühl. Interessant, dachte ich. Ich wich ihrem Blick nicht aus. Es kam zu einem ersten Kräftemessen. Ich gehe ja grundsätzlich keiner Auseinandersetzung aus dem Weg. Dafür bin ich nicht geschaffen. Ist vielleicht auch ein Fehler. Das wären dann ja tatsächlich schon sieben. Ach du meine Güte. Wie viele werden es denn noch?
Obwohl ich mir weiterhin einen stummen Contest im Anstarren mit der Prinzessin lieferte, bemerkte ich die platinblonde Tussi links von ihr, was nicht schwer war, da sie mit einer Überdosis Make-up und dem Gesichtsausdruck eines verwöhnten Schoßhündchens gesegnet war. Die platinblonde Tussi schrieb mit einem puschelbehangenen Kuli was auf einen Zettel und schob ihn der Prinzessin zu, wobei sie ein Prusten unterdrückte. Die Prinzessin reagierte nicht darauf, deswegen stieß die Tussi sie leicht mit dem Ellenbogen an. Die Prinzessin hob blasiert eine Augenbraue und zeigte mir damit an, dass sie des Spiels überdrüssig war, und widmete ihre Aufmerksamkeit dem Zettel. Die Tussi kicherte leise. Die Prinzessin zeigte mit kurzem Nicken an, dass sie die Information zur Kenntnis genommen hatte. Dann schaute sie wieder nach vorne, knapp an mir vorbei. Eines war jetzt schon klar: Das hier würde nicht leicht werden.
Meinhilde von Cappeln hatte sich während des wenige Sekunden dauernden Check-and-Classifyings leise mit dem Lehrer unterhalten und stellte mich jetzt in aller Eile nur als die neue Mitschülerin vor und verschwand grußlos.
»Hallo«, sagte ich. »Ich heiße Natascha.«
Vereinzeltes Hallo-Gemurmel, ansonsten eisiges Schweigen. Mmhh. Nicht dass ich eine stürmische Begrüßung erwartet hätte, aber die Stille war schon unangenehm. Na ja. Immerhin lachte keiner.
»Hallo Natascha«, begrüßte mich der Lehrer freundlich. Kariertes Hemd, Cordjackett, Bundfalten-Jeans, Dreitagebart, raspelkurzes Resthaar auf dem Kopf, Lachfalten um die Augen, eine Ausstrahlung wie ein lustig knisterndes Kaminfeuer. »Ich bin Herr Nowak, Ihr neuer Mathelehrer. Willkommen bei uns.«
Er zeigte auf einen leeren Platz in der ersten Reihe neben der Nägelkauerin und dann auf einen freien Stuhl in der zweiten Reihe, drei Plätze neben der Schwarzhaarigen, die mich feindselig musterte. »Hier vorne sitzen die Mädchen, die Mathe mögen. Weiter hinten logieren die, die Mathe am liebsten ausrangieren würden wie ein Outfit der letzten Saison, nicht wahr, Milena?«
»Sie sind mal wieder äußerst amüsant, Herr Nowak«, bemerkte Milena, die Prinzessin, mit blasiertem Augenaufschlag. Der hellbraune Pagenkopf neben ihr offenbarte sich als Milenas treue Dienerin, indem sie den Lehrer ebenfalls entrüstet anstarrte.
»Stets zu Diensten, Milena.« Nowak grinste. »Wo möchten Sie lieber sitzen, Natascha?«
»Ich mag Mathe«, sagte ich.
»Oh.« Herr Nowak zog erfreut die Augenbrauen in die Höhe. Die Nägelkauerin in der ersten Reihe zog ihre Schulbücher auf ihre Seite des Pults.
»Aber ich setze mich trotzdem nach hinten«, sagte ich und ging zu dem Stuhl in der zweiten Reihe. Auf dem anderen Platz hätte ich genau vor Milena gesessen. Und ich bevorzuge es, meinen Gegnern nicht den Rücken zuzukehren.
Die erste Hürde hatte ich genommen. Ich saß. Meine Sitznachbarin zur Linken nickte mir freundlich zu und stellte sich als Diana vor. Meine Sitznachbarin zur Rechten ignorierte mich. Sie hieß Heidrun Zumke, wie ich mit einem Blick auf ihr Heft feststellte, und war eine Romantikerin – zumindest modisch. Sie trug eine halb durchsichtige Seidenbluse mit Rosenaufdruck, hatte eine süße Stupsnase und eine dieser Gretchenfrisuren, die als trendy galten, seitdem irgendein unterbeschäftigter Stylist tatsächlich prominente Opfer für dieses Haardesaster gefunden hatte: geflochtene Zöpfe, die kronenartig über den Kopf gelegt werden und sogar Salma Hayek in eine altjungferliche Landpomeranze verwandeln. Aber Heidrun Zumke trug die Gretchenfrisur in Brünett mit einer gewissen Würde, jedenfalls bis sie meinen kurzen Blick darauf bemerkte und anfing, nervös an heraushängenden Strähnen zu zubbeln, die Augen starr nach vorne gerichtet.
Herr Nowak erklärte derweil die Hessesche Normalform, eine Formel zur Berechnung von Abständen. Ich nahm Schulheft und Stift aus meiner Tasche und versuchte, mich zu konzentrieren. Doch dann schnappte ich von der Reihe hinter mir die Wörter »Chauffeur« und »heiß« auf. Das interessierte mich natürlich spontan viel mehr als irgendwelche mathematischen Formeln. Ich lehnte mich nach hinten, kippte den Stuhl auf die beiden Hinterbeine, um mitzukriegen, was mit dem heißen Chauffeur so los war. Ausgerechnet als das Wort »küssen« fiel, sprach mich Herr Nowak an. »Natascha«, sagte er und hielt dann die Luft an, weil mir plötzlich das Gleichgewicht abhandenkam und ich nach hinten kippte. Schon sah ich mich rücklings aufs Parkett donnern, kein guter Einstand in der neuen Klasse, eine abrupte Gewichtsverlagerung musste her. Ich schleuderte in letzter Sekunde die Beine nach vorne wie auf der Schaukel und riss gleichzeitig die Arme wie beim Brustschwimmen ausgebreitet nach hinten. Ich habe ziemlich lange Arme, und es klappte. Allerdings hatte ich leider keine Zeit mehr gehabt, selbst eine Abstandsberechnung durchzuführen. Es machte Klatsch! und ich hatte meiner rechten Sitznachbarin, der romantischen Heidrun, meine Flosse ins Gesicht gehauen. Immerhin stand mein Stuhl wieder mit allen vieren auf dem Boden.
»Aua!«, heulte Heidrun und hielt sich die Wange. Ich hörte unterdrücktes Kichern.
»Ups«, sagte ich. »Das war ein Unfall.«
»Das hast du mit Absicht gemacht!«
»Blödsinn. Aber wenn du willst, kannst du mir auch eine langen.«
»Was?« Sie sah mich verständnislos an.
»Hau ruhig zurück.« Ich drehte ihr die Wange zu.
»Nein!«, rief sie entrüstet. »Natürlich nicht.«
»Okay. Dann schenk ich dir einen sauren Saurier.« Ich kramte in meiner Tasche nach der Tüte mit meiner Überlebensration Fruchtgummi und hielt sie ihr hin. Sie glotzte darauf, als ob es lebende Regenwürmer wären.
»Nein danke.«
»Auch gut.« Ich packte sie wieder weg. »Peace?« Ich reichte ihr die Hand zum Friedensschluss.
»Ja«, sagte Heidrun überrumpelt. »Aber mach das nicht noch mal.«
»Ich bemühe mich.« Ich lächelte ihr aufmunternd zu, aber sie warf mir nur einen grimmigen Blick zu und drehte sich wieder nach vorne. Herr Nowak hatte uns die ganze Zeit den Rücken zugekehrt gehabt und an dem Beben seiner Schultern sah ich, dass er mit einem Lachanfall kämpfte. Auch als er sich wieder der Klasse zuwandte, konnte er kaum an sich halten. »Also, Natascha«, sagte er und unterdrückte ein Prusten. »Es wäre vielleicht besser, wenn Sie sich auf das Geschehen hier vorne konzentrieren würden…«
Er kam nicht weiter, denn ein weiterer kleiner Tumult entstand in der letzten Reihe, wo das sommersprossige Mädchen neben der pinken Mangafigur mit dem Stuhl tatsächlich hinten an die Wand geknallt war. Die beiden kicherten wie wild. Nowak seufzte und sagte: »War ja klar, Beatrix, dass Sie es nicht auf sich sitzen lassen können, wenn hier mal jemand anders für Gelächter sorgt.«
Die sommersprossige Beatrix zog eine Grimasse, ihre Freundin, die Mangafigur, prustete, dass ihre pinken Haare wackelten.
»Und auch Sie, liebe Solveig, sollten sich lieber zusammenreißen, sonst sieht es in der nächsten Klausur wieder düster aus.« Nowak wandte sich an mich: »So, Sie haben also schon unseren Klassenclown Beatrix und sein bestes Publikum Solveig kennengelernt, Natascha. Jetzt wollen wir Sie etwas besser kennenlernen. Und deswegen, zurück zum Thema.« Er wandte sich an die Tafel und zeigte auf die Formel. »Natascha, können Sie uns vielleicht den Betrag des Normalvektors berechnen. Sie müssen hier die Wurzel aus minus drei zum Quadrat plus…«
»34«, sagte ich.
»Okay, das stimmt«, antwortete Nowak überrascht. »Und können Sie auch die Hessesche Normalform…«
Ich nannte ihm die Lösung. Er starrte mich einen Augenblick verwundert an, lächelte dann zufrieden und sah aus, als ob er ein Liedchen summen wollte. Gern geschehen.
Dann überlegte ich, wie es mit mir weitergehen sollte. Ich war fünfunddreißig Minuten an der neuen Schule und hatte mich schon mit der Direktorin angelegt und meiner Sitznachbarin eine reingehauen. Nicht gerade eine gute Bilanz. Klar hatte ich mir vorgenommen, alles anders zu machen auf der neuen Schule. Aber doch nicht so! Mein Plan war eigentlich gewesen, mich aus allem rauszuhalten, bis ich wusste, woran ich war. Auf der letzten Schule hatte ich mich nämlich eindeutig auf die falschen Leute eingelassen – und das, obwohl ich von Anfang an ein schlechtes Gefühl hatte bei Silvy. Aber sie und Lola und Marie waren so nett gewesen und die Vorstellung, zu einer angesagten Clique dazuzugehören, war so schön gewesen, dass ich meinen Instinkt überredet hatte, die Klappe zu halten. Und dann hatten sie vornerum so getan, als wären wir beste Freundinnen, und hintenrum hatten sie jede Menge Gerüchte über mich in die Welt gesetzt. Hier nur mal das Top of the Gossip, mit dem sie mir jede Chance bei Lukas verbaut hatte. Sie hatte ihm allen Ernstes erzählt, dass ich… wenn ich daran denke, kocht in mir immer noch die Wut hoch… dass ich mir bei einem meiner angeblich zahlreichen Lover Chlamydien geholt hätte. Nett, nicht? Dabei hatte ich bis dahin in Wahrheit nicht einen einzigen Lover gehabt. Was Silvy auch genau gewusst hat. Erfahren hatte ich von der Lüge erst, als schon klar war, dass ich von der Schule fliege. Marcel, die alte Aua-er-hat-mich-gefoult-Sportpetze, kam zu mir und fragte mich, ob die Chlamydien-Infektion vorbei sei, denn wenn ja, dann würde er sich bereit erklären, mit mir ins Bett zu gehen. Ich brauchte etwa drei Sekunden, um das Gesagte zu begreifen. Dann packte ich ihn am Hemdkragen und drückte ihn gegen die Mauer und er gab sofort zu, von wem er das gehört hätte. Von meiner angeblich besten Freundin. Die hätte die Jungs vor mir gewarnt und ihnen eingebläut, sie sollten mir gegenüber auf gar keinen Fall erwähnen, dass sie Bescheid wüssten, weil ich mich ja sowieso schon so unwohl fühlen würde. Heilige Scheiße! So was, das hatte ich mir geschworen, würde nie wieder passieren. Immerhin gab es auf dieser Schule keine Jungs. Wer weiß, vielleicht sorgte das dafür, dass die Mädels nicht ganz so biestig waren. Aber darauf wollte ich mich nicht verlassen. Ab jetzt würde ich alles total ruhig angehen lassen. Und wenn ich dann zu der Entscheidung kam, dass es niemanden hier gab, mit dem ich auch nur eine Silbe reden wollte, auch gut. Dann würde ich eben bis zum Abitur als schweigender Eremit leben. Sag ich jetzt mal so.
Den Rest des Tages hielt ich zu meiner eigenen Überraschung durch, ohne weiteren Schaden anzurichten. Besonders stolz bin ich, dass ich mich zusammenreißen konnte, als mich zur Pause ein Mädchen mit »Hallo, ich heiße Nevaeh, wie Heaven, nur rückwärts« ansprach und affektiert ihr gekrepptes Haar schüttelte. Da war ich ganz knapp davor, wieder irgendeinen Unsinn zu machen, aber glücklicherweise verfiel ich nur in eine Schockstarre. Eltern, die solche Namen vergeben, sollte man meiner Meinung nach verhaften oder in eine bundesweite Fernseh-Talkshow schicken, wo sie sich jedem als Rautgunde Polyxenia und Pubert Pellegrino Schmitz vorstellen müssen. Als Nevaeh-wie-Heaven-nur-rückwärts merkte, dass ich nicht in Plauderlaune war, zog sie irritiert ab. Um weitere mögliche Zusammenstöße zu vermeiden, änderte ich meine Taktik, indem ich einfach so tat, als hätte ich ganz dringende Sachen zu erledigen. In den Pausen spazierte ich durch das Gebäude und entging jedweder verhängnisvollen Kommunikation. In den Unterrichtsstunden tat ich so, als ob ich eifrig mitschrieb, und kritzelte dabei so feste mit dem Kuli hin und her, dass ich einige Seiten meiner Hefte durchlöcherte. Als die letzte Stunde, Französisch, anbrach, war ich froh, dass ich im Sprachlabor einen Platz neben der Jahrgangsbesten gefunden hatte, denn Nora war offensichtlich genauso wenig auf Kontakt aus wie ich. Sie nickte mir kurz zu und lauschte dann andächtig dem Kauderwelsch von Frau Krawelinski, die um ihre üppige Dampfnudelfigur ein todschickes Wickelkleid mit schwarz-weißem Blumenmuster drapiert hatte und mit ihren signalroten Lippen zu bleichem Teint aussah wie die ewig Champagner schlürfende Muse eines mürrischen Malergenies. Ich fand sie klasse und ließ mich auch nicht davon stören, dass sie einen auf besonders Französisch machte, indem sie das »oui« immer wie »wäh« aussprach. Ihr tolles Outfit machte jedenfalls richtig Lust auf einen Stadtbummel. Und den würde ich direkt nach der Schule in Angriff nehmen. Als Belohnung für… mmmhhh… für diesen verkorksten ersten Tag ... für mein selbst gewähltes Eremitentum und ... einfach überhaupt. Die Aussicht auf eine ausgiebige Shoppingtour besserte meine Laune erheblich. Was ich am liebsten kaufe, sind – keine Überraschung – Klamotten, Schuhe, Make-up und Cremes und besonders gerne Bücher. Ich zwinge mich aber dazu, jedes Mal nur ein einziges Buch zu kaufen, und zwar das, was mich an diesem Tag am meisten anzieht. So kommt man an genau das Buch, das der eigenen Stimmung am besten entspricht, und man muss nicht so viel schleppen, wenn einem danach einfällt, dass man ganz dringend noch ein neues Top braucht. Sobald die Schulglocke ertönte, schnappte ich meine Tasche und eilte zur Tür. Die letzte Stunde hatte im ersten Stock stattgefunden, und ich lief beschwingt die Treppe herunter. Bis ich zum Fenster kam, aus dem man über das Eingangstor auf die Straße schauen konnte. Da sah ich ihn. Und meine gute Laune war mit einem Schlag vorbei.
2
Er stand vor dem Schulgebäude auf der anderen Straßenseite im Schatten eines Baumes, die Arme verschränkt. Er wartete. Er wartete auf mich. Schon wieder. Er war einen halben Kopf größer als ich und ungefähr doppelt so breit. Sein Gesicht war von hier oben nicht zu erkennen, aber ich wusste ja, wie er aussah mit seinen kurz geschorenen schwarzen Haaren und den hellgrünen Augen, die einen erfassten wie ein Laserstrahl.
Seit drei Tagen hing er mir schon an den Hacken. Wie ein verdammter Stalker. Dieser Widerling. Jetzt löste er seine starre Haltung und schaute auf die Uhr. Die anderen Schülerinnen wurden eine nach der anderen mit protzigen Autos abgeholt. Aber er interessierte sich nicht für sie. Dabei hatten die auch massig Geld. Er interessierte sich nur für mich. Aber heute würde er mich nicht kriegen und mich in mein langweiliges, aber sicheres Zuhause treiben. Jetzt verließ er seinen Posten im Schatten und strebte auf den Vordereingang zu. Mist! Der Typ war so dreist, er würde sogar hier reinkommen! Es gab für mich nur eine Lösung: Abhauen. Auf meinem Rundgang durch das Gebäude hatte ich schon gecheckt, dass es im Erdgeschoss einen Hinterausgang gab, aber der war verschlossen. Mir blieb also nur eine Möglichkeit: die Toiletten. Die Fenster hatte ich mir schon angesehen, sie waren leicht zu öffnen. Dummerweise war ich im ersten Stock. Aber runter ins Erdgeschoss kam ich nicht mehr. Denn ich hörte schon das Pfeifen, das durch die Eingangshalle schallte. Dieser Typ pfiff, als ob er nicht das Geringste zu befürchten hätte. Als ob er so überlegen wäre, dass er sich nicht mal verstecken bräuchte! Und dann pfiff er auch noch die Melodie aus »Der Pate«, dem Lieblingsfilm meines Vaters! Hallo?! Ging es noch klischeemäßiger?
Ich sprintete zu den Toiletten, die sich jeweils auf halber Treppe befanden und vermutlich irgendwann mal Dienstbotenzimmer waren. Ich öffnete das Sprossenfenster. Von hier aus sah man den hinteren Teil des Geländes, den Wirtschaftshof, oder anders gesagt: Das hässliche Zeug, was die erlauchte Schülerschaft natürlich nichts anging. Ein Lagerhaus, fünf Müllcontainer und anderer Kram. Weiter hinten lag ein Parkplatz, vermutlich für die Lehrer. Leider waren es von hier oben bestimmt drei Meter bis zum Boden. Mir wurde ein bisschen mulmig. Weiter rechts sah ich eine stählerne Feuertreppe, die aus dem zweiten Stock herunter in den Hof führte. Links von mir standen die riesigen Müllcontainer. Schade, eindeutig zu weit weg. Und wenn ich mich an dem Ledergurt meiner Tasche abseilen würde? Stabil genug wäre der, ich sag nur: sonnengetrocknetes Premium-Rindsleder. Aber leider war er lediglich knapp einen halben Meter lang. Das brachte nichts. Plötzlich sah ich unten Rauch aufsteigen und jemanden zwei Schritte nach vorne gehen. Es war meine Klassenkameradin Nora, die Jahrgangsbeste, die hinter dem Müllcontainer rauchte. Sie schaute zu mir hoch. »Kann ich dir irgendwie helfen?«, fragte sie und blies den Rauch durch die Nase aus.
»Wäh«, keuchte ich, unsere Französischlehrerin imitierend.
»Très bien«, antwortete sie und machte Anstalten, den großen Papiercontainer vor das Fenster zu rollen. Ihre braunen kurzen Haare waren anders als auf dem Klassenbesten-Foto zerzaust, was ihr eine leicht verwegene Ausstrahlung gab. Vielleicht war sie doch nicht so eine langweilige Streberin. Ich hörte das Pfeifen vom Flur und eine Welle der Panik überkam mich. Verdammt! Zu spät!
Schnell flitzte ich in eine der Toilettenkabinen, sprang mit den Füßen auf den Klodeckel und hockte mich hin, in der Hoffnung, dass er auf den alten Offenes-Fenster-Trick hereinfallen würde.
Die Tür zur Toilette öffnete sich. Mein Herz schlug so heftig, dass ich dachte, das würde mich verraten, aber er rannte zum Fenster und sah hinaus. Ich hörte Noras Stimme, er stöhnte auf, dann Schritte, Türenschließen, Ruhe. Ich wartete noch eine Minute, dann wagte ich mich raus. Ich linste vorsichtig über das Treppengeländer in die große Eingangshalle.
Er stand im Eingang. Ich sah seine Silhouette im Gegenlicht, er redete mit zwei jüngeren Mädchen und deutete nach oben und nach draußen. Die Mädchen zuckten mit den Schultern. Er warf einen Blick nach oben. Hatte er mich gesehen? Schnell wich ich zurück und rannte los. Weiter nach oben. Die Feuertreppe, die ich eben aus dem Fenster gesehen hatte, würde mich retten. Im zweiten Stock versuchte ich mich zu orientieren. Das war gar nicht so einfach. Ich rannte weiter, bog um die Ecke nach rechts, in den Marie-Curie-Trakt. Durch ein Fenster sah ich den Wirtschaftshof, das war schon mal gut, die Feuertreppe musste also von einem der Zimmer auf der linken Seite dieses Gebäudeteils abgehen. Dort gab es drei Türen. Die ersten beiden waren abgeschlossen, doch die dritte war nur angelehnt. Wenn ich Glück hätte, wäre das der richtige Raum mit dem Zugang zur Feuertreppe. Ich stieß die Tür auf. Zu meiner Erleichterung war niemand darin. Und zu meiner noch größeren Erleichterung entdeckte ich das grüne leuchtende Schild des Notausgangs an der gegenüberliegenden Wand, links von der aufgeklappten Tafel. Wunderbar! Boutiquen, ich komme! Leise schloss ich hinter mir die Tür. Auf dem Weg zum Notausgang mit dem kleinen vergitterten Sichtfenster blickte ich mich um. Plakate mit der DNS-Doppelspirale und einer Übersicht über die Tierarten hingen an den Wänden. Eindeutig der Bioraum. Es roch merkwürdig. Muffig. Igitt. Als ob hier irgendeiner ein fieses Experiment gemacht hätte. Und dann sah ich, dass ich doch nicht allein war. Da saß ein Mädchen auf einem Stuhl am Ende des Raumes, gegenüber einer weiteren Tür, die in den Nachbarraum zu führen schien. Sie hatte mir den Rücken zugedreht. Im Nachhinein frage ich mich, warum ich nicht einfach weitergegangen bin. Warum ich sie nicht einfach ignoriert habe, so wie sie mich. Denn sie rührte sich kein bisschen. Auch als ich Hallo sagte, antwortete sie nicht. Noch so eine arrogante Ziege, dachte ich. Die sollten hier dringend mal einen Grundkurs in Sachen Höflichkeit anbieten. Trotzdem blieb ich stehen. Es mag daran gelegen haben, dass sie viel zu luftig angezogen war für November. Aber was mich am meisten irritierte, war die Art, wie sie auf dem Stuhl saß. So krumm, so verdreht. Die Arme komisch abgewinkelt. Und auch die Beine merkwürdig von sich gestreckt. Und der Kopf erst! Er war zur Seite gedreht, das Gesicht schaute zur Decke, der Hals war total überdehnt. So würde kein normaler Mensch sitzen. Mir wurde mulmig.
»Alles in Ordnung?«, fragte ich zaghaft. Keine Antwort. Langsam ging ich näher, hielt mich dabei aber an der Wand. Irgendwie hatte ich das Bedürfnis nach einem Sicherheitsabstand wie zu einem bissigen Hund. Mein Herz klopfte wild. Und dann, als ich sie im Profil sehen konnte, wurde mir klar, warum sie nicht geantwortet hatte. Ein Messer steckte in ihrer Brust. Der Schaft war hellbraun. Um die Einstichstelle herum war Blut. Rotes Blut. Richtiges echtes rotes Blut. Auf der nackten Haut ihres Dekolletees. Auf ihrer weißen Bluse, auf der sich ein großer Fleck ausgebreitet hatte. Die Augen starrten leblos an die Decke. Ihr Mund mit den blassen, wächsernen Lippen war leicht geöffnet. Ein Tropfen Blut klebte in ihrem Mundwinkel und verstärkte den Eindruck der großen Verzweiflung, die sie in diesem letzten Augenblick ihres Lebens überkommen hatte. Oh. Mein. Gott. Insgesamt dauerte es vielleicht nur eineinhalb Sekunden, bis das Bild von meiner Netzhaut ins Hirn gekrochen war, aber es kam mir vor wie eine Ewigkeit, bis es sich in meinem Bewusstsein zu einer Feststellung materialisiert hatte und ich verstand, was ich da sah: eine Leiche. Auf dem Stuhl am Ende des Raumes saß ein totes Mädchen in Spitzenbluse, Minirock und Pumps mit einem Messer in der Brust und vor ihren Füßen lagen Blumen wie ein letzter Gruß. Ich drehte mich auf dem Absatz um und rannte zurück auf den Flur, donnerte die Tür hinter mir zu, schleppte mich auf steifen Beinen zum Mülleimer und kotzte, Butterbrot und Orangensaft, Fruchtgummis, Magensäure und jede Menge Angst. Tränen traten mir in die Augen, als ich immer wieder würgen musste. Deswegen sah ich ihn nicht kommen.
»Was ist denn mit dir los?«, fragte er, plötzlich neben mir stehend. »Alles in Ordnung?«
So eine bescheuerte Frage konnte ja auch nur von ihm kommen, dem aufdringlichsten Bodyguard aller Zeiten, der mir seit drei Tagen mit seiner Daueranwesenheit das Leben zur Hölle machte. Wie kann alles in Ordnung sein, wenn ich mir gerade die Seele aus dem Leib kotze, hätte ich gerne geantwortet, aber der Schock saß zu tief und ich war noch nicht in der Lage zu sprechen. Ich stützte mich auf den Rand des Mülleimers, immer noch über den besudelten Abfall gebeugt.
»Tief ein- und ausatmen«, sagte Enzo. »Das hilft mir…«
»Da ist eine Leiche«, stieß ich hervor. »In dem Raum da!«
»Was?«
Ich richtete mich auf und nickte. Enzo musterte mich misstrauisch, ging aber dann doch zu der Tür, neben der ein kleines Schild anzeigte, dass es sich um das Biologielabor handelte. Ich blieb in sicherem Abstand stehen. Das Bild der Leiche war mir mehr als präsent vor Augen und das reichte mir für den Rest meines Lebens. Enzo rüttelte am Türknauf, der sich nicht drehen ließ. »Sie ist zu.«
»Hol die Schulleitung!«, keuchte ich.
Enzo stutzte einen Moment, dann lachte er leise. »Genau. Und ich lass mir dabei viel Zeit. Und wenn ich zurückkomme, ist das Fräulein Sander verschwunden und ich stehe mal wieder da wie der letzte Idiot, weil ich nun mal für die Sicherheit von Fräulein Sander verantwortlich bin.«
Ich warf ihm einen wütenden Blick zu und wischte mir den kalten Schweiß von der Stirn. Normalerweise hätte ich ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass ich dieses Fräulein-Gelaber hasste. Aber ich war viel zu erschöpft, um mich jetzt darüber aufzuregen. Ich hatte gerade eine Leiche gesehen, da war ein missmutiger Bodyguard nichts dagegen. Bei dem Gedanken an das tote Mädchen überkam mich erneut ein Würgereiz.
»Obwohl, ich muss sagen, diesmal hat deine Inszenierung wirklich etwas Überzeugendes«, kommentierte Enzo mein erneutes Abtauchen in den Mülleimer. »Und ich würde dir vielleicht sogar glauben, wenn du mir nicht schon dreimal abgehauen wärst. Aber jetzt ist Schluss mit dem Theater. Komm jetzt, lass uns gehen.«
Ich hatte gute Lust, ihn zu schlagen. Das konnte doch nicht wahr sein, oder? Jetzt hatte Paps mir schon diesen Typen auf den Hals gehetzt, der mich keinen Moment aus den Augen ließ, aber wenn man ihn wirklich einmal gebrauchen könnte, stellte er sich ja so was von dermaßen dämlich an.
»Da ist wirklich eine Leiche drin«, sagte ich mit bebender Stimme. »Über so was würde ich niemals Witze machen.« Ich holte ein Taschentuch aus meiner Tasche und wischte mir über den Mund. »Ehrlich, Enzo.«
Ich schaute ihm in die hellgrünen Augen. Er war irritiert, das merkte ich. Ich hatte ihn bisher noch nie mit seinem Vornamen angesprochen. Er strich sich nachdenklich über seine Meckifrisur. Er trug wie immer einen schwarzen Anzug und ein eng anliegendes weißes Hemd darunter, das sich über seiner muskulösen Brust spannte. Dann fiel sein Blick auf das Haustelefon, das an der Wand des Flurs hing. Er schaute wieder zu mir. »Also dort im Biolabor ist wirklich eine Mädchenleiche?«
»Ja. Sie hat ein Messer in der Brust und ist eindeutig total tot.«
»Na gut«, sagte Enzo. »Wenn du dir sicher bist.«
Ich nickte. Er ging zum Telefon, wählte eine Nummer und bekam jemanden an die Strippe. Ohne ein Anzeichen von Nervosität meldete er sich. »Ja, guten Tag, mit wem spreche ich? Gut, Herr Schmitz, mein Name ist Enzo Tremante, ich bin der Bodyguard von Natascha Sander. Meine Klientin hat soeben eine Leiche im Biologielabor entdeckt. Eine Mädchenleiche.«
Meine Beine zitterten wie Grashalme im Wind und ich konnte mich kaum aufrecht halten. Enzo redete noch drei Sätze mit Herrn Schmitz, dann wurde er weiterverbunden mit der Schulleiterin, der er versicherte, dass sie richtig gehört hätte. Es dauerte vielleicht zwei Minuten, bis wir Schritte hörten. Da kam sie herangeeilt, die Schulleiterin Meinhilde von Cappeln, in ihrem Kielwasser ein Mann, den ich aufgrund seines rustikalen Aussehens inklusive Jeanshemd, Schnurrbart und klimperndem Monster-Schlüsselbund, aber vor allem an seiner hoheitsvollen Miene als Hausmeister identifizierte.
»Was ist los?«, schallte uns die Stimme der Schulleiterin entgegen. »Was behauptet Natascha gefunden zu haben?«
Ich verbiss mir den Kommentar, dass ich es nicht nur behauptete, und zeigte stumm auf die Tür. Der Hausmeister wechselte einen kurzen Blick mit der Direktorin, dann steckte er den Schlüssel ins Schloss, die andere Hand ruhte auf dem Knauf. Enzo trat einen Schritt vor und stellte sich neben Frau von Cappeln. Ich lehnte an der kühlen Wand im Flur. Das noch einmal anzusehen, würde ich mir ersparen. Der Hausmeister stieß die Tür auf.
Für einen Moment standen sie da wie erstarrt – die Schulleiterin, der Hausmeister, mein Bodyguard.
»Das ist ja Sally«, sagte der Hausmeister.
Sally hieß sie also. Arme Sally. Die Schulleiterin warf mir einen entsetzten Blick zu. Ja, dachte ich, so ging es mir auch.
»Die ist wirklich ziemlich tot, die Leiche«, stellte der Hausmeister fest. Laut seufzend betrat er den Raum, Frau von Cappeln folgte ihm mit zusammengekniffenen Lippen. Enzo schaute verwirrt zu mir.
»Na Sally«, sagte der Hausmeister plötzlich im Plauderton. »Musstest du auf deine alten Tage mal wieder dran glauben? Jaja, so ist die Jugend. Kein Respekt vor der älteren Generation.«
Hä? Was redete er denn da für wirres Zeug? Ich taumelte zum Eingang des Biolabors und blieb fassungslos stehen. Dort, wo eben noch die Mädchenleiche gewesen war, saß jetzt ein Skelett. Ein waschechtes Skelett, ein Knochengerüst, ein Gerippe, mit jeder Menge Knochen, aber ohne das kleinste Fitzelchen Fleisch auf den Rippen, geschweige denn einem Messer in der Brust.
In meinem Kopf drehte sich alles. »Aber Sie müssen mir glauben!«, rief ich. »Eben war die Leiche noch viel… lebendiger.«
An den Mienen merkte ich, dass das nicht wirklich geholfen hatte. »Sie hat da gelegen, auf dem Stuhl!«, beharrte ich eifrig.
»Aha, sie hat also auf dem Stuhl gelegen«, sagte von Cappeln frostig.
»Oder gesessen. Mit so komisch verdrehten Beinen.«
Von Cappeln sah mich an, als wäre ich eine der zehn biblischen Plagen. Aber so schnell gab ich nicht auf, ich wusste, was ich wusste: »Und riechen Sie das nicht? Dieser Gestank!« Ich wedelte mit den Armen und merkte selber, wie schrill meine Stimme klang.
»Das ist Parfüm!«, erwiderte von Cappeln verächtlich. »Mein Gott, jedes zweite Mädchen hier sprüht sich ein wie eine mittelalterliche Hofkonkubine, die nur einmal im Jahr badet. Also wirklich, Natascha…«
Jetzt, wo sie das sagte, merkte ich auch, dass jemand einfach nur eine Überdosis von einem dieser aufdringlichen Parfüms versprüht hatte, die ich so hasste, besonders die mit Moschus und Patchouli.
»Ich räume sie weg, Frau Direktor?«, meldete sich nun der Hausmeister wieder zu Wort.
Von Cappeln nickte gnädig. Er fasste die klapprige Gesellin unter den Achseln und trug sie zu einem großen Wandschrank, wo er sie auf einen Ständer hängte. In meinem Kopf kreisten die Gedanken umher wie die Geier in der Wüste auf der Suche nach Aas. Ich wusste plötzlich überhaupt nichts mehr. Von Cappeln baute sich jetzt mit ihren knappen eins sechzig vor mir auf, ihr Kopf wackelte auf dem langen Hals, die grauen Augen durchbohrten mich. Sie musterte mich drei Sekunden, ohne ein Wort zu sagen. Enzo, der bis jetzt geschwiegen hatte, stellte sich hinter mich. »Natascha«, sagte von Cappeln, plötzlich sehr leise. »Wir sind eine anständige Schule voller pflichtbewusster Mädchen und gewissenhafter, professioneller Lehrer. Wir haben einen sehr guten Ruf über die Landesgrenze hinaus.« Die Worte aus ihrem Mund wehten mir in einer Wolke aus eisigem Zorn entgegen. Ich wurde gegen meinen Willen rot.
Das Klügste wäre, jetzt diese Standpauke über mich ergehen zu lassen, mich zu entschuldigen und morgen in die Schule zu kommen, als wäre nichts passiert.
»Einen verwöhnten Störenfried wie Sie können wir hier absolut nicht gebrauchen«, fuhr sie mit entsetzlich tonloser Stimme fort.
Es wäre das Klügste gewesen, ja. Nur leider kann ich es nun mal absolut nicht leiden, ungerecht behandelt zu werden. Besonders nicht von einer arroganten Kuh, die überhaupt keine Ahnung hat, was in ihrer Schule los war!
»Frau von Cappeln«, antwortete ich. Ich kriegte den Tonfall nicht ganz so eisig hin, dazu saß der Schock noch zu tief, aber der Versuch zählte. »Sie mögen eine Schule voller pflichtbewusster Mädchen und Lehrer haben. Aber Sie haben auch eine Schule mit einer Leiche.«
Ich meinte, eine besänftigende Hand auf meiner Schulter zu spüren, die nur von Enzo sein konnte, aber verdammt noch mal, er war mein Bodyguard und nicht mein Babysitter. Ich schüttelte die Hand ab und fuhr fort: »Irgendjemand hier ist weder anständig noch gewissenhaft. Denn irgendjemand hier hat dieses Mädchen getötet! Und wenn mir keiner glaubt, werde ich eben selbst herausfinden, wer das war, da können Sie Gift drauf nehmen.«
Direktorin von Cappeln schnaubte verächtlich. »Natascha, damit eines klar ist. Wenn Sie es noch einmal wagen, in meiner Schule mit Ihrer Wichtigtuerei für Ärger zu sorgen, dann werde ich Sie höchstpersönlich vor die Tür setzen. Und dann können Sie zu Hause hocken, Ihr Haar bürsten und darüber nachdenken, was für ein Mensch Sie sind.«
Damit drehte sie sich um und stakste davon. Aber da ich nun mal auch gerne das letzte Wort habe (Fehler Nummer acht!), rief ich ihr hinterher: »Nee, nee, nee, Frau von Cappeln. So wird das nicht laufen. Garantiert nicht. Weil ich die Leiche finde! Und dann werden Sie ja sehen, wer hier recht hat.«
Sie drehte sich nicht mal mehr um.
3
Also, eines ist ja wohl sonnenklar: Den Wettbewerb Schlimmster-erster-Schultag-aller-Zeiten hatte ich wohl gewonnen. Mit einer schrecklichen Schulleiterin wäre ich klargekommen, mit zickigen Schulkameradinnen auch. Aber nicht mit einer Leiche. Ich hatte eine Leiche gesehen! Ich konnte es immer noch nicht fassen. Das arme Mädchen. So jung und schon so tot! Mir lief ein Schauer über den Rücken. Normalerweise sollte ich mir nach Schulschluss Fragen stellen wie: Wie schnell schaffe ich den Aufsatz für Französisch? Oder: Reichen zehn Minuten vor dem Frühstück für die Mathehausaufgaben? Aber stattdessen gingen mir folgende Fragen durch den Kopf: Warum musste sie sterben? Wer hatte ihr das angetan? Und wieso um alles in der Welt musste ausgerechnet ich sie finden, mich mit der blöden Schulleiterin anlegen und mir selber die Suche nach einer verschwundenen Leiche aufs Auge drücken?
»Wenn ich dir einen Rat geben darf«, meldete sich in dem Moment Enzo vom Fahrersitz zu Wort und musterte mich durch den Rückspiegel.
»Nein, darfst du nicht.« Ich schloss genervt die Augen. Einen Ratschlag von Mister Ich-misch-mich-in-alles-ein war wirklich das Letzte, was ich brauchte. Er ignorierte meine Ablehnung. Wie nicht anders zu erwarten.
»Du solltest dich ein bisschen zurückhalten«, sagte er.
»Ach ja? Und warum?«, brauste ich auf. »Ich bin auf dem Gymnasium und nicht auf der Arschkriecher-Akademie.«
Er prustete los.
»Da gibt’s nichts zu lachen«, schnaubte ich. »Und überhaupt, warum hast du dir ausgerechnet diese Spritschleuder ausgesucht, um mich abzuholen? Ich hasse diese Karre.«
»Ach, wirklich?« Er schien überrascht. »Ich dachte, in so was fahren alle gerne. Alleine wegen der Aussicht von hier oben.«
»Nee. Ein Geländewagen mit Allradantrieb und über 300 PS für den Stadtverkehr? Der schluckt zwanzig Liter Benzin! Das ist eine totale Umweltsauerei.«
»Hast du gehört, Cayenne?« Er streichelte das mit beigem Leder bezogene Armaturenbrett des Porsche. »Sie mag dich nicht.«
Oh Mann. Wenn ich nicht eben schon gekotzt hätte, dann würde ich es jetzt tun. Dieser Typ brachte mich auf die Palme, die Schulleiterin brachte mich auf die Palme und ich ärgerte mich über mich selbst. Da wollte ich an der neuen Schule alles besser machen, einen Neuanfang ohne Komplikationen hinlegen, um dann gemütlich die letzten anderthalb Jahre meiner Schullaufbahn auf einer Pobacke abzusitzen. Aber nein, ich hatte nichts Besseres zu tun, als auf eine Leiche zu stoßen. Die verschwunden war, ausgerechnet, als ich sie den anderen zeigen wollte. Verdammte Hacke. Was fiel der eigentlich ein? Ich meine, Leichen sind ja nun normalerweise nicht gerade bekannt für ihren Bewegungsdrang. Und ich hatte sie gesehen. Oder hatte ich vielleicht geträumt? Oder wurde ich am Ende noch verrückt? Hatten mir meine Nerven einen Streich gespielt und ich hatte mir alles nur eingebild… nein. Schluss, Sander. Sie war da! Sie war tot und auf dem Stuhl. Mitsamt ihren starren Augen und den bleichen Lippen und dem abgeknickten Hals und dem Blut und vor allem diesem Messer in ihrer Brust. Ja, natürlich war sie da gewesen. Und ich würde sie finden. Irgendwo in der Schule musste sie ja sein. Haus verliert nichts, sagt meine Mutter immer.
Aber das musste bis morgen warten. Für heute reichte es mir. Selbst für Shopping war ich zu fertig. Heute hatte ich nur noch Kraft für das Natascha-Verwöhn-Programm. Ich sah aus dem Fenster und versuchte Enzo zu ignorieren, der mir gerade irgendwas erzählte von einem seiner ehemaligen Polizeikollegen, der auch mal überraschend auf eine Leiche gestoßen war und so weiter. Meine Güte! Er redete mal wieder, als würde er dafür bezahlt. Bisher kannte ich Bodyguards ausschließlich als schweigende Schatten, die den Mund nur ein einziges Mal aufmachten, nämlich um sich mit einem Schrei in die Flugbahn der Kugel zu werfen, die für den Präsidenten der Vereinigten Staaten bestimmt war. Woran man mal wieder merkt, wie gut ich mich mit dem Thema auskannte. Wie sollte es aber auch anders sein? Ich hatte meinen ja erst seit drei Tagen. Und den hatte ich mir selber eingebrockt. Hatte jedenfalls mein Vater gesagt. Enzo war sozusagen eine pädagogische Maßnahme. Man könnte es auch Bestrafung nennen. Vergeltung. Oder Rache. Diesmal geht der Dank an meinen großen Bruder Bastian. Danke, Basti!
Der war nämlich vor einer Woche verschwunden. Mitten im Semester. Große Aufregung im Hause Sander. Menschenraub und Entführung – die Worte standen in Großbuchstaben in den Augen meiner Mutter, die es gerne melodramatisch hatte. Woraufhin ich mich in einer fiesen Zwickmühle wiederfand. Ich weiß, ich habe gesagt, dass ich die Klappe nicht halten kann. Aber wenn mich jemand um Stillschweigen bittet, dann kann ich das sehr wohl. Zumindest, wenn es sich bei diesem Jemand um meinen Bruder handelt. Oder jemand anders, der mir sehr nahesteht. Freunde, die keine Geheimnisse für sich behalten können, sind Arschlöcher. Hallo, Silvy! Ja, dich meine ich.
Wie auch immer, ich hatte natürlich nicht verraten, was Bastian mir anvertraut hatte. Das fiel mir auch nicht weiter schwer, denn Bastian hatte mir nur ein paar Stichworte gegeben. Er hätte eine neue Freundin, diesmal wäre es was Ernstes und sie müssten einfach mal raus. Vermutlich hatte er Schiss gehabt, meinen Eltern zu beichten, dass er mitten im Semester Urlaub machen wollte, weil mein Vater sowieso findet, dass Bastian sein VWL-Studium nicht ernst genug nimmt. Wie auch immer. Nachdem ich also meinen Eltern wiederholt versichert hatte, dass es Bastian gut ginge und er sich sicher bald melden würde, waren die stinksauer. Auf ihn, allerdings – und das war die totale Ungerechtigkeit – auch auf mich. Besonders mein Vater.
Tja und dann hatten sie mir Enzo auf den Hals gehetzt. »Damit du nicht auch plötzlich verschwindest«, hatte mein Vater gesagt.
»Aber ich wollte gerade shoppen gehen!«
»Na, dann geht er eben mit. Dann gewöhnst du dich gleich dran.« Damit war das Thema erledigt gewesen. Als ich Enzo dann das erste Mal sah, war ich überrascht. Bei dem Wort Bodyguard fallen mir immer Clint Eastwood und Kevin Costner ein. Aber so steinalt war Enzo zum Glück nicht. So Anfang zwanzig ungefähr. Aber das war auch das einzig Positive. Denn kaum waren wir in dem ersten Laden drin, wo ich einen tollen Kaschmirpullover entdeckte, da sagte er mir, dass mir Grün nicht steht. Ich dachte, ich werd nicht mehr! Da fing er an, mir Stylingtipps zu geben, als wäre er ein blöder Modeberater! Dabei sah er in seinem Schwarzer-Anzug-weißes-Hemd-Outfit selbst aus wie ein entlaufener Pinguin. Den grünen Pullover kaufte ich natürlich trotzdem. Aber den Wink mit dem Zaunpfahl kapierte er nicht. Nämlich, dass ich sowieso nicht auf ihn hören würde. Er gab mir ständig und andauernd Ratschläge zu allem und jedem. Und er redete ohne Punkt und Komma. Auch jetzt auf der Rückfahrt von der Schule schnatterte er wieder wie ein Teenie auf Alkopops.
»Sag mal, wenn mir was passieren sollte – ich meine, wenn mich jemand entführt –, quatschst du den dann einfach tot?«, warf ich von hinten ein.
Sein Redeschwall stoppte. »Keine schlechte Idee«, sagte er und verzog keine Miene. »Einfach, unblutig und nicht strafbar.« Er drehte sich zu mir um. Seine Augen funkelten. »Aber wenn ich dich mit dem Thema Autos langweile, können wir auch über was anderes reden. Musik, Hausverschalungen, Minigolf, Flora und Fauna. Oder Fußball! Magst du Fußball? Also, ich finde, Inter Mailand ist wirklich der beste Club der Welt…«
»Vor ihr lagen Blumen auf dem Boden«, unterbrach ich ihn nachdenklich. »Vor der Leiche, meine ich.«
Enzo schwieg einen Moment. »Was für Blumen?«, fragte er.
»Keine Ahnung. Irgendwelche Blumen halt.« Mit Botanik hatte ich es nicht so.
»Mmhh«, machte Enzo. Und mir fiel was ein. »Ich weiß«, rief ich aufgeregt. »Vielleicht ist das die Unterschrift des Mörders gewesen!«
»Eine Unterschrift?«
»Ja, da ist ein Serienkiller am Werk, der alle seine Opfer mit einem letzten Blumengruß ins Jenseits schickt! Das machen doch total viele Serienkiller so, dass sie ein bestimmtes Zeichen haben und damit die Polizei zum Narren halten und…« Mein Satz lief ins Leere, weil ich auf einmal den Eindruck hatte, dass ich vielleicht doch ein paar Krimiserien zu viel gesehen hatte.
»Ich denke«, dozierte Enzo superwichtig, »wir sollten uns doch bei unseren Ermittlungen eher darauf konzentrieren, dass es keine Leiche gegeben hat.«
»Unsere Ermittlungen sind es schon mal gar nicht. Es sind meine.«
»Ganz wie du meinst.«
»Ja, das meine ich.«
»Auch gut.«
»Nein, das ist nicht nur gut, sondern viel besser.«
»Aha.«