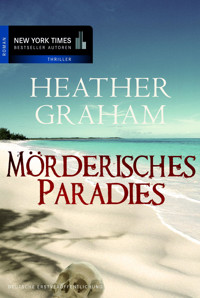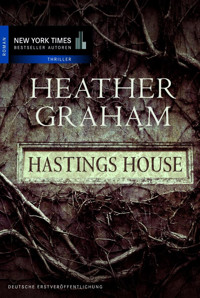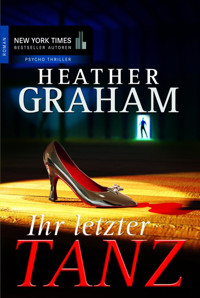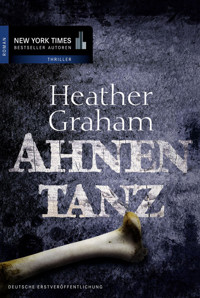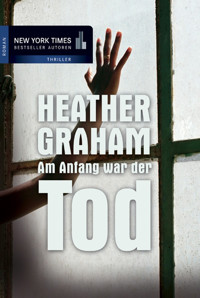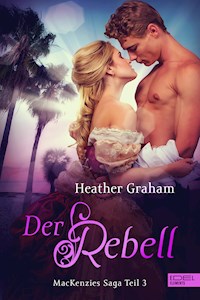Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: venusbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Highland-Kiss-Saga
- Sprache: Deutsch
Wird sie sich dem verführerischen Feind hingeben? Der historische Liebesroman »Gefangen von einem Highlander« von Heather Graham jetzt als eBook bei venusbooks. England, 1307: Schotten und Engländer kämpfen um die Vorherrschaft in Britannien – und die schöne Igrainia, Tochter eines englischen Grafen, wird auf ihrer eigenen Burg als Geisel festgehalten! Der schottische Ritter Eric will den feindlichen König herausfordern, indem er sich ihrer Ländereien bemächtigt, doch er kann der Schönheit der jungen Witwe nicht widerstehen … Eric zwingt sie zur Ehe, aber Igrainias Stolz erlaubt es ihr nicht, sich ihm widerstandslos zu ergeben. Wird es dem stürmischen Highlander gelingen, das Herz der edlen Lady zu erobern? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das Romance-Highlight »Gefangen von einem Highlander« von New-York-Times-Bestseller-Autorin Heather Graham ist Band 4 der »Highland-Kiss-Saga«; alle Bände können unabhängig voneinander gelesen werden. Lesen ist sexy! venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 691
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
England, 1307: Schotten und Engländer kämpfen um die Vorherrschaft in Britannien – und die schöne Igrainia, Tochter eines englischen Grafen, wird auf ihrer eigenen Burg als Geisel festgehalten! Der schottische Ritter Eric will den feindlichen König herausfordern, indem er sich ihrer Ländereien bemächtigt, doch er kann der Schönheit der jungen Witwe nicht widerstehen … Eric zwingt sie zur Ehe, aber Igrainias Stolz erlaubt es ihr nicht, sich ihm widerstandslos zu ergeben. Wird es dem stürmischen Highlander gelingen, das Herz der edlen Lady zu erobern?
Über die Autorin:
Heather Graham wurde 1953 geboren. Die New-York-Times-Bestseller-Autorin hat über zweihundert Romane und Novellen verfasst, die in über dreißig Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurden. Heather Graham lebt mit ihrer Familie in Florida.
Von Heather Graham erscheinen bei venusbooks:
In den Händen des Highlanders
Fieber der Leidenschaft
Der Lord und die Rebellin
Die Leidenschaft des Earls
Das Begehren des Ritters
Die Gefangene des Freibeuters
Das Erbe der Liebenden
Die Highland-Kiss-Saga:
In den Armen des Schotten
Der Highlander und die schöne Feindin
Gefangen von einem Highlander
Die Braut des Viscounts
Die Wild-Passion-Saga:
Der Ungezähmte und die Schöne
Der Laird und die Schöne
Der Krieger und die Schöne
Die Cameron-Saga:
Der Lord und die ungezähmte Schöne
Die Geliebte des Freibeuters
Unter dem Autorennamen Shannon Drake veröffentlicht sie bei venusbooks außerdem:
Blutrote Nacht
Bei Anbruch der Dunkelheit
Verlockende Finsternis
Das Reich der Schatten
Der Kuss der Dunkelheit
***
eBook-Neuausgabe Juni 2019
Ein eBook des venusbooks Verlags. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Dieses Buch erschien bereits 2002 mit dem Titel Triumph des Ritters unter dem Autorenpseudonym Shannon Drake bei Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2002 by Shannon Drake
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel Knight Triumphant
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Lizenzausgabe 2019 venusbooks GmbH, München
Copyright © der aktuellen eBook-Neuausgabe 2020 venusbooks Verlag. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Published by arrangement with Shannon Drake.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © Period Images und © shutterstock / Martin M303 / ESOlex / Swen Stroop / blue pencil / Imichman
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (cg)
ISBN 978-3-95885-675-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des venusbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Gefangen von einem Highlander« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.venusbooks.de
www.facebook.com/venusbooks
www.instagram.com/venusbooks
Heather Graham
Gefangen von einem Highlander
Roman
Aus dem Amerikanischen von Beate Darius
venusbooks
Prolog
Vor langer, langer Zeit ...
... lebte ein König, der regierte sein Land voller Güte, und die Menschen lebten in Frieden und Wohlstand.
Doch der König wurde älter. Voller Sorge darauf bedacht, die Nachfolge zu sichern, heiratete er ein zweites Mal, denn nach dem Verlust der geliebten Gattin und des Sohnes war nur mehr das kleine Mädchen seiner Tochter geblieben, die Krone zu erben. Seine Braut war jung und schön, und seine Aufgabe dem Land starke Söhne zu schenken, die nach seinem Tod regierten – hätte eine angenehme und leichte sein sollen. Gleichwohl, in seinem Übermut, baldmöglichst wieder bei der Dame seines Herzens weilen zu können, ritt er nach einer Sitzung des Kronrats in dunkler, stürmischer Nacht durch die unwegsame, zerklüftete Bergwelt seiner Heimat, sämtlichen Warnungen seiner Berater zum Trotz.
Auf seinem Ritt durch die finstere, von einem Unwetter gepeitschte Nacht strauchelte das Pferd des Königs; vielleicht verlor er auch die Gewalt über sein Ross. Er stürzte in eine tiefe Schlucht und verschied noch vor seiner Zeit und ehe er seine Aufgabe vollenden konnte. Und das Land trauerte um ihn.
Die junge Enkelin des Königs erbte den Thron. Man schöpfte wieder Hoffnung. Das Land werde neu erblühen, glaubten alle, denn die Wächter der Krone gaben alles darum, ihre junge Königin gut zu beschützen.
Sie hieß Margaret, besser bekannt als die Maid von Norwegen. Allein, die Infantin von Schottland starb, noch bevor sie die Küste des Landes erreichte, das sie regieren sollte.
Im Land herrschten Trauer und Verwirrung, denn nach ihrem Tod beanspruchten viele das Recht auf die Krone für sich. Der starke, mächtige und rechtmäßige Herrscher eines benachbarten Landes wurde um Beistand und Rat ersucht. Nach der Anhörung aller Thronanwärter half er dem Rat bei der Entscheidung, wer Regent werden sollte. Von den vielen Anspruchstellern kamen drei in die engere Wahl: John Balliol, John Hastings sowie Robert Bruce, der Rivale. Alle drei waren Nachfahren der Töchter von David, Earl of Huntington, Enkel von David I., einem weiteren gütigen König, der dem Land Stärke und Wohlstand verliehen hatte.
Doch die weisen Männer des Landes verhielten sich unschlüssig und in der Tat alles andere als weise.
Der König des Nachbarlandes liebäugelte zudem selbst mit der Regentschaft. Vor dem Tod der jungen Erbin hatte er geplant, diese mit seinem Sohn zu vermählen, um die beiden Länder zu einen.
Jetzt half er, einen Marionettenkönig zu wählen einen Mann, der das Land regierte, sich ihm als unumschränktem Herrscher jedoch beugte. Seine Wahl fiel auf John Balliol.
Zunächst wurde König John von allen geschätzt und geachtet. Indes, der Oberherr stellte Forderungen, und sobald der Marionettenkönig nicht gehorchte, ward er in die Knie gezwungen. Der mächtige Monarch des Nachbarlandes faltete die Hände und nickte hochzufrieden. Der Sieg, so dachte er, ist mein.
Das Land wurde in einen Jahre währenden Krieg gestürzt.
Es waren Jahre eines höllischen Martyriums.
Ein vernichtendes Fegefeuer, gelinde gesagt.
Heldenhafte Krieger kämpften im Namen ihres abwesenden Königs, den der Oberherrscher überwältigt, entehrt und zur Abdankung gezwungen hatte. Sie stritten für die Freiheit von der brutalen Regentschaft dieses Herrschers, denn sie gehörten einem stolzen Volk in einem eigenständigen Land an. Der Berühmteste dieser Helden war ein Mann namens William. Er wies die Heere der Möchtegern-Eroberer in die Schranken. Doch der Hass des benachbarten Monarchen war grenzenlos, und William Wallace, ein Held des Volkes, fiel einem Verrat anheim und verlor sein Leben – Kopf, Glieder, Eingeweide und mehr – aufgrund des Zorns und der Rachsucht des englischen Königs.
Zwei Männer wetteiferten nun um den fragwürdigen Glanz der schottischen Krone: John Comyn, ein Verwandter von John Balliol und einflussreicher Baron, und Robert Bruce, Enkel von Robert Bruce dem Rivalen, der ursprünglich seinen Anspruch auf den Thron angemeldet hatte.
Die beiden schlossen einen Pakt: Der eine gab dem anderen seine Ländereien und seinen Reichtum im Austausch für dessen Unterstützung bei der Inthronisation. Der König des Nachbarlandes war inzwischen alt und gebrechlich, und, so dachten sie, nach seinem Tod würden sie ihre früheren Ländereien zurückerobern. Die Kirchenmänner wussten von diesem Plan und waren hocherfreut.
Aber wieder regierte der Verrat: Der eine hinterging den anderen, als er erkannte, dass der Regent des Nachbarlandes von dem Plan erfahren hatte. Edward, selbsternannter ›Streiter‹ der Schotten, starb nicht, wie von allen erhofft, sondern ließ stattdessen seinem Groll, seiner Rachsucht erneut freien Lauf.
John Comyn ging heimlich gegen Robert Bruce vor und berichtete dem benachbarten Herrscher von Bruces Übereinkunft mit ihm und den einflussreichen Kirchenmännern.
Der Regent des Nachbarlandes schäumte abermals vor Zorn.
Und nachdem Robert Bruce von dem Verrat erfahren hatte, machte er sich wutentbrannt auf die Suche nach dem Mann, der ihn hintergangen hatte. Sie trafen in einer Kirche zusammen, und ebenda, auf dem Altar, vergoss Bruce das Blut von Comyn. Hätte er seinen entfernten Verwandten nicht eigenhändig mit einem Schwertstreich getötet, so hätten es seine Männer getan.
Im Jahre 1306 wurde Bruce in Scone zum König der Schotten gekrönt. Der englische Monarch hatte den berühmten Stein von Scone entwendet, auf dem die schottischen Könige seit Urzeiten gekrönt worden waren, aber dennoch wurde Robert Bruce auf althergebrachte Weise feierlich inthronisiert. Er wurde nicht nur einmal, sondern gleich zweimal gekrönt, denn Isabella, eine Tochter des Hauses Mar, eilte hinzu, um die von ihrer Familie ererbten Aufgaben bei einer Krönung zu erfüllen, da ihr Bruder, der Earl, noch ein Kind und unter den Fittichen König Edwards von England war. Sie war erst neunzehn und mit dem Earl of Buchan vermählt, einem Verbündeten des englischen Königs; aber ihre Liebe zu ihrem Land machte sie blind gegenüber ihrer Ehe. Und den Konsequenzen.
Doch sie reiste mit einem Tag Verspätung zu den Krönungsfeierlichkeiten an, und um Tradition und Form zu wahren, wurden die althergebrachten Riten noch einmal am Palmsonntag durchgeführt, dem 26. März 1306. Jetzt zweifelte niemand mehr daran, dass Robert Bruce König war.
So war es seiner Linie doch noch gelungen, den Anspruch auf den Thron durchzusetzen.
Gleichwohl, der neue König hatte viele Feinde, unter ihnen auch der einflussreiche Clan des hinterhältigen John Comyn.
Und Edward I. von England, der lange und brutal regiert hatte – und, zum großen Verdruss, immer noch lebte.
Als er von Bruces Krönung erfuhr, ernannte Edward I. seinen Sohn zum Prince of Wales. Hunderte streitbarer junger Engländer wurden im Verlauf dieser Zeremonie zum Ritter geschlagen, schworen vor Gott ihre Treue und Gehorsamspflicht.
Der Zorn des englischen Königs war grenzenlos und kannte kein Erbarmen. Die Engländer machten Gefangene, denn wer Robert Bruce unterstützte, sollte wie ein Gesetzloser behandelt werden, sollte ohne Gerichtsverfahren verurteilt, gehenkt, geköpft, gestreckt und gevierteilt oder durch die Straßen geschleift werden und somit weiterer Folter, Demütigung und schließlich einem grässlichen Tod ausgesetzt werden. Die Herolde verkündeten im ganzen Land, dass es den Frauen – den Gattinnen, Schwestern, ja selbst den Töchtern der mutigen Patrioten – kaum besser ergehen werde. Die englischen Ritter durften nach Gutdünken rauben, schänden und morden. Sie waren die verfemten Vollstrecker eines gesetzlosen Königs.
Schon kurze Zeit nach seiner Thronbesteigung hatte Bruce grausame Niederlagen eingesteckt, viele seiner fähigsten Männer waren gefangen genommen und exekutiert worden, darunter auch drei seiner Brüder. Seine Gemahlin war eine Geisel des rachsüchtigen englischen Königs, gemeinsam mit zweien seiner Schwestern und seiner Tochter. Einzig sein unglaublicher Heldenmut hielt den Patriotismus und die Loyalität seiner Anhänger aufrecht. Er war kein Herrscher, der ein gewaltiges Heer hinter sich stehen hatte, sondern eher ein zerlumpter Bandit, der in den tiefen Wäldern kämpfte, die ihm Schutz boten. Die Truppen umfassten königstreue, loyale Männer, die von Freiheit und Unabhängigkeit träumten. Man ersuchte um Unterstützung aus dem Ausland. Das schottische Hochland war weit entfernt von England und die Lowlands bereits in die Knie gezwungen.
Das Grenzland indes blieb die Hölle auf Erden. In diesem Fegefeuer kämpften Männer und Frauen, die Großen wie die Kleinen ums nackte Überleben.
Robert Bruce war König von Schottland. Aber es war der Verrat, der regierte.
Vor langer, langer Zeit ...
... da lebte ein Mann, der ein großer König werden sollte.
Im Jahr des Herrn 1307 hatte sein Kampf um das Land, für die Freiheit seines Volkes, jedoch gerade erst begonnen ...
Kapitel 1
Wahrhaftig, sie mussten von Sinnen sein.
Von der Anhöhe aus beobachtete Igrainia die herannahenden Reiter.
Sie trugen die Banner von Robert the Bruce.
Sie mussten von Sinnen sein.
Igrainia ritt mit einer Gruppe von 20 Männern, gewissenhaft ausgewählt nach Erfahrung und Tapferkeit – und natürlich infolge der schlichten Tatsache, dass sie noch am Leben und gesund waren. Sie trugen volle Rüstung und kunstfertig geschmiedete Waffen, mit denen sie ausgezeichnet umzugehen wussten.
Die heranpreschenden Reiter waren bei weitem in der Minderzahl, eine entsetzlich zerlumpte Bande, die den Hügel erstürmte.
»Mylady ...?«, hub Sir Morton Hamill an, der Führer ihrer Schutztruppe.
»Können wir sie überwältigen?«, erkundigte sie sich.
»Sie überwältigen!«, empörte sich Sir Hamill und schnaubte angewidert. »Sie sind weiter nichts als Unrat; ihr so genannter König verkriecht sich in den Wäldern, derweil seine Familie hinterhältig gemeuchelt wird. Bruce weiß genau, dass viele seiner eigenen Leute ihn für einen Gesetzlosen halten. Mylady, es besteht wirklich kein Grund zur Flucht.«
»Kein Grund«, murmelte sie und ihre Augen wurden schmal, »außer dass noch mehr Männer sterben werden. Ich habe den Tod so satt!«
Die Reiter preschten nach wie vor in halsbrecherischem Tempo auf sie zu und entfernten sich dabei von dem Burggelände; selbst sie mussten erkannt haben, dass die schwarzen Kreuze auf den Steinen keine List des Feindes, sondern eine ernsthafte Warnung waren.
Sir Morton bemühte sich um Fassung. »Mylady, ich weiß um Eure Seelenqualen. Aber dies sind die Abtrünnigen, die das Entsetzen über Euer Zuhause gebracht haben, die Euch alles ... alles genommen haben.«
»Kein Mann, keine Frau will die Pest, Sir Morton. Und in der Tat, wenn Ihr Vater MacKinley fragt, wird er Euch sagen, dass der Allmächtige die Krankheit in seinem Zorn darüber gesandt hat, dass wir Frauen und Kinder brutal zu Geiseln nehmen und unsere Feinde so freimütig hinrichten. Wir waren vor der Krankheit gewarnt; wir weigerten uns, an die Warnung des Feindes zu glauben. Und deshalb schlage ich vor, dass wir vor diesen Abtrünnigen fliehen. Es war nicht meine Entscheidung, Langley zu verlassen. Ich will keine weiteren Toten verantworten müssen.«
»Nun denn ... Wir können nicht mehr fliehen«, räumte Sir Morton ein. »Sie haben uns fast erreicht.«
Zornesfunkelnd maß sie ihn. »Ihr würdet eher kämpfen, als Eure Pflicht zu erfüllen und mich in Sicherheit zu bringen.«
»Mylady, Ihr seid außer Euch vor Trauer und vermögt nicht mehr klar zu denken. Ich würde gegen solche aufständischen Rebellen kämpfen, gewiss, Mylady, denn auch das ist meine Pflicht.«
»Sir Morton, ich bin im vollen Besitz meiner geistigen Kräfte und ...«
»Mylady, so hört mir zu! Eure Position hier oben auf der Anhöhe ist hervorragend; Ihr könnt das Gemetzel beobachten, derweil ich Vergeltung an diesen Burschen übe!«
Wütend straffte Igrainia die Zügel, während Sir Morton seinen Männern Befehle zubrüllte. Er hatte nicht vor, auf den Feind zu warten, sondern beabsichtigte anzugreifen.
»Sir Morton!« Zornbebend und voller Seelenpein beobachtete sie die Männer, die auf sein Kommando hin die Rösser anspornten. Innerhalb von Sekunden gehorchten die Lehensmänner ihres verblichenen Lords, Afton of Langley, den Befehlen und stoben den Hügel hinab:
Ihre Rüstung glänzte im Sonnenlicht, sodass sie auf einer silbern schimmernden Woge zu segeln schienen. Die Farben ihrer Banner, das kräftige Blau und Rot des Adelshauses, vermischten sich mit dem silbernen Strom. Den Hügel hinunter, eine Zurschaustellung von Macht und Stärke ...
... strebten sie zu dem jämmerlichen Haufen versprengter Reiter auf prächtigen Pferden, einige in angedunkelter Rüstung, die meisten indes nur in Lederwämsern, um ihre Leiber vor dem kommenden Gemetzel zu schützen.
Von ihrem Standort aus konnte sie deren Anführer sehen. Sie runzelte die Stirn, fragte sich, welche Tollkühnheit einen Mann dazu bewegen könnte, den sicheren Tod zu riskieren. Sie blinzelte in die Sonne, beobachtete den Mann. Ihr entwich ein leiser Seufzer.
Sie hatte ihn schon einmal gesehen. Sie erinnerte sich an ihn, da er ohne schützende Kopfbedeckung ritt; kein Helm schützte sein Haupt, und sein langes, zerzaustes Blondhaar glänzte in der Sonne wie die Stahlhauben, die ihre eigenen Leute trugen. Sie hatte ihn gesehen, in Ketten gelegt mit anderen Gefangenen. Und er hatte ausgesehen wie ein Wilder, unzivilisiert, ein Barbar in schmutzigen, verdreckten Lumpen; doch als sie ihm kurz in die Augen geschaut, als ihre Blicke sich getroffen hatten, hatte sie etwas Furchteinflößendes darin gewahrt. Und sie hatte das eigentümliche Gefühl beschlichen, dass er sich vorsätzlich hatte gefangen nehmen lassen – warum, hätte sie nicht zu sagen vermocht. Oder vielleicht doch. Burg Langley, die Heimat ihres Gemahls, hatte vorübergehend Quartiere für die Männer des englischen Königs eingerichtet, die auf der Durchreise waren und die Familien der schottischen Gesetzlosen nach London brachten, wo sie eingekerkert werden sollten, bis ihr rebellischer König kapitulierte.
Und dem Henker seinen eigenen Hals darbot.
Sir Mortons Männer hatten die Reiter fast erreicht. Im gleißenden Sonnenlicht war es ein beinahe bezauberndes Schauspiel: der Glanz des Stahls, der Prunk der Farben ... Bis die Reiter mit ohrenbetäubendem Lärm aufeinander losgingen, Rösser schnaubten, Männer schrien – Stahl in tiefrotes Blut getaucht. Unvermittelt füllten sich Igrainias Augen mit Tränen; Afton hätte das alles nicht gewollt. Er war zutiefst empört gewesen über den Befehl, die Soldaten des Königs willkommen zu heißen und Abtrünnige zu beherbergen, die seinem eigenen Volk entstammten. Er hatte befohlen, die Geiseln nicht wie Tiere zu behandeln,. auch wenn sie in ihrem sonderbaren Hochlanddialekt redeten und wie wilde Gestalten aus heidnischer Zeit anmuteten. Er hatte sich erhoben, eine stolze Stimme der Vernunft und Nachsicht, bis er gefallen war ...
Und weder ihre Liebe noch ihr Mut oder ihre Heilkräuter hatten ihn zu retten vermocht.
Weilte er jetzt an ihrer Seite, wäre er entsetzt über dieses Blutbad.
Hätte man ihm Gehör geschenkt, wäre es nie so weit gekommen ...
Seufzend presste sie die Hand auf die Lippen, als sie sah, dass ein Rebell Sir Morton zum Zweikampf herausforderte. Der Rebell war der Wilde mit dem zerzausten Blondhaar.
Sir Mortons Schwert war es nicht vergönnt, den Rebellen zu treffen.
Sein Haupt rollte zu Boden, während sein eingesunkener Körper zu Pferde verharrte, bis auch dieser stürzte, um niedergetrampelt zu werden.
Bittere Galle stieg in ihr hoch. Sie schloss die Augen, senkte den Kopf und kämpfte gegen die Übelkeit an, die sie zu überwältigen drohte. Gütiger Gott, sie hatte eben erst die Pestopfer verlassen, die Kranken gepflegt, die Stinkenden, die Faulenden und ...
Die Augen geschlossen, sah sie noch immer den rollenden Kopf vor sich.
Rings um sie herum schien sich das Klirren des Stahls zu einer wahren Kakophonie zu erheben; sie vernahm weitere Schreie, Gebrüll, das entsetzte Schnauben der Streitrösser, gewöhnt an Schlachten und Fehden. Sie zwang sich aufzublicken.
Selbst die prachtvollste Rüstung hatte die Krieger von Langley nicht vor der Rache der Rebellen schützen können. Leichen, wohin ihr Auge blickte.
Rüstungen glänzten im Sonnenlicht und bildeten einen schimmernden Kontrast zu dem blutbesudelten Feld. Einige hatten überlebt. Ohne ihre Pferde bildeten die Männer einen Kreis, Befehle und Gebrüll ertönten; der blonde Recke näherte sich den acht Männern von Langley, die das Gemetzel heil überstanden hatten. Entsetzt verfolgte sie das Geschehen, sich ihrer eigenen Gefahr nicht bewusst. Satzfetzen drangen zu ihr.
»Sollen wir sie jetzt gleich hinrichten?«, erkundigte sich einer.
Der Blonde erwiderte irgendetwas und brüllte dann den Überlebenden einen Befehl zu. Schwerter rasselten zu Boden. Ein Mann fiel auf die Knie. War es aus Verzweiflung oder aus Dankbarkeit, weil man ihn am Leben ließ?
Würden sie getötet? Oder verschont?
Sie wusste es nicht. Andere redeten, aber leiser.
Einer der Rebellen deutete auf den Hügel.
Dann, plötzlich, spähte der Blonde zu ihr.
Auf diese Entfernung konnte sie seine Augen nicht ausmachen, doch sie vermochte sich sehr gut daran zu erinnern.
Er eilte zu seinem Pferd.
Erst da erkannte sie ihre eigene Situation und dass er aufsaß, um sie zu verfolgen.
Sie spornte ihr Ross an, betete, dass es diese Gegend besser kennen möge als er, dass es erholt genug sei, um sie in Windeseile davon zu tragen ...
Weit, weit fort.
Sie betete ...
Vor nicht allzu langer Zeit hatte sie noch sterben wollen. Der allgegenwärtige Tod und die Verzweiflung waren ihr so grenzenlos erschienen, dass sie bereitwillig Aftons Hand genommen und ihn ins Jenseits begleitet hätte. Es war der Augenblick gewesen, in dem sie begriffen hatte, dass sie ihn verloren, dass er seinen letzten Atemzug getan hatte und dass sein Lachen nie wieder erschallen würde.
Aber jetzt ...
Sie wollte nicht aus diesem Leben scheiden, gemeuchelt von der Hand eines erzürnten Barbaren, der auf Rache sann. Sie dachte daran, wie Edward I. Wallace getötet hatte, an all das Entsetzen, an die Erzürnung der Engländer anlässlich der Krönung von Robert Bruce ...
Und sie ritt, wie sie nie zuvor geritten war, flach an den Hals ihrer Stute gepresst, ihre Fersen in die Flanken des Tieres bohrend, es im Flüsterton anfeuernd. Das Pferd des Rebellenführers lahmte; ihre Tiere hatten Schaum vor den Nüstern gehabt, als sie zuvor auf die Männer von Langley getroffen waren. Wenn sie doch nur einen gewissen Vorsprung gewinnen könnte ...
Sie galoppierte über die Anhöhe durch das satte Gras der Weiden nach Norden. Hinter den Hügeln erstreckte sich der Wald – ein Wald, den sie gut kannte, mit verschlungenen Pfaden und Schutz spendenden Eichen. Dort würde sie sich verbergen können. Sie sah die Bäume, die ausladenden Äste hoch am Himmel wogen, die dunklen Pfade unter dem Blätterdach. Sie roch die satte Erde und hörte das Rascheln des Laubes, genau wie das Donnern der Pferdehufe; ihre verzweifelten, unregelmäßigen Atemzüge, ihr aufgewühlter Herzschlag dröhnten in ihren Ohren. Da ... nur noch Sekundenbruchteile von ihr entfernt ...
Sie war sich nicht bewusst,, dass der Hufschlag seines Pferdes in den ihrer Stute mit einstimmte; sie bemerkte ihn erst, als er seinen Arm um sie schlang und sie ungestüm vom Pferd zerrte. Sie wurde von der Stute gerissen und gewahrte nur noch, wie das Tier in den Schutz der Bäume floh. Und für Augenblicke schaute sie völlig verwirrt geradeaus, während sie über dem riesigen Streitross hing, eine Gefangene, überwältigt von einem Irrsinnigen.
Dann wand sie sich, kämpfte und biss zu – fest genug, dass er sie fluchend losließ. Sein Pferd war gewaltig; sie stürzte ziemlich tief, sank benommen zu Boden, nahm jedoch rasch ihre fünf Sinne beisammen und fing an zu laufen. Sie strebte zu dem dunklen Pfad, rannte verzweifelt, pfeilschnell wie ein gejagtes Reh.
Wieder wurde sie gepackt, diesmal hochgehoben und zu Boden geschleudert, und das Nächste, was sie gewahrte, war, dass er über ihr war und nach Erde und dem Blut des Kampfes roch. Sie schrie, kämpfte, trat, musste jedoch feststellen, dass er ihre Hände über ihrem Kopf wie mit einem Schraubstock umspannt hielt. Der Barbar saß rittlings auf ihr und maß sie mit kaltem, rachsüchtigem Blick, der keine Gnade verhieß.
»Ihr seid die Lady von Langley«, sagte er.
»Igrainia«, erwiderte sie.
»Verflucht, Euer Name kümmert mich nicht«, erklärte er. »Aber Ihr werdet mit mir kommen und veranlassen, dass die Tore geöffnet werden.«
Sie schüttelte hartnäckig den Kopf. »Das kann ich aber nicht ...«
Sie brach ab, als er die Hand zum Schlag erhob. Dieser blieb indes aus.
»Ihr werdet es tun«, meinte er nur. »Oder ich werde Euch jeden Knochen einzeln brechen.«
»In den Burgmauern wütet die Pest, Ihr Narr!«
»Meine Gemahlin ist dort– und meine Tochter«, erklärte er ihr.
»Sie sind alle tot oder werden dort sterben!«
»Und deshalb lauft Ihr aus Angst davon!«, schnaubte er verächtlich.
»Nein! Nein«, begehrte sie auf, weiterhin bestrebt, sich zu befreien. Angst? Vor der Pest? Sie hatte lediglich Angst vor einem Leben ohne Afton.
Nicht ganz richtig, erkannte sie. Sie hatte Angst vor diesem Mann, der jede seiner Drohungen wahr machen und ihr sämtliche Knochen brechen würde. Jeden einzelnen. Noch nie war ihr ein so eiskalt zu allem entschlossener Mann begegnet.
»Ich fürchte mich nicht vor der Pest!«, sagte sie schließlich erstaunlich gefasst.
»Gut. Wir werden zurückreiten, meine feine Dame, und Ihr werdet Eure Hände beschmutzen, indem Ihr die Kranken pflegt. Ihr werdet meine Gemahlin retten, falls sie sich angesteckt hat, und mir helfen, ansonsten ist Euer eigenes Leben verwirkt.«
Ihre Hände beschmutzen? Glaubte er, dass ihr davor bangte, sich die Hände schmutzig zu machen, nach all den Tagen und Nächten, die sie hinter sich hatte?
Ihr Temperament schnellte hoch wie ein Schlachtbanner, und sie keifte ihn an: »Dann tötet mich doch, Ihr törichter, brutaler Narr! Ich habe in dieser Burg gelebt. Der Tod kann mich nicht schrecken. All das kümmert mich nicht mehr. Versteht Ihr das? Gehören solche Begriffe überhaupt zu Eurem Wortschatz?«
Sie hielt den Atem an, da er sich erhob und sie auf ihre Füße zerrte.
»Wenn meine Gemahlin oder meine Tochter wegen der Grausamkeit des englischen Königs gegenüber unschuldigen Menschen sterben sollten, Mylady, dann seid Ihr diejenige, die dafür büßen wird.«
»Mein Gemahl ist tot, weil Euer Volk die Seuche über uns gebracht hat!«, schrie sie, bemüht, ihm ihren Arm zu entwinden. Es gelang ihr nicht. Sie starrte auf die Hand, die ihren Arm wie ein Schraubstock umschloss. Kräftige lange Finger, bedeckt mit Lehm und Erdreich und ...
Blut.
Seine Umklammerung schien härter als Stahl. Unbezwingbar. Sie stand ganz still, entschlossen, nicht zu zittern oder zu taumeln. Sein Gesicht war ebenso schmutzig und verdreckt wie seine Hand und der zerzauste Blondschopf. Einzig die himmelblauen, intensiv auf sie gehefteten Augen wirkten unbehelligt von den Begleiterscheinungen der Schlacht.
Er hatte sie entweder nicht verstanden oder es kümmerte ihn keinen Deut. Sein Sprachverständnis schien hervorragend zu sein, von daher tippte sie auf Letzteres.
»Hört mich an. Wenn meine Frau stirbt, Mylady, werdet Ihr den Gefolgsmännern des schottischen Regenten und ihrer Gnade ausgeliefert sein.«
»Gnade? Dort kennt man keine Gnade.«
»In einem solchen Fall? Vielleicht habt Ihr sogar Recht. Von daher tut Ihr besser alles, um meine Gattin zu retten.«
»Ich, Sir, habe keinerlei Schwierigkeiten damit, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um die Infizierten zu retten. Dennoch kann ich Euch versichern: Ihr Leben liegt allein in Gottes Hand. Man hat mich gezwungen, Langley zu verlassen. Ich bin nicht aus freien Stücken gegangen.«
Skeptisch zog er eine Braue hoch. »Ihr wolltet den Pestkranken und den Sterbenden helfen?«
»Gewiss, ich wäre freiwillig dort geblieben. Ich hatte keinen Grund aufzubrechen.«
»Ihr seid die Lady von Langley.«
»In der Tat.«
Ihn schien nicht zu interessieren, warum sie geblieben wäre.
»Dann wird es Euch sicher nicht schwer fallen, dorthin zurückzukehren.«
»Wohin ich gehe oder was man mir antut, kümmert mich nicht im Geringsten.«
»Ihr werdet meine Frau und mein Kind retten.«
Sie reckte ihr Kinn.
»Wie bereits erwähnt, und das begreift Ihr gewiss auch, liegt ihr Leben in Gottes Hand. Was, wenn ich ihnen nicht helfen kann?«
»Dann ist es nur von Vorteil, dass Euer eigenes Leben Euch scheinbar so wenig bedeutet.«
Er schob sie vorwärts.
Igrainia blieb keine Wahl, als vor ihm herzustolpern.
Ihr Mut indes sank ins Bodenlose.
Wenn Eure Gemahlin sich angesteckt hat, so fürchte ich, dass sie bereits tot ist!, dachte Igrainia im Stillen.
Weil sie gelogen hatte. Als sie Langley verlassen hatte, hatte sie geglaubt, gegen jegliche Angst gefeit zu sein. Immun gegen weiteren Schmerz. Jetzt musste sie feststellen, dass sie den Tod fürchtete, dass sie instinktiv am Leben hing.
Sie wollte überleben.
Aber wenn sie scheiterte, so hatte er in Aussicht gestellt, dass er sie zerbrechen werde. Gewiss waren seine Anweisungen nicht weniger brutal als die von Edward, was die Frauen der Männer anbelangte, die Robert the Bruce die Treue hielten.
Brich ihr sämtliche Knochen. Jeden einzelnen.
Alles lag in Gottes Hand. Aber vielleicht verstand dieser verdreckte Halbwilde das nicht einmal.
»Ich werde Eure Frau und Euer Kind retten, wenn Ihr mir ein Versprechen gebt.«
»Ihr glaubt, mit mir verhandeln zu können?«, erwiderte er grob.
»Ich werde mit Euch verhandeln.«
»Ihr werdet tun, was ich befehle.«
»Nein. Nein, das werde ich nicht. Weil Ihr mir meinetwegen hier und jetzt den Kopf abhacken könnt, wenn Ihr nicht mit mir verhandeln wollt.«
»Glaubt Ihr, ich würde es nicht wagen?«
»Es kümmert mich aber nicht, was Ihr tut und was nicht.«
»Der Lord of Langley ist also tot!«, seufzte er bitter.
»Ganz recht. Ihr habt keine Macht über mich.«
»Glaubt mir, Mylady, wenn ich will, kann ich Euch beweisen, dass ich dennoch Macht über Euch habe. Der Tod ist so einfach, das Leben nicht. Das Leben kann eine einzige Folter sein. Eure Trauer bedeutet mir nichts. Schließlich war es der Lord of Langley, der die Frauen und Kinder gefangen nahm.«
Sie schüttelte den Kopf. »Da irrt Ihr! Da irrt Ihr ganz gewaltig! Er führte lediglich seine Befehle aus. Diejenigen, die noch leben, tun es einzig, weil seine Anweisungen entsprechend lauteten. Und er selbst ist tot, weil Eure Frauen und Eure Kinder diese verfluchte Seuche eingeschleppt haben!«
»Nichts davon zählt!«, brüllte er sie an.
Igrainia ignorierte seinen Zorn und seinen fester werdenden Klammergriff um ihren Arm.
Sie blickte auf seine Hand, dann in seine Augen, so strahlend blau und kalt in dem schmutziggrauen Gesicht.
»Ich werde Eure Frau und Euer Kind retten, wenn Ihr mir Euer Wort gebt, die Gefangenen am Leben zu lassen.«
Wieder hob er achselzuckend eine Braue. »Ihr Schicksal kümmert mich nicht im Geringsten; macht meine Gemahlin und meine Tochter wieder gesund, und sie werden leben.«
Sie tat ein paar Schritte, dann verharrte sie abrupt. Sie hatte im Brustton der Überzeugung gesprochen. Ein Trick, eine Lüge. Und jetzt zitterten ihr die Hände. »Was, wenn ich es nicht kann? Was, wenn die Krankheit schon zu weit fortgeschritten ist? Gott entscheidet, wer lebt und wer stirbt, und der Schwarze Tod ist ein hinterlistig mordender Gesell ...«
»Ihr werdet sie retten«, murmelte er.
Sie hatten sein Pferd erreicht, ein außergewöhnlich schönes Tier. Gestohlen, dessen war sie sich sicher, von einem reichen, auf dem Schlachtfeld gefallenen Adligen. Er hob sie achtlos auf das Ross, dann starrte er sie an, als sähe er sie zum ersten Mal.
»Ihr werdet sie retten«, wiederholte er, als könnten seine Worte das Wunder bewirken.
»Hört mich an. Gewiss begreift Ihr das: ihr Leben liegt in Gottes Hand.«
»Und in Eurer.«
»Ihr seid von Sinnen, besessen! Nur ein Verrückter glaubt, dass er eine Seuche beherrschen kann. Nicht einmal König Edward hat Macht über Leben und Tod bei dieser Krankheit. Auch Könige sind nicht immun, kein Mann, keine Frau ...«
»Meine Frau und mein Kind müssen überleben.«
Er besaß keinen Verstand, keine Intelligenz, keine Logik!
»Welche der Frauen ist Eure Gattin?«, erkundigte sie sich. Sie fragte sich, ob sie seinem Pferd die Sporen geben und fliehen könnte. Sie war im Sattel, er noch am Boden.
»Und wenn ich Euch den Namen nenne, was würde Euch das nützen?«, wollte er wissen.
»Ich habe die Gefangenen besucht.«
Anscheinend bezweifelte er das. »Margot«, sagte er schließlich. »Sie ist groß, schlank und anmutig – und sehr schön.«
Margot. Gewiss, sie kannte diese Frau. Schön, in der Tat, und sanftmütig. Unermüdlich hatte sie die Kinder getröstet, die anderen gepflegt ...
Bis die Krankheit sie niedergestreckt hatte.
Sie hatte prächtige Kleidung getragen und feinsten keltischen Schmuck, wie die Gemahlin eines angesehenen Mannes, eines Adligen oder zumindest eines wohlhabenden Bürgers.
Anders als die eines verdreckten Barbaren.
Gleichwohl ging das Gerücht, dass selbst Robert Bruce, der schottische König, mittlerweile häufig wie ein Bettler daherkam. Er war ein verzweifelter Mann mit einem zerlumpten Heer, unablässig von Hunger und Härten heimgesucht.
»Wer seid Ihr?«, wollte sie wissen.
»Das tut nichts zur Sache.«
»Habt Ihr einen Namen, oder soll ich in Euch einen Verrückten oder den Sensenmann sehen?«.
In seinen Augen funkelte eiskalte Wut. »Ihr braucht einen Namen, wenn es völlig einerlei ist und Euer Leben auf dem Spiel steht? Wenn Edward kundgegeben hat, dass schottische Frauen Freiwild sind – keinen Deut besser als Abtrünnige –, die man rauben, schänden und morden kann? Seid Ihr nicht diejenige, die hier von Sinnen ist, wenn Ihr Ritterlichkeit im Gegenzug für eine solche Barbarei einfordert und die Selbstbeherrschung eines Mannes auf die Probe stellt, dessen Groll mittlerweile dem Eures Königs gleichkommt? Nun denn. Ich bin Eric, aus freiem Willen Lehensmann von Robert Bruce, eingeschworen auf die unabhängige schottische Nation, durch und durch Patriot. Mein Vater war ein schottischer Ritter, mein Großvater mütterlicherseits indes ein Nordländer von den westlichen Inseln. Von daher habe ich viel von einem Berserker –oder auch einem Verrückten,Mylady. Hütet Euch vor mir. Wir sind nicht dafür bekannt, vernunftgemäß zu handeln, geschweige denn Gnade walten zu lassen. Und jetzt beantwortet mir meine Frage. Lebt meine Gattin? Ihr kennt sie, nicht wahr?«
»Gewiss, ich kenne sie. Vater MacKinley ist bei ihr«, antwortete Igrainia. »Sie lebt. Das heißt, als ich aufbrach, lebte sie noch.« Ja, sie kannte seine Frau. Sie hatten oft miteinander geredet, nachdem die Krankheit sie zusammengeführt hatte; sie hatten Nationalität und Loyalität vergessen und einzig den Tod bekämpft.
Und sie kannte seine kleine Tochter. Das bezaubernde Mädchen mit dem flachsblonden Haar und den riesigen blauen Augen, die selbst dann noch gestrahlt hatten, als es erkrankt war. Wimmernd hatte es die Fieberkrämpfe ertragen.
Die Frau hingegen war so krank gewesen, sie hatte sich im Fieber gewälzt, gestöhnt, geschrien ...
Sie würde sterben. Und dann ...
Unvermittelt packte Igrainia die Zügel und stemmte ihre Fersen mit aller Kraft in die Flanken des Pferdes.
Das massige graue Streitross bäumte sich auf, schlug mit seinen Hufen in die Luft. Igrainia klammerte sich verzweifelt an das Tier, umschlang dessen Nacken und stieß ihm weiterhin die Fersen in die Flanken. Der Mann musste zurückweichen, und sie schöpfte neue Hoffnung, als die Pferdehufe den Boden berührten und in Richtung Wald preschten.
Doch kurz vor dem Pfad scheute das Tier plötzlich, bäumte sich abermals auf und wirbelte herum.
Diesmal vermochte Igrainia sich nicht auf seinem Rücken zu halten. Sie plumpste so unsanft zu Boden, dass es ihr die Luft aus den Lungen presste.
Augenblicke später stand er neben ihr, packte sie und zerrte sie auf die Füße. »Versucht noch einmal mir zu entwischen, und ich werde Euch in Ketten legen.«
Sie rang nach Luft und schüttelte den Kopf. »Keiner wird Euch daran hindern, die Burg zu betreten. Denn nur ein völlig Verrückter würde das tun. Ich kann Eurer Gemahlin nicht helfen ...«
»Ich habe Euch gesagt, wer ich bin. Und ich weiß, wer Ihr seid, Igrainia of Langley, bekannt dafür, dass sie wundersame Heilkräfte besitzt. Tochter eines englischen Grafen, hoch geschätzt von vielen. Mein Gott, Ihr seid ein wertvolles Pfand! Man wird einen hohen Preis auf Euren Kopf aussetzen, und Ihr werdet meine Frau retten.«
Einmal mehr wurde sie aufs Pferd geworfen, welches gehorsam zu seinem Herrn getrottet war.
Diesmal saß er hinter ihr auf.
Und dann spornte er das Pferd zu einem halsbrecherischen Galopp an.
Sie spürte seine schäumende Wut im Rücken, die Kraft seines Körpers und seiner Gefühle.
Und mehr ...
Sie spürte, wie er zitterte.
Und schlagartig begriff sie.
Gewiss, er war zornig.
Und er hatte Angst.
Und lieber Gott ...
Sie nicht minder.
Kapitel 2
Er war ein Meister in der Kunst des Tötens. Eric wusste das nur zu gut. Gegenüber feindlichen Mächten besaßen er und seine Männer stets den Vorteil der intensiven Übung, der Erfahrung und des geradezu unerschöpflichen Kampfgeists. Aber nichts davon hatte den Engländern einen solchen Schlag versetzt wie diese grauenhafte Seuche, die seine kleine Rebellentruppe heimgesucht hatte. Eine Zeit lang waren sie der meist gefürchtete Feind des englischen Monarchen gewesen, dann wieder eine Bande von Abtrünnigen, überwältigt und gehasst von ihren Häschern. Aber selbst nach ihrer Gefangennahme durch die Engländer hatte Eric fest darauf vertraut zu fliehen. Er hatte seine eigene Festnahme gebilligt, in dem Glauben, Kerker und Ketten zu entkommen und den anderen zu Hilfe zu eilen. Er wusste zu kämpfen, vermochte selbst dem stärksten Widersacher zu entwischen. Indes hätte er sich nie vorgestellt, dass es einen unsichtbaren Feind geben könnte, gegen den jede Auflehnung vergebens wäre. Denn trotz all seiner Entschlossenheit und Kampfkraft besaß er nicht die geringste Macht über die Krankheit, die in seinen eigenen Reihen wütete. Es gab keinen Widersacher, den er mit einer solchen Hitzigkeit bekämpft hätte, und keinen, der größere Macht über ihn hatte.
Als sie sich den riesigen Toren der Burg Langley näherten, war er sich kaum der vor ihm im Sattel sitzenden Gefangenen bewusst, sondern einzig seiner eigenen Männer, die genau wie er ihr Leben für die Rückkehr ihrer Frauen, Kinder und Gefährten riskiert hätten. Gewiss, sie waren alle von der Krankheit überrascht worden. Sie hatten sie eingeschleppt, nachdem sie auf See einen Schiffbrüchigen gerettet hatten. Als sie den unseligen Überlebenden aus den Wellen gefischt hatten, hatte keiner geahnt, dass sie sich den leibhaftigen Tod an Land gezogen hatten, war sein Schiff doch allein deshalb untergegangen, weil an Bord niemand mehr gewesen war, der dem Sturm hätte trotzen können. Der Mann hatte sein Bewusstsein nie wiedererlangt. Wenige Stunden nach seiner Rettung war er der grausigen Pest erlegen.
Keiner hätte den noch Lebenden wieder in den Schlund des Meeres geworfen, auch nicht, nachdem ihnen klar geworden war, dass sie sich Gevatter Tod an Bord geholt hatten. Erst als der Fremde seinen Atem ausgehaucht hatte, haften sie ihn auf See bestattet.
Bald darauf waren sie mit ihren kleinen Booten an Land gerudert, und die Engländer hatten ihr Lager angegriffen, nicht ahnend, dass sie dem sicheren Tod ins Auge blickten. Obwohl Eric und viele seiner Männer nicht bei der Gruppe gewesen waren, als König Edwards Soldaten ihre Leute gefangen genommen hatten, hatten auch sie sich überwältigen lassen, waren sie doch in der Minderzahl und in tiefer Sorge um Frauen und Kinder. Ihre einzige Chance hatte darin bestanden, die Engländer vor den Schrecknissen zu warnen. Gleichwohl, ihre Gegner hatten ihnen nicht geglaubt.
Jetzt taten sie es.
Als sie ihrem Ziel entgegenritten, gewahrten sie aus der Ferne bereits die schwarzen, an die Burgmauern gemalten Kreuze, eine Warnung für jeden, dass der Tod dort lauerte.
»Weist die Wachen an, die Tore zu öffnen«, befahl er seiner Gefangenen und straffte die Zügel.
Trutzig erhob sich die Burg Langley vor ihnen, eine normannische Festung mit dicken, unbezwingbaren Steinmauern und einem tiefen Burggraben. Das prachtvolle Anwesen lag auf einer Anhöhe, von fruchtbaren Tälern umgeben. Es befand sich unweit von Bruces ausgedehnten Besitzungen; indes besaß Robert, der frisch gekrönte schottische König, mittlerweile weniger als zu der Zeit, da er noch ein einflussreicher Graf seines Landes gewesen war, denn inzwischen hatte Edward von England seine beherrschende Hand mit noch größerer Rachsucht und Erzürnung auf alle Ländereien gelegt. Die Schotten hatten einen Monarchen, den sie bewundern und in dessen Reihen sie für ein unabhängiges Schottland kämpfen konnten. Aber zum König gekrönt zu werden und König zu sein war in Schottland noch lange nicht dasselbe.
»Ihr könnt nicht von mir verlangen, dass ich die Tore des Todes öffnen lasse«, murmelte sie entsetzt.
»Befiehlt es ihnen; sie sollen die Tore öffnen«, schnaubte er. »Wir sind ohnehin ein Heer todgeweihter Männer.«
»Wachen!«, rief sie. »Ich bin es, Lady Igrainia of Langley. Lasst die Brücke hinunter.«
Auf den Wehrgängen hoch über ihnen regte sich etwas, jemand antwortete.
»Mylady, wo ist Eure Schutztruppe? Ihr müsst Euch von hier fern halten; Ihr dürft nicht wieder hinein!«
»Öffnet die Tore, senkt die Zugbrücke herab.«
»Sir Robert hat erklärt, dass Ihr nicht zurückkehren ...«
»Ich bin hier die Burgherrin. Macht die Tore auf!«
»Ihr reitet mit Irren, Ihr kommt mit Rebellen ...«
»Meine Bewacher werden sterben, wenn Ihr die Tore nicht öffnet.«
»Oh, Mylady! Wenn Euch Euer Leben lieb ist ...«
»Ich befehle es Euch. Öffnet die Tore, lasst die Brücke herunter.«
Für Augenblicke fürchtete Eric, dass die Frau nicht die nötige Befehlsgewalt besitzen könnte; trotz seiner Verzweiflung war er nicht unvorbereitet gekommen, er wusste um die Situation in Langley. Die Dame des Hauses besaß größeren Einfluss als der Lord. Obgleich ihr Gemahl eigentlich dem schottischen Adel angehörte und dennoch Edward von England den Treueid geleistet hatte, war Igrainia, seine Witwe, die Tochter eines englischen Grafen.
Der Lärm von Winden und Ketten durchschnitt die allgegenwärtige Stille. Die Zugbrücke senkte sich langsam über den Burggraben. Hier, nahe dem Meer, war er seltsam sauber, da er von einem Fluss gespeist wurde, der sich wie ein blaues Band durch die grünen Felder in Richtung der Felsküste schlängelte. Augenblicke später sprangen die Tore auf, und der Weg zur Burg war frei. Eric gab seinem Ross die Sporen und ritt in den Innenhof.
Einige jammervolle Gestalten traten zögernd näher, als sein Tross über die Brücke preschte. Obschon sie die Rüstung und die Farben ihres verstorbenen Lords trugen, zogen sie nicht ihre Waffen, sondern scharrten sich im Halbkreis um die Pferde der Eindringlinge. Sie schienen ohne Anführer und seltsam unschlüssig.
»Lasst mich hinunter«, sagte Igrainia, »wenn Ihr dies ohne Blutvergießen regeln wollt.«
Ihr Ton gefiel ihm gar nicht – gleichermaßen verbittert wie ihre ganze Erscheinung. Aber ihre Worte machten Sinn, schließlich wollte er Margot, seine Tochter Aileen und die anderen so bald wie möglich sehen. Er musste sich beherrschen, die Frau nicht von seinem Pferd zu stoßen. Sie war ihm ein Gräuel mit ihrem rabenschwarzen Haar, suchte er doch seine Frau, deren Schopf so golden glänzte wie das Sonnenrund, deren Augen von einem seltsam dunklen Violett waren, schön wie ein strahlender Frühlingsmorgen. Vital, gesund und bei Kräften und nicht im Todeskampf ...
Mit äußerster Beherrschung hob er die Engländerin vom Pferd und setzte sie zu Boden, bevor er selbst absaß.
»Wo ist Sir Robert Neville?«, erkundigte sie sich.
Eine der Wachen trat vor.
»Mylady, er ist ... er ist ans Bett gefesselt.«
»Kümmert sich denn jemand um ihn?«, fragte sie bang.
Eric verlor die Geduld und trat vor sie. »Ich bin Eric Graham, Gesandter des rechtmäßigen Königs in diesem Land, Robert the Bruce von Schottland. Legt Eure Waffen ab, und ich verschone Euer Leben. Die Burg ist jetzt in der Hand der Schotten, die Robert the Bruce als König schätzen und anerkennen.«
Er spähte zu Peter MacDonald, der hinter ihm geritten war, und nickte knapp, dass dieser die Befehlsgewalt übernehmen solle. Alles andere ignorierend, strebte er zum Portal des Wohnturms wohl wissend, wo die Gefangenen und selbst die Dahinsiechenden untergebracht waren. Vielleicht war es ein törichter Schritt; ein Wachposten, der ihm den Tod wünschte, hätte ihm eine Klinge in den Rücken bohren können. Hinter sich vernahm er das Klirren der zu Boden fallenden Waffen und das Absitzen seiner Männer, die diese einsammelten. Peter MacDonald, ein Gefolgsmann, der nach der Krönung des Königs seine rechte Hand geworden war, brüllte Befehle. Eric hatte vollstes Vertrauen zu Peter; die schottischen Nationalisten, mit denen er ritt, hatten bislang nur deshalb überlebt, weil sie einander den Rücken stärkten. Ihre Zahl war gering, aber sie hatten dieselbe Gesinnung.
Er hatte mit Widerstand gerechnet, als er den Rittersaal betrat, doch es war niemand da, nur ein alter Mann, zusammengesunken in einem Sessel neben dem Kaminfeuer.. Der Greis versuchte aufzustehen, doch die Anstrengung schien zu groß. Er sank zurück in den Sessel und beäugte Eric, der seinen Blick erwiderte.
»Ihr habt die Seuche, Mann?«, erkundigte sich Eric. Beinahe unheimlich hallte seine Stimme von dem steinernen Mauerwerk wider.
»Ja, aber ich glaube, dass ich überlebe«, erwiderte der Greis, Eric weiterhin beobachtend. »Seid Ihr gekommen, die Burg zu bezwingen, Sir? Dann habt Ihr die Hölle eingenommen, ganz recht, das habt Ihr. Tötet mich, wenn Ihr wollt. Ich würde Euch dienen, wenn ich nur könnte.«
Eric winkte ab. »Schont Eure Kräfte. Sagt mir, wo sind die anderen, die im Dienste der Burg stehen?«
»Tot ... so viele sind tot. Sir Robert Neville hat es niedergestreckt, und Lady Igrainias Zofe pflegt ihn in seiner Kammer. Die Wachen ... haben sich noch nicht angesteckt, da sie sich meist im Freien aufhalten. Der Lord von Langley wurde hastig in der Krypta bestattet, in sein Grab eingemauert, um die Krankheit zu befrieden; seine Gemahlin hätte es nicht ertragen, wenn man ihn verbrannt hätte wie die anderen Opfer.«
»Und was ist mit den Gefangenen und ihren Bewachern?«
»Alle niedergestreckt in den Gewölbekerkern.«
»Und wer kümmert sich um sie?«
»Die, die noch auf ihren zwei Beinen stehen können. Zuvor ... nun ja, da hat sich die Burgherrin um die Kranken gekümmert, bis man sie fortschickte, um ihr Leben zu retten.«
»Ruht Euch aus, Alter. Wenn Ihr wieder bei Kräften seid, könnt Ihr mir vielleicht zu Diensten sein.«
Eric strebte durch den Saal und fand den Gang, der von der Halle zu der Wendeltreppe nach unten führte. Der Mann hatte irgendetwas von ... Hölle gefaselt. Nun, die Hölle war es bereits gewesen, als der Schwarze Tod noch nicht Einkehr gehalten hatte. Die glitschigen Stufen zu den Kellergewölben schienen endlos; die Verliese hier waren gewiss ein Krankheitsherd: modrig, verwanzt, verdreckt. Wer in diesen Teil der Festung gebracht wurde, zählte bereits zu den Toten: lange Gänge mit Krypten, in denen verblichene Lords und Ladys, Ritter, Adelige und verdiente Gefolgsleute in ewigem Schweigen zu Staub verfielen, einige nicht mehr als ein Haufen Knochen, andere hingegen in kunstvoll gemeißelten Steinmonumenten bestattet. Die Gänge mit den Toten lagen vor den Zellen mit ihren Eisenriegeln, Ketten und dem schmutzigen Reisig. Für die Toten wurde bei weitem mehr Aufwand betrieben als für die Gefangenen, deren Leben am seidenen Faden hing.
Eric passierte die Grabstätten und wusste, dass er in der Nähe der Kerker war, als er das Stöhnen vernahm. Unter einen Felsvorsprung geduckt, gewahrte er eine große, dicke Holztür mit einem gewaltigen Riegel; der Riegel war nicht vorgeschoben, die riesige Tür klaffte auf. Er schlüpfte hindurch, erspähte die Zellen und ihre Insassen.
Hier gab es keine weichen Betten oder Pritschen. Der Gestank war so überwältigend, dass er schwankte und Sekunden lang den Atem anhielt. Zu beiden Seiten des Ganges lagen die Kranken und Sterbenden wie achtlos hingeworfene Kleiderbündel. Er trat nach rechts, wo er mit Margot und seiner Tochter gefangen gehalten worden war. Er drehte eine Gestalt um, sah, dass die Pestbeulen des Mannes geschwollen und aufgeplatzt waren. Er erkannte den Verschiedenen nicht mehr, der sicher zu seinen Gefolgsleuten gezählt hatte. Der Schwarze Tod hatte ihn grässlicher entstellt, als jede Folter des Feindes es vermocht hätte.
Die Toten hätten fortgeschafft werden müssen, ihre verstümmelten Leichen gehörten verbrannt, um eine weitere Ausbreitung der Pest zu verhindern. Hier ...
»Margot!«, hauchte er den Namen seiner Frau, denn der Anblick verschlug ihm die Sprache. Behutsam passierte er die Gestalten auf dem schmutzigen Stroh. Er konnte Margot nicht aufspüren, doch seine Verzweiflung verlieh ihm schier unerschöpfliche Energien; er inspizierte das Gewölbe, fand die noch Ahnenden, hob sie auf und trug sie fort, trennte die Lebenden von den Toten.
»Sie ist nicht hier.«
Beim Klang der Frauenstimme schrak er zusammen.
Igrainia of Langley stand am Eingang zu den Zellen und beobachtete ihn, einen riesigen Krug in den Händen.
»Wo ist sie?«
»Einige von den Frauen wurden auf den Söller gebracht«, erklärte sie ihm.
Als hätte sie geahnt, was er hier unten machte, trat sie zu denen, die sich noch regten. Der Gestank und das Grauen ringsum schienen sie nicht zu berühren. Trotz ihrer eleganten Kleidung kniete sie sich ins Stroh zu den Lebenden. Ihre Berührung war sanft, als sie den Wasserkrug an aufgesprungene Lippen führte.
Er trat zu ihr, packte ein Büschel ihrer Haare und zog sie auf Augenhöhe zu sich hoch – diesmal nicht brutal, sondern verzweifelt. »Wo ist der Söller?«
»Oben. Nehmt die Treppe, die vom Rittersaal hinauf in den Turm führt. Dort ist es warm. Vater MacKinley glaubt, dass die Sonne heilende Kraft besitzt.«
Immer noch hielt er eine Hand voll ihrer ebenholzfarbenen Haare gepackt. Seine Finger umspannten diese fester.
»Kommt mit.«
»Aber habt Ihr denn kein Erbarmen mit diesen Euren Freunden ...«
»Sie bedeuten mir mehr als mein Leben. Meine Männer werden sich um sie kümmern. Sie werden dafür sorgen, dass die Toten verbrannt und die anderen aus diesem feuchten Dreckloch geholt werden.«
Während er sprach, vernahm er Schritte auf den Steinquadern des Zellengangs. James of Menteith und Jarrett Miller waren ihm gefolgt. Die Lady of Langley erhob sich anmutig, wenn auch mit zusammengebissenen Zähnen. »Mein Haar, Sir! Ich will Euch ja gern begleiten, aber seid so gut und lasst meine Haare los.«
Das tat er, sich gar nicht bewusst, dass er ihre schwarzen Locken umklammert hielt.
Sie reichte James den Krug, erklärte ihm, wo sie das Wasser geholt hatte und welche Überlebenden es gab. Vorsichtig ging sie an den geschwächten Schotten vorüber und verließ auf leisen Sohlen das Gelass, während die schweren Schritte der Männer polternd widerhallten. Eric nickte James zu, der unmerklich den Kopf neigte, dann folgten sie der Lady of Langley.
Sie durchschritten den Rittersaal und gelangten zu dem Treppenhaus, dessen Ausmaße gewaltig waren für eine solche Festung. Wiewohl zum Schutz vor Feinden gebaut, hatte irgendein adliger Bewohner keine Mühen gescheut, das Gemäuer in einen Herrensitz zu verwandeln. Das Treppenhaus war nicht aus Stein, sondern aus kunstvoll geschnitztem Holz. Es führte zu einem zweiten Geschoss mit einem langen Gang und Türen, doch die Hausherrin verharrte nicht, sondern strebte zu einer schmaleren Stiege. Dort säumten Schießscharten den Stein, und sie passierte diese, bis sie einen großen, taghellen Raum erreichte. Feldbetten standen dort aufgereiht, und ein Lichtstreifen, der durch eine Deckenritze einfiel, schien einen Hoffnungsstrahl auf die Kranken zu werfen.
Ein Geistlicher wandelte entlang der Betten, ein junger, schlanker Mann in schwarzer Priesterrobe. Er schien überrascht, seine Herrin auf der Schwelle zu erblicken, und wandte sich ihr stirnrunzelnd zu. »Igrainia, Ihr solltet alledem fern bleiben!«, schalt er.
Sie trat ins Innere. »Das ist Sir Eric, Vater MacKinley«, sagte sie, trat ein und begab sich zu einem der Betten. Eric nickte dem Priester zu und folgte Igrainia.
Neben der Pritsche fiel er auf die Knie; endlich hatte er Margot gefunden. Sie sah aus, als ob sie schliefe. Weder Beulen noch Pocken schienen ihre makellose Haut zu verunstalten. Doch als er ihr Gesicht berührte, war es. ihm, als griffe er in lodernde Flammen. Er sah, wo die Pestbeulen ihren Hals, ihr Dekolleté gezeichnet hatten, und war den Tränen nahe.
Er spähte zu Igrainia of Langley. »Rettet sie«, befahl er.
Sie fand Wasser, brachte es zu der Bettstatt und benetzte Margots Gesicht.
»Wo ist meine Tochter?«, fragte er.
»Eure Tochter?«, wiederholte der Geistliche.
»Mein Kind ... Aileen. Jung, blond, helle Haut, zart wie Seide.«
Der Priester blieb stumm.
»Meine Tochter, Mann! Wir hatten nicht viele Kinder bei uns.«
Der Priester nickte. »Der kleine Engel«, murmelte er. »Sir, der Allmächtige hat sie zu sich geholt.«
Eric sprang vom Bett seiner Gemahlin auf; der Schmerz war ein bohrender Pfeil in seinem Herzen. Wie von Sinnen stürzte er sich auf den Geistlichen, versucht, ihm an die Gurgel zu gehen. Eine höhere Eingebung hielt ihn davon ab, und er verharrte vor dem Gottesmann, der keine Miene verzog. Eric stand vor ihm, die Fäuste geballt, jeder Muskel zum Zerreißen gespannt.
»Wo ist ihr Leichnam aufgebahrt?«
»Im Nebengelass«, murmelte der Priester. »Wir wollten ihr die letzte Ehre erweisen.«
»Ihr wusstet, dass ich kommen und Euch töten würde«, schnaubte Eric erbittert.
»Sie war noch ein Kind und wurde von allen geliebt. Warum sollten wir, die wir hier Dienst tun, uns vor einem gewaltsamen Tod, vor Mord, fürchten?«, entgegnete der Geistliche, und trotz seiner tiefen Verzweiflung erkannte Eric, dass ihm mit seinen Worten ernst war.
»Ihr«, sagte er und deutete auf den Priester, »Ihr werdet mich zu meinem Kind bringen. Und Ihr«, er wies auf Igrainia, »Ihr werdet Margot eine eigene Kammer einrichten, keine Sekunde lang von ihrer Seite weichen und jeden ihrer Atemzüge beobachten. Wenn sie nicht mehr atmet ...«
Er brach ab.
»Was ist mit den anderen?«, erkundigte sich Igrainia.
»Wir sind jetzt bei ihnen. Und wir würden eher selber sterben wollen, als tatenlos zuzusehen, wie unsere Liebsten dahinsiechen. Bereitet eine Kammer für meine Gemahlin vor. Nein, die Gemächer des Burgherrn. Seht zu, dass sie alle nur möglichen Annehmlichkeiten genießt. Und jetzt, Priester, bringt mich zu meiner Tochter!«
Der Geistliche führte ihn unumwunden vom Söller und öffnete die Tür zu einer kleinen Nebenkammer im Gang. Dort, auf einer langen Truhe, lag der Leichnam seiner Tochter aufgebahrt.
Für Augenblicke stand Eric zu Stein erstarrt.
»Es ist tröstlich zu wissen, dass sie bei unserem Herrn im Himmel weilt ...«, hub der Mann an.
»Lasst mich allein!«, sagte Eric schroff.
Sogleich fiel hinter ihm die Tür ins Schloss.
Er musste sich zwingen vorzutreten. Er blickte auf Aileens Gesicht hinunter, und die Knie versagten ihm den Dienst, Tränen traten in seine Augen. Er schluckte, tastete nach ihr. Ihr geschundener kleiner Körper war kalt. Er schmiegte sie in seine Arme, als könnte er sie wärmen, ließ seine langen, rauen Finger durch ihre unglaublich weichen Locken gleiten. Aileen mit ihrem Lachen und ihrer Fröhlichkeit, unbehelligt von den Grausamkeiten in dieser Welt. Alleen mit ihren ausgebreiteten Ärmchen, wie sie ihn rief, wenn er fortgewesen war, und ihm mit kleinen Schritten entgegenlief. Dann bückte er sich und nahm sie in seine Arme, und sie umschloss sein Gesicht mit ihren Händchen, küsste ihn auf die Wange und wiederholte seinen Namen so kindlich vertrauensvoll, dass er genau wusste: diese Welt war es wert, errettet zu werden, der Kampf um die Freiheit lohnte ...
Unschuld, Vertrauen, Schönheit ... dahingerafft. Die Sonne seines Lebens war verglüht.
Als seine Knie ein weiteres Mal unter ihm nachgaben, sank er zu Boden, ihre leblose Gestalt in seinen Armen.
Allein mit den Kranken auf dem Söller, blickte Igrainia sich verdrießlich um. Unter den noch lebenden Schotten befand sich eine ältere Frau mit langem, ergrautem Haar. Sie würde überleben, schloss Igrainia. Ihre Pestbeulen waren aufgeplatzt, und sie atmete noch. Die Pestilenz war so eigentümlich wie der Tod an sich; diese Frau war bereits betagt; sie wirkte gebrechlich und schwach. Und doch würde sie die Krankheit besiegen.
Eine andere, jüngere Frau schien ohnmächtig geworden zu sein, als Igrainia ihre Stirn kühlte. Die zwei anderen in dem Raum waren ebenfalls jung, beide von Fieberkrämpfen geschüttelt. Igrainia senkte den Kopf auf den Brustkorb der einen und vernahm deren rasselnde Atemgeräusche. Auch sie würde es schaffen. Und die andere ...
»Wasser!«, ertönte ein verzweifeltes, leises Flüstern.
»Langsam, langsam«, mahnte Igrainia, den Kopf der Frau haltend. Sie war vielleicht zwanzig, beinahe so flachsblond wie Margot. Igrainia zwang sie, in kleinen Schlucken zu trinken, dann ließ sie sacht ihren Kopf auf das Kissen zurückgleiten. Unvermittelt ließ ein Schrei das Gemäuer erzittern. Es war mehr als ein Schrei, eher ein wütendes, verzweifeltes, qualvolles Aufheulen. Wie das eines Wolfes, der seinen Kopf gen Himmel reckte. Da wusste sie, dass der Schotte seine Tochter gefunden hatte.
Ein Geräusch an der Tür ließ sie aufmerken, und sie gewahrte ihre Zofe Jennie, einen entsetzten, fassungslosen Ausdruck im Gesicht, während beide dem unheimlichen Echo lauschten.
»Mein Gott ... Wir werden von Ungeheuern heimgesucht!«, wisperte Jennie. »Mylady ...«
Sie stürmte durch die Kammer und begrüßte Igrainia mit herzlicher Umarmung. »Ihr habt es nicht geschafft zu fliehen; die Schotten sind gekommen. Sie sind hier, hier bei uns. Sie werden uns nicht abnehmen, dass wir alles nur Erdenkliche getan haben. Mary hat in den Kerkern gearbeitet, bis auch sie sich angesteckt hat; sie liegt noch dort unten. Vater MacKinley und ich sind die Einzigen, die noch auf den Beinen sind, selbst Garth wurde krank, wisst Ihr, aber er hat überlebt, die Pest konnte ihm nichts anhaben, und er denkt, dass er vielleicht schon als Kind eine ähnliche Krankheit durchlitten hat. Berlinda, die Köchin, erkrankte, als Ihr fort wart. Sir Robert Neville stand auf den Zinnen und beobachtete Eure Abreise ... und musste hernach gleich das Bett hüten. Gütiger Gott, dieser Mann wird uns umbringen, nicht wahr, wir hätten genauso gut der Pest anheimfallen können! Wir sind nur noch wenige ... »
Jennie lag weiterhin in Igrainias Armen und zitterte. Die Burgherrin löste sich sanft von ihr. Sir Erics tiefe Trauer über den Verlust. seines Kindes würde noch eine Weile anhalten, gleichwohl, irgendwann würde er zu ihnen zurückkehren.
»Jennie, wir müssen stark sein. Sag mir als Erstes, wer pflegt Sir Robert Neville?«
»Ich halte Wache bei ihm. Und Molly, Merry, John ... Tom, der Küchenjunge.«
»Wo ist Sir Neville?«
»In seinen Gemächern. Wir tun, was wir können.«
»Warum wurden die übrigen Gefangenen in den Kerkern sträflich vernachlässigt?«
Jennie starrte sie aus riesigen Augen an. »Wie hätten wir uns um sie kümmern können? Wir alle werden sterben. Die Schmiede und Händler, die auf der Burg leben ... sie alle kämpfen mit dem Tod. Nun ja, welchen Unterschied macht das noch? Wir sind alle verflucht.«
»Dieser Rebell weiß nicht, dass der Earl of Pembroke Sir Niles Mason befohlen hat, sämtliche Truppen des Bruce hierher zu bringen, wo über ihr Schicksal entschieden werden sollte. Und er hat keine Ahnung, dass Sir Niles bei den ersten Anzeichen der Krankheit mit seinem eigenen Regiment abgerückt ist!«, erboste sich Igrainia. »Er denkt, dass Afton dafür verantwortlich war.«
»Und er denkt, dass man ihn hingerichtet hätte«, setzte Jennie mit furchterfüllter Stimme hinzu. »An ein Pferd gebunden, über Fels und Geröll geschleift, bis er halb tot wäre, gestreckt, kastriert und erst geköpft, wenn gewiss wäre, dass er. keinen Schmerz mehr empfindet!«
»Vielleicht wäre das nicht sein Schicksal gewesen.«
»Sir Niles beteuerte, das sei der ihm erteilte Befehl! Ich habe es mit eigenen Ohren gehört, Mylady. Ich habe mit angehört, wie er Eurem Gatten das weitere Vorgehen schilderte. Afton wandte ein, dass er gegen Hinrichtungen sei, aber Sir Niles war fest entschlossen. Er erklärte, dass der Rebell Eric Graham schon viel zu lange und viel zu oft gegen König Edward gekämpft habe – zuerst gemeinsam mit William Wallace und jetzt für Robert Bruce. Er ist ein berüchtigter Abtrünniger, Mylady. Er sollte als abschreckendes Beispiel dienen. Seine Gattin sollte den Truppen überlassen werden. Und seine Tochter ... o Gott!« Sie bekreuzigte sich rasch. »Sir Niles fand es ausgesprochen amüsant. Das Kind sei noch zu jung, um die Männer zu unterhalten, indes, als Rebellenspross würde sie ohnehin eine Verräterin werden, und da sei es das Beste, sie umzubringen.«
»Das hätte Afton nie gebilligt.«
»Lady Igrainia, Lord Afton hatte wenig Einfluss auf Sir Niles, schließlich stammten dessen Anweisungen vom Earl of Pembroke, der dem direkten Befehl von König Edward untersteht! Und Robert Bruce mag sich ja zum König der Schotten gekrönt haben, trotzdem besitzt er keine Macht über das Land – schon gar nicht hier. König Edwards Gefolgsleute halten in den Lowlands die Stellung, von den kleinen Gutshöfen bis hin zu den riesigen Burgen. Igrainia, ich schwöre es erneut, wir haben uns um alle Kranken gekümmert, wie Afton uns anwies und wie wir es Euch versprochen haben, ehe Sir Robert auf Eurer Flucht beharrte. Viele, die noch leben, haben es unserer Fürsorge zu verdanken.«
»Der Umstand, dass so viele überlebt haben, scheint diesen rachsüchtigen Mann wenig zu beeindrucken. Vielleicht verkennt er die Tatsache, und dennoch muss er begreifen! Wir sind es unseren Leuten schuldig, die noch am Leben sind, Jennie, und die vielleicht überleben: Wir müssen alles in unserer Macht Stehende für die Gefangenen tun!« Sie merkte, wie sie leicht die Stimme erhob. Die Gefangenen!Inzwischen waren sie die Gefangenen. »Mein Gemach muss hergerichtet werden. Saubere Laken, frisches Wasser. Frische Binsen. Seine Gemahlin soll dort gepflegt werden. Wir müssen ... wir müssen ihr Leben retten.«
»Er wird uns töten, so oder so.«
»Jennie!« Igrainia fasste ihre Zofe bei den Schultern und schüttelte sie sanft. »Er wird uns nicht töten, solange er uns braucht.«
»Aber ... Eure Kammer. Wo ...« – Ihr versagte die Stimme.
»Wo Afton starb«, murmelte Igrainia. »Es spielt keine Rolle. Er hat gesagt, dass sie dorthin gebracht werden soll. Jennie, wir müssen sie retten.«
»Sie liegt im Sterben.«
»Sie darf nicht sterben.«
Jennie schien begriffen zu haben. Sie straffte sich, nickte Igrainia zu und eilte hinaus. Igrainia wandte sich wieder Margot zu, kühlte deren fiebernde Wangen und zermarterte sich einmal mehr das Hirn, warum eine so sanfte und liebenswerte Frau, die unermüdlich die Kranken gepflegt hatte, niedergestreckt worden war. Aber die Pestilenz hatte mit schonungsloser Grausamkeit gewütet und kaum jemanden verschont. Vor Jahren, als sie Frankreich besucht hatte, war in ihrem Aufenthaltsort unweit von Paris eine ähnliche Epidemie ausgebrochen, und sie und Jennie wären um ein Haar gestorben. Vermutlich steckten sie sich deshalb jetzt nicht an, aber wer konnte das wissen, vielleicht traf es sie ja letztlich doch noch? Nach Aftons Tod hatte es sie nicht mehr gekümmert.
Es gab Heilkräuter, die das heftige Fieber in manchen Fällen zu senken vermochten, und nahrhafte Suppen, die man den Erkrankten einflößen musste. Dennoch konnte man nur wenig ausrichten.
»Sind die Herrschaftsgemächer für meine Gemahlin vorbereitet?«
Er stand auf der Schwelle, jetzt hart und kalt und bleich wie die Eisschollen auf dem winterlichen Nordmeer. Eigentlich sollte sie Mitleid haben mit einem Mann, der sein Kind verloren und mit einem einzigen Schrei so viel Schmerz eingestanden hatte, doch ... er jagte ihr Angst ein mit seiner stählernen Beherrschung.
»Gewiss.«
Er durchquerte die Kammer. Trotz der Ansteckungsgefahr hob er seine Gattin zärtlich, mit äußerster Fürsorglichkeit, in seine Arme. »Ihr werdet mir den Weg zeigen.«
»Aber die Frauen hier ...«
»Der Priester wird zu ihnen zurückkehren. Und meine Männer holen die anderen aus diesem höllischen Drecksloch, in das Ihr sie gepfercht habt«
»Trotzdem ist immer für sie gesorgt worden. Mein Gemahl hat lediglich Befehle ausgeführt.«