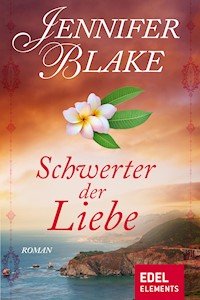Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Master at Arms
- Sprache: Deutsch
Unwiderstehliche Sinnlichkeit und tiefe Gefühle ... Schutzlos und zart wirkt die junge Lisette, als der starke Fechtmeister Caid sie zum ersten Mal sieht. Voll Entsetzen erkennt er in ihr die Witwe des Mannes, den er selbst getötet hat. Nur aus Schuldgefühl kümmert er sich um sie – doch schon bald erglüht Lisette in tiefer Leidenschaft zu ihm. Wie lange wird Caid ihr widerstehen können? "Niemand schreibt mit so viel Liebe und Leidenschaft über New Orleans wie Jennifer Blake." (Romantic Times)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 580
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel “Dawn Encounter”
Edel eBooks
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2014 Edel Germany GmbH
Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2006 by Jennifer Blake
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2007 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH.
Ins Deutsche übertragen von Carola Kasperck
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Inhaltsverzeichnis
TiteleiImpressumErstes KapitelZweites KapitelDrittes KapitelViertes KapitelFünftes KapitelSechstes KapitelSiebtes KapitelAchtes KapitelNeuntes KapitelZehntes KapitelElftes KapitelZwölftes KapitelDreizehntes KapitelVierzehntes KapitelFünfzehntes KapitelSechzehntes KapitelSiebzehntes KapitelAchtzehntes KapitelNeunzehntes Kapitel
Erstes Kapitel
New Orleans, LouisianaMärz 1840
Nach Mitternacht über den Friedhof nach Hause zu gehen, diese Prüfung hatte sich Caid Roe O’Neill selbst auferlegt. Er tat es nicht etwa, um sich an seine eigene Sterblichkeit zu erinnern, sondern im Gegenteil, um nicht allzu vertraut mit dem Tod zu werden.
Einen Mann, der wie er berufsmäßig den Degen schwang, war ständig von der Gefahr eines tödlichen Hiebes bedroht, mochte der nun ihn oder seinen Gegner treffen. Ein falscher Schlenker mit dem Handgelenk, ein sekundenlanges Zögern, wenn es galt, eine geschickte Finte zu parieren, und es war aus. Was dann noch käme, waren der zerbrochene Degen, die schwarzen Armbinden seiner Freunde, der düstere Zug zum Begräbnisplatz. Doch zuweilen, wenn die Dunkelheit wie ein zäher, widerlicher Dunst über New Orleans lag und entferntes Wagenrasseln und gelegentliches Hundegebell die einzigen Geräusche waren, erschien es O’Neill nur allzu leicht, ein solches Ende mit Gleichmut, ja sogar mit einer gewissen Dankbarkeit hinzunehmen.
Derart tiefschürfende Betrachtungen entsprangen nicht etwa einem melancholischen Gemüt, sondern waren natürlicher Ausdruck von Caids irisch-katholischer Herkunft, verbunden mit einer strengen Erziehung durch Priester und Nonnen, die die Meinung vertraten, dass
man solch ein irisches Drecksgör mit den Schattenseiten des Lebens gar nicht vertraut genug machen konnte. Auf ihre Art hatten sie Recht gehabt.
An einem frühen Morgen vor genau einem Monat hatte Caid gespürt, wie sein Degen das Herz von Eugene Moisant durchbohrte und dieses Gefühl hatte weder Schuld noch Scham und auch nicht Triumph in ihm ausgelöst, sondern eine ganz und gar unselige Genugtuung, die Caid nicht noch einmal empfinden wollte.
Aufrecht schritt er dahin, seinen Stockdegen lose umfasst, und betrachtete die weißen Marmorgrüfte, die wie kleine Häuser aussahen, mit Giebeln und Kuppeln, die im Sternenlicht glänzten. Er war nicht erpicht auf Ärger, würde ihm aber auch nicht aus dem Weg gehen. Es war immer gefährlich nachts auf den Straßen, doch besonders hier in der so genannten Stadt der Toten. Wegen des hohen Grundwasserspiegels waren die Grabstätten oberirdisch errichtet worden und boten, ebenso wie die hohen Grabmäler und Marmorgrüfte, umherschleichenden Dieben und Mördern hervorragende Deckung.
Der Pfad aus zerstoßenen Austernschalen knirschte unter Caids Stiefeln und der Saum seines Umhangs bauschte sich beim Gehen und fegte den Staub vom dürren Gestrüpp am Wegrand. Caid roch die trockene, modrige Luft und ganz schwach den Kalk, mit dem die Umfassungsmauern getüncht waren. Die Nacht war kühl für Anfang März in diesen Breiten. Von Norden her war am Tag zuvor kältere Luft geströmt und hatte die gewohnte milde Wärme verdrängt, sodass Caids Atem nun kleine Wölkchen bildete.
Als er in dieser stillen Stadt, wo die schmalen, gewundenen Pfade mehr nach Bedarf als nach Plan angelegt worden waren, um eine Ecke bog, sah er die Grabstätte der Moisants vor sich liegen. Sie bestand aus grauem Marmor, erinnerte entfernt an ein großes Ruhebett und war
von einem schmiedeeisernen Zaun eingefasst, verziert mit dem althergebrachten Friedhofssymbol der Trauerweide.
Doch da lag etwas Weißes auf dem Grab, eine zarte, blasse Gestalt in einem wallenden Gewand ... Caid verharrte einige Sekunden lang unbeweglich. Dann zog er scharf den Atem ein und setzte sich wieder in Bewegung. Das knirschende Geräusch seiner Schritte auf dem Muschelgrus erschien ihm unpassend, als könne es die Ruhe der gemeißelten Engel stören, vor allem des einen, der rücklings und weiß wie Alabaster auf dem Moisant-Grab hingestreckt lag. Beim Näherkommen erblickte Caid die weichen, goldbraunen Locken, die um das Haupt der Gestalt und über die Kante des Grabes hinabflossen, das Ebenmaß ihrer Züge, die hohe Wölbung ihrer Brauen und die feinen Wangenknochen. Das Bild löste unvermittelt eine Erinnerung und gleich darauf heftige Gewissensbisse in Caid aus.
Bei der Frau – vielmehr der Leiche – handelte es sich um Lisette Moisant, die junge Witwe Eugene Moisants, den er vor einem Monat getötet hatte. Nun hatte er also nicht nur die Schuld am Tod des Mannes auf sich geladen, sondern auch noch dessen Frau auf dem Gewissen.
Caid sprang über den niedrigen Eisenzaun und ließ sich neben dem Grab auf ein Knie sinken. Behutsam umfasste er Lisette Moisants schmales Handgelenk – wie kühl es im schützenden Griff seiner warmen Hände lag! Ihre Augen waren geschlossen und die Wimpern warfen kleine fächerförmige Schatten auf ihre Wangen. Eine sanfte Brise fuhr durch ihr Haar und erfasste eine feine braune Strähne, die sich, zart wie Spinnweb, an seinem wollenen Ärmel verfing. Caid kniete regungslos, wie gefangen und gefesselt von dieser leichten Bewegung.
Als er Lisette Moisant das letzte Mal gesehen hatte, wirkte sie bleich und unglücklich in ihrer tiefschwarzen Trauerkleidung. Einen Augenblick lang waren sich ihre
Blicke begegnet, bevor sie ihn erkannte und errötend, mit zusammengepressten Lippen den Blick abwandte. Sie hatte ihn ignoriert und wer wollte ihr das verübeln? Doch für Caid hatte es seitdem keinerlei Hinweis darauf gegeben, dass sie zu einer solchen Tat getrieben würde, durch die sie nun hier lag, kalt und still in ihrem jungfräulich weißen Nachtgewand, als habe sie zu viel von irgendeinem Schlafmittel eingenommen. Laudanum, fuhr es ihm durch den Kopf, als er den schwachen Geruch wahrnahm, der sie umgab.
Selbstmord, und noch dazu wegen eines Mannes wie der verblichene Eugene Moisant, war ein Ende, das keinem Lebewesen zu wünschen war, am allerwenigsten einer solch schönen jungen Frau.
Caid legte ihre Hand wieder neben ihren Körper, richtete sich ein wenig auf und blickte lange auf die sanft geschwungenen Lippen und die Spitze ihres Kinns, das dem ansonsten vollkommenen Oval ihres Gesichts einen vorwitzigen Schwung verlieh. Was für ein vergeudetes Leben, welch zarte Verheißung, die nie ihre Erfüllung finden würde! Ein tiefer Schmerz durchfuhr ihn. Ohne Zweifel war Lisette Moisant von ihrem Flegel von Ehemann ebenso betrogen worden wie Caids Schwester Brona. Daher nötigte ihm ihre Tat, wie sinnlos sie auch sein mochte, doch eine gewisse Anerkennung ab.
Als Zeichen der Achtung beugte Caid sich über die bettähnliche Grabstätte und berührte mit den Lippen sanft den weichen, kühlen Mund der Dame. Dann hob er den Kopf ein wenig und tat einen tiefen Atemzug, als könne er den schmerzhaften Klumpen in seiner Kehle dadurch lösen. In dem Moment spürte er den fast unmerklichen Hauch eines Seufzers auf seiner Wange.
Er runzelte die Stirn und legte seine Hand ohne weitere Umstände zwischen Lisette Moisants Brüste, die sich unter dem weißen Batist abzeichneten.
Ein Herzschlag. Da war es, das leichte Pochen, schwach und etwas unregelmäßig. Er verfluchte sich für seine närrische Schmachterei, mit der er kostbare Zeit vergeudet hatte, warf rasch seinen Umhang ab, breitete ihn über sie und hüllte sie in die üppigen Falten. Dann schob er einen Arm unter ihre Knie, den anderen unter ihren Rücken und hob sie hoch an seine Brust. Ein wenig unter seiner Last schwankend stieß er mit dem Fuß das eiserne Zauntor auf und machte sich auf den Weg zu seiner Unterkunft.
Doch nach drei Schritten blieb er stehen. Er konnte eine anständige Frau nicht in sein Quartier bringen, selbst wenn sie im Sterben lag. Sollte sie überleben, wäre ihr guter Ruf für immer dahin, ihr Leben nicht mehr lebenswert. Ebenso unklug wäre es jedoch für ihn, auf der Schwelle der Moisants aufzutauchen, er, der den Sohn des Hauses getötet hatte. Falls Lisette Moisant sterben sollte, würde man ihn vielleicht sogar dafür hängen. Das Haus von Dr. Labatut, dem jungen Arzt, den man rief, wenn jemand in den Fechtsalons verletzt wurde, lag viele Häuserblocks entfernt, zu weit unter diesen Umständen. Was also sollte er tun?
Ein leises Geräusch, wie eine Mischung aus Keuchen und Stöhnen, drang an sein Ohr. Caid schaute hinunter und erstarrte förmlich unter dem offenen Blick der Frau in seinen Armen. Im fahlen Mondlicht wirkten ihre Augen silbergrau, die Pupillen so unergründlich, dass er in Gefahr war, sich darin zu verlieren. Engelsaugen, weit auseinander stehend und klar hinter einem dichten Wimpernsaum, mit einem unendlich betörenden Ausdruck. Es lag keine Furcht in ihnen, nur Verwirrung und Erstaunen. Plötzlich überlief die Frau ein Schauer. Sie streckte die Hand aus und ergriff den Aufschlag von Caids Rock, bevor sich ihre Wimpern senkten und sie das Gesicht an seiner Schulter vergrub.
Caids Herzschlag stockte, Hitze überflutete ihn wie
eine Welle und ohne Vorwarnung wurde er von einem Ansturm widersprüchlichster Gefühle überwältigt. Er wollte die Frau in seinen Armen forttragen, sie irgendwo verbergen, wo sie für immer vor allem Unheil sicher wäre. Gleichzeitig drängte es ihn, sich mit ihr auf der nächstbesten Marmorplatte niederzulegen und dort mit ihr in den Armen eine Ewigkeit zu schlafen. Er sehnte sich danach, dass sie die Augen öffnen und ihn anlächeln, ihn wiedererkennen und seinen Namen sagen würde. Er lechzte nach ihrer Vergebung, ihrer Absolution und nach der Aufnahme in den illustren Kreis der Menschen, die sie liebte. Um alles in der Welt wollte er in ihren Augen rein und edel erscheinen. Er wünschte, er könne die Uhr zurückdrehen und für sie fehlerlos sein, ohne den Makel der im Zorn verübten Bluttaten. Er brannte darauf, ihre kühlen Lippen zu wärmen, bis sie sich öffneten, bis sich die Frau ihm in zärtlicher Hingabe zuwenden würde, damit er sie in Besitz nahm. Dann würden seine Berührungen sie heilen und beschützen, dann ...
Er war ein Idiot.
Nachdenken, er musste jetzt nachdenken. Er brauchte dringend eine Zuflucht für die Dame, einen Ort, wo sie in Sicherheit gepflegt werden konnte. In Sicherheit vor ihm und allem, was er ihrer behüteten Welt angetan hatte.
Wie als Antwort auf ein Gebet fiel ihm die Lösung ein.
Maurelle Herriot.
Das Stadthaus der Herriots lag nicht weit entfernt in der Rue Dauphine. Maurelle war sicher noch auf, denn sie hatte den Tagesrhythmus einer Katze, blieb bis tief in die Nacht hinein wach und schlief dafür bis nachmittags. Soweit Caid wusste, gab sie heute Abend keine Gesellschaft, denn er hatte keine Einladung erhalten, und höchstwahrscheinlich hatte sie auch kein Rendezvous. Maurelle pflegte zwar einen unkonventionellen Lebensstil, vergaß dabei jedoch nie, dass nur ihre untadelige Abstammung
von einer der französisch-kreolischen Adelsfamilien ihr diese exzentrischen Gewohnheiten erlaubte. Also hütete sie sich, etwas zu tun, was ihre Stellung in der guten Gesellschaft ernsthaft gefährden konnte. Doch gleichzeitig war es für sie wie ein Lebenselixier, im Mittelpunkt aufregender Ereignisse zu stehen, und so würde es ihr nichts ausmachen, wegen eines solch prickelnden Abenteuers gestört zu werden. Und selbst wenn es sie stören sollte, würde sie es ihm verzeihen. Seit sie sich vor einigen Jahren in Paris getroffen hatten, war sie Caids Freundin und hatte ihm schon vieles verziehen. Caid schlug den Weg zu ihrem Haus ein.
Maurelle war für einen Abend zu Hause gekleidet. Im Gegensatz zu den meisten anderen Frauen mochte sie den schlichten Morgenrock nicht, der bei dieser Gelegenheit gern getragen wurde. Stattdessen hatte sie sich in fließende orientalische Gewänder aus rostrotem Seidenbrokat gehüllt und trug einen dazu passenden mit Perlen besetzten Turban. Diese exotische Mode stand ihr, sie unterstrich den geheimnisvollen Ausdruck ihrer schönen dunklen Augen und brachte zugleich ihre üppige Figur zur Geltung, deren Rundungen sie sich dank ihrer Vorliebe für mehrgängige Diners und Schokoladenbonbons mühelos bewahrte. Mit wehenden Gewändern rauschte sie nun heran, als ihr Butler Caid mitsamt seiner Last in den Salon im ersten Stock führte.
»Mon Dieu, cher! Was hast du getan? Leg das arme Ding da auf das Sofa am Kamin.« Sie drehte sich zu ihrem altgedienten Butler um, der wartend in der Tür stand, und klatschte in die Hände. »Hirschhornsalz und Wasser, Solon. Auf der Stelle!«
»Die Dame braucht einen Arzt«, sagte Caid, legte Lisette auf das Sofa, kniete neben ihr nieder und begann, ihr die eiskalten Hände zu reiben. »Und eine warme Decke.«
Maurelle nickte dem Butler zu. »Du hast es gehört.«
Als der Butler die Tür hinter sich geschlossen hatte, fuhr Caid fort: »Ich habe der Dame nicht das Geringste zu Leide getan. Sie war schon in diesem Zustand, als ich sie fand.« In wenigen kurzen Sätzen berichtete er, was geschehen war.
»Und du glaubst, das arme Mädchen habe wegen Eugene Moisants Tod Laudanum getrunken? Unfug! Champagner vielleicht, aber bestimmt nichts Tödlicheres.«
»Ich muss zugeben, dass ich auch keinen Grund sehe, warum sie Selbstmord begehen sollte, aber vielleicht empfindet sie das ja anders.«
»Der Mann war so zart fühlend wie ein Klotz«, sagte Maurelle mit Bestimmtheit. »Es würde mich überraschen, wenn er gewusst hätte, wie man eine Frau behandelt. Sie sollte eher zutiefst dankbar sein für diesen Verlust, der sie in den angenehmen Stand einer jungen, finanziell unabhängigen Witwe versetzt hat.«
Maurelle liebte eine klare und deutliche Sprache – einer der vielen Züge, die Caid an ihr mochte. Mit sechzehn hatte man sie mit einem alten Bock verheiratet, der dreißig Jahre älter war, und knapp vier Jahre und viele Gebete um Erlösung später wurde sie endlich Witwe. Nach dieser Erfahrung war sie für Liebe und Ehe nicht mehr zu haben, auch dies ein Umstand, der Caid gefiel, da er in Maurelle keine Erwartungen wecken würde, die er nicht erfüllen konnte. »Nur weil du bei der Beerdigung deines Mannes die jubelnde Trauerarie aus Don Giovanni gesummt hast, heißt das noch lange nicht, dass alle Frauen so empfinden«, sagte Caid über die Schulter gewandt. »Aber liegt die Dame auch bequem?«
»Du warst nicht hier, als Lisette Saine und Eugene Moisant vor zwei Jahren geheiratet haben, nicht wahr? Der Vater ihres verstorbenen Mannes, Monsieur Henri Moisant, hatte offensichtlich den Coup der Saison gelandet, als er die Heirat zwischen seinem Sohn und der Saine-Erbin
arrangierte. Ihr Besitz allein hätte schon ausgereicht, dem Mädchen einen Baron oder etwas noch Besseres zu verschaffen, wenn Madame Saine sich nur die Mühe gemacht hätte nach Europa zu reisen. Es ist ein Jammer, dass sie sich nicht in höheren Kreisen nach einer vorteilhaften parti umgesehen hat.«
»Was willst du damit sagen?«
»Madame Saine hat hart verhandelt, das wird zumindest behauptet. So bestand sie darauf, dass Lisette weiter frei über den Großteil ihrer riesigen Mitgift verfügen konnte. Als Gegenleistung beglich sie Eugenes Spielschulden und stockte das Familienvermögen der Moisants um einen beträchtlichen Betrag auf. Madame hatte wenig Vertrauen zu den Moisants, ob Vater oder Sohn, und wollte sicher stellen, dass man Lisette gut behandeln würde. Sie wusste wohl, dass sie nicht mehr lange zu leben hatte.«
»Aber ihre Bemühungen waren wohl umsonst.« Caids Stimme klang gedankenverloren, während er die Dame auf dem Sofa eingehend betrachtete. Ihre Wimpern flatterten ein wenig, doch sie öffnete die Augen nicht wieder. Angst schnürte ihm die Brust zusammen, bis er kaum noch atmen konnte.
»Genau. Es heißt, Monsieur Moisant war bereits unzufrieden, als sich die beiden gerade das Jawort gegeben hatten. Er hielt es für unpassend, dass seine junge Schwiegertochter über ein so großes Vermögen verfügte. Seiner Meinung nach bewies sie mit ihrer Weigerung, ihre Angelegenheiten in seine Hände zu legen, dass sie keineswegs gewillt war, ihre Persönlichkeit zu unterdrücken und eine echte Moisant zu werden. Er hatte sicher angenommen, er könne sie überreden, ihm Vollmacht über ihr Vermögen zu geben, wenn sie nur erst unter seinem Dach wohnte. Doch Lisette erwies sich als nicht so gefügig wie erwartet. Sie war in diesem Punkt sogar erstaunlich dickköpfig.«
Caid schüttelte nur abwesend den Kopf.
»Ich meine, schau sie dir doch nur an, so jung und ohne ein Gramm zu viel am Körper! Wer hätte geglaubt, dass sie einem Mann von Monsieur Moisants Alter und Statur standhalten würde?« Maurelle stieß ein kurzes Lachen aus. »Er war es gewohnt, die Frauen in seinem Haushalt herumzukommandieren, angefangen bei seinem Schatten von einer Frau, die bald von irgendeiner geheimnisvollen Krankheit dahingerafft wurde, bis zur niedrigsten Küchenmagd. In seinen Augen war es entwürdigend, dass sich die Braut seinen Forderungen widersetzte.«
»Dafür wird sie aber den Haushalt angemessen unterstützt haben. Eugene warf mit dem Geld nur so um sich, als ich ihn zum ersten Mal sah.«
»Man muss doch schließlich den Schein wahren, oder? Aber das meiste war auf Pump. Er und sein Vater überzogen regelmäßig ihre monatliche Apanage.«
»Besaßen sie denn nichts Eigenes?«
»Schulden«, meinte Maurelle lakonisch. »Ausgerechnet vor dem Bankenkrach vor drei Jahren hatte Henri Moisant unklug investiert. Das Vermögen der Saines hat ihn buchstäblich vor den Geldverleihern gerettet. Aber wenn du denkst, er sei dafür dankbar gewesen, irrst du dich. Er ärgerte sich nur, dass er über Lisettes Vermögen nicht nach Gutdünken verfügen konnte.«
»Arme Lady«, sagte Caid und fuhr sanft mit dem Daumen über ihre zarte, blau geäderte Hand. »Ich bezweifle, dass Eugenes Tod die Dinge zum Besseren gewendet hat.«
»Du sagst es. Eine von Eugenes Methoden, Geld von seiner Frau locker zu machen, war es, sich dafür bezahlen zu lassen, dass er ihrem Schlafzimmer fern blieb. Das flüsterte man sich zumindest hinter vorgehaltener Hand zu. Vielleicht ist es ja wahr, denn er hinterließ keinen Erben. Dieses Druckmittel stand dem alten Moisant nicht zur Verfügung und so befand er sich bald in einer Zwangslage.
Man sagt, er habe sich öffentlich über die Undankbarkeit seiner Schwiegertochter beklagt und auch sonst wenig freundlich von ihr gesprochen.«
»Sie muss doch Verwandte haben, die ihr hätten beistehen können!« Caids Erfahrung nach war in New Orleans fast jeder mit jedem verwandt, zumindest unter den französischstämmigen Einwohnern.
»Nein, gar keine. Madame Saine kam vor etwa 40 Jahren als junges Mädchen mit einem Onkel aus Santo Domingo, nachdem ihre Eltern und eine ältere Schwester beim Sklavenaufstand getötet worden waren. Nachdem sie geheiratet hatte, machte sich ihr Onkel, nun frei von der Verantwortung für seine Nichte, nach Frankreich auf, wo er ein Landgut kaufte, das einem Minister Napoleons gehört hatte. Er hat Lisette nie gesehen und man kann nicht erwarten, dass er sich jetzt um sie kümmert.«
»Und ihr Vater und dessen Familie?«
»Er starb bei der Cholera- und Gelbfieberepidemie vor acht Jahren.«
Maurelle brauchte nicht weiterzusprechen. Immer wieder hatte Caid davon gehört, wie viele damals ihr Leben lassen mussten, dass ganze Familien ausgelöscht wurden, dass man die Toten auf den Friedhöfen wie Holzscheite aufeinander schichtete und die Stadt fast die Hälfte ihrer Bevölkerung verlor.
In dem Moment erschien der Butler mit dem Hirschhornsalz und Wasser. Lisette Moisant reagierte jedoch nicht auf die Mittel. Sie erwachte auch nicht, als der Arzt eintraf.
Er war ein lebhafter Mann mit Mittelscheitel und üppigen Koteletten, der Rock und Weste eilig über sein Nachthemd gezogen hatte, sodass dessen Halsbund nun als Krawatte diente. Doch bei seiner ersten Untersuchung machte er einen durchaus fähigen Eindruck. Er ordnete an, die junge Madame Moisant in ein Schlafzimmer zu
bringen, und bat um eine Waschschüssel und einen Krug Wasser. Inzwischen packte er eine Reihe verkorkter brauner Glasflaschen aus, bei deren Anblick Caid ein kalter Schauer überlief. Der Arzt nahm dankend eine Tasse Kaffee mit einem Schuss Cognac an, um sich für die bevorstehende Aufgabe zu stärken, dann schickte er alle aus dem Zimmer und drückte die Tür hinter ihnen fest ins Schloss.
Caid kam sich wie ein Deserteur vor, als er das Schlafzimmer verließ, doch ihm fiel keine Ausrede ein, um dort bleiben zu können. Maurelle nahm seinen Arm und zusammen gingen sie über die hintere Galerie zum Salon zurück. Eine Zeitlang schritten sie schweigend von einem Fenster zum nächsten und atmeten dabei die frische Nachtluft ein.
Zu ihrer Rechten lag der hübsche kleine Hof, der an einer Seite von Nebengebäuden begrenzt wurde – von Küche und Waschküche, Vorratsschuppen und einem ziemlich eleganten Aborthäuschen. Auf der anderen Seite war der Hof von einer hohen Backsteinmauer eingefasst, deren abweisende Strenge durch eine grüne Kaskade von nachtblühendem Jasmin gemildert wurde. Das Haus besaß keine Kutschendurchfahrt, denn Maurelle wollte keine Equipage, da die Haltung von Pferden unweigerlich mit Mist, Streuschnipseln und Fliegen verbunden wäre. Ansonsten handelte es sich um ein typisches zweigeschossiges Stadthaus mit dem Wohnbereich im ersten Stock und einem Hof auf der Rückseite, in dem sich das Leben im Wesentlichen abspielte. Im rez-de-chaussée, dem Erdgeschoss, befand sich eine pharmacie, um die sich Maurelle als Vermieterin nicht weiter kümmerte.
»Du brauchst nicht hier zu bleiben«, sagte Maurelle nach einer Weile. »Ich kann mich um Lisette kümmern.«
Caid warf der Frau neben ihm einen finsteren Blick zu. »Bin ich dir im Weg?«
»Keineswegs. Du hast nur einfach keinen Grund zu bleiben.«
»Ich fühle mich verantwortlich.«
»Mon cher, wie kommst du denn auf die Idee?«
»Wenn ich Eugene nicht gefordert, ihn nicht dort am Boden liegen gelassen hätte ...«
»Dann hättest du dich nicht wie ein Mann und ganz sicher nicht wie ein liebender Bruder verhalten. Schuld hat allein Eugene Moisant selbst, so wie er sich benommen hat. Sprich nicht von Verantwortung, wenn du mit dem Elend dieses unglücklichen Mädchens gar nichts zu schaffen hast.«
»Aber es kommt mir so herzlos vor, sie dir auf die Schwelle zu legen und dann im Stich zu lassen.«
»Ich werde den Moisants eine Nachricht schicken, dann können sie sie morgen früh abholen. Das heißt, wenn sie die Nacht überlebt. Wenn nicht, wird es deinem Ruf nicht gut tun, wenn man erfährt, dass du dich in der Nähe aufgehalten hast.«
»Mein Ruf …« Caids Stimme war ausdruckslos und er blickte düster in den dunklen Hof hinunter, wo unter den dunkelgrünen Ästen eines duftenden Ölbaums eine schmiedeeiserne Bank stand, wie man sie normalerweise auf Friedhöfen findet. Die kleinen sternförmigen, weißen Blüten des Baumes verbreiteten ihren süßen Duft in der Nachtluft. So hatte auch Lisette geduftet, als er sie in den Armen hielt, dachte Caid. Sie war so zerbrechlich, so hilflos in ihrer Benommenheit! Undenkbar, dass sie sterben sollte, aber ebenso undenkbar, dass sie in das Haus ihres Schwiegervaters zurückkehrte.
»Ich dachte eher an das Renommee deines Fechtsalons.« Mit diesen Worten holte Maurelle ihn wieder in die Gegenwart zurück. »Du hast gesagt, nach dem Duell mit Eugene sei die Zahl der Besucher zurückgegangen, weil der alte Moisant aller Welt erzählte, du hättest seinen Sohn
mit einem unfairen Trick getötet, der eines Gentlemans unwürdig sei. Die jüngsten Ereignisse werden die Sache kaum besser machen.«
Caid wusste das nur zu gut. Lediglich seine Rücksicht auf einen trauernden Vater hatte ihn davon abgehalten, Moisant für dessen Anschuldigungen zur Rechenschaft zu ziehen. »Trotzdem würde ich gern von der Dame selbst erfahren, warum sie sich umbringen wollte.«
Maurelle zuckte mit ihren rundlichen Schultern. »Die Umstände haben ihr jeden Mut genommen, sie war verzweifelt, weil sie praktisch allein in der Welt stand. So was kommt vor.«
»Du hast selbst gesagt, dass Lisette Moisant wenig Grund hatte, um ihren Mann zu trauern, und jemand, der Eugenes Vater die Stirn bieten kann, scheint mir nicht der Typ Frau zu sein, die Laudanum schluckt, nur weil sie einsam ist. Außerdem –«
»Außerdem«, unterbrach Maurelle ihn spöttisch und neigte dabei leicht ihren Kopf, sodass die Perlen ihres Turbans im Licht schillerten, »ist die Dame attraktiv und wurde schlecht behandelt und du hast sie gerade mindestens vor einer Lungenentzündung bewahrt. So galant, so romantisch, nicht wahr? Ich wünschte, mir wäre solch ein Kunstgriff eingefallen um deine Gunst zu gewinnen.«
Caid spürte den Tadel hinter ihrem sarkastischen Humor. Maurelle hegte wohl kaum die Absicht, sich in eine ernsthafte Affäre mit ihm einzulassen, doch sie hatte auch ihren Stolz. Sie flirtete für ihr Leben gern und nahm es schnell übel, wenn einer jener Lebemänner und verwegenen Gesellen, mit denen sie sich umgab, ihr nicht die gebotene Aufmerksamkeit schenkte. Er ergriff ihre Hand und hauchte einen Kuss darauf. »Wie du weißt, chère, bin ich dir ganz und gar ergeben. Was willst du noch mehr?«
»Schmeichler«, erwiderte sie spöttisch, doch bereits ein wenig besänftigt. »Wenn dir dein guter Name schon gleichgültig
ist, dann denk doch wenigstens an Lisettes. Es wird ihre Stellung in der Gesellschaft nicht gerade verbessern, wenn man erfährt, dass du sie hierhergetragen hast und dann bei ihr geblieben bist.«
Caid musste Maurelle insgeheim Recht geben, doch er zögerte noch immer. »Wenn wir sie nach Hause bringen, könnte das noch schlimmere Folgen haben. Was ist, wenn Moisant an all dem Schuld ist, was heute Nacht geschah?«
»Ich bezweifle, dass selbst er sich so weit erniedrigen würde. Immerhin ist er ein Gentleman. Was könnte ihr außerdem Schlimmeres geschehen, als ihren guten Ruf zu verlieren und aus der Gesellschaft ausgestoßen zu werden? Da kann sie ebenso gut sterben.«
Caid war nicht unbedingt dieser Meinung, aber was wusste er schon? Er war ein maître d’armes, ein Fechtmeister, mit einem Salon in der Passage de la Bourse, dem kurzen Fußweg, der von der Canal Street am oberen Ende des Französischen Viertels dorthin führte, wo die St. Louis Handelsbörse und das gleichnamige Hotel letzten Monat abgebrannt waren. Als solcher nahm er eine eigenartige Stellung in der Rangordnung des französischen New Orleans ein. Obwohl ohne gesellschaftlichen Hintergrund, vornehme Abstammung oder nennenswerte finanzielle Mittel, besaß er doch ein gewisses Ansehen. Es beruhte auf seiner Geschicklichkeit im Umgang mit dem Degen und seiner beängstigenden Fähigkeit, immer wieder dem Tod ins Auge zu blicken. Männer ließen ihm an Türen den Vortritt, junge Stutzer, die ihre erste gesellschaftliche Saison erlebten, banden ihre Krawatten und wählten ihre Westen in der gleichen Farbe wie er. Ältere Herren wetteiferten um die Ehre, seine Getränke und Mahlzeiten bezahlen zu dürfen, und kleine Jungen liefen ihm auf der Straße nach. Bei den Männergesellschaften respektabler Herren war er ebenso willkommen wie in den Salons einiger abenteuerlustiger
Damen wie Maurelle. Frauen lächelten ihm hinter ihren Fächern zu und baten ihn zuweilen heimlich zu einem nächtlichen Stelldichein. Niemals jedoch wurde er in einem Haus empfangen, in dem junge Damen lebten, nie wurde er ihnen in der Oper oder auf einem der winterlichen Subskriptionsbälle vorgestellt. Es war eben nicht comme il faut. Er war nicht gesellschaftsfähig, nicht nur auf Grund seiner Herkunft, dem entscheidenden Prüfstein in dieser Stadt, sondern eher noch wegen seines Berufes. Ein Gentleman konnte entweder Rechtsanwalt, Arzt, Bankier oder Kommissionskaufmann werden, doch unter keinen Umständen durfte er einen Beruf wählen, bei dem man ins Schwitzen kam. Und ganz sicher gab ein Gentleman keinen Unterricht in der strapaziösen Kunst des Degenfechtens.
Meistens haderte Caid nicht mit seiner gesellschaftlichen Stellung, die sich gar nicht so sehr von der in seiner Heimat Irland unterschied. Doch zuweilen wurmte es ihn doch.
»Es will mir immer noch nicht gefallen«, sagte er schließlich.
»Was willst du dann? Wohin sollte sie sonst gehen?«, fragte Maurelle in einem leicht vorwurfsvollen Ton.
»Warum kann sie nicht ein paar Tage bei dir bleiben, bis es ihr wieder besser geht?«
»Überleg doch mal, cher. Moisant wird nach ihr suchen lassen. Man wird sie hier sehen und sich fragen, warum sie lieber bei mir ist als zu Hause bei ihm. Die Gerüchteküche wird brodeln. Außerdem will die Dame vielleicht gar nicht hier bleiben.«
»Und wenn doch?« Wie sollte er ihr erklären, warum es ihm so schwer fiel, die Frau, die er gerettet hatte, zu verlassen, wenn er es doch selbst nicht wusste? Es schien ihm beinahe so, als sei es wichtig für seinen Seelenfrieden, sich nicht von ihr zu trennen.
»Wir müssen abwarten, was Moisant dazu sagt. Sie gehört trotz allem in sein Haus.«
Caid wusste, dass Maurelle Recht hatte, doch er konnte sich nicht zu einer Entscheidung durchringen. Es war einfach lächerlich. Ihn band nichts an Lisette Moisant. Sicher, sie war hübsch, aber ebenso gewiss hatte ihn nicht der coup de foudre, der Blitzstrahl der Liebe auf den ersten Blick getroffen. Liebe konnte er gar nicht gebrauchen. Wollust schon, aber nicht die Art von Liebe, die intelligente Männer in schmachtende Idioten verwandelte. Seine ersten Illusionen über dieses erhabene Gefühl hatte er bereits verloren, als er mit ansehen musste, wie seine Mutter jedes Jahr ein Kind zur Welt brachte, von denen die meisten schon starben, bevor sie laufen lernten. Das ging so weiter, als er mit vierzehn von einem Schankmädchen verführt wurde, das sich zweimal mit ihm aus Spaß und zum beiderseitigen Vergnügen im Heu wälzte und beim dritten Mal einen Schilling verlangte. Seine letzten romantischen Vorstellungen erhielten den Todesstoß von einer Pariser Baronesse, die ihn wegen seiner leidenschaftlichen Verliebtheit verhöhnte, als er gerade mit ihr zwischen den zerwühlten Betttüchern lag.
Liebe war nichts als Schwindel, ein Gefühl, das Männer und Frauen zu Liaisons verlockte, die in heftigem Schmerz und Enttäuschung endeten. Sie war nur ein nützliches Märchen, mit dem Kirche und Notare Menschen zu Verbindungen verleiteten, aus denen zu viele hungrige Kinder und schreiende Babys hervorgingen. Genug zu essen, Geld oder Zuneigung für alle gab es dagegen nie. Deshalb wollte Caid nichts mit Liebe zu tun haben.
Allerdings musste er zugeben, dass es zwischen ihm und Lisette Moisant ein seltsames Band gab, das ihn ebenso gefesselt hielt wie die Eisen, die an seinen Hand- und Fußgelenken von Roststaub verfärbte Narben hinterlassen hatten. Er konnte nicht gehen, nicht bevor er wusste,
dass sie den nächsten Tag erleben und in Sicherheit sein würde.
»Sei vernünftig, cher«, redete Maurelle ihm gut zu. »Du trägst wirklich nicht die Verantwortung, das verspreche ich dir.«
»Ich warte noch ein wenig, wenn du erlaubst. Ich kann es mir in der Bibliothek bequem machen, falls du dich zurückziehen möchtest.« Seine Worte klangen kurz angebunden.
»Also bitte, wenn du unbedingt das Risiko eingehen willst …«
»Welches Risiko?«
»Moisant wird nicht erfreut sein, wenn er erfährt, wie seine Schwiegertochter hierher gekommen ist. Je länger du hier bleibst, desto größer wird die Gefahr, dass es ihm zu Ohren kommt. Vielleicht glaubt er sogar, dich fordern zu müssen, weil du sie angerührt hast.«
Caid fühlte eine brennende Hitze im Nacken aufsteigen, als er daran dachte, wie er einen Kuss auf Lisettes kühle Lippen gehaucht hatte. Langsam ballte er im Dunkeln die Fäuste, doch seine Stimme klang sachlich. »Wohl kaum.«
Maurelle begleitete ihn noch bis an die Tür zur Bibliothek, dann wandte sie sich ihm zu. »Warum, mon ami? Warum lässt du dich da hineinziehen? Warum hast du Lisette Moisant hierher gebracht, statt ihren Angehörigen einfach mitzuteilen, wo sie war?«
Er legte seinen ganzen Charme in ein aufgesetztes Lächeln. »Zweifelst du etwa an meinen Absichten?«
»Hast du denn welche?« Sie blickte ihn ernst an.
»Nicht solche, wie du denkst. Wie könnte ich, wo ich die Dame doch kaum kenne?«
»Aber vielleicht andere Absichten? In diesem Fall würde ich dir raten, noch mal darüber nachzudenken. Es würde mich stören, wenn du mein Haus dazu missbrauchtest,
ein armes Opfer für irgendeine krumme Sache gefangen zu halten.«
Caid fühlte Zorn in sich aufwallen und entgegnete mit schnarrendem irischem Akzent: »Glaubst du wirklich, ich hätte das arme Mädchen aus reiner Bosheit hergebracht oder ich wolle sie als Waffe in einer Blutrachegeschichte benutzen?«
»Ich habe keine Ahnung. Ich vermute, diese Frage werden sich viele stellen, einschließlich Monsieur Moisant.«
»Mit dem Mann habe ich keinen Streit. Sein Sohn hat mir Genugtuung gegeben für das, was er meiner Schwester angetan hat. Das reicht.«
»Ich bin nicht sicher, ob Monsieur Moisant das ebenso sieht. Er hasst dich mit geradezu höllischer Inbrunst und diese Angelegenheit wird nur Öl ins Feuer gießen. Lisette Moisant hat es nicht verdient, in euren Streit hineingezogen zu werden.«
»Ich hoffe, das werde ich zu verhindern wissen.«
»Das hoffe ich auch, aber Monsieur Moisant hat da wenig Skrupel. Er zankt sich mit jedem herum. Und denk daran, für dich mag Eugene ein Ungeheuer gewesen sein, doch für Monsieur Moisant war er der geliebte Sohn und Erbe. Er sah in ihm einfach einen Lebemann, der im Umgang mit Frauen nicht übler war als viele andere. Er war der letzte aus dem Geschlecht der Moisants, für seinen Vater die Hoffnung auf Unsterblichkeit, und nun hat er ihn verloren. Henri Moisant wird beinahe alles tun, um seinen Tod zu rächen.«
»Sein Sohn hat Brona zu Grunde gerichtet. Wäre Moisant ein bisschen weniger stolz auf seinen Stammbaum gewesen und hätte sich bereit erklärt, ein irisches Mädchen in seine Familie aufzunehmen, hätte es keinen Grund für Rache gegeben.«
»Du weißt, dass das unmöglich war. Für ihn war sie keine Frau aus guter Familie, sondern eben nur ...«
»Ein Straßenmädchen, die Tochter eines Kleinbauern, die in einem Haus neben einem Kuhstall zur Welt kam und leider in die hiesigen Einwandererslums geriet, die die Leute Irish Channel nennen, nicht wahr?«, unterbrach er sie. »Oder willst du andeuten, dass sie eine Hure war, weil sie mit einem Mann zusammenlebte, der sie nicht zu heiraten gedachte?«
»So etwas würde ich nie sagen, cher.«
»Aber denken.« Caid wandte kurz den Blick ab. »Nicht, dass es etwas ausmachen würde.«
Maurelle berührte leicht seinen Arm und ihre Stimme war dunkel vor Trauer. »Aber es macht etwas aus, cher, zumindest in der engen, kleinen Welt, in der wir leben. Es macht auch dir etwas aus, da kannst du sagen, was du willst. Sollte Moisant dich jemals verletzen wollen, so wird er hier deinen wunden Punkt finden, in dieser übergroßen Fürsorglichkeit und deinem ungeheuren Stolz.«
»Mein Stolz«, entgegnete er mit Nachdruck, »gründet sich nicht darauf, wo ich geboren bin oder wie ich lebe.«
»Nein, er beruht darauf, was du jetzt bist, nicht wahr? Ein maître d’armes, der sich gegen jedermann wehren kann, todbringend für seine Feinde und die Feinde derer, die er liebt. Aber wenn du deinen Degen einsteckst, Caid, was bist du dann noch?«
Er zuckte mit einer Schulter. »Ein Mann wie alle anderen.«
»Denk daran, wenn du jemals unbewaffnet überrascht wirst.«
Maurelles Kaftan rauschte wie ein seidener Wirbel, als sie sich umdrehte und ihn stehen ließ. Caid lauschte ihren Schritten nach, bis ihr Klang sich in der Galerie verlor. Dann betrat er die Bibliothek.
Maurelles verstorbener Mann war ein ziemlicher Bücherwurm gewesen, ein spindelbeiniger alter Narr, der sich nur um seine Sammlung verstaubter Folianten kümmerte
und um die Havannazigarren, von denen er ständig husten musste, so behauptete zumindest Maurelle. Hier in diesem kleinen Zimmer, wo der Duft nach Ledereinbänden und Tabak in der Luft hing, war sein Geist noch gegenwärtig. Caid trat ans Fenster, hob die Samtvorhänge ein wenig an und schaute auf die Straße hinab. Hier gab es noch keine modernen Gaslaternen wie weiter hinten in der Rue Royale. Man konnte nur wenig erkennen in der trüben Dunkelheit, die lediglich durch eine flackernde Tranlampe an der Straßenecke ein wenig erhellt wurde. Caid ließ den Vorhang wieder sinken und setzte sich in einen Sessel. Von einem Beistelltischchen nahm er sich eine Ausgabe der Zeitschrift, die ihren Namen, L’Abeille – ›die Biene‹ – sowohl in Französisch als auch in Englisch, The Bee, auf dem Titelblatt trug. Er hielt das Blatt in der Hand und starrte ins Leere.
Es war eine Winternacht wie diese gewesen, als Brona am Fieber starb und an dem stümperhaften Versuch, sie von dem ungewollten Kind, das sie trug, zu befreien. Sie war von Eugene Moisant geschwängert worden, da sie als seine Mätresse in einem kleinen Haus in der Rue Rampart lebte. Moisant hatte sich zwar zu seiner Vaterschaft bekannt, aber darauf bestanden, dass sie das ungeborene Kind loswerden müsse. Hinterher, als sie unablässig kränkelte, hatte er Brona auf die Straße gesetzt und ihr ihre Kleider nachgeworfen. So hatten es jedenfalls die Nachbarinnen geschildert, zwei elegante hellhäutige Mulattinnen, die ihrerseits von jungen französisch-kreolischen Herren ausgehalten wurden. Brona war schon einige Monate tot, als Caid ihre Spur von Irland nach New Orleans verfolgte und herausfand, wo und mit wem sie gelebt hatte. Er hatte sie nie als junge Frau gesehen. Für ihn war sie immer das sommersprossige Kind mit der Zahnlücke geblieben, das sie gewesen war, als ihn die englischen Soldaten fortschleppten.
Gott im Himmel, er roch jetzt noch die Torffeuer und spürte den kalten irischen Nebel, der ihm das heiße Gesicht kühlte, als er im Gefängniswagen davonrumpelte. In den Duft des Torfrauches mischte sich der Geruch von brennendem Dachstroh, da sie hinter ihm sein Haus angezündet hatten. Seine Mutter und seine kleine Schwester standen in ihre Umschlagtücher gehüllt weinend im Regen, ein paar Töpfe und Bündel auf dem Boden neben sich. Keine von ihnen hatte er je wieder gesehen.
Diese verdammten Engländer brachten ihn auf eines ihrer Gefängnisschiffe. Verrat nannten sie seinen Kampf gegen die Unterdrückung seiner Freunde und Nachbarn und gegen den Raub des Landes, das von altersher das Eigentum der Iren gewesen war. Selbstgerecht und mächtig wie sie waren, bläuten sie ihm die pflichtschuldige Loyalität gegenüber der englischen Krone ein, als müsse er noch dankbar sein für das britische Recht, das ihm alles genommen hatte, was ihm etwas bedeutete. Da er fast noch ein Junge war, ließen sie schließlich Gnade walten und steckten ihn in einen Gefangenentransport nach Australien. Es war nicht ihre Schuld, dass er den fünften Kontinent nie erreichte. Ein Sturm am Horn von Afrika fegte den Gefängnisgestank des Schiffes hinweg, bevor er es versenkte.
Caid wäre normalerweise umgekommen, wenn er nicht ein paar Wochen zuvor mit einem Kerl Freundschaft geschlossen hätte, der mit seinem grauen Zottelhaar eher einem Tier als einem Menschen glich. Dieser Mann, den sie Troll nannten, war zwei Meter groß, hatte eine schiefe Schulter, ein zerschlagenes Gesicht, an seiner rechten Hand fehlten ihm drei Finger und er war so stark wie vier Männer. Wie Troll ihm sagte, hatte er noch nie einen Freund gehabt, besonders keinen, der so singen konnte wie Caid. Jede Nacht sang Caid ihn in den Schlaf und verscheuchte die Albträume, die den verkrüppelten Riesen so
ängstigten, dass er es kaum noch wagte, die Augen zuzumachen. Dafür brachte Troll ihm bei, auf faire und unfaire Art zu kämpfen, und bewahrte ihn vor dem abscheulichen Schicksal, das einem gut aussehenden, aber unerfahrenen Sträfling drohte, der mit dem Abschaum der Menschheit zusammengepfercht war. Das heißt, zumindest bis sich Caid selbst schützen konnte. Der hässliche Hüne mit dem weichen Herzen teilte seine Rationen und ein paar hart erkämpfte zusätzliche Zentimeter Platz mit ihm. Als dann der Sturm losbrach, zerriss er mit seiner gewaltigen Kraft die Ketten, mit denen sie alle im Laderaum gefesselt waren. Doch Troll konnte nicht schwimmen. Er stieß Caid in die aufgewühlten Wogen, brachte es jedoch nicht über sich hinterherzuspringen.
An die Stunden, die dann folgten, hatte Caid keine Erinnerung. Weder daran, wie er endlich auf einen treibenden Lukendeckel geklettert war, noch, wie lange er überhaupt im Wasser getrieben hatte. Als ihn schließlich ein französisches Handelsschiff auffischte, war er schon so lange von den Wellen hin und her geworfen worden, dass er splitternackt, wie zerschlagen und vor lauter Sonnenbrand so rot wie ein gekochter Hummer war. Als er nach tagelangem Fieberdelirium erwachte, stellte sich heraus, dass ein mitreisender Fechtmeister für seine ärztliche Behandlung und seine Passage nach Frankreich bezahlt hatte. Die einzige Gegenleistung, die der Fechter forderte, war, dass Caid mit ihm ein paar Degenkämpfe austragen sollte, um ihm auf der langen Reise die Zeit zu vertreiben. Dem Kapitän des Handelsschiffes, ein Bretone, der für die Engländer nicht so viel übrig hatte, dass er ihnen einen Gefangenen ausgeliefert hätte, gefiel die Vereinbarung und so begann der Fechtunterricht. Je mehr Caid wieder zu Kräften kam und je geschickter er im Umgang mit der Klinge wurde, desto mehr gewann er auch seine Selbstachtung zurück. Als das Schiff schließlich im Hafen von Le Havre vor Anker
ging und sich Caid auf den Weg nach Paris machte, um sich im salle d’assaut des Franzosen zum Fechtmeister ausbilden zu lassen, war er längst kein unerfahrener Junge mehr.
Nun vernahm er hinter sich ein Räuspern, wandte sich um und sah, dass Solon ein Tablett mit einem silbernen Kaffeeservice und einer Karaffe Cognac brachte.
»Ich dachte, ein Schluck des Stärkungsmittels, das sich der Doktor verschrieben hat, wäre auch Ihnen Recht, Monsieur Caid«, sagte der Butler. Er hielt die Augen niedergeschlagen, doch in seiner Stimme klang so etwas wie Mitgefühl.
»Sie sind ein außergewöhnlich umsichtiger Mann.« Caid setzte sich aufrecht hin, während der Butler das Tablett vor ihm abstellte.
»Madame ist schlafen gegangen. Soll ich Ihnen ein Zimmer fertig machen?«
»Das ist sehr freundlich, aber nicht nötig. So lange bleibe ich nicht.«
»Wie Sie wünschen, Monsieur.«
Der Butler verbeugte sich und ging. Caid blickte ihm kopfschüttelnd nach.
Der Pegel der Whiskykaraffe war um fast drei Zentimeter gefallen und die Kaffeekanne leer, als der Arzt drei Stunden später ins Zimmer geführt wurde. »Ah, da sind Sie ja, Monsieur O’Neill. Man sagte mir, dass ich Sie hier finden würde. Wünschen Sie, dass ich Ihnen über den Gesundheitszustand der Dame berichte?«
»Wenn Sie so freundlich sein wollen«, erwiderte Caid höflich und erhob sich.
»Es stand nicht gut um die Patientin, doch jetzt ist sie zur Ruhe gekommen. Ich musste mein ganzes Wissen aufbieten, um –«
»Wird sie wieder gesund?«
»Das kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Die Auswirkungen
der schädlichen Nachtluft, die Unterkühlung – all das kann durchaus zu einer Lungenentzündung führen. Doch die Dame ist kräftiger, als sie aussieht, und hat einen starken Willen, wenn ich so sagen darf, und so kann ich nur vermuten –«
»Ja, schon gut«, unterbrach Caid ihn. »Ist sie wach? Hat sie mit Ihnen gesprochen?«
»Ja. Sie ist recht munter, was ich anfangs gar nicht erwartet habe. Ich habe versucht, ihre Fragen nach bestem Wissen zu beantworten, aber ich fürchte, ich konnte ihr nicht erschöpfend Auskunft geben. Sie möchte dringend mit Ihnen reden. Unter den gegebenen Umständen habe ich ihr davon abgeraten, aber sie besteht darauf.«
»Du liebe Güte, Mann, warum haben Sie das nicht gleich gesagt?«
Caid drängte sich einfach an dem Arzt vorbei und lief ohne zu zögern über die Galerie zum Gästeschlafzimmer. Er stieß die Tür zu dem Zimmer auf, das in den vergangenen Stunden im Zentrum der Aufmerksamkeit gestanden hatte, und trat an das Bett.
Dort lag Lisette Moisant auf mit Valencienner Spitze besetzten Satinkissen und trug ein Nachthemd ihrer Gastgeberin, das bedeutend weniger sittsam war als jenes, das sie zuvor angehabt hatte. Ihr Gesicht war noch immer blass, bis auf zwei rosarote Flecken auf den Wangenknochen. Ihre Lippen waren nach wie vor blutleer und die Mulde ihrer Kehle war so weiß und wehrlos wie bei einem Kind.
Als Caid näher kam, zog sie mit einer nervösen Geste die Bettdecke hoch über ihre Brüste und steckte sie unter ihren Armen fest. »Sie sind es wirklich«, sagte sie mit leicht rauer Stimme und blickte ihm prüfend ins Gesicht. »Ich dachte ..., das heißt, man hat mir erzählt, dass Sie mich hierher gebracht haben.«
»Wenn Sie das in Ungelegenheiten bringt, tut es mir Leid, aber es erschien mir das einzig Richtige.« Caid war
sich nicht ganz sicher gewesen, aber jetzt bemerkte er, dass ihre Augen tatsächlich so grau waren wie der irische Himmel im Winter und so sanft wie irischer Regen.
Sie senkte die Wimpern, um ihren Blick zu verbergen – oder vielleicht auch aus Verlegenheit, weil er sie so eingehend musterte. »Ich verstehe, dass Ihnen nichts anderes übrig blieb. Es war ... sehr freundlich von Madame Herriot mich aufzunehmen, noch dazu so unvorbereitet. Ich bin ihr dankbarer, als ich sagen kann.«
»Ich bin sicher, sie hat es gern getan.«
»Und Sie, Monsieur O’Neill, wenn Sie nicht zufällig vorbeigekommen wären ...«
Caid schüttelte den Kopf. »Denken Sie nicht mehr daran.«
»Doch, das muss ich. Ich werde ewig in Ihrer Schuld stehen, Monsieur.«
»Es war mir eine Ehre, Ihnen helfen zu dürfen. Wenn ich sonst noch etwas für Sie tun kann oder wenn Sie etwas brauchen, können Sie ganz über mich verfügen.«
Sie warf ihm einen Blick zu, in dem trotz ihrer tapferen Haltung so etwas wie Vorsicht, ja Furcht lag. Seltsamerweise hatte der Blick auch etwas Prüfendes und Abschätzendes. »Sehr freundlich. Ich wüsste nur gern, ob Sie das ernst meinen.«
»Jedes Wort, das versichere ich Ihnen. Benötigen Sie vielleicht etwas?«
»Schon möglich.«
»Ja?« Caid verspürte ein leichtes Unbehagen. Die feinen Härchen in seinem Nacken richteten sich auf wie im Angesicht einer drohenden Gefahr. Mit einem Ziehen im Bauch beobachtete er, wie Lisette Moisants rosa Zunge blitzschnell über ihre Lippen fuhr.
»Ich sollte Sie wirklich nicht damit behelligen. Die Angelegenheit ist ein wenig ... delikat.«
»Soll ich nach Madame Herriot schicken?«, fragte er, als
sie zögerte. »Vielleicht wollen Sie die Sache lieber mit einer Dame besprechen.«
»Nein, nein«, widersprach sie hastig und senkte dann erneut den Blick auf ihre Arme, die sie gegen die Brust gepresst hielt. »Das geht auf keinen Fall. Ich weiß nur nicht, wie die Dinge zwischen Ihnen beiden stehen, und ich möchte mich in keiner Weise zwischen Sie drängen.«
Zweites Kapitel
»Sie beschützen.«
Caid O’Neills Stimme klang ausdruckslos und Lisette konnte es ihm nicht verdenken. Ihr Einfall, sich um Hilfe an den irischen Fechtmeister zu wenden, hatte ihr selbst fast den Atem verschlagen. Die Idee war ihr vor ein paar Tagen gekommen, als sie sich anhören musste, wie sich ihr Schwiegervater bitter darüber beklagte, dass dieser Mann anscheinend unbesiegbar sei. Doch mittlerweile hatte sie sich an den Gedanken gewöhnt.
»Wenn es Ihnen Recht ist«, bestätigte sie höflich, während ihr Puls so raste, dass ihr fast schwindlig wurde.
»Was genau meinen Sie damit?«
»Nichts, was Ihnen zu viele Umstände machen würde. Ich dachte einfach ..., das heißt – zunächst einmal müssten Sie mir eine Unterkunft besorgen.«
»Sie wollen doch wohl nicht andeuten, dass Sie bei mir wohnen möchten.«
»Das wohl kaum, Monsieur!« Das Blut schoss Lisette heiß in die Wangen. Zugleich bemerkte sie, dass das Französisch des Gentleman, selbst wenn seine Stimme vor Ironie triefte, einen melodischen Klang besaß, der seine Herkunft verriet.
»Eben«, stimmte er grimmig zu. »Sie suchen sicher etwas Respektableres, könnte ich mir vorstellen. Etwas Imposantes.«
»Ich glaube, Sie könnten die Angelegenheit mit Leichtigkeit regeln.« Von Nahem betrachtet sah er aus, als könne
er alles Mögliche regeln. Er war größer und kräftiger, als sie erwartet hatte, insgesamt beeindruckender. Sein Teint war nicht olivfarben wie bei vielen Männern, die sie kannte, sondern wies den gesunden Bronzeton eines Mannes auf, der sich nicht um Konventionen scherte, wonach ein Gentleman niemals den Eindruck erwecken durfte, er habe in der Sonne gearbeitet. Er hatte eine klassisch gerade Nase, ein kantiges Kinn und einen klar gezeichneten Mund, dessen geschwungene Winkel ihm einen leicht belustigten Ausdruck verliehen. Dichte, gerade Brauen und dunkle Wimpern umrahmten seine Augen, die im flackernden Licht des reich verzierten Kerzenleuchters auf dem Nachttisch so blau und abgrundtief schienen wie der Golf von Mexiko. Diese Augen zeugten von einer scharfen Intelligenz, mit der er ihre verzweifelte List ebenso leicht durchschauen würde, wie er es schaffte, sie aus der Fassung zu bringen.
Dieser Mann, dieser Degenkämpfer, hatte sie geküsst. Durch die kleine romantische Geste, mit der er seine Lippen auf die ihren gepresst hatte, war sie zu sich gekommen. Bei der bloßen Erinnerung daran begannen ihre Lippen zu kribbeln. Die Empfindung setzte sich wie eine kraftvolle Welle durch ihren ganzen Körper fort und ihr kam der Gedanke, dass er nicht so gefühllos sein konnte, wie er sich gab. Sie durfte also noch hoffen.
»Und wenn Sie eine Bleibe gefunden haben?«
»Dann möchte ich, dass Sie dafür sorgen, dass mir nichts geschieht.«
»Sie brauchen also einen Leibwächter.«
»In gewisser Weise«, erwiderte sie, krampfhaft bemüht, ihr Ansinnen so normal wie möglich erscheinen zu lassen.
»Was ist mit Ihrem guten Namen?«, fragte er. »Man hat mich erst kürzlich daran erinnert, dass er in meiner Gesellschaft in Gefahr ist.«
»Solange kein Unheil droht, muss ja niemand wissen,
dass Sie mir zur Seite stehen. Ich erwarte natürlich nicht, dass Sie ständig um mich herumscharwenzeln.«
»Mit anderen Worten«, sagte er gedehnt, »Sie möchten nicht, dass jemand von unserer Bekanntschaft erfährt.«
Ihr Gesicht glühte jetzt beinahe. »Ich wollte Sie nicht kränken und hatte nur Ihre Bequemlichkeit im Sinn. Und, nun ja, die Schicklichkeit natürlich auch.«
»Natürlich.« Seine Lippen kräuselten sich kurz, bevor er weitersprach. »Sie haben doch ein nettes Zuhause bei der Familie Ihres Mannes. Was treibt Sie zu einem solchen Schritt?«
»Vieles, was Sie nicht zu kümmern braucht, Monsieur O’Neill.«
»Sie verlangen von mir, dass ich Sie beschütze, ohne zu wissen, welche Art von Gefahr Ihnen droht?«
»Ich bin gar nicht sicher, dass diese Gefahr noch besteht, wenn ich erst einmal allein lebe«, erklärte sie und setzte sich ein wenig aufrechter hin, als wolle sie sich gegen eine drohende Absage wappnen.
»Ich bin kein junges Mädchen mehr und verfüge über ausreichende Mittel, einen eigenen Haushalt zu bestreiten. Warum sollte ich es nicht Madame Herriot gleichtun und mich unabhängig machen?«
»Madame Herriot ist mindestens zehn Jahre älter als Sie und hat viel mehr Lebenserfahrung. Außerdem wohnte eine ältliche Cousine bis zu deren Tod im vergangenen Winter bei ihr, was dazu beitrug, ihren guten Ruf zu wahren.«
»Eine Gefährtin ist keine Anstandsdame«, widersprach Lisette heftig. »Und was das Übrige angeht, älter werde ich von allein und Erfahrung kann ich auch sammeln.«
»Aber vielleicht erst, nachdem Sie schon irgend eine Dummheit begangen und sich dadurch in der guten Gesellschaft unmöglich gemacht haben.«
»Wie können Sie nur so etwas sagen! So leichtsinnig bin ich nicht.«
»Kaum zu glauben, wenn man bedenkt, dass Sie irgendwelche Männer darum bitten, auf Sie aufzupassen.«
»Ich habe nur einen Mann gebeten und den habe ich sorgfältig ausgewählt.« Als sie sich ein wenig vorbeugte, verrutschte die Decke.
Sein Gesicht wurde ausdruckslos. »Und dieser Mann bin ich?«
»Ja, das sind Sie – oder vielmehr das waren Sie, bevor sie sich so ungefällig gezeigt haben.«
Caid drehte ihr so abrupt den Rücken zu, dass die Schöße seines grauen Gehrocks nur so flogen. Lisette starrte auf seinen Rücken, die breiten Schultern, den Oberkörper, der in einer schmalen Taille auslief, das rabenschwarze Haar, das sich, kürzer geschnitten, als es die Mode verlangte, auf seinem Rockkragen kräuselte, seine langen Beine, die noch länger wirkten, weil die Hosen durch Stege unter den polierten Halbstiefeln stramm gezogen wurden. Gefühle wallten in ihr auf, die ihr ihre Weiblichkeit bewusst machten, und plötzlich fiel ihr ein, dass sie beide als Einzige in dem schlafenden Haus wach waren und wie wenig sie doch von diesem Mann wusste – außer Gerüchten. Lisettes Handflächen wurden feucht und sie wischte sie verstohlen an der Decke ab.
»Es ist unmöglich«, sagte Caid O’Neill über die Schulter. »Das müssen Sie doch einsehen.«
»Das sehe ich überhaupt nicht ein. Sie haben mich in diese Lage gebracht, Sie sind es mir schuldig, mich da wieder herauszuholen.«
»Ihnen schuldig?«, fragte er mit trügerisch sanfter Stimme und drehte sich wieder zu ihr um. »Das müssen Sie mir nun wirklich erklären.«
Die sehr männliche und nicht ungefährliche Kraft, die von ihm ausging, berührte Lisette. Ihr Herz schlug jetzt zum Zerspringen. »Ich meinte nur, wo Sie mir doch den Mann genommen haben ...«
»Genommen ist in diesem Zusammenhang ein etwas merkwürdiger Ausdruck.«
»Wäre es Ihnen lieber, ich hätte ›ermordet‹ gesagt?« Die Augen des Fechters verengten sich und sie fuhr hastig fort: »Nein, bitte. Ich weiß ja, dass es mit dem Duell seine Richtigkeit hatte. Außerdem hätten auch Sie sterben können. Dennoch bin ich durch Eugenes Tod der Gnade meines Schwiegervaters ausgeliefert und dafür sind Sie verantwortlich.«
»Nun gut, das will ich zugeben. Und was weiter?«
Sie wandte den Blick wieder ab. »Ich traue mich kaum es auszusprechen, es klingt so ...«
»So was? Albern?«
»Verrückt. Es klingt verrückt und keiner wird es mir glauben.«
»Probieren Sie es an mir aus«, schlug er vor.
Lisette biss sich auf die Unterlippe und starrte geradeaus. An der Wand hing in Augenhöhe ein Kruzifix aus Elfenbein mit einer sehr realistisch dargestellten Christusfigur. Ihr Blick glitt davon fort und streifte eine Frisierkommode mit Stoffbehang, einen Wandschirm aus Bambusgeflecht und einen großen Mallardschrank mit geschnitzten Türfeldern. Nichts davon half ihr, weitere Ausflüchte zu ersinnen. »Ich glaube, das heißt, ich bin mir fast sicher, dass mein Schwiegervater mich in den Wahnsinn treiben will. Oder vielmehr will er die Leute glauben machen, dass mein Geisteszustand immer schlechter wird und ich daher nicht mehr in der Lage bin, mich um meine Geldangelegenheiten zu kümmern.«
Als Caid nicht antwortete, nahm sie ihren ganzen Mut zusammen und schaute ihm ins Gesicht. Er sah sie mit gerunzelter Stirn an.
»Ich habe es Ihnen ja gesagt, es ist kaum zu glauben«, sagte sie mit stockender Stimme.
»Wie kommen Sie auf diese Anschuldigungen?«
»Er spricht mit mir wie mit einer Geisteskranken und zwingt mich immer wieder, irgendein Gebräu zu trinken, in das er wahrscheinlich Alkohol und Beruhigungsmittel gemischt hat. Schon öfter, wenn er Gäste hatte, wurde ich in meinem Zimmer eingesperrt, damit ich mich nicht im Salon zeigen konnte. Später erzählten mir die Dienstboten, er habe mich bei den Gästen damit entschuldigt, dass ich durch eine Nervenschwäche indisponiert sei. Was ich nicht war, das kann ich Ihnen versichern. Ich bin nicht nervös und war es auch nie.«
»Dieser Vorfall heute Abend – oder vielmehr gestern Abend, da es ja schon fast Morgen ist ... Sie lagen also nicht auf dem Grab, weil Sie die Absicht hatten, ihrem Mann in den Tod zu folgen?«
»Nein!« Sie schauderte bei der bloßen Vorstellung.
»Wie sind Sie dann auf den Friedhof gekommen?«
»Ich habe keine Ahnung. Ich hätte nicht einmal gewusst, dass Sie mich dort gefunden haben, wenn ich nicht gehört hätte, wie Madame Herriot es Dr. Labatut erzählte.«
»Sie haben auch kein Laudanum getrunken?«
»Aber nein!«
»Sind Sie da sicher?«
Sie starrte ihn ungläubig an. »Selbstverständlich bin ich sicher! Ich will ganz bestimmt nicht sterben.«
»Was haben Sie zum Abendessen getrunken? Wein? Kaffee?«
»Natürlich. Das tut doch jeder, oder?«
»Hatte etwas davon einen eigenartigen Geschmack?«
»Nicht, dass ich wüsste, aber für mich schmeckt mittlerweile alles nach den Mittelchen, die man mir seit ein paar Wochen einflößt.«
»Ja«, murmelte Caid nachdenklich, »so könnte es passiert sein.«
»Sie glauben mir also?« Lisette wagte die Frage kaum zu stellen.
Er antwortete nicht, sondern starrte sie nur mit verwirrender Eindringlichkeit an und ließ dann seinen Blick von ihrem Gesicht zu ihren Schultern und über die Wölbung ihrer Brüste gleiten. Als sie an sich hinunterblickte, bemerkte sie, dass sich das geborgte Nachthemd dicht an ihren Körper angeschmiegt hatte. Unter dem Stoff zeichneten sich überdeutlich ihre weiblichen Rundungen ab – bis hin zu den kleinen vorspringenden Brustwarzen. Einen Augenblick lang fragte sie sich, wie Caid sie wohl sehen mochte. Die meisten Leute hielten sie für klein gewachsen, vielleicht, weil sie zarte Knochen hatte. Sie war sich aber sicher, dass sie von mittlerer Größe und Gestalt war, nicht ganz so vollbusig, wie es die herrschende Mode verlangte, aber ganz passabel. Sie zog die Leinendecke über sich. Als sie wieder aufblickte, waren die Augen des Fechtmeisters auf die Wand über ihrem Bett gerichtet.
»Das erklärt immer noch nicht, wie Sie auf das Grab Ihres Mannes gekommen sind«, sagte er in hartem, abweisendem Ton.
»Jedenfalls nicht in einem Anfall von Schwermut. Das ist alles, was ich Ihnen dazu sagen kann.«
»Ist Ihnen klar, dass Sie an einer Lungenentzündung oder an der Überdosis hätten sterben können, wenn ich nicht aufgetaucht wäre?«
»Also muss ich Ihnen dankbar sein und alles, was Sie mir vielleicht schuldeten, ist damit abgeglichen?« Sie bedachte ihn mit einem finsteren Blick, denn dieses Argument war durchaus stichhaltig, auch wenn sie es nur ungern zugeben mochte.
»Ich finde, es gibt Schlimmeres, als in den Wahnsinn getrieben zu werden.«
»Ja«, stimmte sie traurig zu und richtete ihren Blick wieder auf das Kruzifix, »zum Beispiel, auf einen Friedhof geschafft und dort seinem Schicksal überlassen zu werden.«
»Geschafft«, wiederholte er mit gepresster Stimme.
»Da ich keinen Grund hatte, mich freiwillig dort hinzubegeben, muss ich wohl annehmen, dass es so gewesen ist.«
Es folgte ein langes Schweigen. Lisette wagte kaum zu atmen, während sie auf seine Antwort wartete. Im Haus schlug eine Uhr die vierte Morgenstunde. Unten im Hof, hinter der gläsernen Balkontür, begannen Vögel zu zwitschern und irgendwo krähte ein Hahn. Wie friedlich die Geräusche waren, so ganz anders als die Stimmung in diesem Schlafzimmer …
Caid O’Neill wandte sich von ihr ab, fuhr sich mit der Hand durchs Haar und umfasste dann seinen Nacken. »Sie müssen doch wissen, wie ungeeignet ich für die Stellung bin, die Sie mir zugedacht haben.«
»In gesellschaftlicher Hinsicht, meinen Sie wohl. Das ist mir im Moment ziemlich gleichgültig. Schließlich brauche ich keinen ständigen Begleiter. Während der Trauerzeit sind eh nur die bescheidensten Vergnügungen gestattet.«
»Die Zeit des Kummers wird nicht ewig dauern.«
Es drängte sie, ihm zu offenbaren, wie wenig Kummer sie empfand. Doch was für einen unnatürlichen Eindruck würde es machen, wenn sie ihm verriet, dass sie um ihren Mann nicht stärker trauerte als um einen beliebigen Bekannten. »Das Arrangement müsste ja nicht allzu lange dauern, nur bis alle gesehen haben, dass ich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bin und nicht von irgendeiner Krankheit zerrüttet.«
»Das kann Monate dauern.«
»Eher Wochen«, widersprach sie voller Optimismus.
»Es wird Ihnen nicht gefallen, allein zu leben.«
»Im Gegenteil, ich werde es unglaublich genießen. Sie können ja nicht wissen ...«
»Was? Was kann ich nicht wissen? Was finden Sie so erstrebenswert?«
Sie zögerte einen Augenblick lang und platzte dann heraus: »Frei sein, ich möchte frei sein.«
»Frei?« Er schaute sie mit gefurchter Stirn an.
»Frei, zu tun, was immer ich will, ohne meine Gründe nennen zu müssen, oder gehen zu können, wohin es mir passt, ohne jemandem Rechenschaft abzulegen. Ich möchte allein sein, vollkommen allein. Ich war nie allein, müssen Sie wissen. Immer war jemand bei mir, meine Gouvernante, meine Mutter und später meine Zofe oder mein Mann. Sogar, wenn ich in meinem Schlafzimmer eingesperrt wurde, war ich nicht allein, denn meine Zofe blieb bei mir.«
»Was Sie sich wünschen, ist unmöglich«, sagte Caid ruhig. »Wie man es auch dreht und wendet, in der Welt, in der wir leben, brauchen Frauen Schutz.«
Sie starrte ihn an und nahm ihren ganzen Mut zusammen, um dem festen Blick seiner blauen Augen standzuhalten. »Schutz ist eine Sache, Unterdrückung eine ganz andere. Deshalb habe ich mich an Sie gewandt.«
»Am sichersten wären Sie mit einem neuen Ehemann. Das würde Moisants Ambitionen ein für alle Mal ein Ende setzen.« Er lehnte sich gegen die Fensterbank, kreuzte die Arme über der Brust und wartete auf ihre Antwort.
»Ich will keinen Ersatz für Eugene. Ein Ehemann ist sogar das Letzte, was ich will.«
»Im Moment vielleicht.«
»Für immer.«
»Sie sind eine junge Frau und viel zu attraktiv, um lange als Mauerblümchen herumzuhocken«, sagte er mit einem beiläufigen Schulterzucken.
Er hielt sie also für attraktiv. Merkwürdigerweise freute sie sich darüber. »Das alles liegt noch in der Zukunft, in einer sehr fernen Zukunft.«
»Natürlich. Ich verstehe.«
Das bezweifelte sie, doch wenn sie ihn als trauernde Witwe eher dazu bewegen konnte, sich zwischen sie und ihren Schwiegervater zu stellen, dann würde sie diese
Rolle bereitwillig spielen. »Was nun das Anmieten eines Hauses betrifft ...«