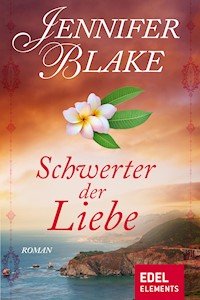Die Originalausgabe erschien unter dem Titel “Gallant Match”
Edel eBooks
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2015 Edel Germany GmbH
Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2009 by Jennifer Blake
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2009 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH.
Ins Deutsche übertragen von Ralph Sander
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Jouve
Inhaltsverzeichnis
TiteleiImpressumErstes KapitelZweites KapitelDrittes KapitelViertes KapitelFünftes KapitelSechstes KapitelSiebtes KapitelAchtes KapitelNeuntes KapitelZehntes KapitelElftes KapitelZwölftes KapitelDreizehntes KapitelVierzehntes KapitelFünfzehntes KapitelSechzehntes KapitelSiebzehntes KapitelAchtzehntes KapitelNeunzehntes KapitelZwanzigstes KapitelEinundzwanzigstes KapitelZweiundzwanzigstes KapitelDreiundzwanzigstes KapitelVierundzwanzigstes KapitelFünfundzwanzigstes KapitelSechsundzwanzigstes KapitelSiebenundzwanzigstes KapitelAchtundzwanzigstes KapitelNeunundzwanzigstes Kapitel
Erstes Kapitel
New Orleans, Louisiana/Mai 1846
Der Regen hielt sich so hartnäckig wie die Tränen einer Witwe. Sonia Bonneval sah durch den Vorhang aus silbrigen Fäden, die vom Dach herabfielen, sich auf den harten Blättern der Fächerpalmen und auf dem Boden des Innenhofs verteilten, wo sich das Regenwasser mit jenem Rinnsal vereinte, das im offenen Ablauf in Richtung Tordurchfahrt floss. Im Licht der Pechfackel an dieser dunklen, tunnelgleichen Einfahrt zum Innenhof nahmen die Regentropfen einen kupfernen Glanz an. Von ihrem Versteck hinter einer Blauregenranke, die am Galeriepfeiler vor der Garçonnière nach oben wuchs, beobachtete Sonia aufmerksam den Durchgang. Jeden Moment musste Vaters heimlicher Besucher daraus hervortreten wie ein aus dem Hades aufsteigender Dämon.
Nur wenige Augenblicke zuvor war die Glocke an der Halbtür geläutet worden, und Vaters Majordomus Eugene hatte sich auf der Freitreppe nach unten begeben, um dem Besuch zu öffnen. Eugene war ein Mann, dessen Gesicht ihn deutlich älter wirken ließ als die dreißig Jahre, die er in Wahrheit zählte, und der stets mit knappen, präzisen Bewegungen auftrat. Sie konnte ihn jetzt eine ehrerbietige Begrüßung aussprechen hören, eine tiefe Stimme antwortete ihm, die kraftvoll und zielgerichtet klang. Dann kamen beide, Eugene mit schlurfenden und der Gast mit ausholenden und resoluten Schritten, durch die Einfahrt.
Schatten bewegten sich in der Düsternis und wurden länger, als die beiden Männer an der Laterne vorbeigingen und durch den Torbogen traten.
In ihrem Versteck musste Sonia beim Anblick des Besuchers nach Atem ringen.
Der Fremde erschien ihr ungeheuer groß zu sein, und der Eindruck wurde durch den wallenden langen Mantel noch verstärkt, der ihm bis zu den Knöcheln reichte. Seine Schultern waren so breit, dass es schien, als würden sie die gesamte Durchfahrt ausfüllen. Sein Zylinder berührte fast die Decke, den er absolut gerade aufgesetzt hatte, nicht etwa schräg, wie es der Mode entsprach. Von Sonias Platz aus war es unmöglich, sein Gesicht zu sehen. Sie konnte lediglich erkennen, dass er seinen Stock wie eine Waffe in der Hand trug.
Gewaltig. Dieser Mann war einfach gewaltig.
Abrupt drehte er den Kopf zur Seite und sein Blick richtete sich auf die Stelle, wo sie sich versteckt hielt. Er konnte sie dort nicht sehen, das war völlig unmöglich. Doch eine Art animalischer Instinkt schien seinen Blick in ihre Richtung zu dirigieren. Sie fühlte sich wie angewurzelt, als würde sie sich nie wieder bewegen können. Ihr stockte der Atem, und das Herz hämmerte in ihrer Brust. Ein Kribbeln auf ihrer Haut schien sie vor einer drohenden Gefahr warnen zu wollen. Die Nacht wurde ganz still, als warte sie darauf, dass sich etwas ereignete.
Eugene war an der Treppe angekommen, die zum Laubengang des Stadthauses führte. Dort blieb er kurz stehen, das schwache Licht aus den Zimmern im ersten Stock fiel auf seine walnussbraune Haut, als er sich zu dem Besucher umdrehte. »Hier entlang, Monsieur.«
Der Mann schaute den Majordomus an, zögerte noch einen Moment, bis er ihm schließlich zur Treppe folgte.
Sonia legte eine Hand auf ihre Brust. Ihr Atem ging so hastig, als würde sie vor dem Fremden davonlaufen, obwohl sie doch nur dastand und verfolgte, wie er sich in gemächlichem Tempo in das erste Stockwerk ihres Hauses begab.
Sie hätte sich gar nicht hier aufhalten dürfen, denn sie sollte
nichts von der Ankunft dieses mitternächtlichen Gastes wissen. Wie typisch für ihren Papa, ihr das zu verschweigen, als ginge sie die Angelegenheit nichts an, die den Mann herführte. Ihr Vater wollte sie vor vollendete Tatsachen stellen, wenn er ihr den Gentleman präsentierte, wobei er sich zweifellos auf ihre guten Manieren verließ, um jeden ihrer Einwände im Keim zu ersticken.
Dass ihr Vater diesen Fehler beging, verwunderte sie nicht. Er hatte sie noch nie verstanden und sich auch nie die Zeit genommen, es wenigstens zu versuchen.
Natürlich bestand die Möglichkeit, dass auch dieser neueste Bewerber für die ihrem Vater vorschwebende Stelle nicht seine Gunst für sich gewann und nach einer gründlichen Befragung so wie alle anderen vor ihm auch weggeschickt wurde. Sie betete, es möge so ausgehen, doch verlassen konnte sie sich darauf nicht.
Dieser Mann unterschied sich deutlich von den anderen. Er wirkte nicht wie ein vagabundierender Abenteurer oder ein Spieler, der zu einem zuträglicheren Hafen mitgenommen werden wollte. Er bewegte sich mit Entschlossenheit und erweckte den Eindruck, mühelos jede Aufgabe erfüllen zu können, die ihm womöglich übertragen wurde. Er war der Inbegriff maskuliner Bedrohung.
Sonia zog das indische Tuch enger um ihre Schultern, da ihr mit einem Mal ein Schauer über den Rücken lief. Dass irgendwann jemand kommen würde, der der Aufgabe gewachsen war, hatte sie von Anfang an gewusst. Doch ihrer Hoffnung nach hätte ihr mehr Zeit bleiben sollen. Ihre Pläne mussten unverzüglich umgesetzt werden, eine weitere Verzögerung konnte sie sich nicht erlauben.
Das zwischen Mobile und New Orleans verkehrende Dampfboot würde in ein oder zwei Tagen im Hafen anlegen. Sonia konnte nur inständig hoffen, dass ihre Großmutter an Bord war, weil sie nicht wusste, was sie sonst machen sollte.
Aber stimmte das wirklich? Sie hielt inne, als ihr eine Idee durch den Kopf ging.
Angenommen, der Gentleman ließ sich davon abbringen, den Posten anzunehmen. Das könnte passieren, wenn er seiner Schutzbefohlenen mit Abneigung begegnete, überlegte sie konzentriert. Kaum ein Gentleman wollte es mit einer Vettel aufnehmen, und erst recht waren sie nicht dafür zu begeistern, mit einer solchen viele Tage hintereinander zu verbringen. Wenn nötig, konnte sie eine Vettel sein. O ja, ganz bestimmt konnte sie das.
Mit Standhaftigkeit und Kühnheit würde sie ein oder zwei Wochen Zeit gewinnen, auch wenn ihr davor graute, sich dem Zorn ihres Vaters zu stellen. Ihr schauderte, als sie sich vorstellte, wie er ihr die kalte Schulter zeigte, was für sie viel schlimmer war als ein Wutausbruch.
Als Kind hatte sie immer dieses Gefühl gefürchtet, ihn enttäuscht und sich selbst in Verlegenheit gebracht zu haben. Alles hätte sie getan, damit er sie wieder anlächelte. Ihr tat es nicht mehr weh, seit sie erkannt hatte, dass er auf diese Weise nur ihren Gehorsam erzwingen wollte, um sie gefügig und von ihm abhängig zu machen. Dennoch verursachte es ihr auch danach immer noch Magenschmerzen.
Jetzt darüber nachzudenken half ihr allerdings nicht weiter. Wenn er das ganze Ausmaß ihres Täuschungsmanövers durchschaute, würde sie längst über alle Berge sein. Außerdem waren manche Dinge das mit ihnen verbundene Risiko wert.
Auf dem Laubengang gegenüber blieben Eugene und der Besucher vor der Tür zum Arbeits- und Rauchzimmer ihres Vaters stehen, wo Eugene ihm Mantel und Stock abnahm und ihm die Tür öffnete. Der Gentleman fuhr sich durchs Haar, straffte die Schultern und betrat dann den Raum.
Der kurze Blick, den Sonia auf sein Gesicht erhaschen konnte, genügte, dass ihr zum zweiten Mal an diesem Abend die Luft wegblieb. Dieses Gesicht hatte etwas Fesselndes,
und unter dem vollen Haar von der Farbe von Eichenblättern im Herbst wirkte es nahezu streng. Ihr entgingen auch nicht seine tief liegenden Augen, die im schwachen Licht beinahe wie leere Höhlen wirkten, wäre da nicht das kurze silbrige Aufblitzen zu sehen gewesen. Sein kantiges Gesicht und das entschlossen gereckte Kinn strahlten eine raue, nahezu urtümliche Form männlicher Schönheit aus, wie sie sie noch nie erlebt hatte. Was sie entsetzte, war die Tatsache, dass sie sich tief im Bauch bei diesem Anblick zu verkrampfen begann.
Er war Amerikaner, überlegte sie. Sehr wahrscheinlich ein Kaintuck, wie die französischen Kreolen die Leute aus den wilden Bergregionen von Kentucky und Tennessee nannten. Sie waren ein Völkchen für sich, und als solches verhielten sie sich Frauen gegenüber weniger manierlich und zuvorkommend als die Männer aus dem Vieux Carré. Einige von ihnen waren regelrechte Grobiane, die ihre mit Schweinen, Mais und Maisschnaps beladenen Kielboote flussabwärts steuerten. Das Geld, das sie damit verdienten, brachten sie in den heruntergekommenen Stadtteilen wieder durch, wo sie sich betranken, mit Fäusten und Füßen kämpften und sich den abscheulichsten Ausschweifungen hingaben.
Andere von ihrem Schlag – Amerikaner aus dem Norden und dem Osten – besaßen zwar mehr Schliff, doch auch ihnen fehlte es an gesellschaftlichem Charme und Esprit sowie an der Fähigkeit zu einer zivilisierten Konversation. Ihnen schien es nur darum zu gehen, ihren Reichtum zu mehren. Sie schauten auf alles herab, was sie für die gottlosen Gewohnheiten der französisch-kreolischen Gesellschaft hielten. Und warum? Nur weil die Gentlemen im Vieux Carré von New Orleans sich lieber amüsierten, anstatt jedem piastre nachzurennen, und weil ihre Ladys Mode à la Parisienne bevorzugten und der Natur ein wenig nachhalfen, indem sie sich dezent schminkten.
Und diese Amerikaner sprachen sich auch dagegen aus,
dass Theater und Spielhallen am Sonntag geöffnet hatten. Ebenso hatten sie etwas gegen die freundliche Angewohnheit von Gastgeberinnen, für Tanzmusik zu sorgen, wenn sie am Sonnabend zu einer Soiree einluden. Wie arrogant sie doch waren, wenn sie glaubten, es sei tugendhafter, in unmoderner Kleidung bis oben zugeknöpft dazusitzen und einander in die ernsten Gesichter zu starren, anstatt sich gut zu kleiden und sich zu vergnügen, wenn man mit le bon Dieu seinen Frieden geschlossen hatte.
Zu ihrem Vater hätte es gepasst, sich für diesen Mann allein wegen seiner Herkunft zu entscheiden. Papa würde schon darauf achten, dass nichts an dessen Gebaren oder Auftreten auf sie anziehend wirkte, und in diesem Fall lag er damit auch genau richtig.
Mére de Dieu! Aber sie musste alles daransetzen, um zu verhindern, dass die Wahl auf den Kaintuck fiel.
Nachdem sie in ihr Schlafzimmer zurückgekehrt war, ging Sonia zum Kamin und zündete an den auf dem Rost liegenden glühenden Kohlen einen Fidibus an.
Damit begab sie sich zu den Kerzen in den Leuchtern zu beiden Seiten ihres Frisierspiegels und zündete sie an. Der helle Lichtschein ließ ihr rotes Haar so erstrahlen, dass ihr Gesicht im Vergleich dazu kreidebleich erschien. Ihre Augen wirkten darin wie zwei brennende blaue Punkte, umgeben von lavendelfarbenen Schatten als Reaktion ihres Körpers auf die letzten Wochen, die beileibe nicht einfach gewesen waren.
An ihrem Toilettentisch sitzend, dachte sie noch einen Moment lang über den Gast ihres Vaters nach. Was würde der wohl zu einer übermäßig geschminkten Vettel sagen?
Von einem plötzlichen Entschluss erfasst, ließ sie das Schultertuch fallen und griff mit beiden Händen den Saum ihres Mieders, um es ein Stück nach unten zu ziehen, damit die Wölbung ihrer Brüste deutlicher in den Mittelpunkt rückte. Das Ergebnis hatte etwas nahezu Verruchtes, was
genau ihrer Absicht entsprach. Als Nächstes griff sie nach einem kleinen Päckchen mit rotem Schminkpapier, das auf dem Tisch lag, zog ein Blatt heraus und rieb es fest über ihre Wangen. Dann benetzte sie mit der Zunge ihre Lippen und drückte das Papier darauf, doch der Effekt genügte ihr noch nicht. Wagemutig rieb sie mit dem Blatt über ihre Augenlider, folgte dem Schwung ihres Halses und schob es zwischen ihre Brüste. So sah das schon besser aus.
Sie griff zu einem Pinsel und ein wenig Öl, um ihre Wimpern mit Lampenruß zu schwärzen. Als die Tür zu ihrem Zimmer aufging, erschrak sie sich so, dass ihr fast der Pinsel aus der Hand gefallen wäre.
»Chère! Was machst du denn da? Du siehst ja aus wie das Abbild einer Dirne!«
Mit trotzigem Blick betrachtete sie das Spiegelbild der gepflegten älteren Lady in der Türöffnung. »Genau das ist meine Absicht, Tante Lily.«
»Wie meinst du denn das? Dein Papa wird entrüstet sein.«
»Das ist es mir wert, wenn der Gentleman, der ihn besucht, genauso reagiert. Außerdem weißt du genau, was du sagen musst, um Papa zu beschwichtigen und die Wogen zu glätten.«
Ihre Tante – seit vielen Jahren ihre Anstandsdame – kam herein und schloss hinter sich die Tür. »Aber nein, chère«, sagte sie und setzte eine besorgte Miene auf. »Dezent ist all das, was die Schönheit betont. Das habe ich dir doch schon so oft gesagt, dass …« Mitten im Satz hielt sie inne. »Gentleman? Was für ein Gentleman? Ich weiß von keinem Gentleman.«
»Ein Amerikaner. Nach dem Aussehen zu urteilen ein Kaintuck. Ich glaube, die mögen ihre Frau blass und schwach, und die Kleider müssen sie so hochgeschlossen wie Nonnen tragen. Sich zu schminken betrachten sie als Teufelswerk.«
»Dann willst du, dass dieser Amerikaner dich abstoßend findet? Im Namen aller Heiligen, warum denn das?«
»Damit er den Posten ablehnt, den Papa ihm in diesen Minuten anbietet. Warum wohl sonst?«
Ihre Tante legte eine Hand an die Schläfe. »Was denn, noch ein Kandidat, der auf dich aufpassen soll? Vielleicht wird er ja so wie die anderen weggeschickt.«
»Ich fürchte, das wird nicht der Fall sein. Er ist … anders.«
»Trotz allem ist er auch ein Mann, zumindest sollte man das annehmen. Wenn er die Gunst deines Papas gewinnt, dann wird er den Posten tout de suite in der Hoffnung annehmen, dass du tatsächlich die liederliche Frau bist, als die du dich präsentierst. Nein, wirklich, chère, das wird nicht funktionieren.«
Skeptisch betrachtete Sonia ihr Spiegelbild, ehe sie wieder zu ihrer Tante sah. »Glaubst du, ich habe es übertrieben?«
»Ganz bestimmt.«
Ihre Tante Lily kannte sich in solchen Dingen besser aus als sie selbst. Zweimal war Lily verheiratet gewesen, beide Male wurde sie Witwe, und als immer noch gut aussehende Frau genoss sie regelmäßig die Gesellschaft verschiedener älterer Gentlemen. Diese Verehrer buhlten darum, wer ihren Fächer oder ihre Tanzkarte halten durfte, sie boten ihr den Arm an, um ihr bei ein paar Stufen oder an der Bordsteinkante zu helfen. An den Besuchstagen kamen sie zu ihr und sorgten mit charmanten Unterhaltungen für ihren Zeitvertreib.
Dabei wurden sie von Tante Lily kaum einmal zu einem solchen Engagement aufgefordert. Nach Sonias Empfinden genoss sie es einfach, von Männern umschwärmt zu werden. Sie wäre vielleicht zu einer dritten Ehe bereit gewesen, doch sie hatte ihren Haushalt aufgegeben, um Anstandsdame für Sonia zu sein, die einzige Tochter ihrer Schwester, die nun
schon seit so vielen Jahren tot war. Dank ihrer corsetière und Schneiderin konnte sie eine tadellose Figur vorweisen, und ihr glänzendes Haar ließ nicht erkennen, dass sie schwarzen Kaffee benutzte, um das ursprüngliche Goldbraun zu erhalten. Auch ihre Wimpern hätten von Natur aus so dunkel sein können, wäre Sonia nicht das Gegenteil bekannt gewesen. Sonias größter Wunsch war es, in diesem Alter noch so auszusehen wie ihre Tante. Allerdings würde sie nach Möglichkeit versuchen, einer Ehe aus dem Weg zu gehen, erst recht einer zweiten!
»Das muss ausreichen«, sagte Sonia schließlich. »Ich wüsste nämlich nicht, wie ich den Mann sonst entmutigen könnte.« Sie wandte sich vom Spiegel ab und hob das Schultertuch auf, das sie auf den Boden hatte fallen lassen. »Mit ein wenig Glück wird er genauso moralisierend und ablehnend reagieren wie die anderen seiner Art. Wünschst du mir bonne chance.«
Auch wenn ihre Tante dazu neigte, sie zu schelten, unternahm sie darüber hinaus wenig, um ihre Schutzbefohlene im Zaum zu halten. »Von ganzem Herzen«, antwortete sie – in ihren braunen Augen lag ein besorgter Ausdruck –, »auch wenn ich nach wie vor glaube, dass du einen Fehler begehst.«
Zweites Kapitel
Kerr Wallace erhob sich von seinem Platz, als ein Wirbelwind aus Seide, Spitze und betörendem Parfümduft ins Zimmer gestürmt kam. Seine Geste war natürlich eine höfliche Reaktion gegenüber einer Lady, zugleich erhob er sich aber aus dem Sessel, weil der Auftritt dieser Lady ihn auf das Äußerste beunruhigte. Das konnte doch nicht die Tochter sein, die eine Begleitung zu ihrer Hochzeit benötigte. Nicht dieses Geschöpf mit rotem Haar, aufblitzenden Augen und zarten milchig weißen Brüsten, denen der Kerzenschein einen rosigen seidigen Glanz verlieh.
Falls ja, dann hätte er mehr als genug zu tun.
Warum in Gottes Namen konnte sie nicht nachlässig gekleidet und demütig sein, flachbrüstig und mit einem schielenden Auge? Mit einer solchen Frau wäre er wohl zurechtgekommen.
Aber er hätte es ohnehin wissen sollen. Ein Mann wie Jean Pierre Rouillard konnte keine schlichte Braut haben, sondern es musste einfach die schönste und feinste sein. Wenn nicht seine Eitelkeit, dann verlangte allein schon sein Stolz das.
Auch sein Gastgeber Monsieur Bonneval war aufgesprungen, jedoch zeigte sein Gesicht einen missbilligenden Ausdruck, so als würde er oft eine solche Miene aufsetzen, sodass die tiefen Falten wie eingemeißelt wirkten. »Sonia, ma chère, du störst eine geschäftliche Angelegenheit. Lass uns bitte allein.«
Kerr entging nicht, dass die Worte als Befehl gemeint waren. Die Lady ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken,
sondern trat einen Schritt vor und streckte ihm die Hand entgegen. »Aber wir haben einen Gast, Papa«, sagte sie und warf nur einen kurzen Blick über die Schulter. »Er muss willkommen geheißen werden. Willst du mich ihm nicht vorstellen?«
»Sonia!«
Unter dem Rot ihrer Wangen wurde sie ein wenig blasser, wie Kerr bemerkte. Er bedauerte, die Ursache für diese Reaktion zu sein, und er sah keinen Grund, warum es so weitergehen sollte. Außerdem missfiel ihm der Gedanke, so lange nicht würdig zu sein, Bonnevals Tochter vorgestellt zu werden, bis er für den fraglichen Posten endgültig ausgewählt worden war.
»Kerr Wallace, zu Ihren Diensten, Mademoiselle.« Er beugte sich über ihre Hand und hielt sie locker und recht ungelenk, da die junge Lady keine Handschuhe trug und er seine eigenen dem Butler übergeben hatte, der ihn ins Haus ließ.
»Sehr erfreut, Monsieur Wallace, und ich bin Sonia Blanche Amalie Bonneval. Ich glaube, Sie und mein Vater besprechen die Reise zu meiner Hochzeit, nicht wahr?«
»Das ist richtig.«
Ihre Finger fühlten sich kühl an und zitterten ein wenig, so als koste es sie große Mühe, die Fassung zu wahren. Er ließ es sich nicht anmerken, doch unwillkürlich überlegte er, was der Grund dafür sein mochte. Und genauso fragte er sich, welchen Hintergrund die angespannte Stimmung zwischen Vater und Tochter haben mochte. Nicht, dass es ihn etwas anginge, schließlich war er nur aus einem einzigen Grund hier. Was es mit den Menschen auf sich hatte, die damit im Zusammenhang standen, zählte letztlich nicht. Nicht einmal dann, wenn die Berührung der Lady wie betäubend durch seinen Arm jagte, als sei er vom Blitz getroffen worden.
Er hätte ihre Hand längst losgelassen, doch sie gestattete
es ihm nicht. Sie klammerte sich an ihn und schien mit aufgerissenen Augen etwas in seinem Gesicht zu suchen. Ihre Wimpern leuchteten nahe dem Lid kastanienrot, während sie an den Spitzen sonderbarerweise schwarz waren. Die Augen selbst hatten den blaugrauen Farbton eines stürmischen, bewölkten Himmels, darüber lag ein trügerischer Hauch von Immergrün wie der von Bergastern im Herbst. Und so wie ein stürmischer Himmel kündigten auch diese Augen an, dass große Probleme folgen sollten.
»Ich befürchte jedoch, es könnte eine gefährliche Reise werden, wenn man bedenkt, dass über uns die schreckliche Bedrohung eines Krieges schwebt«, fuhr sie fort und hielt ihn fester, sodass ihre Hand von seiner schwieligen Handfläche allmählich gewärmt wurde. »Sie schrecken davor nicht zurück?«
»Unsinn«, warf Monsieur Bonneval mit einem gereizten Unterton ein. »Ein paar Scharmützel entlang der Grenze stellen schließlich keinen Krieg dar. Es gibt absolut nichts zu befürchten.«
Die Lady nahm ihren Vater kaum zur Kenntnis, was Kerr dazu veranlasste, vieles von der Strenge des Mannes als Wichtigtuerei abzutun. Ihre ganze Aufmerksamkeit galt ihm, dem Gast. »Und, Monsieur? Stimmen Sie dieser Ansicht zu?«
Kerr hatte Mühe, sich auf ihre Worte zu konzentrieren, da er nur noch diese Lippen wahrnahm, über die sie kamen – diese sanft geschwungenen, vollen Lippen. So verlockend waren sie, und so sehr wollte er ihre Süße kosten, dass ihm allein bei ihrem Anblick bereits das Wasser im Mund zusammenlief. Auf ihren Mund zu starren war sicher nicht das Klügste, was er in diesem Moment tun konnte, doch es schien ihm die bessere Lösung, da er sonst auf ihr verlockendes Dekolleté gestarrt hätte, das sie ihm so offenherzig präsentierte. Und obwohl er fortsah, spürte er, wie sein Körper reagierte und heißes Blut durch seine Adern schickte.
Gleichzeitig bemerkte er ein Kribbeln im Nacken, eine Warnung, von der er seit einigen Jahren wusste, dass er sie nicht ignorieren durfte. Auslöser dafür musste wohl der sehr abschätzende Blick sein, den er in den Tiefen ihrer Augen ausmachen konnte.
»Oh, es wird Krieg geben«, entgegnete er in ruhigem Tonfall, der jedoch eine Spur schroffer als beabsichtigt war.
»Dann ist die Situation gefährlich.«
»Das könnte sein.«
»Papa glaubt, es macht nichts aus. Er ist der Meinung, Zivilisten und vor allem Frauen werden in Sicherheit sein, ganz gleich, was kommen wird. Was denken Sie? Werde ich in Sicherheit sein?«
Kerrs persönliche Meinung war, dass Bonneval mexikanischem Edelmut zu große Bedeutung zumaß. Oder aber der Mann interessierte sich nicht weiter für das Wohl seiner Tochter. Diese Frage kümmerte ihn aber genauso wenig wie die Reibereien zwischen den beiden. Er wollte von Bonneval nur die Zusage bekommen, dass er die zukünftige Braut begleiten sollte. Er brauchte diesen Auftrag, um nach Mexiko zu gelangen und sich Zutritt zu Rouillards Haus zu verschaffen – weiter nichts.
»Ich bezweifle, dass Ihr Vater Sie vorsätzlich in Gefahr bringen würde«, antwortete er bewusst diplomatisch.
»Sind Sie sich denn sicher, dass Sie selbst diese Reise unternehmen wollen?«
»Ich hatte von vornherein die Reise geplant. Da kann ich diese Gelegenheit nutzen, die sich mir hier bietet.« Das waren klare und deutliche Worte, doch Kerr verscheuchte sie aus seinem Gedächtnis, kaum dass er sie ausgesprochen hatte. Eine Lady von diesem Schlag war zweifellos an eine gewähltere Ausdrucksweise gewöhnt, ebenso an anmutige Komplimente sowie an Beteuerungen, dass ihr Leben in seiner Begleitung nicht in Gefahr war. Doch so zu reden war nicht seine Art. Er sprach die Dinge so aus, wie sie
ihm durch den Kopf gingen, und in der Mehrzahl der Fälle machte er sich auch keine weiteren Gedanken darüber.
»Es ist unwahrscheinlich, dass Monsieur Wallace Sorge verspüren wird, meine liebe Sonia«, erklärte ihr Vater mit einem Anflug von Ironie in seiner Stimme. »Immerhin ist er ein Fechtmeister.«
Die Lady zog die Hand zurück, als hätte sie glühende Kohlen angefasst. »Was?«
»Ein Fechtmeister mit einem eigenen Salon an der Passage de la Bourse, die von der Rue St. Louis bis zur …«
»Ich weiß, wo sie verläuft! Aber das kann doch nicht dein Ernst sein!«
»Aber bitte, ma chère, du wirst doch nicht geglaubt haben, ich würde dem erstbesten Mann den Auftrag geben, für deinen Schutz zu sorgen! Du solltest erfreut darüber sein, dass du einen Experten im Umgang mit der Klinge an deiner Seite hast, einen Gentleman, der mit der Gefahr vertraut ist, von der du ja so fest ausgehst, dass sie auf dich lauert.«
»Verspotte mich nicht, Papa! Wie kannst du nur glauben, ein solcher Mann wäre akzeptabel? Aber das glaubst du auch gar nicht, denn du weißt, er genügt nicht.«
Die Lady schien vor Kummer wie erstarrt, die geballten Fäuste drückte sie an ihre Seiten, und ihre Wangen waren so rot, als würden sie jeden Moment in Flammen aufgehen. Ihre Augen funkelten so sehr, dass man meinen konnte, Blitze müssten aus ihnen hervorschießen. Und ihre Lippen presste sie so sehr aufeinander, dass sie nur noch eine schmale, blasse Linie bildeten. Es war ein interessantes Spektakel, insbesondere mit Blick auf ihre Brüste, über denen die Seide ihres Mieders bis zum Zerreißen gespannt war.
Kerr trat einen Schritt zurück und verschränkte die Arme, während er abwartete, wie sich die Situation entwickeln würde. Über die Tatsache, dass ihre Ablehnung ihn auf eine sonderbare Weise schmerzte, wollte er dabei nicht nachdenken.
Ihr Vater beugte sich über den Schreibtisch, seine Fingerspitzen ruhten auf der polierten Tischplatte. »Er ist ein Gentleman, der die besten Referenzen vorweisen kann, darunter die persönliche Empfehlung des Conde de Lérida.«
»Der selbst auch einmal ein Fechtmeister war und deshalb mit seinesgleichen mitfühlte. Nein und nochmals nein! Wallace ist ganz offensichtlich ein flegelhafter Kaintuck ohne jegliche Manieren. Eine Stunde in seiner Gesellschaft wäre unerträglich, von mehreren Tagen ganz zu schweigen.«
»Beherrsch dich, Sonia. Der Gentleman ist Gast in diesem Haus.«
»Ich habe ihn nicht eingeladen, und ich ertrage den Gedanken nicht, von jemandem wie ihm auf meiner Reise nach Vera Cruz begleitet zu werden. Jean Pierre wäre so entsetzt wie ich.«
»Und was ist mit diesem Krieg, von dem du ständig redest? Meinst du etwa, ein Dandy, der gut Walzer tanzt und dein hübsches Gesicht lobt, würde etwas taugen, wenn es zu einem Kampf kommt? Da du es nicht kannst, müssen eben dein Verlobter und ich praktisch denken.«
»Ganz bestimmt gibt es jemanden mit besseren Manieren und mehr Stil – zumindest aber jemanden, der nicht so tölpelhaft ist und sich allein auf seine Muskeln verlässt.«
»Wie ich schon sagte, sind das Aussehen und das Benehmen deiner Eskorte nicht von Bedeutung. Ich muss dich ja wohl nicht daran erinnern, dass er dich zu deinem Vergnügen begleitet.«
Er sagte noch mehr, doch davon bekam Kerr kaum noch etwas mit. Zu ihrem Vergnügen. Die Bilder, die bei diesen Worten vor seinem geistigen Auge entstanden – ihre milchig weißen Oberschenkel, die sich ihm öffneten, zarte Hände, die nach ihm griffen, alles begleitet von leisen Seufzern und unterdrücktem Stöhnen –, sollten von der Kirche verboten werden, aber vermutlich waren sie das auch. Sie bewirkten, dass ihm sein Hemdkragen zu eng vorkam und sein Kopf
anzuschwellen schien. Er atmete tief durch, um das in den Griff zu bekommen, was zweifellos unziemliche Reaktionen auf diese Frau und die Situation waren.
»Aber sein Französisch, Papa! C’est atroce! Einfach schrecklich! Ich würde verrückt werden, müsste ich ihm über längere Zeit zuhören. Und wie peinlich es für mich wäre, ihn an meiner Seite zu haben, sodass jeder sehen kann, er ist meine Eskorte. Ich kann dir gar nicht sagen, wie unangenehm mir das wäre.«
Im ersten Augenblick hatte die Lady Kerr tatsächlich noch leidgetan. Mit einem Mann wie Rouillard verheiratet zu werden und die eigene Familie zu verlassen, um in einem fremden Land zu leben, konnte für sie nicht leicht sein. Aber vielleicht gab es einen Grund dafür, dass sie noch nicht verheiratet war. Und möglicherweise war ein zänkisches Weib wie sie genau die Richtige für einen Bastard wie Rouillard.
»Dann sag es mir auch nicht. Sag mir einfach gar nichts mehr.« Monsieur Bonneval warf seiner Tochter einen missbilligenden Blick zu, während er sich mit vor Wut gerötetem Gesicht über seinen Schreibtisch beugte. »Da du kein akzeptables Verhalten an den Tag legen kannst, wirst du uns sofort verlassen.«
»Aber Papa!«
»Auf der Stelle, Sonia.«
Das war ein klarer Befehl. Die Lady presste die Lippen aufeinander, während sich ihre Brust bei jedem aufgebrachten Atemzug hob und senkte. Sie warf ihrem Vater und Kerr einen letzten zornigen Blick zu, dann wirbelte sie herum und stürmte wutschnaubend aus dem Arbeitszimmer. Hinter ihr fiel die Tür laut ins Schloss.
Die anschließende Stille hielt nur Sekunden an, erschien aber wie eine halbe Ewigkeit. Bonneval drückte Zeigefinger und Daumen auf seinen Nasenrücken und hielt die Augen geschlossen. Mit einem Mal wirkte er um zehn Jahre gealtert.
Dann schüttelte er den Kopf und machte eine wegwerfende Geste.
»Sie müssen meine Tochter entschuldigen, Monsieur Wallace. Seit über fünfzehn Jahren ist sie ohne den besänftigenden Einfluss einer Mutter. Ich fürchte, ihre Tante, die den Platz meiner geliebten Frau als Sonias Anstandsdame einnahm, hat sie zu oft das tun lassen, wonach ihr der Sinn stand. Die Ehe mit Monsieur Rouillard wird diesem lachhaften Eigenwillen ein Ende setzen – ein Grund mehr, jede weitere Verzögerung zu vermeiden.«
Diese Lösung war nach Kerrs Ansicht maßlos übertrieben, und das fand er sogar trotz seiner verletzten Gefühle. Aber natürlich ging ihn das alles nichts an. »Sie scheint entschlossen, mich nicht als ihren Begleiter zu akzeptieren.«
»Sie scheint gegen jeden geeigneten Mann eingestellt zu sein. Nehmen Sie einfach keine Notiz davon. Ihre Aufgabe wird es sein, sie unversehrt zu ihrem zukünftigen Ehemann zu bringen, weiter nichts.«
»Ich hatte auch nichts anderes erwartet.«
Bonneval schürzte die Lippen. »Die Bemerkungen meiner Tochter könnten Sie zu der Ansicht gebracht haben, dass dieser Posten einen gesellschaftlichen Aspekt besitzt. Mich freut es, zu sehen, dass Sie sich der Grenzen bewusst sind.«
Mit anderen Worten, dachte Kerr ein wenig mürrisch, er sollte Mademoiselle Sonia Bonneval auf dem Schiff nicht zu nahe kommen. Aber da hatte ihr Vater nichts zu befürchten. Eher würde er mit einem Bärenweibchen flirten, bevor er sich dieser Lady zuwandte. »Heißt das, Sie bieten mir den Posten an?«
»Wenn Sie interessiert sind«, antwortete Monsieur Bonneval und nickte dabei ernst.
»Dann nehme ich an.« Kerr stand auf, streckte den Arm über den Mahagonischreibtisch hinweg, der sie beide voneinander
trennte, und wartete, dass sein Gegenüber einschlug, um den Vertrag zu besiegeln.
»Exzellent.« Bonneval ergriff seine Hand, wenn auch erst nach einem kurzen Zögern, als sei ihm die Geste nicht vertraut – oder als überrasche ihn Kerrs prompte Zusage. Der hatte schon vor einer Weile festgestellt, dass diese aristokratischen Kreolen sich gern mit allen Dingen Zeit ließen.
»Wann fange ich an?«
»Sofort, wenn Sie möchten. Die Lime Rock hat am Morgen am Anlegeplatz festgemacht. Treffen Sie alle Vorbereitungen, die Sie für nötig erachten, und dann halten Sie sich zur Abreise bereit, wenn sich das Schiff auf den Rückweg nach Vera Cruz macht.«
Die Zeit, die ihm damit noch zur Verfügung stand, war begrenzt – es ging nur um die wenigen Tage, die nötig waren, um die mitgebrachte Fracht zu löschen und neue an Bord zu nehmen. Kerr würde dafür sorgen, dass er mit dieser wenigen Zeit hinkam, da sich eine solche Gelegenheit sehr wahrscheinlich nicht wieder bieten würde. Jahrelang hatte er in New Orleans gewartet, ohne auch nur ein Wort von Rouillard zu hören. Und dann auf einmal fiel ihm die Chance einer reifen Frucht gleich in den Schoß, indem er die Braut dieses Mannes zu ihm bringen sollte. Er hatte befürchtet, mit seiner Bewerbung um den Posten zu spät zu kommen, doch wie es schien, war der dank der Halsstarrigkeit dieser Lady noch nicht besetzt worden. Dafür war er ihr zu großem Dank verpflichtet, ganz gleich, wie betrübt sie darüber war. Nichts würde ihn noch davon abhalten können, zusammen mit Mademoiselle Bonneval an Bord dieses Dampfschiffs zu gehen.
Kerr verabschiedete sich mit jener Förmlichkeit, die die Herzen dieser Franzosen höher schlagen ließ, unter denen er nunmehr seit vier Jahren lebte. Der Majordomus brachte ihm seine Sachen, darunter auch den Stockdegen, und ließ ihn nach draußen, die in das größere schmiedeeiserne
Tor der Durchfahrt eingefügt war. Kerr trat hinaus in die regnerische Nacht und sah nachdenklich drein, da er überlegte, was vor seiner Abreise alles noch zu erledigen war. Unter anderem musste er sicherstellen, dass er über genügend Hemden für die Seereise verfügte, ferner war es erforderlich, den Fechtsalon vorübergehend zu schließen. Er hatte fast die Häuserecke erreicht, an der die Gasflamme der kunstvoll verzierten Straßenlaterne hinter dem dicken Glas hin und her zuckte, als er plötzlich hinter sich Schritte hörte.
Abrupt drehte er sich um, seine kräftigen Muskeln bewegten sich geschmeidig, der aufgeknöpfte Mantel wirbelte um ihn herum. Der in seinem Stock verborgene Degen zischte, als Kerr ihn herauszog.
»Monsieur!«
Eine Mischung aus Wut und Erstaunen ließ Kerr einen Moment lang wie erstarrt dastehen, dann erst löste er sich aus seiner instinktiv eingenommenen Fechthaltung. Er steckte den Degen zurück in den Stock, nahm seinen Zylinder ab und hielt beides gegen seinen Mantel gedrückt.
»Es ist ein gefährliches Spiel, Mademoiselle Bonneval, wenn Sie sich um diese nachtschlafende Zeit von hinten einem Mann nähern. Das könnte leicht Ihren Tod zur Folge haben.«
»Das sehe ich.«
Ihr reizvolles, an die Form eines Diamanten erinnerndes Gesicht war blass, die Augen waren weit aufgerissen, doch sie schrak nicht vor ihm zurück. Sie hatte ein Cape über ihr Kleid gezogen und die Kapuze hochgeschlagen, damit sie ihr Gesicht vor dem Regen und vor den Blicken anderer Passanten verbergen konnte, doch sie machte keine Anstalten, sich unter dem Stoff zu verstecken. Mademoiselle Sonia Bonneval war eine kühne Lady, jedoch keine besonders vorsichtige.
»Sie wollten mich sprechen? Machen Sie’s am besten
schnell, da es Ihrem guten Namen schaden dürfte, mit mir auf der Straße gesehen zu werden.«
»Dessen bin ich mir bewusst.« Als Reaktion auf seinen ironischen Tonfall wurde ihre Stimme noch ein wenig frostiger. »Ich wollte … das heißt, ich möchte Sie bitten, den Posten abzulehnen, den mein Vater Ihnen anbot. Ich bin mir sicher, diese Reise ist für Sie mit großen Unannehmlichkeiten verbunden, und um ganz ehrlich zu sein, Mexiko ist derzeit nicht der Ort, an dem sich ein Amerikaner aufhalten sollte.«
»Ein Kaintuck, meinen Sie, richtig?«
»Ich entschuldige mich, dass ich Sie mit dieser Bezeichnung beleidigt habe. Und ich werde es noch tausendmal tun, wenn ich Sie davon überzeugen kann, meiner Bitte nachzukommen.«
Er gestattete sich ein zynisches Lächeln. Die Regentropfen liefen ihm bereits von den nassen Haaren über seine Schläfen. »Ich habe es gar nicht als Beleidigung aufgefasst, da ich zufälligerweise aus Kentucky komme. Doch worum Sie mich bitten, das muss für Sie eine sehr wichtige Sache sein.«
»Sie können sich gar nicht vorstellen, wie wichtig. All meine Hoffnungen hängen davon ab. Bitte! Ich flehe Sie an, lehnen Sie das Angebot ab.«
»Verraten Sie mir, warum ich das machen sollte.«
Lange sah sie ihn schweigend an, und während die Straßenlaterne in den Tiefen ihrer Augen ein bläulich violettes Feuer aufleuchten ließ, konnte er dort zugleich die Zweifel erkennen, die diese Lady plagten. Einen Moment lang nahm Kerr überdeutlich wahr, wie der Regen auf die Erde niederprasselte, wie ganz in der Nähe das Schild über dem Eingang zum Geschäft eines Schuhmachers leise knarrte, wie die feuchte Nachtluft einen Geruch nach Schlamm, frisch gebrühtem Kaffee und regennassen süßlichen Olivenblüten mit sich trug. Auch das Aroma der Lady stieg ihm in
die Nase – eine Mischung aus fein gemahlener Seife, Veilchen und dem Duft eines warmen, vom Regen durchnässten weiblichen Körpers. Seine Muskeln spannten sich an und zogen mit einer Gewalt an seinen Lenden, dass ihm Tränen in die Augen traten.
Endlich antwortete sie, doch es hörte sich an, als würde ihr jemand jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen. »Ich will nicht heiraten, und vor allem verspüre ich nicht den Wunsch, die Ehefrau von Monsieur Rouillard zu werden.«
»Kann es sein, dass Sie ihn näher kennen?« Er wollte kein Mitgefühl mit ihr verspüren, er wollte sich davon nicht in seiner Entscheidung beeinflussen lassen.
»Ich bin ihm nur ein einziges Mal begegnet, und er machte auf mich einen äußerst unangenehmen Eindruck.«
»Eine eindrucksvolle Anklageschrift«, meinte er ironisch. »Es könnte doch sein, dass er sich geändert hat.«
»Das ist eher unwahrscheinlich.« Dann presste sie die Lippen aufeinander – eine untrügliches Zeichen für ihren Unwillen, mehr als das zu sagen. Ihr Blick schien den Regentropfen zu folgen, die ihm über die Wange und den Hemdkragen liefen.
»Aber Sie wissen es nicht mit Sicherheit.«
»Ich weiß, er versäumte es, sich mit seinem Heiratsantrag an mich zu wenden. Stattdessen ließ er lediglich meinen Vater wissen, er wünsche mich zu heiraten, und teilte ihm das Datum mit, wann ich bei ihm eintreffen solle.«
»Wie anmaßend.« Unwillkürlich umfasste Kerr seinen Stockdegen fester, als Erinnerungen wach wurden an die Machenschaften dieses Gentleman, die sogar noch arroganter und egoistischer waren. Untaten wie zum Beispiel Lügen, Betrügen, Stehlen und seine Freunde dem Tod zu überlassen.
»Er ist das übersteigerte Selbstbewusstsein in Person … »Mitten im Satz hielt sie inne, holte tief Luft und sah sofort
zur Seite, als sich ihrer beider Blicke trafen. »Aber das ist es nicht, worum es mir geht. Ich werde nicht nach Mexiko reisen und den Mann nicht heiraten, also brauche ich auch keine Eskorte, keinen Beschützer oder wie immer Sie sich auch nennen mögen. Es gibt keinen Posten, der besetzt werden müsste. Sie können sich die Mühe sparen, sich reisefertig zu machen, nur um dann zu erfahren, dass Ihre Dienste nicht benötigt werden.«
»Ihr Vater scheint das anders zu sehen.«
»Mein Vater befindet sich im Irrtum.«
Sekundenlang schwieg er. Der Regen wurde heftiger. Kleine Sturzbäche sammelten sich im Rinnstein neben dem Bürgersteig, das Wasser ergoss sich von einem Balkon auf die Straße und schüttete schier endlos vom Himmel herunter. Der Regen durchnässte die Vorderseite ihres Capes, sodass sich der Stoff eng an ihre Brüste schmiegte, während die kalte Nässe bewirkte, dass sich unter der dunkelroten Seide ihre Brustspitzen versteiften. Der feine Stoff würde vom Regen ruiniert werden, doch das schien sie nicht zu kümmern.
Zumindest vermutete er, dass Kälte und Regen bei ihr diese Reaktion hervorriefen. Er hielt es für sehr unwahrscheinlich, seine Gegenwart könnte etwas damit zu tun haben.
Mit nachdenklicher, aber leicht bemühter Stimme sagte er: »Soweit ich das beobachten konnte, haben die wenigsten Töchter von Ihrem Schlag bei diesen Vereinbarungen etwas mitzureden.«
»Von meinem Schlag?« Sie reckte das Kinn und starrte ihn an.
»Die Franzosen, die hochrangigen Ladys und Gentlemen dieser schönen Stadt, die – wie nennen Sie sich selbst noch gleich? Ach ja, die crème de la crème. Oder vielleicht auch lieber die Sorti de la cuisse de Jupiter. Diejenigen geschaffen aus dem Oberschenkel des alten Jupiter persönlich,
um sagen zu können, dass sie von den Göttern abstammen.«
»Sie verachten uns, und in Ihrer Arroganz halten Sie sich für etwas Besseres.«
»Zumindest für etwas Gleichrangiges.«
Sie warf den Kopf in den Nacken, wodurch die Kapuze auf ihre Schultern rutschte und der Regen ihre Haare durchnässte. »Es ist schon gut, dass Sie mit mir nirgendwohin reisen werden.«
In ihrer Geringschätzung war sie so herrlich, wie sie in ihrer Verachtung wundervoll war. In diesem Moment wünschte er sich nichts mehr, als sie in seine Arme zu nehmen und diese Geringschätzung und Verachtung von ihren Lippen ebenso zu vertreiben wie aus ihren Augen und dem Herzen. Er sehnte sich danach, sie zu berühren, zu fühlen, wie sie sich an ihn schmiegte und auf ihn so reagierte, wie sie ohne Zweifel auf jenen Gentleman reagieren würde, den sie heiraten sollte. Er wollte in ihren Augen würdig sein, er wollte von ihr als tapfer wahrgenommen werden, um selbst einen Platz zwischen den Göttern und Göttinnen einzunehmen.
Er wurde aus seinen absurden Träumereien geholt, als er sah, dass ihr schwarze Rinnsale über die Wangen liefen. Blinzelnd wollte er einen von ihnen mit dem Daumen wegwischen, doch als er sie berührte, sammelte sich die Schwärze an der schwieligen Außenseite seines Fingers. Ihre Haut … oh, ihre Haut war kühl und fest, zugleich aber so zart, dass seine Zunge sich danach verzehrte, über diese Haut zu streichen und sie zu kosten.
»Sie weinen schwarze Tränen«, sagte er und stellte fest, dass seine Stimme ungewohnt belegt klang.
»Ich weine nicht!«, gab sie zurück und schlug seine Hand weg, wobei die schwarze Farbe auf ihrer Wange verschmiert wurde. Fasziniert sah er sie an, bis ihm bewusst wurde, dass es sich um Schminke handelte, die sich
im Regen aufzulösen begann. Er hatte davon gehört, dass französisch-kreolische Ladys sich schminkten, aber gesehen hatte er das bislang nur bei den Schauspielerinnen und Operndiven im Theater. Mademoiselle Bonneval dagegen musste nicht auf solche Kniffe zurückgreifen, das konnte er ihr deutlich ansehen. Dass nun diese Schminke zerfloss, wirkte auf ihn erheiternd, auf eine gewisse Weise aber auch anrührend, weil es ihn an einen traurigen Clown erinnerte.
»Hören Sie, es tut mir leid, dass Sie gegen Ihren Willen verheiratet werden sollen«, sagte er so sachlich, wie er konnte. »Aber ich kann daran nichts ändern. Ich wurde angeheuert, um einen Auftrag zu erledigen, mehr nicht.«
»Es tut Ihnen leid?«, wiederholte sie, wobei ihre Augen glühten. »Ich spucke auf herzloses Leid, auf ein Leid, das zu beenden Sie nicht einmal versuchen wollen.«
Den Teufel würde er tun. Seine Aufgabe war es lediglich, sie zu ihrer Hochzeit zu begleiten, und was dann kam …
Nun, was dann kam, da konnte er für nichts garantieren.
»Tun Sie, was Sie tun müssen, Mademoiselle Bonneval. Aber für mich ist nur Ihr Vater derjenige, der mich aus unserer Vereinbarung entlassen kann.« Er setzte seinen Hut auf und rückte ihn zurecht, ehe er eine knappe Verbeugung beschrieb. »Bis dahin freue ich mich schon auf unsere gemeinsame Reise.«
Drittes Kapitel
Sonia durchschritt den von Säulen flankierten Eingang zum Hotel Saint Louis und blieb unter der hohen Bleiglaskuppel der berühmten Rotunde stehen. Mondlicht fiel durch das riesige Glasgebilde in über sechzig Fuß Höhe und sorgte trotz der Gaslampen auf dem Marmorfußboden für ein farbenprächtiges Muster. Dutzende von Menschen eilten im Foyer umher – hauptsächlich Männer, auch wenn ein paar von ihnen in Begleitung von Ladys in Abendkleidern waren. Ihre Stimmen wurden von den ebenfalls mit Marmor verkleideten Wänden des großzügig geschnittenen Rundbaus zurückgeworfen und vermischten sich mit den Klängen eines Streichquartetts im ersten Stock, das eine solche Geräuschkulisse erzeugte, dass man kaum sein eigenes Wort verstehen konnte. Sonias Tante Lily flüsterte ihr etwas zu, während sie sich an ihrem Arm festhielt, doch obwohl ihr Atem über Sonias Ohr strich, hatte sie keine Ahnung, was ihre Tante da redete.
Vor ihnen lag die breite Treppe, die hinauf in den ersten Stock und damit zum Ballsaal führte, einem der schönsten in der ganzen Stadt. Sie bewegten sich auf diese Treppe zu und hielten sich ständig vor Augen, dass wegen des stützenden Krinolins in ihren Röcken ein breiter freier Weg vonnöten war, wenn sie vorankommen wollten. Im Foyer hing ein Geruch, eine Mischung aus kaltem Zigarrenrauch und Schweiß, die daran erinnerte, dass dieser Ort für gewöhnlich Schauplatz geschäftlicher Angelegenheiten war, an dem man jeden zweiten Samstag Auktionen veranstaltete. Gehandelt wurde dort alles von Aktien und Pfandbriefen, über Land und
Eigentum bis hin zu Schiffsladungen und Sklaven. Sonia rümpfte darüber die Nase, gleichzeitig hob sie ihre Röcke weit genug an, um den Fuß auf die erste Stufe der Treppe zu setzen.
»Da drüben. Hast du gesehen?« Tante Lily zog ruckartig an ihrem Arm und redete hastiger auf sie ein. »Sieh jetzt nicht hin, aber ich bin mir sicher, das da ist dein Kaintuck.«
Der Wunsch, sich sofort umzudrehen, war fast übermächtig. Doch Sonia ging entschlossen Stufe für Stufe weiter nach oben und geduldete sich, bis die elegant geschwungene Treppe es ihr erlaubte, den Blick über das weitläufige Foyer in die von ihrer Tante angedeutete Richtung schweifen zu lassen.
Monsieur Kerr Wallace war schnell ausfindig gemacht. Er überragte die meisten Gentlemen um einen Kopf und war ein Riese von einem Mann, womit er zweifellos gut in die gewaltigen Gebirgslandschaften seiner Heimat passte. Seine Abendkleidung war dem Anlass angemessen, das Haar glänzte im Gaslicht wie poliertes Leder. Mit Blicken aus Augen so dunkel wie die Nacht verfolgte er wachsam ihr Vorankommen auf der Treppe.
Sonias Herz schien einen Schlag lang auszusetzen. Die Wärme in der Rotunde kam ihr auf einmal so intensiv vor, dass ihr die Luft wegblieb, und irgendwo tief in ihrem Inneren regte sich ein verworrenes Durcheinander aus Wut, Verzweiflung und Faszination.
Erst als sie von ihrer Tante angestoßen wurde, begriff sie, dass sie stehen geblieben war. Zum Glück hielt sie sich mit einer Hand am Geländer fest, sonst wären sie beide hingefallen, was peinlicher nicht hätte sein können.
»Pass auf, ma petite«, rief ihre Tante aus, als sie ihr Gleichgewicht wiedererlangte. »Aber ich habe doch recht, oder? Ist er das? Ich frage mich, was er hier zu suchen hat.«
»Wir sind in einem öffentlichen Hotel. Ich vermute, er darf besuchen, wen immer er möchte.«
»Da fällt mir ein, die Straße der Fechtmeister ist so gut wie um die Ecke. Zweifellos nutzen sie oft den Speisesaal des Hotels.« Ihre Tante beugte sich vor. »Ich muss sagen, er ist ein wunderbarer Mann. Und sieh dir nur den Gentleman neben ihm an. Magnifique, möchte ich sagen, wenn auch auf eine wilde Art.«
Ihre Tante neigte dazu, die meisten Männer auf die eine oder andere Weise als wunderbar zu bezeichnen, doch der Gentleman, der sich mit Monsieur Wallace unterhielt, war tatsächlich ungewöhnlich anzuschauen. Seine Haut hatte einen kupfernen Farbton, ganz im Gegensatz zu dem olivefarbenen Teint jener Gentlemen, die Sonia kannte, und anders auch als die gebräunte Haut des Mannes aus Kentucky, die sich am ehesten mit dem Parkettboden vergleichen ließ. Die Augenbrauen dieses Fremden waren buschig und ausdrucksstark, die Nase so schmal wie eine Klinge, das Kinn unerbittlich kantig, das Haar so schwarz, dass es einen bläulichen Schein bekam. Da er so groß war wie Wallace, ragten die beiden aus der Menge heraus wie zwei unerschütterliche Eichen, die von einer Flut umspült wurden.
»Es sieht so aus, als sei er …«, setzte Sonia nachdenklich an.
»Aber ja. Es heißt, in seinen Adern fließt das Blut der einstigen Führer des Stammes der Natchez, auch wenn er als Kind von Priestern getauft wurde. Man gab ihm den Namen Christien Lenoir, doch er wird Faucon oder Falke genannt, weil dies die Bedeutung seines Namens in seiner eigenen Sprache war.
»Du scheinst ja einiges über ihn zu wissen.«
Das Lächeln ihrer Tante war ein klein wenig betreten. »Ich holte gestern Morgen Erkundigungen ein, da mich das plötzliche Interesse gepackt hat, über alles und jeden Bescheid zu wissen, der irgendetwas mit Monsieur Wallace zu
tun hat. Die Damen meines Stickkränzchens sind ein wahrer Quell an Informationen.«
»Das kann ich mir vorstellen.« Zu gern hätte Sonia erfahren, was man sich denn so über Wallace erzählte, doch das konnte noch warten. Im Augenblick zählte nur, nicht dazustehen, zu gaffen und zu tuscheln, als wäre sie eine Mademoiselle vom Lande. Auch wollte sie dem Gentleman aus Kentucky nicht die Genugtuung geben, seine Anwesenheit könnte für sie von Bedeutung sein. Sie griff nach den Enden ihres Schultertuchs und nahm sie zusammen mit ihrem Fächer in eine Hand, dann hob sie mit der anderen ihre Röcke aus blassblauer Seide an und drehte dem Mann den Rücken zu.
Was Monsieur Wallace tat und wohin er sich begab, war ihr wirklich egal, überlegte sie, als sie die Treppe weiter hinaufging. Von diesem Mann würde sie sich nirgendwohin eskortieren lassen. Sie hatte sich einen Plan zurechtgelegt, und nichts und niemand würde sich ihr in den Weg stellen können, schon gar nicht dieser Tollpatsch von Amerikaner, auch wenn er noch so Furcht einflößend groß war.
Der Gesichtsausdruck, mit dem er sie betrachtete, hatte etwas Besitzergreifendes an sich, als sei sie ihm über jeden Schritt Rechenschaft schuldig. Wohin sie ging und was sie tat, ging ihn nichts an. Ihr Vater mochte ihr Wohl in die Hände dieses Mannes gelegt haben, doch sie selbst hatte seine Vormundschaft nicht akzeptiert.
Aber auch wenn der Verstand ihr das sagte, hatte eine nervöse Spannung sie erfasst, und ein heftiges Unbehagen regte sich in ihrer Brust, als stünde sie am Rand einer Klippe. Sie konnte sich nicht daran erinnern, sich je so verwirrt gefühlt zu haben.
Der Ball an diesem Abend unterschied sich auf den ersten Blick in nichts von anderen derartigen Veranstaltungen. Auf dem Podest spielte ein Streichquartett, Rosenduft erfüllte die Luft, die Gentlemen trugen dunkle Abendanzüge,
die Ladys bildeten ein pastellfarbenes Kaleidoskop aus Seidenkleidern. Dutzende solcher Bälle hatte es während der sich nun dem Ende zuneigenden saison des visites gegeben, einige davon in diesem, andere in den Ballsälen anderer Hotels hier im Vieux Carré ebenso wie im amerikanischen Viertel, für das sich allmählich der Name Garden District durchsetzte.
Eine Gruppe Gentlemen gab jeder einen gewissen Betrag, um den Ballsaal zu mieten, ließ ihn schmücken, sorgte für Erfrischungen und stellte Dienstpersonal ein, das sich um das Aufkommen an Kutschen ebenso kümmerte wie um das Wohl und die Sicherheit der Gäste. Diese Gäste wählten die einladenden Gentlemen nach ihrem Ermessen aus, wobei die nächsten Angehörigen auf der Liste zuoberst standen, gefolgt von Freunden und deren Ladys und schließlich von weiteren Bekannten. Eine solche Einladung wurde nur selten ausgeschlagen, weil ganz New Orleans geradezu verrückt nach Tanzen war, vor allem nach Walzern, von denen Woche für Woche neue Variationen aus den Ballsälen von Paris und Wien gespielt wurden.
Für gewöhnlich begegnete man auf jedem Ball den gleichen Leuten, da jeder die crème de la crème einlud. Doch als sich Sonia nun umschaute, musste sie feststellen, dass ihr kaum ein Gesicht vertraut war. Es war auffallend, aber wohl auch nachvollziehbar. Mardi Gras und Fastenzeit waren bereits vorüber, und die Palmenwedel, die vom Priester zu Ostern gesegnet und sorgfältig hinter Spiegel und Bilderrahmen gesteckt worden waren, sammelten sich längst auf dem Fußboden. Jetzt, da die Tage wieder wärmer wurden, waren einige Fälle von Fieber gemeldet worden. Viele Leute hatten ihre Sachen gepackt, um auf ihre Plantagen auf dem Land zurückzukehren oder um auf Reisen zu gehen und Kurorte wie Saratoga und White Sulphur Springs oder ferne Ziele wie Paris, Rom oder Wiesbaden
zu erleben. Sogar ihr Vater plante eine Geschäftsreise nach Memphis.
Niemand trat vor, um Sonia und ihre Tante zu begrüßen, nicht eine Bekannte war in der Menge auszumachen. Die meisten Gäste um sie herum bewegten sich für gewöhnlich am äußersten Rand der besseren Gesellschaft. Sie erkannte eine geschiedene Frau wieder, die nur selten in ein Haus eingeladen wurde, das etwas auf sich hielt. Dort war ein Plantagenbesitzer, der wegen seiner Vorliebe für purpurrote Seidenhemden und gut aussehende Jungs viele Jahre im Exil in Havanna verbracht hatte. Und da drüben stand eine ältere Witwe, der man nachsagte, sie habe ihren zweiten Ehemann schockierend kurz nach der Eheschließung bereits zu Grabe getragen. Anwesend war auch der berühmte Fechtmeister und Duellist Pépé Llulla, gefällig und todbringend, sowie sein italienisches Pendant Gilbert Rosière. Wo immer diese beiden auftauchten, teilte sich vor ihnen wie durch ein Wunder die Menschenmenge, um eine breite Gasse zu bilden, und sobald sie hindurch waren, schlossen sich die Reihen wieder.
Eben erst hatte es Sonia zu dämmern begonnen, in welcher Situation sie sich hier befanden, da tauchten Monsieur Wallace und sein Freund mit der kupferfarbenen Haut am Eingang zum Ballsaal auf. Sie zeigten ihre Einladungen vor, dann nahm man ihnen Hut und Stockdegen ab und ließ sie eintreten, als würden sie hierher gehören.
»Tante Lily«, setzte Sonia an. »Ich glaube …«
»Ich weiß, chère, keiner von den Kreisen, in denen wir üblicherweise verkehren. Aufregend, nicht wahr?« In den Augen ihrer Tante sah sie ein freudiges Funkeln, während sie ihren Fächer aus schwarzer Spitze lässig hin und her bewegte.
»Papa wird außer sich sein.«
»Aber warum sollte er? Dein Beschützer ist ebenfalls anwesend. Wenn dein Papa einen solchen Mann engagiert, damit
er dich zu deiner Hochzeit begleitet, dann kann er wohl kaum etwas dagegen einwenden, dass du einen Abend in seiner Gesellschaft verbringst.«
»Ich bezweifle, dass er so vernünftig darüber denken wird. Aber dich scheint das alles gar nicht zu überraschen.«
»Sagen wir, ich hatte eine Ahnung, wie dieser Abend verlaufen würde«, stimmte ihre Tante in verschwörerischem Tonfall zu. »Immerhin handelt es sich bei den Schirmherren um vier ehemalige, angesehene Fechtmeister. Es sind der Conde de Lérida sowie die Messieurs Pasquale, O’Neill und Blackford. Da sie französisch-kreolische Ladys heirateten, sind aus ihnen in den letzten Jahren respektable Gentlemen geworden. Aber so war es ja schon immer, musst du wissen. Selbst die Spanier, die vor Jahrzehnten als Eroberer herkamen, wurden erst von der Gesellschaft akzeptiert, nachdem sie eine Frau aus unseren Reihen geheiratet hatten.«
»Das war mir nicht bewusst … ich meine, wer liest auch schon die Auflistung der Schirmherren durch?« Sie erkannte jetzt auch die vier Gentlemen, nachdem ihre Tante sie auf sie aufmerksam gemacht hatte. Es waren eindrucksvolle Männer, die mit ihren Ladys zwanglos nahe dem Kamin beisammenstanden und ihre Gäste begrüßten. Die Gruppe lachte und unterhielt sich ausgelassen untereinander, was auf eine ausgeprägte Kameradschaft zwischen ihnen schließen ließ. Ein Grund für ihre Belustigung waren allem Anschein nach die raffiniert geschneiderten Kleider der beiden Frauen, die unübersehbar ein Kind erwarteten.
Mancher hätte gesagt, sie sollten in diesem Zustand besser zu Hause bleiben, doch die Meinung anderer schien ihnen gleichgültig zu sein, was sich auch an ihrer Wahl des Ehemanns und der Gäste zeigte.
Ihre Tante machte eine verwunderte Miene, als sie Sonias reglosen Gesichtsausdruck bemerkte. »Die ganze Saison hindurch hast du dich darüber beklagt, wie sehr dich die üblichen Bälle und die übrigen Veranstaltungen langweilen.
Deshalb dachte ich, dieser Abend könnte dein Interesse wecken. Außerdem wirst du bald verheiratet sein, daher musst du deinen Horizont erweitern, chère. Ich hege starke Zweifel, dass Jean Pierre so nette Bekannte hat wie dein Papa.«
In dem Punkt musste Sonia ihrer Tante zwar recht geben, doch letztlich war egal, mit wem ihr Verlobter Umgang hatte, da sie ohnehin nicht an seiner Seite sein würde, um sie zu empfangen.
»Was glaubst du, wie wir auf die Gästeliste gelangt sind?«
»Ich habe keine Ahnung.« Ihre Tante hob die Schulter. »Vielleicht weiß einer der Gastgeber von deiner Verbindung zu Monsieur Wallace.«
»Meinst du nicht, wir sollten besser gehen?«
»Aber nicht doch. Das verspricht ein interessanter Abend zu werden, den ich für nichts in der Welt verpassen möchte. Und was die Frage des Anstands angeht – ich bin schließlich an deiner Seite, nicht wahr? Außerdem weiß ich, du wirst mich nicht allein lassen.«
»Selbstverständlich werde ich das nicht tun«, erklärte Sonia in treuer Ergebenheit. Um ehrlich zu sein, war es sogar recht aufregend, inmitten dieser schillernden Gesellschaft zu sein. Schon oft hatte sie sich gefragt, wie es fernab jener gesetzten Kreise sein würde, in denen sie sonst verkehrte. Ihre größte Sorge war, dass ihr Vater missbilligend darauf reagieren und ihr die wenigen Freiheiten, die ihr zugestanden waren, weiter beschneiden würde. Das käme ihr im Augenblick sehr ungelegen.
Was den Mann aus Kentucky anging, würde sie einfach so tun, als existiere er gar nicht. Das sollte ihr nicht weiter schwerfallen.
Tatsächlich erwies sich dieser Vorsatz als äußerst schwierig umzusetzen. Egal wohin sie auch sah, immer schien er sich irgendwo am Rand ihres Gesichtsfelds aufzuhalten, und
seine tiefe Stimme überlagerte stets das allgemeine Gemurmel. Es war zum Verrücktwerden.
Insgesamt versprach dieser Abend aber kaum eine Abwechslung von den Dutzenden anderen Bällen, die sie in diesem Winter besucht hatte. Die Musik war genauso lebhaft, die Dekorationen waren ebenso verschwenderisch, und an Speisen und Getränken wurde gleichfalls nicht gespart. Trotz der ungewohnten Gesellschaft behandelte man Sonia nicht wie ein Mauerblümchen. Kaum hatte sie sich auf einen Stuhl gesetzt und ihre Röcke um sich herum ausgebreitet, da wurde sie auch schon von einer ganzen Schar Gentlemen belagert. Denys Vallier, der Schwager des Conde de Lérida und ein mustergültiger Gentleman, stand dabei in vorderster Reihe, begleitet wurde er von seinen speziellen Freunden Albert Lollain und Hippolyte Ducolet. Die beiden Tänze mit ihr, die jeder von ihnen erbettelte, machten sich gut auf der Tanzkarte, die man ihr beim Hereinkommen überreicht hatte. Doch nachdem sie notiert waren, wurde Sonia wählerischer. Eine solche Karte zu füllen erforderte große Sorgfalt. Zwar sollte eine Lady darauf Lücken vermeiden, dennoch konnte es sein, dass sie den einen oder anderen Tanz frei halten wollte für den Fall, dass ein besonders angenehmer Gentleman erst mit Verspätung an sie herantrat.
Ein paar Mal betrat Wallace auch die Tanzfläche, was ihr nicht entging, wobei er jedes Mal mit der Ehefrau des einen oder anderen Freundes den Walzer tanzte. Er war nicht so tollpatschig, wie sie angenommen hatte. Vielmehr schien es ihm sogar Spaß zu machen, vor allem wenn er seine Partnerin drehen und ihre Röcke wirbeln lassen konnte. Dabei sorgte seine körperliche Kraft dafür, dass sie nicht den Halt verlieren konnten. Insgeheim wünschte sich Sonia, er würde auch sie um einen Tanz bitten, aber natürlich nur, weil es ihr eine Freude gewesen wäre, ihm einen Korb zu geben.
Bei ihrem zweiten Tanz mit Hippolyte – einem Sportsmann,
bekannten Possenreißer und Bonvivant, der nur wenige Fingerbreit größer war als sie und bereits die rundlichen Konturen ihres geschätzten Vaters annahm – bemerkte sie, wie sich ein Gentleman Monsieur Wallace näherte. Sie hätte davon keine Notiz genommen, jedoch war der vor Charme sprühende, ältliche Lebemann mit den spärlichen Locken nur Augenblicke zuvor mit ihrer Tante in ein Gespräch vertieft gewesen. Nun schien es so, als habe Tante Lily den Gentleman auf eine Mission geschickt. Der deutete auf den Alkoven, in dem die Lady sich aufhielt, deren Miene einen bittenden Ausdruck angenommen hatte.
Der Fluch, den Sonia murmelte, war so heftig, dass ihr Tanzpartner ein Stückchen zurückwich und sie ansah. »Ich bitte tausendmal um Verzeihung, wenn ich Ihnen auf die Zehen getreten sein sollte.«
»Nein, nein, es ist … ich wollte sagen, ich sah nur etwas sehr Überraschendes.«
»Nun, dann bin ich erleichtert. Ich weiß, ich kann ein rechter Tollpatsch sein, aber üblicherweise merke ich es, wenn ich einer Lady auf die Füße trete.« Er drehte sich so, dass er ihrer Blickrichtung folgen konnte, und sah den Fechtmeister neben dem Überbringer der Nachricht auf Tante Lily zugehen. »Sacre! Ihre Tante kokettiert mit Wallace. Weiß sie, wer er ist?«
»Da können Sie sich sicher sein. Zumindest dem Ruf nach weiß sie es.«
»Ihrer Tante gefällt es, neue Leute kennenzulernen«, meinte er höflich.
Das stimmte, vor allem wenn es sich dabei um Männer handelte. »Und es gefällt ihr auch, meinem Vater auf der Nase herumzutanzen.«
»Sie ist die Schwester Ihrer Mutter, richtig?«
»Sie sagen es.« Sonias Lächeln hatte einen ironischen Hauch.
Eine Zeit lang hatte sie geglaubt, ihr Vater und Tante
Lily könnten heiraten. So etwas war keineswegs ungewöhnlich, wenn die Schwester einer verstorbenen Ehefrau in den Haushalt kam, um sich der Kinder anzunehmen, die ohne Mutter waren. Damit wurde man nicht nur den Konventionen gerecht, wonach es nicht gern gesehen wurde, wenn eine ungebundene Frau im gleichen Haus lebte wie der Witwer. Man nahm auch an, dass sie für ihre Schutzbefohlenen eine natürliche Zuneigung empfinden würde. Dazu war es jedoch nicht gekommen. Tante Lily hielt ihren Schwager distanziert und reserviert, was nichts anderes heißen sollte, als dass er sich nicht zu ihr hingezogen fühlte. Ihr Vater wiederum sah in Sonias Tante eine Frau, deren Ansichten über die Kindererziehung und über den Platz der Frau in der Gesellschaft beklagenswert überspannt waren. Allein wegen Sonia war er bereit, ihre Art zu tolerieren. Bemerkenswert war jedoch, dass beide gleichermaßen die Unschicklichkeit der bestehenden Situation ignorierten, da sie sich beharrlich weigerten, einem solchen Unsinn bindende Bedeutung beizumessen.
Hippolyte schaute abermals zum Alkoven. »Wenn sie sich vorgenommen hat, Ihren Herrn Papa zu verärgern, wird es genügen, Wallace in seinem Stadthaus ein und aus gehen zu lassen.«
»Ich bezweifele, dass sie so weit gehen wird«, antwortete Sonia. »Wahrscheinlich ist sie nur neugierig. Aber kennen Sie den Gentleman?« Ihr erschien es nicht notwendig, ihn sofort wissen zu lassen, dass sie mit Monsieur Wallace bereits Bekanntschaft gemacht hatte.
»Ich bin mit ihm in der Louisiana Legion marschiert, und ein- oder zweimal stand ich ihm schon auf der Fechtbahn in seinem Salon gegenüber.«
Letzteres sagte einiges über ihren Tanzpartner aus, denn nur die besten Fechter wagten es, sich mit einem maître d’armes zu messen – sofern ihnen dieses Privileg überhaupt gewährt wurde. Hippolyte selbst musste einige Erfahrung
im Umgang mit dem Degen haben. »Dann hatten Sie einen guten Eindruck von ihm?«