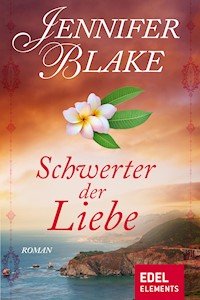Die Originalausgabe erschien unter dem Titel “Triumph in Arms"
Edel eBooks
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2015 Edel Germany GmbH
Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2010 by Jennifer Blake Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2010 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH.
Ins Deutsche übertragen von Roger Schöntag
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Inhaltsverzeichnis
TiteleiImpressumPrologErstes KapitelZweites KapitelDrittes KapitelViertes KapitelFünftes KapitelSechstes KapitelSiebtes KapitelAchtes KapitelNeuntes KapitelZehntes KapitelElftes KapitelZwölftes KapitelDreizehntes KapitelVierzehntes KapitelFünfzehntes KapitelSechzehntes KapitelSiebzehntes KapitelAchtzehntes KapitelNeunzehntes KapitelZwanzigstes KapitelEinundzwanzigstes KapitelZweiundzwanzigstes KapitelDreiundzwanzigstes KapitelVierundzwanzigstes KapitelFünfundzwanzigstes KapitelSechsundzwanzigstes Kapitel
Prolog
New Orleans, LouisianaApril 1847
Christien Lenoir wartete am Eingang des Théâtre d’Orléans. Die Daumen lässig in seinen Westentaschen und den Rücken an eine der dorischen Säulen gelehnt, war er bis aufs Äußerste angespannt. Die erhoffte Dame sollte jeden Augenblick erscheinen. Ein einziger Augenaufschlag würde ihm genügen, um zu entscheiden, ob er weitermachen oder die Angelegenheit auf sich beruhen lassen würde.
Während er noch in der Eingangshalle stand, strömte um ihn herum die High Society des Vieux Carré aus dem Theater und verlor sich in der feuchtwarmen Nacht. In kleinen Gruppen, bestehend aus Paaren mit ihren Anstandsdamen, Familien, Witwen und ledigen Herren, bewegte sich der Menschenschwarm an ihm vorbei, zurück in die Straßen der Stadt, eingehüllt in Gesprächsfetzen und das Summen der eben gehörten Melodie aus L’elisir d’amore. Die flackernden Gaslampen an den Arkaden der Eingangshalle verbreiteten ein warmes Licht, in dem die Juwelen, die Seiden- und Satinstoffe, der Samt sowie das feine Linnen der Operngäste glänzten. Auf der Straße spiegelte sich das Licht des Theaters in den Pfützen und auf den nassen Kutschen, deren fluchende Fahrer sich bereit machten, ihre Herrschaft wieder nach Hause zu bringen. Während der Vorstellung hatte es geregnet und die Wasserlachen, die sich auf dem unebenen Straßenpflaster gebildet hatten, kräuselten sich zu glitzernden Wellen, als die Kutschenräder und Pferdehufe durch sie hindurchpflügten.
Christien nahm Haltung an, denn plötzlich tauchte Madame Reine Marie Cassard Pingre in Begleitung ihrer kleinen Tochter auf. Sie kamen beide näher und gingen so knapp an Christien vorbei, dass er das Rauschen der seidenen Unterröcke hören konnte und den zarten Duft von Rosenwasser und Lavendel wahrnahm. Den Blick geradeaus gerichtet, schien Madame Pingre direkt die nahe gelegene Straßenecke anzuvisieren, wo sich die Rue d’Orléans mit der Rue Royale kreuzte.
Sie war wunderschön, so wie alle unerreichbaren Dinge besonders reizvoll und anziehend sind. Christien folgte ihr mit geschärftem Blick und fühlte ein Prickeln in seinem Nacken, dem Gefühl ähnlich, das er verspürte, wenn er einem unberechenbaren Gegner gegenüberstand.
Mutter und Tochter sahen einander verblüffend ähnlich. Die hellbraunen Haare zeigten einen Schimmer von Gold und endeten in lockigen Strähnen, die sanft über ihre zarten Wangen strichen. Ihre raffinierten Hochsteckfrisuren, geschickt von feinen Nadeln zusammengehalten, wurden durch einen Kopfschmuck von rosa Kamelien gekrönt. Beide hatten große, neugierige Augen, eine wohlgeformte Nasen und ein Kinn, das eine gewisse Entschiedenheit erkennen ließ. Ihre schlanken Körper waren von lavendelfarbenen Seidenstoffen umhüllt. Die eleganten, modisch geschnittenen Kleider ließen dabei jedoch kaum mehr die angemessene Trauer erahnen. Ihre gegenseitige Zuneigung war auf den ersten Blick zu erkennen. Madame Pingre blickte mit Liebe auf ihre wohl erst vier oder fünf Jahre alte Tochter hinunter, deren zarte, mit einem weißen Handschuh bekleidete Hand vertrauensvoll in der ihrigen lag.
Christiens Nerven waren bis aufs Äußerste angespannt. Die Straßenlaternen schienen heller zu leuchten als zuvor, die Nacht fühlte sich kühler an, und das Gemurmel der Opernbesucher kam ihm wie ein Tosen vor. Sein Herzschlag beschleunigte sich immer mehr, während sich in seinen Lenden ein stechender Schmerz breitmachte.
Er wunderte sich über diese plötzliche Regung seines Herzens. Als maître d’armes, einer der berühmtesten Waffenmeister der Stadt, waren seine Tage mit den typischen Aktivitäten, denen ein Mann nachzugehen pflegte, ausgefüllt. Dabei blieb wenig Zeit für weibliche Gesellschaft, schon gar nicht für den Umgang mit angesehenen Damen. Er hatte jeglichen Gefühlen abgeschworen und war darin geübt, ohne zarte Bande auszukommen. Derartige Anwandlungen verbannte er konsequent aus seinen Gedanken, denn er wollte einfach nicht der Sklave seiner Gefühle werden. Er glaubte, gegen den berühmten coup de foudre immun zu sein, diesem Donnerschlag der Liebe, der aus gestandenen Männern willenlose Narren machte.
Allerdings hatte er nicht die Kraft der weiblichen Anziehung berücksichtigt, ebenso wenig wie die Tatsache, dass er bereits seit geraumer Zeit alleine war. Dies könnte sich als verhängnisvolle Nachlässigkeit herausstellen.
Obwohl rein körperliches Verlangen nicht wirklich das Problem war, vermochte er es nicht, seine Augen von der Dame abzuwenden; er fühlte, wie es ihn nach ihrem Geruch dürstete, nach dem Gefühl, seinen Körper an ihrem zu spüren. Noch stärker aber war das brennende Verlangen, neben Mutter und Tochter zu stehen, sie nach Hause zu begleiten, sie zu beschützen und ein Teil ihrer kleinen Familie zu werden.
Christien schluckte, denn er hatte plötzlich das Gefühl, dass es ihm die Kehle zuschnüren wollte. Er war sich wohl bewusst, wer diese beiden waren, welchen Status Mutter und Tochter innerhalb der französischen Gesellschaft von New Orleans hatten, und dass er aufgrund seiner Herkunft in ihrem engen Bekanntenkreis keinen Platz haben konnte. Das Gefühl, ausgeschlossen zu sein, war nicht neu für ihn, doch in diesem Fall machte es sich besonders schmerzvoll bemerkbar.
Madame Pingre war nun schon das zweite Jahr verwitwet, sodass sie nun langsam die zur Schau getragene Trauer ablegen konnte. Das Gemunkel über den Tod ihres Mannes war Christien nicht unbekannt. Es kursierten Gerüchte über einen blutigen Mord, der ihr angeblich sehr gelegen kam. Sie gehörte durchaus zu der Sorte Frau, die einen Mann dazu bringen konnte, zu töten, um sie zu besitzen; doch noch glaubte er an ihre Unschuld, denn dies war die einzige Möglichkeit, die Angelegenheit erfolgreich zu Ende zu bringen.
Mutter und Tochter lebten in einem der Stadthäuser in der Rue Royale, in einer Zweitwohnung, die man sich für die saison des visites leistete, der jährlichen Flucht vom Landleben in die Ballsaison der Stadt, wo man mondäner Unterhaltung inmitten des aufkommenden Frühlings frönen konnte. Für die beiden ergab sich somit keine Notwendigkeit, mit den anderen Gästen der Oper herumzustehen und auf eine der Kutschen zu warten, die sich ihren Weg durch den Straßenschlamm bahnen mussten. Sie würden einfach auf dem noch etwas nassen Bürgersteig entlang nach Hause gehen.
Madame Pingres Aufmerksamkeit war ganz auf ihre Tochter gerichtet, und sie hatte für die anderen Leute
kaum einen Blick übrig. Sie schien sich in einer Aura der Zurückgezogenheit zu bewegen und dies auch zu bevorzugen.
Nichtsdestoweniger wäre eine männliche Begleitung angebracht, sinnierte Christien vor sich hin. Sicherlich müsste ihr Vater, Monsieur Cassard, in der Nähe sein, doch er verspätete sich, da er sich nicht von dem Gespräch mit seinen Bekannten lösen wollte. Auf diese Weise waren Madame Pingre und ihre Tochter für einen Augenblick ohne Schutz. Angesichts dieser Tatsache konnte Christien seinen Ärger und seine Besorgnis nicht verbergen.
Direkt vor ihr ging eine Witwe in einem moosgrünen Samtkleid und mit einer üppigen Perlenkette um den Hals, die sich spontan umdrehte und Madame Pingre einen freundlichen Gruß zurief. Diese errötete leicht und blieb stehen, um mit der Dame zu plaudern, wobei letztere wohl auch noch einige Beschwerden über die schauspielerische Leistung des soeben gehörten Tenors in einem Wortschwall über die beiden ergoss. Die kleine Marguerite Pingre stand indessen gelangweilt neben ihrer Mutter, schaute in die Gegend und schwang die Hand ihrer Mutter in großem Bogen hin und her.
Sie blickte spontan in die Richtung, in der Christien stand, vielleicht, weil dieser so angespannt die Situation beobachtet hatte. Sie blinzelte ihm zu, wandte sich dann aber in demonstrativ feierlichem Interesse der Unterhaltung der beiden Damen zu. Christien lächelte und beugte seinen Kopf in einer betont galanten Manier zum Gruße.
Die kleine Marguerite verzog die Mundwinkel nach unten und kehrte ihm wieder den Rücken zu. Sie schnappte sich die Finger ihrer Mutter mit beiden
Händen und drückte ihre Stirn gegen den gebauschten Bund ihrer weißen Opernhandschuhe. Für einige Sekunden versteckte sie auf diese Weise ihr Gesicht vor dem merkwürdigen Beobachter, dann aber riskierte sie doch wieder einen kurzen Blick über die Schulter.
Es schien Christien wie ein großer Sieg, viel schmeichelhafter als ein kokettes Zurschaustellen von unverhohlenem Interesse. Unwillkürlich musste er lächeln.
Der Blick der Kleinen wanderte umher. Plötzlich hielt sie in ihrer Bewegung inne und wurde ganz starr, die Farbe wich aus ihrem Gesicht, und mit einem schrillen Schrei befreite sie sich von der Hand ihrer Mutter. Mit flatternden Röcken und weißen Satinschuhen sprang sie vom Bürgersteig auf die Fahrbahn. In diesem Augenblick bog ein offener Zweispänner, gezogen von zwei prächtigen Apfelschimmeln, in raschem Tempo um die Straßenecke. Während die Kutsche auf das Theater zuraste, stand das Mädchen auf Zehenspitzen im Straßenschlamm und hielt eine kleine, verschmutzte Statue in der Hand.
Madame Pingre drehte sich alarmiert um und hielt angstvoll nach ihrer Tochter Ausschau. Ihre Augen weiteten sich vor Schreck, als sie ihre Tochter mitten auf der Straße entdeckte, direkt in der Fahrspur der heranstürmenden Karosse. Sie schürzte ihre Röcke und sprang, ohne zu zögern, vom Bürgersteig in den Schmutz der unbefestigten Straße.
Christien war jedoch ebenfalls bereits in Bewegung und bahnte sich seinen Weg durch die gaffende Menge. Die wild schnaubenden Pferde und den fluchenden Kutscher im Blick, stürmte er auf die Dame zu, während die Tiere in ungebremster Geschwindigkeit vorwärtsdrängten und an den Zügeln rissen. Mit seinen
langen, dank vieler Degenkämpfe gestählten Armen gelang es ihm, Madame Pingre an der Hüfte zu packen und sie zurückzureißen, just in dem Moment, als diese ihre Tochter zu fassen bekam. Christien hielt die beiden in eiserner Umklammerung fest, während er sich, Madame Pingre und das Mädchen auf die sichere Seite rettete, wobei er durch den ernormen Schwung mit voller Wucht auf dem Rücken zu Fall kam.
Schmutziges Wasser und Straßenschlamm spritzten neben ihm hoch. Für einen Moment drehte sich der Himmel über ihm, und die Anstrengung entlockte ihm ein tiefes Stöhnen, als er, die beiden an seine Brust gepresst, schließlich rücklings auf der dreckigen Straße landete. Sein Puls raste, und sein Herzschlag dröhnte in seinem Kopf, denn die vorbeifahrenden Räder der Kutsche streiften seine Haare, und er spürte die Vibration des über das Pflaster donnernden Fahrzeugs mit jeder Faser seines Körpers.
Das Geklapper der Hufe ließ langsam nach, als der Zweispänner am Ende der Straße endlich zum Stehen kamen.
Von irgendwoher ertönte das bewundernde Pfeifen eines Jungen, die Umstehenden nahmen ihre Unterhaltung wieder auf, sie riefen, schrien und applaudierten schließlich. Ein streunender Hund bellte seine Aufregung hinaus. Männer rannten auf die Straße, um den Verkehr anzuhalten. Die Leute strömten herbei und erkundigten sich, ob sie verletzt seien.
Christien konnte in diesem Moment den Trubel um ihn herum nur sehr verschwommen wahrnehmen. Sein Herz schien in seinem Brustkorb zu zerspringen, so heftig pochte es gegen seine Rippen. Madame Pingres wohlgeformte Gestalt war an ihn gepresst.
Erstes Kapitel
River’s Edge PlantageAugust 1847
»Es kommt jemand, Madame, Fremde kommen die Straße herunter!«
Reine Marie Cassard Pingre legte ihre Schreibfeder beiseite, als sie den Warnruf aus dem Parterre vernahm. Sie klappte das Kassenbuch zu, in das sie gerade die Rechnungen der Warenladung eingetragen hatte, welche am Morgen mit dem Dampfschiff der Plantage eingetroffen war. Sie erhob sich von ihrem Stuhl und starrte die Tintenkleckse auf ihren Fingern an. Sie sollte sich wohl besser beeilen und die Hände waschen, bevor sie hinunterging, um den ankommenden Besucher zu begrüßen.
Doch weshalb eigentlich der Umstand? Der eintreffende Monsieur war zweifellos nur ein Freund ihres Vaters. Sie würden sich auf der Veranda treffen, welche zu dieser Tageszeit angenehm im Schatten der alten Eichen lag. Mit einem Glas Madeira in der Hand würden die beiden in entspannter Atmosphäre den Preis der Baumwolle besprechen und wohl auch die neuesten politischen Skandale. Sie selbst könnte wieder an ihren Schreibtisch zurückkehren, sobald die üblichen Höflichkeiten ausgetauscht wären.
Reine streckte ein wenig ihre Glieder und begab sich zur Verandatür des Wohnzimmers, die bereits offen stand, um die frische Morgenluft hereinzulassen. Das Sonnenlicht flutete herein, und die weiß getünchten Bodenbretter des Balkons reflektierten die Strahlen des gleißenden Gestirns. Sie beschattete ihre Augen
mit der rechten Hand und blickte angestrengt die Zufahrtsstraße hinunter, welche sich in zahlreichen Kurven bis zum Fluss wand.
Ein Reiter näherte sich in gestrecktem Galopp der Veranda des Hauses, wobei er kleine Staubwolken aufwirbelte, die sich wie ein Kometenschweif hinter ihm herzogen. Von hohem Wuchs und mit breiten Schultern, saß er mit einer solch eleganten Lässigkeit im Sattel, als ob er nie etwas anderes gemacht hätte. Sein Gesicht war von einem breitkrempigen Strohhut, wie ihn die Plantagenbesitzer trugen, halb verdeckt, während seine Kleider durch einen langen, grauen Reitmantel vor dem aufwirbelnden Staub geschützt wurden. Er war noch zu weit entfernt, als dass man seine Gesichtszüge genau erkennen könnte, doch irgendetwas an ihm erschien seltsam vertraut.
Sie fühlte, wie ein kleiner Schauer über ihren Rücken jagte. Eigentlich war sie keine Frau von überschwänglicher Fantasie, doch nun schien sich der Himmel ein wenig zu verfinstern. Die Hitze des Tages legte sich und ließ sie auf unerklärliche Weise beunruhigt zurück.
Nichts als Grillen, die es zu verscheuchen gilt, sagte sie sich und wandte sich energisch ab. Sie fasste einen Entschluss und durchschritt eilig den Flur der ersten Etage, um über die Treppe ins Parterre zu gelangen.
Alonzo, der weißhaarige Butler, der schon vor ihrer Geburt eine Institution auf der River’s Edge Plantage war, erwartete sie bereits. Sie forderte ihn auf, nachzusehen, ob die nötigen Erfrischungen bereits auf die untere Veranda gebracht worden waren. Als er sich entfernte, um ihren Auftrag auszuführen, atmete sie tief durch und ging durch die Eingangstür hinaus. Sie
verlangsamte ihre Schritte, als sie die weiß glänzenden Säulen der Veranda erreicht hatte.
Der Besucher hatte gerade das kleine Tor erreicht, das die Zufahrt vom Haus und der dazugehörigen Gartenanlage abtrennte. Er war eindeutig kein Freund ihres Vaters, denn der Elan, mit dem er sich aus dem Sattel schwang, ließ auf einen Mann in den besten Jahren schließen, der es gewohnt war, seine Muskeln in Bewegung zu halten. Sein Auftreten verriet, dass es ihm nicht an Selbstbewusstsein mangelte, denn am Gartentor angekommen, warf er dem heraneilenden Stallburschen die Zügel in einer Art und Weise zu, als ob er nach Hause käme und nicht, als würde er einen Anstandsbesuch machen. Mit prüfendem Blick begutachtete er die sich im Wind wiegenden Zuckerrohrfelder, den Damm aus Grassoden gegen das Mississippi-Hochwasser und das große, glänzend weiße Herrenhaus inmitten des blühenden Gartens. Der Eigentümer selbst hätte nicht gründlicher seine Besitztümer auf Zeichen der Nachlässigkeit hin untersuchen können.
Alonzo, der seine Aufgaben ausgeführt hatte, trat auf die überdachte Veranda hinaus und blieb diskret hinter Reine stehen. Sie war ihm für seinen stillen Beistand unendlich dankbar. Die Ankunft von Chalmette, dem großen, dürren Jagdhund ihres Bruders, der von seinem Schattenplätzchen unter den Hortensien herbeigelaufen kam, trug ebenfalls dazu bei, ihr Mut zu machen. Sie wies den Hund auch nicht zurück, als er sich mit einem tiefen Knurren direkt vor ihren Füßen niederlegte.
»Guten Tag, Monsieur«, grüßte sie den Besucher höflich. »Können wir Ihnen irgendwie helfen?«
Er wandte sich ihr zu und nahm im selben Moment
seinen Hut ab, der sein Gesicht bislang bedeckt hatte. Nun stand er breitschultrig mit grimmiger Miene vor ihr.
»Sie!«
Der Schock stand ihr ins Gesicht geschrieben, und der schrille Ausruf der Überraschung schreckte den Hund auf, der ein warnendes Knurren vernehmen ließ, sodass sie sich genötigt fühlte, ihm beruhigend die Hand auf den Kopf zu legen.
»So ist es, Madame Pingre«, antwortete der Besucher und senkte seinen Kopf zu einer angedeuteten Verbeugung. »Christien Lenoir, zu Ihren Diensten.«
Dunkles Haar mit einem Schimmer von schwarzem Satin gleich dem Fell eines Panthers, tiefdunkle Augen und markante Gesichtszüge, die durch den sonnengebräunten Teint besonders hervorstachen: Dies war der Mann, der jede Nacht in Reines Träumen wiederkehrte. Er war es, der die kleine Marguerite davor bewahrt hatte, von den Wagenrädern zermalmt zu werden, damals, in jener Nacht vor vier Monaten. Für einen Augenblick lag Reine in Gedanken wieder in seinen Armen, an seinen starken Körper gepresst und wurde von ihm so sicher festgehalten, dass es schien, als ob ihr niemals wieder etwas zustoßen könnte.
Der drängende Wunsch, sich in diese unendliche Sicherheit zurückfallen zu lassen, war so verführerisch, dass sie sich regelrecht zwingen musste, sich innerlich dagegen zu wehren. In diesem Augenblick überkam sie der Ärger über diese Schwäche und die Unmöglichkeit, jemals irgendwen an ihrer Seite zu haben, der ihr gescheitertes Leben mit ihr teilen würde. Obwohl es ihr nun unsägliche Schmerzen bereitete, sich daran zu erinnern, hatte sie damals ihren Retter wie eine alte Vettel angeschrien, sich aufgerappelt und
ihre Tochter so schnell wie möglich von ihm fortgezogen.
Sie errötete bis unter die Haarwurzeln, denn mehr hatte sie ihm nicht entgegenzusetzen, während sein stechender Blick auf ihr lastete. Welch unglücklicher Zufall hatte ihn wohl nach River’s Edge geführt? Sie konnte es sich nicht im Mindesten vorstellen, doch sie hoffte inständig, er möge so schnell als möglich wieder verschwinden. »Ich frage Sie noch einmal, zu wem möchten Sie denn, Monsieur?«
»Ich würde gerne Ihren Vater in einer Geschäftsangelegenheit sprechen, das heißt, falls er zu Hause ist.«
»Was könnten Sie denn schon mit ihm zu besprechen haben?« Die Frage war nicht gerade zuvorkommend, doch Reine hatte sie sich nicht verkneifen können.
»Sie zweifeln an meinen Worten?«
Ein gefährlicher Unterton lag in der Stimme von Christien Lenoir. Und plötzlich erinnerte Reine sich wieder an das dunkle Glühen, das von seinen Augen ausging, als sie sich damals auf der schlammigen Straße ansahen. Sie waren schmutzig gewesen, zersaust und mit kleinen Verletzungen übersät, doch für einen kurzen Augenblick brandete zwischen ihnen die heiße Glut der Anziehung auf. Allerdings waren sie auch kurz davor gewesen, sich zu streiten, woran sie jedoch durch die weinende Marguerite gehindert wurden.
Erneut fühlte Reine das Blut in ihren Adern kochen, es pulsierte durch ihren Körper und stieg ihr zu Kopf. Sie konnte sich nur mit Mühe darauf konzentrieren, was sie eben eigentlich gesagt hatte.
»Ich … ich muss gestehen, dass ich überrascht bin«, brachte sie endlich hervor. »Mein Vater erwartet Sie demnach?«
»So sollte es sein«, sagte Christien in einem rätselhaften Ton.
Sie zögerte, trat dann einen Schritt zurück und zeigte auf die andere Seite der Veranda. »Hier entlang bitte. Alonzo wird Ihnen Ihren Hut und den Reitmantel abnehmen und Sie dann zu ihm führen.«
»Sie sind zu freundlich, Madame.«
Seine Stimme war trocken, und seine Augen drückten eine feine Ironie aus, als er die Stufen heraufkam und an ihr vorbeiging. Er schien ein Ritter zu sein, mit seiner hünenhaften Statur, den breiten Schultern und dem, einem Zauberumhang gleichenden Reitmantel, dessen Enden im Wind flatterten. Falls die Anwesenheit des Jagdhunds ihn störte, so zeigte er zumindest nach außen keine Anzeichen der Unruhe, sondern ließ ihn nur an seiner Hand schnuppern. Chalmette machte von diesem unerwarteten Angebot Gebrauch, wedelte kurz mit dem Schwanz und verschwand dann wieder in Richtung seines Plätzchens unter der Hortensie.
Reine warf dem Hund einen verbitterten Blick zu und bemerkte aber gleichzeitig, wie der Besucher sie mit einem amüsierten Lächeln bedachte, so als verstünde er den Grund ihres Ärgers über die Abtrünnigkeit des Vierbeiners. Sie neigte ihren Kopf ein wenig in der Absicht, höflich ihren Rückzug ins Haus zu signalisieren, wohin sie sich dann auch begab.
Möglicherweise sah er ihr hinterher, doch sie war sich nicht ganz sicher, denn sie wagte es nicht, sich noch einmal umzudrehen, bevor sie die Eingangstür passiert hatte.
Die Ankunft des unerwarteten Besuchers versetzte sie in eine derartige Verwirrung, dass es ihr nicht mehr gelang, sich auf die Schreibtischarbeit zu konzentrieren.
Als sie ungefähr ein halbes Dutzend Zahlen in die falsche Reihe der Bilanz geschrieben hatte, wobei sie die Abrechnungen mehr als nur einmal durcheinanderbrachte, legte sie ihre Schreibfeder beiseite und verließ zum zweiten Mal ihren Arbeitsplatz.
Zwischen den beiden Verandatüren hing über dem Frisiertischchen in einem goldenen Rahmen ein kleiner Spiegel an der Wand. Sie trat unwillkürlich näher und betrachtete stirnrunzelnd ihre Erscheinung. Ihre Haare, die nie besonders ordentlich waren, hingen in Strähnen um ihr Gesicht, ihre Wangen waren wenig attraktiv gerötet, und zu alledem hatte sie auch noch einen Fleck indischer Tinte auf ihrem Kinn.
Mit einem unterdrückten Ausruf des Verdrusses zog sie ein Taschentuch aus ihrem bestickten Beutelchen, das an einer Kordel an ihrer Hüfte baumelte, direkt neben den nötigen Hausschlüsseln. Sie befeuchtete das Tuch mit ihrer Zunge und rieb mit aller Kraft, um die schwarze Tinte zu beseitigen. Nicht, dass es ihr etwas ausgemacht hätte, wie sie aussah, natürlich nicht. Ihr Aussehen war noch nie mehr als recht passabel gewesen und ihre Attraktivität eher mäßig, doch sie bevorzugte es, zumindest adrett zu sein.
Welche Geschäfte könnten Monsieur Lenoir wohl nach River’s Edge geführt haben?
Sie glaubte kaum, dass ihr Vater eine Unterweisung im Umgang mit Florett oder Degen brauchte, denn er war einst durchaus geübt im Fechten gewesen, auch wenn dies schon einige Jahre zurücklag. Ihm gehörte ihres Wissens auch keine Immobilie an der Passage de la Bourse, welche man als Atelier an einen Fechtmeister hätte vermieten können. Schließlich war er auch zu gutmütig, als dass er einen maître d’armes engagieren würde, um sich eines Feindes zu entledigen. Natürlich
nur für den Fall, dass Monsieur Lenoir überhaupt derart ehrlose Aufträge annahm.
Das Einzige, was sie sich vorstellen konnte, war, dass es sich um die Begleichung einer Ehrenschuld handelte. Ihr Vater war ein feiner Mann, doch er hatte ein Laster, nämlich das Glücksspiel. Bereits seit vielen Jahren ließ er es zu, dass diese Leidenschaft sein Urteilsvermögen trübte. Reines Mutter sprach früher manchmal davon, wie er noch in Zeiten vor ihrer Hochzeit das ein oder andere Vermögen gewann und auch wieder verlor. Erst kürzlich war er wieder einmal erst im Morgengrauen nach Hause gekommen, nach einer durchspielten und durchzechten Nacht, was ihn wohl, wie schon des Öfteren, knapp an Geldmitteln werden ließ.
Reine spürte ein Gefühl der Verachtung und der Missbilligung in sich aufsteigen, als ihr plötzlich klar wurde, was der Grund für den Besuch des Fechtmeisters war. Es handelte sich um nichts anderes als Spielschulden. Bargeld dürfte im Hause ihres Vaters eher knapp bemessen sein, das wusste sie nur zu genau, da sie ja heute Morgen die Buchhaltungsbelege durchgegangen war. Die meisten Plantagenbesitzer bauten in ihrer Bewirtschaftung auf zukünftigen Gewinn, wobei die Erntezeit meist ihre Hoffnungen erfüllte, jedoch nicht unbedingt jedes Mal. Nur eine einzige Ernte, die durch Trockenheit, eine Insektenplage, Krankheiten oder Unwetter zerstört wurde, konnte schon der Ruin des Landwirtes sein. In so einem Fall halfen dann nur noch gute Freunde oder entgegenkommende Banken, die eine letzte Rettung möglich machten.
Ihr Vater hatte bisher in Bezug auf die Wahl seiner Freunde und Geschäftsbekanntschaften immer ein glückliches Händchen bewiesen. Er selbst war aber
auch ein unbeschwerter und gutmütiger Mensch, der sich großzügig zeigte, wenn sich jemand in finanziellen Schwierigkeiten befand, sofern er bei Kasse war. Unabhängig davon, ob er beim Kartenspiel gewann oder verlor, er hatte kaum Feinde und galt als umgänglich und freundlich; für ihn das Geheimnis eines guten und erfüllten Lebens, wie er immer wieder betonte.
Die raue Wirklichkeit und ihr lieber Herr Papa waren nicht immer die besten Freunde, denn er hatte die Angewohnheit, unangenehme Fakten so lange wie möglich zu ignorieren. Zudem glaubte er, man solle Damen nicht mit finanziellen Sorgen belasten; und dies angesichts der Tatsache, dass es keine andere als Reine war, die Buch führte und die Ausgaben und Gewinne der Plantage nachrechnete.
Auch wenn ihre Zuneigung zu ihrem Vater groß und unerschütterlich war, so hatte sie doch, was diesen ungewöhnlichen Besuch betraf, ein unangenehmes Gefühl.
Das Verlangen, ganz genau Bescheid zu wissen, wie es um die Angelegenheit zwischen ihrem Vater und Monsieur Lenoir bestellt war, wurde mit jedem Augenblick, der verging, immer drängender. Sie fühlte Erleichterung, als Alonzo endlich in ihrem Zimmer erschien und ihr zu verstehen gab, dass sie auf der Veranda verlangt würde.
Der Besucher und ihr Vater erhoben sich kurz, als sie näher kam, ließen sich dann aber wieder auf ihren Stühlen nieder, während Reine sich einen Korbsessel nahm und mit im Schoß gefalteten Händen diskret neben sie setzte. Ihr Vater erinnerte in blumigen Worten an die erste Begegnung Lenoirs mit seiner Tochter und drückte seine Dankbarkeit gegenüber seinem Gast aus, der Reine und Marguerite
damals auf der Straße vor schwerwiegenden Verletzungen bewahrt hatte. Nachdem er diesen Vorfall allen nochmals ins Gedächtnis gerufen hatte, wurde er auf einmal ungewohnt schweigsam und ließ, die Stirn in Falten gelegt, den Blick seiner müden blauen Augen zwischen dem Besucher und Reine hin- und herschweifen. Versonnen schaute er über das Geländer der Veranda zu den sich bewegenden Sonnenflecken unter den alten Eichen. Schließlich blickte er erneut seinen Besucher an, schürzte die Lippen und holte tief Luft.
Ihr Vater wurde unzweifelhaft älter, wie Reine mit einem bangen Gefühl bemerkte. Leberflecken zeichneten sich auf seinen Handrücken ab, seine Gesichtszüge waren von tiefen Falten geprägt, und sein ehemals dunkles Haar war bereits von grauen Strähnen durchzogen. Als junger Mann noch ein Bon Vivant, heiratete er relativ spät, sodass er bei ihrer Geburt schon fast vierzig Lenze zählte. Die Ereignisse der letzten Jahre hatten zudem ihren Tribut gefordert, sodass sich die Leichtigkeit seiner Schritte verlor und das beständige Lächeln aus seinem Gesicht verschwand. Teilweise war auch sie dafür verantwortlich, das wusste sie ganz genau.
»Nun, Papa?«, fragte sie nach einer Weile. »Wolltest du mir irgendetwas mitteilen?«
»Ja, in der Tat, da gäbe es eine Angelegenheit … die ich erzählen muss … Ach, es ist eine unglückselige Geschichte, und es tut mir furchtbar leid. Es betrifft dich mehr als jeden anderen, und es scheint mir das Beste zu sein, dich als Erste darüber zu informieren, sodass du dann … Ach, Chérie!«
Reine war in diesem Moment nicht mehr nur besorgt, sondern äußerst alarmiert. Sie lehnte sich ein
wenig nach vorne. »Was ist los? Ist irgendetwas passiert? Bitte sag es mir sofort!«
Ihr Vater öffnete den Mund, und nach kurzem Zögern schloss er ihn mit einem Kopfschütteln wieder. Reine, die den Blick des Fechtmeisters auf sich spürte, drehte sich zu diesem um, in der Hoffnung, von ihm über die Angelegenheit aufgeklärt zu werden. Zum Glück enttäuschte er sie nicht.
»Was Ihr Vater versucht, Ihnen zu erzählen, Madame Pingre«, sagte er, und seine Stimme war ebenso neutral wie der Blick aus seinen schwarzen Augen, »ist, dass er den Rechtsanspruch auf dieses Anwesen verloren hat. Das Haus, die Möblierung, die Arbeiter und das dazugehörigen Land gingen über den Spieltisch. Sein Verlust ist mein Gewinn. Ich bin der neue Eigentümer von River’s Edge.«
Seine Worte waren eindeutig, doch ihr Verstand weigerte sich, die Bedeutung des Gesagten anzuerkennen. Das war schlimmer, weitaus schlimmer, als sie befürchtet hatte. »Was? Was haben Sie soeben gesagt?«
»Es stimmt«, antwortete ihr Vater stattdessen in einem Ton tiefer Trauer, während sie sich zu ihm umdrehte. »Alles ist dahin. Das Stadthaus im Vieux Carré ebenfalls.«
»Es tut mir leid«, beschwichtigte Lenoir.
Reine schloss die Augen, unfähig, das sicherlich geheuchelte Bedauern und seine unbeweglichen Gesichtszüge zu ertragen. »Glücksspiel«, stieß sie halb flüsternd hervor, ohne ihre Wut zu verbergen.
»Nun ja.« Ihr Vater fand seine Sprache wieder, jetzt, da die furchtbare Neuigkeit heraus war. »Meine Pechsträhne war unglaublich, so etwas habe ich noch nie erlebt. Ich war absolut sicher, dass sich mir im Laufe der Nacht das Glück wieder zuwenden würde, doch
leider war dem nicht so.« Er zuckte resigniert mit den Schultern.
»Wie konntest du nur?«, fragte sie vor Wut bebend. »Hast du denn dabei überhaupt nicht an mich oder Marguerite gedacht? Was Maman angeht, so habe ich keine Ahnung, wie du ihr das beibringen willst.«
Ein Schatten von Beklommenheit huschte über das Gesicht ihres Vaters. »Die Sache steht nicht so schlimm, wie es den Anschein hat.«
»Wie schlimm könnte es denn noch sein? Wir werden hier ausziehen müssen und wissen nicht, wohin. Natürlich könnten wir für ein paar Tage ins Hotel gehen, aber wenn du so viel verloren hast …« Reine hielt inne und presste ihre Lippen zusammen, um sich selbst davor zu bewahren, noch mehr zu sagen. Es ging ihr gegen den Strich, vor ihrem Gast das ganze Ausmaß der Katastrophe auszubreiten. On lave son linge sale en famille, schmutzige Wäsche wird in der Familie gewaschen, wie die alten Frauen zu sagen pflegten.
Ihr Vater kratzte sich im Nacken, während sein Blick peinlich berührt wirkte. »Es werden keine allzu drastischen Maßnahmen vonnöten sein. Monsieur Lenoir und ich haben eine Absprache getroffen, die ganz gut funktionieren müsste.«
»Hinsichtlich ein wenig mehr Zeit, um unsere Angelegenheiten zu ordnen, meinst du das? Ich bin sicher, dass dies sehr zuvorkommend von ihm ist, aber es ändert nicht wirklich etwas an der jetzigen Situation.« Sie warf dem Fechtmeister einen vernichtenden Blick zu. Je mehr sie über die Sache nachdachte, desto unwahrscheinlicher erschien es ihr, dass ihr Vater alles aufs Spiel gesetzt hatte, erst recht gegen diesen Mann. Dies war einfach merkwürdig, außer natürlich,
die beiden hatten sich durch den Vorfall am Theater kennengelernt.
»Die Angelegenheit ist delikat, Chérie, aber sie sollte zufriedenstellend ausgehen, wenn alles wie geplant verläuft.« Ihr Vater stand so hastig von seinem Stuhl auf, dass seine Knie knackten. »Ich sollte zu deiner Mutter gehen, bevor sie sich entschließt, herunterzukommen, um unseren Besuch zu begrüßen. Monsieur Lenoir wird besser als ich in der Lage sein, dir die Sache so zu erläutern, dass … dass es zu deinem Wohlgefallen ausgeht. Ich werde ihn allein lassen, damit er dir seinen Standpunkt erläutern kann, so wie er es auch mir gegenüber dargestellt hat.«
Reine spürte, dass ihr das Herz bis zum Hals klopfte, als sie ihren Vater von dannen gehen sah, in einer Eile, dass die Enden seiner Rockschöße im Wind flatterten. Sobald seine Schritte im Inneren des Hauses verhallt waren, drehte sie sich zu dem neben ihr sitzenden Mann um.
Christien Lenoir lehnte sich bedächtig nach vorne und stütze seine Ellbogen auf der Lehne des Korbstuhls ab. Ein bedauerndes Lächeln umspielte seinen Mund, als er ihrem Blick begegnete, der Ausdruck in seinen Augen jedoch änderte sich nicht. Aus diesem Grund blieb sie wachsam und taxierte ihn, als ob sie es mit einem Gegner in einem feindlichen Duell zu tun hätte.
»Nun denn, Monsieur?«
»Dies mag für Sie vielleicht schockierend sein, doch es ist die Wahrheit, und ich hoffe, Sie werden mir deswegen keine Vorhaltungen machen.«
»Das kann ich kaum versprechen, da ich immer noch keine Ahnung habe, was sie eigentlich meinen.« Sie war verwirrt von dem Gefühl, ihr Herz so lautstark
gegen ihre Brust klopfen zu hören und von der unwiderstehlichen Anziehungskraft dieses Mannes, von dem sie ihren Blick nicht abwenden konnte.
»Nein, natürlich nicht. Die Sache ist die, dass mein Vorschlag völlig rational und logisch erschien, als er mir in den Sinn kam. Mit Ihrem Vater darüber zu sprechen, war nur eine einfache Geschäftsangelegenheit. Jetzt, mit Ihnen, sieht das schon ganz anders aus.«
»Das wird Sie ja hoffentlich nicht davon abhalten, es trotzdem zu tun.«
»Keinesfalls. Nachdem ich Sie wiedergesehen habe, bin ich erst recht davon überzeugt.«
Sie beobachtete genau seine Gesichtszüge. Seine Augen, die so dunkel waren wie die Nacht und von dichten Wimpern umrahmt wurden, die alle Gefühle verbargen. Der Widerschein der Sonne auf seinem markanten Gesicht und seinen tiefschwarzen Haaren. Seine Nase, die zwischen buschigen, ausdrucksstarken Augenbrauen seinem Gesicht prägnante Züge verlieh, wäre in einem weniger männlichen Gesicht vielleicht zu groß gewesen, doch ihre Form, die aufgrund ihrer scharfen Kanten an einen Adler erinnerte, gab ihm diese gewisse Note an Männlichkeit und Bestimmtheit. Sein Kinn war äußerst ausgeprägt, fast bedrohlich.
Christien Lenoir war, gemessen an der aktuellen Mode raffinierter Eleganz, nicht wirklich makellos. Von seinen teuflisch finsteren Gesichtszügen und dem kräftigen Bau seines Körpers ging jedoch eine Art dunkle Anziehungskraft aus. Seine maskuline Präsenz und seine eisenharte Entschlossenheit, die nur ein dünner Firnis von Zivilisiertheit überdeckte, schienen den sonnigen Morgen zu überstrahlen. Sie entdeckte an
ihm wirklich nichts, das ihr Grund für Hoffnung gab, er könnte sich dazu veranlasst fühlen, ihrem Vater die Spielschulden zu erlassen.
Sie senkte ihren Blick und ließ ihn für einen Augenblick auf der Manschette seines Hemdärmels ruhen. Der Leinenstoff war hauchdünn und an den Enden bereits ausgefranst. Seine eigentlich schwarze Krawatte hatte durch ihr Alter einen rötlichen Glanz bekommen. Seine aus Wolle gewebten Hosen waren an den Knien bereits mehr ausgebeult, als es gesellschaftlich tragbar war. Es schien, als ob er River’s Edge so nötig bräuchte wie sie selbst, ja er war wohl geradezu darauf angewiesen. Was aber, um alles in der Welt, konnte er dann von ihr noch wollen?
Ein unangenehmer Gedanke bemächtigte sich ihrer und ließ eine Welle der Hitze durch ihre Adern branden. Er hatte einen Vorschlag erwähnt. Was, wenn er damit einen Antrag meinte? Nein, das konnte einfach nicht sein.
Sich nur mühsam beherrschend, presste sie hervor: »Ich möchte gar nicht erst raten, welche Pläne Sie im Kopf haben, denn ich nehme nicht an, dass Sie daran gedacht haben, dass mein Vater River’s Edge von Ihnen pachten soll.«
»Das wäre mir ganz und gar nicht recht.«
»So etwas habe ich schon befürchtet. In diesem Fall hätten Sie mich ja in Ihre Planungen auch nicht einweihen müssen. Wollen Sie sich vielleicht als Plantagenbesitzer niederlassen? Dann bräuchten Sie womöglich das Fachwissen meines Vaters und mich, um Ihren Haushalt zu führen?«
»Etwas in dieser Richtung.«
»Sie können von Papa aber kaum erwarten, dass er Ihr Aufseher wird«, entgegnete sie abweisend. »Nicht
weil er ungefällig wäre, sondern weil er dazu einfach nicht die nötigen Fähigkeiten hat, verstehen Sie. Er ist und war schon immer ein Gentleman.«
»Also ist es ihm verboten, seinen Lebensunterhalt wie ein gemeiner Arbeiter zu verdienen. Mir ist der Unterschied durchaus bewusst.«
Sie ignorierte den rauen Unterton in seiner Stimme und fuhr fort: »Auch meine Mutter würde es wohl kaum akzeptieren, in das Haus des Aufsehers umzuziehen. Es ist … ist einfach nicht angemessen.«
»Madame Cassard würde sich lieber von irgendeinem Verwandten aushalten lassen und ein Leben als Gesellschafterin führen, als die Annehmlichkeit eines Haushaltes aufzugeben, der ausreichend Personal zur Verfügung hat, um ihre Wünsche zu erfüllen. Das ist absolut verständlich. Aber in diesem Fall ist es ja wohl eher so, dass Sie, Ihr Vater und Ihre kleine Tochter auf meine Kosten leben werden.«
Reine blickte ihn irritiert an und knetete nervös ihre im Schoß gefalteten Hände. »Sie sind nicht … wir sind nicht auf ihre Wohltätigkeit angewiesen.«
»Wirklich nicht?«
Die Frage war ein weiteres Mal mit einem verwirrenden Anflug von Sympathie gestellt. Ein aufglimmernder Hauch von Gold inmitten der dunklen Iris seiner Augen drückte dabei eine gewisse Sanftheit aus. Reine lehnte diese Unterstellung ohne das geringste Zögern ab. »Auf keinen Fall.«
»Ich verstehe natürlich, dass sich die Sache für Sie anders darstellt. Vorausgesetzt, Sie wären dazu bereit, eine entsprechende Gegenleistung zu erbringen, würden Sie selbstverständlich die Herrin auf River’s Edge werden.«
Sie starrte ihn einen langen Augenblick entgeistert
an. »Die Herrin«, wiederholte sie mit leichtem Unverständnis.
»Nun, ich wollte damit sagen, anstelle ihrer Mutter, die im Moment diese Position innehat. Die diesbezügliche Verantwortung würde natürlich als meine zukünftige Frau in Ihren Aufgabenbereich fallen.«
Sie sah in seine tiefschwarzen Augen, völlig verunsichert, ob die von ihm so sanft, aber doch klar und deutlich gesprochenen Worte wirklich die Bedeutung hatten, die sie eben verstanden zu haben glaubte. Gleichzeitig durchströmte sie ein wohliges Gefühl, ihre Brustwarzen erhärteten sich, und sie spürte, wie sich brennende Hitze zwischen ihren Schenkeln ausbreitete. Sie fühlte sich ein wenig benommen und schloss instinktiv die Finger fester um die Lehne des Korbstuhls.
»Ihre Frau«, sagte sie ganz schwach.
»Sie müssen zugeben, dass dies auf der Hand liegt, die beste Lösung für alle. Als Ihr Ehemann würde ich von River’s Edge Besitz ergreifen können, ohne Ihre Familie brüskieren zu müssen. Es würde sich auch kaum etwas ändern, außer dass wir einander gesetzlich verbunden wären.«
Besitz ergreifen. Was für ein aggressiver Ausdruck, einer, bei dem sich ihre Zehen unwillkürlich zusammenkrampften.
Reine war schon einmal verheiratet gewesen. Das Letzte, was sie gebrauchen konnte, war, dass wieder jemand von ihr Besitz ergriff. Ihr verschwommener Blick klärte sich plötzlich auf, und mit einer entschlossenen Drehung ihres Kopfes wandte sie sich ihm zu. »Unmöglich«.
»Unwahrscheinlich zumindest«, entgegnete der Fechtmeister, ohne dabei seinen Gesichtsausdruck zu verändern, »aber vielleicht nicht unmöglich.«
»Sie verstehen nicht. Ich verspüre nicht den geringsten Wunsch, noch einmal zu heiraten.«
»Lieber würden Sie demnach in Kauf nehmen, dass Ihre Eltern und Ihre Tochter das liebgewonnene Heim verlassen müssten?«
»Nein, das nicht … aber ich kann wirklich nicht …«
»Sie sträuben sich gegen die Vorstellung, mit einem Mann verheiratet zu sein, der seinen Lebensunterhalt als Waffenlehrer verdient hat.«
»Das ist es nicht.« Sie meinte das wirklich so, denn seit dem Tod ihres Mannes wusste sie, was es heißt, gesellschaftlich gebrandmarkt zu sein.
Nichtsdestoweniger erschien es ihr seltsam, dass sie von so einem Mann einen Antrag erhielt. Theodore, ihr verstorbener Mann, hatte immer eine besondere Angst vor Fechtmeistern. Diese waren eine Art exklusive Bruderschaft, deren Mitglieder meist unterwegs waren, um Ungerechtigkeiten gegenüber Schwächeren, insbesondere Frauen und Kindern, zu rächen. Dabei waren sie in der Wahl ihrer Mittel oft nicht zimperlich und berücksichtigten kaum Stand und Ehre ihrer Opfer.
»Sie lehnen mich als Person ab«, fuhr Christien Lenoir fort.
Sie warf ihm einen schneidenden Blick zu, der sein ebenmäßiges Antlitz traf, aber auch auf seine muskulösen Schultern und seine langen, kräftigen Beine fiel, die sich durch den dünnen Stoff seiner Hose abzeichneten. »Seien Sie nicht lächerlich. Meine Präferenzen spielen hierbei keine Rolle.«
»Ich widere Sie also nicht an. Demnach machen wir schon Fortschritte.«
Seine Stimme hatte einen nicht kalkulierbaren Unterton. Mit Entschlossenheit streckte sie ihr Kinn vor,
Zweites Kapitel
»Sie glauben mir nicht.«
Christien konnte die Anschuldigung nicht einfach abtun. Auf der anderen Seite erschien es ihm lächerlich, dass dieses, hier vor ihm sitzende zarte Geschöpf die Kraft haben sollte, einen tödlichen Faustschlag auszuführen. Was ihn an dieser Behauptung weitaus mehr interessierte, und das abgesehen von der Tatsache, dass bei der von ihr unbeabsichtigten Erwähnung eines gemeinsamen Bettes sich eine leichte Röte auf ihren Wangen bemerkbar gemacht hatte, war die wohl dahintersteckende Absicht, ihn von seinen Heiratsplänen abzubringen. Nun, und schließlich war er auch neugierig, warum sie dafür zu solch drastischen Mitteln griff.
»Lassen Sie uns einfach sagen, es scheint recht zweifelhaft zu sein«, versuchte er, zu beschwichtigen. »Es sei denn, Ihr Mann war besonders schmächtig?«
»Er war nicht kleiner als ich, aber sicherlich nicht so groß und kräftig wie Sie.«
Er konnte förmlich ihren Blick spüren, der über seine Schultern und seine ausgestreckten Beine glitt, als sie ihm antwortete. Es überkam ihn dabei ein prickelndes Gefühl, das er kaum ignorieren konnte.
»Aber jeder Mensch muss irgendwann einmal schlafen«, fuhr sie fort. »Er wurde in unserem Schlafzimmer angegriffen, verstehen Sie.«
»Also entledigten Sie sich seiner, während er neben Ihnen lag und schnarchte. Und dann? Haben Sie sich
daraufhin wieder hingelegt und gewartet, bis jemand kam und ihn fand?«
»Bestimmt nicht. Ich habe ihn nicht …«
Sie hielt inne und holte tief Luft. Ihre Lungen füllten sich und ließen ihre wohlgeformten Brüste in einer Weise anschwellen, die zu aufreizend für ihn war, um sich noch länger wohlzufühlen. Ihre Wangen röteten sich erneut, und in ihren graublauen Augen bahnte sich ein Sturm der Entrüstung an. Christien störte sich nicht weiter daran. Ihm gefiel es besser als ihre zur Schau getragene, vornehme Blässe, die noch ein paar Sekunden zuvor ihr Gesicht beherrschte. Ein weiteres Mal diesen Effekt bei ihr zu erzielen, schien ihm ein lohnendes Unterfangen zu sein.
»An einem solchen Ort«, sagte er mit größter Zuvorkommenheit, »könntet Ihr nicht so gefühllos sein, genauso wenig, wie Ihr dort mein Anliegen ablehnen würdet.«
»Ist es wirklich das, als was Ihr es verkauft, ein Anliegen? Ich dachte eher, es sei ein Ultimatum.«
Er schüttelte seinen Kopf. »Ich biete Euch meine Hand an und alles, was ich habe. Ihr müsst nur vernünftig genug sein, es auch anzunehmen.«
»Alles, was Ihr habt«, antwortete sie mit bitterer Verachtung.
Er beobachtete mit aufgewühltem Interesse, wie sich die Linien ihrer feinen Lippen zusammenzogen und spürte, wie sich im unteren Bereich seines Bauches ein kribbelndes Gefühl breitmachte. »Der Verlust Ihres Vaters ist eine Ehrenschuld, Madame Pingre und als solche muss sie gezahlt werden. Niemand hat ihn gezwungen, so hoch zu pokern und so lange dabeizubleiben.«
»Sie haben ja nur davon profitiert.«
»Das habe ich wirklich«, stimmte er ihr in aller Offenheit zu. »Irgendjemand hätte am Ende des Abends seine zu hohen Einsätze gewonnen. Ich dachte, warum sollte nicht ich es sein.«
Reine hielt seinem Blick für eine ganze Weile stand und blieb, während sie ihn abschätzte, selbst unergründlich. Er fragte sich, ob sie die tiefe Wahrheit in seiner Stimme erkannt hatte und ob sie in irgendeiner Form verstanden hatte, dass es nicht purer Zufall war, als er sich entschied, in ein Spiel mit Cassard einzusteigen. Er wich als Erster ihren Augen aus und erlaubte sich einen flüchtigen Blick auf ihre sanft geschwungenen Lippen, die so voll und einladend waren, dass er sich mit aller Gewalt gegen den inneren Drang wehren musste, sie einfach an sich heranzuziehen, um das Ersehnte ausgiebig zu kosten.
Sie holte kurz Luft, wandte ihre Augen von ihm ab und lehnte sich ein wenig zur Seite, um ein bisschen mehr Distanz zwischen ihnen zu schaffen. »Wenn Sie nur ein wenig Mitgefühl hätten, würden Sie Papa erlauben, einen Schuldschein für seine Spielverluste auszustellen, denn ihn in seinem Alter zu enteignen und erst recht meine Mutter, ist … ist nicht rechtens, sondern vielmehr unglaublich herzlos.«
»Aber ich enteigne keinen von beiden. Ich ermögliche Ihnen vielmehr, weiterhin in ihrem Zuhause zu leben. Alles, was Sie dazu tun müssen …«,
»… ist, mich selbst als ein Opfer für ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen darzubringen«, unterbrach sie ihn.
»Angesicht der sonst möglichen Alternativen erscheint das am vernünftigsten zu sein.«
»Es ist nicht im Geringsten vernünftig! Ich dachte, ich bliebe bis an das Ende meiner Tage eine Witwe.«
Er runzelte die Stirn, war sich aber des Überschwangs seiner Gefühle bewusst. »Sie haben Ihr Herz am Grab Ihres Geliebten gelassen.«
»Bitte«, sagte sie mit einer müden Geste.
»Es ist nicht so melodramatisch, oder? Sie sind sicherlich auch nicht so verzweifelt.«
»Ich hoffe nicht.«
»Die Ehe war eine Enttäuschung für Sie?«
»Nein, überhaupt nicht.«
Er hörte die spontane Antwort, schätzte sie jedoch falsch ein. Er wollte sie doch zu seiner Frau haben und ihre Erinnerung an den verstorbenen Ehemann mit aller Brutalität ausmerzen.
»Also nicht«, gab er schwer atmend zurück. »Dann weiß ich nicht mehr weiter. Wenn ich sehe, wie sehr Sie sich gegen etwas sträuben, was letztendlich ein annehmbares Arrangement für alle ist«.
»Das die Heirat mit einem Mann beinhaltet, den ich nicht im Mindesten kenne und mit dem ich nichts gemein habe? Unter den gegebenen Umständen ist natürlich auch keine Zeit dafür vorgesehen, herauszufinden, ob man mit Geist und Seele zueinanderpasst, ganz zu schweigen davon, ob vielleicht auch noch gegenseitige Zuneigung mit im Spiel ist. Monsieur Lenoir, unsere Vorstellungen von dem, was annehmbar ist, unterscheiden sich offenbar gewaltig.«
»Sie bevorzugen also eine Liebesheirat.«
»Ich hoffe, Sie haben mehr gesunden Menschenverstand. Für mich ist selbstverständlich ein Mann meinesgleichen die erste Wahl.«
»Jetzt, wo sich Ihre Trauerzeit dem Ende zuneigt, wollen Sie also die Annehmlichkeiten und Vergnügungen von gesellschaftlichen Zusammenkünften für die eine oder andere Saison genießen, bevor Sie sich ihn
auswählen. Oder haben Sie gar schon jemanden im Auge?«
»Ganz bestimmt nicht!« Das tiefe Blau ihrer Augen leuchtete intensiver als der klare, sommerliche Morgenhimmel. »Ich habe darüber ganz theoretisch gesprochen. Wie schon erwähnt, habe ich kein Interesse an einem weiteren Ehemann.«
»Da möchte ich mir aber doch die Freiheit nehmen, das anzuzweifeln, denn Sie sind eindeutig zu attraktiv, als dass Sie für den Rest Ihres Lebens in Trauergewändern herumlaufen werden.«
Sie schüttelte den Kopf, sowohl das Kompliment als auch die diesbezügliche Schlussfolgerung ablehnend. »Die Art und Weise, wie meine erste Ehe ein Ende gefunden hat, macht es nicht sehr wahrscheinlich, dass ich noch einmal einen Antrag erhalten werde.«
Er verstand, dass sie sich als gesellschaftlich geächtet empfand. Der Grund hierfür lag auf der Hand, denn es würden wohl nur wenige Einladungen an eine Frau herausgehen, die im Verdacht stand, ihren Mann umgebracht zu haben. Dieses Thema auf sich beruhen zu lassen, erschien für den Moment das Beste. »Es ist meine Herkunft, die Sie stört«, fuhr er beharrlich fort.
»Nicht wirklich, obwohl ich nicht ganz verstehe, warum Sie von mir erwarten, dass ich mich mit einem Mann wohlfühlen sollte, der einen ganz anderen Hintergrund hat als ich selbst.«
»Ich habe einige Jahre damit verbracht, für mich eine Heimstatt im Vieux Carré einzurichten, Madame Pingre, und dabei war ich zumindest erfolgreich genug, um zahlreiche angesehene Herren aus guter Familie in meinem Salon empfangen zu können«, antwortete er, während sich eine gewisse Kälte um sein Herz legte. »Aber womöglich ist der entscheidende Punkt
einfach der, dass ich für meinen Lebensunterhalt arbeite. Na ja, und dann natürlich auch noch in einem so skandalösen Beruf.«
»Das spricht in der Tat nicht gerade für Sie.« Der Ausdruck in ihren Augen hielt ihn davon ab, etwas zu entgegnen. »Was für ein Leben müsste ich führen, wenn ich mich an einen Mann binden würde, der glaubt, dass jeder Streit mit dem Degen gelöst werden kann? Das wäre schlimmer als …«
»Schlimmer als Ihre erste Ehe vielleicht? Ich verstehe die Einwände. Bezüglich meiner Herkunft kann ich nichts ändern. Ich stamme von den Natchez ab, den Ureinwohnern des Landes. Französische Frauen haben mit Heirat schon ganz andere Völker zivilisiert.« Er schenkte ihr ein kleines Lächeln in Anerkennung der Tatsache, dass es ohne ein bisschen Zivilisation nicht ginge. »Was meinen Beruf angeht, so verspreche ich, dass ich meinen Degen an unserem Hochzeitstag niederlege und ihn von da an nie wieder gegen jemanden erheben werde.«
In ihrem Gesichtsausdruck machte sich leichte Verwirrung breit, während sie ihn anstarrte. »Sie würden das für mich tun?«
»Wenn Sie das wünschen.« Es gab nur wenige Dinge, die er ihr nicht zugestanden hätte, um ihre Zustimmung zu erhalten.
»Und angenommen, ich wünschte …«
»Was?« Er musste die Frage stellen, als er bemerkte, wie sie innehielt, auch wenn er die Antwort bereits ahnte.
»In unserem … unserem Ehebett alleine zu sein.«
Unwillkürlich stieg in ihm die Vorstellung auf, wie sie in diesem Bett in Batist und Spitze gekleidet liegen würde, ihre offenen Haare mit den verführerischen
Locken, in voller Pracht über den Kissen ausgebreitet und im Lampenschein intensiv glänzend. Sie könnte vielleicht zunächst alleine dort sein, doch wenn er irgendetwas mitzubestimmen hätte, nicht sehr lange. Er atmete tief ein, um die heißen Wellen, die bei diesem Gedanken durch seinen Körper strömten, unter Kontrolle zu bringen. Schließlich sagte er: »Sie würden uns also zu Enthaltsamkeit und Kinderlosigkeit verurteilen?«
»Ich habe bereits ein Kind, meine Tochter Marguerite.« Ihr Blick wanderte suchend über seine Schultern hinweg.
»Und ich wäre stolz, ihr ein Vater zu sein, wenn Sie das möchten und es ihr auch recht wäre; aber ich hoffe doch, auch noch weitere Kinder zu haben.«
Sie schaute leicht betreten auf ihre Hände hinunter. »Ich verstehe.«
»Das ist nun keine unbegründete Erwartung«, sagte er ruhig.
»Nein, ist es nicht, wenn die Umstände normal wären.«
»Die Sache liegt ganz in unserer Macht. Es könnte alles normal werden, wenn wir es nur wollen.«
Sie schaute ihn misstrauisch, aber mit einem leichten Anflug von Humor, an. »Sie haben wohl auf alles eine Antwort.«
»Das ist einer meiner Fehler«, entgegnete er fast feierlich, »und nicht der Einzige.«
»Es gibt noch mehr?«
Dieses erste Anzeichen von Interesse erschien vielversprechend, fast schmeichelhaft. »Ich bin ein Frühaufsteher und mache gerne einen Ausritt vor dem Frühstück. Müßiggang ist für mich schwer zu ertragen. Ich muss immer irgendetwas tun, deshalb erwarte
ich auch, dass ich mich in das Tagesgeschäft der Plantage einbringen kann. Es macht mir Freude, mit meinen Händen zu arbeiten, wobei ich Sie hoffentlich nicht in Verlegenheit bringe, wenn man mich dabei sieht. Obwohl ich ab und an nichts dagegen habe, mal an einem gesellschaftlichen Ereignis teilzunehmen, ziehe ich doch den ruhigen Abend zu Hause vor. Letztlich bin ich, womöglich gegen Ihre Erwartungen, ein eher langweiliger Mensch.«
»Sie werden mir verzeihen, wenn ich das als eher unwahrscheinlich erachte.«
»Ihnen steht es frei, zu denken, was Sie wollen«, gestand er ihr trocken zu. »Oh, und ich sollte hinzufügen, dass ich einige Verpflichtungen gegenüber Freunden in und um New Orleans habe, sodass ich ab und zu einen Abend abwesend sein würde.«
»Ich würde Ihre Abwesenheit dann schon ertragen können.«
Er dachte, sein Herzschlag würde für einen Augenblick lang aussetzen. »Heißt das, Sie willigen ein?«
»Nein, nicht so übereilt«, antwortete sie, wobei ihr nicht mehr nur Verwirrung, sondern fast Panik ins Gesicht geschrieben stand. »Es war lediglich … nur eine Anmerkung. Nein, ich brauche Zeit, nachzudenken, um die Angelegenheit mit meinen Eltern zu besprechen. Etwas so Wichtiges … so Dauerhaftes wie dieses kann kaum in einer halben Stunde entschieden werden.«
»Da irren Sie, es kann schon in einem ganz kurzen Moment entschieden werden.« Christien wusste das mit absoluter Sicherheit. Deshalb war er überhaupt hier, und aus diesem Grund war er der Eigentümer von River’s Edge.
»Manche können das, ich nicht.« Sie senkte die Augen,
betrachtete ihre Finger, die sanft über das alte Korbgeflecht der Armlehne strichen. Plötzlich formte sie jedoch ihre Hand zu einer Faust. »Warum«, fragte sie. »Warum tun Sie das?«
»Weshalb ich Sie alle nicht einfach auf die Straße setze? Betrachten Sie es als eine Laune.«
»Ich glaube nicht, dass Sie ein Mann sind, der launisch ist«, hielt sie ihm entgegen, den Blick suchend auf sein Gesicht geheftet, »erst recht nicht jemand, der gemäß seiner Launen handelt. Sie brauchen eine Frau, die Ihnen den Haushalt führt, ist es das? Vielleicht denken Sie aber auch, dass ich Ihnen wegen der Geschichte vor dem Theater etwas schuldig bin und deswegen in alles einwilligen muss.«
»Ich habe keinerlei Erwartungen hinsichtlich Ihrer Dankbarkeit und auch keine Verwendung dafür.«
»Aber Sie müssen doch irgendeinen Grund haben.«
Oh ja, er hatte einen, doch den würde er gewiss nicht darlegen. So ein Wissen könnte, in falschen Händen, eine gegen ihn gerichtete Waffe sein. Er antwortete ihr stattdessen mit einer Gegenfrage: »Meinen Sie nicht, dass für mich die Gelegenheit, meine Situation zu verbessern, Grund genug ist?«
»Ich nehme an, Sie meinen Ihre Stellung in der Gesellschaft.«
»Kein Ehegelöbnis würde mich wirklich in die High-Society bringen. Das Einzige, was mich interessiert, ist River’s Edge. Ein Gutsbesitzer und niemandem verpflichtet zu sein, ist mehr als genug.« Seinen mangelnden Status in der Gesellschaft hatte er schon seit Langem als unumstößlich akzeptiert. Davon zu sprechen, bereitete ihm keinen Kummer mehr.
»Und Sie erwarten von mir, dass ich als Ihre Frau
dieses Leben außerhalb der Gesellschaft mit Ihnen teilen würde.«
»Ich dachte«, entgegnete er ruhig, »dass Sie bereits aufgrund der Art des Hinscheidens Ihres Ehegatten gesellschaftlich inakzeptabel geworden seien. Wir scheinen ein Paar von Ausgestoßenen zu sein, Sie und ich.«
Reines Augen verfinsterten sich, und sie presste ihre Lippen zu einer dünnen Linie zusammen. Von irgendwoher hörte man ein Eichhörnchen rascheln, eine Krähe schreien, und in der Ferne stimmte eine junge Frau mit voller Stimme einen Trauergesang an. Eine warme Sommerbrise strich herüber und ließ die Blätter der Bäume rauschen, legte sich dann aber so plötzlich, wie sie gekommen war.
»Sie haben durchaus recht«, sagte sie schließlich beinahe schroff, ohne ihn dabei anzusehen. »Nichtsdestoweniger brauche ich Zeit zum Nachdenken. Wenn Sie vielleicht morgen wiederkommen würden …«
»Ihr Vater hat mich eingeladen, als Gast auf River’s Edge zu bleiben, bis die Angelegenheit sich bereinigt hat, so oder so.«
Sie drehte sich zu ihm um und studierte sein Gesicht. »Ist das womöglich eine Drohung?«
»Eher eine Tatsache.« Christien erlaubte sich einen leicht ironischen Unterton. »Obwohl ich nur ungern Ihre Gefühle verletzen will, möchte ich Sie noch mal darauf hinweisen, dass Sie sich alle als meine Gäste betrachten können.«
»Können wir also.« Abrupt erhob sie sich von ihrem Stuhl, sodass er gezwungen war, das Gleiche zu tun. »Ich werde Ihnen so schnell wie möglich eine Antwort erteilen.«
»Dafür wäre ich sehr dankbar«, antwortete er und
war in diesem Augenblick so aufrichtig wie noch nie in seinem Leben.
Falls sie das noch gehört hatte, so zeigte sie zumindest kein Anzeichen der Regung. Mit einem Rauschen der Röcke, die so weit und zahlreich waren, dass sie beim Umdrehen den Staub von seinen Stiefeln fegten, entfernte sie sich von der Veranda. Er sah ihr nach und bemerkte dabei ihre gestrafften Schultern und die stolze Neigung ihres Kopfes sowie die bei ihrem graziösen Gang sich abzeichnenden, weiblichen Linien ihres Körpers und den verführerischen Schwung ihrer Hüften. Er fühlte sich so angespannt, als ob er gerade einen tödlichen Zweikampf überstanden hätte. Sein Nacken war steif geworden, und er spürte, dass sich auch noch ein ganz anderer Teil seines Körpers verhärtet hatte.
Drittes Kapitel
Monsieur Cassard kam gerade zur rechten Zeit, um Christien von der Veranda abzuholen. Er schlug ihm einen Spaziergang über die ausgedehnten Ländereien vor, was Christien dankbar annahm. Die unerwartete Geste, die ihn in seiner Eigenschaft als neuer Besitzer von River’s Edge bestätigte, nahm er mit einer gewissen Erleichterung zur Kenntnis. Christien hatte zahlreiche Fragen, doch es war selbstverständlich nicht angemessen, sie alle auf einmal anzubringen. Stattdessen machte er die eine oder andere Bemerkung zur Lokalpolitik, was schließlich in eine Unterhaltung über den Krieg in Mexiko mündete.
»Ich bin überrascht, dass ein junger Mann wie Sie nicht in der Armee ist«, meinte Cassard, während er dahinschlenderte und seine Hände auf dem Rücken unter den Schößen seines Gehrocks verschränkte. »Ich würde dabei sein, wenn ich noch jünger wäre.«
»Das ist nicht mein Krieg«, antwortete Christien.
»So eine Gelegenheit für Abenteuer gibt es nicht in jeder Generation.«
»Das ist schon richtig.« Er hatte in Erwägung gezogen, sich für die Louisiana Division zu verpflichten, die zurzeit in der Nähe der Grenze kämpfte. Er war bei den großen Versammlungen im Hewlett’s gewesen, wo viele seiner Freunde und Kollegen von der Fechtmeisterzunft unterschrieben hatten, um in den Krieg zu ziehen. Die begeisternden Reden der Militärs ließen sein Herz im Rhythmus der Trommeln schlagen. Es schien
eine edle Sache zu sein, sich für die noch jungen Vereinigten Staaten einzusetzen und gegen die alten Mächte und Ideale zu kämpfen. Ein Land aufzubauen, das sich von einem Ozean zum anderen erstrecken würde, war ein verlockender Traum. Nichtsdestotrotz hatte er andere Pläne, und zwar eigene.
»Glauben Sie, dass der alte Scott der Richtige dafür ist, um die Angelegenheit da unten zu bereinigen?«, fragte Cassard, der damit auf General Winfield Scott, den Kommandeur der östlichen Streitkräfte in Mexiko anspielte.
»Er ist ein erfahrener Soldat und wird schon wissen, woran er ist«, antwortete Christien einsilbig. »Er hatte schon genug Probleme bei Buena Vista.«
»Oh ja, bei Gott, er ist schonungslos genug. Schrecklich, allein wie er Veracruz eingenommen hat. Man sagt, er habe sechstausend Kanonenschüsse auf die Stadt abfeuern lassen. Der Blutzoll war dabei so hoch, dass die Stadtväter beschlossen, zu kapitulieren, um ihre Toten vor den Geiern retten zu können. Mit einer solchen Kriegsführung, die sich gegen Frauen und Kinder richtet, bin ich wirklich nicht einverstanden. Das ist widerlich.«
Das ist es zweifellos, dachte Christien. Sich einen so liebreizenden Körper wie den von Reine vorzustellen, wie er von explodierenden Granaten zerrissen würde, war mehr, als sein Magen verkraften konnte. Ihre Haut war so zart, ihre Figur so sanft geschwungen, dass man ihren Linien nachfahren wollte und ihre Lippen …
Er riss sich zusammen und nahm die Konversation wieder auf. »Präsident Polk musste gewusst haben, auf was er sich da einlässt. Scott kommandierte, wie Sie sich erinnern, die Kavallerieeinheit, die vor etwa
zehn Jahren die Zwangsumsiedlung der südwestlichen Indianerstämme in das ihnen zugewiesene Reservat durchführte. Auf dem langen Marsch kamen einige hundert Frauen, Kinder und alte Leute ums Leben, was ihn nicht im Geringsten kümmerte.«
Was Christien nicht erwähnte, war die Tatsache, dass die Aussicht, unter diesem General dienen zu müssen, der Hauptgrund war, warum er nicht zur Armee ging. Scotts Name wurde von seinen Verwandten nur mit Verachtung erwähnt.
»Sicherlich haben Sie ein gutes Geschäft mit all den Rekruten gemacht, die auszogen, um kurz darauf mexikanischen Gewehrläufen gegenüberzustehen.«
Bei dieser Unterstellung, er würde von dem militärischen Konflikt profitieren, schluckte Christien einen Anflug von aufkommendem Ärger hinunter. Das wirklich als Beleidigung aufzufassen, würde aber seiner Sache nicht dienlich sein. »Zugegebenermaßen, die Geschäfte in der Fechtschule liefen die letzten fünf Jahre ganz gut. Ich denke jedoch, dass ich dem ein oder anderen zukünftigen Soldaten das Leben gerettet habe, indem ich ihn gelehrt habe, den Degen richtig einzusetzen und sich wirkungsvoll gegen seine Gegner zu verteidigen.«
Cassard schürzte seine Lippen. »Abgesehen davon, vielleicht sieht Scott zumindest Mexiko City als ein schwierigeres Unternehmen an.«
»Die Streitkräfte von Santa Ana werden die Stadt mit ihrem letzten Atemzug verteidigen. Wer sollte ihnen das auch übel nehmen?«, pflichtete Christien ihm bei.
»Man sagt, dass er nicht mehr lange durchhalten wird.«
»Es wird viel geredet.«
»Das ist wohl war«, grummelte der alte Mann vor sich hin. »Jetzt, wo die berittenen Eilboten mehrmals pro Woche Depeschen von den Häfen an der Grenze bringen, denkt jeder, der einen Penny für ein Nachrichtenblatt ausgibt, er sei selbst ein Militärstratege. Wenn man denen zuhört, könnte man schwören, sie hätten höchstpersönlich die westlichen Armee-Einheiten von New Mexiko nach Kalifornien beordert und die östlichen Divisionen nach Veracruz, um auf Mexiko City vorzurücken. Was die Blockade der Seestreitkräfte anbelangt …«
»Die verfluchen sie, weil ihnen dadurch der Zugang zu Gütern aus diesem Teil der Welt verwehrt wird«, fügte Christien mit einem trockenen Lächeln hinzu. »Die meisten glauben an den Fall von Mexiko City vor dem Ende des Sommers oder hoffen zumindest darauf.«
»Gebe Gott, dass sie Recht haben«, sagte Cassard. »Allmählich habe ich genug von der ganzen Angelegenheit.«
Es schien ein guter Zeitpunkt zu sein, das Thema zu wechseln. Dementsprechend erkundigte sich Christien nun nach dem Zustand der Bewässerungsgräben der Plantage, dem Fortschritt bei den notwendigen Reparaturmaßnahmen am Hochwasserdamm, der Anzahl und dem Gesundheitszustand der Maultiere, den Ausbesserungsarbeiten an der nahe gelegenen Zuckerrohrmühle, und er wollte wissen, wie hoch die Unfall- und Sterberate auf der Plantage wäre. Während die beiden in ihre Unterhaltung über dieses und jenes vertieft waren, durchquerten sie die Ländereien von River’s Edge und besichtigten die Stallungen, die Scheunen und die anderen Wirtschaftsgebäude. Am Schluss kamen sie vor einer kleinen Kirche zu stehen,