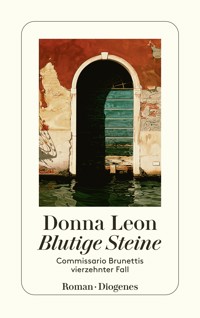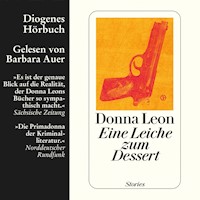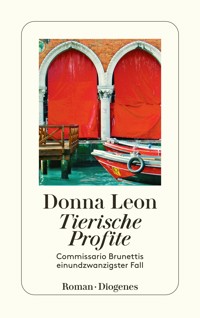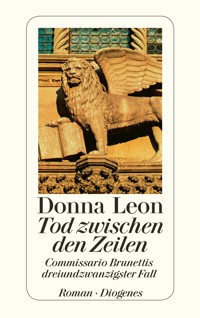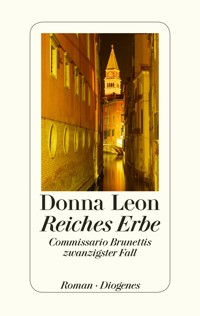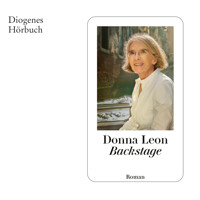10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissario Brunetti
- Sprache: Deutsch
Als Vittorio Fadalto in einer Sommernacht auf dem Rückweg von der Arbeit mit dem Motorrad verunglückt, glauben alle an einen Unfall. Nur nicht seine Frau, die Brunetti um Hilfe bittet. Wollte tatsächlich jemand Fadalto etwas Böses? Oder sind das nur Hirngespinste seiner schwerkranken Frau? Brunetti braucht all seine Intuition – und enthüllt schließlich ein Verbrechen größeren Ausmaßes mit Folgen für die Gewässer des ganzen Veneto.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Donna Leon
Geheime Quellen
Commissario Brunettis neunundzwanzigster Fall
Roman
Aus dem Amerikanischen von Werner Schmitz
Diogenes
Für Ana de Vedia
They loathed to drink of the river.
He turned their waters into blood.
Mit Ekel erfüllte der Trank nun,
des Stromes Gewässer ward zu Blut.
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL, ISRAEL IN ÄGYPTEN
1
Ein Mann und eine Frau näherten sich, ins Gespräch vertieft, dem Ponte dei Lustraferi, schweißgebadet an diesem Nachmittag Ende Juli. Auf der breiten riva kannte die Sonne keine Gnade; grelles Licht sengte ihre Rücken, und das blendend weiße Pflaster sandte die Strahlen in ihre Gesichter zurück.
Der Mann trug sein Jackett – einen Finger in der Kragenschlaufe – über der Schulter. Die Frau trug eine beige Leinenhose und ein langärmeliges weißes Leinenhemd und hatte ihr blondes Haar zu einem Pferdeschwanz hochgebunden. Am Fuß der Brücke blieben beide plötzlich wie angewurzelt stehen; im Rio della Misericordia versperrte ein großes Boot allen anderen die Zufahrt in den kleineren Rio dei Lustraferi. Der Wasserpegel dieses kleineren Kanals war nur noch halb so hoch, denn er war auf einer Strecke von fünfzig Metern durch zwei Spundwände abgeriegelt.
Schlamm und eine unappetitliche schwarze Masse waren an den Rändern zurückgeblieben und in der Mitte des Kanals ein breiter, öliger Film. Zwischen der Brücke und der Spundwand lag ein Baggerschiff mit einem Container am Bug, in den die Baggerschaufel den Bodensatz aus dem Kanal entlud. Eine Bö von der Lagune trieb den Fäulnisgeruch vor sich her, ohne den Ölfilm auch nur zu kräuseln. Ein jaulender Dieselmotor saugte das Wasser durch einen dicken, über die Spundwand hängenden Schlauch und spie es auf der anderen Seite wieder aus.
»Oddio«, sagte Commissario Claudia Griffoni. »Ich habe noch nie dabei zugesehen.«
Guido Brunetti, ihr Freund und Kollege, den rechten Fuß auf der ersten Brückenstufe, in Entdeckerpose wie Hernán Cortés am Pazifik, rief entzückt: »Bei mir ist es auch Jahre her!«
»Ich habe mir noch nie überlegt, wie man das macht«, rief Griffoni voller Neugier und ging die Stufen hinauf, um besser zu sehen.
»Wo haben die nur das Geld dafür her?«, murmelte Brunetti, während er ihr folgte. Gerade heute hatte im Gazzettino ein langer Artikel über all die Infrastrukturprojekte gestanden, die aus Geldmangel beschnitten oder ganz gestrichen worden waren. Das Nachsehen hatten einmal mehr: die Alten, die Jungen, friedliche Bürger, Studenten, Lehrer, ja selbst die Feuerwehr. Wo um alles in der Welt nahm der Bürgermeister, deus ex machina, die nötigen Mittel für die Reinigung der Kanäle her?
»Er wirft uns ein paar Krumen hin«, bemerkte Griffoni.
Brunetti betrachtete den Schlick, jahrzehntealten Schlamm und Abraum, der da ans Licht befördert wurde. Die schwarze Schmiere begann dicht unterhalb der Hochwasserlinie. Dunkel, modrig, übelriechend, glitschig und glatt erinnerte er an eine Fäkalienmulde. In Brunetti stieg nackter Ekel auf. »Wie passend, dass ausgerechnet er uns das vorsetzt«, sagte er.
Doch trotz des Gestanks rührten sie sich nicht vom Fleck. Brunetti fühlte sich in seine Kindheit zurückversetzt, als die Kanäle noch von Hand und wesentlich häufiger gereinigt wurden. Er erinnerte sich an die Holzstege, auf denen Arbeiter mit Schaufeln und Eimern behende wie Katzen herumkletterten.
Da donnerte es so laut, dass sie sich die Ohren zuhielten. Der Bagger hatte sein schwarzes Riesenmaul für eine Verschnaufpause aufs Deck des Bootes fallen lassen.
In der Führerkabine war ein Mann in dunkelblauem Overall zu erkennen, der, eine Zigarette im Mundwinkel, mit beiden Händen die Knöpfe und Hebel der Maschine bediente. Wie sehr hatte Brunetti sich früher gewünscht, selbst einmal eine solche Arbeit zu haben: fast wie ein Spiel, aber mit so viel Macht! Griffoni wirkte nicht minder gebannt, auch wenn die Stadt wohl kaum eine Frau als Kranführer einstellen würde, und schon gar nicht eine Neapolitanerin.
In stillem Einvernehmen liefen sie ganz über die Brücke hinüber und beobachteten von der anderen Seite aus, wie die zusammengebissenen Zähne vom Deck aufschwebten und der Bagger schließlich über dem Kanal sein grässliches Maul aufriss und die Zähne im Wasser versenkte.
Der Mann betätigte einen Hebel, der mächtige Stahlarm schwenkte ein kleines Stück nach rechts, ruckelte und kam dann aus der schmutzigen Brühe ans Licht. Die Plastik-, Gummi- und Eisenreste zwischen seinen Lefzen erinnerten Brunetti an einen riesigen Rottweiler über einer Schüssel Spaghetti. Wasser troff in den Kanal; dann schwenkte das Maul zum Bug des Boots, wo bereits ein ganzer Berg schlammigen Unrats lag. Die Zahnreihen klappten auf, und der Schrott klirrte und schepperte auf den Haufen. Mit ein paar Handbewegungen befreite der Arbeiter die Zahnlücken von den letzten Resten, und schon schwenkte das Maul zurück und tauchte aufs Neue ins Wasser.
Erst jetzt bemerkten sie einen zweiten Arbeiter, der mit einer Schaufel auf der riva stand. Sobald der Bagger abschwenkte, ging dieser über ein Brett an Bord und schippte die Abfälle auf einen Haufen: verrottende Plastiktüten voller Flaschen, ein kaputtes Radio, einen Fahrradreifen und andere, zur Unkenntlichkeit vergammelte Gegenstände.
Immer noch konnten sie sich von dem Anblick nicht lösen und blieben in stillem Einverständnis stehen.
Plötzlich sprang der Baggerführer auf, stieg die Sprossen hinunter an Deck und spähte über den Bootsrand. Er schirmte die Augen ab und starrte angestrengt in die dunkle Brühe. Dann stellte er den Motor leiser, winkte den anderen zu sich und zeigte auf die Stelle im Wasser. Was sie sagten, war nicht zu hören, doch die Heftigkeit der Gesten sprach eine deutliche Sprache.
Brunetti fiel auf, wie steif die zwei Männer sich auf einmal bewegten. Während der Baggerführer in die Kabine zurückkehrte, wirkte er widerwillig, ganz so, als wollte er lieber nicht weitermachen.
Bitte nicht, flehte Brunetti innerlich; laut aussprechen wollte er seinen Gedanken nicht, aus Furcht, sich vor Griffoni lächerlich zu machen, falls der Bagger ihn eines Besseren belehren sollte. Er blickte auf seine Hände, die sich um das Eisengeländer der Brücke spannten, die weiß hervortretenden Knöchel. Griffonis Hände sahen genauso aus. Aus dem Augenwinkel bemerkte er ihr angespanntes Profil, die starre Kinnpartie.
In diesem Moment ließ der Baggerführer seine Hebel los, sprang aufs Deck hinunter und spähte erneut über den Bootsrand. Er wechselte einen Blick mit seinem Kollegen, der zurück auf der riva war, zuckte schließlich die Schultern und kehrte in den Führerstand zurück.
Der Motor wurde lauter. Griffoni und Brunetti nahmen Haltung an, tauschten einen kurzen Blick und ließen den Kanal nicht mehr aus den Augen.
Man hörte die Kupplung und das Knirschen der Kette. Erst kam der Baggerarm aus dem Wasser, dann die Schaufel an seinem Ende.
Brunetti zwang sich, nicht wegzusehen. Griffoni neben ihm war zur Salzsäule erstarrt.
Der Eisenkopf schwenkte kurz in die andere Richtung. Als er sich ihnen zuwandte, erkannten sie den schmutzig weißen Leichnam eines Kühlschranks. Klein, wie er war, hätte er Brunetti kaum bis zur Hüfte gereicht. Mit seiner an einem Scharnier baumelnden Tür sah er aus wie Kriegsbeute.
Brunetti und Griffoni sahen einander an. Erst lächelte sie, dann Brunetti mit einem Achselzucken. Ohne ein Wort wandten die beiden sich ab und ließen die Brücke hinter sich.
2
Eine Weile schwiegen sie einträchtig. Dann fragte Griffoni: »Was dachtest du, was da zum Vorschein käme?«
»Ich fürchtete – das Verhalten der Männer schien mir darauf hinzudeuten –, sie hätten eine Leiche gefunden«, druckste Brunetti.
»Passiert das oft?«, fragte Griffoni, die unvermutet stehengeblieben war.
»Nein, zum Glück.« Brunetti versuchte ein Lächeln hinzubekommen. »Nicht oft.«
Seine Kollegin hob nachdenklich das Kinn: »Diese Frauenleiche auf dem Lido – wann war das, vor sechs, sieben Jahren?«
Brunetti erinnerte sich. Der Fund hatte die ganze Stadt schockiert.
»Wo kamen die Mörder her? Bangladesch?«, fragte Griffoni.
»Indien. Aber das war vor deiner Zeit.«
Sie nickte. »Ich kenne den Fall nur aus der Zeitung. Il Mattino ist geradezu ausgeflippt, ja alle Blätter waren voll davon. Die haben sich darauf gestürzt wie die Geier.«
Brunetti war die Sache noch gegenwärtig, obwohl er zu der Zeit in Ljubljana gewesen war, um die Auslieferung eines Italieners zu erwirken, der seinen Arbeitgeber ermordet hatte und nach Slowenien geflohen war. Bei Brunettis Rückkehr saßen die Mörder der Frau bereits hinter Schloss und Riegel.
»Sie wurde in einem Kanal auf dem Lido gefunden, nicht wahr?«, fragte Griffoni. »Und dann war da noch etwas mit einem Koffer.«
Brunetti erinnerte sich an die grausigen Einzelheiten. »Getötet wurde die Frau in Mailand. Die Leiche wurde in einem Koffer hierhergebracht und auf dem Lido ins Wasser geworfen.«
»Es ging um Geld, oder?«
»Wann denn nicht?«
»Den Rest habe ich vergessen«, sagte Griffoni. »Irgendwas mit einem Taxi.«
Brunetti blieb stehen und zupfte an seinem Hemd, das ihm am Körper klebte. Die Hitze hatte sich im Lauf der Woche noch gesteigert, ebenso die Luftfeuchtigkeit, auch wenn an Regen nicht zu denken war. Die Boote waren überfüllt, kein Lüftchen wehte, alle Nerven lagen blank.
Brunetti schnaubte, ob entrüstet oder fassungslos, wusste er selbst nicht. »Soweit ich mich erinnere, verpassten die Mörder den letzten Zug nach Mailand; also nahmen sie am Piazzale Roma ein Taxi und zahlten an die fünfhundert Euro für die Fahrt. Dem Taxifahrer fiel der leere Koffer auf, und als er die Nachricht in der Zeitung sah, erinnerte er sich, wie nervös die zwei gewesen waren. Er alarmierte die Questura.« Brunetti rieb sich die Hände. »Und schon hatten wir sie.«
»Wie es weiterging, war nicht mehr zu lesen«, sagte Griffoni. »Weißt du etwas darüber?«
»Nein. Da der Mord in Mailand verübt wurde, muss es dort auch zum Prozess gekommen sein.« Brunetti sah auf die Uhr. Es war kurz vor drei, Zeit für ihre Verabredung im Ospedale Fatebenefratelli. Eine Patientin im dortigen Hospiz hatte um ein Gespräch mit der Polizei gebeten.
Sie kannten ihren Namen und ihr Alter: Benedetta Toso, 38, Venezianerin, wohnhaft in Santa Croce. Mehr wussten sie nicht, doch da der Anruf aus dem Hospiz gekommen war, wollten sie den Besuch lieber nicht auf die lange Bank schieben. Der Commissario war tags zuvor von Cecilia Donato kontaktiert worden, Signora Tosos behandelnder Ärztin, die vor Jahren mit Brunettis Bruder Sergio, einem Röntgentechniker am Ospedale Civile, zusammengearbeitet hatte.
In ihrer Funktion als Chefärztin am Hospiz des Ospedale Fatebenefratelli hatte sie Brunetti zu sprechen verlangt. Der Mann in der Telefonzentrale bat sie zu warten, er müsse erst schauen, ob Commissario Brunetti im Hause sei; doch als sie hinzufügte, sie sei mit Brunettis Bruder Sergio befreundet, wurde ihr Anruf sofort durchgestellt.
Ohne näher auf die Umstände einzugehen, vermeldete die Ärztin, Signora Toso sei ihre Patientin und habe statt eines Priesters die Polizei sprechen wollen, am liebsten eine Polizistin.
Also wurde Griffoni entsandt. Brunetti begleitete sie in der Hoffnung, Dottoressa Donatos Bekanntschaft mit seinem Bruder könne ihnen zu weiteren Auskünften verhelfen. Griffoni würde die Regie übernehmen. Wenn sie mit der Patientin sprach, sollte Brunetti so tun, als sei sie seine Vorgesetzte.
Um fünf vor drei betraten die beiden das Gebäude und gingen geradewegs zum Aufzug. Brunetti hatte schon mehr als einen Freund besucht, der in diesem Hospiz aus dem Leben geschieden war, genau wie Freunde im Ospedale Civile. Sollte er selbst in die Lage kommen, würde er sich für das Fatebenefratelli entscheiden.
In der zweiten Etage steuerte Brunetti unverzüglich die Stationstheke an. Seine Besuche in Kliniken hatten sich stets als Geduldsproben erwiesen: warten, bis man in die Station vorgelassen wurde; einen freien Stuhl in dem jeweiligen Zimmer ergattern, in dem gewöhnlich zwei, nicht selten sogar vier Patienten lagen; das Rattern der Rollwagen, wenn Mahlzeiten angeliefert und verteilt wurden.
In diesem Flur hingegen herrschte Stille. Hinter dem Empfang saß ein junger Mann mit einem langen blonden Zopf. Er trug Jeans und ein weißes T-Shirt unter einem weißen Laborkittel und begrüßte sie mit einem Lächeln. Auf seinem Namensschildchen stand einfach nur »Domingo«. »Sind Sie die Polizisten?«, fragte er in nicht ganz akzentfreiem Italienisch, und es klang, als freue er sich über ihr Kommen.
Griffoni, vorgeblich die Ranghöhere, nickte bestätigend. »Ja. Commissario Claudia Griffoni und« – mit einem Fingerzeig auf Brunetti – »mein Kollege Guido Brunetti.«
»Angenehm.« Der junge Mann lächelte. »Dottoressa Donato hat mich gebeten, Sie zu ihr zu bringen, sobald Sie da sind.« Er kam in weißen Converse-Sneakers hinter der Theke zum Vorschein und gab ihnen die Hand. »Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Signora Toso möchte Sie dringend sprechen.«
Und bevor sie nachhaken konnten, lief er ihnen auch schon den Flur hinunter voraus. Brunetti fiel auf, dass die Wände mit Schwarzweißfotos von Stränden dekoriert waren: schnurgerade oder hügelig, windstill oder aufgepeitscht, Felsen oder nur Sand. Gemeinsam war allen das gänzliche Fehlen von Menschen oder auch nur menschlichen Spuren: keine Getränkedosen, Plastikabfälle, Liegestühle, Boote – nur Wasser und Weite.
Vor der dritten Tür links, die offen stand, blieb der junge Mann stehen und rief leise hinein: »Cecilia, die Polizei ist hier.«
Eine Stimme sagte etwas, das Brunetti nicht hören konnte, und Domingo gab den Weg frei. Griffoni ging voraus.
Eine äußerst korpulente weißhaarige Frau machte Anstalten, sich zu erheben, was ihr erst gelang, als die beiden den Schreibtisch erreicht hatten. Mit der linken Hand auf die Tischplatte gestützt, reichte sie Griffoni und dann Brunetti die Rechte.
Wie der junge Mann trug die Frau ein Namensschildchen, jedoch mit Titel und vollem Namen: Dottoressa Cecilia Donato. Einladend wies sie auf die Stühle vor ihrem Schreibtisch, umklammerte die Armlehnen und ließ sich mühsam wieder nieder.
Nicht nur ihr Körper, auch ihr Kopf war birnenförmig. Stirn und Augen die einer weit kleineren Person, während die untere Gesichtshälfte sich ausbuchtete und die Wangen direkt auf dem Hals zu ruhen schienen, der fast so breit war wie ihr Kiefer. Ihr Körper, der von den Schultern abwärts immer umfangreicher wurde, war hinter dem Schreibtisch nur zur Hälfte zu sehen.
Um sie nicht anzustarren, richtete Brunetti den Blick auf ihre Hände. Schlank und glatt, trennte eine dünne Einkerbung wie von einer fest gezurrten Schnur sie von den prallen Unterarmen. An der Linken trug sie einen goldenen Ehering.
»Danke, dass Sie gekommen sind, nehmen Sie doch Platz«, ließ Dottoressa Donato eine tiefe Altstimme ertönen. Sie sah auf eins der Papiere vor sich nieder, wobei ihr sich lichtendes Haar auf dem Schädeldach bemerkbar wurde, blickte auf und sagte zu Brunetti: »Ich habe am Telefon erklärt, worum Signora Toso gebeten hat, Commissario. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen.«
Brunetti nickte. Und nach kurzem Überlegen: »Heißt das, Sie wissen mehr, Dottoressa?«
Sie ließ sich mit der Antwort Zeit.
Schlechte Lügnerin, dachte Brunetti.
»Ich denke«, erklärte sie schließlich, »es spielt keine Rolle, was oder wie viel ich über Signora Toso weiß. Sie ist meine Patientin, also ist alles, was sie mir erzählt hat, vertraulich.«
Als Brunetti nichts erwiderte, fügte sie hinzu: »Das ist Ihnen sicherlich klar, Commissario.«
»Selbstverständlich, Dottoressa. Mich interessiert nur, ob eine zweite Person Bescheid weiß.«
»Warum?«
»Falls weitere Aussagen notwendig werden sollten«, antwortete Brunetti.
»Und warum sollte dem so sein?«
Brunetti breitete die Hände aus. »Weil sie hier ist.«
Die Ärztin sah hilfesuchend zu Griffoni. Als diese nur den Kopf schüttelte, wandte sie sich wieder Brunetti zu. »Ich verstehe.«
»Sie könnten ihre Aussage bestätigen.«
Die Ärztin stützte die Ellbogen auf die Tischplatte, legte die Handflächen aneinander und ihr Kinn auf die Fingerspitzen. »Wozu sollte das nötig sein?«
Brunetti schlug lässig die Beine übereinander. »Nun ja, die Frau liegt im Sterben und ruft nach der Polizei. Da ist es doch … nicht auszuschließen, dass es um ein Verbrechen gehen könnte.« Brunetti legte eine Pause ein.
Als die Ärztin nichts erwiderte, fuhr er fort: »Wenn Sie eingeweiht sind, Dottoressa, würde Ihre Bestätigung glaubhafter machen, was sie …« Brunetti verstummte: Er wusste nicht, in welcher Zeitform er den Satz beenden sollte.
»Mitzuteilen hat«, ergänzte die Ärztin. Brunetti nickte.
Die Frau rückte auf ihrem Stuhl hin und her, und Brunetti überlegte unwillkürlich, was für eine Anstrengung es sie kosten musste, diese Masse in Bewegung zu setzen. Er sah zu Griffoni, sagte aber nichts.
Als Dottoressa Donato ihre neue Position weiter vorn auf dem Stuhl gefunden hatte, fuhr sie fort: »Dies ist ein Hospiz, Commissario. Meine Patienten gehen nicht mehr nach Hause.« Sie presste die Lippen zusammen und sah ihn abweisend an: »Als ihre Ärztin werde ich auch dann nicht weitererzählen können, was Benedetta Toso mir anvertraut hat, wenn sie nicht mehr ist.«
Brunetti beugte sich vor und zupfte sich das Hemd vom Rücken. »Vielleicht sollten wir besser mit Signora Toso sprechen«, sagte er.
Doch Griffoni kam ihm zuvor: »Können Sie ungefähr sagen, wie lange Signora Toso noch zu leben hat, Dottoressa?«
Sichtlich erleichtert, dass endlich jemand Anteilnahme – oder zumindest Interesse – an ihrer Patientin bekundete, bedachte die korpulente Dottoressa Griffoni mit einem kleinen Lächeln und antwortete schließlich: »Ein paar Wochen. Bestenfalls. Vielleicht deutlich weniger. Es ist in ihren Knochen angelangt, daher muss sie sediert werden.«
»Wo hat es angefangen?«, fragte Griffoni.
»In ihrer Brust«, antwortete Dottoressa Donato. »Vor fünf Jahren.«
Griffoni ließ ein Stöhnen vernehmen. »Ach, die Ärmste.«
Die Miene der Ärztin entspannte sich. »Sie war eine Zeitlang im onkologischen Zentrum in Aviano, dort begann vor ein paar Jahren ihre Behandlung, und man hielt sie für geheilt. Sie bekam Bestrahlung und Chemo und war längere Zeit ohne Symptome, bis Anfang dieses Jahres. Da fand man unter ihrem linken Arm eine Geschwulst.«
Brunetti hatte sich in einen Stein verwandelt. Die Frauen fuhren fort in ihrem Zwiegespräch. »Es hatte bereits ihre Knochen erfasst. In Aviano versuchte man noch eine Behandlung, aber nichts schlug an. Vor etwas mehr als drei Wochen kam sie schließlich hierher.«
Griffoni beugte sich vor. Mit gesenktem Kopf und gefalteten Händen bewegte sie den Oberkörper ein paarmal kaum merklich vor und zurück.
»Hat sie Kinder?«, fragte sie.
»Ja, zwei Töchter. Livia ist zwölf, Daria vierzehn.«
»Und der Vater?«, fragte Griffoni von Frau zu Frau.
»Ihr Mann ist eine Woche nach ihrer Ankunft hier ums Leben gekommen.« Dottoressa Donatos Stimme wirkte unbeteiligt, aus ihrer Miene sprach das genaue Gegenteil.
»Oddio«, flüsterte Griffoni. »Was ist passiert?«
Die Ärztin schien der traurigen Unterhaltung ein Ende machen zu wollen, sagte aber schließlich: »Er wurde bei einem Unfall getötet.«
»Wie?«
»Er kam auf dem Heimweg von der Arbeit mit seinem Motorrad von der Straße ab. Die Polizei sagt, entweder er hat die Kontrolle verloren, oder ein pirata della strada hat ihn gestreift.«
»Und?«, schaltete sich Brunetti ein. »Wurde der Fahrer gefunden?«
Sie sah ihn verständnislos an. »Als ob heutzutage noch jemand anhalten würde, nachdem er einen Unfall verursacht hat.«
»Zeugen?«, fragte er.
Sie schüttelte den Kopf. »Das müssen Sie schon die Polizei fragen«, sagte sie ohne hörbare Ironie. »Soweit ich weiß, hat sich niemand gemeldet. Ich nehme an, man hat den Unfallort und das Motorrad untersucht, aber gehört habe ich nichts.«
Alle drei verfielen in Schweigen, bis Griffoni besorgt fragte: »Und Signora Toso?«, und sich dann einen Ausbruch leistete: »Wie erträgt sie das nur?«
Wieder rutschte die Ärztin umständlich auf ihrem Stuhl herum, noch immer auf der Suche nach einer bequemeren Verteilung ihrer Masse. Als sie endlich so weit war, meinte sie kopfschüttelnd: »Ihr bleibt keine Wahl.«
»Wie meinen Sie das?« Griffoni tat verwirrt.
»Wegen der Mädchen. Für die muss sie stark sein.«
Als keiner von beiden antwortete, fuhr die Ärztin fort: »Maria Grazia, ihre Schwester, kam am Tag nach dem Unfall. Und sagte es ihr.« Sie legte die Hände flach auf den Tisch, betrachtete sie eingehend, drehte mit dem Daumen den Ehering hin und her.
»Ich hatte Dienst und habe ihre Schreie gehört.« Sie beobachtete den Ring so angespannt, als drehe jemand Fremdes an ihm herum oder als bewegte er sich von alleine. Ohne aufzusehen, sagte sie schließlich: »Ich ging in ihr Zimmer und hörte, wie sie Maria Grazia anschrie: ›Das ist meine Schuld. Meine Schuld.‹« Die Ärztin schüttelte seufzend den Kopf.
»Die Mädchen sind nach dem Unfall zwei Tage lang nicht gekommen, dann hat Maria Grazia sie wieder mitgebracht.«
»Was war denn genau passiert?«, fragte Griffoni.
Die Ärztin sah von Griffoni zu Brunetti und erzählte weiter: »Nachdem ihre Familie weg war, gingen Domingo und ich hinein. Sie hatte sich aufgedeckt und versuchte, aus dem Bett zu steigen.« Wieder sah sie auf ihre Hände. »Wir mussten sie daran hindern.«
Sie zögerte kurz und sagte staunend: »Es war ganz leicht. Die übermenschlichen Kräfte der Sterbenden, von denen man in der Literatur liest, sind ein Mythos. Domingo hielt sie, und ich ging ein Beruhigungsmittel holen. Bei meiner Rückkehr war sie völlig in sich zusammengesunken. Die Spritze gab ich ihr trotzdem, so schlief sie durch.« Die Ärztin stockte. Brunetti wusste aus langjähriger Erfahrung, dass sie sich dem Ende ihrer Geschichte näherte und irgendwelche Zwischenfragen sie nur aus dem Konzept bringen würden.
»Ich habe seinen Tod einige Tage später einmal erwähnt«, schloss Dottoressa Donato, »und Benedetta mein Beileid ausgesprochen. Sie wollte nichts hören und drehte sich von mir weg.« Hiermit wandte sich auch Dottoressa Donato ab und studierte die Pinienwipfel vor ihrem Fenster.
Brunetti erhob sich. »Ich denke, wir sollten jetzt mit Ihrer Patientin sprechen, Dottoressa«, sagte er. »Wenn Sie gestatten.«
3
Auch Griffoni erhob sich. Dottoressa Donato stemmte sich mühsam aus ihrem Stuhl, hielt den beiden die Tür auf und ging ihnen voran Richtung Empfangstheke. Die beiden folgten schweigend und ohne einen Blick zu wechseln der trägen Masse durch den Flur.
Der Empfang war verwaist, auf dem Tresen weder Papiere noch irgendwelche Instrumente. Dottoressa Donato bog dahinter in einen Gang, wo die Fotos alle gleich groß und farbig waren. Jedes zeigte einen einzeln stehenden Baum. Brunetti erkannte eine Birke, einsam an einem Fluss; einen Kirschbaum mitten auf einem Feld; eine Kastanie, die sich an einen Abhang klammerte; und einen gewaltigen Ahorn zuoberst auf einem Hügel. Jedes dieser Fotos schien das Leben des Baums zu erzählen. Die Birke neigte sich gierig zum Wasser; das Laub des Kirschbaums war fast grau vor Durst; die Kastanie wirkte verängstigt, während der Ahorn fordernd auftrat und ganz den Eindruck machte, als werde er seine Ansprüche auch durchsetzen können.
Vor einer der Türen hielt die Ärztin inne. »Ich werde ihr zuerst von Dottoressa Griffoni erzählen. Ich nehme an, Sie haben verabredet, dass sie das Gespräch führen soll«, und, ohne eine Miene zu verziehen, zu Brunetti: »während Sie sich schön brav im Hintergrund halten.«
Um Griffonis Beherrschung war es geschehen. Sie schlug eine Hand vor den Mund, prustete aber dennoch los. Sie platzte heraus: »Ich wünschte, Sie wären meine Ärztin.«
Dottoressa Donato senkte geschmeichelt den Kopf, darauf sah sie Griffoni in die Augen: »Aber dann wären Sie hier als meine Patientin. Und das möchte ich Ihnen nicht wünschen, meine Liebe.« Aus ihrer Stimme sprach aufrichtige Sympathie.
Sie klopfte an, wartete kurz und klopfte noch einmal. Von drinnen ließ sich etwas vernehmen. Dottoressa Donato ging hinein, bedeutete Griffoni und Brunetti, draußen zu warten, und schloss die Tür.
Griffoni lehnte sich mit verschränkten Armen und übereinandergeschlagenen Beinen an die Wand, als warte sie auf den Bus oder ein Vaporetto und habe alle Zeit der Welt.
Brunetti ging mit den Händen in den Taschen zum Fenster. Er entdeckte die Pinien. In der säuberlich geharkten Erde unter ihnen wucherte eine Blumenpracht. Ein schöner Anblick für die Patienten, dachte er – gesetzt den Fall, dass sie noch bis zum Fenster kamen.
Im Korridor näherte sich ein älterer Mann mit einem Hund, der sogar noch älter aussah, ein struppiges beiges Knäuel, das lustlos neben ihm hertrottete. »Komm, Eglantine, nur noch ein paar Schritte, dann sind wir bei deiner Mama.« Bei dem Wort ›Mama‹ blieb der Hund stehen und sah zu dem Mann auf. »Ganz recht, mein Kleiner. Du weißt doch, wo sie ist«, sagte das Herrchen und ließ den Hund von der Leine. Dieser flitzte, um Jahre jünger, aufgeregt jaulend den Gang hinunter und verschwand im hintersten Zimmer auf der rechten Seite.
Spitze Jubelrufe klangen herüber. Der alte Mann wickelte die Leine auf und steckte sie in seine Jacke. Eine Wolljacke, wie Brunetti erstaunt bemerkte. Dann tappte der Mann, »Permesso« murmelnd, an ihnen vorbei bis zu dem Zimmer, wo auch er lautstark begrüßt wurde.
Endlich kam Dottoressa Donato wieder heraus und erklärte bei angelehnter Tür: »Sie sagt, sie möchte Sie beide sprechen.«
Griffoni stieß sich von der Wand ab: »Wäre es Ihnen lieber, dabei zu sein, Dottoressa?«
Der Gesichtsausdruck der Älteren wurde weich, doch sie wehrte ab: »Ich denke, es ist besser, wenn nur Sie beide hineingehen.« Und auf Griffonis fragenden Blick hin: »Sie braucht immer eine Weile, um zu verstehen, was man ihr sagt. Je weniger Aufregung, desto besser für Benedetta – und für Sie.« Sie bemerkte den Blick, den Brunetti und Griffoni tauschten, und erklärte leise: »Sie ist noch ganz klar im Kopf, keine Sorge. Das kommt nur von dem Schmerzmittel. Es ist für sie, als würde ständig ein Fernseher auf voller Lautstärke laufen. Sie muss sich sehr konzentrieren, um etwas zu verstehen.« Als keiner von ihnen etwas darüber sagte, fügte sie noch leiser hinzu: »Es ist schlimm, wenn es in den Knochen sitzt.«
Damit zog sie die Tür auf. Griffoni und Brunetti betraten schweigend den Raum.
Rechter Hand stand mit dem Kopfende zur Wand ein einzelnes Bett. Auch wenn eine handgestrickte rote Decke darüber lag, war es doch unverkennbar ein Krankenhausbett: Metallgitter an beiden Seiten, wenn auch heruntergeklappt, und am Kopfende der Anschluss für eine Sauerstoffmaske. An einem Ständer hingen zwei Plastikbeutel, aus denen Flüssigkeiten, eine klare und eine orangefarbene, in Plastikschläuche tropften, die unter der Bettdecke verschwanden.
Der Kopf der Kranken war mit grauen Haarstoppeln bedeckt, die ihre eingefallenen Schläfen noch mehr hervortreten ließen. Wie auf die Kissen geworfen, die ihn hätten stützen sollen, war ihr Oberkörper nach rechts gesunken. Sie nickte den beiden zu, jedoch ohne zu lächeln. Griffoni näherte sich dem Bett und blieb neben dem Besucherstuhl stehen. Wieder nickte die Frau, und die Kommissarin setzte sich. Brunetti wählte den zweiten roten Plastikstuhl am Fenster, doch die Lehne verbrannte ihm den Rücken. Er richtete sich auf, möglichst weit weg von dem aufgeheizten Plastik.
Alle schwiegen, bis Griffoni schließlich erklärte: »Signora Toso, wir sind hier, weil Dottoressa Donato uns gerufen hat. Sie sagt, Sie möchten mit jemandem von der Polizei sprechen.«
Die Frau sah zu Griffoni, dann zu Brunetti und wieder zu Griffoni. Sie nickte stumm. Sie hätte ebenso gut dreißig wie fünfzig sein können. Ihr Gesicht war nur noch Haut und Knochen. Und dennoch ahnte man zwischen den Ruinen noch Spuren ihrer früheren Schönheit. Dunkelbraune Augen blickten aus tiefen Höhlen. Mit den grauen Ringen darum erinnerten sie Brunetti an die Augen der Lemuren, die er vor Jahren in einer Fernsehdokumentation gesehen hatte. Von ihrer Nase, wenngleich immer noch gerade und ebenmäßig, war ein scharfer Zinken geblieben, schorfig und trocken. Nur ihr Mund hatte seine alte Schönheit bewahrt: volle, rote Lippen, wenn auch verkrampft vor Schmerzen, die Brunetti sich lieber nicht vorstellen wollte.
Griffoni schwieg, und Brunetti rührte sich nicht. Er bemerkte zwei Unebenheiten unter der roten Decke, ein wenig unterhalb der Stelle, wo ihre Taille sein musste. Um ihr nicht ins Gesicht zu starren, während er darauf wartete, dass die Frauen miteinander zu reden anfingen, sah er sich diese Erhebungen genauer an. Konnten dort irgendwelche medizinischen Gerätschaften verborgen sein? Womöglich Apparate zum Ableiten von Körperflüssigkeiten – was für ein schreckliches Wort – oder zum Einspritzen von Medikamenten? Groß wie Äpfel waren sie, jedoch flacher, und beide voller Knubbel, auf der einen mehrere in einer Reihe, auf der anderen größere und nicht so viele. Er hielt den Blick darauf gesenkt, so wie sich das Schweigen über den Raum gesenkt hatte.
Aber was war das? Hatte sich da nicht etwas bewegt? Nun an der anderen Erhebung. Es schlug kleine Wellen und beruhigte sich wieder. Plötzlich aber krochen die Knubbel aufeinander zu, und während sie über den Körper der Frau zu krabbeln begannen, entfuhr Brunetti ein Stöhnen. Erst als sich die eine in die andere schob, erkannte Brunetti, dass es ihre Hände waren. Er schloss die Augen. Als er sie wieder öffnete, lag eine davon auf der Bettdecke.
»Signora?« Griffonis Stimme beruhigte ihn. »Signora?«
»Sì?«, flüsterte die Frau im Bett und nickte kaum merklich.
»Wir sind hier, um zu hören, was Sie uns sagen möchten.«
Signora Toso hatte die Augen geschlossen. Ihre Brust hob sich, einmal, zweimal, dann schlug sie die Augen auf. »Das Geld«, sagte sie.
»Was ist mit dem Geld?«, fragte Griffoni wie nebenbei, als seien sie alte Freundinnen, die beim Kaffee über ihre Kinder plauderten.
»Er hat ja gesagt«, stöhnte sie und versuchte zu erklären: »Er hat es genommen.«
»Wann war das, Benedetta?«, fragte Griffoni.
Signora Toso schüttelte ganz leicht den Kopf. »Ich«, sie holte zweimal tief Luft, »weiß nicht mehr.«
»Verstehe.« Griffoni beugte sich vor. »Es muss schwer sein. Sich zu erinnern.«
Signora Toso öffnete die Augen und sah ihr ins Gesicht. Ihre Lippen bewegten sich; Brunetti hätte nicht sagen können, ob sie zu lächeln oder zu sprechen versuchte. Schließlich brachte sie ein Wort heraus: »Geburtstag.«
»Verstehe«, sagte Griffoni freundlich und fragte wie aus purer Höflichkeit: »Ihrer?«
Wieder nickte die andere, aber noch kraftloser. Ihre Hand verkrampfte sich.
»Wofür war es denn gedacht, Benedetta?«, fragte Griffoni.
»Klinik.« Dem Wort folgte ein rasselndes Luftholen, das Brunetti die Zähne zusammenbeißen ließ.
Griffoni blickte sich um. »Meinen Sie diese Klinik hier?«
»Nein. Davor.«
»Bevor Sie hierhergekommen sind?«
Signora Tosos Hand entspannte sich. »Sì. Sì.«
»Das ist gut, dass er das Geld dafür aufgetrieben hat«, sagte Griffoni und tätschelte bekräftigend Signora Tosos Hand.
Signora Toso starrte sie an. Ihr angestrengter Atem ging schneller, quälend anzuhören, und beruhigte sich dann langsam wieder. Ihre zweite Hand kam unter der Bettdecke hervor und suchte Griffonis.
»Hat er Ihnen erzählt, woher es stammte?«, fragte Griffoni mit echtem Interesse und unverhohlener Bewunderung.
»Arbeit.«
»Was hat er denn gearbeitet?«, fragte Griffoni. Brunetti spürte, irgendwie war Griffoni zur ältesten, besten Freundin dieser Frau geworden. Sie fragte so unbefangen wie jemand, mit dem man ein Leben lang Geheimnisse ausgetauscht hat, dem man Versprechen gemacht und sie gehalten hat.
Wieder das kaum merkliche Kopfschütteln.
»Wollte er es Ihnen nicht sagen?« Da Signora Toso nicht antwortete, fuhr Griffoni fort: »Mein Mann ist auch nicht anders. Sie sind doch alle gleich: In Gelddingen trauen sie uns nicht über den Weg.« Brunetti fiel der venezianische Tonfall in Griffonis Stimme auf, die verschluckten »l«, das verschliffene marito. Wie machte sie das nur?
»Schlecht«, flüsterte Signora Toso so leise, dass Brunetti sich nicht sicher war, ob er richtig gehört hatte.
»Schlecht, es Ihnen nicht zu sagen?«, fragte Griffoni.
»Schlechtes Geld.« Signora Tosos Mund blieb offen stehen, kein Wort kam mehr heraus, nur noch ein lautes Schnarchen.
Ohne die Hand der anderen loszulassen, lehnte Griffoni sich zurück, sah zu Brunetti und hob fragend das Kinn. Er machte eine abwiegelnde Geste mit der Hand und legte einen Finger an seine Lippen.
Erst jetzt bemerkte Brunetti, wie heiß ihm war. Er versuchte das rechte Bein zu heben, aber das klebte verschwitzt an dem Plastikstuhl. Von der glühend heißen Lehne lief ihm der Schweiß nur so über den Rücken. Die Hände auf die Stuhlkanten gestützt, stemmte er sich hoch; die Hosenbeine lösten sich mit einem schmatzenden Geräusch von der Sitzfläche. Er zupfte und zog an beiden Seiten, bis der Stoff sich von der Rückseite seiner Oberschenkel schälte.
Signora Toso drehte ruckartig den Kopf weg, vielleicht, um weiteren Fragen zu entgehen, oder vor Schmerzen. Brunetti kauerte sich wieder auf seinem Stuhl zusammen. Was meinte sie nur mit »schlechtem Geld«?
Jemand öffnete, ohne anzuklopfen, die Tür. Domingo kam herein, nickte Griffoni und Brunetti freundlich zu, trat ans Bett und ersetzte den leeren Beutel mit der durchsichtigen Flüssigkeit durch einen vollen. Da Griffoni immer noch Signora Tosos Rechte hielt, zog er deren Linke unter der Decke hervor und kontrollierte den Puls. Er legte Signora Tosos Hand auf die Decke zurück, trug etwas in die Krankenakte am Fußende des Bettes ein und verließ das Zimmer so leise, wie er gekommen war.
Brunetti und Griffoni saßen da und betrachteten die Schlafende. Was nun? Zu sprechen wagten sie nicht. Wieder ging die Tür auf, und Domingo trug ein Tablett mit zwei Gläsern Wasser herein. Eins bot er Griffoni an, das andere Brunetti, beide dankten leise, leerten die Gläser in einem Zug und stellten sie auf das Tablett zurück. Der junge Mann entfernte sich schweigend.
Als Brunetti wieder nach der Frau im Bett sah, hatte sie die Augen offen und starrte ihn an. Er zwang sich zu einem Lächeln und nickte ihr zu. Seiner untergeordneten Rolle gemäß blieb er stumm und richtete seine Aufmerksamkeit auf diejenige, die hier das Sagen hatte. Signora Toso tat es ihm nach.
Als sei die Unterhaltung gar nicht unterbrochen worden, fragte Griffoni: »Warum ›schlechtes Geld‹, Benedetta?« Beim Klang ihrer sanften Stimme war Brunetti dankbar, dass Griffoni die Fragen stellte und nicht er, ungeduldig, wie er war, und als Mann selbstverständlich davon ausgehend, dass man seine Fragen zu beantworten habe.
Griffoni erweckte mit ihrer Anteilnahme nicht den Eindruck einer Polizistin, die Informationen sammelte, sie wirkte einfach nur hilfsbereit.
Signora Toso wandte den Kopf nicht länger ab, ließ vielmehr den Blick auf Griffoni ruhen. Sie presste die Lippen zusammen wie jemand, der eine schwere Last zu tragen hat. Von der Anstrengung fielen ihr die Augen zu, doch als sie sie wieder öffnete, wirkte ihr Blick klarer und konzentrierter.
»Es war schlechtes Geld. Ich will das nicht, habe ich gesagt.« Auf einmal sprach sie mit heller Stimme und so deutlich wie nie zuvor. Brunetti entging nicht, welche Mühe sie das kostete.
Er hoffte, Griffoni werde der Versuchung widerstehen, mit Fragen in sie zu dringen, aber da sagte Griffoni schon: »Der arme Mann. Aber ihm blieb nichts anderes übrig, nicht wahr?« Signora Toso sah sie nur an, und Griffoni bohrte weiter: »Sie hätten es für ihn doch auch getan?« Und setzte noch einen drauf: »Oder für Ihre Mädchen.«
»Aber …«
Griffoni unterbrach sie energisch: »Wenn es Ihnen mehr Zeit mit den Mädchen verschafft hat, gibt es kein ›Aber‹, Benedetta.«
Brunetti ließ seine Kollegin nicht aus den Augen, die sich über die todkranke Frau beugte, deren Hand sie hielt, während sie mit der anderen Hand ihren Stuhl umklammerte. Griffonis Frisur war durcheinandergeraten. Signora Toso griff nach einer Strähne und rieb sie zwischen Daumen und Zeigefinger. Sie brachte gerade noch ein Lächeln zustande, bevor die Hand wieder niedersank.
Signora Toso sah zu Griffoni, dann zu Brunetti, dann wieder zu Griffoni. »Die haben ihn umgebracht«, sagte sie mit vollkommen normaler Stimme, als mache sie eine Bemerkung über das Wetter.
»Die? Ihn?«, fragte Griffoni, offenkundig verwirrt.
»Vittorio«, begann Signora Toso. Doch da fielen ihr plötzlich die Augen zu, ihr Kopf rollte zur Seite, und ihr ganzer Körper rutschte von den stützenden Kissen herab auf Griffoni zu, während sie stöhnend die Arme an die Brust presste.
Brunetti eilte herbei. Schnell klappte er das Gitter hoch, beugte sich vor und wollte die Frau festhalten, damit sie sich nicht an dem Eisen stieß.
Doch Griffoni war noch schneller gewesen und hielt Signora Toso bereits an den Schultern. Sie nahm ein Kissen und stopfte es als Puffer dazwischen. Die Frau rührte sich nicht.
»Ich hole jemanden«, sagte Griffoni.
Brunetti blieb bei Signora Toso, auch wenn er nicht wusste, wie er ihr hätte helfen können. Er wandte den Blick ab, dann sah er wieder hin. Abgemagert, runzlig, ausgezehrt von der Krankheit, der sie bald erliegen würde, sah sie viel älter aus als er, dabei war sie noch keine vierzig. Wie gern hätte er sie getröstet, ihren Schmerz gelindert über das, was sie zurücklassen musste. Am liebsten hätte er ihr versprochen, er werde sich um das Wohl ihrer Kinder kümmern, Vittorios Mörder würden gefunden und bald werde sie Frieden finden. Aber wie konnte er das alles mit Sicherheit sagen? Er wusste nur, in kurzer Zeit war sie tot, und bis dahin würde sie noch mehr zu leiden haben.
Stöhnend schlug Signora Toso die Augen auf. Brunetti sah ihr ins Gesicht und versuchte zu lächeln, wollte etwas sagen. Ihr Blick irrte umher, und schon fielen ihr die Augen zu; sie war wieder weggetreten, unruhig und immer wieder leise stöhnend.
»Ich werde tun, was ich kann«, sagte Brunetti, auch wenn er nicht wusste, ob sie ihn hörte. Er hatte sein Versprechen gegeben, und das musste reichen.
4
Dottoressa Donato stürzte ins Zimmer, gefolgt von Griffoni. Die Ärztin fasste Signora Tosos Hand und sprach beruhigend auf sie ein wie bei einem Kind. Bald ließ das Stöhnen nach, und die Patientin atmete regelmäßiger. Dottoressa Donatos Rechte glitt zu Signora Tosos Puls. Schließlich legte sie die schlaffe Hand mit einem Nicken sachte auf die Decke zurück.
Dann zu Brunetti, gereizt: »Was ist passiert?«
Griffoni, die hinter Brunetti stand, nahm das Heft in die Hand: »Wir haben gefragt, warum sie uns sprechen wollte. Sie sagte, jemand habe ›schlechtes Geld‹ bekommen, um für eine Klinik zu zahlen, und ›die‹ hätten Vittorio umgebracht.« Griffoni ließ Brunetti Zeit, etwas hinzuzufügen. Als nichts kam, ergänzte sie noch: »Das Sprechen bereitete ihr große Mühe.«
Die Ärztin sah zwischen den beiden hin und her: »Und weiter?«
Da Griffoni schwieg, erklärte Brunetti: »Nichts weiter. Wir haben nicht erfahren, welche Klinik oder wie viel Geld oder warum ›schlechtes Geld‹ und wer Vittorio ist oder war.«
»Das war ihr Mann. Vittorio Fadalto«, erklärte Dottoressa Donato knapp. »Er ist, wie gesagt, vor kurzem gestorben. Sie ist aus einer Klinik auf dem Festland zu uns gekommen. Von Geld weiß ich nichts.«
»Wie lange war sie dort?«, fragte Brunetti.
»Woher soll ich das wissen?«, gab Dottoressa Donato zurück, schwächte dies jedoch sogleich ab: »Das müsste in ihrer Akte stehen.« Einsicht in die Akte bot sie nicht an.
Brunetti unterließ es wohlweislich, darum zu bitten, und dankte nur für die Auskunft.
Wie es aussah, hatten sie diese erste Befragung vermasselt, und so wählte er seine Worte sorgfältig, um klarzustellen, wer hier das Kommando hatte: »Erlauben Sie uns, noch einmal mit ihr zu sprechen?«
Dottoressa Donato sah zu Brunetti, dann zu Griffoni und ließ sich mit der Antwort viel Zeit. »Kommt drauf an, wie es ihr geht. Die Aufregung war nicht gut für sie.« Angesichts der einsichtigen Mienen fügte sie hinzu: »Ich habe Ihre Nummer. Ich rufe Sie an.«
Brunetti nickte nur. Griffoni gab der Ärztin die Hand, dankte für ihre Unterstützung und öffnete die Tür.
Nachdem auch Brunetti sich von der Ärztin verabschiedet hatte, gingen sie aus dem Zimmer und hinaus ins Freie.
Auf der riva fiel die Sonne über sie her. Brunetti hielt gegen das grelle Licht die Hand vor die Stirn. Griffoni hatte ihre Sonnenbrille dabei, duckte sich aber dennoch in den Eingang des Gebäudes.
»Du bist doch der Einheimische hier«, sagte sie. »Welches Vaporetto können wir nehmen?« Und bevor Brunetti etwas einwenden konnte: »Zu Fuß ist unmöglich. Überlebe ich nicht.«
»Und das von einer Neapolitanerin«, schlug Brunetti einen munteren Tonfall an.
Griffoni aber ließ sich nicht aus der Reserve locken und sprach mit feierlichem Ernst: »In Neapel gibt es hohe Häuser. Die Straßen sind schmal, dunkel und feucht, die Häuser hoch und haben Durchgänge zu Innenhöfen, in denen Brunnen plätschern.« Ein anklagender Zeigefinger löste sich aus dem Schatten und wies auf das Wasser hinter ihm. »In Neapel gibt es keine breiten Kanäle, die das Licht reflektieren, und keine weißen Häuser, geschweige denn mit sauberen Fassaden. Dort herrschen Dunkelheit und Dämmer. Die Sonne scheint am Strand, und der ist schön weit weg vom Zentrum, und das reicht uns vollkommen.«
Mit Frauen, die das letzte Wort behalten mussten, kannte Brunetti sich aus: Er lebte seit Jahrzehnten mit einer zusammen. Brav nahm er sein Handy aus der Tasche und wählte Foas Nummer.
Der Bootsführer meldete sich nach dem zweiten Klingeln. »Sì, Commissario?«
»Es handelt sich um einen Notfall, Foa.«
»Ja, Signore?«, fragte der Bootsführer besorgt.
»Dottoressa Griffoni weigert sich, zu Fuß in die Questura zurückzugehen.«
Schon wieder beruhigt, meinte der Bootsführer: »Kluge Frau. Wo sind Sie?«
»Bei den Fatebenefratelli.«
»Hm«, murmelte Foa, und Brunetti hörte ihn förmlich Strecke und Fahrzeit berechnen. »Zwanzig Minuten. Es gibt eine Bar in der Nähe. Ich hole Sie dort ab.«
Brunetti steckte das Handy wieder ein und berichtete Griffoni.
»Er ist verheiratet, oder?«, fragte sie.
»Was?«
»Foa. Er ist verheiratet.«
»Ja. Zwei Kinder.«
»Schade«, meinte die Kommissarin noch und machte sich auf den Weg.
»Warum?«
»Weil ich meine restlichen Jahre hier gern mit einem Mann verbringen würde, der ein Boot hat und mich jederzeit abholt, wenn ich ihn rufe.«
»Ich war es, der angerufen hat.«
»Heißt das, du willst ihn mir wegschnappen?« Die Hitze war ihr wirklich nicht gut bekommen.
»Ich bin schon verheiratet.«
»Hat sie ein Boot?«
»Nein, aber ihr Vater.«
»Und einen Fahrer?«
»Bootsführer«, korrigierte Brunetti automatisch. »Mein Schwiegervater hat jemanden, der sich um alles kümmert.«
»Um alles?«
»Kaputte Fenster, undichte Leitungen, acqua alta, Elektrik, Schlösser, das Dach und das Boot.«
»Ist er verheiratet?«
»Ja. Mit der Köchin. Und er ist über sechzig.«
Die Tür der Bar stand offen. Brunetti folgte Griffoni über die Schwelle. Lautes Rasseln begrüßte ihn, als schüttle der Barmann vor Freude über die Kundschaft ein Tamburin. Doch der Mann, groß, breit und kahl, las hinter dem Tresen die Zeitung und rührte sich nicht.
Der Lärm kam aus dem Hintergrund, wo drei Spielautomaten im schummrigen Licht lustig blinkten und der linke gerade einen Sturzbach gewonnener Münzen ausspie. Ein untersetzter Mann stand davor und schaufelte die Münzen in ein Plastikeimerchen, wie Kinder es zum Bau von Sandburgen benutzen. Er gab dem Automaten einen freundschaftlichen Klaps. »Wer sagt, hier gibt’s nichts zu gewinnen?«, frohlockte er.
Er machte zwei Schritte zur Seite und steckte eine Münze in den äußersten Automaten, dann eine in den mittleren, drückte dessen Startknopf, dann den des ersten. Lichter blinkten, es surrte und dudelte, dann legte sich plötzlich Stille über den Raum.