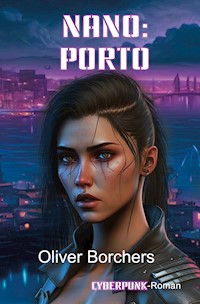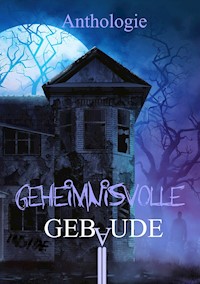
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Shadodex - Verlag der Schatten
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gruselgeschichten über verlassene Orte
- Sprache: Deutsch
Verlassen liegen sie da. Niemand hat sie seit Jahren betreten. Es gibt sie in fast jedem Ort: alte, schon lange leer stehende Häuser – verfallen, abbruchreif, die Fassade bröckelt, die Fenster sind blind oder gar gesplittert. Niemand wagt sich mehr hinein. Doch warum wurden diese Gebäude verlassen? Welche Geschichten erzählt man sich hinter vorgehaltener Hand darüber? Und wieso werden manche dieser Häuser sogar gemieden? Was ist dort geschehen? Neugierig geworden? Dann folgt uns einfach und betretet die sogenannten Geisterhäuser. Lasst euch überraschen, welche Mysterien die Geschichten jeweils aufdecken werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geheimnisvolle
Gebäude
Anthologie
Alle Rechte, insbesondere auf digitale Vervielfältigung, vorbehalten.
Das Buchcover darf zur Darstellung des Buches unter Hinweis auf den Verlag jederzeit frei verwendet werden.
Eine anderweitige Vervielfältigung des Coverbilds ist nur mit Zustimmung des Verlags möglich.
Die Namen und Handlungen sind frei erfunden.
Evtl. Namensgleichheiten oder Handlungsähnlichkeiten sind zufällig.
www.verlag-der-schatten.de
Erste Auflage 2022
© Coverbild: Depositphotos breakermaximus
Covergestaltung: Verlag der Schatten
© Bilder: Depositphotos judykennamer (Holzvilla), outchill (Spukvilla), YAYImages (Herrenhaus, Villa Caligo) thomaseder (Vingança), marcinmaslowski (Verlorenes Schicksal), Copit1606 (Vergessen), bukki88 (Holländerhaus), 1000Words (Tempus fugit, Schwefel-Labyrinth), twindesigner (Spinnenloch), Wirestock (Lass mich nicht allein!), netfalls (Herr von Gegenüber), haraldmuc (Der Fuchs), photoquest7 (Deal), WitthayaP (alte Villa)
Bettina Ickelsheimer-Förster (altes Forsthaus, Nachbarhaus), Oliver Borchers (Schattenkinder), GSTV (Mietshaus)
Lektorat: Verlag der Schatten
© Verlag der Schatten, Ruhefeld 16/1, 74594 Kreßberg-Mariäkappel
ISBN: 978-3-98528-017-9
Geheimnisvolle
Gebaeude
Anthologie
Verlassen liegen sie da.
Niemand hat sie seit Jahren betreten.
Es gibt sie in fast jedem Ort: alte, schon lange leer stehende Häuser – verfallen, abbruchreif, die Fassade bröckelt, die Fenster sind blind oder gar gesplittert. Niemand wagt sich mehr hinein.
Doch warum wurden diese Gebäude verlassen?
Welche Geschichten erzählt man sich hinter vorgehaltener Hand darüber?
Und wieso werden manche dieser Häuser sogar gemieden?
Was ist dort geschehen?
Neugierig geworden?
Dann folgt uns einfach und betretet die sogenannten Geisterhäuser. Lasst euch überraschen, welche Mysterien die Geschichten jeweils aufdecken werden.
Inhalt
Vingança
© Oliver Borchers
Villa Caligo
© Anke Schlachter
Verlorenes Schicksal
© Andreas Dörr
Das verlassene Mietshaus
© Bianca Röschl
Vergessen
© Anna Graupner
Der Teufel im alten Holländerhaus
© Detlev Jänicke
Tempus fugit
© Alexander Klymchuk
Das Schwefel-Labyrinth
© Piet Woudenberg
Das Nachbarhaus
© Jona Baykouchev
Die Legende vom Spinnenloch
© Louisa Dormann
Lass mich nicht allein!
© Jennifer Pfingstmann
Der Herr von gegenüber
© Dennis Puplicks
Der Fuchs
© Kai Focke
Ein folgenschwerer Deal
© Bettina Ickelsheimer-Förster
Vingança
© Oliver Borchers
Es war kurz vor Sonnenuntergang, als ich meine Tasche mit den Schulsachen schulterte und meinen Eltern zurief: »Ich bin dann weg!« Während ich noch schnell ein paar harte Brötchen vom Vortag in der Tasche verschwinden ließ, fügte ich hinzu: »Wartet nicht auf mich. Mario und ich wollen bis in die Morgenstunden lernen.« Auch wenn ich sie nicht sehen konnte, so wusste ich doch, dass meine Eltern die Augen verdrehten.
»Qualmt nicht so viel und Finger weg vom Alkohol, okay?«
Die Stimme meiner Mutter klang längst nicht mehr so besorgt wie noch letztes Jahr, als ich begann mich regelmäßig um diese Zeit mit meinen Freunden zu treffen. Da meine Noten in diesem Jahr besser geworden waren, akzeptierte sie allmählich, dass die Uhren hier in Portugal doch ein wenig anders tickten als in Deutschland.
Mein Vater grummelte nur und widmete sich wieder dem Fernsehprogramm, das seit einigen Wochen dank der neuen Satellitenschüssel Einzug gehalten hatte. Das Jahr 1990 brachte den Genuss der deutschen Medienwelt endlich in diesen Winkel der Welt, und das genossen meine Eltern in vollen Zügen.
Zu den Klängen einer Werbemusik für Erdnüsse verließ ich das Haus und lief die Straße entlang, auf der die Schatten der Platanenbäume immer dunkler wurden. Die ersten Straßenlaternen erwachten und zauberten einen goldgelben Schein auf die Gesichter der Menschen, die sich auf den Weg zu einem der zahlreichen Cafés oder einen Verdauungsspaziergang an der Strandpromenade machten. Eine kleine Gruppe schnatternder Mädchen kam mir entgegen und obwohl sie in meinem Alter und sehr hübsch waren, zwang ich mich, ihnen nicht nachzuschauen. Ich war auf dem Weg, Laura zu treffen, und die war allemal schöner als diese Meninas da Foz, die Mädchen des Vorortes Foz, welche den Ruf hatten, überheblich zu sein.
Foz war ein Ort, in dem gut situierte Portugiesen oder Ausländer wie meine Eltern lebten. Trotzdem hatte die Gegend schon bessere Zeiten erlebt, davon zeugten Ruinen prachtvoller Gebäude, die noch vor wenigen Jahrzehnten bewohnt waren und deren dunkle und geborstene Fenster einen starken Kontrast zu den modernen Apartments mit Satellitenschüsseln bildeten.
Ich bog in eine Straße, deren unteres Ende zur Strandpromenade führte. Von dort erstreckte sie sich einen Hügel empor bis in den Häuserwald eines anderen Ortsteils. In Sichtweite des Strandes, eingerahmt von zwei älteren Gebäuden, befand sich mein Ziel. Die Villa Dos Sonhos, ein vor Jahrzehnten bestimmt imposanter Anblick, hatte eine aus Granitsteinen bestehende Fassade, an der einige hellere Bereiche auf ehemals weiße Farbe schließen ließen. Hohe Fensterläden waren teilweise verwittert und hingen schief vor gesprungenem Fensterglas. Ein viereckiger Turm thronte mittig auf dem Hauptgebäude, stumpfe Fenster schauten jeweils in eine Himmelsrichtung.
Für einen kurzen Moment drang ein flackerndes Licht durch eine der Scheiben. Ich grinste. Ich war nicht der Erste in unserem Lieblingsunterschlupf, in dem wir ungestört lernen und feiern konnten.
Niemanden interessierte es, dass ich mich in den engen Bereich zwischen der Villa und dem Nachbarhaus quetschte und einen Weg einschlug, den sonst nur diejenigen nutzten, deren Blase voll war.
Ich ignorierte den Gestank nach Urin und erreichte den Bretterverschlag, der mit einem ordentlichen Ruck zur Seite geschoben werden konnte und dann einen dunklen Seiteneingang freigab. Kühle Luft, die nach Schimmel und Moder roch, empfing mich, während ich nach der Taschenlampe in meinem Rucksack kramte.
Etwas Kaltes berührte meinen Arm. Ein gedämpfter Schrei entfuhr mir, als an meiner Seite eine düstere Gestalt erschien.
»Wer wagt es, die Residenz des Senhor Goncalves zu betreten, ohne mindestens einmal gepinkelt zu haben? Ich verlange nach einem Opfer, einem ekligen Opfer …«
Die kühle Coladose, die meinen Arm berührt hatte, schwenkte zurück und wurde von einem spitzbübisch lächelnden Jungen mit einem Ruck geöffnet.
Mario war mein bester Freund und Kumpel. Er war genauso vernarrt in Computerspiele wie ich, doch seit er, dank der neuen Kontaktlinsen, nicht mehr aussah wie ein Loser, hatten sich seine Interessen gewandelt, und so gehörte er nun zu den cooleren Typen mit einer schönen Freundin.
»Arschloch!«, sagte ich.
Er grinste breit und zuckte mit den Schultern. »Wenn wir schon die Nacht hier verbringen wollen, dann auch bitte stilecht mit Grusel und so.« Dann hob er die Dose zum Prost an, doch ein Stoß in seine Seite ließ ihn innehalten.
Im Dunkeln stand Isabella, seine frischgebackene Freundin. Von ihrem stets aufwendig geschminkten Gesicht waren nur die hübsche Nase und die Grübchen an ihren Wangen zu sehen.
»Die Cola war für mich, du Egoist! Du hast ja nur an Super Bock und andere Biere gedacht.«
Er lachte und zog sie näher an sich heran. »Na ja, in dieser Notlage wirst du doch deinem lieben Freund sicher aushelfen, oder?«
Ich schüttelte den Kopf und quetschte mich an den beiden Turteltauben vorbei in die alte Empfangshalle der Villa, die trotz der abgerissenen und verschimmelten Tapeten immer noch die Würde eines Herrenhauses der portugiesischen Obrigkeit ausstrahlte. An der linken und rechten Seite führten Treppen mit steinernen Geländern zu den oberen Etagen. Auf der Balustrade im ersten Stockwerk befanden sich stilisierte Kelche aus Granit, dem Lieblingsmotiv des Senhor Goncalves, der diese Villa vor über einem Jahrhundert hatte errichten lassen.
Ich nutzte die linke Treppe, auf der die Stufenbohlen einen zuverlässigeren Eindruck machten als auf der anderen Seite. Trotzdem knarrte die Konstruktion, als ich emporstieg. Ich hatte mich mittlerweile an die Geräusche des Hauses gewöhnt, sodass ich nicht zusammenzuckte, als das Knarren hinter mir laut protestierend anstieg. Arm in Arm folgten mir Mario und Isabella.
Da erschien eine Person mit einer Taschenlampe an der Balustrade und stampfte verärgert auf. »Leute! Wie oft haben wir das jetzt schon diskutiert? Die Treppe darf nur von einer Person zur gleichen Zeit genutzt werden! Sonst bricht uns das morsche Ding zusammen und es ist aus mit unseren Lerntreffen in der Villa!«
Die dunkelhaarige kleine Person mit Zopf und dicker Brille funkelte mich vorwurfsvoll an, als hätte ich dieses Vorgehen gegen die Regeln geplant. Trotz ihres Ärgers musste ich lächeln. Laura war nicht nur intelligent, sie war die schönste Person der Welt, und ihr verärgerter Blick machte sie nur noch begehrenswerter.
Während ich die richtigen Worte zu finden versuchte, murrte Mario gespielt und sprang ein paar Stufen hinunter. Dann salutierte er und rief: »Sim, cabo-sargento!«
Laura schnaubte. »Wenn du schon Anspielungen auf den Militärrang des Herrn Goncalves machst, dann mach es richtig. Er war tenente.«
Mario lächelte. »Du bist echt eine laufende Enzyklopädie, nicht wahr? Simon, wie kannst du es nur auf Dauer mit ihr aushalten?«
Ich schmunzelte und gab ihr ein wenig ungelenk einen Kuss, doch sie war nur halb bei der Sache. Irgendetwas beschäftige Laura.
Ihre Augen funkelten, als sie sagte: »Während ihr hier unten versucht habt, das Haus zum Einstürzen zu bringen, ist oben im Turm tatsächlich etwas kaputt gegangen.«
»Oh? Was denn?«
Sie runzelte die Stirn. »Es war verrückt. Ich habe mich an den Mittelpfeiler gelehnt, während ich aus dem Fenster im Westen geblickt habe, dabei ist der alte Putz hinter mir abgebröckelt und hat eine Nische freigelegt.« Laura deutete auf die Stufen, die in den Turm empor führten. »Und das Interessanteste ist, die Nische ist nicht leer. Kommt!«
Die beiden anderen waren mittlerweile eingetroffen und hörten mit. Isabella klatschte in die Hände und grinste gespannt. »Ein Schatz. Unser Einstein hat einen Schatz entdeckt!« Dann ergriff sie Mario und mich und preschte nach vorn. »Los, ihr lahmen Hammel! Lasst uns den Schatz bestaunen, etwas lernen und dann endlich in den Sao Joao feiern!«
Hinter uns erklang die genervte Stimme meiner Freundin. »He! Was habe ich gerade eben gesagt? Nacheinander!«
Die Treppe verjüngte sich und mündete in eine Türöffnung. Isabellas Griff lockerte sich nicht, während sie sich mit uns in den Raum quetschte, aus dem der Turm bestand. Dass sie sich dabei eng an uns presste, war eines ihrer Lieblingsspiele und mir nicht unangenehm.
»Dürfte ich vielleicht auch in den Raum?« Laura stand hinter uns und betrachtete die Szene stirnrunzelnd.
Hell lachend ließ Isabella mich los und umarmte sie. »Ihr beide seid echt süß! Komm querida, zeig uns den Schatz, umso früher können wir mit der Feier anfangen.«
Der Raum war das alte Studierzimmer des Herrn Goncalves. Die letzten Sonnenstrahlen des Tages fluteten durch das westliche Fenster und warfen einen warmen Farbton auf alte Malereien, die den bröckeligen Putz verzierten. Der Boden bestand aus alten Holzdielen und hier und da standen noch betagte Möbelstücke herum. In der Mitte des Raumes ragte eine breite, eckige Säule empor, die wie ein Kamin im Dachstuhl verschwand. An der westlichen Seite klaffte ein großes Loch, alter Putz lag dort verstreut auf den Dielen.
Lauras Schuhe knirschten, als sie sich hinkniete. »Ich habe mich nicht getraut, es anzufassen, weil … nun ja, seht selbst!«
Die Sonne leuchtete in die Nische, und zuerst erblickte ich nur verwirrende Winkel. Doch da verirrte sich ein Strahl auf eine grob behauene Steinoberfläche, und ich erkannte den Gegenstand. »Ein Steinkelch. So wie auf der Balustrade!«
»Wow«, bemerkte Isabella mit zitternder Stimme. »Irgendwie unheimlich, einen geheimen Kelch des berüchtigten Senhor Goncalves zu finden. Angeblich war er ja nicht nur Mörder, sondern auch Giftmischer. Hat er dieses Teil wohl dafür genutzt?«
Ich beugte mich vor und bemerkte, dass der ungefähr fünfundzwanzig Zentimeter im Durchmesser große v-förmige Kelch auf einem fleckigen Leinentuch stand, welches früher einmal weiß gewesen sein musste. Wäre es den Elementen ausgesetzt, wäre es wohl verwittert, so aber prangten aufgemalte vier schwarze Buchstaben jeweils an einer Ecke des Tuches.
»A I N G«, murmelte Laura. »Was das wohl heißt?«
»Keine Ahnung.« Mit einem Schwung packte Mario den Kelch und nahm ihn aus der Nische.
Ein kaltes Gefühl erfasste mich und aus einem Instinkt heraus wollte ich Mario warnen, dies zu tun. Auch Laura neben mir zuckte zusammen, als hätten wir etwas Verbotenes getan. Der Moment verflog, und als Mario den Kelch hoch in die Sonnenstrahlen hielt und dann Herrn Dewalder, unseren Chemielehrer, imitierte, war die seltsame Kälte vergessen.
»Hm. Kein ›Made in Japan‹. Das steht schon mal fest. Schwer ist er nicht, also kein verstecktes Gold, sondern nur ein dunkler Stein. Ein wirklich toller Schatz, den du da gefunden hast, Laura. Setzen. Sechs. So wird das nichts mit dem Abi 1990!«
Isabella lachte und kniff ihrer Freundin in den Arm. »Mach dir nichts draus. Komm, werde etwas lockerer. … Moment, Mario hat mich auf eine Idee gebracht.« Sie kramte ihren alten Walkman hervor und drehte die Musik so laut auf, dass ihre Kopfhörer ›Big in Japan‹ der Gruppe Alphaville durch den Raum tönen ließen. »Jetzt noch ein bisschen was zu trinken und die Lernsitzung kann beginnen! Mario, wirf mal ein Super Bock rüber.«
Der grinste breit und wollte das Steingefäß absetzen, doch dann entschied er sich um und rief: »Aufpassen! Ein fliegender Kelch!«
Er warf das Ding in meine Richtung, doch obwohl ich stolz auf meine Reaktionsfähigkeit war, griffen meine Finger ins Leere. Mit einem lauten Dröhnen fiel der Gegenstand auf die Dielen schräg hinter mir. Für einen kurzen Augenblick schien es, als würde ich grün schimmernde Funken sehen, doch es konnten Reflexionen des sterbenden Tageslichtes sein.
»Verflucht! Was sollte das? Wer weiß, wie viel das Teil wert ist – und du schmeißt es durch die Gegend!« Meine Finger tasteten nach dem Gegenstand.
»Oh, ich vergaß, unser Betriebswirt in spe sieht überall die Möglichkeit, Geld zu verdienen«, feixte Mario. Er schaltete seine Taschenlampe ein und richtete den Kegel auf den Kelch.
Ich ergriff und drehte ihn. Er war unbeschädigt. Der Stein wog wenig und fühlte sich sogar ein wenig warm an, möglicherweise von der Sonne, die ihn angestrahlt hatte. Das Material schien trotz seiner Leichtigkeit robust zu sein, denn es wies keinerlei Kratzer oder Abnutzungserscheinungen auf. Nur an der Unterseite befanden sich ein paar Furchen, die schon älter zu sein schienen. Neugierig knibbelte ich mit einem Fingernagel an der Stelle herum, und tatsächlich brach ein kleines Stück des Steines ab. Die Bruchstelle funkelte grünlich. »Mist!«, rief ich. Wieder überkam mich das Gefühl, als hätte ich etwas Verbotenes getan.
Lauras Stimme riss mich aus den Gedanken. »Lasst uns mal anfangen. Als Erstes benötigen wir Licht. Ich habe die Kerzen dabei, Simon, gib mir mal deine Pfanne, damit ich sie dort aufbauen kann.«
Ich runzelte die Stirn. »Oh, die habe ich vergessen. Verdammt!«
Laura seufzte und sagte: »Hat sonst jemand was dabei, wo wir die Kerzen aufstellen können, ohne dass wir das alte Holz hier in Brand setzen? Oder müssen wir im Schein der Taschenlampen lernen, bis die Batterien versagen?«
Isabella schüttelte den Kopf. »Nein, ich habe nur Decken dabei wie verabredet.«
Mario salutierte wieder und hob eine Flasche in die Höhe. »Saufkram besorgt, keine Pfanne dabei, senhora tenente!« Dann fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu: »Für später, wenn es dunkel ist und wir noch eine Wanderung machen wollen, hab ich noch was anderes dabei, etwas Feuriges …«
Die Laune sank, bis Isabella mir den Kelch mit spitzen Fingern aus der Hand nahm. »Der ist doch aus Stein, oder nicht? Ziemlich staubig und ein wenig eklig, aber da sollten wir doch die Kerzen reinstellen können!«
Laura zuckte mit den Schultern.
»Aber erst mach ich das Ding mal ein bisschen sauber. Mario, etwas Hochprozentiges, bitte.«
Mit Schnaps und einem Taschentuch rieb sie die Oberfläche ab und stellte dann das Gefäß auf das Tuch in der Nische. Laura entzündete eine Kerze und ließ Wachs auf die Innenfläche des Kelches tropfen. Dann drückte sie sie fest. Sie rückte den Kelch so weit an den Rand, dass sein Licht den Raum erhellen konnte. Das flackernde Licht bewegte sich im Rhythmus der Musik und ließ unsere Schatten durch den Raum tanzen wie bei einem Reigen aus alter Zeit.
Laura schien ähnliche Assoziationen zu haben und ergriff meine Hand. »Ich habe das Gefühl, dass an diesem Ort viel mehr Dinge geschehen sind als das, was vom Mörder Goncalves gemeinhin bekannt ist. Und der Kelch, er …«
»Er flößt dir irgendwie Angst ein.« Ich drückte ihre Hand. »Ich weiß, mir geht es genauso. Ein … kaltes Gefühl macht sich in mir breit, wenn ich ihn berühre.«
Sie starrte mich an, dann lächelte sie. »Okay, weißt du, wir benehmen uns ziemlich kindisch. Als künftige Wissenschaftlerin muss ich sagen: Am besten reißen wir uns ein wenig zusammen. Ein altes Steingefäß soll uns nicht davon abhalten, zu lernen! Und … Spaß zu haben!« Sie zog meinen Kopf zu sich und küsste mich.
»He ihr!« Isabella kicherte. »Spart euch das für später! Jetzt sollten wir erst einmal Mathe büffeln. Kommt!«
Mario drückte uns Bierflaschen in die Hände und ahmte den Chemielehrer nach. »Hiermit verabreiche ich euch ein paar Tropfen von dieser wunderbaren Flüssigkeit, auf dass die Infinitesimalrechnungen gut in eure Synapsen rutschen!«
Über dem flackernden Licht der Kerze prosteten wir uns zu. Ich versuchte die Schatten hinter uns zu ignorieren.
*
Er trieb sein Pferd an, indem er die Hacken fest in die Seiten des Tieres rammte. Trotzdem entfernte sich sein Widersacher immer weiter.
»Maldito! Los, du verdammte Mähre!« Seine Stimme war heiser, sein Gesicht puterrot vor Zorn und Scham darüber, dass er so schlecht bei dem Rennen abschneiden würde. Doch es half nichts. Unter dem Applaus der versammelten Oberschicht ritt sein Widersacher durch das Ziel und schwenkte übermütig seinen Hut.
»Fonseca«, riefen sie, »FONSECA!« Ein Choral aus schadenfrohen Stimmen, die es dem Mann gönnten, dass er die Wette gegen den aufstrebenden Goncalves gewonnen hatte.
Als er Sekunden später durch das Ziel ritt, bemerkte er, dass auch Elisabete de Bragança dem Sprechchoral beiwohnte und fröhlich ihr Tuch schwenkte.
Natürlich war ihm klar, dass dieser Wettstreit im Vorfeld des Festes von Sao Joao für Elisabete nur ein nettes Imponiergeplänkel von zwei Männern war, die ihre Gunst zu erlangen versuchten. Für ihn war es viel mehr. Hasserfüllt musterte er seinen feiernden Widersacher, doch er musste den Anschein wahren, gerade vor den Augen seiner Angebeteten.
»Der Sieg ist Euer«, rief er ergeben lächelnd und zückte seinen Geldbeutel. Er ignorierte die süffisanten Blicke des Publikums und schleuderte ihn so hoch, dass Fonseca gezwungen war, sich aufzurichten.
Goncalves kannte Fonseca gut und er wusste, er würde keine Gelegenheit auslassen, eine gute Show abzuliefern. Tatsächlich enttäuschte der Mann ihn nicht und katapultierte sich ein Stück weit aus dem Sattel, seine Hand nach dem Gegenstand ausgestreckt. Er fing den Beutel und plumpste zurück.
Goncalves hielt kurz den Atem an und murmelte leise vor sich hin: »Rache. Die Rache soll mein sein!«
In dem Moment, in dem der stolze Fonseca seinen Wettgewinn hochhob, brüllte sein Pferd auf und stellte sich auf die Hinterbeine. Der Mann, der nicht mit dieser Reaktion gerechnet hatte, versuchte sich festzuhalten, doch da stürmte sein Tier wiehernd auf das Publikum zu, bockte hin und her. Fonseca flog kopfüber in die entsetzte Menge und schlug mit einem Krachen auf dem Boden auf.
Obwohl er innerlich triumphierte, setzte Goncalves einen bestürzten Ausdruck auf und hastete zu dem wild gewordenen Pferd. Er ergriff die Zügel und tat, als würde er es tätscheln. In Wirklichkeit griff er zu dem Nagel, den er kurz vor dem Rennen in den Sattel gehämmert hatte und der aufgrund Fonsecas Bewegung in das Fleisch des Tieres gerammt worden war. Er ragte gerade so weit heraus, dass nur ein starker Druck auf die Hinterkante des Sattels ihn hinausdrücken konnte. Heimlich schob er ein dickes Lederstück an die Stelle und tätschelte das Pferd.
Als es sich beruhigt hatte, musterte er Elisabete de Bragança, die mit ihrem weißen Tuch das Blut zu stillen versuchte, das aus dem Schädel Fonsecas floss. Ein Mann neben ihr fühlte den Puls des Verunglückten und schüttelte den Kopf. Verzweifelt zerknüllte Elisabete ihr Tuch und weinte.
Fonseca war tot.
Goncalves konnte seinen Triumph nicht mehr geheim halten. Für einen kurzen Augenblick grinste er breit. Genau in diesem Moment hob seine Angebetete ihre tränenverschleierten Augen und starrte ihn an.
»Wie könnt Ihr bei so etwas lachen? Hier, nehmt das zurück, Ihr … Ihr Unmensch!« Sie schleuderte den Beutel sowie das zusammengeknüllte, blutverschmierte Tuch in seine Richtung.
Instinktiv fing er beides. Sein Hochgefühl verschwand sofort. Wenn Elisabete de Bragança ihn nicht akzeptierte, würde er nie in die Oberschicht aufsteigen, unabhängig davon, wie reich er mit seinen Arzneien würde. »Aber liebste Elisabete, ich habe nur dem Pferd zugesprochen, damit es sich beruhigt. Der Tod Fonsecas schockt mich genau wie jeden hier, ich kann es gar nicht fassen.«
Kalte Blicke von ihr und den anderen Anwesenden ließen ihn verstummen. Die Menge zerstreute sich, doch hier und da wurde getuschelt, ein paar Männer spuckten sogar vor ihm auf den Boden. Er würde das Stadtgespräch im diesjährigen Sao Joao werden.
Wütend und enttäuscht ritt Goncalves davon. Er hob das Tuch empor und verzog seine Augen zu Schlitzen. »Verdammte Schlampe. Du machst meinen Ruf kaputt! Du zerstörst, was mir gebührt! Dafür wirst du büßen!«
*
Das Nebelhorn dröhnte, während meine Hände über Lauras Rücken strichen. Sie bekam Gänsehaut und küsste mich noch intensiver. Eng umschlungen unter der alten Decke trotzten wir der Kälte, die die immer feuchter werdende Luft in den Turm trieb.
Eine lallende Stimme gurrte in mein Ohr: »Na ihr beiden? Habt ihr noch Platz da drinnen?«
Ich löste mich von Laura und blickte in die großen Augen von Isabella, die sich neben uns hingekniet hatte. Ich war selbst ziemlich betrunken, daher starrte ich ein wenig länger auf ihren halb entblößten Körper, der vom flackernden Kerzenlicht beleuchtet wurde, als ich sollte.
Lauras Stimme klang unwirsch, aber ich konnte ihr verstecktes Lachen heraushören.
»Hattest du nicht gerade noch einen eigenen Freund, der dir von den tollen Abenteuern erzählte, die ihr beiden mit seinem zukünftigen Auto erleben werdet?«
Isabella seufzte und hob die halb entleerte Flasche Bagaço hoch, einem starken Schnaps aus Marios Rucksack. »Ja. Aber der hat wohl ein bisschen zu viel getrunken. Zumindest mehr als ich.«
Wie zur Bestätigung erklang lautes Schnarchen aus einer Ecke.
Ohne abzuwarten, hob Isabella die Decke an und schlüpfte neben uns. »Brrrrr. Kalt. Und das im Sommer!«
Sie presste ihren Körper fest an meine Seite.
Laura atmete scharf ein.
Isabella kicherte. »Nun sei doch nicht so prüde, querida. Wir können doch …«
Laura schüttelte den Kopf. »Nein! … Schaut mal dahinten. Seht ihr das auch?« Sie zeigte in die Richtung, aus der Marios Schnarchen erklang.
Außer einem leichten Lichtschimmer erkannte ich nichts. Ich glaubte an ein Ablenkungsmanöver, da begann sich das Licht zu bewegen und einen grünlichen Schein anzunehmen. So grün wie der Schimmer, den ich vor ein paar Stunden gesehen hatte.
Isabelle murmelte: »Oh nein, hoffentlich sind das nicht die Sao Joao Feuerwerkskörper, die Mario in seinem Rucksack mitgenommen hat!« Sie seufzte. »Der Idiot. Als ob das eine gute Idee sei, so was hier mitzubringen! Ich geh mal gucken, nicht dass uns alles abfackelt.«
In diesem Moment ertönten schwere Schritte auf der Treppe, die Stufen knarrten laut. Es klang, als würde jemand mit großer Eile emporhasteten. Plötzlich wurde es eiskalt, mein Atem erkennbar. Der grüne Schimmer hatte sich zu leuchtenden Nebelschwaden verdichtet und wirbelte umher. Es schien, als würde jemand mit schnellen, zornigen Schritten in Richtung meines schlafenden Freundes stapfen. Es war aber niemand zu sehen.
»Wer … ist das?« Isabella neben mir richtete sich schwankend auf und rieb sich die Augen. »Ich muss zu viel getrunken haben, verdammt. Könnt ihr den Arsch erkennen, der hier gerade hereingestürmt ist?«
Die Eiseskälte durchdrang mich und plötzlich erfasste mich ein Grauen, wie ich es noch nie erlebt hatte. Niemand war zu sehen, doch ich konnte hören, wie jemand keine zwei Meter entfernt über die alten Bohlen stapfte. Der Nebel wirbelte an den Stellen auf, an denen Füße den Boden berührten. Laura neben mir zitterte und klammerte sich an mich, doch dies bemerkte ich nur am Rande.
Isabella schüttelte den Kopf und machte eine ungelenke Bewegung nach vorn, und in dem Moment erkannte ich den Schatten einer dunklen Gestalt, die sich über Mario beugte. Sie wandte ihr Gesicht mir zu. Grausame Gesichtszüge verschmolzen mit grünen Nebelschwaden, bevor sie wieder verschwanden.
Laura gab einen Schrei von sich. »Isabella. Bleib hier!«
Instinktiv wollte ich fortlaufen, fort von diesem grauenvollen nebelartigen Ding, dessen Züge pure Boshaftigkeit gezeigt hatten. Doch da war Laura, meine Freundin, und trotz der Unheimlichkeit des Wesens würde ich sie beschützen.
Ich versuchte mich zu beruhigen, da rief Isabella: »Mario! Endlich! Ist da jemand neben dir?«
Er wandte seinen Kopf in unsere Richtung. Seine Augen schimmerten grün.
Mein Atem schoss kalt hervor, als ich versuchte meine Stimme zu kontrollieren. »Mario, was ist mit …« Ich verstummte, als ich seinen Gesichtsausdruck sah. Er grinste, schien aber überhaupt nicht wahrzunehmen, wer wir waren.
Für einen Augenblick glaubte ich, es sei alles ein Trick und Mario würde uns eröffnen, dass er all dies nur inszeniert hatte, da brüllte er los: »Gewonnen! Ich habe das Rennen gewonnen!« Er riss seine Arme hoch, bewegte sich, als würde er einen Hut schwenken.
Es war offensichtlich, dass Mario etwas sah, was wir nicht erfassen konnten.
Isabella blieb wie erstarrt stehen. Auch sie bemerkte, dass etwas nicht stimmte. »Was … was tust du? Mario? Bitte beruhige dich und komm zu mir.«
Da wandte sich der Junge zur Wand um und zischte: »Ich habe dich besiegt, du gottverlassener Angeber und Emporkömmling!«
Mario setzte sich in Bewegung und schritt rasch auf die Tür zu. Als er in der Öffnung stand, erschien an der Decke plötzlich ein grünlicher Nebelball, der rasch auf ihn zuströmte. Mein Freund drehte sich um und setzte zu einem Sprung an.
Das kalte Gefühl in mir intensivierte sich und ich spürte, dass etwas Schreckliches bevorstand.
»Tu es nicht!« Ich wollte mich aufrichten, ihm zu Hilfe kommen, doch meine Gliedmaßen waren so kalt, dass sie mir nicht gehorchen wollten.
Mario sprang in die Höhe und griff nach den grünen Schwaden. Er kam mit dem linken Fuß wieder auf und knickte um. Rumpelnd fiel er die Treppe hinunter. Ein hässliches Knirschen erklang.
Isabella schrie und taumelte nach vorn. Sie stürzte und war ebenso unfähig wie ich, Füße und Arme zu rühren, doch irgendwie robbte sie trotzdem weiter. Der lallende Klang ihrer Stimme war fort, als sie brüllte: »Mario! Sag was! Geht es dir gut?« Weißer Atem schoss aus ihrem Mund und vermischte sich mit dem grünen Nebel am Boden.
Plötzlich schwelte vor uns der Nebel in die Höhe, wie eine Gewitterwolke im Zeitraffer entstand die Gestalt eines Mannes mit verhärmten Gesichtszügen und einem kalten Blick, der uns musterte, als seien wir Ungeziefer.
Der Augenblick währte nur kurz, doch er reichte, um mich vollends zu lähmen. Laura keuchte und wimmerte.
Der Nebel verformte sich und bildete nun Schwaden, die eine Figur zeigten, die einen Kelch durch die Luft schleuderte.
Sie ähnelte Mario, der genau dies vor einigen Stunden gemacht hatte.
Da hörte ich einen tiefen, grausam verzerrten Klang. Ich benötigte ein paar Augenblicke, um zu erkennen, dass es ein Wort war, das wiederholt wurde. »Vingança.« Rache.
Mit jeder Wiederholung schien mein Herz kurz auszusetzen und die Stimme fraß sich in meinen Verstand. Unfähig, rationale Gedanken zu fassen oder den Körper zu bewegen, begann ich das Bewusstsein zu verlieren.
Bevor barmherzige Dunkelheit das grüne Licht vertrieb, sah ich Isabella keuchen und verzweifelt nach Luft schnappen, eine Hand an ihrem Hals, die andere ausgestreckt Richtung Tür.
*
Er mied Ansammlungen von Menschen, wo er konnte, doch in dieser Nacht, in der jeder mit dem stinkenden Lauch durch die Stadt irrte, konnte er unbeliebten Bekanntschaften nicht ausweichen.
So fluchte er leise, als er ein paar Straßen von seinem Haus entfernt in eine fröhliche Gesellschaft geriet, die ihm das übel riechende Gemüse unter die Nase hielt. Es waren unverheiratete Frauen niederer Herkunft, die sich nicht schämten, den frivolen Vergnügungen eines Sommerfestes zu frönen, das eindeutig eine Anspielung auf Fruchtbarkeitsrituale war.
Er machte eine widerwillige Miene, und als die Frauen ihn erkannten, verblasste das Lachen auf ihren Gesichtern und sie wandten sich von ihm ab.
»Lasst uns gehen. Es ist der blutige Apotheker.«
Diese geflüsterten Worte drangen an seine Ohren und ließen seine Gesichtszüge hart werden.
Einige Frauen hatten so viel Anstand, ihm einen entschuldigenden Knicks zu präsentieren, doch die meisten rauschten einfach ab, als seien sie etwas Besseres als er. Mit Gelächter steuerten sie einige junge Männer an, die mehr Spaß verhießen.
Eine Frau blieb zurück und drehte ihren Alho-Porro, den Lauch des Sao Joao, keck zwischen ihren Fingern.Es war Mafalda, die Bäckerstochter aus seiner Straße. »Ich glaube nicht daran, dass Ihr so blutig seid, wie man sagt.«
»Das freut mich«, sagte er mit unbewegter Miene und machte Anstalten, weiterzugehen.
Sie jedoch folgte ihm und verwickelte ihn in ein Gespräch, das er unerwarteterweise genoss.
Als sie ihn bis zur Tür begleitet hatte und eindeutig Interesse daran zeigte, mit hineinzukommen, hatte er eine Idee.
»Ich komme gerade vom Überseehändler mit exotischen Kräutern, aus denen ich einen neuartigen Tee zubereiten möchte. Lust auf ein Experiment?« Er zwang sich zu einem Lächeln, machte eine einladende Bewegung und konnte seine Aufregung kaum verbergen, als sie nach kurzem Zögern zusagte.
»Ihr müsst nicht nervös sein«, sagte sie auf der Treppe und hakte sich bei ihm ein. »Ihr seht für Euer Alter gut aus. Und Ihr macht trotz Eures Rufes gut Geld mit Eurer Apotheke. Da könnt Ihr ruhig einmal Spaß an Sao Joao haben. Schließlich geht es zu dieser Zeit hauptsächlich darum, nicht wahr?«
Wieder musste er sich zwingen, freundlich zu nicken.
In seinem Studierzimmer hieß er Mafalda sich setzen und kehrte kurze Zeit später mit einem Krug voll heißem Wasser zurück.
Während er mit zitternden Fingern den Lederbeutel des Händlers öffnete, berührte die junge Frau seine Hand sanft.
»Soll ich?«
Er unterdrückte den Drang, sie fortzustoßen, und schüttelte den Kopf. »Nein danke, es ist nur ein kleiner Anfall von Gicht. Aber du könntest mir den Kelch dort reichen.«
Mafalda lächelte und griff nach dem aus weißem Marmor geformten Kelch, auf den er deutete. Sie schwenkte ihn herum, doch da entglitt er ihrem Griff und fiel zu Boden.
»Huch, wie ungeschickt von mir.« Mit einer aufreizenden Bewegung bückte sie sich und präsentierte dabei betont ihr Dekolleté.
Er atmete tief durch, um nicht zu explodieren. Noch war das Experiment nicht durchgeführt, noch benötigte er sie.
Er lächelte süffisant und nahm ihr den Kelch aus der Hand.
Sein Zittern quittierte sie mit einem Lächeln. »Ihr seid ja so aufgeregt, mein Herr. Soll ich ...«
»Meine liebe Mafalda, lass mich kurz den Tee brauen. Dann beginnen wir mit dem Experiment, ja?«
Sie grinste und nickte betont ehrerbietig. »Mit dem Experiment. Natürlich.«
»Weißt du«, fuhr er fort, »diese Kräuter sind überaus selten. Sie werden angeblich von den Häuptlingen brasilianischer Indios als eine Art Kraft- und Heiltrunk genutzt. Manchmal verbrennen sie sie auch einfach nur und inhalieren den Duft. Danach sind sie stärker und gesünder als zuvor.«
Mafalda blickte interessiert, als er die Kräuter in das Gefäß fallen ließ und Wasser einschüttete. Sie machte große Augen, als der Dampf emporstieg. »Solch ein Grün habe ich noch nie gesehen! Es ist so hell und … schön.« Sie atmete die Schwaden tief ein.
Er tat es ihr nach. »Nun, dann trink einen Schluck.«
Mafalda tat, wie ihr geheißen, und verzog den Mund. »Hm. Da habe ich schon bessere Dinge getrunken.«
Er schluckte die Flüssigkeit gierig und stellte den Kelch wieder hin. Grüne Kräuterreste hingen an seinen Mundwinkeln und auf dem weißen Marmor.
»Ihr habt da etwas«, säuselte Mafalda und strich über seine Wange.
Er ignorierte ihre Annäherungsversuche und rieb sich seine rechte Hand. Sie zitterte und schmerzte, wie immer. Dann fuhr er sich über die zerfurchte Stirn. »Vielleicht müssen wir den gewünschten Effekt auslösen … Aber wie nur?«
Mafalda seufzte. »Langsam habe ich das Gefühl, dass wir an unterschiedlichen Dingen interessiert sind, Senhor Goncalves.«
Sie richtete sich auf und streifte ihr Kleid glatt. Dann ging sie Richtung Tür. Der Mann folgte ihr und hielt sie fest.
»Wir sind noch nicht fertig mit dem Experiment. Geh noch nicht.«
Empört starrte Mafalda ihn an. »Ich muss doch bitten! Lasst mich sofort los!«
Seine Hand hielt sie fest, und obwohl seine Gicht ihm Schmerzen bereitete, lockerte er nicht den Griff. »Du verstehst nicht – laut meinen Recherchen müsste jetzt Heilkraft vom gesunden zum kranken Subjekt übertragen werden, aber irgendwas fehlt noch …«
Sie wehrte sich und schaffte es fast, den zitternden Griff des Mannes zu lösen.
Verzweifelt stieß er seine Nägel in ihr Fleisch. Mafalda schrie vor Schmerzen.
Plötzlich verspürte er eine Energie, die ihm die Finger mit großer Kraft zusammendrücken ließ. Mafalda zuckte zusammen und schrie noch lauter, nun mit einem panischen Klang in ihrer Stimme.
»Das … ist es. Schmerzen und Angst! Das gesunde Subjekt muss Schmerzen verspüren und Angst empfinden. Das sind die Auslöser!«, rief er, als immer mehr Kraft auf ihn einströmte.
Das Mädchen blickte ihn entsetzt an. Er hielt ihr den Mund zu, damit niemand erfuhr, was er hier tat. Noch ein Gerücht und er würde völlig in Verruf geraten!
Je intensiver ihre Panik wurde, desto mehr Kraft strömte auf ihn ein. Er konnte fühlen, wie seine Muskeln anwuchsen, wie seine Lebensgeister sich erfrischten. Grüner Dunst waberte aus ihrem Mund, zog zwischen seinen Fingern hindurch und erfüllte ihn.
Mafaldas Schreie steigerten sich noch immer, daher legte er seine andere Hand um ihre Kehle und drückte zu.
Eine Weile noch floss die Energie, bis seine Knochen knackten und sich die Gicht zurückbildete. Dann sank der Kopf des Mädchens zurück. Er ließ sie zu Boden sinken und wollte lachen und weinen zugleich.
Aufgewühlt lief er durch sein Studierzimmer und war überwältigt von der neuen Lebensenergie, die er verspürte. Da stieß er gegen den Kelch, aus dem er zuvor getrunken hatte. Ein dunkler Fleck, den er mit dem Fingernagel nicht entfernen konnte, verunzierte ihn.
Durch das Westfenster blickte er hinaus auf die Stadt, die voller lebensfreudiger Menschen war.
Er lächelte.
*
Eine drängende Frauenstimme flüsterte in mein Ohr: »Simon, wach auf!«
»Mafalda?« Ich schreckte, verwirrt im ersten Moment, hoch.
Es waren Lauras Augen, die ich dann im grünen Halblicht des Studierzimmers funkeln sah. Ich lag noch immer neben meiner Freundin, fernab der beängstigend realistischen Träume aus längst vergangener Zeit.
Vorsichtig hob ich eine Hand und bewegte sie.
War der Bann gebrochen?
Ich wollte aufstehen, doch von der Hüfte abwärts war die Kälte so stark, dass ich meine Beine nicht bewegen konnte.
»Bei mir ist es genauso«, flüsterte Laura. »Ich kann nicht aufstehen.«
»Ist … ist er fort?« Ich schluckte, als ich mich an das grausame Gesicht erinnerte, das dem Mann in meinem Traum ähnelte. War es dieselbe Gestalt? Handelte es sich hier um den Geist des Mörders Goncalves, der vor einhundert Jahren sein Unwesen getrieben hatte?
»Nein.« Ihre Stimme zitterte, aber sie schluckte und zeigte dann auf die dunkle Ecke, in der Mario geschlafen hatte. »Dort hinten knarren die Dielen immer wieder, als würde jemand hin und her laufen.« Sie blickte ihn an und flüsterte: »Du hast vorhin den Namen Mafalda erwähnt. Hast du etwa auch von ihr geträumt? Und von dem Tee?«
Ich starrte sie verblüfft an. »Ja – von Mafalda, dem Tee und den anderen furchtbaren Dingen.« Ich nagte an der Unterlippe. »Wenn das wahr ist, dann ist das der Geist Goncalves, den wir irgendwie geweckt haben müssen.«
Sie nickte.
Ich dachte an die Schatten, die Marios Wurf gezeigt hatten. Dann blickte ich zu Isabella, die mit ausgestreckten Armen auf halbem Weg zur Tür lag. »Verdammt, Isabella!«
Laura legte eine Hand auf meine Schulter. »Keine Sorge, sie lebt – siehst du den weißen Dunst vor ihrem Mund?«
Ich atmete tief durch. »Du hast recht. Und wenn sie das überlebt hat, vielleicht hat auch Mario überlebt!«
Laura drückte meine Schulter und nickte.
»Allerdings – wenn es das war, was ihn verärgerte, dann sind wir beide auch in Gefahr. Mario hat den Kelch geworfen, er ist die Treppe hinuntergefallen. Isabella hat Alkohol über ihn gekippt und ihn gesäubert, sie ist fast erstickt.« Ihre Stimme zitterte. »Ich habe heißes Wachs in ihn tropfen lassen und eine Kerze angezündet. Ich habe Angst!«
Ich dachte daran, was ich machte, als ich den Kelch aufgehoben hatte. »Und ich habe schwarze Brocken von der Unterseite des Kelches abgebrochen. Verdammt.«
Es polterte in der dunklen Ecke.
Laura stieß einen leisen Schrei aus. »Er kommt. Was sollen wir nur tun?«
Fieberhaft versuchte ich mich zu konzentrieren, während die Schritte näher kamen. Nebelschwaden begleiteten die Bewegungen des Geistes und quollen hoch. Fast konnte ich eine gebückte Gestalt mit grausamen Gesichtszügen erahnen, die immer größer wurde.
»Irgendwie müssen wir die gleiche Verbindung mit ihm eingegangen sein wie damals Mafalda. Sie hat Schmerzen und Angst erlitten und ihm damit Energie gespendet.«
»Die Kälte … Ein Anzeichen dafür, dass er Energie gezogen hat!« Lauras Stimme hob sich ein wenig. »Da wir uns wieder besser bewegen können als zuvor … Heißt das nicht, dass dieser Effekt nachgelassen hat?«
Der Geist blieb vor uns stehen und stampfte wütend auf. Grünliche Nebelschwaden leckten an seinen Beinen und hoben ihre Form hervor.
Da erklang wieder die furchtbare Stimme: »Vingança!«
Ich versuchte die Panik zu unterdrücken, doch der Klang dieser Stimme war so abgrundtief böse, dass ich machtlos war. Laura neben mir sackte zitternd zusammen.
Heißt das nicht, dass dieser Effekt nachgelassen hat?
Lauras Worte hallten in mir wider, verdrängten langsam die chaotischen Gefühle. In einem Winkel meines Gehirns wurde mir klar, dass sie recht hat. Vorhin war ich in eine Art Ohnmacht gefallen, jetzt konnte ich mich teilweise bewegen und sogar Gedanken fassen. Mein Blick fiel auf die schlafende Isabella. Konnte es sein, dass seine Fähigkeit, Leute zu kontrollieren, nachließ, je weniger Menschen Angst vor ihm hatten?
In diesem Moment stand Laura mit einem Ruck auf. Ihre Augen schimmerten grün. Fast schien es, als würde das Licht auf ihrem dünnen T-Shirt das Kleid einer vornehmen Dame zeichnen. Sie sagte: »Senhor Goncalves! Lange nicht mehr gesehen. Seit Eure Apotheke geschlossen hat, hört man nichts mehr von Euch, wofür ich dankbar bin. Und jetzt taucht Ihr hier im Trubel des Sao Joao auf und noch dazu direkt bei den Feuerwerksexperten. Wartet, ich frage meinen Mann, ob es in Ordnung ist, dass Ihr …«
In diesem Moment brach sie ab und lehnte sich zurück. Es schien, als würde ihr Kopf mit Gewalt zurückgebeugt werden und jemand flößte ihr eine Flüssigkeit ein.
»Laura!« Meine Stimme war hoch und schwach.
Die spuckte, doch ich bemerkte, dass sie nicht wirklich etwas eingeflößt bekommen hatte. Sie ahmte die Reaktionen einer Frau nach, die schon vor langer Zeit gestorben war.
»Was habt Ihr getan, Ihr Scheusal? … Wartet, ich werde meinem Mann …« Plötzlich zitterte sie und blickte ängstlich in die Richtung, in der der Geist stand. »Wieso ist mir plötzlich so kalt, wieso …« Sie brach ab, ihre Hände griffen nach etwas, was der Geist ihr gab, dann wandte sie sich zur dunklen Ecke.
Vor mir waberten Schatten, die zeigten, wie Laura Wachs in den Kelch tropfen ließ.
Marios Feuerwerkskörper! Sie wird sie entzünden!
Mein Herz raste, Laura war in Lebensgefahr! Ich wollte aufspringen, doch die Lähmung in meinen Beinen hielt an. Ich ballte die Faust zusammen und schlug auf den Boden. Schmerzen durchzuckten mich und fuhren durch den ganzen Körper.
Ich riss die Augen auf. Die Lähmung ließ nach! Der Geist musste sich auf Laura konzentrieren, seine Kraft war im Moment nicht stark genug, mich völlig zu paralysieren!
Verfluchtes Wesen, lass meine Laura in Ruhe!
Mein linkes Bein schlug aus, dann folgte mein rechtes. Ich wollte aufspringen und Laura von Marios Rucksack wegziehen, doch dann hielt ich inne. Der Geist war mächtig. Er würde sein Opfer fallen lassen und sich stattdessen auf mich konzentrieren. Ich musste ihn selbst angreifen!
In diesem Augenblick hörte ich, wie Laura die Streichholzschachtel öffnete.
Meine Gedanken rasten. Diese ganze Sache hatte angefangen mit dem verfluchten Kelch. Sie musste auch mit ihm beendet werden!
Ich sprang hoch, und obwohl ich wieder die volle Kontrolle über meinen Körper besaß, waren meine Muskeln steif. Ich taumelte und kam dadurch dem Geist sehr nahe. Grüne Schwaden umschlossen mich, tasteten mich ab wie Fühler eines unmenschlichen Wesens. Die Stimme, die immer wieder Rache forderte, hämmerte nun auf mich ein, drohte meinen schwachen Schild aus Entschlossenheit zu zertrümmern.
Geh aus meinem Kopf, du elendiges Scheusal, du bösartiges Arschloch!
Ich torkelte in Richtung des Kelches, in dem die Kerze glomm, die Laura entzündet hatte. Ich wollte nach ihm greifen, da verwandelte sich das Studierzimmer in einen Raum voller Instrumente und Bücher. Alles sah so aus wie in meinem Traum. Ich wollte schreien, mich wehren, doch ich erkannte, dass der Geist mich in seine Welt entführt hatte. Ich vermochte mich zu bewegen, doch was ich sah, war nur das, was der Geist erlaubte.
Ich drehte mich zur Seite und stand Auge in Auge mit Senhor Goncalves. Verbitterte, grausame Gesichtszüge verzogen sich zu einem spöttischen Lächeln. Sein Umhang war schwarz und schien aus Nebel zu bestehen. Es waren seine Augen, die mich schlucken ließen. Sie waren tiefgrün und musterten mich mit einer Mischung aus Abscheu, Hass und Gier.
»Ihr seid alle gleich. Alle verachtet ihr mich. Alle missgönnt ihr, was ich besitze! Komm nur näher, komm. Ich werde dich töten, wie ich so viele von deiner Sorte getötet habe.«
Ich konnte den Anblick des Wesens nicht lange ertragen, daher senkte ich den Blick. Und doch empfand ich die Angst nicht mehr so intensiv wie anfänglich. Außerdem musste er Laura fallen gelassen haben, um sich um mich zu kümmern. Ich spürte, wie ich ein wenig zuversichtlicher wurde. Vielleicht hatte ich doch noch eine Chance, den Geist zu besiegen.
Seine kalte Stimme schlug weiter auf mich ein. »Der Kelch, von dem du etwas abgebrochen hast, war einstmals weiß. Die Kraft, die Wesen wie du mir geschenkt haben, ist zum Teil verbrannt. Diese Rückstände machen den Kelch schwarz. Ihr müsst diese Teile wieder ersetzen. Wo bliebe sonst die Gerechtigkeit?« Dann zeigte er auf einen Punkt hinter sich und lachte. »Und keine Sorge, ich kann mich um euch beide kümmern, eure Willenskraft ist meiner weit unterlegen.«
Im Hintergrund befand sich Laura. Ihre Kleidung war noch immer die einer vornehmen Frau Anfang des Jahrhunderts.
Entsetzt hörte ich, wie ein Streichholz entzündet wurde.
Da wurde mir klar, dass ich in Wirklichkeit direkt vor dem Kelch stehen musste, dass der Geist nur meine Sinne vernebelte.
Entschlossen trat ich ein paar Schritte vor. Der Geist zischte und versuchte sich in meinen Weg zu schieben. Er fluchte und schimpfte.
»Gleich wird deine Geliebte in Flammen aufgehen, wie es Elisabete getan hat, als ich sie an Sao Joao vor den Augen ihres frischgebackenen Ehemannes das Schwarzpulver anzünden ließ. Die Energie, die sie absonderte, als sie verbrannte, schmecke ich noch heute …«
Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Laura das brennende Streichholz so hielt, dass die Flamme sich in das Holz fraß. Ich schüttelte den Kopf und stürmte mit geballten Fäusten nach vorn, mitten durch den Geist hindurch.
Funken sprühten und ich glaubte schon, dass Laura in Flammen aufgegangen sei, da sah ich, dass es die Kerze im Kelch war, die ich mit meiner Faust getroffen hatte. Hastig ergriff ich das Gefäß und schleuderte es mit voller Wucht in Richtung des nächsten Fensters.
Der Geist schrie, versuchte den Kelch mit grünen Schwaden zu umschließen, doch da traf das Gefäß auf das alte Fensterglas und durchschlug es.
Scherben schossen in alle Richtungen und reflektierten das zarte Licht der aufgehenden Sonne. Draußen prallte der Kelch auf den Asphalt der Straße.
Die Gestalt des Geistes brach in sich zusammen und flüsterte: »Vingança!« Ein Windstoß fegte herein und verjagte die grünen Schwaden. Die Stimme Goncalves verstummte.
Ich lief zu Laura, die vor Marios Sachen kniete und ein verkohltes Streichholz in der Hand hielt. Sie schüttelte den Kopf und begriff nur langsam, was passiert war. Wir umarmten und küssten uns innig.
Eine Windbö trug den Geruch nach Verbranntem zu uns.
»Oh verdammt, das Tuch brennt!«
Die Kerze, die ich umgestoßen hatte, hatte das Tuch mit den vier Buchstaben entzündet. Das Feuer fraß sich schneller in die alten Dielen, als ich es für möglich gehalten hatte.
»AING … Zusammen mit dem Kelch bilden die Buchstaben das Wort vinga – sich rächen!«, rief Laura.
Ich zog sie empor. »Wir müssen hier raus!«
Wir stürzten zu Isabella, die hustend aus ihrer Ohnmacht erwachte. Gemeinsam hasteten wir die Treppe hinunter, die bedrohlich knarrte. Als wir die Hälfte der Stufen geschafft hatten, schwankte sie und brach zur Seite weg. Laura schaffte es, hinunterzuspringen, doch ich und Isabella stürzten zur Seite.
Da ergriffen uns zwei Hände und verminderten unseren Aufprall. Es war Mario, der eine große Schürfwunde davongetragen hatte, ansonsten aber gesund schien. Er grinste sein typisches Lächeln, aber an den dunklen Schatten unter seinen Augen waren ihm die Schrecken der Nacht anzusehen.
»Von wegen du bist der Held, der die Mädchen rettet. Den Ruhm teilen wir uns«, sagte er mit einem gequälten Lächeln.
Gemeinsam hasteten wir aus dem Haus. Als wir vor den schwarzen Scherben des Kelches standen, explodierten die Feuerwerkskörper im Studierzimmer und fachten das Feuer weiter an, das einen grünen Farbstich hatte.
Da veränderten sich die Scherben zu unseren Füßen, wurden heller, bis nur noch einige Brocken Marmor vor uns lagen. Vorsichtig hob Laura eines der Stücke hoch.
»Die Teile sehen so aus, als wären sie in Säure gelegen. Völlig zerfressen!«
Ich nickte. »Das muss das Böse gewesen sein, das Senhor Goncalves mit seinen Morden geschaffen hat. Schicht für Schicht hat sich der Stein gewandelt.« Ich schluckte. »Und wir haben das Böse geweckt, als wir den Kelch freilegten.«
Wir blickten uns lange an, dann umarmten wir uns.
Hinter uns brach der Turm mit dem Studierzimmer krachend in sich zusammen.
»Fröhliches Sao Joao«, sagte Mario.
Oliver Borchers wurde 1971 in Wiesbaden geboren. Er ist in Porto, Portugal aufgewachsen und hat sich schon früh für spannende Geschichten interessiert.
Er lebt und arbeitet heute in Paderborn. 2015 wurde sein erster Roman »Ein Orbit voller Hacker« veröffentlicht. Seitdem sind mehrere Kurzgeschichten in Anthologien und auch bei tor-online erschienen.
2020 ist sein zweiter Roman erschienen: »Nano: Lüneburg« (Cyberpunk).
Er ist Mitglied beim Phantastik-Autoren-Netzwerk e.V. (PAN).
Weitere Informationen: https://oliverborchers.info
Andere Kurzgeschichten von Oliver Borchers erschienen beim »Shadodex – Verlag der Schatten«:
»Kalte Vergangenheit« (Mysteriöse Orte)
»Annas Kreuz« (Mysteriöse Friedhöfe und Grabstätten),
»Der Flug des Falken« (Dominium Terrae)
Villa Caligo
© Anke Schlachter
Die alte Sandsteinvilla stand unter Denkmalschutz und hatte schon lange nicht mehr so viel Aktivität erlebt wie heute. Gleich vier junge Menschen befanden sich seit dem späten Nachmittag in dem Gebäude, waren einmal durch alle Räume des Hauses gelaufen und hatten dabei von diversen Zetteln etwas vorgelesen. Danach hatten sie sich in verschiedenen Zimmern zu schaffen gemacht. Kameras waren aufgestellt und Kabel verlegt worden. In der ehemaligen Küche im Erdgeschoss, in der noch eine alte, fadenscheinige Eckbank stand, richteten die vier jungen Menschen ihr Hauptquartier ein.
»Seid ihr bereit?« Andy grinste die anderen vorfreudig an. Alle nickten und Ben hob die Kamera, um sie auf Andy zu richten. Der räusperte sich und fuhr sich noch ein paarmal durch die Haare.
»Wir sind hier in der sogenannten Villa Caligo, die seit Jahren leer steht und um die sich viele Geschichten ranken. Diese scheinen ihren Ursprung im frühen zwanzigsten Jahrhundert zu haben, als hier eine Welle der Schwindsucht jede der örtlichen Familien heimsuchte und auch die Bewohner der Villa nicht verschonte. Nachdem Hausherr und Hausherrin gestorben waren und ihre Kinder in jungen Jahren zu Waisen wurden, zogen entfernte Verwandte zu ihnen, um sie …« Er hob die Finger, um Anführungszeichen anzudeuten. »… auf den Weg der Tugend zurückzuführen, damit sie nicht auch von der Strafe Gottes erfasst würden.« Andy machte eine dramatische Pause und Julia, die sich leise an seine Seite gestellt hatte, sodass Ben die Kamera nur ein kleines Stück schwenken musste, übernahm.
»Die Kinder wurden mit christlicher Strenge erzogen. Jeden Morgen gab es eine Andacht und zu jeder Mahlzeit wurde gebetet. Wenn die Kinder nach Meinung ihrer Verwandten, einer Frau namens Martha, ihrer Schwester Gesine und ihrem Bruder August, gegen die Regeln verstießen, mussten sie mitunter Stunden auf den Knien verbringen und den Rosenkranz beten, Psalmen rezitieren oder singen. Bei den Kindern handelte es sich um den zehnjährigen Cornelius, die achtjährige Johanne, die sechsjährige Mathilda und die fünfjährige Gudrun. Nicht alle sollten das Erwachsenenalter erreichen. Die Kindersterblichkeit war zwar noch sehr hoch, aber wenn die Kinder die ersten vier Jahre überlebten, schafften sie es in der Regel auch ins Erwachsenenalter. Von den Kindern der Villa Caligo sollte aber nur Johanne alt werden.«
Jetzt übernahm Nadja. »Es heißt, in diesen Zeiten habe man die Kinder häufig weinen hören. Nach außen hin gab es nie Klagen. Die Kinder waren immer artig, nett und adrett. Aber wenn Spaziergänger abends an dem Haus vorbeikamen, hörte es sich manches Mal an, als seien die Kinder ordentlich gezüchtigt worden. Damals war das normal und niemand hätte wegen ein paar Schlägen die Behörden informiert. Auch als die Kinder – eines nach dem anderen – starben, gab es niemanden, an den sich die überlebenden hätten wenden können. So heißt es jedenfalls in den urbanen Legenden.«
»Warum wir euch das alles erzählen?« Ben schwenkte wieder auf Andy, der übernahm. »Weil alle Menschen, die in späteren Jahren dieses Haus bezogen, berichteten, dass sie Kinderstimmen hören würden. Niemand hat es lange hier ausgehalten. Die Mieter oder Besitzer nach der ursprünglichen Familie, die am längsten hier lebten, hielten es fünf Jahre aus. Danach haben sie nicht nur dieses Haus, sondern auch die Region verlassen. Die Dörfler erinnern sich noch, dass sie mit jedem Jahr, das sie hier verbracht haben, immer verhärmter aussahen. Die Alten sprechen noch heute davon und warnen ihre Enkel.«
»Also auch uns«, sprang Julia wieder ein. »Wir alle wurden gewarnt, niemals in diesem Haus zu spielen und den Garten nie zu betreten. Es sei gefährlich. Als wir noch klein waren, wurde uns nie genau gesagt, was hier los sein soll. Aber je älter wir wurden, desto mehr erfuhren wir. Wann immer ein Obdachloser im Winter auf den Gedanken kam, dass er dieses Haus zum Schutz nutzen könne, wurde er nicht mehr gesehen. Die Polizei hat mehrfach Habseligkeiten gefunden, aber die Menschen verschwanden spurlos. Kinder, die auf dem Grundstück spielten, wurden schwer krank. Manche von ihnen sollen sogar gestorben sein – wobei wir dazu keine bestätigten Quellen finden konnten.«
»Aber das ist noch nicht alles«, fuhr Nadja fort. »Obwohl dieses Haus seit Jahrzehnten leer steht, sehen Nachbarn oder Spaziergänger regelmäßig Licht hinter den blinden Fensterscheiben. Es wurde schon Musik gehört – die Zeugen sprechen von kirchlichen Liedern – und der Postbote schwört, dass er hier von einer Frau nach dem Weg gefragt wurde. Als er ihr diesen erklärte und dabei kurz von ihr wegsah, war sie verschwunden. Ohne dass es einen Laut gegeben hätte. Seitdem wechselt er immer die Straßenseite, wenn er hier entlangmuss.«
Andy übernahm wieder. »Uns ist es gelungen, ein paar der ehemaligen Mieter oder Besitzer dieses Hauses ausfindig zu machen. Nachdem wir versichert hatten, dass wir ihre Namen nicht nennen würden, weihten sie uns ein, was ihnen in diesem Haus passiert ist. Neben den bereits genannten Kinderstimmen berichteten sie von Schritten, Türen, die sich von allein öffneten oder schlossen und dem ständigen Gefühl, beobachtet zu werden. Alles in allem verspricht diese Location also, sehr interessant zu werden. Wir sind vorhin schon durch das Haus gegangen und haben unsere Kameras aufgestellt. Ben? Was haben wir?«
Ben ließ die Kamera noch ein paar Sekunden laufen, dann reichte er sie an Andy weiter, der sie auf ihn richtete und ihm dann zunickte. Natürlich würden sie das Material im Nachgang sichten und schneiden.
»Wir haben eine stationäre Kamera im Keller, zwei im Treppenhaus – eine filmt von oben und eine von unten – eine auf dem Dachboden und eine im Salon. Jeder von uns wird eine Handheld-Kamera mit sich führen, wir haben diverse Tonbandgeräte für EVPs und natürlich K2- und Mel-Meter für die elektromagnetischen Messungen. Julia wird die Wärmebildkamera bedienen und Andy möchte weitere Experimente mit der Kinect machen. Uns schweben außerdem Versuche mit der Spirit-Box vor. Bewegungsmelder haben wir in den Zimmern, die vermutlich von den Kindern bewohnt wurden, installiert. Sie machen mit Geräuschen auf sich aufmerksam.«
Andy richtete die Kamera auf die beiden Mädchen.
»Wir werden uns jetzt in zwei Gruppen aufteilen«, sagte Nadja. »Ich gehe mit Andy und Julia begleitet Ben. Wir fangen im Keller an und die anderen gehen auf den Dachboden.«
Wie auf ein Stichwort fiel Julia mit ein: »Wir sind die Paranormal Force und sind gespannt, was uns dieser Ort zu bieten hat.« Dann lächelten die beiden jungen Frauen in die Kamera, bis Andy ihnen zunickte und das Gerät senkte.
»Das war richtig klasse. Dann lasst uns mal die Ausrüstung schnappen und loslegen. Es wird langsam dunkel. Lasst uns mit den Grundmessungen anfangen und dann die ersten Untersuchungen im Keller und auf dem Dachboden machen.«
Jedes Teammitglied nahm sich eine Kamera und ein Ansteckmikrofon, welches sie mit der Kamera verbanden. Verschiedene andere Geräte wanderten an Gürtelklips oder in Bauchtaschen, damit sie für den späteren Einsatz parat waren.
Dann gingen die vier zur Treppe. Mit eingeschalteten Kameras stiegen Julia und Ben nach oben, während Andy und Nadja warteten, bevor sie die Kellertür in der Treppenverkleidung öffneten und dann die steile Stiege hinableuchteten.
»Wir sind oben angekommen«, meldete sich Julia über das Walkie-Talkie. »Wenn ihr ab jetzt Schritte auf der Treppe hört, waren nicht wir das.«
Nadja grinste. »Verstanden. Wir gehen jetzt runter.«
Taktvoll überließ sie Andy den Vortritt. Dieser nutzte die Kinect, um im Keller Aufnahmen zu machen. Weil die Stufen so schmal waren, wäre er fast die restliche Treppe hinuntergefallen.
Nadja schnappte erschrocken nach Luft. »Bist du in Ordnung? Was ist passiert?«
»Ich bin nur abgerutscht. Ich nutze die Kinect am besten erst unten.« Er hörte, wie sie erleichtert ausatmete, und schmunzelte in sich hinein. »Keine Sorge. Wenn mich ein Geist schubsen sollte, sag ich dir Bescheid.«
»Du bist doof.« Aber Nadja lachte trotzdem.
Der Keller war niedrig, Andy hatte ständig das Gefühl, mit den Haaren an der Decke entlangzuschrammen. Unwillkürlich zog er den Kopf zwischen die Schultern, während er, ein paar Schritt weit im ersten Raum stehend, einen langsamen Schwenk mit der Kinect machte. Nadja filmte mit der normalen Kamera.
»Ich hab schon wieder vergessen, was hier im Keller vorgefallen sein soll«, sagte sie.
»Fast alle haben davon berichtet, dass sie sich hier beobachtet gefühlt haben. Insbesondere wenn sie im zweiten Raum an der Waschmaschine waren. So als würde ihnen jemand über die Schulter schauen oder als ob jemand in diesem Raum sei und zu ihnen reinschauen würde. Eine Frau beschrieb, dass sie sich kontrolliert fühlte. Also nicht so, als sei sie eine Marionette, sondern so, als würde ihr jemand ganz genau auf die Finger schauen, um mit ihr zu schimpfen, wenn sie was verkehrt mache. Sie sagte, sie sei immer nervös gewesen hier unten.«
»Ja, ich muss sagen, dass ich mich hier auch nicht wirklich wohlfühle«, bestätigte Nadja und sah über die Schulter zurück.
Hier im ersten Keller war es ziemlich dunkel, zumal sie kein Licht eingeschaltet hatten. Vom Treppenaufgang her fiel schwacher Lichtschein herunter und auch aus dem nächsten Kellerraum kam ein wenig Helligkeit – gerade genug, damit sich der Durchgang merklich vom Rest des Raumes abhob.
»Was hast du?«, fragte Andy, nachdem Nadja mehrere Sekunden lang zur Treppe geschaut hatte. Ihre Kamera richtete sie weiterhin in den Raum.
»Ich weiß nicht«, erwiderte sie. Weil sie mit den Augen nichts erkennen konnte, schwenkte sie nun auch die Kamera dahin. Der Nachtsichtmodus zeigte den Beginn der Stufen und ein paar Gerätschaften unter der Treppe. Auf dem grünlichen Bild des kleinen Bildschirms war keine wirkliche Tiefe zu erkennen. Auch zeigte es nicht den Grad der Verstaubung dieser Räumlichkeiten. Aber es wies auch keinerlei Besonderheiten auf. Nadja zuckte mit den Schultern und wandte sich wieder dem Raum zu. Langsam schwenkte sie die Kamera. Dabei entging ihr die leichte Veränderung der Lichtverhältnisse am Fuß der Treppenstufen.
Auch der nächste Kellerraum zeigte äußerlich keine Auffälligkeiten. Hier gab es Steckdosen auf halber Höhe der Wand und Wasseranschlüsse. Im Boden gab es einen Abfluss. Ansonsten war der Raum leer, Waschmaschine und Trockner waren schon vor langer Zeit entfernt worden. Auch hier war die Decke niedrig und der Bereich für die Maschinen beengt, fast schon eine Nische.