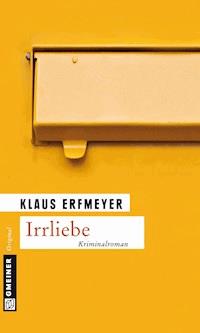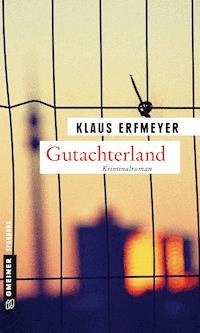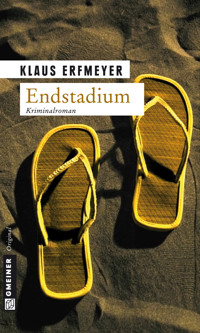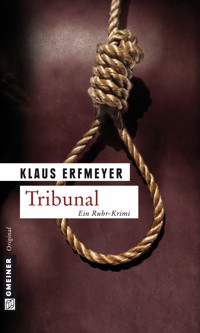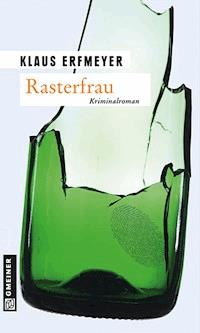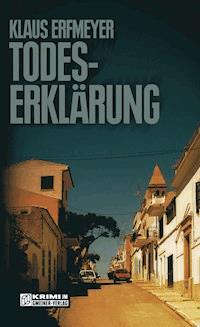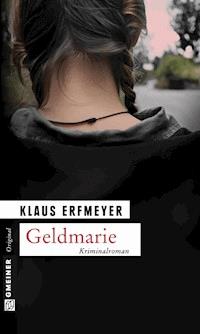
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Rechtsanwalt Stephan Knobel
- Sprache: Deutsch
Stephan Knobel geht es nicht gut. Die Dortmunder Kanzlei, für die er arbeitet, ist wirtschaftlich angeschlagen. Unter den Beschäftigten wachsen das Misstrauen und die Angst, Opfer eines Sanierungskonzepts zu werden. Doch viel mehr Sorgen bereitet ihm ein ganz anderes Problem. Seine Freundin Marie ist seit einem Besuch bei ihrem Germanistikprofessor spurlos verschwunden. Und der ist jetzt tot, gestorben an einem Herzinfarkt. Seit ihrem Verschwinden werden von Maries Girokonto täglich 1.000 Euro an verschiedenen Geldautomaten der Stadt abgehoben. Die Polizei ist sich sicher, dass Marie mit dem Tod des Professors etwas zu tun haben muss und ihre Flucht vorbereitet. Eine Theorie, an die Knobel nicht glauben mag!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Erfmeyer
Geldmarie
Knobels dritter Fall
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2008 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von Prokop, Photocase.com
ISBN 978-3-8392-3032-9
1. Kapitel
Das Unheil kündigte sich lautstark an. Energische harte Schritte im Flur, näher kommendes Stimmengewirr, wie abgehackt wirkende Wortfetzen, Lärm, der die bürokratische Geschäftigkeit der Kanzlei überwältigte und die Alltäglichkeit erdrückte. Rechtsanwalt Stephan Knobel hielt inne, sah ungläubig seiner Sekretärin ins Gesicht, die ihm an diesem Oktobernachmittag im Büro gegenübersaß und mit ihm die Termine des morgigen Tages vorbereitete, Akten herausgesucht und zur Bearbeitung vorgelegt hatte. Die Schritte stampften draußen auf den Marmorfliesen entlang. Knobel wähnte sie hinter der Bücherwand seines Büros, die an den Flur grenzte. Dann verstummte das soldatische Stampfen, und die Stimmen wurden lauter. Frau Klabunde sah unwillkürlich auf die geschlossene Tür, die Knobels Büro von ihrem Sekretariat trennte, und bevor sie instinktiv aufstehen konnte, weil sie die Eindringlinge nun in ihrem Zimmer wähnte, flog die Tür zu Knobels Büro auf. Hubert Löffke stand im Türrahmen. Sein rotes Gesicht verriet eine ungewohnte Erregung. Die Anzugweste spannte sich über Löffkes fettleibigen Bauch, und sein ganzer Körper bebte. Hinter Löffke standen zwei Männer. Knobel nahm sie hinter dem die Szene dominierenden Löffke nur flüchtig wahr. Sie blieben still im Hintergrund und spähten interessiert in Knobels Büro.
»Sie lassen uns mit Herrn Kollegen Knobel jetzt allein«, befahl Löffke.
Frau Klabunde erschrak, wagte einen unsicheren Blick zu Knobel, raffte einige der vor ihr liegenden Akten zusammen und suchte umständlich und irritiert nach ihrem Notizblock, den sie unter den vielen Unterlagen auf Knobels Schreibtisch vermutete.
»Sofort!«, bellte Löffke. Er war einen Schritt in Knobels Büro vorgetreten, stand mit leicht gespreizten Beinen da und verschränkte die Arme vor der Brust. Frau Klabunde wagte nicht, ihre Suche fortzusetzen, erst recht nicht ihre geschäftige Frage anzufügen, ob sie noch etwas für den Besuch tun könne, und drückte sich mit einigen Akten still an Löffke vorbei. Die beiden Unbekannten sagten höflich »Guten Tag«. Die Worte stachen eigentümlich beruhigend in die aggressive Bedrohlichkeit, und fast, als wollte Löffke dem entgegenwirken, trat er nun ganz in Knobels Büro, winkte die beiden Herren herein, wies mit ausgestrecktem Arm auf Knobel und präsentierte im Ton eigentümlicher Befriedigung: »Das ist er!«
Knobel hatte sich bis dahin nicht gerührt. Die Überraschung des Angriffs, die Ahnungslosigkeit, was sich dahinter verbarg, hatte ihn eingeschüchtert und schuldig fühlen lassen, ohne dass er einen Grund hierfür hätte benennen können. Einem Automatismus folgend, bat er die Herren, vor seinem Schreibtisch Platz zu nehmen.
»Das sind die Herren Faltinger und Reitz, beide vom Polizeipräsidium Dortmund«, erklärte Löffke schneidend, der wie eine Statue stehen blieb, während die Besucher Platz nahmen. »Sie ermitteln in einem Tötungsdelikt!«
»Ein Tötungsdelikt?«, wiederholte Knobel tonlos. Seine Stimme klang belegt, und seine Blicke irrten zwischen den Polizeibeamten und Löffke hin und her.
»Es ist nicht sicher, ob es sich tatsächlich um ein Verbrechen handelt«, meinte Herr Faltinger. »Aber wir können es nicht ausschließen, und deshalb ermitteln wir.« Er hatte ein Notizbuch aus seiner Jacke gezogen, blätterte darin herum und verharrte auf einer Seite.
»Wollen Sie mir nicht endlich sagen, was los ist?« Knobels Stimme war fester geworden.
»Sie kennen Professor Grömitz?«, fragte der andere.
»Grömitz? Ja, der Name sagt mir selbstverständlich etwas«, antwortete Knobel. »Aber ich kenne ihn nicht persönlich. Nur vom Hörensagen. Er ist Professor für Germanistik an der Universität Dortmund.«
Reitz nickte.
»Er ist der Professor, bei dem die Studentin Marie Schwarz ihren Abschluss machen wird«, ergänzte Löffke. »Und Marie Schwarz ist die Geliebte des Kollegen Knobel. Für die er – das ist kein Geheimnis – seine Frau Lisa und sein Töchterchen Malin sitzen gelassen hat. Und jene Marie Schwarz hat für unsere Kanzlei – dank des persönlichen Einsatzes des Kollegen Knobel für seine geliebte Studentin – gelegentlich Detektivarbeiten übernommen. Sie sollten schon vollständig erzählen, Herr Knobel!«
Löffke hatte seine Hände nun in die Hüften gestützt. Er begann, in Knobels Büro auf und ab zu gehen.
»Stimmt das?«, fragte Herr Reitz.
»Ja, es stimmt«, antwortete Knobel. »Aber ich habe nicht wegen Marie meine Frau sitzen lassen. Aber das tut auch nichts zur Sache. Es war auch nicht Ihre Frage.«
»Aber, aber, aber«, äffte Löffke nach. »Sie tun ja, als müssten Sie sich verteidigen, Herr Knobel!«
»Was ist mit Professor Grömitz?« Knobel blickte fragend in die Gesichter der Beamten.
»Tot!«, antwortete Löffke. »Er ist heute Morgen tot von seiner Haushälterin in seinem Haus aufgefunden worden.«
»Es liegt noch kein Obduktionsergebnis vor«, erklärte Herr Faltinger. »Von seinen Lehrstuhlmitarbeitern und von seiner Haushälterin wissen wir, dass Grömitz schwer herzkrank war. Es ist nicht auszuschließen, dass es ein Herzinfarkt gewesen ist. Äußerliche Gewalteinwirkungen sind jedenfalls nicht feststellbar. Aber das soll nichts heißen. – Was den Fall jedenfalls undurchsichtig macht: Professor Grömitz ist – wie es aussieht – während des Abendessens gestorben. Er hat am Esstisch im Wohnzimmer seines Hauses gesessen. Es gab ein Nudelgericht, das von seiner Haushälterin auftragsgemäß am gestrigen Nachmittag vorbereitet wurde. Eine Mahlzeit für zwei Personen. Grömitz hat seinen Teller etwa zur Hälfte leer gegessen. Und das Gleiche gilt für den Gast. Beide haben etwas gegessen, mehr nicht. Und Grömitz und sein Gast haben auch Rotwein getrunken. Wie viel genau, wissen wir noch nicht. Aber sowohl das Glas des Professors als auch das Glas des Gastes waren noch halb gefüllt. Sie werden zugeben, dass das merkwürdig ist.«
»Ich verstehe noch immer nicht, was das mit mir zu tun hat.«
»Nicht mit Ihnen direkt, Kollege Knobel, sondern mit Ihrem Mariechen«, erwiderte Löffke, »und somit doch wieder mit Ihnen.«
»Die Faktenlage ist noch dünn«, fuhr Faltinger fort. »Weder das Essen noch der Rotwein waren nach ersten Laborerkenntnissen vergiftet. Auch nicht der Wodka, den es offensichtlich vor dem Essen gegeben hat. Vielleicht als Aperitif.«
Knobel blickte fragend auf.
»In der Küche standen zwei leere Gläser. Dem Geruch nach waren sie mit Wodka gefüllt«, erklärte Faltinger.
»Vielleicht sollten wir dem Kollegen Knobel mehr auf die Sprünge helfen«, unterbrach Löffke, »er schaut ja aus, als könne er mit alledem nichts anfangen.«
»Von den Lehrstuhlmitarbeitern von Professor Grömitz wissen wir, dass Marie Schwarz Herrn Professor Grömitz gestern Abend besuchen wollte«, fuhr Faltinger fort. »Stimmt das?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete Knobel. »Wir haben uns seit gestern Morgen, also Montagmorgen, nicht gesprochen. Von einem Besuch Maries bei Professor Grömitz war nicht die Rede. Sie war auch heute Nacht nicht bei mir.«
»Frau Schwarz wohnt im Dortmunder Norden in der Brunnenstraße, und Herr Kollege Knobel wohnt derzeit im Dortmunder Westen in einer kleinen Mietwohnung, seit er seine Frau und Tochter im Familienheim in der Dahmsfeldstraße zurückgelassen hat«, setzte Löffke hinzu, der nun mit verschränkten Armen hinter den beiden Kommissaren Stellung bezogen hatte.
»Sie brauchen nicht zu soufflieren. Es gibt keine Geheimnisse«, giftete Knobel.
»Ich will nur aufklären. Der unangenehme Fall betrifft letztlich die gesamte Kanzlei«, gab Löffke zurück.
»Es darf als gesichert angesehen werden, dass Frau Schwarz den Professor gezielt aufsuchen wollte«, fuhr Faltinger fort. »Die Aussagen der Lehrstuhlmitarbeiter sind eindeutig. Sie sagen auch übereinstimmend aus, dass Frau Schwarz sehr aufgeregt war. Ungewöhnlich für Ihre Freundin, wie man sagt.«
»Ja«, antwortete Knobel.
»Also war sie schon aufgeregt, als Sie mit ihr gesprochen haben?«
»Nein! Das Ja bezog sich darauf, dass es für Marie ungewöhnlich ist, sich aufzuregen. Jedenfalls regt sie sich gewöhnlich nicht sichtbar auf.«
»Sie müssen präzise sein«, mahnte Löffke und wippte auf den Zehenspitzen.
»Sie wissen, dass Frau Schwarz bei Professor Grömitz studentische Hilfskraft war«, fragte Reitz.
»Natürlich!«
»Kam es häufiger vor, dass sie Professor Grömitz zu Hause besuchte?«
»Soweit ich weiß, war sie schon zwei- oder dreimal bei ihm. Vielleicht auch noch etwas häufiger.«
»Nach unseren Ermittlungen waren die anderen Lehrstuhlmitarbeiter bislang nie bei Herrn Professor Grömitz zu Hause gewesen. Außer zu seinem 60. Geburtstag. Aber das ist, denken wir, etwas anderes, sozusagen außer der Reihe. Bei Frau Schwarz scheint es etwas anderes gewesen zu sein.«
»Sie schätzten sich sehr«, erwiderte Knobel. »Marie hat gern von Herrn Professor Grömitz erzählt. Ihr gefielen seine Vorlesungen. Nachdem er eine Seminararbeit von ihr hervorragend benotet hatte, bot er ihr eine Tätigkeit als studentische Hilfskraft an.«
»Marie Schwarz ist – das darf ich anmerken – eine sehr attraktive junge Dame«, warf Löffke ein und registrierte zufrieden, dass Faltinger offenbar eine entsprechende Notiz aufnahm.
»Warum in Gottes Namen soll Marie Professor Grömitz etwas angetan haben? – Herr Faltinger, Herr Reitz: Nennen Sie mir einen einzigen vernünftigen Grund!«
»Wir können Ihnen noch keinen Grund nennen, Herr Knobel. Aber die Sache wirft Fragen auf. Wenn es so ist, wie es nach den bisher bekannten Fakten aussieht, dann hat Ihre Frau Schwarz gestern Abend Herrn Professor Grömitz aufgesucht…«
»Vielleicht ist sie gar nicht hingefahren«, unterbrach Knobel. »Vielleicht hatte sie es vorgehabt, dann aber ihren Plan geändert.«
»Sie ist«, widersprach Herr Reitz, »denn ihr Auto stand vor dem Haus des Professors. Nach Zeugenaussagen bis etwa 23.00 Uhr.« Knobel wollte widersprechen, aber Herr Reitz wehrte mit einer Handbewegung ab. »DO-MS 2306. Das ist doch das Kennzeichen des Autos von Frau Schwarz, oder? – MS steht für Marie Schwarz, 2306 für ihren Geburtstag, den 23. Juni. Stimmt’s?«
»Ja, das ist richtig. Aber welcher Zeuge will Marie bei Grömitz gesehen haben, und welcher Zeuge merkt sich ein so krummes Kennzeichen? So etwas merkt man sich doch nicht zufällig.«
»Gleich, Herr Knobel!« Herr Faltinger blätterte in seinem Notizbuch und sammelte sich.
»Sie müssen Herrn Knobel verstehen«, warf Löffke ein, »er ist zwar kein Strafrechtler, aber die Liebe macht ihn jetzt zum Verteidiger…«
»Marie Schwarz fährt also am Abend des gestrigen Montags zu Professor Grömitz in die Aplerbecker Mark«, hob Faltinger erneut an. »Wann genau sie dort angekommen ist, wissen wir nicht. Die Haushälterin ist – wie immer – gegen 17.00 Uhr gegangen. Das Abendessen ist vorbereitet, die Rotweinflaschen sind geöffnet. Der Rotwein sollte atmen. – Mag Frau Schwarz Rotwein?«
»Auf unserer letzten Weihnachtsfeier reichlich«, stellte Löffke fest. »Merlot für Merlot, Fläschchen für Fläschchen. Aber nichts für ungut. Man gewöhnt sich ja schnell an guten Geschmack. Nichts Verwerfliches also…«
»Sie genießt gern Rotwein«, hielt Knobel dagegen. »Aber sie säuft ihn nicht wie Sie, Herr Löffke! – Und wenn sie von zwei Flaschen für zwei Personen sprechen: Das passt auch nicht zu Marie! – Wie Sie sagen, war sie mit dem Auto bei Grömitz. Sie trinkt nie, wenn sie fährt, und auch sonst schafft sie kaum mehr als zwei Gläser am Abend.«
»Vielleicht wollte sie dort übernachten«, fiel Löffke ein.
»Halten Sie den Mund!«, giftete Knobel zurück.
Faltinger notierte sich dies und das, und Knobel wiederholte, dass Marie nur wenig Alkohol trinke.
»Habe ich verstanden«, nickte Faltinger. »Sie kommt also bei Grömitz an – irgendwann nach 17.00Uhr«, fuhr er fort. »Außer ihm ist niemand da. Wie üblich. Grömitz ist seit vier Jahren verwitwet. Seine beiden Kinder sind längst aus dem Haus. Die Tochter studiert in Freiburg, der Sohn arbeitet als Chemiker in Lausanne. Grömitz öffnet ihr die Tür. Sie geht ins Haus. Sie kennt das Haus. – Wie Sie sagen, war sie schon einige Male bei ihm. Was machen sie?«
»Ja, was machen sie?«, wiederholte Löffke.
»Sie trinken zur Begrüßung einen Wodka, zum Beispiel«, setzte Faltinger erneut an.
»Erstens: Marie trinkt keinen Wodka. Hat sie noch nie getan! – Zweitens: Warum sollten die beiden den Abend beginnen, als gäbe es etwas zu feiern?« Knobel schlug sich mit der Hand vor die Stirn. »Die Geschichte ist so aberwitzig, dass ich mir nicht zu helfen weiß.«
»Warum war Frau Schwarz denn schon früher einige Male bei Professor Grömitz – ganz im Gegensatz zu den anderen Lehrstuhlmitarbeitern? Dazu haben Sie uns bislang nichts sagen können.«
»Ich weiß es nicht – ehrlich«, rief Knobel.
»Professor Grömitz und Marie Schwarz trinken also, warum auch immer, einen Wodka. Oder vielleicht trinken sie ihn auch später. Egal.«
»Und schließlich«, fuhr Knobel dazwischen, »warum dieses feierliche und eigentlich gemütliche Ritual, wenn Marie, wie Sie sagen, an diesem Tage ungewöhnlich aufgeregt war? Das passt nicht zu der Geschichte, die Sie kreieren.«
»Vielleicht war sie so aufgeregt vor dem, was sie im Hause Grömitz erwartete«, sagte Löffke, und sein Gesicht verzog sich zu einem breiten Grinsen. »Sie ist ja außergewöhnlich hübsch – und macht bald ihre Prüfung.« Und dem zu erwartenden Angriff Knobels zuvorkommend, fügte er nüchtern an: »Wir sind eine Kanzlei, die nicht in den Schmutz gezogen werden will, Kollege Knobel! – Es geht hier bislang nur um Hypothesen. Alles muss diskutiert werden.«
»Es sind nur Gedankenspiele«, bestätigte Reitz. »Sie können sich doch denken, dass wir eine Person noch nicht befragen konnten…«
Knobel erschrak. »Was ist mit Marie? Wo ist sie?«
»Verschwunden«, antwortete Faltinger. »Und dieser Umstand wirft Fragen auf, das ist doch klar! Bitte, Herr Knobel, lassen Sie uns fortfahren: Professor Grömitz und Frau Schwarz essen also zu Abend. Die von der Haushälterin vorbereitete Mahlzeit steht auf dem Tisch. Und während dieses Essens – lassen Sie es mich ganz neutral ausdrücken – passiert etwas mit Professor Grömitz. Vielleicht bricht er zusammen. Möglicherweise ein Herzinfarkt. Einfach so. Warum, frage ich Sie, holt Frau Schwarz keinen Arzt? Vielleicht stirbt er sogar in ihren Armen. – Bitte, das ist nicht anzüglich gemeint. Vielleicht kümmert sie sich um den Professor, den sie, wie Sie sagen, so schätzt? Warum auch in diesem Fall kein Ruf nach Hilfe? Warum nicht einmal von alledem eine Nachricht an Sie, Herr Knobel? Das sind Fragen, die bis jetzt nicht schlüssig zu beantworten sind. Sehen Sie es einmal so: Einleuchtend und vernünftig wäre allein, dass Frau Schwarz Hilfe geholt hätte. Selbst wenn sie – worauf Ihr Kollege Löffke immer wieder anspielt – ein Verhältnis zu Professor Grömitz gehabt hätte: Was hindert Frau Schwarz, Hilfe zu holen?« Er ließ die Frage für einige Augenblicke unbeantwortet im Raum stehen, dann fuhr er fort: »Gegen 23.00 Uhr verlässt Frau Schwarz mit ihrem Auto das Grundstück von Professor Grömitz. Sie startet den Wagen, würgt ihn offensichtlich einige Male ab, dann heult der Motor auf, die Reifen drehen auf dem Kies in der Einfahrt des Hauses durch, das Fahrzeug schießt nach vorn und rammt vor dem Grundstück eine für den nächsten Morgen zur Entleerung bereitgestellte Mülltonne. Diese Art des Wegfahrens ist außergewöhnlich. Und wenn ein Zeuge dies beobachtet – und beobachtet wurde es von einer Anwohnerin, die ihren Hund ausführte –, dann merkt dieser Zeuge sich auch einAutokennzeichen, das nicht so einprägsam ist wie viele andere mit glatten Zahlen: DO-MS 2306. So weit zu Ihrer Frage.«
Knobel überlegte. »Marie fährt sicher Auto«, entgegnete er. »Sie fährt nicht so, wie es die Zeugin beschrieben hat.«
»Wie fahren Sie Auto, Herr Knobel, wenn Sie – ich formuliere es wieder neutral – diesem in seinem Hergang noch unbekannten Ereignis beiwohnten? Und wenn Sie zudem noch getrunken haben?«
»Hat die Zeugin Marie überhaupt erkannt?«
»Nein, Herr Knobel! Die Zeugin ist zunächst auf den Krach aufmerksam geworden, und dann hat sie das Auto von dem Grundstück rasen, nach rechts abbiegen und die Mülltonne umstoßen sehen. – Aber wer sollte es sonst sein, zumal Ihre Marie nicht auffindbar ist? Das Auto übrigens auch nicht. – Und Ihrer Frage zuvorkommend: Es war auch der kleine Toyota Ihrer Frau Schwarz und nicht irgendein anderes Auto mit einem gestohlenen oder gefälschten Kennzeichen. Die Zeugin fährt ein Auto desselben Typs. Sie war sich sicher.«
»Und da es keine schlüssige und rechtlich unbelastete Erklärung für das Verhalten von Marie Schwarz gibt«, folgerte Löffke, »kann es nur so sein, dass Marie Schwarz mit dem Tod des Professors in irgendeiner Weise zu tun hat.«
»Und wenn Marie mit Grömitz gegessen, sie sich mit ihm vielleicht zerstritten, dann das Essen mit ihm abgebrochen hat, wütend davongefahren ist und Herr Grömitz in seiner Aufregung erst danach zusammengebrochen und verstorben ist? Wenn sie aus Wut über Grömitz, vielleicht auch alkoholisiert, davongerast ist und sich versteckt, um nicht ihre Trunkenheitsfahrt offenbaren zu müssen? Was ist mit dieser Alternative?« Knobels Stimme hatte sich aggressiv aufgeladen. »An diese Möglichkeit denkt offenbar niemand.«
»Doch«, antwortete Faltinger ruhig. »Aber sie ist mehr als unwahrscheinlich. Denn sie erklärt nicht, warum Frau Schwarz immer noch verschwunden ist. Sie hat, das sollten wir Ihnen auch noch mitteilen, aus ihrer Wohnung offensichtlich reichlich Kleidung mitgenommen. Wir haben die Wohnung von Frau Schwarz vorhin aufgrund richterlichen Beschlusses durchsucht. Sie hat in ihrer Wohnung – ich darf voraussetzen, Herr Knobel, dass Sie die Räumlichkeiten kennen – im Schlafzimmer zwei Schränke, die hauptsächlich Kleidung enthalten. Und aus diesen Schränken sind offensichtlich hastig einige Kleidungsstücke mitgenommen worden. Wir schließen das aus dem Umstand, dass die Schränke geöffnet und einige Fächer ausgeräumt sind und einzelne Pullover und Hosen auf dem Fußboden liegen, als seien sie bei der überstürzten Suche aus den Schränken geworfen worden. Frau Schwarz ist, wie es aussieht, hektisch, aber gleichwohl geplant aufgebrochen. Sie ist, da besteht kein Zweifel, auf der Flucht. – Versuchen Sie, sie über Handy zu erreichen, Herr Knobel! Sie werden sie nicht erreichen! Das Gerät ist abgeschaltet.«
Knobel merkte, dass er zu zittern begann.
»Ich verstehe Sie ja«, sagte Herr Faltinger.
»Es könnte Mord durch Unterlassen sein«, setzte Löffke nach. »Wenn die Ergebnisse zeigen, dass der Zusammenbruch von Professor Grömitz vor Schwarzens Flucht lag, der Tod aber erst später eintrat, könnte es Mord sein. Rechtlich hatte sie gegenüber Grömitz mindestens aus ihrer Lehrstuhltätigkeit für ihn so etwas wie eine Schutzpflicht. Das ist mehr als bloße unterlassene Hilfeleistung. Da steckt ein Plan dahinter. Ich wittere Vorsatz!« Und er steigerte sich: »Ich sehe die Wahrheit klar vor mir!«
»Löffke!« Knobels Schrei fuhr den anderen dreien in die Glieder. Er bemerkte, dass die Klinke zum Sekretariatszimmer leise und langsam heruntergedrückt wurde und sich die Tür einen kleinen Spalt öffnete. Frau Klabunde würde zu ihm halten. Aber was würde es nutzen?
»Frau Schwarz ist eine reiche Frau«, fuhr Löffke schließlich unbeirrt fort. »Sie hat eine Erbschaft gemacht. Sie hat eine alleinstehende alte Frau beerbt, die ihre letzten Tage im Wohnstift Augustinum verbracht hat. 500.000 Euro, wenn ich mich recht erinnere. Wenn sie auf der Flucht ist, kann sie durchaus weit kommen, unsere Geldmarie.«
»Raus!« Knobel sprang auf, bereit, den bulligen Löffke aus seinem Büro zu drängen. Die Polizeibeamten blickten irritiert auf.
»Der geht jetzt«, sagte Knobel knapp.
»Sind Sie denn nicht Herrn Knobels Chef?«, fragte Faltinger unsicher.
»Die Kanzlei heißt ›Dr. Hübenthal & Knobel‹, nicht ›Dr. Hübenthal & Löffke‹«, schäumte Knobel, »wobei es kein Geheimnis ist, dass Kollege Löffke lieber heute als morgen meinen Platz einnehmen würde.«
»Also sind Sie Herrn Löffkes Chef?«, fragte Faltinger weiter.
»Das hätte er gern«, giftete Löffke.
»Das heißt?«, fragte Herr Reitz.
»Wir sind Partner in der Sozietät«, erklärte Knobel.
»Partner.« Herr Faltinger notierte sich das. »Vielleicht ist es wirklich besser, Herr Löffke, wenn Sie uns jetzt hier allein lassen. Es ist doch ein sehr sensibles Thema, wie wir merken.«
»Kein Problem!« Löffke hob die Hände, als unterwerfe er sich freiwillig. »Kein Problem! – Es wird sich alles aufklären, da bin ich mir sicher. Und im Interesse der Kanzlei muss sich auch alles aufklären! Ich habe unser aller Interesse im Blick! Sie tragen für die Kanzlei und ihre Mitarbeiter Verantwortung, Herr Knobel! Daran werden Sie denken, wenn Sie Ihr Mariechen schützen. Und vielleicht denken Sie an den Vater Ihrer Frau, mit der Sie ja noch verheiratet sind. Guter Strafverteidiger, professionell durch und durch! Keine Allüren, keine Affären! Ein Gegenentwurf zu Ihnen, verehrter Herr Kollege Knobel!«
Dann ging er. Knobel sah durch die kurz geöffnete Tür zu seinem Sekretariat, dass sich Frau Klabunde auf ihren Platz zurückgezogen hatte und scheinbar unbeteiligt ein Diktatband zu einer Akte schrieb. Ihre Augen widmeten sich dem Bildschirm ihres Computers, während ihre Finger flink über die Tastatur huschten. Nur ihr hochroter Kopf verriet, dass sie über das Geschehen in Knobels Büro im Detail im Bilde war. Knobel stand auf und lehnte die Tür zum Sekretariat nur an.
»Nachdem wir von den Lehrstuhlmitarbeitern erfahren hatten, dass Frau Schwarz gelegentlich für Ihre Kanzlei arbeitet und sie mit Ihnen befreundet ist, haben wir uns an Ihre Sozietät gewandt«, erklärte Faltinger. »Herr Löffke war so freundlich …«
»… sich anzudienen und seine Version der Dinge zu schildern«, vollendete Knobel. »Ich kann es mir denken.«
»Nun ja, gewisse Differenzen zwischen Ihnen sind nicht zu übersehen. Aber im Kern geht es nur um Frau Schwarz. Sehen Sie: Wir haben Rotwein- und Wodkagläser, Besteck und viele andere Gegenstände, die am gestrigen Abend angefasst worden sein dürften, ebenso wie einige Gegenstände aus dem Haushalt von Frau Schwarz zur kriminaltechnischen Untersuchung gegeben. Die Ergebnisse liegen morgen vor, aber ich denke, dass die Fingerabdrücke übereinstimmen werden. Sie werden sich darauf einrichten müssen, dass Frau Schwarz im Hause Grömitz war und mit dem Professor zusammen gegessen hat. Was aus welchen Gründen dabei oder danach passiert ist, wissen wir noch nicht. Aber Sie wissen genauso gut wie wir, dass alles dafür spricht, dass Frau Schwarz hier ihrem Namen alle Ehre macht: Hier liegt vieles im Dunkeln, und nur Ihre Marie Schwarz kann es derzeit aufklären. Wenn Sie also Ihre Frau Schwarz lieben, dann helfen Sie mit, dass sie sich stellt.« Faltingers Blick war milde und aufmunternd.
»Ja, sicher!«
»Stimmt das mit der Geldmarie?«, fragte Reitz.
»Sie hat geerbt, das ist richtig.« Knobel erzählte gerafft von dem Mandat, bei dem ihm Marie behilflich gewesen war und im Laufe der Recherchen mit einer Frau Klingbeil Freundschaft geschlossen, zuletzt sogar das Herz der alten Frau gewonnen hatte und so in den Genuss einer erheblichen Erbschaft gekommen war. »Soweit ich weiß, hat sie etwa die Hälfte des Geldes ihren Eltern gegeben, damit sie nicht bis ins hohe Alter auf ihrem Bauernhof wirtschaften müssen. Sie hatte ihr Girokonto gut gefüllt und den überwiegenden Teil angelegt. Ansonsten hat sie aus dem Geld nichts gemacht. Kein Haus, kein teures Auto, nicht mal kostspielige Reisen.«
»Frau Schwarz und Professor Grömitz haben sich sehr geschätzt«, erinnerte Reitz.
Knobel wurde schlagartig bewusst, dass sich bei den Beamten ein Zerrbild von Marie entwickelte. Von Hubert Löffke plump und dennoch wirkungsvoll vorbereitet, wollten die bruchstückhaften Informationen über Marie kein geschlossenes Bild ergeben. Und Knobel speiste das Zerrbild, wollte erklären und aufklären – und weckte stattdessen Zweifel an Marie. Auf der einen Seite die einfache Studentin, die schlichte Wohnung in einem schäbigen Altbau in der Dortmunder Nordstadt, auf der anderen Seite die reiche Erbin, privilegiert durch diesen unerwarteten Geldsegen. Privilegiert auch an der Universität. Professor Grömitz – sicher, Marie redete gern von ihm. Sie schätzte ihn, so, wie Knobel es vorhin gesagt und gemeint hatte. Aber im Kontext der den Beamten zur Verfügung stehenden Informationen, genährt durch Löffkes wie immer anzügliche Anspielungen, war auch Maries Verhältnis zu Professor Grömitz offensichtlich außergewöhnlich. Marie war zum Abendessen bei Professor Grömitz gewesen. Sie war auch früher schon mehrere Male dort zum Essen eingeladen. Sie sprachen dabei über ein Buchprojekt, eine wissenschaftliche Arbeit des Professors, für die Marie die Zutaten lieferte. Knobel wusste das. Sollte er es den Beamten sagen? Das scheinbar Außergewöhnliche gewöhnlich machen? Es würde dabei bleiben: Maries Verhältnis zu Professor Grömitz war enger als zu den anderen Lehrstuhlmitarbeitern, fast freundschaftlich. Unbelastet und voller Respekt könnte er dies anfügen, aber es würde das Zerrbild nicht korrigieren. Eine Studentin, die hin und wieder bei einem Abendessen mit ihrem Professor wissenschaftlichen Austausch betreibt: Wie sollte das in das sich fügende Bild passen? Marie als hübsche junge Frau. Löffkes wiederholter Einwurf konnte seine Wirkung nicht verfehlen. Die einfache und unkomplizierte, die intelligente und intellektuelle, die reiche und schöne, die von Frau Klingbeil und von Professor Grömitz geschätzte, von beiden auf gewisse Art geliebte Studentin, die Germanistik studiert und mit einem Rechtsanwalt zusammen ist, der einige Jahre älter ist als sie. Ein Anwalt, der seinerseits mit den Strukturen der Kanzlei hadert, der er seinen kometenhaften Aufstieg zu verdanken hat. Ein Anwalt, der einige Monate eine Ehe geführt hat, die keine war, der aus dem eleganten Einfamilienhaus aus- und in eine eher schäbige Mietwohnung im Dortmunder Westen eingezogen war. Vorübergehend. Übergang zu was? Der noch nie offen ausgesprochene Neubeginn mit Marie? Knobel sah sich selbst zum Zerrbild werden.
»Das mit der Erbschaft der Frau Klingbeil war ein schöner Zufall«, sagte Knobel schließlich. »Marie und Frau Klingbeil haben sich Gedichte von Goethe vorgelesen.«
›Eine halbe Millionen Euro von Frau Klingbeil geerbt, Frau Klingbeil Gedichte von Goethe vorgelesen‹, notierte Reitz.
»Geldmarie ist nicht ganz unpassend«, lächelte Faltinger. »Es ist ein klarer, fester Begriff.«
»Im Gegensatz zu Marie«, nickte Knobel. »Ich weiß, was Sie meinen – auch im übertragenen Sinn.«
»Sie ist Ihre Gefährtin«, erwiderte Faltinger. Die beiden erhoben sich. »Wir melden uns wieder bei Ihnen.« Dann verabschiedeten sie sich.
Gefährtin. Nicht einmal dieser Begriff war unbefangen. Knobel hatte sich an dem Wort gestoßen, es jedoch nicht kommentiert. Fährte steckte darin. Eine entdeckte und verfolgte Spur. Etwas Geheimnisvolles. Der Gefährte als der Verbündete. Eine Verschworenheit. Der Gefährte als der Komplize? Was meinte Faltinger wirklich? Knobel saß aufgewühlt hinter seinem Schreibtisch. Er zitterte, als er auf seinem Handy Maries Nummer wählte. Das Gerät war ausgeschaltet, wie er es erwartet hatte. Er wechselte in das Menü der SMS-Eingänge. Eine Nachricht von Marie an ihn vom gestrigen Abend, 18.19 Uhr: ›Habe gerade mit Frau K. gesprochen. Sie sagte, du hast noch Termin. Bin zu Grömitz. Aufregende Sache. Wird später. Melde mich morgen. Küsschen, M.‹
Als er aufblickte, stand seine Sekretärin vor ihm.
»Es tut mir so leid, Herr Knobel!« Ihre Blicke hatten eine traurige Tiefe. Mit diesen Blicken hatte sie ihn angesehen, als er sie vor etlichen Monaten in seine Trennung von seiner Frau Lisa einweihte. ›So etwas ist immer ein bisschen wie Sterben‹, sagte sie damals. »Sie müssen Ihre Marie finden«, sagte sie jetzt.
Knobel tippte mit dem Zeigefinger auf sein auf dem Schreibtisch liegendes Handy.
»Sie hat Sie gestern angerufen, stimmt das?«
Frau Klabunde nickte. »Ja, es war schon nach 18.00 Uhr. Sie wollte Sie sprechen, aber Sie waren noch im Gespräch mit dem Mandanten Siewerling. Das habe ich ihr gesagt. Ich wollte Ihr Gespräch nicht stören. Wenn ich gewusst hätte, das der Anruf so wichtig war…«
»Es ist schon gut. Was hat sie gesagt?«
»Nichts weiter. Sie sagte, sie wolle Ihnen dann eine SMS schicken.«
»Das hat sie gemacht«, bestätigte Knobel. »Was hat sie sonst gesagt?«
»Eigentlich nicht viel…«
»Frau Klabunde!«
»Ja, ich meine: Sie sagte nichts Wesentliches. Als ich ihr sagte, dass noch ein Mandant bei Ihnen sei, sagte sie, dass sich dann ja noch mein Feierabend verschiebe, bis der Mandant gehe…Das ist doch lapidar, oder nicht?«
»Ja. – War sie aufgeregt?«
»Aufgeregt?«
»Sie haben doch gehört, was die Beamten vorhin gesagt haben! War sie nervös? Hat sie schnell gesprochen? War sie zunächst ungehalten, als Sie ihr sagten, dass noch ein Mandant da sei? Hat sie irgendetwas gesagt oder angedeutet, was uns weiterbringt?«
»Nein! Wie gesagt: Sie machte nur diese eine lapidare Bemerkung. Alles war normal.«
Frau Klabunde hob ratlos die Schultern.
»Haben Sie eine Ahnung, von wo sie angerufen hat?«
»Von ihrer Wohnung aus.«
»Woher wissen Sie das?«
»Es erschien ihre Nummer im Display: 8036652.«
»Sie kennen Maries Telefonnummer auswendig?«, staunte Knobel.
»Ich habe sie mir gemerkt, als sie einmal hier angerufen hat und eine Information aus einer Akte haben wollte, an der sie arbeitete. Und da ich die Akte erst suchen musste, habe ich ihr gesagt, dass ich sie zurückrufen wolle. Ich notierte mir ihre Telefonnummer, und Frau Schwarz sagte, dass man sie sich ganz leicht einprägen könne: Man müsse sich nur die 80 merken, dann die Anzahl der Tage eines Schaltjahres und schließlich die Anzahl der Wochen eines Jahres. Das sind die Zahlen.«
»Merkwürdig!«
»Das ist nicht merkwürdig! Man muss Zahlen immer mit irgendwelchen Bildern oder Geschichten verbinden. Dann kann man sie sich leichter merken. Wissen Sie zum Beispiel, wann Karl der Große geboren wurde?«
»Frau Klabunde…«
»Nein, sagen Sie es!«
Knobel schüttelte unruhig den Kopf.
»747 nach Christus. Ich stelle mir immer vor, dass der kleine König in einer Boeing 747 geboren wird und schreit. Dann vergisst man diese Zahl nie wieder.«
»So ein Quatsch!«
»Das ist kein Unsinn. Das hat ein Gedächtnisprofi so erklärt. Es stand vor einiger Zeit auch in der ›Bunten‹. Nur so kann man sich das merken. Und Ihre Frau Schwarz merkt sich Zahlen ebenso. Sie gibt den Zahlen eine Bedeutung. Denken Sie an ihr Autokennzeichen.«
»Haben Sie eine Ahnung, wo Marie sein könnte?«
Frau Klabunde, die eben noch eigentümlich redselig war, deren Gesicht fast heitere Züge bekommen hatte, wurde unvermittelt ernst. »Nein, es tut mir leid.« Sie schwieg einen Moment. »Wenn ich nur ein bisschen mehr über die Marie Schwarz wüsste! Vielleicht kämen mir dann Gedanken. Aber ich kenne Ihre Marie kaum. Manchmal, wenn ich sie sehe, meine ich, sie wirkt ein bisschen wie ein Blumenmädchen auf dem Markt.«
»Ein Blumenmädchen?«
»Ja, wirklich. Ich erinnere mich an einen Besuch von Frau Schwarz vor etwa einem Monat hier im Büro. Es war ein außergewöhnlich heißer Septembertag. Sie trugeinhübsches Sommerkleid und in ihrem schwarzen Haar eine Spange, die einfach…« – Frau Klabunde suchte nach Worten – »…die einfach süß aussah, ich kann es nicht anders beschreiben. So stellt man sich Blumenmädchen vor, oder? Ich weiß ja, dass Ihre Marie nicht wirklich mehr ein Mädchen ist, und ich weiß, dass Sie das kitschig finden, was ich jetzt sage.«
»Sie machen sich ein Bild von ihr, wie offensichtlich jeder. Geldmarie, Professorenmarie, Blumenmarie.«
»Wie ist sie denn nun wirklich?«, fragte Frau Klabunde.
Knobel erhob sich. »Ich muss sie suchen, und ich weiß ehrlich im Moment selbst nicht, was und wen ich finde. Aber ich weiß, dass Marie niemals Professor Grömitz etwas antun würde. Und auch keinem anderen Menschen.« Er nahm einige Akten von seinem Schreibtisch und gab sie Frau Klabunde. »Sagen Sie in diesen Vorgängen alle Termine für morgen ab! Und kein Wort zu Löffke oder sonst wem hier! Notfalls sagen Sie, ich sei krank.«
»Man wird über Sie reden, Herr Knobel.«
»Man redet schon. Radio Löffke berichtet unablässig, kommentiert und intrigiert. Der Radiochef schiebt seinen massigen Körper durch alle Büros. Sein schwitzendes Gesicht wittert Stimmungen, seine klebrige Zunge leckt Informationen und Informatiönchen auf, verdaut und streut Gerüchte, belohnt und bestraft die Abhängigen, dient sich dem Senior an und stellt seine Fallen auf. Es ist also alles wie immer! Das gewöhnliche Schlechte.«
»Sie bleiben hoffentlich an Bord?« Frau Klabundes Frage offenbarte ein blitzartig vor ihrem geistigen Auge ablaufendes Szenario, ihren Anwalt, ihren Chef zu verlieren und sich in der Kanzlei mit ihren insgesamt neun Anwälten und einer Vielzahl von Büroangestellten neu orientieren zu müssen. Die Kanzlei, die Knobel im vertraulichen Gespräch mit Frau Klabunde gern als Haifischbecken bezeichnete, bot eine schützende Insel: Zimmer 102, also Knobels Büro, und das dazugehörige von Frau Klabunde besetzte Sekretariat. Knobels Worte sollten nicht die von Frau Klabunde gestellte Frage aufwerfen. Aber Knobel mochte auf diese Frage auch keine Antwort geben. Stattdessen beantwortete er ihre vorherige Frage: »Marie ist für mich ein Glück.«
Frau Klabunde überlegte. »Ein großes Wort«, sagte sie. Glücksmarie.
2. Kapitel
Knobel fuhr zu Maries Wohnung in der Brunnenstraße. Er hatte einen Schlüssel zu ihrer Wohnung, so, wie sie einen für seine Wohnung besaß. Einen Schlüssel auszuhändigen, hat stets auch etwas Symbolisches. Diesen Sommer, als Stephan und Marie vereinbarten, sich wechselseitig Schlüssel zu ihren Wohnungen zu geben, saßen sie auf einer Decke am Dortmund-Ems-Kanal nahe der Kanalbrücke Deusen. Es war ein sonnendurchfluteter Samstagnachmittag, an dem alles stimmte. Hunderte Familien und Grüppchen, die es ihnen am Kanal gleichtaten, im Kanal schwammen, dann wieder in der Sonne dösten. Eine stete Geräuschkulisse durch die spielenden Kinder, ein Getöse, das nicht störte, nicht am Schlafen hinderte und nicht am Lernen. Marie las in irgendwelchen Fachbüchern, Knobel träumte vor sich hin, später holte er für beide Bier von einem kleinen Verkaufsstand. Eine Leichtigkeit, in die Marie irgendwann sagte, dass es an der Zeit sei, einander Schlüssel zu geben. »Damit jeder schon mal reinkann, wenn der andere noch nicht da ist«, fügte sie an, und diese Worte spiegelten in gewisser Weise die äußere Leichtigkeit dieses Tages wider und wirkten wie eine nur allzu selbstverständliche Erklärung, die dem Schlüsselgeben einen unbefangenen und praktischen Sinn gaben. Tatsächlich gingen die Worte tiefer und waren von einer feierlichen Ernsthaftigkeit getragen. Marie und Stephan saßen auf der Wolldecke am Kanal und gingen einen großen Schritt weiter. Ihre Beziehung zueinander hatte sich langsam entwickelt und war zunächst auf ritualhafte wöchentliche Treffen bei ihr beschränkt gewesen. – Den Schlüssel zu geben, bedeutete Einladung zum Eintreten, aber nicht zum Eindringen. Eintreten und auf den anderen warten. Der gewaltige Schritt nach vorn, der zugleich signalisierte, dass die Wohnungen und damit ihre Leben sich noch nicht miteinander verbanden. Marie war kein Mensch, der etwas gewährte und dann einfach wieder entzog.
Knobel hatte auf der Fahrt zu ihrer Wohnung mehrmals versucht, sie über Handy zu erreichen. Nach wie vor war ihr Gerät abgeschaltet.
Er stieg die Treppen zu ihrer Wohnung hoch. Es klebte kein Polizeisiegel an ihrer Tür. Vermutlich hatte der Hausmeister noch einen Schlüssel, mit dem Faltinger und Reitz in die Wohnung gekommen waren. Knobel sperrte auf, und als er die Tür hinter sich geschlossen, das Licht eingeschaltet und einen Schritt nach vorn in ihre Diele gemacht hatte, kam er sich als Eindringling vor. Der Gedanke, hier etwas zu suchen und nicht zu wissen, was er suchte, kam ihm wie Verrat vor. ›Du hast hier nichts zu suchen‹, dachte er. ›Du suchst Marie‹, machte er sich klar, und er merkte, dass sein Unbehagen eine andere Ursache hatte. War es wirklich ausgeschlossen, dass Marie, aus welchen Gründen auch immer, fliehen wollte? Wollte sie wirklich, dass er Spuren findet? Sollte er hier nicht einfach nur auf sie warten, weil sie noch nicht da war? So, wie das Schlüsselgeben gemeint war?
Ihm fiel unwillkürlich ein, wie er vor vielen Jahren mit seinen Eltern die Wohnung des kurz zuvor verstorbenen Onkels betreten hatte. Das Eindringen zur Entsorgung. Sein Vater, der den Inhalt der Schränke in blaue Müllsäcke entleerte. Schlüssel zum Räumen. Er erinnerte sich an abgestandene Luft und muffige Kleidungsstücke. Alle Sachen vom Onkel kamen auf den Müll. ›Oder zur Caritas‹, sagte seine Mutter dazwischen. Damals hatte er ohne Zaudern mitgeholfen. Das Helfen brachte Taschengeld. Er räumte schnell und ohne Nachdenken.
Dann stand er in Maries Küche. Knobel blickte in den Abfalleimer. Er fand zwei leere Joghurtbecher und Apfelschalen. Die Leerung der Mülltonnen draußen erfolgte stets montags, also gestern. Marie brachte ihren Müll stets am Tag der Leerung nach unten, weil sich zu viele Mietparteien eine Tonne teilen mussten. Die Tonne quoll meistens schon am nächsten Tag über. Wenn Marie gestern Abend bei Grömitz war, konnte vom Abendessen kein Müll da sein. Zum Frühstück holte sie sich regelmäßig Brötchen bei der Bäckerei Dahlmann an der Mallinckrodtstraße. In ihrem Abfalleimer befand sich keine Brötchentüte. Also war sie seit gestern nicht mehr da gewesen. Er fand auch keine Filtertüte mit Kaffeesatz. Auf der Spüle befand sich kein benutztes Besteck. Es war alles sauber. – So, wie sie gewöhnlich ihre Wohnung hinterließ. – War Marie also mit ihrem kleinen Toyota auf der Flucht? Dazu betrunken? Dass sie keinen Wodka trank, stimmte im Grundsatz. Doch auf einer Überfahrt mit der Fähre nach England hatte sie wegen des starken Seegangs Wodka getrunken. Und auf einer Party bei Kommilitonen, zu der sie Stephan begleitet hatte, hatte sie ebenfalls Wodka getrunken. Aber sie hatte wie Knobel zu Hause keinen Wodka vorrätig. – Rotwein? Ja, sie hatte auf der letzten Weihnachtsfeier der Kanzlei Rotwein getrunken. Und auch mehr als die zwei Gläser, die Knobel gegenüber den Beamten als Höchstmenge angegeben hatte. Marie war damals angetrunken gewesen, und es mochten fünf oder sechs Gläser Merlot gewesen sein. ›Anders hätte ich die verehrten Anwältinnen und Anwälte nicht ausgehalten‹, hatte sie ihm am nächsten Tag gesagt. – Wie viele Gläser Rotwein mochten in den zwei Flaschen gewesen sein, die bei Grömitz getrunken worden sein sollen? Wie auch immer: Sollte Marie getrunken haben, wäre sie nicht mehr Auto gefahren. Das tat sie tatsächlich nie. Aber wenn in diesem Fall doch? Er öffnete in der Küche einen der Wandschränke. Da lagen noch die drei Riojaflaschen, die Knobel ihr letztens mitgebracht hatte. Faltinger und Reitz würden mit Sicherheit in diesen Schrank geblickt haben. ›Höchstens zwei Gläser Wein und niemals Wodka…‹ Sie werden es ihm nicht geglaubt haben.
Er sah in ihr Schlafzimmer. Hier war er noch nie allein gewesen. Hier war er nur mit ihr, und selbst dann, wenn sie zwischenzeitlich in die Küche oder zur Toilette ging oder sie einmal vor ihm das Haus verließ und er noch zwei Stunden in ihrem Bett weiterschlief, war sie anwesend. Er roch sie, roch sie aus der Bettwäsche, ihr Parfüm, ihre zarte Haut, auch ihren Schweiß. Sie roch gut. Duftmarie.
Die Kleiderschränke standen offen. Wenn nicht die Polizisten die Schränke durchwühlt und Gegenstände auf den Boden geworfen haben sollten, war ihre Schlussfolgerung richtig: Hier war offensichtlich hektisch ausgeräumt worden! – Marie bevorzugte die Farbe Schwarz. ›Schwarz liebt Schwarz‹, sagte sie einmal. Schwarze Unterwäsche, schwarze T-Shirts, auch schwarze Pullover. Alles war mehrfach und reichlich vorhanden, auch jetzt noch. Aber trotzdem wirkte der Schrank leerer. Es fehlten Kleidungsstücke, wohl auch ein oder zwei Jeanshosen, ohne dass er genauere Angaben hätte machen können. Faltinger und Reitz werden sich die Sachen angesehen haben. Hatten sie ihre Unterwäsche in die Hand genommen?
Das Arbeitszimmer. Ein Sammelsurium an Büchern, teilweise antiquarisch erworben, dazu reichlich Schreibmaterial. Stifte und päckchenweise Papier. Ja, es war Kopierpapier aus der Kanzlei, das Knobel hin und wieder aus der Kanzlei mitbrachte. Löffke hätte seine Freude an dieser Entdeckung: Löffke, der Inquisitor der Kanzlei ›Hübenthal & Knobel‹. Drucker und Bildschirm. Knobel erinnerte sich, wie ihm Marie auf dem Bildschirm Bilder von Mallorca aus dem Internet gezeigt hatte. Auf dem Schreibtisch lagen Notizen für ihre Abschlussarbeit an der Universität. Es waren Gliederungsentwürfe und einzelne Stichworte. Betreuer der Arbeit hätte Professor Grömitz sein sollen. Die Notizen waren mehr geworden seit Knobels letztem Besuch in ihrer Wohnung. Auch die Hinweise auf Fundstellen erschienen zahlreicher. Er hatte, als er vorgestern das letzte Mal hier war, nicht genau darauf geachtet, was auf ihrem Schreibtisch lag. Aber er war sich sicher, dass hier mehr lag. Sie hatte also gearbeitet, ihre Abschlussarbeit vorangetrieben. Nichtsdeutete darauf hin, was ihre Aufregung erklärt hätte, von der Faltinger sprach. Alles war – bis auf die teilweise ausgeräumten Kleiderschränke – normal. Es war unwahrscheinlich, dass sie mit Professor Grömitz wirklich über ihre Arbeit reden wollte. Für diesen Fall hätte sie zumindest einige der Unterlagen mitgenommen, die Knobel auf dem Schreibtisch fand. Die Gliederungsentwürfe beispielsweise. – Gab es Anzeichen, dass sie mit ihrer Arbeit nicht weiterkam? Brauchte sie Hilfestellung des Professors bei der einen oder anderen Frage? Es gab keine Hinweise, und Marie hatte ihm gegenüber, was sie sonst wohl getan hätte, nichts verlautbaren lassen. Warum also das Abendessen bei dem Professor? Warum die Aufregung?