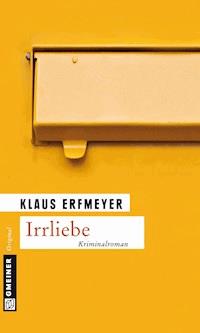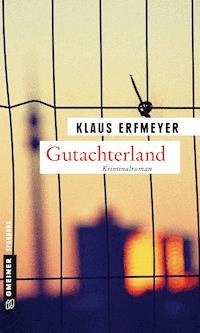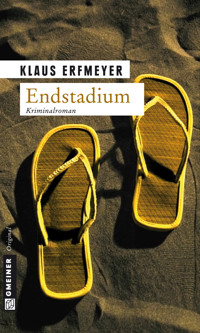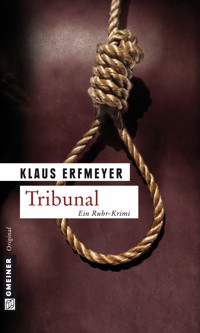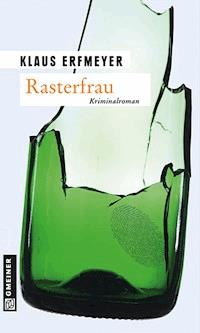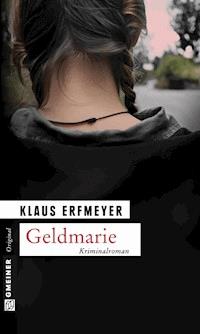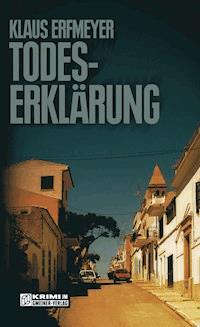Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Rechtsanwalt Stephan Knobel
- Sprache: Deutsch
Junganwalt Stefan Knobel erhält kurz nach seinem Eintritt in eine renommierte Dortmunder Anwaltskanzlei die Chance, den wichtigsten Mandanten der Kanzlei, den Industriellen Tassilo Rosenboom, zu vertreten. Rosenboom, von den Fähigkeiten Knobels überzeugt, überträgt ihm bald die Vertretung in Prozessen, deren Sinn sich der Anwalt nicht erschließen kann. Doch Knobel kommt seinem Mandanten auf die Spur. Unversehens wird er in einen Mord verwickelt und plötzlich erkennt er, dass er selbst von dem Verbrechen profitieren könnte ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Erfmeyer
Karrieresprung
Kriminalroman
Zum Buch
ANWALTSPFLICHT Fast Junganwalt Stefan Knobel erhält kurz nach seinem Eintritt in eine renommierte Dortmunder Anwaltskanzlei die Chance, den wichtigsten Mandanten der Kanzlei, den Industriellen Tassilo Rosenboom, zu vertreten. Rosenboom, von den Fähigkeiten Knobels überzeugt, überträgt ihm bald die Vertretung in Prozessen, deren Sinn sich der Anwalt nicht erschließen kann. Wieso wird Rosenboom immer wieder vom selben Mann angeklagt? Unsicher, ob seine Loyalität zu Rosenboom nicht ein Nachforschen verbietet, beginnt er dennoch gemeinsam mit der Studentin Marie das Geheimnis seines Mandanten zu erforschen. Dabei kommt er Marie näher, obwohl er seit kurzer Zeit mit seiner Studienfreundin Lisa verheiratet ist. Zudem wird er unversehens in einen Mord verwickelt und plötzlich erkennt er, dass er selbst von dem Verbrechen profitieren könnte …
Klaus Erfmeyer, geboren 1964, lebt in Dortmund und ist seit 1993 Rechtsanwalt, darüber hinaus Maler und Dozent. Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen. „Karrieresprung“ ist sein erster Roman.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2006 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Photocase.de
ISBN 978-3-8392-3234-7
1
Stephan Knobel lehnte sich im Besucherstuhl vor Löffkes Schreibtisch zurück. Angespannt schlug er die Beine übereinander und hielt die Hände gefaltet, gab sich aufmerksam und zugleich gelassen. Mal bejahte er mit Gesten und Worten, mal fragte er interessiert und höflich nach und bezog bei Gelegenheit Position. Er servierte konventionell kompatible Ansichten, zeigte sich dankbar und blieb unkompliziert.
Löffke rief Knobels wichtigste Stationen ab und Knobel rekapitulierte folgsam Schulzeit, Abitur, Jurastudium und seine Hochzeit mit Lisa vor knapp einem Jahr. Er gliederte sein unauffälliges Leben, nahm dankend die angebotene Zigarette und bemerkte mit schüchternem Lächeln, dass er eigentlich gar nicht mehr rauche. Doch die Zigarette entkrampfte und bewies zugleich Spuren eines Lasters. Knobel dachte, dass es gut sei, sich in kleinen Dingen nicht zu prinzipientreu zu zeigen.
Scheu widerstand er Löffkes musterndem Blick, blickte in dessen rotes, schon am Morgen verschwitztes Gesicht und betrachtete fast andächtig dessen fleischige, an einer Zigarette saugende Lippen.
»Wenn Sie sich bewähren, werden wir Sie in ein paar Jahren zum Sozius machen«, schloss Löffke. »Dann gehören Sie richtig dazu. – Bis dahin sind Sie Angestellter.«
Knobel dankte für die gebotene Chance und versicherte schnell, die Sozietät anzustreben, aber das vorgegebene Ziel blieb ebenso konturenlos wie der Weg, der zu diesem Ziel führen sollte. Sein Gelöbnis, das Beste zu geben, suchte einen Bezugspunkt und fand ihn nicht.
Löffke nickte befriedigt, drückte seine Zigarette aus und begleitete ihn hinaus.
»Unsere Kanzlei hat drei Etagen«, erklärte Löffke auf dem Flur. »Hier im Erdgeschoss sitzen der Senior und die drei anderen Sozien.«
Kurz vor Weihnachten hatte ihn der Kanzleisenior Dr. Hübenthal in seinem ostwärts zur Gartenseite liegenden Arbeitszimmer empfangen. Der Senior hatte Knobel an die Verandatür geführt und davon geschwärmt, wie das Sonnenlicht im Sommer in das Zimmer flutete, sich auf dem Parkett spiegelte und den Raum bis an die Stuckdecken ausleuchtete.
Dr. Hübenthals Büro trug die Nummer 101. Es war das frühere Gesellschaftszimmer der nun als Anwaltskanzlei genutzten Villa. Das stattliche Jugendstilgebäude an der Prinz-Friedrich-Karl-Straße im Osten der Dortmunder Innenstadt galt als gute Adresse für die gehobene Klientel. Knobel hatte das Gebäude mit Ehrfurcht betreten und Dr. Hübenthals Büro bewundert, den massiven Schreibtisch bestaunt, die darauf aufgetürmten aufgeschlagenen Bücher betrachtet, auch den dunklen Regalwänden seinen Respekt gezollt, in die sich juristische Periodika und gebundene Einzelwerke zwängten. Alles in diesem Raum diente mächtig, stumm und bleiern Dr. Hübenthal, dessen kleine hagere Statur hierzu im eigentümlichen Gegensatz stand. Eloquent und im Auftreten verbindlich, verstand er es, seine Gesprächspartner unter der ständigen Observation seiner wachen Augen zu fesseln, dabei strahlte sein gefurchtes Gesicht eine faszinierende patriarchalische Strenge aus.
Dr. Hübenthal hatte flüchtig durch seine Bewerbungsunterlagen geblättert, sich zufrieden gezeigt, sodann Knobels Gehaltswunsch mit mildem Nachdruck nach unten korrigiert und nach der erlösenden Zusage, dass man es miteinander versuchen solle, die Erörterung aller weiteren Details Löffke übertragen.
Dieser machte ihn anschließend in der Kanzlei bekannt. Sie besuchten jedes Anwaltsbüro, jedes Sekretariat, und Knobel schüttelte Hände und spulte sein unverbindliches Begrüßungslächeln ab. Es war ein wechselndes Willkommenheißen und Danken, erst in den 100er-Zimmern im Erdgeschoss, dann in den 200er-Räumen im ersten Stock und schließlich, als sie über eine mit Linoleum belegte schmale Holztreppe in das Obergeschoss gelangt waren, auch in den 300er-Zimmern. Im Gegensatz zu den unteren Geschossen gab es hier nur bescheiden eingerichtete kleine Büros und den mit Regalen und Schränken gefüllten Archivraum. Die Luft dort war stickig, roch nach altem Papier und der Elektronik des leise brummenden Fotokopierers.
Andächtigt maß Knobel die alten Holzschränke, die zentnerschwer die aktenmäßige Seele der Kanzlei bargen und mit jedem neu eingefächerten Vorgang deren Reichtum mehrten. Ihm schien, dass das Archiv und das Büro 101 die eigentlichen Pole dieses Hauses waren, die ein geheimnisvolles System kommunizierender Röhren miteinander verband. Er verweilte bei dem Gedanken, all die Anwälte, Sekretärinnen und Bürogehilfinnen zu physikalischen Gefäßen stilisiert zu sehen. Alle begleiteten in verzahnter Arbeitsteilung das Leben einer Akte von ihrer Anlage bis zu ihrer Vernichtung und sorgten somit für einen gleich hohen Akten-Pegelstand. Nur die Höhe des Pegelstandes schien auf geheimnisvolle Weise all die Jahre ständig geklettert zu sein. Und er wusste, dass die unzähligen Akten nur schwach die Mühsal und die zahllosen langen Abende im kalten weißen Neonlicht erahnen ließen.
Der wolkige Qualm aus Löffkes frisch angezündeter Zigarette riss ihn aus seinen Gedanken.
»Das hier sind alles Rosenboomakten«, dozierte Löffke und trat dabei leicht gegen einen Schrank in der rechten Ecke. »Der Name Tassilo Rosenboom sagt Ihnen hoffentlich etwas?«
Löffkes Rauchwolke traf ihn mitten ins Gesicht.
Knobel nickte. Um die Rosenboom-Mandate war es bereits im Vorgespräch mit Dr. Hübenthal gegangen. Ganz im Gegensatz zu seiner geschäftigen, sich auf das Wesentliche beschränkenden Eile hatte der Senior farbig und detailfreudig die Entstehung dieses Mandatsverhältnisses geschildert, das in einer Schulkameradschaft zwischen ihm und Tassilo Rosenboom wurzelte. Mit bewundernden Worten hatte Dr. Hübenthal die Entwicklung der Firma Rosenboom zum bedeutenden Elektrogeräteunternehmen illustriert, der noch immer ihr Gründer vorstand. Von Beginn an war die Firma Rosenboom Garant zahlreicher umsatzträchtiger Mandate und darüber hinaus vermittelnder Auslöser für ebenso attraktive geldträchtige Folgemandate.
Die Rosenboom-Mandate blieben den 100er-Zimmern vorbehalten. Der Name Rosenboom forderte bevorzugte Bearbeitung und bedeutete deshalb Chefsache.
Löffke wies ihn in 307 ein. Ein kleines helles Zimmer, weiße Raufaser an den Wänden, Dachschräge mit zwei schmalen Kippfenstern und Blick auf mächtige Buchenkronen, die dem weiträumigen Garten im Sommer einen willkommenen Schatten spendeten.
In den Regalen standen die wichtigsten juristischen Kommentare in älteren Auflagen. Knobel ahnte den Lebenslauf dieser Bücher, ihren druckfrischen Beginn in den 100er Büros, um nach Erscheinen der Folgeauflage in die nachrangigen Büros zu wechseln und schließlich, abgegriffen und vergilbt, in den Mansardenzimmern unterm Dach zu enden. Im Gegensatz zu den Karrieren der erfolgreichen Anwälte strebte das veraltete Schriftgut aus dem privilegierten Erdgeschoss nach oben.
»Ich denke, Sie finden sich zurecht.«
Löffke öffnete eine Tür im Wandschrank.
»Hier unten gibt’s sogar einen Kühlschrank.«
Er lachte heiser auf.
»Natürlich von Rosenboom. – Ansonsten fragen Sie mich. Sie finden mich auf 104«, sagte Löffke und verließ das Zimmer.
Knobel musterte das ihm zugeteilte Büro, betrachtete den unter dem Schreibtisch aufgeriebenen steingrauen Teppichboden und nahm hinter dem schlichten furnierten Schreibtisch Platz. Der alte Kunstledersessel mit seinen speckig glänzenden Armlehnen quietschte, als er sich in ihm bewegte. Eine Neon-Deckenlampe flackerte knisternd.
Büro 307 hatte nichts von der Atmosphäre der Räume im Erdgeschoss, erst recht nichts von Dr. Hübenthals Büro 101. Es fehlten sämtliche Attribute, die einen Besucher beeindruckt hätten. 307 gestattete keine wichtigen Gespräche vor der Kulisse langjährig zusammengetragener Periodika, die mit ihren dunklen ledernen Buchrücken und eingeprägten fortlaufenden Jahreszahlen das beständige Studium juristischer Zeitschriften suggerierten. Und es gab keine Sitzgruppe, in die er sich mit seinem Mandanten zur wichtigen Konferenz hätte zurückziehen können.
Die Luft in 307 schmeckte nach Essig und Zitrone. Es war ein bis in die Winkel reinliches kaltes Zimmer.
Knobel sah durch die von getrockneten Regenschlieren übersäten Fenster in den tristen Januarhimmel.
2
Knobel hatte sich für den Anwaltsberuf entschieden, nachdem er Lisa kennen gelernt hatte. Lisas Vater führte in der Dortmunder Innenstadt am Alten Markt eine namhafte Kanzlei und bereitete seine Tochter zielstrebig auf den späteren Eintritt in sein Büro vor. Obwohl sie noch am Beginn ihres Studiums stand, durfte sie bereits die Einrichtung für ihr zukünftiges Büro auswählen.
Lisa war eine Hörsaalbekanntschaft. Stephan Knobel hatte sie ausgewählt, als er das behütete dörfliche Zuhause im münsterländischen Telgte mit einer Wohnzelle in einem Bochumer Studentenwohnheim getauscht hatte und sich mit dem Beginn der ersten Vorlesungen in ein Meer unbekannter Gesichter geworfen fühlte. Der Beginn des Studiums war ein Abschied von bemäkelter und bequem genossener elterlicher Umsorgung und zugleich der mutige und ängstliche Schritt in eine ungewohnte räumliche Beschränkung, die ihm trotz der Enge wie ein Hineinfallen in schlagartig überwältigende Leere erschien. Der Umzug ging einher mit der fröstelnden Erkundung von Sammelwäschereien und schmierigen Wohnheimküchen mit angelaufenen fettigen Edelstahltöpfen und bunt zusammengewürfeltem alten Geschirr. Der Verlorenheit in den anonymen Hörsälen folgte die Einsamkeit in seiner Zelle, und Knobels Gedanken kreisten schnell um die Idee, das fade Studium wieder aufzugeben und in seine vertraute dörfliche Heimat zurückzukehren.
Zuerst waren ihm Lisas Wangengrübchen aufgefallen, die sich besonders ausbildeten, wenn sie lachte. Lisa lachte viel. In dem Kreis von Kommilitonen, der sich um sie scharte, war sie häufig Mittelpunkt. Lisa dirigierte, sie fragte nicht viel. Das fiel ihm schnell an ihr auf.
Knobel hatte sich ihr über Wochen hinweg genähert, sich im Hörsaal zu ihr vorgearbeitet, wie zufällig seinen Platz immer näher dem ihren genommen, den Hörsaal nach ihr betreten, wenn sie, ohne ihn zu bemerken, die Mauernische vor dem Hörsaaleingang passiert hatte, in der er verborgen wartete. Aber er setzte sich im Hörsaal nie direkt neben sie.
Mal saß er ein oder zwei Reihen vor oder hinter ihr, manchmal auch drei, vier Plätze neben ihr, verfolgte aufmerksam ihre leisen Gespräche mit ihren Nachbarn, schnappte begierig auf, woraus sich manche privaten Informationen über sie erschloss und begann sie so bereits zu einem Zeitpunkt kennen zu lernen, als sie ihn noch gar nicht bewusst beachtet hatte.
Er trat erst in ihr Leben, als er sie zufällig in einem Kaufhaus im Bochumer Uni-Center getroffen hatte. Als sie ihn grüßte, gelang es ihm schüchtern, sie in ein Gespräch zu verwickeln und auf dem Höhepunkt schließlich, sie endlich auf eine Tasse Tee in ein Café einzuladen.
Sie unterhielten sich über die gerade im Studium zu absolvierenden Prüfungen, alberten gemeinsam über schrullige Kommilitonen und schweiften in private Belanglosigkeiten ab. Knobel nutzte sein heimlich über Lisa gesammeltes Wissen, ließ wie an einer Perlenkette aufgereiht Stichworte einfließen, die er auf sich bezog, und die sie natürlich gerne aufnahm und schließlich ihre Interessen und Meinungen in den seinen gespiegelt sah. Fortan saß er im Hörsaal häufig neben ihr. Außerhalb der Vorlesungen übten sie gemeinsam mit Kommilitonen Zivil- und Strafrecht, wechselnd mal bei dem einen und mal bei dem anderen. Man hielt die Lernstunden in den elterlichen Wohnungen ab, die in biederen Wohnzimmern mit Kaffee und Gebäck ihren Anfang nahmen und sich in zu klein gewordenen Jugendzimmern fortsetzten. Dort saß man mit dem Gesetzbuch auf den Knien an kleinen Schreibtischen oder auf Teppichböden und diskutierte.
Bei Lisa war es anders. Die Zusammenkünfte bei ihr führten in eine noch ferne erwachsene Welt. Lisa war einziges Kind ihrer Eltern und bewohnte im ausgebauten Dach des väterlichen Hauses in der Dahmsfeldstraße im Dortmunder Süden eine vollständig eingerichtete eigene Wohnung. Gelernt wurde stets in ihrem weiten hellen Wohnzimmer. Man saß bequem in ihren weißen weichen Sofas und philosophierte über Sinn und Unsinn der Vorlesungen und Seminare.
In Lisas Wohnung waren alle erwachsen und ihrer Zeit voraus. Ihre Wohnung war zu groß für eine mit dem Bestehen des Abiturs hinter sich geglaubte und nun mit Macht umso heftiger zurückkehrende Zeit zermürbender Büffelei.
Sie kamen sich näher, als ihm Lisas Wangengrübchen nicht mehr auffielen. Das bevorstehende Examen hatte alle ernster und strebsamer gemacht und im Verein mit der überwältigenden Stofffülle eine nervöse Hektik ausgelöst, die der beständig knapper werdenden Freizeit jede Leichtigkeit nahm und die Beschäftigung mit privaten Dingen den Nachgeschmack des schlechten Gewissens bescherte.
Das Pauken mündete in einen Kampf gegen das Vergessen des bereits Erlernten und erschöpfte sich schließlich darin, gebetsmühlenartig Skripten zu wiederholen und Merksätze einzupeitschen, deren wirkliche Bedeutung sich trotz der steten Wiederholung nicht übergreifend erschließen wollte.
Jede Aufgabe wucherte bei näherer Betrachtung zu einem unbeherrschbaren Fundus rechtlicher Probleme und führte zu der bestürzenden Erkenntnis, dass das bereits Gelernte bei weitem nicht auszureichen vermochte, um das Bestehen des Examens auch nur als einigermaßen wahrscheinlich erscheinen zu lassen. Man fühlte sich in die Schulzeit zurückgeworfen und wollte Schüler sein. Lisas erwachsene Welt war dafür zu groß.
In dieser ernst und bleiern gewordenen Zeit löste sich der Kreis um Lisa.
Knobel blieb mit Lisa zurück, die sich mit stoischer Ruhe einige Stunden am Tag dem Lernen und ansonsten ihrer Freizeit hingab. Er folgte ihr, fand Gefallen und Geborgenheit in diesem Rhythmus, der gegen das hektische Treiben der anderen immun zu sein schien und wohlig an seine häusliche Ruhe im elterlichen Haus erinnerte, in der er behütet und manchmal noch kindlich träumend seine Schulzeit verbracht hatte.
Lisa bestimmte, wann gelernt wurde. Er entdeckte in der jungen Frau vorgelebte Lebenstauglichkeit, die er begierig in sich aufsog und zu seiner eigenen zu machen beschloss.
Fortan mied Knobel den Kontakt zu den anderen Kommilitonen, und Lisa schwor ihn trotzig auf ihren Weg ein.
Als sie begannen, ihre freie Zeit gemeinsam miteinander zu verbringen, entwickelte sich eine Vertrautheit zwischen ihnen, die sich mehr, als sie es selbst wahrhaben wollten, gerade aus jener Gemeinsamkeit speiste, aus der heraus sie Lisas Weg verteidigten. Sie verstanden sich gut. Es streichelte ihn, wenn sie ihn bekräftigte, und er litt, wenn sie ihm widersprach. Wenn sie laut und wütend wurde, relativierte und modifizierte er und suchte nach Verbindendem. Knobel war seit jeher ein leiser Mensch.
An einem Samstag Anfang Mai fuhren sie mit dem Fahrrad hinaus. Ihr Weg führte sie zunächst durch Dortmunds Süden. Sie passierten Kirchhörde und Lücklemberg, kämpften sich die lang gezogene Steigung des Theodor-Freywald-Weges bergan, ließen den Landgasthof Dieckmann linkerhand liegen, durchquerten Syburg und erreichten schließlich auf steil abfallender Straße das Ruhrtal. Er genoss das Fahren auf ihm unbekannten Wegen und die Kühle des umschmeichelnden Fahrtwindes, atmete den Duft des leuchtend gelben Rapses. Lisa fuhr unermüdlich weiter, und er folgte ihr still und zufrieden.
Sie mochten eineinhalb Stunden gefahren sein, als Lisa unvermittelt am Feldrand anhielt und das Fahrrad in den Grassaum fallen ließ. Er dachte, dass sie des Fahrens überdrüssig sei und überlegte, ob er ihr die Rückfahrt vorschlagen solle. Erschöpft setzte er sich neben sie. Sie schwitzten unter der Mittagssonne. Lisas Haar war nass, und Gewittertierchen krochen über ihre feuchte Stirn. Er lehnte sich an sie, roch erregt ihren Schweiß und genoss ihren heftig atmenden Körper, der ihn warm massierte. Langsam strich er mit seiner klebrigen Hand über ihre Stirn und tupfte mit zitterndem Zeigefinger eines der kleinen Insekten auf, das auf ihr linkes Augenlid krabbelte. Er betrachtete sie eine Weile, strich zart ihre Wangen und war ungläubig stolz, dass sie ihn gewähren ließ. Unsicher glitt seine Hand über ihr feuchtes Shirt, ertastete schließlich ihren Bauch und massierte ihn kreisend, bis er ihre weichen Brüste berührte, sie schließlich ganz in seiner Hand fühlte und zärtlich kneten durfte, während er sie scheu auf den Mund küsste. Lisa atmete heftiger und ließ sich in das trockene Gras fallen. Sie blickten sich still und neugierig an, als seine Hand sanft ihren Körper erkundete, und er begann, ihre warme Haut wieder und wieder mit seinen Lippen zu liebkosen.
Lisa war keine Schulfreundin, der er heimlich bei allen Klassenarbeiten geholfen, bereitwillig die Hausaufgaben gemacht und sich auf diese Weise als stets verlässlicher und immer zuhörender Freund empfohlen hatte, ohne dass es ihm gelang, damit zum Mann und als solcher interessant zu werden. Lisa war erwachsen, seine erste Frau, und er nahm an, dass sie seine große Liebe sei.
Seither waren sie ein Paar. Bis heute schmeckte er in der Erinnerung ihren Schweiß, ihre feuchte Haut, ihre Erregung, die zitternde Spannung, am Wegesrand entdeckt zu werden, und einen männlichen Stolz der Eroberung.
Immer wieder suchten sie sich in Gedanken in diese stillen und so gewaltigen Minuten zurück, die sich in der Phantasie zu einem Rausch auswuchsen und in ihrer geheimnisvollen Heftigkeit doch nicht wiederkehren wollten.
Von nun an war er noch häufiger bei ihr. Ihr Vater nahm ihn freundlich und doch distanziert auf. Er hatte den Eindruck, dass er seine mangelnde Zielstrebigkeit im Studium missbilligte. Der Weg ihres Vaters war geradlinig und ohne Irritationen gewesen. Vielleicht mied Knobel deswegen den Kontakt zu ihm.
Knobel fiel auf, dass ihr Vater nie Lisas Mutter erwähnte. Auch Lisa tat es nicht. Als er sich einmal nach ihrer Mutter erkundigte, blieb Lisas Antwort knapp. Er erfuhr lediglich, dass ihre Mutter nach der Trennung der Eltern aus der Familie ausgeschieden war. Knobel verstand nicht recht und unterließ weitere Nachfragen.
Kurz darauf verließ Knobel das verhasste kleine Studentenzimmer im Bochumer Uni-Center und zog bei Lisa ein.
Gelegentlich hielt ihr Vater leuchtende Monologe über die Vorzüge des Anwaltsberufs.
Lisa nahm seine trostreichen und optimistischen Visionen dankbar und aufmerksam auf. Es schien, als seien diese wesentlicher und gehaltvoller als alles, was sie tagsüber erarbeitet und eingepaukt hatte. Knobel saß dann meist still neben ihr und umarmte sie, als wollte er sie an seine Existenz erinnern, während sie unverwandt ihrem Vater lauschte.
Knobel hatte nicht einmal eine einigermaßen konkrete Vorstellung von der Palette der möglichen Berufe, zu denen das ungeliebt gebliebene Studium den Zugang ebnen konnte. Der einzige Beruf, der ihm nun aus den Schilderungen von Lisas Vater vertraut und deshalb verheißungsvoll erschien, war der des Anwalts. In den abwechslungsreichen und sogar durchaus spannenden beruflichen Episoden, die er zu erzählen wusste, blieben hingegen die Schilderungen des richterlichen und staatsanwaltlichen Umfeldes merkwürdig blass.
Allmählich erweckte der idealisierte Glanz in Knobel den Wunsch, sich als Anwalt zu versuchen. Dabei verschwieg Lisas Vater die Härten seines Berufs keineswegs. Streng und sachlich wie immer erhob er sie sogar zur Herausforderung. Knobel zauderte indes vor der kommenden Aufgabe, obgleich er gewillt war, sich in ihr zu beweisen.
Die Reden des Vaters pflegten mit einem sanften Kuss auf Lisas Stirn zu enden. Er sagte dann »Liebes« zu ihr, was er sonst nicht tat, und als das Examen bevorstand, erweiterte er dieses Ritual um die tröstende Versicherung, dass egal, was immer auch passiere, in seiner Kanzlei ein Büro für sie bereitstünde. Auf Stephan erstreckte er dieses Angebot nicht, aber er deutete vage und zugleich verheißungsvoll seine langjährigen Verbindungen zu seinem Studienfreund Dr. Hübenthal an.
Lisas Vater verband keine Ideale mit seinem Beruf, die aus einem besonderen Interesse an Recht und Gerechtigkeit erwachsen wären. Es wurde nicht klar, ob er darin überhaupt jemals ein Motiv für seine Wahl erblickt hatte. Der Mann dirigierte gern und behielt die Dinge in der Hand. Sein Beruf ließ ihn seine Dominanz geradezu idealtypisch ausleben. Er fand Gefallen an der Macht und an verdeckt operierenden Strategien, die den Gegner wehrlos überraschten. Er blieb unnachgiebig, wenn der Gegner, den Verlust des Prozesses fürchtend oder des Streitens müde werdend, sich auf ihn zu bewegte und Schritt für Schritt eisern verteidigte Positionen aufgab und schlug die versöhnlich entgegengestreckte Hand aus. In der Tat war Lisas Vater ein guter Anwalt, und er erinnerte ihn an Dr. Hübenthal.
Knobel hingegen mied den Konflikt, in dem er sich hätte exponieren müssen, litt unter Verteidigung und Angriff, ohne dass es ihm an Positionen fehlte, die er vertreten konnte, aber er scheute, sie werbend darzustellen. Zumeist zog er kein klares Resümee, sondern bezog die gegenteilige Ansicht abwägend mit ein.
Fest vertretene Standpunkte imponierten ihm, aber es war ihm gleichermaßen schwierig, sich dauerhaft zu einer Position durchzuringen. Manchmal war ihm eine Lösung zu schlicht, manchmal mied er sie wegen ihrer Konfliktträchtigkeit, manchmal suchte er auch nur den versöhnenden Ausgleich. Das Prinzipielle lag ihm nicht. Wenn überhaupt, so entdeckte er gerade deswegen bei sich eine gewisse Berufung zur Tätigkeit des Anwalts, oder er glaubte sie nur zu erkennen, weil er den unüberwindlich scheinenden Graben zur Mentalität und Machtfülle von Lisas Vater nicht anders zu schließen vermochte.
Stephan Knobel begann seine Tätigkeit bei Dr. Hübenthal & Partner mit aller Entschlossenheit, und er nahm sich heimlich Lisas Vater zum Vorbild.
Lisa hatte in der Zwischenzeit unter familiärer Anleitung ihren vorbestimmten Platz in der Kanzlei ihres Vaters eingenommen, und Knobel litt still darunter, sich mit ihr im Wettbewerb messen zu müssen.
Einige Male hatte er mit ihr über seine Angst sprechen wollen, in ihrem Schatten zu stehen und ihrem vorgezeichneten Erfolg hinterherzulaufen, denn er fühlte sich herausgefordert, etwas zu schaffen, was dem Erfolg ihres Vaters entsprach.
Manchmal bereute er still, in das Haus ihres Vaters eingezogen zu sein, aber andererseits bot sich hierzu keine wirkliche Alternative. Lisas Wohnung war von Anfang an darauf ausgerichtet, dass sie im Hause blieb, und Lisa hatte nie ernsthaft etwas anderes erwogen. Er konnte ihr dies also nicht vorwerfen. Wenn er ihr dann doch einmal vorsichtig vorgeschlagen hatte, einen anderen Weg zu gehen, pflegte sie stets zu lachen, gleichwohl er es nicht als Auslachen empfand, zumal er sich eingestehen musste, den eigenen Weg stets unterlassen zu haben. Solche Gespräche waren schwierig, und sie wurden noch schwieriger, wenn Lisa ihm ihre ganze Aufmerksamkeit schenkte. Sie nahm dadurch dem Gespräch die Leichtigkeit, die es ihm erlaubt hätte, sich ihr ehrlich mitzuteilen. Lisa duldete keine beiläufigen Botschaften, dennoch hätte er ihr gern wie nebenbei von seiner Angst erzählt, sich mit ihr messen zu müssen, auch wenn er wusste, dass er den Wettstreit mit ihr verlieren würde.
Als es ihm doch einmal gelang, seine Angst vor ihr auszubreiten, nahm sie ihn in den Arm, um daraufhin sein Gefühl zu analysieren. Als sich seine Sorgen sodann im Nichts auflösten, fühlte er sich in seinen düsteren Ahnungen bestätigt. Das Gespräch hatte nichts Versöhnliches. Dabei konnte er selbst ihm keinen versöhnlichen Abschluss geben, und Lisa hatte an dem Gespräch nichts Belastendes empfunden.
Danach liebten sie sich. Sie schliefen oft miteinander, wenn etwas unklar geblieben war.
3
In den ersten Monaten seiner Tätigkeit bei Dr. Hübenthal & Partner sah Stephan Knobel kein Gerichtsgebäude von innen, und er betreute kaum eigene Mandanten. Die meiste Zeit saß er zurückgezogen in seinem Mansardenbüro hoch über der Prinz-Friedrich-Karl-Straße. Seine Arbeit bestand hauptsächlich darin, Aufgaben zu erledigen, die ihm von den Sozien aus den 100er-Zimmern übertragen wurden. Insbesondere Löffke deckte ihn mit Akten ein, in denen eine bestimmte Rechtsfrage zu klären war, deren Beantwortung zeitraubendes Studium umfangreicher juristischer Literatur voraussetzte. Löffke pflegte in solchen Fällen, ihn zu sich zu bitten und mit knappen Worten zu skizzieren, worum es ging. In Löffkes Akten ging es stets um viel, und wenn es in der Sache einmal nicht um hohe Streitwerte ging, war nach seinen blumigen Worten zumindest der Mandant für die Kanzlei grundsätzlich von großer Bedeutung. Somit war jede Akte von außerordentlicher Wichtigkeit, und Löffke verstand es stets, wortgewaltig seine Strategie zu rühmen, mit der er den Fall zu Ende führen werde. Knobel saß bei diesen Gesprächen wie am ersten Tag auf dem Schwingsessel vor Löffkes Schreibtisch. Eifrig fertigte er Notizen, während Löffke zwischendurch innehielt, den Rauch seiner unvermeidlichen Zigarette ausstieß und zu anderen Fällen abschweifte, die zwar ganz anders gelagert waren, dem vorliegenden aber in einem Detail ähnelten, in jedem Fall aber von ihm mit Bravour abgeschlossen wurden. Löffke gefiel es, ihm bei solchen Gelegenheiten Fachfragen zu stellen, deren Beantwortung das Wissen eines gewieften Routiniers voraussetzte. Knobel musste deshalb zumeist schulterzuckend dem Vorgesetzten selbst die Antwort überlassen.
Es waren jene kollegialen Gespräche, die unter dem Ungleichgewicht der Gesprächspartner litten. Indem Löffke die Rolle des erhabenen Lehrers einnahm, steckte er Knobel zwangsläufig in die Rolle des unwissenden Schülers, der gleichermaßen pflichtschuldig zu staunen hatte. Knobel litt unter diesen Prüfungen, in denen er unter der Last der von ihm nicht zu beantwortenden Fragen nach nichts anderem streben konnte als der Prüfungsstunde endlich entfliehen und sich in Büro 307 zurückziehen zu können.
Das karge Mansardenzimmer war ihm inzwischen vertraut und als Zufluchtsort fast lieb geworden, auch fiel ihm mittlerweile der säuerliche Geruch der Reinigungsmittel nicht mehr auf.
Seine Akten, die nicht seine waren, schichtete er dort sorgfältig zu kleinen Stapeln und ordnete sie nach seinen hausinternen Auftraggebern. Von Büchern umgeben, die er sich schüchtern aus den Büros im Erdgeschoss auslieh, löste er theoretisierend rechtliche Einzelprobleme von Fällen, die er im Detail nicht kannte, jedoch allein schon wegen ihres enormen Umfangs Ehrfurcht einflößten und ihm dadurch fremd bleiben mussten.
Gewissenhaft und leidenschaftslos arbeitete er seine Aufträge mit den zu Rate gezogenen Büchern ab, sah zitierte Gerichtsurteile ein und vertiefte sich in das Studium lehrreicher Fachaufsätze.
Zum Schluss sah er sich bar aller Strategien, zumindest jener, von denen Löffke unablässig sprach und die das Geheimnis seines Erfolges, überhaupt den Inhalt seines Berufs auszumachen schienen.
Letztlich blieb Knobel als einziges Ergebnis des umfangreichen Aktenstudiums indes lediglich die Einsicht, dass er sich nicht zum Anwalt berufen fühlte.
4
Lisa war schlagartig damenhafter geworden. Hose und Pullover wichen den nun bevorzugten modischen Kostümen.
Wenn sie sich abends zu Hause trafen, wusste sie mehr vom Tag zu berichten als er.
Er beobachtete einen bisher unbekannten Ehrgeiz an ihr, mit dem sie sich in die Dinge verstieg, immer in dem Willen, das Mögliche aus jeder Sache herauszuholen, und nicht selten gelang es ihr. Am Ende fragte sie auch stets nach seinem Tag. Dann gab er manchmal Löffkes Schilderungen als eigene wieder, wobei er auch die blumige Darstellung der wichtigen Fälle übernahm und mit wenigen Worten Bedeutungsvolles skizzierte. Hin und wieder fragte Lisa nach. Einige der Fragen hatte ihm auch Löffke gestellt, weshalb er sie mit einem gewissen Überdruss abwehrte.
Mit aller Macht suchte er ihre Nähe, wartete unruhig und wie gelähmt auf sie, wenn sie spät am Abend noch Akten vorbereitete, ging dann manchmal in ihr Arbeitszimmer, stellte sich hinter sie, umgriff ihre Schulter und küsste ihren Nacken. Es quälte ihn, dass er sie belog. Einmal fragte er, ob sie ihn wirklich liebe, doch Lisa war die Frage zu gewaltig.
»Ja«, hatte sie erwidert, aber ihm war, als sei ihr die Frage lästig gewesen.
Damals, als er sie im Feld berührt hatte, gestand er ihr, sie zu lieben. Die Worte kamen leise und stockend, fast erschienen sie ihm zu gering.
Sie hatte ihm die gleichen Worte geantwortet. Er vermutete, dass ihr solche Worte fremd und stets unpassend erschienen, und er gab sich darin ähnlich, dennoch hätte er gern mehr von ihr gehört.
Er überlegte, wie er unaufdringlich nachfragen könnte. Schließlich streichelte er nur über ihren Kopf und unterließ weitere Fragen. Er hatte jugendliche Liebessehnsüchte hinter sich, Mädchen, deren Nähe er sich herbeigeträumt, nach denen er sich verzehrt hatte und die ihn nachts nicht schlafen ließen. Es waren Freundschaften, die keine waren, sich verloren, ohne je begonnen zu haben, unerledigte Lieben. Mit Lisa verband ihn eine erwachsene Beziehung. Er wollte nicht, dass sie durch seine Liebe erschwert wurde.
5
Sein Aufstieg in der Kanzlei Dr. Hübenthal & Partner begann unerwartet an einem regenverhangenen grauen Aprilnachmittag.
Löffke hatte ihn zu sich gerufen und ihm eröffnet, dass eine wichtige Zivilsache vor dem Dortmunder Landgericht zur Verhandlung anstehe.
»Sie wissen um die Bedeutung des Mandats Rosenboom?«
Diese Suggestivfrage machte weitere Ausführungen entbehrlich, und Knobel bejahte tonlos.
»Wir machen mit der Firma Rosenboom einen großen Teil unseres Umsatzes«, erklärte Löffke. »Meistens mit großen Sachen: Gestaltung der Verträge mit Kunden und Zulieferanten und natürlich alle Prozesssachen aus Streitigkeiten mit seinen Geschäftspartnern.«
Er hielt inne.