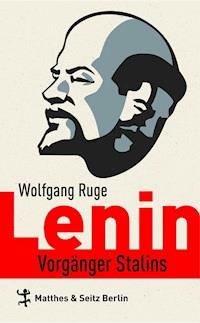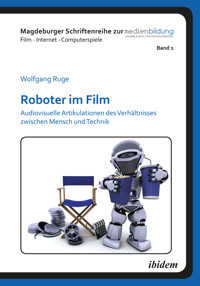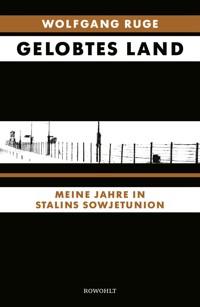
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wolfgang Ruge wächst in einem kommunistischen Elternhaus auf. 1933, mit der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten, flieht er in die Sowjetunion, sein «Gelobtes Land». Zunächst arbeitet er als Zeichner, holt sein Abitur nach, beginnt Geschichte an der Moskauer Universität zu studieren. Es sind die Jahre der Parteisäuberung, der Schauprozesse und des Nichtangriffspaktes zwischen Hitler und Stalin. Zusammen mit seiner damaligen Ehefrau wird er 1941 nach Kasachstan deportiert, ein Jahr später als «Arbeitsarmist» in einem Straflager im Nordural interniert. Nach dem Krieg wird die Internierung in «ewige Verbannung» umgewandelt. Obwohl ihm eine Entfernung vom Verbannungsort Soswa untersagt ist, gelingt es Ruge, als Fernstudent sein Diplom an der Universität Swerdlowsk abzuschließen. Am Ende hat er vier Jahre im Lager und elf Jahre in der Verbannung verbracht. In diesem Buch erzählt Wolfgang Ruge von den Schwierigkeiten, sich als Emigrant zurechtzufinden, von Liebesbeziehungen und Freundschaften im Moskau der Terrorjahre, von Deportation und Zwangsarbeit, von Hunger, Willkür und Gewalt, aber auch von inneren Kämpfen, vom schmerzlichen Reifen der Erkenntnis und vom Versuch, eine Haltung und einen Glauben zu bewahren in einer Epoche des Irrsinns und der Barbarei.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Wolfgang Ruge
Gelobtes Land
Meine Jahre in Stalins Sowjetunion
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Eugen Ruge
Inhaltsverzeichnis
TEIL I • NEUE HEIMAT
Nach Moskau!
Was hatte ich erwartet?
Emigrantenalltag
Zeitenwende
Himmelhoch jauchzend ...
Wie im Mittelalter
Das Lebengeht weiter
Der Krieg kommt
TEIL II • DIE STEPPE
Vorladung
Siedlung Nr. 11
Die Obrigkeit
Arbeitssuche
Mobilisierung
TEIL III • HUNGER
Ins Ungewisse
Lagpunkt «Schwarzes Flüsschen»
Hinaus in die Taiga
Zuträger, Sägeschleifer, Deputierte
Hunger
Bolschaja Kossolmanka
Um ein Haar zum Volksfeind gestempelt
Die schlimmste Zeit beginnt
Winter 1943
Reiten und andere Erlebnisse
Wieder im Wald
Heizer in der Sauna
Heumahd
Ein neuer Lagpunkt wird gegründet
Unfall
In die Lagerhauptstadt
Nachkrieg
Im Projektierungsbüro
TEIL IV • DIE EWIGKEIT
Untaugliche Freiheit
Drei Tage Kasachstan
Fernstudium
Alle mal herhören
Taja
Stalins Tod
Bruder Walter in Soswa
Mutter in Swerdlowsk
Nach 23 Jahren wieder in Berlin
ANMERKUNGEN
NACHWORT VON EUGEN RUGE
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND GLOSSAR
PERSONENREGISTER
Bildteil
Fußnoten
TEIL I • NEUE HEIMAT
(Teil I und II wurden geschrieben zwischen 1981 und 1989)
NACH MOSKAU!
Seltsamerweise kann ich mich nicht mehr an das genaue Datum unserer Ausreise aus Deutschland erinnern. Es muss aber einer der letzten Augusttage 1933 gewesen sein, an dem mein zwei Jahre älterer Bruder Walter und ich, gerade sechzehnjährig, auf der Hintertreppe unseres Tempelhofer Mietshauses per Selbstauslöser ein Abschiedsfoto machten. Zwar lachen wir dort, doch war uns eigentlich nicht ganz geheuer zumute. Immerhin verriet unser Gepäck, dass wir nicht nur eine Wochenendreise nach Kopenhagen vorhatten. Was würde geschehen, wenn man Verdacht schöpfte, uns einer gründlichen Untersuchung an der Grenze unterzog und unsere Sowjetvisa entdeckte?
Um unliebsamen Überraschungen vorzubeugen, hatten Walter und ich – beide blond und blauäugig – so etwas wie Nazibonzen-Zivil angelegt: Schaftstiefel und Breeches, wie sie SS-Männer trugen, dazu sportliche Sakkos. Trotzdem gingen uns auf der Fahrt von Berlin nach Warnemünde fast die Nerven durch. Die Anspannung schlug in Albernheit um. Unser Gekicher hätte jedem aufmerksamen Beobachter verraten, dass mit uns etwas nicht in Ordnung war. An der Grenze lief jedoch alles komplikationslos ab. Die noch aus der «Regimezeit» stammenden Zöllner drückten routinemäßig ihre Stempel in unsere Pässe, und zwei zunächst argwöhnisch dreinschauende SS-Leute, an denen die Ausreisenden vorbeimussten, nickten uns sogar freundlich zu. Unvergesslich der Augenblick, als ich, nun alle Gefahren hinter mir wissend, auf das Oberdeck des Fährschiffes Warnemünde– Gedser in die dunkle, warme Augustnacht hinaustrat.
Im unwirklichen Licht des allzu frühen Morgens erreichten wir Kopenhagen. Walter kannte eine dänische Familie, deren Sohn er auf einer Schulreise nach Kopenhagen kennengelernt hatte. Als wir dort gegen acht Uhr klingelten, ließ man uns jedoch nicht einmal über die Schwelle. Wahrscheinlich befürchteten die Leute, dass wir uns, aus Deutschland vertrieben, bei ihnen einnisten wollten.
Sechs oder acht Stunden lungerten wir in Kopenhagen einfach herum. Ich rauchte meine letzte deutsche Zigarette (Muratti For ever) und überlegte, ob ich den Nichtraucher Walter, der die Kasse verwaltete, um ein paar Kronen für etwas Rauchzeug bitten sollte. Zu meinem Erstaunen bewilligte er mir sogar eine Schachtel mittlerer Preisklasse.
Die Abfahrtszeit rückte heran. Ein kleiner Dampfer schaukelte uns über den Sund, vorbei an der berühmten Kopenhagener Meerjungfrau, die allerdings, viel kleiner als erwartet, in der beginnenden Dämmerung höchst unscheinbar aussah. Von Malmö sahen wir nur die Lichter. Beeindruckend war dagegen der elektrisch (!) betriebene Nachtexpress Malmö– Stockholm, in dem wir fast geräuschlos durch die nicht endenden Wälder rasten. Noch immer misstrauisch, antworteten wir nur einsilbig, als ein Herr mit uns ins Gespräch zu kommen versuchte. Die Atmosphäre lockerte sich erst, als er mir eine Zigarette jener Sorte anbot, die angeblich nur für den König von Schweden hergestellt wurde. Er sei nämlich, sagte er, Zigarettenfabrikant und habe die Ehre, die Lieblingsmarke Seiner Majestät zu produzieren.
Mit dem Geschmack des königlichen Tabaks auf der Zunge und dem erhebenden Gedanken im Kopf, dass ich jetzt auf derselben Route wie Lenin im Revolutionsjahr 1917 nach Russland einreiste, schlief ich ein.
An der Bahnsteigsperre in Stockholm tauchte völlig unerwartet Hans Baumgarten auf, der Lebensgefährte unserer Mutter. Hans war, wie wir wussten, Kurier der OMS1*, der Geheimabteilung der Komintern*, bei dem auch unsere Mutter seit einiger Zeit arbeitete. Er hatte gerade eine Kurierreise hinter sich gebracht und war auf dem Weg nach Moskau. So verbrachten wir den Tag zu dritt in Stockholm, sehr angenehm auch deshalb, weil Hans uns ein opulentes Essen bezahlte. Er kannte sich etwas in der Metropole aus und zeigte uns einige historische Gebäude, schöne Brücken und Uferpromenaden in der von Wasser durchspülten Stadt.
Ziemlich pflastermüde kamen wir gegen Abend zum Schiff, das uns ins finnische Turku bringen sollte. Unübertroffen schön war die Ausfahrt aus Stockholm durch Schären und Dutzende kleiner und kleinster Felsinseln. Als es vollends dunkel wurde, gingen wir unter Deck. Hans hatte natürlich eine Kabine, für Walter und mich gab es dagegen nur einen Hängemattenplatz im allerdings fast leeren Gemeinschaftsschlafraum. So gut wie dort habe ich selten geschlafen.
Von Turku ging es per Bahn zunächst nach Helsinki und von dort aus zur finnischen Grenzstation. Nun war die sowjetische Grenze nicht mehr weit. Die kleine Lokomotive pfiff und krächzte und blieb lange an kleinen Stationen mit unaussprechlichen Namen stehen.
In Wyborg stiegen die meisten Passagiere aus. Mein Herz schlug höher, als wir uns im fast leeren Waggon dem sowjetischen Grenzort Beloostrov näherten. Dann quietschten die Bremsen, und der Zug hielt. Wir schauten hinaus, doch auf dem verlassenen Bahnsteig tat sich nichts. Unser einziger Mitreisender, offenbar ein Russe, stieg rasch aus und verschwand. Dass er sich auskannte, begriffen wir erst, als uns ein finnischer Eisenbahner fragte, worauf wir noch warteten. Hier sei Endstation, über die eigentliche Grenze müssten wir zu Fuß gehen.
Am Erfrischungsstand im finnischen Wartesaal kaufte Hans ein Dutzend Bananen und trank im Stehen einen Kaffee. Er schlug vor, sich noch einmal hinzusetzen, doch Walter und ich drängten, weil wir so schnell wie möglich über den Schlagbaum nach «drüben» gelangen wollten.
Dann die entscheidenden 20 oder 30Schritte. Fasziniert starrte ich auf den großen Holzbogen, der den nicht befahrenen Schienenstrang aus der alten in die neue Welt überspannte. Zwar konnte ich die fremdländischen Buchstaben nicht lesen und die Worte nicht verstehen, doch wusste ich, was dort stand: «Proletarier aller Länder, vereinigt euch!» Mich übermannte ein unbeschreibliches Gefühl – wie es ein religiöser Mensch beim Anblick der Jungfrau Maria empfinden mag. So betrat ich meine neue Welt.
Die ersten Eindrücke vom roten Russland hat mein Gedächtnis nur verschwommen bewahrt. Offenbar wurde die Wirklichkeit von der inneren Verpflichtung, begeistert zu sein, verschleiert. Hans, Walter und ich betraten ein verwahrlostes Bahnhofsgebäude: überall Dreck, die Regale des kleinen Verkaufsstandes waren leer, von Spinnweben durchzogen.
Erst nachdem die Abfahrtszeit des Zuges, der uns nach Leningrad bringen sollte, verstrichen war, erschienen die ersten Sowjetbürger: zwei Grenzer und ein Zollbeamter mit betont abweisenden Mienen. Dennoch betrachtete ich die leibhaftigen Repräsentanten des Sowjetstaates mit ungeheurem Respekt, oblag es ihnen doch, die hier in den Wäldern versteckte Grenze zu sichern, vielleicht sogar Provokateure dingfest zu machen. Da konnten sie nicht jeden Ankommenden umarmen. Tatsächlich nahmen sie ihre Pflichten sehr ernst. Der Zöllner öffnete jeden Koffer, nahm Wäschestücke heraus. Verblüffenderweise blieb Hansens schwarzer Diplomatenkoffer ungeöffnet – der Grenzposten schob ihn mit dem Fuß lässig vom Stapel des unkontrollierten zum bereits inspizierten Gepäck. Ich erinnere mich, dass ich begeistert war: Donnerwetter, dachte ich, wie perfekt im Arbeiter- und Bauernstaat alles organisiert ist. Die Grenzer erkannten die kommunistische Kurierpost an geheimen Zeichen.
Als sich der Zug – mit fast zweistündiger Verspätung – in Bewegung setzte, war unser Waggon leer: bis zur ersten Station, die, wie ich später erfuhr, außerhalb der Sperrzone lag. Dort jedoch war der Bahnsteig schwarz vor Menschen. In unser Abteil drängten zwei mit Kiepen bepackte Frauen und ein kahlgeschorener, dürftig gekleideter Mann mit zwei Kindern. Er lächelte uns an, wir lächelten zurück, doch die Sprachbarriere verhinderte jede weitere Verständigung. Ich glaubte, dass er uns so freundlich begegnete, weil er in uns seine Kampfgenossen gegen den Weltimperialismus erblickte. Heute denke ich, dass er vor allem über unsere Kleidung und unsere Koffer staunte, ganz zu schweigen von den Bananen, die wir ihm und den Kindern anboten. Wir mussten ihnen zeigen, wie sie abzuschälen waren.
Je näher wir Leningrad kamen, desto voller wurde der Zug. Von den hereindrängenden Menschen sahen wir nicht viel, weil es inzwischen Nacht geworden war und keine Lampe in unserem Abteil funktionierte. Schrille, unverständliche Laute kamen aus der Dunkelheit. Es roch fremdartig.
Da wir mit großer Verspätung in Leningrad ankamen, machte Hans sich Sorgen, dass er den Verbindungsmann, der ihn in Leningrad abholen sollte, verfehlen könnte. Doch der Genosse war zur Stelle. Der Mann brachte uns in das leicht heruntergekommene (heute wieder tadellos renovierte) Hotel Astoria, das einst das erste Haus am Platze gewesen war. Da Fragen über Begleitpersonen der Kominternkuriere nicht gestellt werden durften, wies man uns dreien ohne weiteres ein Zimmer zu.
Zum Abendbrot, das ziemlich frugal ausfiel (allerdings, wie ich bald feststellen musste, für sowjetische Verhältnisse üppig war), stiegen wir in einen kantinenähnlichen Keller hinab. Mich wunderte, dass Hans die äußerst bescheidene Zeche mit Deutscher Mark bezahlte; erst in der Folgezeit erfuhr ich, dass man in sogenannten Intouristhotels mit ausländischer Währung bezahlen musste. Dabei bewunderte ich, wie gewandt sich Hans auf Russisch mit dem Ober verständigte. Gleichermaßen beeindruckt von seinen Sprachkenntnissen waren wir, als am nächsten Morgen das Telefon in unserem Zimmer klingelte und Hans in den Hörer rief: Ja nitschewo ne ponimaju, towarischtsch! – «Ich verstehe nichts, Genosse!»
Unser Zug nach Moskau ging erst am Abend des nächsten Tages, sodass wir uns am Vormittag in der Stadt umschauen konnten. «Die Wiege der Oktoberrevolution!» Dass mich das Fluidum der Newa-Metropole – anders als bei späteren Besuchen – kaum fesselte, lag nicht nur am Regen, sondern vor allem daran, dass mir ununterbrochen kleine Schocks verpasst wurden. Als wir uns bei starkem Regen in einem Hausflur unterstellten, sah ich, wie ein Mann aus einem Bündel Zeitungspapier ein Stückchen Zucker verlor und wie sich der nächste Passant sofort bückte, das Würfelchen blitzschnell aufhob und – in den Mund steckte. Schlimm sah ein zerlumpter, beinamputierter Invalide aus, der auf einem Holzbrett mit Rädern vorbeirollte, indem er sich mit Holzklötzchen, die er in den Händen hielt, vom Boden abstieß. Hatten in Deutschland nicht sogar die ärmsten Versehrten einen Rollstuhl?
Am Abend stiegen wir in den Nachtzug nach Moskau. Als wir am nächsten Morgen ausstiegen, schien wieder die Sonne. Die «Hauptstadt der Welt» – stoliza mira – lag zu unseren Füßen.
Tatsächlich habe ich den Atem dieser Stadt vom ersten Moment an als außer-, ja als «übereuropäisch» empfunden. Der Bahnhofsvorplatz mit Fahnen, Riesenporträts und unverständlichen Losungen, der gegenüberliegende Kasaner Bahnhof mit seiner orientalisch anmutenden Architektur, die weithin schimmernden Zwiebelkuppeln der orthodoxen Kirchen, von denen es angeblich sorok sorokow, also 40 mal 40, geben sollte – über alledem lag ein Hauch von Exotik: Bärtige Droschkenkutscher boten schreiend ihre Dienste an und schlugen ihre in seltsame Bögen eingeschirrten Pferde. Altersschwache Straßenbahnen, an deren Plattformen Menschentrauben hingen, klapperten und klingelten sich über den damals noch unebenen, geradezu hügeligen Platz. Vor den Bahnhöfen, inmitten von Truhen und Säcken lagen, hockten, dösten und schliefen Hunderte von Menschen, denen man ansah, dass sie schon längere Zeit unterwegs waren. Steppjacken, Halbpelze, Kaftane, bestickte Westen, Pluderhosen, Fellmützen, Turbane, abgeschabte Rotarmistenhelme, Kopf- und Schultertücher, vor sich hin starrende Greise, stillende Mütter, spielende, lachende und sich streitende Kinder. Woher diese Menschen kamen und wohin sie wollten, konnte ich mir nicht erklären. Erst als ich viel später mit der Sowjetwirklichkeit vertraut wurde, kam mir der Verdacht, dass viele dieser nach Moskau Gespülten aus den Hungergebieten geflüchtet waren und selbst nicht wussten, was ihnen der nächste Tag bringen würde.
Eines der wenigen Autos, die vor dem Bahnhof standen, ein alter Ford mit schäbigem Leinenverdeck, wartete auf Hans. Der Fahrer verstaute das Gepäck, und wir fuhren durch die verwinkelte Innenstadt zum Sitz der Komintern.
Ganz anders als heute war Moskau 1933 noch eine Art um den Kreml gruppiertes, riesiges Dorf: Holzhäuser, von der Zeit geschwärzt und gebeugt, verschachtelten sich ineinander zu unterbrochenen Ketten, die sich in der Ferne verloren. Hier und dort gab es Inseln und Streifen aus Stein: heruntergekommene Adelssitze mit verwüsteten Gärten, scheckige Mietskasernen, halb zerfallene Villen an beiden Stadtringen und auf den Ausfallstraßen.
Als fremdartig empfand ich auch die überall prangenden Losungen sowie die schwarzweißen Großporträts der Politbüromitglieder, die, wie ich später begriff, Relikt und Fortsetzung der orthodoxen Heiligenbildtradition darstellten.
Einigermaßen ortskundig machte Hans uns auf revolutionäre Sehenswürdigkeiten aufmerksam: Hier die Ljubjanka, der Sitz der Tscheka*, da das «Haus der Gewerkschaften»*, in dem damals Lenins Leichnam aufgebahrt war, und dort schließlich die Auffahrt zum Roten Platz – man sah schon den Spasski-Turm und die Zinnen der Kremlmauer.
Das erste russische Wort, das ich lernte, war propusk – einer der wichtigsten Begriffe im Sowjetsozialismus. Wir erhielten unseren ersten Passierschein im Anmeldebüro der Komintern, die gegenüber der Kremlmauer in der Mochowaja uliza residierte. Obwohl uns damit der Zugang zum Gebäude freigegeben war, begleitete uns ein Genosse vom Sicherheitsdienst. Damit nicht genug, ließen sich die auf jeder Etage mit aufgepflanztem Bajonett stehenden Posten mindestens sechsmal unsere Papiere vorweisen. Begeistert registrierte ich, dass die revolutionäre Wachsamkeit hier wirklich ernst genommen wurde.
Die Geheimabteilung OMS nahm das ganze oberste Stockwerk ein, von dem aus man über die Kremlmauer hinweg die dort patrouillierenden Rotarmisten sehen konnte. Hans wurde (mitsamt Koffer) sofort zum Chef hinter eine gepolsterte und mit Wachstuch beschlagene Tür beordert. Walter und ich blieben im Vorzimmer, wo die uns aus Berlin bekannte Hilde Tal – mit ihrer Tochter Sina hatten wir seinerzeit gespielt – Tee für uns kochte. Da wir Hilde bisher nur als Mutter und Hausfrau kannten, beeindruckte uns ihre Stellung als Chefsekretärin in der geheimsten Abteilung des «Stabes der Weltrevolution» über alle Maßen. Dies umso mehr, als sie in fließendem Russisch telefonierte und (was wir nur durch einen Zufall mitbekamen) sich zwischendurch auch mal in ihrer lettischen Muttersprache unterhielt. Während wir den Tee erstmals auf russische Art genossen, ihn nämlich durch einen zwischen die Zähne geklemmten Bonbon tranken, lauschten wir einigen «Moskauer Verhaltensregeln», mit denen uns Hilde bekannt machte.
Kurze Zeit nachdem Hans zufrieden – jetzt ohne Koffer – aus dem Arbeitszimmer des Chefs entlassen worden war, kam der oberste Boss persönlich ins Vorzimmer. Abramow-Mirow war nicht groß, sah gepflegt aus und trug eine Hornbrille. Er sprach gut Deutsch und konnte sich angeblich in sämtlichen europäischen Sprachen zu den kompliziertesten Problemen äußern. Ich erstarrte vor Ehrfurcht, als er mir die Hand reichte. Für mich stellten die OMS und ihre Mitarbeiter die Spitze der kommunistischen Elite dar. Ich war überzeugt, dass dieser untersetzte, unauffällige Mensch zu den am besten informierten Geheimdienstlern und den mächtigsten Menschen dieser Erde gehöre. Gewiss war er unbekannt, seine Fotos prangten an keiner Plakatwand, seine Reden wurden nicht veröffentlicht, und doch entschied er maßgeblich über das Schicksal der kommunistischen Bewegung und der antikolonialen Befreiungsarmeen – also über die Zukunft der Menschheit. Dabei konnte er sich natürlich auf die von Marx entdeckte Zwangsläufigkeit des Geschehens verlassen. Womit sich die OMS im Einzelnen beschäftigte, war mir natürlich unbekannt. Fest stand aber, dass sie das revolutionäre Zentrum der Welt war, diejenige Organisation, die den «großen Aufstand» plante und vorbereitete, indem sie Geld, Waffen, Funkausrüstungen usw. in die verschiedensten Länder schmuggelte und an legale und illegale Organisationen, Vereine, Verbände und Zusammenschlüsse verteilte. Der Name OMS wurde übrigens nie genannt. Wenn wir «Eingeweihten» uns ehrfürchtig über diesen wohl geheimsten aller Geheimdienste austauschten, dann sprachen wir allgemein von der «Firma» oder vom «Fünften Stock der Komintern» – allerdings hatte das Kominterngebäude nur vier Stockwerke. Nun waren wir im «Fünften Stock», und der Chef der OMS hatte mir persönlich die Hand gegeben.
Abramow selbst bin ich nie wieder begegnet, allerdings bin ich noch mehrmals mit seiner Frau Lola Mirowa zusammengetroffen, die vielleicht nicht zu Unrecht einmal als letzte Moskauer grande dame bezeichnet worden ist. Rotblond, groß, äußerst elegant, unterhielt sie trotz aller Hindernisse der sowjetischen Wirklichkeit einen Salon, arbeitete in der außenpolitischen Redaktion der berühmten Tageszeitung Iswestija* und fand obendrein Zeit, sich um die zumeist ausländischen Mitarbeiter ihres Mannes zu kümmern, die Schwierigkeiten mit der Sprache hatten und mit den Moskauer Verhältnissen nicht zurechtkamen. Mir verhalf sie 1935/36 mehrmals zu Aufträgen für die Iswestija. Ich zeichnete kleine Karten zur Illustration der militärischen Operationen in Abessinien und Spanien. Für eine solche Skizze, an der ich drei bis vier Stunden arbeitete, zahlte mir die Zeitungsredaktion 50Rubel – mehr als mein halbes Monatsgehalt zu dieser Zeit. Lola Mirowa wurde vermutlich 1939 erschossen.
Da sowohl Hans als auch unsere Mutter außerhalb Moskaus im «Punkt Zwei»* bei Podlipki wohnten, wo die Fälscherwerkstatt und die Geheimschule der Komintern untergebracht waren, schied für Walter und mich eine Unterbringung in deren Wohnung von vornherein aus. Deshalb wies der Geheimdienstchef an, uns Jungs vorerst in einem Gemeinschaftszimmer unter dem Dach des damals noch nicht aufgestockten Hotels Lux in der Twerskaja (seit 1932 offiziell uliza Gorkowo) unterzubringen. Wir aßen dort in der Kantine und begegneten häufig der Politprominenz. Da wir anfangs mit unseren Abenden nichts anzufangen wussten, ergab es sich fast von selbst, dass wir oft bei Hilde Tal saßen, die mit ihrem Lebensgefährten Jule Gebhardt und ihrer Tochter Sina ebenfalls im Lux wohnte (zweite Etage, Zimmer 14). Jule, eigentlich Julius Gebhardt, hatte in Deutschland an der Seite von Hugo Eberlein im Exekutivkomitee der Komintern gearbeitet und war jetzt im «Verlag ausländischer Arbeiter»* beschäftigt, dessen Direktor er sogar kurzzeitig werden sollte. Komisch, aber wenn man sein späteres Schicksal bedenkt auch tragisch, war Jules Reinlichkeitsbedürfnis, das dazu führte, dass er in seinem Büro eine eigene Klobrille aufbewahrte, die er aus Protest gegen die verdreckten Toiletten unter den Arm zu klemmen pflegte, wenn er durch den Korridor zum stillen Örtchen schritt.
Trotz der lästigen Passierscheinformalitäten besuchten wir Hilde Tal auch nach unserem baldigen Auszug aus dem Lux noch häufig. Bei den Gesprächen, an denen zumeist noch einige Zimmernachbarn teilnahmen, gab es fast ausschließlich ein Thema: die tschistka, die damals in Gang befindliche Parteireinigung. Obwohl mehr Russisch als Deutsch gesprochen wurde, kam ich bald dahinter, dass da eine für mich bislang unvorstellbare Aktion über die Bühne ging. Seit Wochen tagten Parteigruppenversammlungen oft bis in die tiefe Nacht hinein, um alle Parteimitglieder «durchzuarbeiten». Dies wurde so gründlich getan, dass man sich an einem Abend meist nur mit einer Person beschäftigte, ja dass es manchmal zweier Zusammenkünfte bedurfte, um einen Genossen oder eine Genossin zu «reinigen». Nur wer – vorbehaltlich der Zustimmung der nächsthöheren Parteiorganisation – als «intakt» befunden wurde, bekam sein neues Parteibuch. Mich verblüffte vor allem, mit welcher Vehemenz Fehler und Schwächen geradezu gesucht wurden; dass man von der Existenz solcher Schwächen in den Reihen der siegreichen Partei dermaßen überzeugt war. Am wenigsten begriff ich, wieso der allergrößte Wert auf Selbstanklage und Selbstkasteiung gelegt wurde. Nur wer sich Asche aufs Haupt streute, nur wer – sowohl in ideologischen als auch in privaten Fragen – tiefschürfend genug und rechtzeitig Selbstkritik übte, hatte überhaupt die Chance zu bestehen. Von einigen, die zu spät oder nicht gründlich genug Selbstkritik übten, hörte ich, dass sie Selbstmord begangen hatten. Mitleid wurde jedoch nie geäußert. Selbstmord galt als Schuldeingeständnis; wer sich das Leben nahm, wurde verdächtigt, der «Opposition» angehört zu haben.
«Opposition» war, wie ich bald herausfand, das schlimmste aller Worte. Leute, die auch nur einer Verbindung zu sogenannten Oppositionellen verdächtigt wurden, überstanden die tschistka nicht, sie wurden aus der Partei «hinausgereinigt» und verloren, weil ein Parteiloser nicht in der Komintern arbeiten konnte, ihren Arbeitsplatz. Als ich mein Unbehagen über diese Vorgänge einmal vorsichtig Hilde gegenüber zur Sprache brachte, reagierte sie ungewöhnlich scharf und klärte mich darüber auf, dass der Genosse Stalin erst kürzlich den wütenden Widerstand des Klassenfeindes (von dem ich glaubte, dass er längst liquidiert worden sei) konstatiert und zu seiner vollständigen Überwindung aufgerufen habe. Zu meinem Schrecken erwähnte sie, dass sogar namhafte Mitglieder des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei (ZK*) wegen ihrer Verbindung zu oppositionellen Gruppen verwarnt worden waren. Nach dieser Abfuhr getraute ich mich nicht mehr, ältere Genossen in heiklen Angelegenheiten zu befragen – lieber fraß ich die unverständlichen Dinge in mich hinein.
Ich hatte meine erste Sowjetlektion erhalten. Verkraftet hatte ich sie noch nicht.
WAS HATTE ICH ERWARTET?
1914 war mein Vater, Erwin Ruge, ein junger, national eingestellter Studienrat, als Reserveleutnant in den Ersten Weltkrieg gezogen.
Nachdem 1915 mein Bruder Walter geboren worden war, erlitt Vater im Dezember 1916 eine mittelschwere Verwundung, gerade ausreichend, um nach einigen Lazarettwochen für einen Heimataufenthalt beurlaubt zu werden (eine Tatsache, der ich übrigens meine Zeugung verdanke, wahrscheinlich in der Nacht zum 1.Februar 1917, als Deutschland, die USA herausfordernd, den uneingeschränkten U-Boot-Krieg eröffnete und damit endgültig den Weg zu seiner Niederlage bahnte).
Nach seinem Urlaub kehrte Erwin in den Schützengraben zurück, wo die letzten Reste seiner nationalen Gesinnung zusammenbrachen. Empört erkannte er, dass sich die sogenannten Kulturvölker im sinnlosen, brutalen Tötungswettstreit überboten, und wurde Pazifist. Aus der Kriegsgefangenschaft, in die er vor Verdun geraten war, nach Haus gekommen, überwarf er sich mit sämtlichen Verwandten, die ihre konservative Haltung hinter bildungsbürgerlichen Traditionen verbargen. Im Jahre 1919 rückte Vater noch weiter von seiner Familie ab und schloss sich der Unabhängigen Sozialdemokratie an. Schließlich trat er 1920 mit dem linken Flügel der USPD* zur KPD* über.
Als das geschah, war ich drei Jahre alt, hatte also ein Alter erreicht, in dem sich erste Lebenseindrücke zu verfestigen beginnen. Einer dieser Eindrücke war, dass Kriege die allergrößten Verbrechen sind und folgerichtig nur von schrecklichen Bösewichtern angezettelt werden. Dass Vater ein Todfeind dieser bösen Geister war, erfüllte mich mit Genugtuung. Ich bewunderte ihn, weil er sich mutig in die von Feinden wimmelnde Welt außerhalb unserer Wohnung wagte. Selbstverständlich war, dass sich unser Tagesablauf an ihm orientierte und er bestimmte, was zu tun und zu lassen sei. Zutiefst beeindruckte mich darüber hinaus, dass er die Fehler anderer Leute – der Großeltern, der Nachbarn, seiner sich in fernen Regionen bewegenden Kollegen – mühelos erkannte und deren Hintergründe aufzuzeigen vermochte. Für mich stand fest: Bald würden alle guten Menschen Vaters Unfehlbarkeit erkennen und sich zur Ächtung des Krieges und zum Kommunismus bekehren.
Nach dem Krieg bemühte sich Vater – darin nicht ganz undeutsch–, seine durch das Fronterlebnis gereifte Überzeugung theoretisch zu untermauern. Er las Bebel und den alten Liebknecht, dann Engels und schließlich Marx. Als er sich in deren Arbeiten einigermaßen auskannte, rief er sogleich einen Zirkel zum Studium des «Kapitals» ins Leben. Da schwoll mir die Brust: Mein Vater erklärte gewöhnlich Sterblichen die Gedanken dieses Wunderwerkes.
Unsere Mutter Charlotte hatte der kommunistischen Idee zunächst feindselig, zumindest aber ablehnend gegenübergestanden. Das änderte sich erst, als unser Vater sie durch seine nicht abreißenden Affären in die Hände des behäbigen, aber zuverlässigen Hans Baumgarten trieb (den Vater – zusammen mit der kommunistischen Idee – in die Familie eingeschleppt hatte). Hans war Metallarbeiter und strenggläubiger Kommunist, allerdings als bezahlter Funktionär nicht mehr mit den Arbeitern verbunden und, seit er von der Komintern als Kurier angeworben worden war, auch ohne sonstige organisatorische Bindung. Unter dem Einfluss ihres neuen Partners trat Mutter der Kommunistischen Partei bei, entdeckte ihre rhetorische Begabung und stieg ins politische Leben ein. Indes dauerte ihre offizielle Parteizugehörigkeit nicht lange. Zwei, drei Jahre bevor die Nazis an die Macht kamen, streckte die Komintern ihre Fühler nach ihr aus und stellte Charlotte als Dolmetscherin ein, entsprechend der Regel, nach der möglichst beide Partner einer Zweierbeziehung im Apparat sein sollten.
Soweit ich mich entsinne, wurde das Scheitern der elterlichen Ehe von uns Brüdern keineswegs als außergewöhnlich empfunden. Bis 1930 (da war ich 13) wurde die wachsende Entfremdung von Mutter und Vater von uns Jungs zwar wahrgenommen, jedoch sprachen wir nicht darüber, zum einen, weil wir wussten, dass sich Vater als Lehrer keine Seitensprünge erlauben konnte (den Terminus Seitensprung hatte Walter mir erklärt), zum anderen, weil Hans als Kominternkurier eine halblegale Wohnung besaß, die geheim gehalten werden musste. Als Mutter dann auszog und Vater sich ungehemmt seinen Besucherinnen widmete, meinten wir, erwachsen zu sein, auf familiäre Geborgenheit und ähnliche bürgerliche Hirngespinste verzichten zu können. Wir waren nachgerade stolz auf unsere Selbständigkeit und fühlten uns den Altersgenossen überlegen.
Mutter sahen wir von da an nur selten und meist in Begleitung von Hans Baumgarten, der uns – die nach seinem Dafürhalten «verwöhnten Bürgersöhnchen» – zu Klassenkämpfern umerziehen wollte. Pädagogisches Talent ging ihm jedoch völlig ab. So langweilte er uns mit Geschichtchen im Funktionärsjargon, die mir schon damals verschroben erschienen, weil ich spürte, dass sie aus propagandistischen Sprechblasen bestanden.
Viel lebendiger war es mit unserem Vater, mit dem wir in einer Wohnung lebten, die wir «Dreier-Pension für ledige Herren» nannten. Vater war humorvoll und genusssüchtig, machte aus seiner intellektuellen Überlegenheit über Hans Baumgarten keinen Hehl und bewahrte sich bei uns Söhnen den Ruf eines Kommunisten, der mit beiden Beinen im Leben stand. Er war es, der den Grundstein für unsere Weltanschauung legte.
Schon von klein auf gingen wir einmal in der Woche zur Kommunistischen Kindergruppe, die in einem düsteren stadteigenen Lokal tagte. Dort brachte uns eine Tante Hedwig, die sicher noch keine 30 war, mir aber steinalt vorkam, Wander- und Kampflieder bei, bastelte mit uns Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenke und klebte ausgeschnittene Zeitungsfotos und handgeschriebene Artikel zu Wandzeitungen zusammen. Obwohl ich, noch Vorschulkind, diese Artikel nicht lesen konnte, bestaunte ich die Verfasser derartiger Pamphlete, leisteten sie doch – davon war ich überzeugt – einen Beitrag zum Befreiungskampf der Unterdrückten.
Mit dem Lande Lenins, in dem – wie wir lernten – der erste Akt der Weltrevolution über die Bühne gegangen war, verbanden wir Jungen grandiose, mitunter groteske Vorstellungen. Felsenfest glaubte ich zum Beispiel, dass alle Popen in die Kommunistische Partei eingetreten seien oder dass Politbüromitglieder (und schwangere Frauen) vorn in der Straßenbahn einsteigen durften.
Als Lenin starb, hatte ich mich als Sechsjähriger eine Weile damit beschwichtigt, dass sein Bruder K.Lenin (Kalinin) an seine Stelle getreten war und der nicht ganz verständlichen Losung «Lenin ist tot, der Leninismus lebt» einen fassbaren Ausdruck verliehen hatte. Als ich dann nach drei, vier Jahren meines Fehlers gewahr wurde, kannte ich dem Namen nach bereits ein Dutzend Sowjetführer, die sich um die Fortsetzung des Lenin’schen Werkes bemühten. Von Meinungsverschiedenheiten oder gar Richtungskämpfen innerhalb der russischen Führungsequipe hatten wir, die Kinder des kommunistischen Fußvolks im Westen, noch nie etwas gehört, erst recht nichts über die Schikanierung oder Verfolgung von Sowjetgegnern. Feinde des Sowjetstaates, so vermuteten wir, säßen nur im Ausland, im Lande selbst konnte es solche Leute nicht geben.
Die Nachricht von der Verbannung des Oktoberhelden Leo Trotzki hielten wir für plumpe Verleumdung. Die Amtsenthebung Sinowjews nahmen wir kaum zur Kenntnis. Legendär war in Deutschland der rote Haudegen Budjonny. Ein Zeltlager in Templin war von uns (oder von unseren Oberen?) nach dem Bürgerkriegshelden Woroschilow benannt worden. Von Stalin hatten wir seltsamerweise nie etwas gehört.
Auch Pressenachrichten über Hungersnöte in Sowjetrussland* hatten wir stets als feindliche Hetze abgetan. Ich wusste zwar, dass es in Russland nach dem Bürgerkrieg verwahrloste Kinder und auch Versorgungsschwierigkeiten gegeben hatte, übertrug aber, wenn ich etwa an «Versorgungsschwierigkeiten» dachte, die deutschen Maßstäbe auf russische Verhältnisse. Dabei stand für mich außer Frage, dass die Russen, allen voran die sowjetischen Jungkommunisten, ununterbrochen Erfolge errangen und alle Schwierigkeiten überwanden. Darüber las man ja in der «Roten Fahne»* sowie in der mitunter leicht exotischen, deshalb aber desto spannenderen sowjetischen Belletristik, die vom Neuen Deutschen Verlag* herausgegeben wurde – in Pantelejews «Schkid, die Republik der Strolche», im «Tagebuch des Schülers Kostja Rjabzew» sowie in den Werken Aleksej Tolstois, Pilnjaks und Scholochows. Gelinde Bauchschmerzen hatte mir allerdings das Buch von Berta Lask «Wie Franz und Grete nach Russland reisten» bereitet. Dort hatte die Autorin kein Hehl daraus gemacht, dass es auch im angehimmelten Sowjetstaat Hunger und Not sowie Menschen gab, die von kommunistischen Ideen unbeeindruckt geblieben waren.
Mit solcherart Skrupeln hatte ich mich aber nicht lange aufgehalten. Erst später – nämlich in der Sowjetunion – fiel mir auf, dass Leute, die in Russland gelebt hatten, nie so richtig mit der Sprache über den dortigen Alltag herausgekommen waren. Die Sowjetrussen in Deutschland schienen sich in Berlin recht wohl zu fühlen und äußerten sich nur knapp über die Verhältnisse in ihrer Heimat. Selbst deutsche Kommunisten, die kurz nach Moskau verschlagen worden waren, ließen sich lang und breit über die dort gehegten Zukunftspläne und über die Begeisterung der Massen aus, erzählten aber nichts über den Verdienst des Durchschnittsbürgers oder darüber, was er aß und trank, wie er wohnte und sich kleidete.
Wieso Vater uns 1924 in die antiautoritäre und deshalb als modern geltende Berthold-Otto-Schule in Lichterfelde gab, ist mir bis heute unverständlich. Diese Schule, die als Ministaat mit Kanzler, Ministern, Gerichten und Schiedskommissionen erfolgreich Kaiser Wilhelm, Ebert, Hindenburg, Hitler, Adenauer und alle seine Nachfolger überdauert hat, wurde damals von dem kauzigen Professor Berthold Otto geleitet, der mit einem Regenschirm schwimmen ging und (wie ich erst Jahrzehnte später erfuhr) eine Lehre vom «volksorganischen Denken» entwickelt hatte, die im Kern die Einführung eines deutschen Sozialismus unter dem zurückgerufenen Kaiser propagierte. Oberstes Prinzip an der Schule war (wie man heute sagen würde) learning by doing, der Unterrichtsstoff wurde nicht erklärt, sondern musste dem Lehrer beziehungsweise den Mitschülern abgeguckt werden. Nun hatten die beiden Neuzugänge des Jahres 1924 – ein gewisser Gunnar und ich – schon deshalb mit dem Abgucken Schwierigkeiten, weil wir in den bereits seit dem Vorjahr bestehenden Anfängerkursus aufgenommen wurden, in dem eingefuchste Schüler die Flüsse Europas oder Rechenaufgaben mitsamt den Ergebnissen nach der Stoppuhr herunterschnarrten. Einige Monate später fand ich mich mit der betrüblichen Einsicht ab, außergewöhnlich unbegabt zu sein.
Zu meinem Glück zogen wir 1925 in die gerade erbaute Britzer Hufeisensiedlung, sodass ich in die ebenfalls von einem Reformpädagogen geleitete Rütli-Schule im Arbeiterbezirk Neukölln kam. Mein neuer Lehrer, Herr Lemke, erkannte mein Problem und trichterte mir in zwei Dutzend Nachhilfestunden das Jahrespensum der ersten Klasse mitsamt einer gehörigen Portion Selbstsicherheit ein, und ich fand Anschluss zu meinen – zumeist aus proletarisch-kommunistischem Milieu stammenden – Klassenkameraden.
Ich erinnere mich an die Wahlagitation vor den Reichstagswahlen am 20.Mai 1928, bei denen die SPD als Liste 1, die KPD als Liste 5 antrat. Eifrige Sozialdemokraten hatten Plakate herausgehängt, auf denen stand, schon jedes Kind wisse, dass die Eins «ausgezeichnet» bedeute, die Fünf aber «mangelhaft». Wir Knirpse bildeten unter solchen Aushängen Sprechchöre und schmetterten aus voller Kehle: «In Russland ist es umgekehrt, da ist die Fünfe lobenswert!» Dann liefen wir, so rasch wir konnten, weg, höchst befriedigt darüber, dass wir die «Bonzen» abgekanzelt hatten.
Innerlich halbwegs gefestigt kam ich zwei Jahre später in die Karl-Marx-Schule, die früher Kaiser-Friedrich-Realgymnasium geheißen hatte, nun aber unter einem sozialdemokratischen Direktor als eine der fortschrittlichsten Schulen Deutschlands galt. Im Gegensatz zur Rütli-Schule, wo die Kommunisten in der Mehrzahl gewesen waren, überwogen hier Töchter und Söhne von SPD-Mitgliedern. Da zu dieser Zeit gerade die Weltwirtschaftskrise im Gange war, die fast jeden zweiten Arbeiter in Deutschland erwerbslos machte, traten die Unterschiede im Lebensstandard deutlicher als bisher hervor. Ich kam, da wir zu Hause keine Not litten, in die seltsame Lage, der staatserhaltenden Elite zugerechnet zu werden, während ich mich doch als erklärten Gegner der Kapitalistenrepublik sah!
Viele Nachmittage verbrachte ich im rein kommunistischen «Sozialistischen Schülerbund»* und fuhr auch in die von ihm organisierten ländlichen Ferienschulen in diversen Zeltlagern. Dort wurde nicht nur über aktuelle Probleme, über die Kriegsgefahr und die internationale Lage gestritten, sondern es gab auch zünftige Vorlesungen zum dialektischen und historischen Materialismus, der nach allen Richtungen abgeklopft und für gut befunden wurde. Zwischendurch verschlang ich die Schriften von Max Beer, Edwin Hoernle und Frida Rubiner, versuchte mich an Trotzki und Bucharin und griff schließlich sogar zu Engels und Lenin. Nur an den obersten Gott des atheistischen Olymps, an Marx, traute ich mich nicht heran. Für einen stümperhaften Anfänger wie mich ziemte es sich einfach nicht, die Werke des Urvaters anzurühren und dessen Mammutsätze womöglich verständlich zu finden.
Aber Marxens Lehre schimmerte durch alle Diskussionen und gelesenen Texte hindurch, ganz gleich, ob sie sich gegen die Prügelstrafe an deutschen Schulen richteten, über den Kampf der Rifkabylen gegen die französischen Kolonialherren informierten oder das Wesen des Mehrprodukts erläuterten. Mich faszinierte, dass der Marxismus die unterschiedlichsten Erscheinungen in Beziehung zueinander setzte, sämtliche gesellschaftlichen Konflikte aus einem einzigen Urwiderspruch ableitete, sodass die Großartigkeit der Marx’schen Ideen letztlich in ihrer frappierenden Einfachheit bestand.
Alles, was sich ringsum abspielte, schien zu bestätigen, dass der Kapitalismus – wie Marx und Engels vor 80Jahren vorausgesagt hatten – dabei war, an seinen Krisen zugrunde zu gehen. Scheinbar zutreffend hatten die beiden Klassiker schon damals die nun vor unseren Augen ablaufenden Todeszuckungen der Ausbeutergesellschaft, das immer tiefer greifende Chaos und das Erstarken der «proletarischen Totengräber» beschrieben. Der Untergang des Kapitalismus dauerte zwar länger, als Marx und Engels es vorausgesagt hatten, aber das große Aufbegehren hatte begonnen – vorerst in der Sowjetunion – und würde bald Deutschland, Europa und die übrigen Kontinente ergreifen. Vater vertraute mir unter dem Siegel der Verschwiegenheit an, dass der Sitz der Komintern, nach dem Sieg der deutschen Revolution, nach Berlin verlegt werde. Wie sollte man da nicht der Euphorie verfallen?
Indes, während wir noch über die Losung der «Volksrevolution» stritten, zogen sich dunkle Wolken über Deutschland zusammen. Am 14.September 1930 kam es zu einem erdrutschartigen Erfolg für die NSDAP*, die von wüsten Reaktionären hochgepäppelt wurde. Als im nächsten Jahr die ersten braunen Uniformen in den Straßen Neuköllns auftauchten, waren wir, weil es den historischen Gesetzen widersprach, eher verblüfft als empört. Mit der Zeit mussten wir uns allerdings daran gewöhnen, dass hier eine Nazi-Kneipe eröffnet und dort eine SA-Kaserne* aufgemacht wurde.
Mit dem Faschismus, der das Gerede vom Sozialfaschismus allmählich ablöste, erging es mir wie mit anderen Erscheinungen, die in meinem Leben Spuren hinterlassen haben. Wenngleich ich mir das Ausmaß der Verbrechen, auf die Deutschland zusteuerte, nicht auszumalen vermochte, weigerte ich mich auf der anderen Seite beharrlich, an einen Erfolg der Hitlerfaschisten zu glauben. Ich war davon überzeugt, dass die mit nationalistischen Parolen irregeleiteten Werktätigen für unsere Befreiungsideen gewonnen werden mussten. Doch war es schwierig, an Nazi-Anhänger heranzukommen, noch schwieriger, sie in Grundsatzdiskussionen zu verwickeln. Dabei wussten wir im Kommunistischen Jugendverband nicht einmal, ob man mit den «Verführten» reden oder die «Störrischen». (entsprechend der ZK-Losung «Schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft») verprügeln sollte. So liefen unsere Entlarvungen der Hitler’schen Versprechungen im Sozialistischen Schülerbund und im Jugendverband im Grunde darauf hinaus, bereits Überzeugte zu überzeugen. Das stärkte zwar unser Selbstbewusstsein, doch konnte der Erfolg der Faschisten damit nicht aufgehalten werden. Öfter ging es uns so wie am ersten Tage des Berliner Verkehrsarbeiterstreiks im November 1932: Als wir auf dem Schulweg feststellten, dass weit und breit keine Straßenbahn fuhr, frohlockten wir wegen des Sieges der Revolutionären Gewerkschafts-Opposition über die «Bonzen», dann aber ernüchterte uns am U-Bahnhof Grenzallee ein handgeschriebenes Plakat: «Hier streikt die NSBO» – die Nationalsozialistische Betriebsorganisation.
Auch die immer häufiger angekurbelten Flugblatt- und Klebezettelaktionen, bei denen wir vor den hektisch aufeinanderfolgenden Wahlen des Jahres 1932 nachts halbmeterhohe Buchstaben an die Wände pinselten und, um keinen Verdacht zu erwecken, darauf achteten, keine Farbe auf die Schuhe zu verkleckern, verpufften in der überhitzten Atmosphäre der allen alles versprechenden Propaganda.
Dass die Leute, unverständlicherweise auch die Arbeiter, nicht so leicht zu überzeugen waren, merkten wir bei jenen Einsätzen, die stolz «Betriebsagitation» genannt wurden. Sie fanden ein paarmal vor dem einzigen in unserer Nähe gelegenen Werk statt, der EFHA-Fleischwarenfabrik. Die Arbeit dort begann um sechs Uhr früh, sodass wir, wenn wir rechtzeitig dort sein wollten, um fünf aufstehen mussten. Kostete schon das Überwindung, so entmutigte uns noch mehr, dass die meisten der zum Werktor eilenden Beschäftigten entweder so taten, als sähen sie uns nicht, oder abwinkten, wenn wir ihnen unsere Flugblätter aufdrängten. Besonders deprimierend war, dass den SA-Leuten, die mehrmals zeitgleich mit uns erschienen, die Nazi-Pamphlete aus den Händen gerissen wurden. Das erboste uns, zumal wir bei den anschließenden Handgemengen meistens noch den Kürzeren zogen. Bei solch einem Gerangel büßte ich sogar – auf dem Altar des Klassenkampfes! – einen Schneidezahn ein.
Schlimme Erinnerungen holen mich ein, wenn ich an die nur selten veranstalteten «Landagitationen» denke, bei denen wir zu zehnt oder zwölft mit einem klapprigen Lkw ins Oderbruch fuhren, um die längst auf Hitler eingeschworenen Bauern zu mobilisieren. In einem Dorf angekommen, wendeten wir unseren Laster vorsorglich in Fluchtrichtung und ließen zwei Leute als Bewacher zurück. In der Regel kamen wir überhaupt nicht dazu, unsere Argumente anzubringen. Kaum hatten die Bewohner «Rotfront-Leute» in uns erkannt, begannen sie uns zu beschimpfen und zu bedrohen.
Begeisterung ergriff mich dagegen bei den kommunistischen Demonstrationen, zu denen wir vom Neuköllner Richardplatz zum Karl-Liebknecht-Haus am Bülowplatz marschierten. Schon am Sammelpunkt geriet man, wenn das Kommando «In Viererreihen schwenkt marsch!» erscholl, in den Sog der proletarischen Disziplin. Trotz Schikanen der Polizei, die den Zug auseinanderriss oder das Singen von Kampfliedern verbot (da pfiff man eben!), fühlte man sich als Teil einer in die Zukunft drängenden, unbesiegbaren Masse. Unvergesslich ist mir der letzte dieser Aufmärsche am 25.Januar 1933 geblieben. Wir froren erbärmlich, doch erfüllte es uns mit Genugtuung, dass Arbeiterfrauen den Demonstranten heißen Malzkaffee auf die Straße brachten. Unsere Rufe «Wo sind die Faschisten?» beantworteten wir selbst mit düsterem «Im Keller!» und jubelten Thälmann, Dahlem und Florin zu, die auf einer Tribüne vor dem Karl-Liebknecht-Haus standen und ihren Kampfeswillen mit geballten Fäusten bekundeten.
Fünf Tage später, am 30.Januar, kamen wir, zwei Jungen und ein Mädchen, auf dem Nachhauseweg von der Schule am dichtumringten Schaufenster des «Neuköllner Anzeigers» vorbei. Vor ein paar Minuten hatte man eine Eilnachricht des Wolff’schen Telegrafenbüros hinter die große Scheibe gehängt: Adolf Hitler war zum Reichskanzler berufen worden. Bestürzt nahmen wir die Neuigkeit zur Kenntnis. Mein Kumpel sagte: «Nun, länger als der Schleicher wird’s der braune Schlawiner auch nicht machen.» Das Mädchen an unserer Seite, eine Jüdin, schüttelte den Kopf. «Wenn diese Regierung mal nicht lange an der Macht bleibt. Auf jeden Fall werden wir den heutigen Tag im Gedächtnis behalten. Ich fürchte, solange wir leben.»
In dieses Mädchen war ich mit meinen 15Jahren verliebt, sodass meine Erinnerung an die nun beginnende nationalsozialistische Gleichschaltungsphase in sehr widersprüchliche Bildfolgen gekleidet ist. Natürlich beängstigten mich die ersten Gehversuche der Hitlerregierung, doch daneben beflügelten mich die schüchternen Küsse, die mich doppelt verlegen machten, weil Luta kein Arbeiterkind war. Als sie ihre, wie mir schien, kleinbürgerlich-pessimistische Voraussage traf, fühlte ich mich verpflichtet, ihr meinen proletarischen Optimismus entgegenzusetzen, doch brachte ich, da das unmöglich Geglaubte wahr geworden war, keine zuversichtliche Aussage über die Lippen. Zum ersten Mal im Leben schien mir die von vermeintlichen Gesetzmäßigkeiten geprägte Zukunft mit Flecken bedeckt.
In den ersten Wochen nach Hitlers Machtübernahme verlief mein Alltag seltsamerweise in gewohnten Bahnen – ich ging zur Schule, nahm nach wie vor an den Gruppenabenden im Schülerbund teil, tummelte mich auf der Eisbahn und verbrachte die Abendstunden mit Freunden. Zwar traten die Hakenkreuzler jetzt herausfordernder auf und die Zeitungen der Arbeiterparteien wurden häufiger als früher verboten, doch beruhigten wir uns noch immer damit, dass diese Regierung, in der die Nazis zudem in der Minderheit waren, nicht viel reaktionärer sei als die vorherige.
Diese scheinbare Ruhe fand ein Ende, als der Reichstag in der Nacht zum 28.Februar 1933 in Flammen aufging. Schon am nächsten Morgen, als wir in der Zeitung die «Verordnung zum Schutze von Volk und Staat» lasen, schwirrten Gerüchte über Massenverhaftungen durch die Luft. Dann verdichteten sich die Schreckensnachrichten, sodass wir nach und nach erfuhren, wer von den Parteiführern festgenommen, wo Parteilokale von SA-Leuten überfallen, welche Druckereien verwüstet worden waren. Weitere Schläge folgten: Die Aberkennung der kommunistischen Abgeordnetenmandate nach der Reichstagswahl vom 5.März, die Absegnung der neuen Macht durch den Handschlag Hindenburgs und Hitlers am Sarge Friedrichs des Großen, der erste Judenboykott, die Proklamierung des Arbeiterfeiertages am 1.Mai zum «Tag der nationalen Arbeit», die Zerschlagung der Gewerkschaften, die Bücherverbrennungen, die Verbote sämtlicher Parteien und fast aller Verbände.
Da mein Bruder und ich in Britz und an der Schule als Kommunisten bekannt waren, hatte Vater unseren Umzug nach Tempelhof und meinen Wechsel ins Köllnische Gymnasium im Zentrum Berlins beschlossen. Das traf mich hart, brachen doch viele Kontakte ab, und langjährige Schulfreundschaften trockneten ein. In der neuen Schule fiel es mir verdammt schwer, den – wie mir Vater geraten hatte – politisch uninteressierten Gymnasiasten zu mimen und die abstoßende Wirklichkeit zu beobachten: den nationalen Ton der plötzlich gewendeten Lehrer, die überheblich dreinblickenden Hitlerjungs, die durch die Arbeiterviertel marschierenden und «Juda verrecke!» brüllenden SA-Schläger.
Am 1.April, dem Tag des Judenboykotts, starrten meine Freundin Luta und ich entgeistert auf die SA-Posten vor jüdischen Geschäften und auf die Plakate «Deutsche, kauft nicht bei Juden!». Kurz darauf begann Lutas Familie die Auswanderung nach Palästina vorzubereiten. Lutas Vater, ein englischer Staatsbürger, schickte Frau und Tochter für die zum Abschluss seiner Geschäfte nötigen Monate in die Tschechoslowakei. Luta und ich schworen uns gegenseitig die Treue, kurz darauf begleitete ich sie zum Anhalter Bahnhof.
Auch mein Vater, der nach dem faschistischen «Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums» entlassen worden war, begann von einer künftigen Beschäftigung außerhalb Nazideutschlands zu sprechen und verkündete schließlich, dass er mit seiner derzeitigen Freundin Gerda, einer meinen Bruder und mich völlig ablehnenden jungen Frau, nach Moskau gehen werde. Außerdem regte er an, Mutters Beziehungen in der Komintern zur Besorgung der sowjetischen Visa für uns Jungs zu nutzen.
Anfangs schien mir eine Flucht vor dem Faschismus, den man doch im Lande selbst bekämpfen musste, wie eine Desertation, dann nahm mich die Gloriole der Sowjetunion aber mehr und mehr gefangen. Jetzt eröffne sich die Möglichkeit, sagte ich mir, den Staat der Werktätigen nicht nur wahrzunehmen, sondern tatkräftig am Aufbau einer neuen Gesellschaft mitzuhelfen. So sah ich mich schon, wie ich nach einem Universitätsabschluss als Geologe in Sibirien gewaltige Entdeckungen machen, wie ich mich als Offizier der Roten Armee in dem von Deutschland entfesselten Krieg bewähren oder den Auftrag erhalten würde, zu meiner Freundin nach Tel Aviv überzusiedeln, weil ja dort genauso für den Kommunismus geworben werden musste.
Wahrscheinlich wäre meine Entscheidung für Sowjetrussland auch ohne meinen Bruder gefallen, doch bestärkte er mich in meinen Plänen. Seine Freundin Böszi, die Tochter eines Funktionärs der Ungarischen Räterepublik von 1919, war nämlich schon in die neue Welt gefahren, sodass er sich längst für die Ausreise nach Moskau entschieden hatte.
Aus Furcht vor unbedachten Äußerungen oder unüberlegten Versprechern verschwiegen wir die Abreise selbst vor unseren Freunden. Wir verschlangen russische Bücher, um noch so viel wie möglich über die Sowjetunion zu erfahren, kauften von dem wenigen Geld, das wir hatten, allerlei Krimskrams und warteten auf die von der Komintern beantragten sowjetischen Visa. Dass sich deren Ausfertigung über Monate hinzog, empfand ich als unangenehm, aber einleuchtend, weil alle in die rote Hauptstadt Strebenden selbstverständlich gründlich überprüft werden mussten. Das betraf indes, wie wir glaubten, nicht Walter und mich, waren wir doch Angehörige der über jeden Zweifel erhabenen Mitarbeiter der Komintern – der kommunistischen Weltorganisation.
Die Mühlen der Sowjetbürokratie mahlten langsam. Erst im August wurden wir in die Sowjetbotschaft Unter den Linden bestellt, um unsere Reisepapiere abzuholen. Ehe wir hineingingen, schlichen wir misstrauisch um das Gebäude herum, dann drückten wir uns rasch durch das große Tor und erfuhren, dass die Visa schon im Portierfensterchen der Einfahrt ausgegeben wurden. Es waren sogenannte Einlegevisa, also Einreisegenehmigungen auf einem Extrablatt, welches man bei der Ausreise aus Deutschland tunlichst verbarg und erst an der sowjetischen Grenze in den Pass hineinlegte. Da wir befürchteten, beim Verlassen der Botschaft festgenommen und durchsucht zu werden, knifften wir das wertvolle Dokument auf die Größe des Passbildes zurecht und klebten es in eine Verbandsattrappe an eine heikle Stelle unserer Körper. Um die Sache glaubwürdig erscheinen zu lassen, hatten wir der betreffenden Stelle schon vorher mit Hilfe einer Rasierklinge etwas Blut entlockt: Welch eine Symbolik!
EMIGRANTENALLTAG
Wenige Tage nach unserer Ankunft in Moskau suchten Walter und ich die Zentrale der Internationalen Roten Hilfe (MOPR*) auf, wo wir endlos lange Fragebögen ausfüllten, aufgrund derer wir dann als politische Emigranten anerkannt wurden. Von der MOPR erhielten wir jeweils 50Rubel als Überbrückungsgeld, das ich teils in russische Zigaretten (papirossy) und teils in «französische» Brötchen umsetzte (größere Schrippen zu 32Kopeken das Stück), die ich immer trocken und meist gleich nach dem Einkauf auf der Straße verzehrte.
Unsere drei wichtigsten Fragen, die zu klären sich die MOPR für uns bemühte, waren: Verpflegung, Unterbringung und Arbeit. Da Walter sehr bald (allerdings nur für kurze Zeit) als Übersetzer im Apparat der Roten Gewerkschaftsinternationale* unterkam und dort im Palast der Arbeit essen konnte, war nur ich auf die Kantine in den Kellerräumen eines Rote-Hilfe-Heims in der uliza Woronzowa angewiesen, wo es täglich eine kostenlose Mittagsmahlzeit gab.
Das Schönste an der Emigranten-Speisung war der tägliche Hin- und Rückweg, bei dem ich immer mehr vom Moskauer Stadtzentrum kennenlernte. Oft wählte ich den Weg über den Roten Platz, der auch nach meinem heutigen Verständnis ein großartiges Ensemble darstellt. Von dort aus schlenderte ich manchmal durch die winkligen Gassen der damals noch nicht abgerissenen Kitaj-Stadt (auch «Weiße Stadt» genannt), manchmal aber auch am Ufer der Moskwa entlang, oder ich folgte der Twerskaja bis zum Strastnoi-Kloster und ging dann über den nach der Straßenbahnlinie benannten A-Ring bis zu den Teichen Tschistye prudy.
Zu meinen ersten Eindrücken gehörte, dass die Straßen immer belebt und die Straßenbahnen stets überfüllt waren. Noch auf den Puffern drängelten sich die Leute. Auch an den Bushaltestellen wimmelte es von Menschen, die, sobald ein altersschwacher Leyland-Bus auftauchte, kreischend nach vorn drängten. Im Gegensatz zur Straßenbahn, wo eisern der Grundsatz hinten einsteigen, vorne aussteigen galt, hatte der Bus nur eine einzige Tür, und oft war es unmöglich, sich rechtzeitig einen Weg nach draußen zu bahnen. Die Sensation war ein Verkehrsmittel, das selbst in Berlin unbekannt war – der O-Bus, dessen große und natürlich auch übervollen Wagen mit flatternden roten Fähnchen die Twerskaja auf und ab sausten. Beim Anblick dieser nicht einmal im Kapitalismus vorhandenen Verkehrsmittel lachte mir das Herz, wollte ich doch überall Merkmale der Überlegenheit des Sozialismus ausmachen. Auf der Twerskaja gelang das halbwegs. Wenn es auch wenige Neubauten gab, so fesselten mich die in den Schaufenstern ausgestellten Projekte der geplanten Großbauten des Kommunismus. Es gab riesige Plakate oder Tableaus mit Zahlen zur Planerfüllung, die ich begeistert anschaute. Überhaupt konnte man auf den Straßen des Moskauer Zentrums einiges entdecken: Rotarmisten marschierten an großen Porträts von Bestarbeitern vorbei, Lesehungrige drängten sich vor den ausgehängten Zeitungen, Menschen mit Büchern unterm Arm besuchten Kirchen, die zu Bibliotheken umfunktioniert worden waren. Seltsam: Wenn ein Platzregen die Bürgersteige überflutete, zogen die Frauen und Mädchen ihre Schuhe aus und liefen unbekümmert barfuß weiter. Es gab keine Straßenfeger, dafür aber untätige dworniki, die, halb Portier, halb Hausmeister, mit einer Blechplakette am Revers herumstanden und irgendetwas bewachten – den Hof, die Abfallhaufen, vielleicht auch die Mieter. Autos, meist klapprige Fords oder Anderthalbtonner aus dem kürzlich eingeweihten Moskauer Autowerk AMO-SIL*, hatten Seltenheitswert. Fahr- und Motorräder schienen unbekannt zu sein. Weil es zumeist keine Gardinen gab, wirkten die Fenster der Wohnhäuser tagsüber leblos; aber auch abends, wenn man die von der Decke herabhängende Glühbirne sah, wirkten sie nicht gerade wohnlich.
Schockiert war ich über die Rationierung der Lebensmittel, von der ich in Deutschland nie etwas gehört hatte. Zwar gab es – für deutsche Verhältnisse – genügend Brot (500Gramm für die «Kopfarbeiter», im Unterschied zu den «Handarbeitern»), doch war das für russische Bedingungen, wo Brot früh, mittags und abends gegessen wurde, zu wenig. Außerdem konnte man sich in Moskau nur auf die Brotmarken verlassen, denn die übrigen Produkte wurden spärlich und oft genug gar nicht ausgehändigt, sodass viele Leute regelrecht hungerten. Ich empfand die Existenz des Kartensystems als bedrückend, redete mir aber mit Vokabeln wie «Bedarfsermittlung» und «Planvorlauf» ein, dass es bald verschwinden werde. Als das am 1.Januar 1935 tatsächlich geschah, atmete ich regelrecht auf – wieder hatte der Sozialismus einen Sieg errungen. Allerdings änderte das nichts an den riesigen Menschenschlangen vor den «Verteilern». (so wurden die Läden genannt), sobald es etwas zu kaufen gab. Erst mit der Zeit kam ich dahinter, dass sich selbst der Durchschnittsfunktionär – ich kannte nur solche – nicht ins Gedrängel stürzen brauchte, weil er seinen pajok (das wöchentliche Lebensmittelpaket) in einem Sonderladen erhielt, der von Zeit zu Zeit auch mal ein Stück Stoff beziehungsweise ein Paar billigere Schuhe gegen entsprechende Talons erhielt. Auf den Märkten, wo mit sauber gewaschenen Möhren, Kartoffeln oder Kohlköpfen gehandelt wurde, war alles – anders als in Deutschland – viel teurer als in den Geschäften.
In den ersten Monaten bummelte ich nicht zuletzt deshalb gern durch die Stadt, weil es bedrückend war, sich in dem Gemeinschaftszimmer aufzuhalten, das uns die MOPR im Hotel Passage zugewiesen hatte, da wir – als Nicht-Komintern-Zugehörige – das Lux bald hatten verlassen müssen. Dort standen sieben oder acht Betten, die zumeist von Politemigranten aus den Balkanländern belegt waren. Die ganze Einrichtung bestand aus ein paar Nachtschränkchen, einem Tisch und sechs Stühlen. Das einzige Fenster ging auf einen geräumigen, überdachten Hof hinaus, in dem Tag und Nacht (nachts bei grellem Scheinwerferlicht) an den Kulissen des nebenan befindlichen Meyerhold-Theaters gehämmert wurde.
Von allen Bewohnern des Hotels ist mir nur ein Genosse in Erinnerung geblieben. Er nannte sich Paul, hieß in Wahrheit aber Erich Ziemer und hatte das Privileg, ein, wenn auch winziges, Einzelzimmer zu bewohnen. Paul war ein Berliner Arbeiterjunge. Dass er eine abschnallbare Beinprothese trug, hing mit einem Ereignis zusammen, das eines seiner beliebtesten Gesprächsthemen war, sodass ich bald alle Einzelheiten kannte. Bei einer Demonstration am Berliner Bülowplatz am Tage des – später von der KPD verurteilten, damals aber von Faschisten und Kommunisten gemeinsam betriebenen – Volksentscheids zur Auflösung des preußischen Landtages am 9.August 1931 hatte Paul zusammen mit einem Genossen auf zwei besonders verhasste Polizeioffiziere geschossen und war selbst vom Gegenfeuer schwer verwundet worden. Die Offiziere waren am selben Tag verstorben, Paul war unter großen Schwierigkeiten über die Grenze gebracht worden. Was aus seinem Kumpel geworden ist, weiß ich nicht.1 Paul dürfte die Terrorjahre in Moskau kaum überlebt haben.
Nach einigen Monaten mieteten Mutter und Hans, die auf ihrem «Punkt Zwei» wie in einer Pension lebten, jedoch nicht übermäßig viel Geld bekamen, für uns Jungs ein Privatzimmer zum ortsüblichen Preis von 150Rubel (als ich Arbeit fand, betrug mein Monatsgehalt 90Rubel), wobei Hans nicht müde wurde zu betonen, dass dies nur zur Entlastung der Roten Hilfe geschehe. Unser Domizil, das wir gegen Jahresende bezogen, befand sich in einem – allerdings teilweise schon wieder verkommenen – Neubau in der Spasso-Naliwkowsi-Gasse unweit der Bolschaja Poljanka.
Als schwierigstes Problem erwies sich, eine Arbeitsstelle zu finden. Im Grunde hätte ich nach meiner Ankunft in Moskau die deutschsprachige Karl-Liebknecht-Schule* besuchen müssen. Da die Schule aber weder von meiner Mutter noch von meinem Vater, der inzwischen ebenfalls mit seiner Freundin in Moskau angekommen war, oder von der Roten Hilfe erwähnt wurde, kam ich nicht auf den Gedanken. Das ist mir heute unverständlich, da ich weder einen richtigen Schulabschluss noch einen Beruf besaß.
Mein Vater meinte, ich hätte doch in der Schule recht akkurate geographische Karten gezeichnet. Schon wenige Tage nach seiner Ankunft brachte er mich mit Hilfe eines Bekannten im Institut isobrasitelnoi statistiki (Isostat) unter, einer unmittelbar hinter der Lubjanka gelegenen Großwerkstätte für Propagandamittel. Die Probezeit bestand ich jedoch nicht. Ein im weißen Kittel herumflatternder Vorgesetzter drückte mir einen Kasten Gouache-Farben in die Hand und forderte mich auf, 144 in Zwölferreihen angeordnete Kreise abgestuft in den Regenbogenfarben anzupinseln. Ich brauchte dafür eine Woche, danach durfte ich gehen.
Mein Vater redete mir gut zu und vermittelte mir (wahrscheinlich mit Hilfe desselben Bekannten) einen zweiten Anlauf. Jedenfalls meldete uns irgendein einflussreicher Genosse bei Nadjeshda Krupskaja, der Witwe Lenins, die stellvertretende Volkskommissarin2 für das Bildungswesen war. Das Erste, was mich im Gebäude des Volksbildungskommissariats verblüffte, war der penetrante Geruch, das Zweite eine Bemerkung unseres Begleiters. Während wir im Vorzimmer der Krupskaja warteten, sagte er nämlich, ich solle, wenn wir hineingingen, die Mütze auf dem Kopf behalten, damit ich nicht servil wirke, denn das habe die alte Dame nicht gern.
Die Krupskaja sah genauso aus wie auf den Fotos. Ich glaube sogar, mich entsinnen zu können, dass sie eine blaue Bluse mit aufgedruckten schmalen weißen Streifen trug, genau wie auf den Kalenderbildern, die in den Buchläden feilgeboten wurden – nur dass sie steinalt und unendlich müde wirkte. Sie sprach einwandfrei Deutsch, allerdings so leise, dass ich mich zu ihr niederbeugen musste, um ihre Worte verstehen zu können. Sie befragte mich über meine Vorstellungen und erklärte zum Abschluss des fünf- oder zehnminütigen Gesprächs, dass sie sich meinetwegen mit einer alten Genossin in Verbindung setzen und diese mir Bescheid geben würde.
Diese Genossin war Maria Frumkina, Rektorin der «Kommunistischen Marchlewski-Universität der nationalen Minderheiten des Westens». (KUNMS)* und Ehefrau des stellvertretenden Außenhandelskommissars Moise Frumkin. Sie bestellte mich nach wenigen Tagen zu sich. Maria Frumkina war eine stark übergewichtige, kranke Frau, die ihre geschwollenen Beine nur mit Mühe durch die Korridore schleppte. Sie begrüßte mich ebenfalls in ausgezeichnetem Deutsch und bot mir an, mich als Lehrling in der Lehrmittelabteilung ihrer Hochschule einzustellen. Ich sagte zu.
Die KUNMS war im Gebäude des Deutschen Gymnasiums aus der Zarenzeit untergebracht. Sie war 1921 auf Initiative Lenins gegründet worden. Anfangs wurden vornehmlich Angehörige nicht russischer Sowjetvölker hier unterrichtet. Daneben gab es aber auch schon Fakultäten– Sektoren genannt – für Polen, Tschechen, Rumänen, Jugoslawen, Esten, Letten, Litauer. Zu meiner Zeit war der deutsche Sektor, in dem die aus Deutschland gekommenen Emigranten überwogen, zahlenmäßig der stärkste.
Erster Rektor der KUNMS war Julian Marchlewski (nach dem die Universität später benannt wurde). Er war sowohl Mitbegründer der deutschen Spartakusgruppe als auch der Polnischen Kommunistischen Partei und der Kommunistischen Internationale gewesen, gehörte der alten Garde der Revolution an und war noch zutiefst vom Geist des Internationalismus durchdrungen. Dies galt genauso für seine Nachfolgerin Maria Frumkina. Sie kam ursprünglich aus dem sogenannten Bund, dem Allgemeinen jüdischen Arbeiterbund (einer rechtssozialistischen jüdisch-litauischen Organisation), und war 1917/18 zu den Bolschewiki gestoßen. Nicht zuletzt solchen Persönlichkeiten war es zu verdanken, dass sich in der KUNMS bis in die dreißiger Jahre hinein Denk- und Verhaltensmuster der Revolutionszeit erhalten hatten. Der Umgangston war unprätentiös und denkbar einfach. Auf Titel und Orden wurde keinen Wert gelegt. Lehrer, Studenten und technische Mitarbeiter verkehrten gleichberechtigt miteinander, als Genossen. Selbst ich wurde in Gesprächen oder beim Sport (ich spielte eine Zeitlang in der Eishockeymannschaft des deutschen Sektors) von den Studenten genauso akzeptiert wie ein Dozent oder ein Gastlektor.
Mich verwunderte etwas, dass es auch einen jüdischen Sektor gab. In der kommunistischen Bewegung in Deutschland hatte man zwischen Juden und Nichtjuden keinen Unterschied gemacht. Später kam es mir auch merkwürdig vor, dass die jüdischen Dozenten, die natürlich allesamt nicht aus Moskau fortwollten, stets darauf aus waren, das jüdische Siedlungsgebiet im Fernen Osten, Birobidshan, in gutem Licht erscheinen zu lassen. Je mehr ich nämlich über das dortige raue Klima und den ewig gefrorenen Boden erfuhr, desto mehr zweifelte ich an dem Gerede von einer neuen Heimat für die russischen Juden – auch wenn ich mich für meine Zweifel schämte.
Rasch eignete ich mir die Fähigkeiten an, die man beim Zeichnen von Lageplänen, Diagrammen, Tabellen und diversen Schemata benötigt, qualifizierte mich sogar zum mittelmäßigen Kartographen. Besonders gern gestaltete ich den farbenfrohen Kopf und die bunten Artikelüberschriften der täglich für die Angestellten der KUNMS erscheinenden Wandzeitung Rabotschij byt («Arbeitsalltag», Zeitung der technischen Mitarbeiter: Heizer, Köche, Sekretärinnen, Zeichner usw.). Neben den offiziellen Leitartikeln enthielt die Wandzeitung auch teilweise herbe Kritik an den Unzulänglichkeiten im Arbeitsalltag und sogar an Leitungsmitgliedern, was ich als wesentlichen Bestandteil einer neuen, unmittelbar von den Werktätigen ausgehenden Demokratie betrachtete.
In der Lehrmittelabteilung wuchs ich in ein Kollektiv Moskauer Jugendlicher und damit in das russische Leben hinein. Ich wurde mit den Sorgen der Kollegen vertraut und lernte ihre kleinen Nöte kennen, die mal eine in der Wäscherei zerrissene Unterhose, mal das am Monatsende fehlende Geld betrafen. Die Zeichner, etwa acht oder zehn Leute, unterstützten mich, den manchmal begriffsstutzigen Emigranten, nach Kräften. Sie brachten mir russische Redewendungen, bisweilen auch obszöne Ausdrücke bei und amüsierten sich, wenn ich sie nachplapperte. Bei vielen Gelegenheiten erteilten sie mir Ratschläge, bemühten sich um meine fachliche Ausbildung und gaben mir Tipps, wenn ich in bürokratische Amtsstuben vorgeladen wurde. Ganz ernst wurden sie, wenn sie mir erklärten, warum bestimmte Missstände bis jetzt nicht abgestellt werden konnten. Da hörte ich aufmerksam zu, war ich doch an Erklärungen für mir häufig unverständliche Engpässe interessiert. Manches blieb mir jedoch schleierhaft. Als beispielsweise ein freiwilliger Arbeitseinsatz, ein subbotnik*, veranstaltet wurde, schleppte ich beschwingt Kartoffelsäcke aus einem Keller in den eines anderen Gebäudes (von kostenlosen Arbeitsleistungen hatte ich bereits bei Lenin gelesen), doch als beim nächsten subbotnik die Kartoffeln – noch dazu bei Regen und Matsch – wieder zurückgekarrt werden mussten, war meine Begeisterung dahin, und ich bezeichnete solches Hin und Her als sinnlos. Da aber unterstützten die Kollegen mich nicht: Der Lagerverwalter, meinten sie, wisse am besten, welche Keller für das Einlagern der Kartoffeln geeignet seien. Und überhaupt – das machte mich besonders stutzig – solle man sich nicht in fremde Arbeitsgebiete einmischen.
Trotz solcher Unstimmigkeiten tat mir das Arbeitskollektiv gut. Über gemeinsame Kino- und Kulturparkbesuche, auch durch gelegentliche Abende im Theater oder Konservatorium bildeten sich Interessengruppen, manchmal auch kleine Liebeleien, die sich jedoch nicht entfalten konnten, weil die Mädchen zu dritt oder viert in Zimmern betriebseigener Heime wohnten, wo der Empfang von Fremden streng verboten war.
Viele Schwierigkeiten in der roten Metropole waren Folge des herrschenden Platzmangels. Erst viel später begriff ich, dass diese Raumknappheit auf vielfältige Ursachen zurückging – auf die Bevölkerungsströme vom Land in die Stadt, die sich durch die Kollektivierung enorm verstärkten, auf die in Gang befindliche Industrialisierung, auf die ständig zunehmende Bürokratisierung und die Gründung neuer Institutionen, Ausschüsse, Komitees und Kommissionen. Zunächst sah ich lediglich, dass auch das Gebäude der KUNMS aus allen Nähten platzte und unser Zeichenbüro auf dem Rang der Aula untergebracht wurde. Das hatte den Vorteil, dass ich, während ich Linien zog und Flächen ausmalte, die Referate mithören konnte, die unten gehalten wurden. Meinen Russischkenntnissen kam das sehr zugute. Häufig wurden aber auch Vorträge auf Deutsch gehalten, bei denen ich so manches über die Geschichte des Bolschewismus, die internationale Lage oder die von bürgerlichen Politikern des Westens versuchte (und natürlich zum Scheitern verurteilte) Krisenbewältigung lernte.
In der ersten Moskauer Zeit verbrachte ich meine Abende häufig im «Klub ausländischer Arbeiter»* in der uliza Gerzena (im Gebäude des heutigen Revolutionstheaters), der einer besinnlichen Oase in der brodelnden Stadt glich. Während sich sonst auf den Plätzen und Boulevards, in den Straßen und Gassen Hektik, Hast und Schmuddligkeit breitmachten, konnte man in den weitläufigen Räumen des Klubs durchatmen. Der Klub war die ganze Woche hindurch bis spät in die Nacht geöffnet und immer gut beheizt. Es gab einen Lesesaal, den man nur flüsternd betrat, ein durch seine Stille einschüchterndes Schach- und Billardzimmer, ein als Rauchsalon aufgemachtes Kabinett für intimere Plaudereien und den großen Saal, in dem allabendlich Kinovorführungen und Vorträge stattfanden. Anziehend war zudem die preiswerte Imbissstube, wo man günstig Tee (ungesüßt) und einen Happen zu essen bekommen konnte. Zur Auswahl standen meist nicht mehr als Rote-Rüben-Salat und Marmeladenschnitten, für die man allerdings hier keine Brotmarken abgeben musste.
Vor allem war der Klub, in dem zumeist Deutsch gesprochen wurde, eine Stätte der Begegnungen. Man traf in Moskau lebende Emigranten oder solche, die gerade aus Deutschland angereist waren und etwas über die Situation und die Stimmung in Berlin berichten konnten; man traf aber auch deutsche Berg- oder Stahlwerker aus dem Donbass, die nur ein paar Tage in der Hauptstadt waren und unwahrscheinliche Dinge über die geheimnisumwobenen Weiten des Landes erzählten, oder unpolitische Spezialisten, die von uns bürgerlich genannt wurden.
Die politische Prominenz verkehrte nicht im Klub. Leute wie Pieck und Ulbricht, auch Becher und der kurzfristig in Moskau weilende Brecht waren in der Regel besser untergebracht als wir und konnten ihre Freunde zu Hause empfangen. Immerhin sah ich zuweilen Gustav von Wangenheim, der eine Zeitlang mit einer Laientruppe ein neues Stück inszenierte, oder den Dramatiker Friedrich Wolf, der manchmal von seinen laut in den Räumen herumtollenden Söhnen begleitet wurde – Konrad, dem späteren Filmregisseur und Präsidenten der Akademie der Künste der DDR, und Markus, dem nachmaligen Spionagechef unserer Republik.
Mein Kontakt im Klub beschränkte sich allerdings auf gewöhnliche Sterbliche, meist deutsche Jungkommunisten, die jetzt als geschätzte – und natürlich gut bezahlte – Facharbeiter im neu errichteten Moskauer Kugellagerwerk, bei AMO (später Stalin-Autowerk) oder in anderen Großbetrieben tätig waren.
Obwohl 80 bis 90