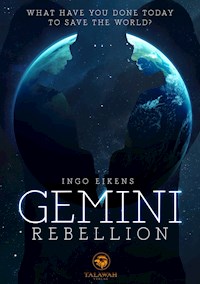
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Talawah Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
„Machen Sie sich keine Sorgen, Sir. Wenn Sie eine Kasko haben, zahlt das sogar die Versicherung. In Ohio zählt das, glaub ich, wie ein Wildunfall.“ Russel sah den Cop entgeistert an. Die Gestalt am Straßenrand lag leblos unter der Folie, die in Wind und Regen flatterte. Zum ersten Mal spürte er, was es wirklich bedeutete, eine legale ID zu besitzen. War das gerecht? Plötzlich erschien ihm alles, was er herausgefunden hatte, in einem völlig anderen Licht. War ein unbedeutender Reporter wie er wirklich in der Lage die Menschheit vor sich selbst zu retten? * Wenn die Welt überbevölkert ist, Lebensmittel aus sterilen Farmen kommen und man zum Leben eine legale ID besitzen muss – welche Perspektiven bieten sich den Menschen dann noch? In einer Zukunft, in der Städte zu Megaplexen zusammengewachsen sind, spielen Moral oder das Leben eines Einzelnen kaum noch eine Rolle, erst Recht nicht, wenn es darum geht, etwas viel Größeres zu verbergen. Der Reporter Russel Brand stößt auf ein finsteres Geheimnis und muss erkennen, dass auch sein Leben in Gefahr ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Besuchen Sie uns im Internet:
www.talawah-verlag.de
www.facebook.com/talawahverlag
erschienen im Talawah Verlag
1. Auflage 2019
© Talawah Verlag
Text: Ingo Eikens
Umschlaggestaltung:Marie Graßhoff
www.marie-grasshoff.de
Lektorat: Sandra Florean
www.sandraflorean-autorin.blogspot.com/
Satz / Layout / eBook: Grittany Design
www.grittany-design.de
ISBN:978-3-947550-34-0
Das altehrwürdige Steingebäude mit seinen gotischen Fenstern und Schnitzereien erinnerte Russel an die Feudalzeit. An Herrscher und Beherrschte, an große Fürsten und reiche Kaufleute. Und doch war es zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts in Erinnerung an die alten britischen Gerichtsgebäude entworfen worden. Einem Sinnbild für Recht und Gerechtigkeit.
Für das heutige Interview bot es eine spektakuläre Kulisse. Im begrünten Innenhof warfen die seitlichen Gebäude noch lange Schatten, aber das Hauptmotiv erstrahlte bereits in der aufgehenden Sonne. Etwas nervös nahm er das Mikrofon zur Hand, fuhr sich noch einmal durch die kurzen, braunen Haare und wartete gespannt auf die Geste des Kameramanns. Da war sie. Er wandte sich an seinen Interviewpartner.
„Guten Morgen, mein Name ist Russel Brand von United American Networks. Ich stehe heute vor dem Sterling Law Building der renommierten Yale-Law School in New Haven zusammen mit dem Senator des Staates Connecticut, Mister Theodore Myers. Guten Morgen, Sir.“
„Guten Morgen, Russel. Ich freue mich, dass wir heute vor einem der bekanntesten Wahrzeichen unseres Staates miteinander sprechen können.“
„Vielen Dank für ihre Bereitschaft zu diesem Interview. Stimmt es, dass sie selbst hier studiert haben?“
„Ja, das ist richtig.“ Der Senator zeigte im Blitzlichtgewitter sein werbewirksamstes Zahnpastalächeln. Jetzt nur keine Zeit verlieren, dachte er. Um den Politiker in aller Öffentlichkeit zu konfrontieren blieben ihm vielleicht nur wenige Sekunden, aber er hoffte, dass der Sender sensationsgeil genug war. Immerhin waren sie live.
„Mister Myers. Die laufenden Verhandlungen über eine Legalisierung der neuesten Nahrungsmittelerzeugnisse aus genetisch verändertem Biomaterial schlagen derzeit große Wellen. Es wurde schon früher in vielen Reportagen auf die Risiken hingewiesen. Umso schlimmer empfinden Kritiker nun die erneuten Verhandlungen über eine Zulassung. Ist es nicht korrekt, dass sie als Befürworter von Gen-Food bereits mehrfach in der Vergangenheit mit ernsthaften Bedenken konfrontiert worden sind?“
„Wissen Sie, Russel, die Debatte um Gen-Food zieht sich nun schon über Jahrzehnte hin. Innerhalb des letzten Jahrhunderts hat man immer wieder gegen die genetische Veränderung von Pflanzen gewettert, ohne sich auf die Vorteile einer derartigen Manipulation einzulassen. Wir sind heute der einhelligen Meinung, dass die genetische Mutation nicht mehr ist als eine Beschleunigung der natürlichen Evolution.“
„Und dennoch hat es heute wie damals immer wieder Hinweise gegeben, dass Gen-Food auch Risiken birgt. Insbesondere in der Form, wie wir es in den letzten zehn Jahren verstärkt gesehen haben. Sogar hier an der Yale Universität“, unterbrach Russel und beobachtete ihn aus zusammengekniffenen Augen. Er deutete ein Lächeln an.
Der Senator straffte sich und schwieg.
„Der ausgeprägte Lobbyismus hat zu einer sinkenden Transparenz der Herstellungsverfahren für die Verbraucher geführt, was letztlich den Konzernen freie Hand bei der Generierung der Lebensmittel lässt. Mangelnde staatliche Sicherheitskontrollen führen uns in eine Situation, die den Normalbürger einer möglichen Gesundheitsgefahr aussetzt“, fuhr Russel ungerührt fort.
Myers schüttelte vehement den Kopf und schwenkte abwehrend die Hände. „So können Sie das nun auch nicht darstellen, die staatlichen Kontrollen für diese Produkte sind …“
„Dann sind sie also nicht darüber informiert, dass es in der jüngeren Vergangenheit Krankheitsfälle gegeben hat, die sich unmittelbar mit Erzeugnissen der neuesten Gen-Food-Generation in Zusammenhang bringen lassen? Bedenkt man die weitreichenden Folgen, zöge das ernsthafte Konsequenzen für den Gen-Food-Sektor nach sich. Stimmen Sie dem zu?“ Seine Frage durchschnitt den Einwand des Senators wie ein heißes Messer weiche Butter.
Die Blitzlichter setzten für einen Moment aus. Myers begann sichtlich zu schwitzen. Russel war sich sicher, dass jetzt niemand mehr abbrechen würde. Das war es, was die Leute sehen wollten, die Chance, auf die er gewartet hatte – die Story, die ihn berühmt machen würde.
Dutzende Mikrofone reckten sich den beiden entgegen. Myers Gesicht nahm eine rötliche Färbung an. Er räusperte sich und versuchte, eine Erklärung anzubringen.
„Die Frage … die Frage zielt auf, äh … Einzelfälle genetischer Mutationen ab. Hierbei ist nicht erwiesen, dass Gen-Food für diese Vorfälle verantwortlich gemacht werden kann. Was genau soll …“
„Dann bestreiten Sie, dass es Fälle gegeben hat, die zu Unfruchtbarkeit geführt haben?“ Russel schoss die Frage ab wie ein Scharfschütze, der in der Deckung seines Gegners nach Schwachstellen sucht. Nicht argumentieren lassen – treib ihn weiter. „Oder ist es nicht so, dass die Risiken, die sich hinter der letzten Gen-Food-Generation verbergen vor dem Hintergrund dieser neuesten Erkenntnisse eine immense Gesundheitsgefahr darstellen? Es gibt sogar Stimmen, die vermuten, sie könnten die Veränderung des menschlichen Genoms bewusst in Kauf genommen haben.“
Die Reporter zwischen den Kameraleuten drängten sich nach vorn. Entweder redete sich Russel gerade um Kopf und Kragen, oder sie wurden soeben Zeugen der größten Story des Jahrhunderts. Myers schien nicht gewillt zu sein, weiter auf ihn einzugehen, und feuerte zurück.
„Ihre Frage ist sensationsheischend und unprofessionell, Mister Brand. Man hat mir versichert, dass wir ein sachliches Interview zum Thema führen. Wenn Sie also sachliche Fragen aufbringen können bin ich gerne bereit, …“
Der Panzer des Mannes bröckelte, und die Haie lechzten nach einer Story. Er spürte, dass er kurz davor stand, den Typen zu knacken. Er durfte Myers jetzt auf keinen Fall von der Angel lassen.
„Ich glaube, unsere Zuschauer sind nicht der Meinung, dass die Gefährdung künftiger Generationen unsachlich ist. Sie sind also nicht bereit, vor der Öffentlichkeit die potentielle Gefährlichkeit des Gen-Foods der letzten Generation einzuräumen? Ist es nicht so, dass eben diese Haltung die Vermutung nahelegt, diese genetischen Mutationen seien einkalkuliert?“
Erschrockenes Einatmen aus der Menge war zu hören. Die erneute Unterstellung war gewagt und schlicht ungeheuerlich. Er wusste es, sah aber keine andere Möglichkeit, den Politiker in der Defensive zu halten. Zu allem Übel fehlten Russel für diese Behauptung stichhaltige Beweise. Trotzdem wollte er den Senator irgendwie aus der Reserve locken. Das war Sensationsjournalismus, wie er ihn normalerweise verabscheute, aber eine zweite derartige Gelegenheit würde Russel so schnell nicht wieder bekommen.
Myers schien sichtlich angeschlagen. Die Stille währte fast zwei Herzschläge. War er zu weit gegangen?
„Ich … was?“ Der Senator sah sich hilfesuchend nach jemandem außerhalb des Bildes um. Russel nahm sein Zögern als Ermutigung und setzte sofort nach.
„Stimmen Sie mir zu, dass die Regierung sich hier mitschuldig an einer Gefährdung der Weltgemeinschaft macht, indem sie die Unfruchtbarkeit nachfolgender Generationen billigend in Kauf nimmt?“
„Blödsinn …“
„Dann wissen Sie also nichts von Fällen genetischer Veränderungen entlang der gesamten Ostküste, die sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf besagtes Gen-Food zurückführen lassen? Insbesondere bei Kindern und jungen Erwachsenen?“
Fassungslosigkeit gepaart mit hilfesuchenden Blicken gaben Russel recht. Er hatte Oberwasser. Doch bevor er noch einmal nachsetzen konnte, hob jemand außerhalb des Bildes ein Schild hoch, und Myers atmete beinahe hörbar auf. Russel versuchte, mit einem Seitenblick zu entziffern, was darauf stand, doch da war das Schild bereits wieder verschwunden. So unsicher er eben noch gewirkt hatte, so plötzlich veränderte sich die Haltung des Politikers, und er strahlte beinahe wieder die gewohnte Stabilität aus. Mit ernster und wütender Miene nahm er ihn ins Visier.
„Mister Brand, ihre Theorie entbehrt jeder Grundlage und ist obendrein schlecht recherchiert. Die Vorfälle an den Schulen haben erwiesenermaßen nichts mit der Gen-Food-Debatte zu tun, sondern werden von sensationsheischenden Reportern, wie Ihnen, nur als willkommenes Vorschubsargument benutzt. Renommierte Institute haben die Vorfälle gründlich untersucht und einhellig erklärt, dass das Gen-Food der letzten Generation keinerlei Einfluss auf den Gesundheitszustand der Menschen hat. Die vorliegenden Expertisen belegen das.“
Russel versuchte, eine Frage anzubringen, doch diesmal ließ ihn der Senator nicht zu Wort kommen. „Unser Senat hat sich monatelang mit dem Thema beschäftigt und die Ergebnisse aller Institute ausgewertet. Der Sonderausschuss, der über die Freigabe von genetisch veränderten Lebensmitteln berät, stand in Kontakt mit führenden Wissenschaftlern auf der ganzen Welt. Warum denken Sie also, hat sich dieses Gremium letztlich für eine Zulassung der neuesten Gen-Food-Generation entschieden?“
Russel erstarrte. Für einen kurzen Moment setzte sein Herzschlag vor Wut aus.
Weil sie alle gekauft sind.
Das überlegene Lächeln im Gesicht seines Gegenübers überzeugte ihn davon, dass der Politiker dieses Mal ganz sicher nicht log.
„Ganz recht, Mister Brand. Soeben ist die Entscheidung bekanntgegeben worden. Denken Sie nicht, dass angesichts einer Gefährdung, wie Sie sie beschreiben, dieses Gremium Abstand davon genommen hätte, die letzte Generation von Gen-Food in Umlauf zu bringen?“ Er wandte sich wieder an die Kameras. „Ladies und Gentlemen, die einzige Möglichkeit, die weltweite Nahrungsknappheit zu bekämpfen, besteht in der Sorge um die Menschen und der Versorgung mit Nahrungsmitteln aus sicheren Quellen. Die neuartigen Produktionsmethoden stellen eben dies sicher.“ Zu Russel gedreht fügte er hinzu: „Ich sehe in haltlosen Verschwörungstheorien, wie Sie sie propagieren, eine viel größere Gefährdung des Allgemeinwohls. Wenn Sie mich nun entschuldigen würden, meine Damen und Herren.“
Das folgende Blitzlichtgewitter und die aufgeregten Rufe der anderen Reporter, die dem Senator nachströmten und ihn mit Fragen bestürmten, verschwanden mit dem Politiker auf dem Campusgelände.
Lewis bedeutete Russel mit einer Geste, dass sie raus waren, und er ließ geschockt das Mikro sinken.
„Fuck …“
Der Kameramann war mit drei schnellen Schritten bei ihm und gab ihm einen Schluck Ersatzkaffee. Die Brühe war kalt und schmeckte ekelhaft. Russel spuckte den Mist in die Blumen.
„Trinkst du immer noch diese Soja-Ersatzscheiße? Mann, hört mir eigentlich keiner zu?“
Lewis sah ihn unschuldig an und zuckte mit den Schultern. „Du hast ihn doch gehört – die Gen-Food-Debatte ist gelaufen. Außerdem kann ich mir bei meinem Gehalt keinen echten Kaffee leisten.“
Sie gingen zusammen zurück zum Ü-Wagen, und Lewis verstaute die Ausrüstung. Russel saß auf dem Beifahrersitz und ließ die Beine aus der offenen Tür baumeln. Sein mobiler Kommunikator klingelte pausenlos, doch er starrte nur abwesend auf die Stelle, an der der Senator ihn stehen gelassen hatte.
„Ich dachte echt, ich hätte ihn soweit. Mann, hast du gesehen, wie er ins Schwitzen gekommen ist? Ich hatte ihn, verdammt.“
Lewis´ Kopf kam neben der Schiebetür zum Vorschein. „Klar hab ich´s gesehen. Ich war der Typ hinter der Kamera, falls du das vergessen hast. Übrigens, willst du nicht rangehen?“ Er deutete auf das tanzende Gerät.
Russel zuckte die Schultern. „Wozu? Das ist sicher Liz, die mir sagen wird, dass ich die ganze Story abblasen soll.“
„Dann bring es lieber gleich hinter dich – Liz ist ziemlich unangenehm, wenn man sie warten lässt. Du kennst sie doch.“
Der Aufschrei aus dem kleinen Lautsprecher war sogar noch für Lewis zu hören, der gute zwei Meter entfernt stand. „BRAAAAAND! Sind Sie jetzt vollkommen irre geworden?“
Er behielt Nerven und antwortete freundlich und unverbindlich. „Hallo Melissa! Ich freue mich auch, Sie zu sprechen.“
Der Tonfall seiner Chefin erinnerte Russel an den einer Kreissäge, die sich in dünnes Metallblech fraß.
„Die Scheiße können Sie sich gleich sparen. Ich glaube, Sie haben heute Morgen ihre Tabletten nicht genommen, oder was?“
Russel erwiderte unschuldig: „Was genau meinen Sie? Ich hatte ihn fast so weit. Hören Sie, Liz, die Untersuchungen der Institute sind doch getürkt. Oder nehmen Sie ihm die Geschichte mit der Zulassung etwa ab? Ich glaube, das haben die ihm zugespielt, damit er aus der Nummer rauskam. Ich bin sicher, wenn wir ihn …“
Melissa schäumte. Sie hatte die Bildübertragung abgeschaltet, damit es für ihn schlimmer war, sich vorzustellen, wie sauer sie wirklich war. Er konnte ihre Schritte durch die Leitung hören. Sie tigerte anscheinend in ihrem Büro auf und ab. „Myers ist vielleicht ein Vollidiot, aber er hat Sie auflaufen lassen, Russel. Auflaufen! Verstehen Sie?“
Bevor sie weiter wettern konnte, unterbrach Russel seine Chefin und gestikulierte heftig mit der freien Hand, ungeachtet der Tatsache, dass sie ihn nicht sah.
„Melissa. Melissa! Jetzt kommen Sie doch mal runter, verdammt. Die Story ist heiß, sag ich Ihnen. Ich hatte ihn fast so weit, dass er sich verplappert. Die Sache ist hier ziemlich hochgekocht. Ich habe Eltern, die mit …“
„Russel. Einen verdammten Scheiß haben Sie! Die paar Kinder mit Hodenkrebs, die sie da rausgekehrt haben, sind mir verflucht nochmal egal. Sie haben soeben einem Senator offen ans Bein gepisst, der einer Lobby von einflussreichen Industriellen und Politikern angehört. Diese Leute sind wahrscheinlich schon morgen auf allen Kanälen und lassen die biblische Speisung der Hungernden durch Jesus aussehen wie ein Sonntagspicknick! Mir liegen ein halbes Dutzend Meldungen über Flugzeuge voll mit Genfutter von Pan Tech vor. Ziel Afrika. Von den landesweiten, öffentlichen Verteilungen an ID-Lose anlässlich der globalen Zulassung ganz zu schweigen.“
„Das ist es, was ich meine. Sehen sie nicht, dass dahinter nur eine groß angelegte Publicityaktion steht? Genau das wollen die doch. Die Öffentlichkeit soll sich über diese Scheiße auch noch freuen! Liz, ich sage Ihnen, da steckt etwas dahinter – etwas Übles.“ Er schlug mit der Faust auf die Konsole des Ü-Wagens. Wollte Melissa nicht einsehen, dass das die Chance war, eine echte Verschwörung aufzudecken?
„Alles, was ich sehe, sind ihre Halluzinationen, Brand. Sie bringen unseren Sender in Verruf. Ich habe in den letzten Minuten zwei Anrufe bekommen. Einen vom Justizministerium und einen vom Büro des Senators. Die Unterlassungsklage ist schon vorbereitet, und man hat mir mitgeteilt, dass ich dafür sorgen soll, dass Sie sich an der Ostküste nicht mehr im Holo blicken lassen.“
„Was soll das heißen? Wo soll ich denn hin?“ Russels Magen revoltierte.
„Das ist mir doch scheißegal. Wenn sie Glück haben, finden Sie ihre Sachen noch in einer Kiste. Holen Sie sich ihre Unterlagen in der Personalabteilung, aber kommen Sie mir ja nicht mehr unter die Augen“, fauchte sie. „Lewis soll sich bei Taylor melden, er ist an der Sache mit dem Öllager in Cincinnati dran. Sein Ticket liegt am Flughafen.“
Das klang verflucht endgültig für seinen Geschmack. Russel spürte, wie er den Boden unter den Füßen verlor.
„Sie schmeißen mich raus? Melissa, das können Sie nicht machen, die Story …“
„Was denn für eine Story?“ Melissas Tonfall war gedehnt und troff vor Spott. „Die Leute wollen Weltgeschehen oder Glamour – mehr interessiert diesen sensationsgeilen Mob da draußen nicht. Und ich will Einschaltquoten und Leser.
Vorgestern hat ein Typ in Philly zwölf Menschen geköpft und dabei Frauenkleider getragen. Sowas verkauft sich bis nach Japan. Kapieren Sie´s doch, Russel. Sie sind nicht nur unglaubwürdig, sondern auch nicht mehr tragbar. Ihr Bedenklichkeitsscheiß kostet mich ein Vermögen. Die Klagen von Myers und Pan Tech noch gar nicht mitgerechnet.“
„Aber …“
Die Verbindung wurde abrupt unterbrochen. Für Melissa war das Thema beendet.
„Fuck!“
Hey Larry, gib mir ein Bier, ja?“
Sie musste schreien, um gegen die dröhnende Musik und das Stimmengewirr anzukommen. Das rundliche Gesicht des Barkeepers schob sich durch den Tabakqualm wie durch dichte Nebelschwaden auf sie zu. Das Glas kratzte über die alte Edelstahloberfläche des Tresens, der Inhalt schwappte leicht über den Rand.
„Hey Susi! Geht aufs Haus. Tut mir leid, das mit deiner Mutter.“
Sie sah in die von vielen Runzeln und Fältchen umrahmten Augen, in denen sie sein Mitgefühl deutlich erkennen konnte. Müde winkte sie ab und nippte an ihrem Getränk. Ihr stand nicht der Sinn nach Familiengeschichten. Eine kurze Trauerfeier in der Charity Church, Händeschütteln, traurige Gesichter und eine lustlose Predigt eines resignierten Geistlichen. Das war alles, was ihre Mum zum Abschied von dieser Welt bekommen hatte. Irgendwann hatte sie es nicht mehr ausgehalten. Sie hatte weggemusst, und das Billbow´s Inn war nur eine von zahlreichen Anlaufstellen im Squatter, um den Schmerz zu betäuben. Larry war ein alter Freund, hatte stets ein offenes Ohr und bedrängte sie nie. Doch jetzt war nicht der Zeitpunkt zum Reden.
In dem Sumpf aus Tabakqualm, lauten Bässen und den Ausdünstungen der Tänzer nahm sie sich aus wie eine Statue. Unentwegt starrte sie auf das halbleere Glas und bemerkte nur nebenbei die Gruppe junger Männer, die mit großem Aufruhr die Bar betraten. Ein Junggesellenabschied, wie es schien. Laut singend und mit Sweatshirts bekleidet, auf denen irgendein dämlicher Spruch über den Abschied aus der Freiheit stand.
Freiheit – pah! Sie versuchte, an etwas anderes zu denken, sich abzulenken. Das Glas. Das Bier. Der Tresen. Ihre Mutter. Freiheit. Leben. Die Junggesellen. Verdammt!
Diese verdammten Arschlöcher. Toll. Da hatte wieder einer ausreichend Geld gespart, um sich eine legale Ehe und vielleicht sogar ein Kind leisten zu können. Klar war das ein Grund zum Feiern. Aber warum hier? Warum jetzt?
Sie erinnerte sich an ihre Mutter. An ihr trauriges Lächeln. An ihre Opferbereitschaft. An Jahre voller Arbeit für das Leben ihres Kindes.
Für sie.
Wie Streiflichter tauchten die Momente ihres Lebens und die Bilder ihrer Kindheit aus der Erinnerung auf. Schulaufgaben an der schmutzig weißen Kunststofftheke. Der Geruch von Nudeln und gekochtem Gemüse. Hühnerfleischsurrogat aus der Kühlung des Wagens. Und der kleine Verschlag dahinter mit der armseligen Matratze. Hier schliefen sie zu dritt, eingekuschelt in die Arme ihrer Mutter, wenn sie sich nachts zu ihnen schlich, noch immer mit den Kochgerüchen in den Kleidern.
Kochgerüche. Gerüche. Tabakqualm. Die Realität holte sie zurück, und sie erschrak. Neben ihr ließ sich plötzlich eine schlanke Frau rücklings auf den Barhocker fallen. Die Arme weit auf dem Tresen ausgestreckt, lachte sie laut auf und stieß einen aufdringlichen Feiernden mit dem Fuß weg. Sie seufzte und grinste breit.
Von der Kleidung abgesehen war es, als blicke Susanne in einen Spiegel. Das schmale, hübsche Gesicht der Frau war auffällig geschminkt, mit Smokey Eyes, betonten Wimpern und vollen Lippen in ausdrucksstarkem Rot. Die blasse Haut wirkte beinahe vornehm – ein Eindruck, den sie beide durch die freche Kurzhaarfrisur wettmachten. Die rechte Kopfhälfte war bis über das Ohr ausrasiert – die übrigen Haare im kecken Schwung auf die linke Seite gekämmt. Nicht nur äußerlich hatten sie viel gemeinsam. Seit ihrer Kindheit teilten sie ihr armseliges Leben – denn nur eine von ihnen hatte eine Chance auf eine normale Existenz mit einer ID und einer verschissenen Steuernummer.
„Hey Susi! Nein, verdammt nochmal, verpiss dich endlich.“ Ihr Spiegelbild lachte und stieß ihren Verehrer ein weiteres Mal weg. Er zwinkerte ihr lüstern zu und trollte sich grinsend.
„Susi. Kleines. Alles klar?“
Sie fuhr herum und funkelte ihre Zwillingsschwester zornig an.
„Was?“ Trotzig schob die das Kinn vor und winkte Larry nach einem Drink.
„Wo, verdammt noch mal, warst du die letzten zwei Monate? Ich hab dich gesucht“, zischte Susi. „Aber du treibst dich ja lieber mit irgendeiner Gang im Sprawl rum, anstatt dich mal wieder zu Hause blicken zu lassen.“
Schon früh war klar gewesen, dass ihrer Schwester das Leben auf der anderen Seite der Gesellschaft leichter fiel. Sicher hatte es ihre Mum nur gut gemeint, aber Zwillinge ohne die teure Sondergenehmigung zu gebären … weiß Hades, was sie dem schmierigen Beamten alles gegeben haben musste, damit er den Mund hielt.
„Ach, komm schon – jetzt mach hier nicht einen auf besorgte Schwester. Als ob es Dich kümmern würde, wo ich mich rumtreibe. Oder hat Mum wieder mal s…“
„Mum ist tot“, platzte Susi heraus.
Das Grinsen auf dem Gesicht ihrer Schwester erstarb und wich schockierter Fassungslosigkeit.
„Wir haben sie heute Mittag in der Charity Central verbrannt.“
Erschüttert wich ihre Schwester zurück. Susanne streckte den Arm aus, um sie aufzuhalten, doch ehe sie sie greifen konnte, hatte die sich auf dem Stiefelabsatz umgedreht und stürmte ohne ein weiteres Wort aus der Bar.
„Claire …“
Das hatte sie nicht gewollt, aber die Wut und Enttäuschung über Claires ewig lockere Art waren einfach zu viel gewesen. Trotzig funkelte sie ihr nach. Sollte sie ruhig auch einmal einen Eindruck davon bekommen, wie sie sich fühlte.
Susi sah ihrer Schwester frustriert nach und verwarf den Gedanken daran, ihr nachzulaufen. Claire war in dieser Stimmung sowieso unberechenbar – was das anging, waren sie sich zu ähnlich.
Sie stürzte das Bier in einem Zug hinunter und zog Claires Glas zu sich heran. Der ölig schwarze Inhalt roch stark und zog breite Schlieren an den Rändern des Glases. Susi rümpfte die Nase, nippte an der Flüssigkeit und verzog das Gesicht. Es schmeckte herb, nach Kräutern, gleichzeitig scharf und feurig mit einer süßen Note. Eigentlich gar nicht so schlecht, dachte sie, und nippte ein zweites Mal. Langsam verstand sie Claires Vorliebe für Kräuterschnaps. Das Zeug war ein echter Seelentröster, und Susi nahm einen größeren Schluck.
Der Drink breitete eine wohlige Wärme in ihrem Inneren aus, vertrieb ein wenig die abgrundtiefe Trauer und den Schmerz.
Vielleicht war Claires Wahl nicht die Schlechteste? Sie lebte einfach von einem Tag zum anderen, machte sich keine Gedanken um die Zukunft, Steuern und Einkünfte, oder den schmalen Grat zwischen Behörden und örtlicher Gang, wenn es darum ging, einen sicheren Standplatz für die Garküche zu finden.
Susi kippte den Rest des Drinks hinunter und winkte Larry mit dem leeren Glas. Der alte Mann schlurfte zu ihr hinüber, wischte gewohnheitsmäßig mit dem fleckigen Lappen über die Theke und setzte sein mahnendes Gesicht auf.
„Bist du sicher, dass du noch einen willst, Kleines? Das Zeug ist nicht ohne, und du hast nicht die Leber deiner Schwester.“ Er nahm ihr das Glas aus der Hand und holte langsam unter der Theke eine angebrochene Flasche ohne Label hervor.
„Schenk verdammt nochmal nach, Larry. Ich brauch heute echt keine Predigten mehr.“
Sein Gesicht nahm einen seltsam schwammigen Ausdruck an, und Susi schüttelte sich. Der Schnaps begann erschreckend schnell, ihre Sinne zu benebeln.
„Schon gut, ich bin ja nicht dein Beichtvater, aber du solltest mit dem Zeug aufpassen, wenn du es nicht gewöhnt bist.“
Ungeduldig winkte sie ab, entriss ihm die Flasche, goss sich selbst eine großzügig bemessene Menge nach und kippte das Zeug runter.
Sie beobachtete eine Weile, wie die Luftfeuchtigkeit am eiskalten Glas der Flasche zu großen Tropfen kondensierte, sich sammelte und schließlich in kleinen Rinnsalen auf die Theke zu rinnen begann. Larry wollte die Flasche wegräumen, doch sie hielt sich daran fest wie eine Ertrinkende. Trübselig fuhr sie mit Finger die Wasserspuren nach.
Was genau tat sie da? Das war doch sonst nicht ihre Art. Larry war immer freundlich zu ihr gewesen, sie hatte keinen Grund, ihn anzufahren. Dieses Zeug machte einen anderen Menschen aus ihr. Etwas wackelig schob sie den Flaschenhals wieder über den Rand des Glases und sah zu, wie die schwarze Flüssigkeit hinein gluckerte. Larry sah sie besorgt an, nahm ihr die Flasche ab, bevor sie die Theke überfluten konnte, und griff nach dem Glas.
Trotzig zog sie den randvollen Tumbler näher heran, und ein Teil des Alkohols schwappte über den Rand.
„Da siehst du …“, lallte sie mit schwerer Zunge. „Das ist nur deine Schuld.“
Larry schüttelte nur schweigend den Kopf, verkorkte die Flasche wieder sorgfältig und ließ sie außerhalb ihrer Reichweite und außer Sicht verschwinden.
Susi blinzelte und versuchte, seinen Bewegungen zu folgen, aber er war einfach zu schnell. Sie hatte bemerkt, dass sie undeutlich sprach, und es fiel ihr immer schwerer, den Blick zu fokussieren. Der Alte hatte nicht gelogen, was den Drink betraf, oder sie vertrug ihn schlichtweg nicht. Ein lustiges Prickeln überzog ihr Gesicht. Mehr und mehr entglitt ihr die Kontrolle über ihren Körper, und die Bar begann, sich zu bewegen.
„Da ist ja unser Mäuschen …“, lallte jemand hinter ihr, und Claires Verehrer tauchte mit alkoholschwangerem Atem neben ihr auf. Er schwankte genauso wie der Rest der Bar und musste sich mit einer Hand am Tresen festhalten. Susi lachte ihn aus – als ob das etwas bringen würde, wo die Theke doch selbst langsam anfing zu schwanken.
Der Typ nahm ihr Lachen als Aufmunterung. „Willst du dich nicht ssssu uns setzen, Schätzchen?“
Susi blinzelte, drehte sich schwerfällig zum Tisch der Junggesellen um und beäugte die Feiernden. Was brachte es denn, sich in Selbstmitleid zu vergraben, wo sie es Claire doch nachtun und sich einfach vom Schmerz ablenken könnte? Der Alkohol löste auf angenehme Weise ihre Hemmungen, und sie beschloss, dass es Zeit war, ihr verfluchtes Spießbürgerdenken zum Hades zu schicken. Sie trank einen großen Schluck, um unterwegs nicht noch mehr des kostbaren Gesöffs zu verlieren, und legte den freien Arm um die Schultern des Mannes. Der Weg zum Tisch fühlte sich an wie ein Marathon. Susi hörte sich kichern, als die Hemmungen und der Frust mit einem weiteren Schluck in ihrem Magen landeten.
Als sie wieder zu sich kam, war es dunkel und etwas Schweres lag über ihren Beinen. Sie rieb sich die Augen und versuchte, den Kopf frei zu kriegen. Dass sie nur Schemen erkannte, war gut, denn die wenigen unklaren Bilder des Raumes schwankten wie auf einem wildgewordenen Schiff und drehten sich. Sie kniff die Augen zusammen, stieß das Ding auf ihren Schenkeln von sich herunter und hörte jemanden stöhnen.
Sie befand sich in einem Hotelzimmer, einem der schäbigen Sorte, die alle gleich aussahen und sich in Schnitt und Größe kaum voneinander unterschieden. Susi krabbelte zur Bettkante. Mit unsicheren Schritten wankte sie ins Bad, rutschte vor der Toilette auf den Boden und kotzte ihr Elend in die Schüssel. Nach zweimalig erfolgter Mageninventur zog sie sich am Rand des breiten Waschtisches hoch und spülte sich den Mund mit Wasser aus.
Der latente Chlorgeschmack der nachgereinigten Brühe, die gemeinhin gerade noch den Namen Wasser verdiente, sich aber ganz sicher nicht mehr über die chemische Formel H2O definierte, wusch die letzten Geschmacksspuren der Galle und Magensäure von ihrer Zunge.
Ihr Spiegelbild sah genauso verlaufen aus wie der Mascara unter ihren Wimpern. Der verschmierte Lippenstift verlieh ihrem Mund einen surrealistischen Touch. Ihre Haare standen in wirren, schwarzen Strähnen ab. Insgesamt wirkte sie wie die Verschmelzung der Muse von Salvador Dalí und einem Kunstwerk von Picasso. Genauso fühlte sie sich auch.
Sie stützte den Unterarm am Türrahmen und den Kopf in die Hand, sah an sich hinunter und stellte schockiert fest, dass sie außer ihrem kurzen Unterhemd nichts trug. Sie bewegte die Zehen ihrer nackten Füße auf dem schmutzigen Boden, beobachtete, wie sie auf und ab wanderten, und versuchte verzweifelt, wieder klar zu werden.
Sie stand in irgendeiner Absteige und hatte sich verkauft wie eine billige Nutte – nein, schlimmer noch, sie hatte nicht einmal Geld von dem Scheißkerl genommen. Oder?
Schwankend hielt sie sich am Türrahmen fest und unterdrückte den Brechreiz. So schnell es ging, raffte sie in dem dunklen Zimmer ihre Sachen zusammen und begann, sich anzuziehen. Der Mann auf dem Bett rührte sich noch immer nicht. Sie sah nur seinen Rücken und ein Büschel braunen Haars. Die Kopfschmerzen hämmerten wie wild gegen ihre Schläfen, als ob eine volltrunkene Marschkapelle in ihren Hirnwindungen Gleichschritt übte.
Während sie mühsam den zweiten Stiefel anzog und den Reißverschluss schloss, fiel ihr Blick auf seine Brieftasche. Sie lag vor dem Bett auf dem Boden zwischen Zigarettenkippen und einer leeren Flasche Syntho.
Susi zögerte, warf dem Schlafenden noch einen kurzen Blick zu und hob dann mit einer schnellen Bewegung die teuer aussehende Brieftasche auf und steckte sie ein. Jetzt war sie wirklich zu Claire geworden. Beim Hochkommen kam sie gegen einen Stapel Kleidung und sein Shirt rutschte vom Sessel. Sie nahm es hoch und betrachtete es. „Ein letzter Tag in Freiheit“ stand darauf und darüber ein Bild von einem Paar Handschellen.
Der Bräutigam.
Arschloch.
Susi schniefte und sah noch einmal zum Bett. Er rührte sich nicht – vielleicht auch besser so, denn wenn seine Angetraute erführe, was heute Nacht passiert war …
Sie schlüpfte durch die Tür, mied den Aufzug und hastete stattdessen den Gang entlang und das enge Treppenhaus hinunter, in dem sich über die Jahre etliche, mäßig talentierte Graffiti-Künstler ausgetobt hatten. Die Uhr über der baufälligen Rezeption zeigte halb fünf. Der fette Rezeptionist mit schwarzem Schnauzer, Backenbart und Afrolocken in der schmierigen Uniform hinter der zerkratzten Plexiglasscheibe schnarchte lautstark vor sich hin.
Draußen empfingen sie Regen und das übliche Grau des beginnenden Tages. Ein paar Meter die Straße hinauf machte sich eine Gruppe Biker einen Spaß daraus, den Elektroschlitten eines feinen Pinkels zu zertrümmern. Also wählte Susi die andere Richtung. Als sie um die Straßenecke bog, ging das Vehikel gerade unter dem wilden Gegröle der Gang in Flammen auf. Eine Straße weiter zog sie die Brieftasche hervor und blätterte durch die Karten und virtuellen Ausweise. Sportclub, Waffenbesitzkarte, Country Club, Parkausweis.
Ah, die Kreditkarten.
Unwillkürlich wurde sie langsamer, als die Lichter der grellen Neonreklame die schwarzen und goldenen Oberflächen beleuchteten. Mehrere nicht gekennzeichnete Cred-Karten, deren Hologramme unterschiedliche Restwerte auswiesen, steckten im dafür vorgesehenen Fach und auch einige Scheine Bargeld. Geldkarten oder Geldstäbe, die elektronischen Wertspeicher ihrer Zeit, hatten es immer noch nicht geschafft, das gute alte Bargeld zu ersetzen, boten aber eine exzellente Möglichkeit, auch größere Summen mit sich zu führen. Der angenehme Vorteil gegenüber althergebrachter bargeldloser Bezahlung war, dass sich die Credkarten und -stäbe normalerweise nicht nachverfolgen ließen.
Susi blieb stehen, überflog die Zahlenwerte der ersten zwei Karten und blätterte durch die Banknoten. Allein der Bargeldbestand dieser Geldbörse überstieg ihr monatliches Einkommen um ein Vielfaches.
Sie suchte weiter und fand persönliche Bilder, ein laminiertes Foto, das den Typen mit seiner vermutlich zukünftigen Ehefrau zeigte, und das Pass-Holo einer älteren Frau, die sie von irgendwoher zu kennen glaubte. Ein Reiseschnappschuss von irgendeiner Luxusreise. Dieses Arschloch – aber immerhin hatte er genug Geld für alle notwendigen Genehmigungen.
Aus einem Impuls heraus steckte sie das Foto mit dem Bargeld und den Cred-Karten ein und warf die Brieftasche in einen Hauseingang. Der integrierte Sender würde die Polizei nur auf ihre Spur bringen. Erpressen ließ sich der Typ ganz sicher nicht, und das war auch nicht ihr Stil.
Die frische Luft vertrieb die Kopfschmerzen, und es ging ihr allmählich etwas besser. Irgendwie hoffte sie, dass es seine Karre gewesen war, die die Punks von eben in einen Tischgrill verwandelt hatten.
Das Billbow´s Inn lag nur einige Querstraßen entfernt in Englewood, in der Nähe des alten St. Bernhard-Krankenhauses. Susi überlegte, ob sie Larry noch auf einen Kaffee besuchen sollte. Schließlich entschied sie sich dagegen und machte sich auf den Heimweg – was im Wesentlichen hieß, sie hoffte, die kleine Garküche noch unversehrt auf ihrem letzten Stellplatz vorzufinden.
Du weißt ganz genau, dass sie es irgendwann herausfinden wird. Ist Dir eigentlich klar, was für ein Skandal das ist?“
Mutter strich ihr perfekt sitzendes Kostüm glatt und sah in den Dunst der Barrington Hills unterhalb des Penthouses. Der Wolkenkratzer der Familie ragte aus dem Konglomerat der kleineren Gebäude wie ein Mahnmal. Einhundertzweiundzwanzig Stockwerke hoch – höher als das einstige Wahrzeichen der Stadt Chicago – und dennoch heute nicht mehr als einer von Vielen. Sie ließ den Blick schweifen und hielt ihm den Rücken zugewandt, ihre faltigen Hände demonstrativ hinter sich verschränkt. Sie gab einen theatralischen Seufzer von sich, dann drehte sie sich endlich zu ihm um.
„Was dachtest du dir nur dabei?“
Eine Pause entstand, in der sie offensichtlich eine Antwort erwartete, aber Piter war außerstande, ihr zu antworten. Er schwieg und kämpfte mit der Übelkeit. Schuld und Scham wechselten sich mit den körperlichen Beschwerden seines Katers ab.
„Was soll ich denn jetzt Gabriel sagen? Diese Ehe war seit Monaten vorbereitet, und ich habe mir alle Mühe gegeben, dich zu unterstützen. Aber deine blinde Vernarrtheit war wohl doch wieder nur ein Strohfeuer – wie immer. Jetzt müssen wir Schadensbegrenzung betreiben.“ Sie nestelte übertrieben an der kleinen Brille auf ihrer Nase herum, die sie nur trug, weil ihr das Accessoire einen einzigartigen Auftritt verlieh. Es sollte ihre Gesprächspartner einschüchtern, wenn sie sie bedrohlich auf ihrem Nasenrücken hin und her schob.
Piter massierte seine Schläfen.
„Wieder einmal. Piter, ich weiß nicht, was ich noch mit dir machen soll. Zuerst wehrst du dich, dann willst du sie unbedingt, und nun das …“
Er schob sich die gespreizten Finger in die Haare und stützte den Ellbogen auf dem Knie ab. Er konnte die Ringe unter seinen Augen beinahe fühlen und kratzte sich sein unrasiertes Kinn. Er räusperte sich mehrfach und versuchte zu antworten, aber es klang immer noch, als hätte er mit rostigen Nägeln gegurgelt. Endlich brachte er etwas heraus.
„Mutter … ich …“
Sie ließ ihn nicht zu Wort kommen. In einer einstudierten Geste hob sie die Hand zum Schlag, und er duckte sich instinktiv.
„Fang ja nicht an, mir deine Entschuldigungen vorzutragen!“, schrie sie. „Ich habe weiß Gott genug ertragen. Du und dein Vater – ihr seid beide gleich. Euer Egoismus, eure verdammte Selbstsucht … Nicht eine Sekunde hast du auch nur daran gedacht, in welche Lage mich dein Handeln bringt. Ich hatte gehofft, du bist endlich erwachsen geworden, aber nein, du schlägst immer wieder über die Stränge. Wie oft noch?“
„Ich …“ Er hob verzweifelt eine Hand.
„Ich, ich, ich, das einzige Wort, das ihr kennt, heißt ich“, schrie sie.
Die Worte trafen ihn wie Peitschenhiebe, und er zuckte unter jedem zusammen wie ein geprügelter Hund. Er war kurz davor, in Tränen auszubrechen.
Seine Mutter drehte sich wieder weg und beobachtete den Horizont. Dreißig Meilen östlich blinkten die Hochhäuser von Downtown Chicago.
„Wir werden die Sache erstmal unter Verschluss halten, aber ich kann nicht versprechen, dass Alma es nicht erfahren wird. Du warst nie ein guter Lügner. Sehr zu meinem Leidwesen, muss ich sagen, aber ich habe die Hoffnung ohnehin aufgegeben, dass du einmal in meine Fußstapfen treten wirst. Ich muss dir wohl nicht sagen, dass du mich wieder einmal zutiefst enttäuscht hast.“ Ihre Stimme war nun wieder ruhig und gefasst.
Piter erwiderte nichts. Er beschränkte sich darauf, die Flammen im Kamin zu beobachten. Er fühlte, wie sich eine einzelne Träne in seinem linken Auge sammelte und sich beharrlich weigerte, sich ihren Weg die Wange hinunter zu bahnen.
Mutter drehte sich zu ihm um und hielt die Hände wie eine Schaukel verschränkt vor sich. Es war die einstudierte Pose der enttäuschten Lehrerin, und sie verfehlte ihre Wirkung nicht.
Piter ließ sich noch tiefer in seinen Sitz sinken. Er wollte vor Scham am liebsten im Erdboden versinken.
Mit einem vorwurfsvollen Blick sah sie ihn über den Rand der kleinen Brille hinweg an.
„Falls Alma nach diesem Fiasko noch an eurer Verbindung festhält, hoffe ich, dass zumindest eure Kinder bessere Nachfolger für die Aufgabe unserer Familie sein werden.“
Ein Funken Auflehnung flammte in ihm auf und weckte seinen Trotz.
„Alma liebt mich“, krächzte er.
Sie schüttelte abschätzig den Kopf und behielt ihre mitleidsvolle Miene bei. „Das glaubst du vielleicht, mein Sohn. Aber in Wirklichkeit bin ich mir nicht so sicher, dass sie dich nach dieser Katastrophe noch will. Oder glaubst du im Ernst, sie hätte anfangs anders gedacht als du? Gabriel musste sie regelrecht zwingen, nach Chicago zu kommen, und wenn ich dir nicht bei deinen stümperhaften Annäherungsversuchen unter die Arme gegriffen hätte, dann wäre eure Verbindung gar nicht erst zustande gekommen. Sie ist sich sehr wohl bewusst, warum diese Ehe überhaupt vereinbart wurde. Gabriel und ich haben uns darauf geeinigt, aber alles hat seine Grenzen. Ich hatte erwartet, dass du mit der Zeit ein bisschen vernünftiger werden würdest, aber du hast ja nichts Besseres zu tun, als mich wieder einmal zu enttäuschen.“
Sie schnaubte.
„Wenn du glaubst, dass sie dich liebt, dann bist du ein romantischer Idiot und hast endgültig den Bezug zur Realität verloren. Anstatt deinen niederen Trieben nachzugeben, hättest du dir lieber Gedanken darüber machen sollen, was für Konsequenzen das Ganze für unsere Geschäftsbeziehungen zu Gabriel und das Ansehen unserer Familie haben könnte.“
„Ich kann das nicht allein. Bitte. Sie darf es nicht erfahren, Mutter, bitte …“ Er reckte ihr hilfesuchend die Arme entgegen. Angst flammte in seinem Herzen auf.
Sie nahm seinen Kopf behutsam in die Arme und hielt ihn sanft an ihre Brust gedrückt. „Aber natürlich werde ich dir helfen. Wir müssen die Familie schließlich beschützen, nicht wahr, mein Sohn?“, sagte sie leise.
Der Zufall hatte ihm diese Story geschenkt und ihm eine steile Karriere beschert. Früher hatte es für ihn nur diese kleine Gemeinschaft im Bostoner Süden gegeben, doch plötzlich hatten ihm alle Türen offen gestanden. Natürlich ging das anfangs Hand in Hand mit kleingeistigen Eifersüchteleien und hart eingesetzten Ellbogen, aber Russel hatte sich durchgebissen. Wie gefährlich dieses Haifischbecken wirklich war, war ihm gar nicht bewusst gewesen. Doch das änderte sich schnell.
Kaum hatte er in wochenlanger, mühevoller Recherche herausgefunden, dass Pan Tech hinter den Fällen genetischer Mutation steckte, hatten ihn auch schon die ersten anonymen Anrufe erreicht.
Er schloss die Augen und erinnerte sich an die dunkle, warnende Stimme, mit der er zuletzt gesprochen hatte.
„Sie täten gut daran, Ihre kostbare, kleine Story aufzugeben, Mr. Brand.“
Bei der Erinnerung an den gefährlich ruhigen Unterton stellten sich ihm selbst jetzt noch die Nackenhaare auf, aber Russel war noch nie der Typ gewesen, der einfach so aufgab.
„Wissen Sie, genau deswegen sollte ich weitermachen. Weil Leute wie Sie mich anrufen.“ Seine Antwort hatte fest und selbstbewusst geklungen. Er wollte sie provozieren, sie aus der Reserve locken und ihnen zeigen, dass er keine Angst vor ihnen hatte. „Ich weiß, wer hinter der Geschichte in Boston steckt, und auch, woher sie das Zeug hatten. Ich weiß auch, dass die Leute keine Ahnung hatten, was genau sie da verteilt haben. Aber ich habe eine sehr gute Vorstellung davon, was das Zeug anrichten kann, und ich finde auch noch heraus, was genau Sie damit vorhaben.“
Der Sprecher war nicht im Geringsten beeindruckt gewesen. „Ihr Weg führt in eine Sackgasse, und danach in die nächste. Wenn Sie jetzt aufhören, könnten Sie weiter als Reporter arbeiten, und wir entschädigen Sie mit einer großzügigen Summe für ihre … nun, nennen wir es Diskretion.“
„Denken Sie wirklich, ich verkaufe für ein bisschen Geld meine Ideale und Prinzipien?“
Der Anrufer lachte. „Ideale und Prinzipien? Wohl eher der Pulitzer-Preis. Hofft nicht jeder Schreiberling darauf? Aber ich dachte mir bereits, dass Sie so unvernünftig sind.“
„Unvernünftig?“ Russel wurde laut. „Wie unvernünftig ist es denn, Lebensmittel in Umlauf zu bringen, die verhindern, dass Menschen Kinder zeugen?“
„Das haben wir beide nicht zu entscheiden.“
„Aber die Regierung und die Konzerne haben es? Und sie bringen es auch noch offiziell in Umlauf. Wozu also wurde es entwickelt?“
„Diskutieren Sie nicht mit mir, das hat keinen Zweck. Hören Sie lieber auf, bevor es zu spät ist.“
„Und was, wenn nicht? Ich habe die Proben vergleichen lassen, das Gen-Food der letzten Generation und die Proben aus Connecticut sind identisch. Sie bringen es offiziell in Umlauf. Warum?“
Das Gespräch war an der Stelle beendet worden, aber Russel hatte seine Antworten dennoch bekommen.
Zuerst traf es seine Neffen. Jemand sprach die Kinder vor der Schule an und fragte nach ihrem Onkel Russel. Als Norah, Sammy und er die Jungs dazu befragten, antworteten sie nur, sie hätten schreckliche Angst gehabt. Die beiden Männer in den dunklen Anzügen waren aus dem Nichts aufgetaucht und hatten den beiden Siebenjährigen gesagt, dass sie ihnen fürchterliche Dinge antun würden, wenn ihr Onkel nicht aufhörte, Lügen zu erzählen. Sie nannten Russel einen schlechten Menschen, der sich nicht um sie kümmerte. Auch Mum und Dad würde Schlimmes geschehen, wenn sie nicht verhinderten, dass Russel damit aufhörte. Norah hatte die zitternden Jungen zwei Tage nicht aus dem Haus gelassen, aber in ihr wohnte der gleiche, unbeugsame Geist wie in ihm. Wütend hatte sie Russel ermutigt, es diesen elenden Mistkerlen zu zeigen, hatte bei der Schule und der Polizei angerufen und sich beschwert, dass man so wenig auf ihre Kinder achtgab. Natürlich war sich dort niemand einer Schuld bewusst gewesen.
Russel hatte sich die nachfolgenden zwei Wochen lang darauf beschränkt, unauffällig zu bleiben. Doch als er schließlich wieder zu arbeiten begann, kam die Reaktion der Unbekannten postwendend.
Von einem Tag auf den anderen verschwand Jones – einer seiner Informanten aus New Haven. Sie hatten sich gelegentlich in einem kleinen Café getroffen, nur ein paar Straßen entfernt von der Redaktion. Trotz seiner Suspendierung hatte Jones ihm weitere Kontakte zu Hintermännern zugesagt, die eventuell aussagen wollten. Russel versprach, sich dafür einzusetzen, dass Pan Tech zur Verantwortung gezogen würde. Aus irgendeinem Grund war Jones und seinen Leuten das sehr wichtig gewesen, aber er hatte nicht weiter darüber sprechen wollen. Dann kam unerwartet der Anruf auf den Russel so gehofft hatte. Angeblich verfügten sie über genauere Informationen über die Herkunft der Lebensmittel und deren Entwicklung.
Woher sie das alles hatten, wollte Jones am Kommunikator nicht sagen, aber in seiner Stimme schwang ein ängstlicher Unterton mit. Wenn der Mann Russel wirklich mit einem der Hintermänner in Kontakt bringen konnte, dann wären er in der Lage, Pan Tech ernsthaft zu belasten.
Letzten Dienstag war Jones der Verabredung ferngeblieben, ohne sich bei ihm zu melden. Zwei Tage lang war Russel sauer und fluchte beim Gedanken daran, Jones hätte vielleicht doch das Geld vom Konzern genommen. Als er aber am Freitag seine letzten Sachen aus dem Büro holen fuhr, fand er ihn im Rinnstein der Nebengasse.
Der Anblick der zerschundenen Leiche stand ihm immer noch vor Augen. Wer auch immer dafür verantwortlich war, er wusste, wann Russel dort vorbeikommen würde und hatte den Körper just vor seinem Eintreffen dort deponiert. Ansonsten hätte man ihn sicher früher entdeckt. Für eine ganze Weile war er nicht mehr ans Telefon gegangen. Norah durfte einfach nicht wissen, wie gefährlich es mittlerweile für ihn geworden war. Er wollte ihr keine Angst machen. Es wurde Zeit, dass er handelte.
Russel packte seufzend die wenigen Habseligkeiten zusammen, die er besaß. Er sah sich in der winzigen, möblierten Wohnung noch einmal kurz um und zog dann die alte Holztür am Schlüssel ins Schloss.
Auf der Dorchester Avenue wartete sein Pick-up. Alles war startbereit für den Neuanfang. Norah stand an den Kotflügel gelehnt und zog ihr wollenes Tuch fester um die Schultern. Die winzigen Fältchen um ihre Augen schimmerten feucht. Der Wind frischte auf und blies mit eisigem Atem von Nordwest.
„Bist du sicher, dass du das tun willst?“
Er seufzte. So oft sie auch in den vergangenen Wochen darüber gesprochen hatten, es gab keinen anderen Ausweg.
„Sammy und die Kinder werden dich vermissen.“
„Ich weiß. Aber dir ist doch klar, dass ich nicht mehr hierbleiben kann.“ Immer die gleiche Leier. Er kam sich vor, wie eine kaputte Audiodatei auf Wiederholschleife. „Hör mal. Ich habe hier keine Zukunft mehr.“
„Red doch nicht so einen Unsinn“, schimpfte sie. „Du hast mich und Sammy und die Kinder. Du könntest wieder als Reporter in der Lokalredaktion arbeiten. Sind wir denn etwa nicht wichtig für dich?“
Er schüttelte resigniert den Kopf. „Du weißt genau, warum ich nicht bleiben kann. Bitte, Norah, mach es mir nicht schwerer, als es ohnehin schon ist.“
„Warum musst du gehen?“, beharrte sie störrisch.
„Niemand will mehr mit mir arbeiten, verstehst du das nicht? Und zurück in die Hinterhofredaktion der Lokalnachrichten ist für mich keine Option. Nicht einmal als freier Texter gibt es für mich auf dem Markt noch eine Chance. Keine Agentur braucht einen Reporter wie mich.“
„Dann such dir was anderes. Du musst doch nicht schreiben. Du kannst bei Sammy anfangen. Er bringt dir alles bei. Wir haben es dir doch angeboten. Und wegen der Miete mach dir keine Sorgen – wir stunden es, bis du wieder flüssig bist. Du brauchst auch gar nichts zu bezahlen. Aber das willst du ja nicht.“
Ja, sicher, Hausmeisterarbeiten und Instandsetzungen. Nicht, dass Russel seinen Schwager nicht respektierte, aber das war erst recht nicht sein Leben. Norah konnte sich mit dem friedlichen Familienleben arrangieren und hatte die Schreiberei noch in der Highschool aufgegeben, aber er hatte es als Reporter aus einer langweiligen Lokalredaktion mit Berichten über Altenheime und Schulfeiern bis in das lokale Holo gebracht. Er wollte nicht mehr in dieses einfache Leben zurück.
Auch Mary-Anne hatte das nicht verstanden. Sie hatten es versucht, aber es hatte einfach nicht gepasst.
„Ich hab nun mal den gleichen Sturkopf wie du und Dad.“ Er lächelte traurig.
„Bitte, Russel, geh nicht. Ich habe wirklich kein gutes Gefühl dabei.“ Sie hielt ihn am Saum seiner Jacke fest.
Er vermied es, sie anzusehen, und drehte das Gesicht in den Wind. Im frühen Morgengrauen scheuchte die Brise einige flatternde Papierfetzen die Straße hinunter auf sie zu.
Die Welt sah genauso grau und trostlos aus wie in seinen Gedanken. Seine Schwester ließ die Jacke los, und sah ihn erwartungsvoll an. „Bitte bleib hier“, bat sie.
„Du weißt, dass ich das nicht tun kann. Nicht nach dem, was den Kleinen passiert ist. Sie haben irgendetwas vor, Norah, das spüre ich.“ Er vermied es, sie anzusehen, aus Angst, sie könne seine Gedanken erraten.
Sie starrte abwesend über seine Schulter, und der Wind zerrte an ihren rotbraunen Haaren. Als er an der Häuserfront hinaufblickte, erkannte er an den Fenstern im ersten Stock die Gesichter der Jungs, die sich trotz der frühen Stunde die Nasen daran plattdrückten.
„Dann versprich mir wenigstens, dass du irgendwann wiederkommst, ja? Und melde dich, wenn du dort bist. Mir zuliebe.“ Ihr Gesicht drückte ehrliche Sorge aus, als sie zärtlich die Hand auf seine linke Wange legte.
„Das werde ich tun, Norah. Ganz sicher.“
Sicher war nur, dass er log, und sie wusste es. Um nichts in der Welt würde er seine Schwester oder ihre Familie in Gefahr bringen. Er musste für die gesamte Ostküste unsichtbar werden.
„Ich muss los, Kleines. Bitte grüß Sam von mir. Wir hören uns, sobald ich dort etwas gefunden habe.“
„Du Schwindler! Was willst du wirklich dort? Du gehst doch nicht wirklich zufällig nach Chicago? Sag mir wenigstens, was du vor hast …“
Chicago galt als weltgrößter Handelsplatz für Nahrungsmittel. Wenn es irgendwo auf der Welt weitere Beweise für seine Story gab, dann dort. Außerdem hatte Pan Tech eine Niederlassung in der Stadt. Russels Riecher sagte ihm, dass der Schlüssel irgendwo in Chicago lag. Hier im Osten führten zu wenige Hinweise in die Lokalpolitik.
„Ich …“ Er seufzte und fuhr sich mit der Hand durch die Haare. „Na schön. Ich glaube, dass Pan Tech in Chicago das Ganze zum Laufen gebracht hat. Wenn ich dort nichts erfahre, dann nirgends. Hier haben sie bereits begonnen, mich fertig zu machen. Sie werden nicht damit rechnen, dass ich mich mitten in die Höhle des Löwen begebe.“
„Oooooooh …“, sie trommelte mit den Fäusten gegen seine Brust. In ihren Augen standen kleine Tränen. „Du verfluchter Mistkerl! Warum kannst du damit nicht einfach aufhören? Immer geht es nur um diese Story. Allmählich glaube ich, du verrennst dich da in etwas, das es gar nicht gibt. Lass es gut sein, Russel, du wirst noch dabei umkommen.“
Er hielt ihre Hände fest und drückte sie an sich. Es tat ihm weh, sie so leiden zu sehen. Sie schluchzte an seiner Brust.
„Du kommst nicht zurück, nicht wahr?“, flüsterte sie.
„Es ist einfacher, wenn du das glaubst, No. Wenn dich jemand anspricht, dann sag einfach, ich bin fortgegangen. Sag ihnen, du wüsstest nicht wohin. Vertrau mir – es ist besser so. Sag den Kindern alles Liebe von mir.“
Sie nickte nur stumm unter Tränen und ließ ihn einsteigen. Als Russel am Ende der Straße in den Rückspiegel sah, stand Norah noch immer dort, eingewickelt in ihren selbstgestrickten Wollumhang. Eine einsame Gestalt im eisigen Wind.
Der Schriftzug „Nicht schwanger“ blinkte zweimal kurz auf der Digitalanzeige des Tests und verschwand dann. Die schlanke Hand mit dem kaffeebraunen Teint, sank kraftlos herab und entließ das unschuldig aussehende Kunststoffröhrchen aus ihrem Griff. Winslow zog den Kamerazoom zurück um Almas Reaktion darauf beobachten zu können. Sie presste die vollen, roten Lippen zu einem schmalen Strich zusammen, und ihre Züge wurden hart. Mit einer schnellen Bewegung hob sie das Teil wieder auf und schleuderte es quer durch den Raum. Er wechselte auf die Totale. Der Test schlitterte mit einem schabenden Geräusch über die schwarzen Natursteinfliesen und kam irgendwo unter dem Sofa am anderen Ende des luxuriös eingerichteten Schlafzimmers zum Stillstand.
Mit einem Tastendruck wechselte er auf eine andere Einstellung und überprüfte die Aufnahmeparameter. Die Mikrokameras übertrugen Bild und Ton einwandfrei. Er ließ die aktive Kamera einen kompletten Schwenk ausführen, um sich einen aktuellen Überblick über den Raum zu verschaffen. Seit er die Geräte installiert hatte, hatte sich einiges verändert.
Neben dem Kanapee standen nun eine Schneiderpuppe und ein kunstvoll bemalter Paravent aus dunklem Tropenholz. Die Puppe trug ein kostbares Kleid des italienischen Modezaren Enrico Vernucci. Ein Traum aus echter weißer Seide, handgefertigter Spitze und eingewebten Silberfäden. Besetzt mit Perlen und Steinen ausgesuchter Qualität hatte dieses Hochzeitskleid einen Wert, der sich für normale Menschen nur in mehreren Jahresgehältern rechnen ließ – wenn überhaupt.
Piter DeBruyn war heute Nacht nicht hier. Angesichts von Almas Laune wahrscheinlich besser für ihn. Winslow sah auf die Uhr. Halb sechs.
In ein paar Tagen hätte die Hochzeit zwischen den beiden stattfinden sollen. Er rief sich Piters Akte auf dem zweiten Monitor auf.
Das Foto zeigte einen gutaussehenden, schlanken und sportlichen Mann mit kurzem, leicht gewelltem, braunem Haar. Rein optisch bildeten die beiden ein Traumpaar, obwohl allgemein gemunkelt wurde, dass die Hochzeit rein politisch motiviert war. Die DeBruyns galten als einflussreiche Politiker, und Almas Vater arbeitete eng mit Piters Mutter zusammen. Winslow informierte sich wenn möglich immer über die Motive seiner Auftraggeber. Gabriel Ruaréz galt allgemein als sehr verschlossen, doch aus Sorge um seine Tochter war er ausgesprochen mitteilsam gewesen.
Zu Beginn verlief Piters schwaches Werben erfolglos. Sein sklavischer Gehorsam gegenüber seiner Mutter war Almas rebellischen, eigenständigen Wesen zuwider. Er hatte Gabriel jede ihrer Ausreden aufgedeckt. Sie hatte ihr Studium vorgeschoben, mit Bravour abgeschlossen, und schließlich ein Stellenangebot einer peruanischen Stahlfirma angenommen, was sie außer Landes geführt hatte.
Mit seiner Hilfe war es für Gabriel jedoch ein Leichtes gewesen, ihre Versetzung zurück in den Metroplex Milwaukee-Chicago zu organisieren. Natürlich hatte sie es gemerkt, aber Piter hatte sie mehrmals ausgeführt, und sie waren sich tatsächlich nähergekommen. Als er ihr eines Abends einen Antrag machte, der genau ihrer romantischen Vorstellung zu entsprechen schien, sagte sie schließlich zu.
Dass die Senatorin ihrer Schwiegertochter in Spe in den folgenden Wochen immer mehr Druck machte, in angemessener Zeit schwanger zu werden, und ihnen einen Enkel zu schenken, strapazierte das Verhältnis von Alma und Piter ungemein. Natürlich bestand Martysha DeBruyn auf einem Jungen, der die Reihe seines Vaters und Großvaters fortsetzte.
Ihr Mann Michael war ein hohes Tier beim Militär in Washington und ließ sich so gut wie nie in der Stadt blicken. Seine Frau engagierte sich in der lokalen Politik, organisierte die familiären Verhältnisse, und hielt auch sonst alle Fäden in der Hand. Jegliche Information über eine mögliche Schwangerschaft wäre ihr sicher einige Credits wert. Andererseits vertrat Winslow immer noch einen gewissen Ehrenkodex, der besagte, dass man niemals zwei Auftraggeber gegeneinander ausspielte.
Winslow biss in ein belegtes Brot und nahm einen Schluck schwarzen Tee, während er weiter gelangweilt auf den Monitor starrte. Alma hatte den Raum inzwischen verlassen und war ins Bad gegangen.
Im Grunde verhielt es sich bei beiden Familien gleich. Gabriel Ruaréz leitete eines der weltweit einflussreichsten Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche. Pan Tech war Marktführer im Gen-Food-Sektor und produzierte verschiedenste Nahrungsmittel in gewaltigen Gen-Farmen und Laboranlagen. Vor der Welt gab er sich als großer Wohltäter mit seinen Schenkungen an die Armen. ID-Lose, deren Status am Rande der Gesellschaft sie quasi zu Freiwild machte. ID-Losen waren die unkontrollierte Fortpflanzung genaugenommen ebenso verboten wie die Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses. Ein Teufelskreis, aber sie vermehrten sich, ohne dass die Regierung ihnen Einhalt gebieten konnte.
Alma kam mit einem Kommunikator am Ohr wieder ins Bild und trat wütend gegen die teure Teakholzkommode, als niemand antwortete. Ärgerlich ging sie hinüber zum Fenster, legte ungeduldig auf und wählte erneut. Nach einigen Sekunden wandte sie sich abrupt ab, warf den Kommunikator frustriert auf die Couch und kreischte aufgeregt. Enttäuscht ließ sie ihrem Frust freien Lauf.
Aus früheren Unterhaltungen mit ihren Freundinnen, wusste Winslow bereits, dass sie sich schon immer Kinder gewünscht hatte, und sich Piter dabei mittlerweile auch als Vater vorstellen konnte. Zwei sollten es sein – ein Junge und ein Mädchen. Am liebsten Zwillinge.
Winslow tat sie irgendwie leid. Seit Wochen hoffte sie jetzt verzweifelt. Gabriels Reaktion auf seinen Bericht fiel schon beim ersten Mal sehr verhalten aus. Im Gegensatz zu Martysha DeBruyn hielt er sich in dieser Hinsicht aus dem Leben seiner Tochter völlig heraus. Die Senatorin hatte Alma bereits an einen Spezialisten verwiesen, und wurde nicht müde, Alma auf die politische Wirkung von Hochzeit und Nachwuchs hinzuweisen.
Alma hingegen ging es schon lange nicht mehr um die politische Wirkung. Sie wollte sich ihren Herzenswunsch erfüllen.
Das Zimmer sah mittlerweile aus, als hätte eine Rockband gefeiert. An der karmesinroten Wand, hinter der sich das Badezimmer befand, prangte ein großer Wasserfleck und auf dem schwarzen Granitboden lagen noch die Überbleibsel einer teuren Porzellanvase zwischen vierundzwanzig verstreuten roten Rosen. Alma hatte gewütet wie eine Berserkerin.
Winslow beobachtete gespannt, wie sie nach einem Bild griff, das von ihr und Piter auf ihrer letzten Reise nach Honolulu aufgenommen worden war.
Sie holte zum Wurf aus und wollte wohl es an die Wand schmettern, da blieb ihr Blick an etwas hängen, das sie mitten in der Bewegung erstarren ließ. Winslow folgte ihrem Blick und vergrößerte den Bildausschnitt.
Ihr Juradiplom. Alma Maria Ruaréz, M.S.L., Yale Law School, Connecticut, Class of 2115.
„Ich hätte Medizin studieren sollen“, sagte sie laut zu sich selbst und stellte das Bild mit traurigem Blick zurück. Ihre Finger strichen über Piters Gesicht. „Es tut mir so leid …“
Plötzlich sprang sie auf, und ließ sich vor dem Kanapee auf die Knie nieder und beugte sich mit dem Kopf tief hinab. Die langen, schwarzen Haare fielen über ihr Gesicht und verschmolzen mit dem dunklen Boden. Dabei übersah sie die Scherben, stützte sich mit der rechten Hand ab und streckte die linke nach dem Test aus. Er musste knapp außerhalb ihrer Reichweite liegen, denn sie streckte sich erfolglos. Der geringe Abstand zum Boden verhinderte, dass sie ihr Ziel erreichte. Sie fluchte, beugte sich tiefer und reckte den Arm weiter unter das Sofa. Dabei rutschte ihre Rechte auf dem glatten Boden ab, und sie musste sich mit dem Unterarm abstützen, um nicht mit dem Kopf auf den Stein zu prallen. Jetzt hatte sie den Test, aber zugleich zuckte sie unter Schmerzen zusammen und besah sich ihre Hand.
Blut lief aus einem kleinen Schnitt in ihrem Handteller, wo eine Scherbe die Haut durchstoßen hatte.
„Maldita mierda“, rief sie und drückte auf die Anzeigetaste, doch der Text blieb unverändert. Nicht schwanger.
„Senora haben mich gerufen?“, hörte Winslow eine helle Stimme auf Spanisch fragen und wechselte wieder auf die Totale.
„Si.“ Alma zog die Scherbe heraus, lutschte an der Wunde und stand auf. Wütend schmetterte sie den Test auf den Boden, und die Anzeige erlosch, als das Plastik zersplitterte.
„Machen sie das sauber, Missy“, schimpfte sie. Dann nahm sie eine Visitenkarte vom Sekretär und gab sie der Angestellten. „Rufen sie Doktor Altmann an. Sagen Sie ihm, ich will ihn heute noch sprechen. Dringend!“
Winslow beendete die Aufzeichnung und kratzte sich nachdenklich das Kinn. Diese Nachrichten würden seiner neuen Auftraggeberin sicher nicht gefallen. Vorerst konnte sich Martysha DeBruyn also nicht über einen Enkel freuen.
Russels Wagen kämpfte mit dem Wetter. Die Scheibenwischer liefen auf Hochtouren und lieferten sich einen Wettstreit mit dem prasselnden Regen. Die Straße verwandelte sich vor seinen Augen in einen verschwommenen Alptraum aus verwaschenem Schwarz. Die Nacht war noch lange nicht vorbei, und die Scheinwerfer seines Pick-ups schnitten undeutliche Schemen aus der Dunkelheit. Russel blinzelte, müde von der langen und eintönigen Fahrt. Im Radio lief irgendein Werbejingle zum gefühlt fünfzigsten Mal und lullte seine Aufmerksamkeit ein.
Auf dem Highway war um diese Nachtzeit kaum noch etwas los, und das ewige Schwarz der undefinierbaren Schatten um ihn herum wurde nur unterbrochen von den wenigen Lichtreflexen, die im Kegel der Scheinwerfer aufblitzten. Es wurde Zeit für eine Kaffeepause. Er beschloss, den rechten Fahrbahnrand nach Werbeschildern des nächstbesten Diners im Auge zu behalten, als sich plötzlich einer der Schatten über die Straße bewegte.
Instinktiv riss er das Steuer herum und versuchte, den Wagen in der Spur zu halten. Er war zu schnell, und die Reifen schwammen auf dem nassen Asphalt. Russel konnte spüren, wie das Heck des Trucks begann, ihn rechts zu überholen. Ein Schlag, eine Schrecksekunde, und er hatte den Wagen wieder unter Kontrolle. Schlingernd kam er einige Meter weiter zum Stehen. Der Highway war schwarz und weit und breit kein anderer PKW zu sehen. Russel zitterte. Was war das gewesen? Ein Reh?
Blödsinn, schalt er sich! Kein Reh hätte im Scheinwerferlicht versucht auszuweichen. Sie blieben geschockt stehen. Es war größer gewesen … zu groß. Der Highway war dunkel wie die Nacht selbst. Er hatte keinen Schimmer, wo er war. In weiter Ferne erkannte er den Beleuchtungssmog über Chicago. Im Norden wölbte sich ebenfalls eine diffuse Lichtkuppel – das musste der Metroplex Detroit sein.
Er versuchte, ruhig zu bleiben, und setzte den Wagen vorsichtig zurück, bis er im Licht der Rückfahrleuchten den unförmigen Haufen hinter dem Truck liegen sah. Im Näherkommen bestätigte sich seine schlimmste Vorahnung – es war ein Mensch.
Russel fluchte, sprang aus dem Wagen und ignorierte den eiskalten Regen, der ihm ins Gesicht schlug. Eine Böe zerrte an seiner Jacke und wirbelte nasses Laub auf. Sein Herz raste.
„Sind Sie verletzt?“, schrie er gegen den heulenden Wind an, der ihm weitere Regenschauer ins Gesicht warf.
Die Gestalt rührte sich nicht. Er kniete sich hilflos in die Pfütze, in der der Verletzte lag. Es war ein Mann. Er roch ungewaschen – ja, er stank regelrecht –, Russel konnte es sogar gegen den Wind wahrnehmen. Die langen, schwarzen Haare schienen mit Blut verklebt und überdeckten fast das hohlwangige, bärtige Gesicht. Was hatte der Mann hier draußen zu suchen? Außer einem gelegentlichen Motel oder Diner fand sich zwischen den Metroplexen, zu denen sich die Städte entwickelt hatten, kaum noch etwas. Sah man von den gigantischen Agrarflächen und automatisierten Fabriken ab, wo die Landstriche nicht brach und verwüstet dalagen. Anstatt weiter darüber nachzudenken, was der Kerl hier draußen in der Nacht zu suchen hatte, riss Russel seinen Kommunikator aus der Tasche und wählte den Notruf. Erleichtert atmete er auf, als sich am anderen Ende eine Stimme meldete.
„Guten Abend, Sie haben den Notruf gewählt. Bitte teilen Sie mir mit, was geschehen ist.“ Die Ansage wurde von einem herzhaften Gähnen unterbrochen und klang eher gelangweilt als besorgt.
Russel ratterte die Informationen an der Kilometermarke herunter, die undeutlich am Straßenrand erkennbar war, und sah dabei immer wieder auf den Verletzten. Der Brustkorb hob und senkte sich unter seiner flachen Hand. Ein gutes Zeichen, der Mann lebte noch.
„Ich … ich hab hier einen Verletzten,“ stammelte er aufgeregt. „Er kam plötzlich aus den Schatten am Fahrbahnrand und lief auf die Straße. Ich bin mir sicher, dass ich ihn angefahren habe. Ich weiß nicht, wie es ihm geht, aber er atmet noch.“
Ein kurzes Schweigen war die Antwort.
„Hallo?“ Fast glaubte er, die Verbindung sei unterbrochen worden, als sich die Stimme zu seiner Erleichterung wieder meldete.
„Hat die Person eine Krankenversicherung?“
Er glaubte, sich verhört zu haben. Für einen Moment schien es, als rausche der Regen noch lauter. Russel war außer sich.
„Was? Scheiße, Mann, hier liegt einer in seinem Blut, und weit und breit ist keiner zu sehen, der uns helfen könnte. Ich hab keine Ahnung, ob der sowas hat, aber hier verrecken kann er ja auch nicht einfach so, oder?“
„Gut, bleiben Sie ruhig. Ein Einsatzwagen der Highway Patrol und ein Krankenwagen sind auf dem Weg.“ Die Stimme des Notdienstes klang nicht überzeugt, aber zumindest war der Mann nicht in der Stimmung zu diskutieren.
Russels Panik nahm etwas ab. „Okay. Gibt es … gibt es denn etwas, was ich jetzt noch tun kann?“
„Nehmen Sie die Wärmefolie aus Ihrer Erste-Hilfe-Ausrüstung und wickeln Sie den Verunglückten ein.“ Die Stimme am Telefon klang nun wieder beruhigend professionell. „Sie reflektiert die Körperwärme, und die Folie hält den Regen ein wenig ab. Falls Sie geübt sind, bringen Sie die Person in die stabile Seitenlage. Falls Sie aber unsicher sind, oder falls Sie Hinweise auf innere Verletzungen sehen …“ Der Helfer nannte ihm einige Anzeichen, auf die er achten sollte. „Dann bewegen Sie die Person lieber nicht. Der Krankenwagen müsste in wenigen Minuten bei Ihnen eintreffen.“





























