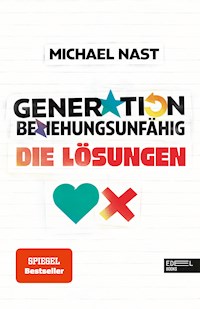14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Michael Nast steht schon jetzt für ein Lebensgefühl. Der gebürtige Berliner berührt und bewegt mit seinen Kolumnen im Internet bereits Millionen von Lesern. Seine Texte werden geteilt und geliked, seine Lesungen sind regelmäßig ausverkauft. In seinem neuen Buch "Generation Beziehungsunfähig" bringt Nast die Dinge auf den Punkt und beschreibt unvergleichlich charmant die Stimmung seiner Generation: Weshalb wir uns gegenseitig als beziehungsunfähig bezeichnen, wie Tinder unsere Partnersuche verändert und warum wir uns immer wieder selbst in den Mittelpunkt stellen, ohne Rücksicht auf Verluste. "Generation Beziehungsunfähig" hält uns einen Spiegel vor ohne zu urteilen, sondern ermutigt zur Selbstreflexion. Ein augenöffnendes wie anregendes Buch, das sich liest wie ein Gespräch mit dem besten Freund.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
MICHAEL NAST
GENERATION
BEZIEHUNGSUNFÄHIG
Inhalt
Vorwort
Illusion perfekte Liebe
Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden
Lass uns einfach Freunde bleiben
Schon mal über eine Trennung nachgedacht?
Von Mingles und Menschen
Ich hatte zu viel Sex
Sexualethisch desorientierende Tendenzen
Wie viel Ehrlichkeit verträgt eine Beziehung?
Der neue Mann
Charmantisch
„Wahre Liebe ist doch nur ein Mythos“
Berufung Beruf
Generation Beziehungsunfähig
Tut mir leid, wenn ich eure Erwartungen nicht erfülle – aber meine sind mir wichtiger
Du willst kein Geld verdienen, mein Kind – du musst nach Berlin!
Du musst dein Ändern leben
Ich mach da so’n Projekt
Es herrscht Krieg da draußen
Dreißig ist das neue Zwanzig
Der Zwölfjährige in mir
„Männer reifen, Frauen welken“
Wer, wenn nicht wir?
In der StayFriends-Welt
Berlin ist nicht Berlin – Tag & Nacht
„Vom Stapeln wird die Scheiße auch nicht sauber“
Wenn die Musik zu laut ist
„Jung und dumm – die passt zu dir“
Religion Selbstoptimierung
Verhütungstendenzen
Welt verbessern nicht vergessen
Ich und meine Maske
Allein unter Freunden
Vielleicht lieber morgen
Fremdschämformatsüchtig
Glücklich?
Veganism Isn’t Cool Anymore
Ein Volk von Legasthenikern
Die rote oder die blaue Pille?
So much Internet to do
Die Bedeutung eines „Zuletzt Online“
Leben ohne Instagram-Filter
Nicht ohne meinen Therapeuten
Diagnose: Beziehungsunfähig
Vorwort
Es gibt Momente in einem Autorenleben, die nicht mit Geld aufzuwiegen sind. Es sind diese Momente, ideelle Erfolge, die viel nachhaltiger sind als ein Blick auf den erhöhten Kontostand.
Ein schönes Beispiel dafür ist ein Erlebnis, das mir vor ein paar Jahren passiert ist. Der Postbote klingelte nachmittags an meiner Wohnungstür und gab mir ein Päckchen, dessen Absender mein damaliger Verlag war. In dem Päckchen befand sich ein Buch, teilweise in französischer Sprache, mit dem ich erst gar nichts anfangen konnte. Es war kein Anschreiben dabei, und Französisch habe ich nie gelernt. In Ost-Berlin, wo ich aufgewachsen und zur Schule gegangen bin, lernte man Russisch. Eine Sprache, von der ich heute noch ungefähr zehn Worte beherrsche. Nach sechs Schuljahren. Nicht einmal zwei Worte pro Schuljahr, und das ist nun wirklich kein guter Schnitt.
Trotzdem begriff ich natürlich, während ich in dem Buch blätterte, dass es sich um ein Schulbuch handelte. Das war der Augenblick, in dem es Klick machte. Ich blätterte schneller, um dann überrascht festzustellen, dass es einer meiner Texte in ein französisches Schulbuch geschafft hatte. Es war ein unwirkliches Gefühl. Die Zeilen waren nummeriert und auf der gegenüberliegenden Seite befanden sich Arbeitsanweisungen, wie die Schüler den Text analysieren sollten. Es war das Erfolgserlebnis schlechthin, einer meiner schönsten Momente als Autor.
Kürzlich hat mich nach einer Lesung in Frankfurt ein Zuhörer angesprochen, um mir zu danken. Er hatte meinen Text „Die Bedeutung eines ‚Zuletzt Online‘ “ gelesen, der sich auch in diesem Buch befindet und den wohl am besten dieser schöne Satz zusammenfasst: „Wir wissen nicht, was andere denken oder fühlen, wir interpretieren ihr Verhalten und sind dann wegen unserer eigenen Gedanken beleidigt.“ Der Mann erzählte mir, dass dieser Text die Situation seiner Familie wiederspiegelte, in der einige Mitglieder schon seit Jahren nicht mehr miteinander sprachen. Kurzerhand berief er ein Familientreffen ein und las den Text dort vor. Noch an diesem Nachmittag war die Fehde beendet.
„Das hat ihnen die Augen geöffnet“, sagte er und gab mir die Hand. „Und dafür wollte ich dir danken.“
Ich wusste zuerst gar nicht, was ich sagen sollte, wieder hatte ich dieses unwirkliche Gefühl. Ich spürte, dass das hier gerade einer dieser großartigen ideellen Erfolge war, die so selten vorkommen.
Ich glaube, die Geschichte des Frankfurters beschreibt die Texte in diesem Buch sehr gut. Dieses Buch ist kein Ratgeber. Keine Anleitung. Ich bin weder Psychologe noch Soziologe, ich bin Beobachter und Erzähler. Vielleicht findet man die Antworten, die man sucht, zwischen den Zeilen. Mein Schreiben sehe ich eher in der belletristischen Tradition, ein authentisches Abbild des Lebens zu schaffen. Das echte Leben abzubilden und meine Schlüsse daraus zu ziehen. Ich selbst habe mehr über das Leben aus guten Romanen gelernt als aus jedem Ratgeber.
Als mein Text „Generation Beziehungsunfähig“ in dem Online-Magazin Im Gegenteil veröffentlicht wurde, wurde er schon am ersten Abend so oft aufgerufen, dass der Server immer mal wieder nicht erreichbar war. Er war kurz davor zusammenzubrechen. Allein in der ersten Woche lasen ihn eine Million Menschen, noch in derselben Woche kauften sich die Macher von Im Gegenteil einen neuen Server. Der Erfolg dieses Textes hat mich offen gestanden überrascht, denn er unterscheidet sich ja eigentlich nicht von meinen anderen Texten. Es ist derselbe Ansatz.
Ich habe in den letzten Monaten Tausende Nachrichten bekommen, in denen sich Menschen bei mir bedankt haben. Dafür, dass meine Texte sie berührt und bewegt haben, dass sie nach der Lektüre über sich und ihr Leben nachgedacht haben. Viele schrieben mir, ich hätte ein vages Gefühl, das sie schon vorher hatten, in Worte gefasst. Dinge, die ich beim Schreiben nie geplant habe. Wahrscheinlich kann man es auch nicht planen, so etwas passiert einfach. Jede einzelne dieser Nachrichten war eins dieser ideellen Erfolgserlebnisse. Denn das ist das größte Kompliment für mich als Autor. Im Leser etwas zu berühren, in ihm etwas auszulösen.
Vor einigen Monaten habe ich eine Nachricht von einer Siebzehnjährigen bekommen, die mir unbedingt schreiben musste, weil sie ganz überrascht von sich selbst war. Sie hatte einen meiner Texte gelesen – und sie hatte ihn zu Ende gelesen. „Eigentlich lese ich gar nicht, es sei denn, die Schule zwingt mich dazu“, schrieb sie. „Aber meiner Generation spricht das halt echt aus der Seele. Wenn wir solche Texte in der Schule behandeln würden, würden wir dort auch gern wieder lesen.“
Ich lächelte und dachte daran, wie mir der Postbote vor einigen Jahren das Päckchen mit dem französischen Schulbuch überreichte.
Wie gesagt, wer einen Ratgeber sucht, wird hier nicht fündig werden. Und auch wem Ironie fremd ist, wird an diesen Texten nur bedingt Freude haben.
Allen anderen wünsche ich viel Spaß beim Lesen!
Michael Nast
Berlin, im Januar 2016
ILLUSION PERFEKTE LIEBE
Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden
Es gibt hin und wieder Augenblicke, in denen ich auf meine Beziehungen zurückblicke und mich frage, ob ich meine Exfreundinnen geliebt habe. Ich meine, wirklich geliebt. Ob ich ein Gefühl gespürt habe, wie ich es erwartet habe. Ein Gefühl, wie es eigentlich hätte sein sollen. Am letzten Montag gab es einige solcher Augenblicke.
Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch hat in seinen Tagebüchern einen Fragebogen mit 25 Fragen aufgestellt, die inzwischen weltberühmt sind. Zwei dieser Fragen lauten: „Lieben Sie jemanden? Und falls ja, woraus schließen Sie das?“ Tja, das ist eine sehr gute Frage. Die Frage danach, wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden. Eine Frage, die sich wohl jeder einmal stellen sollte.
Beispielsweise Christian, der Freund von Jasmin. Vor einigen Tagen habe ich mich mit Jasmin getroffen. Sie wirkte ganz verstört, schon als wir uns begrüßten. „Alles okay?“, fragte ich.
„Na ja, nicht wirklich“, sagte sie. „Ich hatte vorhin eine Meinungsverschiedenheit mit meinem Freund.“
„Ach?“, sagte ich, denn ich ahnte schon, dass der Begriff „Meinungsverschiedenheit“ wohl eine eher milde Umschreibung ihrer Auseinandersetzung war, ein harmloses Wort, mit dem sich Jasmin vor allem selbst beruhigen wollte. Es war eine Ahnung, die sich bestätigen sollte. In ihrer Auseinandersetzung ging es nämlich ums Fremdgehen.
„Er meinte: Fremdgehen kann passieren, das liegt nun mal in der Natur des Menschen“, sagte Jasmin. „Sex hätte nichts mit Liebe zu tun. Das machen doch alle.“
„Ach?“, sagte ich noch einmal und spürte, wie sich meine Züge verhärteten.
„Er hat gesagt, er wäre in seiner letzten Beziehung ja auch betrogen worden, also kann er auch betrügen“, sagte sie. „Aber man sollte schon früh darüber reden, und den anderen nicht vor vollendete Tatsachen stellen, wenn es dann einmal passiert ist.“
„Okay“, sagte ich gedehnt. „Und wie seid ihr auseinandergegangen?“
„Er hat gesagt: Du hast deine Meinung und ich hab meine, machen wir das Beste draus“, sagte Jasmin mit Tränen in den Augen.
Ich warf ihr einen fassungslosen Blick zu. Noch vor einem Monat, als sich Jasmin von ihm trennen wollte, hatte Christian schließlich um sie gekämpft. Er hatte ihr seine Liebe beteuert, täglich mindestens dreißig Nachrichten auf ihrer Mailbox hinterlassen, er hatte gebettelt. Sie wäre die Liebe seines Lebens. Ein Gefühl, das nur einen Monat darauf auf den Satz: „Du hast deine Meinung und ich hab meine, machen wir das Beste draus“ zusammengeschrumpft war.
Christian empfand natürlich keine Liebe, als er um sie kämpfte, und das sagte ich ihr auch. Seine „Liebe“ war ein Ego-Trip. Er pflegte eine „Liebe“, in der es nie um Jasmin ging, sondern ausschließlich um ihn selbst. Er war auf ihre Gefühle angewiesen, um sich selbst zu bestätigen. Es hatte nie etwas mit ihr zu tun.
Christian ist in seiner Empathielosigkeit natürlich ein drastisches Beispiel, ein Prototyp, aber im Ansatz geht es ihm wie den meisten. Sie lieben wie er. Sie pflegen eine narzisstische Liebe. „In der Liebe geht es Ihnen eher darum, sich selbst zu schmeicheln, als ein tiefes Gefühl zu befriedigen.“ Ein Satz, der es übrigens auch in ein dreißigseitiges Persönlichkeitshoroskop geschafft hat, das eine ehemalige Kollegin mit einer speziellen Astrologie-Software für mich erstellt hat, obwohl ich das gar nicht wollte, weil mir ja eigentlich der Zugang zu Horoskopen fehlt. Wenn es nach den Sternen geht, ist Christian also wie ich, dachte ich, was bei mir schon ein ziemlich unangenehmes Ziehen in der Magengegend verursachte.
„So gesehen sind die meisten wie du“, sagte Till lachend, als ich ihm einige Tage darauf in der Goldfischbar von dieser beunruhigenden Gemeinsamkeit erzählte. Till hat Betriebswirtschaftslehre und Philosophie studiert, eine originelle Kombination, die ihm einen aufschlussreichen Blick auf die Dinge ermöglicht.
„Das ist natürlich gesellschaftlich bedingt“, sagte er. „Wir sind nun mal Konsumenten in einer Konsumgesellschaft. Wir leben in einer Bedarfsweckungsgesellschaft. Wir brauchen kein Telefon, wir brauchen das neueste iPhone. Der Kauf von Produkten schenkt uns einen kurzen Moment Befriedigung, einen kurzen Moment Glück sozusagen. Aber das ist nun mal kein nachhaltiges Gefühl, darum müssen wir immer weitere Produkte kaufen. Wir müssen permanent unzufrieden mit uns selbst sein, damit das System funktioniert. Leider wenden wir das auch im zwischenmenschlichen Bereich an.“
„Im zwischenmenschlichen Bereich?“, fragte ich. „Inwiefern?“
„Es ist das Gefühl, sich selbst nicht glücklich machen zu können, dass andere Dinge oder Menschen für die eigenen Gefühle verantwortlich sind – ob es nun das neueste iPhone ist oder ein Mensch, der etwas für einen empfindet. Es schmeichelt unserer Eitelkeit, mehr nicht. Letztlich haben wir verlernt, uns selbst zu lieben. Wir verwechseln Selbstliebe mit Narzissmus.“
Ich dachte an Erich Fromm, für den die Fähigkeit, sich selbst zu lieben, die Voraussetzung dafür war, überhaupt jemand anderen lieben zu können. Tja, dachte ich, aber wer liebt sich schon selbst? Wer ist mit sich vollständig im Reinen, mit seinen Vorzügen – und vor allem mit seinen Fehlern? Ich kenne niemanden. Wir leben nun mal in einer narzisstischen Gesellschaft, und Narzissmus ist ein Zeichen von Unsicherheit, ein überhöhtes Selbstbild, in dem alle Schwächen ausgeblendet werden. Eine Selbstdarstellung, die auf permanente Bestätigung der eigenen Vorzüge angewiesen ist. Narzisstische Liebe ist die Sehnsucht nach einem wohlwollenden Spiegel, in dem man ein Bild sieht, das einem schmeichelt. Man sehnt sich nicht nach dem Anblick seiner Fehler, man sehnt sich nach Bestätigung. Man projiziert ein Bild auf den anderen und verliebt sich letztendlich in eine Illusion, die perfekt zu einem passt, die mit dem Menschen aber selbst nichts zu tun hat. Man will sich in sich selbst verlieben, in das Bild, das man von sich hat, wie man sich selbst sehen möchte.
„Narzisstische Verliebtheit ist einfach mal nichts anderes als der verzweifelte Versuch, sich selbst zu lieben“, sagte Till.
Wenn man es mal aus dieser Perspektive betrachtet, ist es schon sehr aufschlussreich zu sehen, warum wir uns überhaupt verlieben. Inwieweit unsere Gefühle etwas mit dem anderen zu tun haben. Wir verlieben uns in die Schnittmengen, die Gemeinsamkeiten zweier Leben, darum wird auf Dates auch so krampfhaft nach Gemeinsamkeiten gesucht. Darum gleichen sich Dates so sehr. Man verliebt sich nicht in einen Menschen, man verliebt sich in den Teil eines Menschen, der einem selbst ähnelt. Der in Ansätzen, Haltungen und Wünschen ein Ebenbild zu sein scheint.
„Liebe entsteht ja generell aus einer Illusion“, sagte Till. „Liebe ist die Sehnsucht nach absoluter Identität. Und absolute Identität gibt es natürlich nicht. Insofern entsteht Liebe nur aus einem großen Missverständnis. Kennst du den Satz: ‚Wir irrten aneinander, es war eine schöne Zeit?‘ Vielleicht liegt in diesem schönen, tragischen Satz eine der großen Wahrheiten unserer Zeit. Wir verlieben uns in eine Illusion, in ein Trugbild, in etwas Falsches, das uns Kraft und Halt gibt. Die Illusion ist für uns wahrer als die Wirklichkeit.“
Till machte eine Pause, während er gedankenverloren auf seinen Drink schaute. Dann hob er seinen Blick und sagte: „Im Grunde ist nur das Falsche wirklich echt. Alles andere ist ein armseliger Versuch, der zum Scheitern verurteilt ist.“
Puh, dachte ich. Vielleicht ist es ein Fehler, zu sehr über die Dinge nachzudenken. Ich blickte zu Till, der gerade an seinem Drink nippte, und spürte, dass das gerade einer dieser Momente war, in denen ich auf meine Beziehungen zurückblickte und mich fragte, ob ich je geliebt habe.
„Ich habe immer nur Talent für Dinge, die mich interessieren.“ Das hat Karl Lagerfeld einmal gesagt, und das ist ein sehr wahrer Satz. Eine der Überschriften über meinem Leben sozusagen. Lagerfeld bezieht sich natürlich auf seine Arbeit, aber wirklich interessant wird es, wenn man diesen Satz auf das Zwischenmenschliche anwendet. Auf die Frauen, mit denen man zusammen war. Nach dem Gespräch mit Till war ich mir nämlich nicht mehr so sicher, ob ich wirklich Talent für meine Exfreundinnen hatte. Vielleicht war ich rückblickend gesehen einfach zu sehr mit mir selbst beschäftigt, um Talent für sie haben zu können. Oder drastischer formuliert: Vielleicht war ich zu wenig an ihnen interessiert, um mich wirklich auf sie einzulassen.
Wie wir alle bin ich ja auch in dem Bewusstsein aufgewachsen, etwas Besonderes zu sein, etwas Einzigartiges, anders als die Anderen. Es ist ein Bewusstsein, dass es uns immer schwerer macht, uns auf einen anderen einzulassen. Ich glaube, genau dieses Problem zu bewältigen, das ist die Aufgabe der Liebe. Wenn man sich verliebt, also wirklich verliebt, lässt man die Strukturen, die gesellschaftlichen Konventionen hinter sich. Wirkliche Liebe gibt uns die Möglichkeit, wieder Mensch zu sein, kein degeneriertes Produkt dieser Gesellschaft. Liebe ist die Möglichkeit auszubrechen, die Strukturen zu verlassen, die Perspektive zu ändern. Sie ist unsere Chance, der Ausweg, den Egoismus hinter sich zu lassen, den unsere Gesellschaft von uns verlangt.
Auf Max Frischs Fragen „Lieben Sie jemand? Und woraus schließen Sie das?“ antwortete der Schriftsteller Jonathan Franzen: „Mein Herz sagt es mir, und mein gesunkenes Maß an Selbstsucht liefert verlässliche Beweise dafür.“ Besser kann man es wohl nicht formulieren.
Obwohl meine letzte Beziehung in die Brüche gegangen ist, habe ich in ihr viel über mich herausgefunden. Meine Freundin war der Spiegel, der mich Dinge erkennen ließ, die ich mir nicht eingestanden habe. Durch sie änderte sich die Perspektive. Ich entdeckte mich sozusagen noch einmal neu, mit einem frischen Blick. Ich sah neue Vorzüge, und ich sah meine Fehler. Ich begriff, dass es noch einiges zu tun gab.
Ich glaube, dass die Liebe zu jemandem in einem den tiefen Impuls auslöst, ein besserer Mensch zu werden. Für den anderen und für sich selbst. Und das haben meine Exfreundinnen tatsächlich in mir ausgelöst. Nicht permanent, aber immer mal wieder. Sie lösten in mir den Wunsch aus, die Selbstsucht zu überwinden. Ein besserer Mensch zu sein.
Und das ist die wunderbare Möglichkeit, die uns die Liebe gibt. Ein besserer Mensch sein zu wollen.
Wir sollten sie nutzen.
Lass uns einfach Freunde bleiben
Es gibt Sätze zwischen Männern und Frauen, die sehr grausam sind, obwohl sie auf den ersten Blick eher unscheinbar klingen. Mit einem dieser unscheinbaren Sätze setzt sich gerade mein guter Freund Markus auseinander.
Es ist der Satz: „Lass uns einfach Freunde bleiben.“
Seit einigen Monaten sehe ich Markus häufiger, weil er jemanden braucht, mit dem er die Dinge besprechen und auswerten kann, die ihn gerade so beschäftigen. Markus ist nämlich verliebt. Unglücklich verliebt.
Er trifft sich seit dem Sommer mit Josefine. Er mag sie wirklich sehr, aber er spürt auch, wie sie zurückweicht, wenn er ihr näher kommt. Sie ist nicht greifbar. Sie weicht ihm aus. Und es gibt viele schlüssige Gründe für ihr Ausweichen.
Immer wenn ich Markus treffe, berichtet er von anderen Motiven, warum sie gerade keine Gefühle zulassen kann. Anfangs war ihre letzte Beziehung noch zu gegenwärtig, später erklärte sie, dass es ihr schwer fällt, Männern generell zu vertrauen, sie kann sich gerade auf niemanden einlassen. „Aber wenn ich es wieder kann“, schreibt sie ihm. „Dann will ich mit dir zusammen sein. Du bist meine erste Wahl.“
Ihre erste Wahl?, dachte ich. Die Frage ist nur, wofür?
Ich kenne ihre Nachrichten. Markus zeigt sie mir bei jedem unserer Treffen, damit ich sie interpretiere, sie analysiere – damit ich ihm Hoffnung gebe.
Ich lese Sätze wie: „Eigentlich müsste ich total glücklich sein, dass jemand wie du mit mir zusammen sein will. Du bist so ein wertvoller Mensch, aber irgendetwas hindert mich daran, den letzten Schritt zu gehen.“ Allzu viel Hoffnung war da nicht zu erkennen. Es war klar, dass die Frau ihn hinhielt, dass sie mit ihm spielte. Vielleicht nahm sie es selbst gar nicht wahr. Sie mag ihn, aber mehr auch nicht. Und man darf nicht vergessen, dass es ein schmeichelhaftes Gefühl ist, begehrt zu werden. Auch (oder gerade) wenn man spürt, dass es ein aussichtsloses Begehren ist. Sie genoss es, und Markus litt. Sie genoss sozusagen sein Leiden – hoffentlich ohne es so richtig mitzubekommen. Bösartigkeit will ich hier schließlich niemandem unterstellen.
Am Montag war ich mit Markus in einem Café in der Torstraße verabredet. Er wartete schon an einem der Fenstertische, obwohl ich zehn Minuten zu früh da war. Er zeigte mir das Display seines Handys, bevor ich mich überhaupt gesetzt hatte. Und dann las ich ihn, diesen grausamen, so unscheinbar wirkenden Satz.
„Du bist so ein wertvoller Mensch“, las ich. „Ich hab dich gar nicht verdient. Wollen wir nicht einfach Freunde bleiben.“
Bleiben?, dachte ich irritiert. Das Wort „bleiben“ benutzt man doch in diesem Zusammenhang nur, wenn zumindest ansatzweise eine Freundschaft existiert hat. Schon ganz am Anfang ihrer Freundschaft, als meine Treffen mit Markus immer häufiger und verzweifelter wurden, hatte ich da meine Zweifel.
„Und, was denkst du?“, sagte Markus.
„Nun ja“, sagte ich und setzte mich erstmal. Dann gab ich der Kellnerin ein Zeichen und bestellte einen Milchkaffee.
„Freunde“, sagte ich. „Willst du das überhaupt?“
„Na klar“, sagte Markus ein bisschen zu schnell. „Sie ist wirklich wertvoll. Als Mensch. Ich will sie als Mensch nicht verlieren.“
Ich spürte einen dieser unangenehmen Schauer, die ich immer empfinde, wenn mir plötzlich sehr kalt wird oder wenn ich an etwas besonders Unangenehmes oder Peinliches denke. Es lag an Markus. Er klang schon so wie Josefines Nachrichten. Sie hatte ihn offensichtlich sozialisiert.
Als der Milchkaffee serviert wurde, vergegenwärtigte ich mir die Umstände, unter denen ich diesen Satz zu einer Frau gesagt habe: „Lass uns einfach Freunde bleiben.“
Wenn ich diesen Satz sage, meine ich ihn nicht ernst. Er ist eine Umschreibung dafür, dass ich nicht interessiert bin. So gesehen ist er eine Beleidigung. Alle Komplimente, die man um diesen Satz baut, sind nur Floskeln, damit der andere nicht zu sehr verletzt wird. Sie sind eine schöne Verpackung. Man mag den anderen ja schon irgendwie. Man will ihn nicht verletzen. Aber man will ihn in der nächsten Zeit auch nicht unbedingt in seiner Nähe haben.
Ganz unabhängig von Markus’ aussichtsloser Situation ist es natürlich eine gute Frage: Gibt es das eigentlich? Können Männer und Frauen Freunde sein?
„Freundschaft zwischen Männern und Frauen? Existiert nicht“, sagt mein Bekannter David.
„Es sei denn“ und an dieser Stelle macht er eine Kunstpause, „die Frau sieht scheiße aus.“
Das ist natürlich plakativ formuliert, aber im Grunde hat er recht. Es gibt Freundschaften zwischen Männern und Frauen. Es ist eine Frage der sexuellen Attraktivität. Eine Freundschaft zwischen Männern und Frauen ist möglich, wenn das Sexuelle ausgeblendet werden kann. Wenn sich keiner der beiden Hoffnung auf ein Liebesbeziehung macht.
Wenn ich darüber nachdenke, welche Frauen ich als Freunde bezeichnen würde, fällt mir keine ein, mit der ich schlafen würde. Ich habe eine Freundin, mit der ich mich sehr gut verstehe. Wir haben denselben Humor, es gibt kaum jemanden, mit dem ich so ausgelassen lachen kann. Sie lebt in Köln und wir sehen uns nur selten, aber wenn wir uns dann doch mal wieder treffen, ist es, als hätten wir uns vor einigen Tagen zum letzten Mal gesehen. Wenn ich mir jedoch vorstelle, mit ihr zu schlafen, spüre ich einen unangenehmen Druck in der Magengegend. Sie ist ein Kumpeltyp. Leider habe ich einmal den Fehler gemacht, ihr das zu sagen. Das war natürlich verletzend, obwohl es nicht so gemeint war. Sie spricht mich heute noch darauf an.
Vielleicht wäre ja die Freundschaft zu einer Exfreundin eine Möglichkeit. Man kennt sich sehr gut, hat aber in der Beziehung festgestellt, dass es nicht funktioniert. So gesehen kann man ein platonisches Verhältnis aufbauen.
Ein Bekannter hat mir einmal erzählt, dass er sich nach einiger Zeit mit seiner ersten großen Liebe getroffen hatte, in der Erwartung, sich viel zu erzählen zu haben. Er hoffte irgendwie, die gemeinsame Vergangenheit zumindest für die Dauer eines Abends zurückholen zu können. Im Laufe des Abends stellte er jedoch fest, dass mit dem Ende der Beziehung auch die Gesprächsthemen ausgegangen waren. Es gab keine Gemeinsamkeiten mehr. Es gab nichts mehr zu besprechen.
Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, fällt mir auf, dass ich zu keiner meiner Exfreundinnen mehr Kontakt habe.
Ich kenne einen Mann, der nur mit einer seiner Exfreundinnen befreundet sein kann. Er hat mir erzählt, woran das liegt. Sie ist für ihn sexuell nicht mehr interessant.
„Wir haben uns praktisch jeden zweiten Tag gestritten“, sagt er. „Nach zwei Jahren habe ich mit ihr nur noch Probleme verbunden. Ich konnte nicht mehr mit ihr schlafen. Ich bekam nicht einmal mehr eine Erektion.“
Er war asexuell in Bezug auf sie. Er empfand sie eher als jüngere Schwester. Darum funktioniert ihre Freundschaft. Die meisten seiner Freunde vermuten, dass sie ein heimliches Verhältnis haben, aber darüber kann er nur lachen. Da ist einfach nichts mehr. Aber die Vermutungen seiner Freunde erzählen die eigentliche Geschichte.
Männer sind eigentlich nicht für die Monogamie geschaffen. Sie sind auf der Jagd. Das hat evolutionsbiologische Gründe. Männer wollen sich fortpflanzen. Es ist Instinkt. Wenn ein Mann – sagen wir mal – in einem Jahr mit dreißig Frauen schläft, erzeugt er vermutlich mehr Nachkommen als jemand, der nur mit einer Frau Sex hat. Allerdings wird eine Frau, die in derselben Zeit mit dreißig Männern schläft, nicht unbedingt mehr Babys gebären als eine Frau mit nur einem Sexpartner.
Das Konzept der Monogamie ist ja religiös bedingt. Es presst unsere Triebe in ein Korsett. Wenn ein Mann seine Frau betrügt, wird sie sich höchstwahrscheinlich von ihm trennen. Man muss sich einschränken, sich andere Wege suchen, um seinen Instinkten nachzugehen, ohne seine Partnerin zu verletzen.
Das passiert vor allem im Kopf. Wenn Männer sich nach attraktiven Frauen umsehen oder wenn sie onanieren. Ich kenne einen Mann, der nur noch selten mit seiner Freundin schläft. Manchmal verreist sie aus beruflichen Gründen für einige Tage. Wenn sie weg ist, onaniert er bis zu fünf Mal am Tag. Er ist ein Sklave seiner Instinkte. Er kann nicht aus seiner Haut. Es hat schon seine Gründe, warum Porno-Websites die meistbesuchten Seiten im Internet sind.
Mit diesen für die Freundschaft zwischen Männern und Frauen ja sehr hoffnungslosen Gedanken tauchte ich wieder in die Unterhaltung mit Markus ein. Ich trank einen Schluck Milchkaffee, blickte in sein hilfloses Gesicht und musste an Ted Mosby denken. Ted Mosby ist der Protagonist der sehr erfolgreichen Serie How I met your mother. Die Serie erzählt seine Geschichte, und irgendwie hatte ich plötzlich den Eindruck, Teds Erlebnisse würden Markus Geschichte vorwegnehmen.
Ted verliebt sich in der ersten Folge der ersten Staffel in eine Frau namens Robin Scherbatsky, die attraktiver ist als es ihr Name vermuten lässt. Sie kommen zusammen, Robin wird auch schnell Teil von Teds engstem Freundeskreis. Dann trennen sie sich, versuchen es immer mal wieder, bevor sie mit einem seiner besten Freunde zusammen kommt. Ted hat immer noch Gefühle für sie, alle Frauen, die er kennenlernt, scheinen nur Ersatz zu sein. Die Serie umfasst neun Staffeln, das sind 196 Folgen. Robin ist als Teil des Freundeskreises immer gegenwärtig. In der letzten Staffel heiratet sie einen seiner besten Freunde und Ted zieht sich zurück, weil er immer noch Gefühle für sie hat.
Ted erzählt die Geschichte, er ist der Hauptdarsteller. Ich habe mich immer gefragt, warum ich die Figur nie wirklich ernst nehmen konnte. Dann fiel es mir auf, er ist ein Verlierer. Er ist einem nur irgendwie sympathisch, weil man sich selbst in ihm entdeckt, als man unglücklich verliebt war. Man mag ihn, weil man Mitleid mit ihm hat.
Ach Ted, dachte ich.
Ach Ted.
Ich bestellte zwei große Bier, obwohl es erst 15 Uhr war, und betrachtete das leuchtende Display von Markus Handy, das vor mir lag.
„Telefoniert ihr eigentlich miteinander?“, fragte ich. „Oder schreibt ihr euch nur noch Nachrichten?“
„Na ja“, sagte Markus.
Die Antwort genügte. Vielleicht wurde ihm auch gerade selbst klar, was die beiden da kultivierten.
Die Gläser wurden serviert, wir stießen an. Dann begann ich, Markus Ted’s Geschichte zu erzählen. Ich erzählte sie allerdings, als wäre sie einem Bekannten von mir passiert. Ich wollte Markus nicht das Argument liefern, dass sich Drehbuchautoren die Geschichte ausgedacht hätten. Dass sie nichts mit der Realität zu tun hatte.
Während ich sprach, wirkte Markus immer verzweifelter. Ich nahm ihm schließlich gerade die Hoffnung, verhielt mich damit aber – im Gegensatz zu Josefine – wirklich wie ein Freund.
Letztlich muss er selbst entscheiden. Wie Ted muss er allein an den Punkt kommen, an dem er erkennt, dass es ihm ohne sie besser geht. Ted hat natürlich das Glück, Teil einer amerikanischen Serie zu sein – die letzte Folge gibt dann doch Hoffnung auf eine Zukunft mit Robin. Im echten Leben läuft es anders.
Markus muss da alleine durch. Leider.
Ach Markus, dachte ich wehmütig, während ich sprach.
Ach Markus.
Schon mal über eine Trennung nachgedacht?
Einige kennen das vielleicht: Gerade ist die Beziehung eines Freundes in die Brüche gegangen, dessen Exfreundin man – wenn man ehrlich ist – eigentlich nie so richtig mochte. Man trifft sich mit ihm, weil man ja für ihn da ist, und kann jetzt endlich mal die Wahrheit sagen. Man kann endlich sagen, was man von ihr gehalten hat.
Viele sagen ihren Freunden erst nach ihrer Trennung, was sie wirklich von deren Partnern gehalten haben. Oder der Beziehung. Das ist sicherlich vernünftig. Man will sich ja nicht einmischen. Auch bei Paaren, die jahrelang eine Beziehung führen, obwohl sie eigentlich gar nicht zusammenpassen. Die nicht glücklich sind, nicht einmal zufrieden, die weitermachen, warum auch immer.
Es stellt mich immer wieder vor Rätsel, wie viele Jahre solche Konstrukte halten können. Manchmal halten sie sogar ein Leben lang. Manchmal frage ich mich schon, was diese Paare zusammenhält. Irgendetwas muss sie ja verbinden. Irgendetwas muss doch da sein. Irgendetwas! Aber manchmal ist da einfach nichts zu finden.
Zum letzten Mal habe ich mir diese Fragen im Sommer gestellt, als ich meinem alten Freund Stephan einen Rat gab, den ich ihm eigentlich nicht geben durfte. Es war ein angenehmer Sommernachmittag. Wir saßen im Biergarten des Café Schoenbrunn im Volkspark Friedrichshain, und weil wir uns lange nicht gesehen hatten, gab es viel zu besprechen. In seinem Leben schien alles gut zu laufen. Er erzählte mit leuchtenden Augen von seiner dreijährigen Tochter, er plante gerade mit seiner Freundin, eine Eigentumswohnung zu kaufen, und auch beruflich lief alles ausgezeichnet. Alles schien zu passen. Als die zweite Runde Weizen serviert wurde, passierte allerdings etwas, das alles änderte.
Stephans Handy klingelte.
Er nahm es mit einem Lächeln aus der Innentasche seines Jacketts. Als er den Namen auf dem Display sah, veränderte sich sein Gesicht. Sein Lächeln war nicht mehr da. Er hielt das Handy unschlüssig in der Hand und betrachtete es mit einem unwilligen Gesichtsausdruck. Als wäre er gestört worden.
„Geh doch ran“, sagte ich.
„Ach“, sagte er. „Ist nicht so wichtig.“
Als das Klingeln aufhörte, stellte er sein Telefon auf lautlos und legte es sehr behutsam auf die Tischplatte.
„So“, sagte er, nahm sein Glas und wir stießen an. Als ich das Glas absetzte, begann sein Handy zu vibrieren. Dann noch einmal, und noch einmal. Es hörte nicht auf. Das Vibrieren begleitete unser Gespräch, was den Gesprächsfluss nicht unbedingt verbesserte.
„Wer ist denn das?“, fragte ich irgendwann ungeduldig.
„Das ist meine Freundin“, sagte Stephan. „Die weiß doch ganz genau, dass wir uns heute treffen.“
„Da kannst du doch rangehen.“
„Na ja“, sagte Stephan und machte eine abwehrende Geste. Er sah aus, als wollte er noch etwas sagen, schien es sich jedoch anders zu überlegen. Dann sagte er: „Okay, ich ruf sie mal kurz an. Bin gleich wieder da.“ Er griff nach dem Handy und erhob sich.
Nun ja.
Sagen wir es so: Es war ein „kurz“, das eine gute Stunde dauerte. Ein „kurz“, in dem ich zwei weitere Weizen schaffte, während ich Stephan hektisch gestikulierend über die tiefgrüne Wiese vor dem Biergarten laufen sah. Ich ahnte, dass hier gerade die Wirklichkeit in die perfekte Welt brach, die Stephan in der ersten Stunde unseres Treffens beschrieben hatte. Die sorgfältig modellierte Fassade war gerissen. Allerdings ahnte ich noch nicht, wie schlimm es wirklich um ihn stand. Noch nicht.
Als Stephan wieder an den Tisch trat, leerte er sein Weizen in einem Zug und stellte das Glas resolut auf den Tisch.
„Was war denn los?“, fragte ich.
„Also“, sagte er und setzte sich entschlossen.
Dann schüttete er mir sein Herz aus.
Wenn man frisch verliebt ist, ist es ja ganz natürlich, dass man sich erst einmal zurückzieht. Man verbringt viel Zeit mit der neuen Liebe und vernachlässigt seine Freunde. Ich kenne das. Jeder kennt das. Allerdings löst sich das nach einer gewissen Zeit wieder auf. Eigentlich. Stephan war jetzt allerdings schon seit fünf Jahren mit Anja liiert. Fünf Jahre, in denen Freunde kaum noch in seinem Leben vorkamen.
Es begann ganz harmlos, als Anja ihm vorschlug, alkoholfreie Wochen einzuführen. Ein Gedanke, der zunächst gar nicht schlecht klang, wie er fand. Also stimmte er zu. Als er sich jedoch während dieser Wochen doch einmal spontan mit Freunden traf und zwei Bier trank, warf Anja ihm vor, dass er ihr Vertrauen missbraucht hätte.
„Ich weiß nicht, ob ich dir überhaupt noch vertrauen kann“, sagte sie.
Dann hielt sie ihm vor, dass er sowieso lieber Zeit mit seinen Freunden verbrachte, weil er mit ihnen ja offensichtlich mehr Spaß hatte als mit ihr.
Stephan erzählte, dass er inzwischen Strategien entwickelte, wie er ihr am besten die seltenen Abende verkaufte, die er mit seinen Freunden verbrachte, um die Harmonie ihrer Beziehung für die nächsten Tage nicht zu gefährden. Generell schienen Deeskalationsstrategien der Faden zu sein, der sich durch ihre Beziehung zog. Stephan schilderte, wie er sie entwarf und verfeinerte, mit einer Art verzweifelter Euphorie. Sie waren offenbar zu seinem Hobby geworden.
Aber sie halfen nicht.
Sie stritten immer häufiger. Genau genommen stritten sie sich ständig. Anjas Argumentationen wurden immer unsachlicher, obwohl er nicht sicher war, ob man ihre Argumentationen überhaupt noch als Argumentationen bezeichnen konnte. Aber wahrscheinlich kam es darauf auch nicht mehr an. Sie waren nicht in der Lage, miteinander zu sprechen, sagte Stephan. Eigentlich redeten sie aneinander vorbei, seitdem sie zusammen waren. Einmal hatte Anja einen Streit mit den Worten „du Wichser“ beendet, während sie ihre Tochter im Arm hielt. Mia hatte ihn ängstlich und mit großen Augen angesehen, und Stephan hatte sich vorgestellt, wie ein unbeteiligter Dritter diese Szene aufgenommen hätte. Sie erinnerte an das Klischee einer sozial benachteiligten Familie, die man in diesen Reality-Formaten auf RTL2 sehen kann. Das war schon erschreckend. Seitdem ging er nicht mehr auf ihre Streitereien ein.
Das war der Moment, in dem ich mich aufsetzte.
Vielleicht habe ich zu naive Ansprüche an eine Beziehung, aber ich denke, Beziehungen sind auch dazu da, dass die Partner einander Kraft geben. Aber Anja schien ja eher wie ein schwarzes Loch zu sein: Alles, was man ihr gab, wurde verschluckt. Es war nicht mehr vorhanden. Es kam nichts zurück.
„Schlaft ihr eigentlich noch miteinander“, fragte ich.
„Nun ja“, sagte Stephan.
Sie hatten ja generell nicht so viel Sex gehabt in den letzten Jahren, aber nachdem Anja schwanger geworden war, hatten sie gar keinen mehr. Mia war jetzt drei Jahre alt. Vier Jahre ohne Sex. Vier Jahre ohne Orgasmus. Er konnte sich nicht einmal selbst befriedigen. Sie war immer da. Immer gegenwärtig. Und im Büro wollte er nun wirklich nicht onanieren.
Auf der letzten Weihnachtsfeier hatte er betrunken eine Kollegin geküsst. Zwanzig Minuten lang. Es war befreiend gewesen, eine Ahnung, wie es sein könnte, obwohl er annahm, Anja nicht mehr in die Augen sehen zu können. Aber als er am nächsten Morgen mit ihr am Frühstückstisch saß, war alles wie immer. Er hatte kein Schuldbewusstsein. Er hatte erwartet, dass es ihn mehr bewegen würde. Aber es bewegte ihn weniger, als es ihn wohl hätte bewegen sollen.
Er flüchtete sich in die Arbeit, es war seine Rückzugsmöglichkeit, er war seit Monaten der Letzte im Büro. Er war immer müde.
Wahrscheinlich begriff Stephan ja gerade doch irgendwie, dass er die brüchige Fassade ihrer Beziehung nur aufrechterhielt, weil sie das Einzige war, was sie noch hatten.
„Was soll ich denn machen?“, fragte er, als er seine Schilderung beendet hatte.
Tja, dachte ich. Was sollte er machen?
Die beiden führten keine Beziehung, sie kultivierten die Reste einer Beziehung. Und dass offensichtlich schon ziemlich lange. So gesehen wäre mein Rat gewesen, sich zu trennen. Aber ich wusste, wie vermessen es ist, solche Ratschläge zu geben. Ich hatte ja auch zu wenig Einblick in die Beziehung, um so einen folgenschweren Rat zu geben. Ich kannte nur Stephans Schilderungen.
Und dann war da ja noch das Kind. Das war dann doch eine Nummer zu groß. Eine Freundin hat mir einmal erzählt, dass sie viele Frauen kennt, die nur noch wegen der Kinder mit ihren Männern zusammenleben. Die heimlich die Jahre zählen, bis die Kinder aus dem Haus sind, bis sie sich endlich trennen können. „Sie wahren den schönen Schein so lange, bis alles auseinander fällt“, sagte sie.
Ich bin mir nicht sicher, ob dies das Beste für das Kind ist.
Ich wollte nicht eingreifen. Aber weil ich ja weiß, wie hilfreich es für Stephan sein kann, hin und wieder darüber zu reden, um sich und sein Leben zu reflektieren, um selber zu den richtigen Schlüssen zu kommen, sagte ich: „Wie sieht’s denn bei dir am Samstag aus? Wir können ja mal wieder ein Bier trinken gehen?“
„Am Samstag“, sagte Stephan gedehnt. „Das ist ein bisschen kurzfristig, ich weiß noch nicht, glaube nicht. Ich muss das erst mit Anja besprechen. Ich muss erst mal sehen, ob ich frei kriege.“
Gott, dachte ich, und dann sagte ich es auch.
„Wann hast du denn mal wieder Zeit?“, fragte ich.
„Ich glaub, ich komm dann lieber zu deinem Geburtstag“, sagte Stephan nach einem längeren Zögern.
„Mein Geburtstag?“, sagte ich. „Der ist im Februar.“
„Tja, das sind die Zeitfenster, in denen ich rechne.“
„Tja“, sagte auch ich, weil mir dazu nun wirklich nichts mehr einfiel.
In seiner Beziehung waren die Rollen offenbar verteilt. Und so wie es aussah, hatte sie Stephan nicht verteilt.
Und dann passierte es. Ich gab Stephan einen Rat, den man eigentlich nicht geben darf: „Trenn dich von ihr“, sagte ich eindringlich. „Um Gottes willen – trenn dich von der Frau.“
Stephan sah mich an. Es war ein merkwürdiger Moment. Voller Spannung. Wie eine gespannte Saite, die kurz davor ist zu reißen.
Dann sagte Stephan: „Vielleicht hast du recht.“
Offenbar war die Saite gerade gerissen.
Ich begriff, dass ich ab sofort nicht mehr der außenstehende Beobachter war. Jetzt war ich Teil der Geschichte. Eine handelnde Figur. Das konnte zu Komplikationen führen, vor allem, wenn man Anjas psychische Anlagen berücksichtigte. Ich sah Stephan schon vor mir, in dem Streit mit seiner Freundin, nachdem er ihr seinen Entschluss mitgeteilt hatte.
„Ach, und übrigens“, hörte ich ihn sagen, „Michael ist der gleichen Ansicht.“
Ich stellte mir vor, wie ich mit Stephan in einem halben Jahr zusammensitze, nachdem sein Leben auseinandergefallen ist. Ich stellte mir vor, wie er mir mit brüchiger Stimme sagt: „Du hast doch gesagt, ich soll mich trennen.“
Ich dachte einen Moment lang darüber nach. Dann wusste ich, dass ich richtig gehandelt hatte. Hätte ich nichts gesagt, hätte ich mir ewig Vorwürfe gemacht. Es gibt Beziehungen, die nur noch funktionieren, weil man den Schein wahren will. Auch vor sich selbst. Weil man die Realität nicht sehen will, weil man sich vor Veränderung fürchtet oder weil man einfach zu nah dran ist. Man biegt sich die Dinge zurecht, damit man besser damit leben kann.
Und dafür sind Freunde da. Um ehrlich zu sein. Um jemandem auch mal die Augen zu öffnen und mit dem Blick des objektiven Beobachters auf seine Beziehung sehen zu lassen. Das schaffen die meisten nämlich nicht.
Das ist jetzt einige Monate her. Sie haben sich nicht getrennt. Sie sind gerade in eine Eigentumswohnung gezogen. Beruflich läuft alles ausgezeichnet. Alles passt. Sie gelten als perfektes Paar. Als perfekte Familie. Die Fassade stimmt. Der Schein wird wieder gewahrt. Auch vor sich selbst. Die beiden machen weiter.
Immer weiter.
Tja, dachte ich. So kann man auch ein Leben verbringen.
Leider, muss man wohl sagen.
Von Mingles und Menschen
Vor einigen Tagen hat mich eine Journalistin während eines Interviews gefragt, ob das Thema Liebe irgendwann einmal auserzählt sein wird.
„Nein“, erwiderte ich nach kurzem Zögern. „Die Menschen verändern sich ja, in der heutigen Gesellschaft schneller denn je. Und mit diesen Veränderungen ändern sich auch die Gegebenheiten für die Liebe. Das Thema kriegt immer neues Material, es wird nie auserzählt sein.“ Ich trank einen Schluck von meinem Milchkaffee, bevor ich fortfuhr.
„Gerade sind es ja die Mingles“, sagte ich.
Die Journalistin nickte. Sie wusste offensichtlich genau, was ich meinte. Für diejenigen, denen der Begriff „Mingle“ nichts sagt, muss ich jetzt wohl ein wenig ausholen, und zwar zu einem ziemlich bemerkenswerten Gespräch mit Thomas.
Ein halbes Jahr nachdem er mit seiner Freundin zusammengezogen war, erzählte er mir bei einem Feierabendbier, dass der Entwurf des Zusammenlebens eigentlich gar nicht zu ihm passt.
„Ich brauch schon meinen Freiraum, das merk ich gerade“, sagte er. „Wenn jeder seine eigene Wohnung hat, das ist doch für eine Beziehung ideal.“
„Ach?“, fragte ich überrascht, weil ich ja wusste, wie konkret seine Freundin seit einiger Zeit über ihre Schwangerschaftspläne sprach. Ich zögerte, bevor ich fragte: „Auch wenn das Kind da ist?“
„Gerade dann“, sagte er. „Weißt du, wie das erste halbe Jahr nach der Geburt aussieht?! Dann brauche ich auf jeden Fall ’ne eigene Wohnung.“
„Hast du ihr das so gesagt?“, fragte ich.
„Na ja, nicht mit diesen Worten“, sagte er. „Also eher indirekt. Das merkt sie doch.“
„Klar“, sagte ich. „Aber an deiner Stelle würde ich es ihr schon unverschlüsselter sagen – am besten bevor sie schwanger ist.“