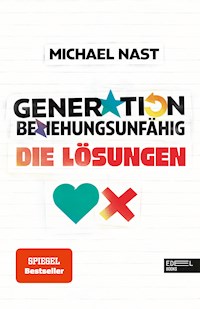17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Wieso fühlen wir uns so verloren in unseren vollgepackten, durchorganisierten Leben? Warum empfinden wir die endlosen Wahlmöglichkeiten nicht als Freiheit, sondern immer öfter als Belastung? Viele Menschen merken, dass etwas fehlt, wissen aber nicht, was sie vermissen. Michael Nast geht es nicht anders – er erkennt, dass er sich oft mit Dingen beschäftigt, die vermeintlich zu einem erfüllten Leben gehören, aber eigentlich nicht das Richtige für ihn sind. In seinen Texten hinterfragt er unsere modernen Lebensgewohnheiten und Denkmuster kritisch und regt dazu an, die eigenen Prioritäten zu überdenken. Indem er Gefühle in Worte fasst, die wir alle kennen, hilft er uns dabei, uns mit den eigenen Bedürfnissen und Wünschen auseinanderzusetzen. Denn wenn wir uns von äußeren Erwartungen lösen, können wir ein erfüllteres Leben führen. »Michael Nast ist ein Phänomen.« Die Zeit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Steffen Jänicke
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Bereit für die nächste Sitzung
Die To-do-Liste, die man Leben nennt
Mir fiel auf, dass ich lächelte
Verlassen und Verlassenwerden
»Wie es sich anfühlt, der andere zu sein«
Im »Hätte, wäre, wenn«-Leben
Der Gilmore Boy
Mein tägliches Auf-morgen-Verschieben
In der Clickbaiting-Wirklichkeit
»Das ist hier Nazizeit und SED und alles zusammen«
80 Millionen Experten
Eher »Berlin – Tag & Nacht« als »ZDF Magazin Royale«?
McDonald’s für den Verstand
Der Blick auf die Versäumnisse
Tinderfrustriert – das Dating-App-Handhabungsproblem
Empathie gibt’s nicht im Appstore
Die Dinge, die man nicht kaufen kann
»Das ist keine Liebe, das ist ganz was anderes.«
Der Singleblick
Das Glück der Check24-Familie
Die Messbarkeit des Glücks
Das Missverständnis vom Erwachsensein
Ein perfektes Beinaheleben
Die Risse in den Fassaden
Was Paare sich verschweigen sollten
… und aus Liebe wurde Hass
Ein Tiefkühlgerichtleben
Müssen alle Eltern zum Psychologen?
Man nennt es Gier
Wir Lifestyle-Gestörten
Die Filtereinstellungen des Lebens
Die Bedeutung des Abschiednehmens
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Bereit für die nächste Sitzung
Ein Vorwort
Was mich an der Arbeit als Autor schon immer angezogen hat, war die Idee, mich in dem reichhaltigen Rohstoff zu bewegen, aus dem meine Texte entstehen. Teil des Materials zu sein. Ich werde oft gefragt, ob es nicht anstrengend sei, die Welt auf diese Art zu betrachten. Fortwährend alle und alles zu analysieren, zu bewerten oder in Zusammenhänge einzuordnen? Es müsse doch belastend sein, jede Unterhaltung, jedes Date oder jedes Familientreffen zu einer Charakteranalyse zu machen. Nähme mir das nicht jede Ungezwungenheit? Könne ich meinen Alltag durch dieses fortwährende Abtasten und Bewerten überhaupt noch genießen? Solche Fragen stellen sogar gute Freunde, dennoch entstehen sie aus einem Missverständnis.
Es ist ja nicht so, dass ich mich permanent mit einem analytischen Blick durch meinen Alltag bewege. Für mich gibt es zwei Arten, die Welt zu betrachten. Es gibt den Blick des Menschen aus dem Leben, dessen Teil ich bin, und es gibt den Blick des Autors.
Manche Texte sind klüger als der Mensch, der sie geschrieben hat. Das hat der Dramatiker Heiner Müller mal in einem Interview gesagt. Ich glaube, meine Texte sind generell klüger als ich. In ihnen sehe ich mehr als die Person, die ich in meinem Alltag bin. In ihnen beschäftige ich mich mit den Dingen, komme zu Schlüssen, zu denen ich unmittelbar gar nicht kommen würde. Erst unter dem Blick des Autors – wenn ich mich an meinen Schreibtisch setze und mich aus der Welt zurückziehe, um sie mit Abstand zu betrachten –, erst dann wird das Leben zu Material.
Der Blick des Autors ist manchmal gnadenlos. Jemanden mit diesem Blick zu sehen kann für das Gegenüber schnell verletzend, schmerzvoll und enttäuschend sein. Gerade am Anfang, in meinen ersten publizistischen Texten, als ich die Verletzungen, die ich anderen damit zufügte, noch nicht einschätzen konnte, hat er mich nicht wenige Bekanntschaften gekostet, und auch zwei Freundschaften sind über die Jahre dadurch abgekühlt.
»Es gehört ja zu deiner Jobbeschreibung, vor allem das Negative zu sehen«, sagt ein guter Freund gelegentlich, wenn er fürchtet, durch eine unbedachte Äußerung in meinen Texten aufzutauchen.
Seine Feststellung dient der Abwehr. Er möchte meine Arbeitsweise so sehen, um sein Selbstbild nicht zu beschädigen. Aber er hat diese Äußerungen ja getätigt, er will sich nur nicht so sehen. Mein guter Freund übersieht, dass auch seine eigene Sicht verstellt ist. Sie behindert den Blick auf sich selbst. Den Blick auf das Echte.
Das geht mir selbst genauso: Ich stehe zu nah vor meinem Spiegelbild. Ich nehme das Fehlerhafte in meinem Leben gar nicht wahr. Ich neige dazu, alles, was mir widerfährt, in seiner Unmittelbarkeit zu beurteilen. Ich richte meine Aufmerksamkeit vor allem auf die Details, ohne das Gesamtbild zu erfassen. Während ich mich auf die Einzelheiten stürze, verliere ich das große Ganze aus den Augen. Vielleicht weil etwas in mir nicht das eigentliche Problem sehen will, das unter dem Alltäglichen verborgen liegt.
Mit dem Blick des Autors schaffe ich einen Abstand zu mir selbst, über den ich mich neu zu sehen lerne. Vielleicht sogar, mich besser zu verstehen. Nicht als Methode, eher als Nebeneffekt. Interessanterweise fällt es mir während des Schreibens gar nicht auf. Erst auf Lesungen, wenn ich die Texte laut vortrage, wird mir oft klar, wie gnadenlos dieser Blick beim Schreiben ist.
Ihn wende ich in meinen Texten allerdings vor allem auf mich an. Wenn ich mich dadurch gebrochen anschaue, indem ich mich selbst als Material verstehe, Verhalten und Gefühle sichte, analysiere und einordne, entdecke ich Zusammenhänge zwischen Ereignissen, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, aber auf einer tieferen Ebene wie selbstverständlich miteinander verwoben sind.
Ich nehme keine Rücksichten auf andere, aber vor allem nehme ich keine Rücksichten auf mich. Das Schreiben hilft mir, die Dinge, die ich in meinem Alltag oft nur betrachte, wirklich zu sehen. Auch wenn ich in einen Spiegel blicke. Der Blick des Autors macht meine Texte zu einer gnadenlosen Selbsttherapie.
Die meisten Irrtümer meines Lebens erkenne ich oft erst an ihren Folgen. Das liegt daran, dass ich viele davon gar nicht als Irrtümer erkenne. Wenn ich mich in meinem Alltag bewege, fehlt mir die nötige Distanz, um sie wahrzunehmen. Mir fehlt einfach der Überblick. Mir ist schon klar, dass ich mich immer in den Ergebnissen des Lebens bewege, das ich bisher geführt habe. Eine unübersichtliche Kette von Entscheidungen und Nichtentscheidungen, die mich in meinen gegenwärtigen Alltag geführt haben. Wie ich mich auch entschied, es erschien mir in dem Moment vollkommen schlüssig und gerechtfertigt. Ich stellte meine Entscheidungen nicht infrage. Wenn ich allerdings ihre Folgen betrachte, sieht das schon etwas anders aus.
Als Mensch geht es mir unter anderem darum, Antworten zu finden, mit denen ich gut leben kann. So funktionieren auch die meisten dieser Zitatbilder, mit denen die sozialen Medien überschwemmt werden. Sie geben Antworten, die ein Aha-Erlebnis auslösen, aber letztlich nicht so sehr schmerzen, dass man wirklich etwas ändern würde. Denn darum geht es doch am Ende: dass es nicht wehtut. Aber Antworten, die nicht wehtun, sind nur Schmerzmittel.
Ich habe erst spät begriffen, dass die meisten Probleme in meinem Leben nur Folgen sind. Symptome tiefer liegender Themen.
Wie jemand, der den Fehler macht, die Anzeichen einer Erkrankung für die Erkrankung selbst zu halten, neige ich seit Jahren zu den falschen Schlüssen. Ich beschäftigte mich sehr eingehend mit den Symptomen, wich aber meist der Frage aus, was diese hervorgerufen hat. Ich analysierte sie dann zwar, versuchte sie abzumildern, wurde aber immer ratloser, weil ich trotz aller Maßnahmen zu keinen zufriedenstellenden Resultaten gelangte. Ich steckte in meiner ganz persönlichen Schmerztherapie fest. Mit ihr bewegte ich mich immer nur auf der Oberfläche.
Aber mein Blick als Autor bricht die Oberflächen auf. Er stellt die Frage nach dem »Warum«, das hinter dem »Warum« liegt, um nach dem »Warum« zu fragen, das wiederum dahinterliegt. Man kann das endlos so fortführen und hinter jede Antwort ein neues Warum setzen. Es ähnelt dem Gespräch mit einem Kind, das immer weiter nachfragt, obwohl man annimmt, längst eine zufriedenstellende Antwort gegeben zu haben. Obwohl man nun seine Ruhe haben will. Bei einem Kind ist es ein Spiel, aber wenn man dieses Spiel ernst nimmt, ist es eine Methode, die Dinge zu Ende zu denken.
Das ist es, was ich mit »Es muss wehtun« meine. Weiterzufragen, obwohl man annimmt, die Antwort schon gefunden zu haben, mit der man eigentlich ganz gut leben kann. Immer weiter. Bis einem die Antworten nicht mehr gefallen. Bis sie wehtun. Erst dann kann man die Schmerzmittel absetzen.
Die Texte in diesem Buch sind voller Symptome. Symptome, die ich lange für die eigentlichen Probleme gehalten habe. Vielleicht geht es Ihnen bei der Lektüre ähnlich. Vielleicht finden Sie sich in Texten dieses Buches wieder, aber erst wenn Sie sich angegriffen fühlen oder Passagen persönlich nehmen, berühren sie den Kern.
Es kann sehr aufschlussreich sein, eigene Gewissheiten zu prüfen, die einem so klar und unverrückbar erscheinen, indem man die Haltung, mit der man sich durchs Leben bewegt, nach ihren Folgen beurteilt. Vielleicht ist das die eigentliche Klammer, die die Texte dieses Buches zusammenhält. Vielleicht ist es das, was mir mein Blick als Autor eigentlich sagen will. Er fordert mich auf, meine Gewissheiten zu prüfen. Vor allem die über mich selbst. Genau darum geht es in diesem Buch.
Ich muss nur bereit sein. Dafür, mein Smartphone auszuschalten, mich an meinen Schreibtisch zurückzuziehen, um mich und mein Leben mit Abstand zu betrachten. Ich muss nur bereit sein.
Bereit für die nächste Sitzung.
Die To-do-Liste, die man Leben nennt
Von der Gefahr, ein gefülltes für ein erfülltes Leben zu halten – wenn man das Leben wie eine To-do-Liste behandelt.
Auf meinem Schreibtisch liegt ein Notizblock, den mir eine Freundin zu einem meiner letzten Geburtstage geschenkt hat. Erst seitdem ich ihn besitze, verstehe ich, wie wertvoll er für jemanden wie mich ist. Ich notiere mir jeden Morgen die Dinge, die ich erledigen muss. Das ist notwendig, weil ich oft vergesse, was ich erledigen muss.
Für Dinge, die ich gern mache, brauche ich keine To-do-Listen. Ich muss mich nicht daran erinnern, mich jeden Morgen an den Schreibtisch zu setzen. Zu schreiben, ist mir ein Bedürfnis, das allgegenwärtig ist. Ich habe mir vor einigen Monaten angewöhnt, ein oder zwei Stunden am Tag zu lesen, aber mir würde nie einfallen, diesen Punkt auf meine To-do-Liste zu setzen. Ich arbeite keine Dinge ab, die mir etwas geben.
Meine tägliche Liste hat allerdings einen ungewöhnlich starken Effekt, der nicht ungefährlich ist. Weil sich durch sie etwas verschiebt. Wenn ich einen der Stichpunkte abstreiche, habe ich tatsächlich das Gefühl, etwas geschafft zu haben, auch wenn es Erledigungen sind, die ich nur in Kauf nehme. Das potenziert sich noch einmal, wenn ich am Abend die Seite mit den geschwärzten Punkten abreiße, um sie mit großer Geste in den Papierkorb zu werfen.
Meine To-do-Liste zerteilt meinen Tag in nützliche Abschnitte. Sie macht Erfolge sichtbar. Auch vermeintliche Erfolge, die mir eigentlich fremd sind.
Ob ich die Belege für meinen Steuerberater zusammentrage oder Anrufe bei Behörden erledige, meine tägliche Liste gibt mir das Gefühl, dem vergangenen Tag einen Sinn gegeben zu haben. Je länger die Liste war, die ich abgearbeitet habe, desto nützlicher scheint der Tag gewesen zu sein. Jede durchgestrichene Erledigung gibt mir das Gefühl, die Zeit ein bisschen besser genutzt zu haben. Sobald ich einen weiteren Stichpunkt streichen kann, denke ich: Wieder was geschafft.
Das macht diese Liste so gefährlich. Sie vermittelt mir Erfolgserlebnisse, die gar keine sind. Es sind künstliche Erfolgserlebnisse, die nichts mit mir zu tun haben. Mein Gefühl, dem vergangenen Tag einen Sinn gegeben zu haben, darf sich einfach nicht aus Erledigungen zusammenfügen, die ich eigentlich nur in Kauf nehme, weil sie mir fremd sind, denke ich dann. Die To-do-Liste darf nicht mein Leben bestimmen.
Erledigungen füllen mein Leben, Erlebnisse erfüllen es. Die Gefahr liegt darin, das nicht zu verwechseln. Meine Familie hilft mir dabei.
In meiner Familie gibt es einen Running Gag, in dem die Formulierung »Wieder was geschafft« eine zentrale Rolle spielt. Ich kann gar nicht mehr sagen, wie genau dieser Scherz entstand, aber inzwischen machen wir ihn pausenlos.
Wir verwenden den Ausspruch universell, vor allem in Zusammenhängen, in denen es eigentlich absurd ist, ihn zu benutzen. Wenn wir zu Mittag gegessen haben, sagt immer irgendjemand: »Wieda wat jeschafft.« Wenn wir von einem gemeinsamen Spaziergang zurückkehren. »Wieda wat jeschafft.« Wenn wir uns verabschieden. »Wieda wat jeschafft.«
Es ist ein Scherz, der sich nicht verbraucht. Weil wir so oft darüber lachen, fällt uns auch kaum noch die Tragik auf, die über dieser Bemerkung liegt, indem wir sie für die Dinge zweckentfremden, die man genießt.
Wir verstehen unseren Running Gag natürlich nicht als Zivilisationskritik, man könnte ihn aber so verstehen. Ich meine, wie viel Tragik würde in einem Alltag liegen, den man jeden Tag aufs Neue nach einer inneren Liste abarbeiten würde. Wenn man ihn in »Wieda wat jeschafft«-Abschnitte unterteilen würde. Was für eine erbärmliche Form von Existenz wäre es, ein gefülltes Leben mit einem erfüllten zu verwechseln, denke ich. Dann fällt mir allerdings ein, dass dieser Satz meinen Alltag eigentlich gut beschreibt. Ein Großteil meines Alltags entspricht diesem Satz. Es fällt mir nur nicht mehr auf, weil ich mich daran gewöhnt habe.
Nicht nur meine handgeschriebene Liste, auch die Technik hilft mir dabei, meine Tage zu zerstückeln. Sie macht die Abschnitte sichtbar, in die ich meinen Alltag zerteile. Sie bilden meine digitale To-do-Liste als fortwährendes Live-Experiment.
Mein Alltag setzt sich aus Countdowns, Stoppuhren und Weckern zusammen. Der Timer meines Smartphones ist meine meistgenutzte App. Er erinnert mich daran, wann die Wäsche fertig, mein Ingwertee durchgezogen ist oder wann ich beim Sport den nächsten Satz machen muss. Das ist ein 50-Sekunden-Countdown. Ich tracke jede Radtour, um die Statistik nicht zu gefährden. Ich nutze mein Smartphone auch als Duschwecker. Weil ich zu Hause arbeite, dusche ich nicht morgens, sondern erst, wenn ich die Wohnung verlasse. Meine Morgenroutine verlagert sich auf den Nachmittag. Mein Duschwecker erinnert mich, wann ich sie beginnen muss, ohne dass es stressig wird.
Manchmal spüre ich das beunruhigende Gefühl, der Technik meine Entscheidungen zu überlassen. Mein Smartphone ist zu einem Sinnesorgan geworden, das mir mein Zeitgefühl abnimmt. Ich würde gar nicht mehr daran denken, dass die Wäsche fertig ist, wenn mein Smartphone mich nicht daran erinnern würde. Ohne mein iPhone wäre ich Michael, der Unbeholfene. Eine hilflose Person. Vollkommen orientierungslos. Auch keine Entwicklung, die für mich spricht.
Aber es gibt dann doch diese befreienden Momente, in denen ich vergesse, dass mein Smartphone existiert. Momente, in denen es keine To-do-Listen gibt, die abgehakt werden müssen. Momente, die mir zeigen, dass es noch Hoffnung gibt.
Es gibt einen wunderbaren, beinahe ausgestorbenen Begriff, den ich liebe. Es ist der Begriff »Flanieren«. Er klingt seltsam antiquiert, sicherlich auch weil er nicht mehr in unsere Gegenwart passt, in der Müßiggang als Untätigkeit empfunden wird. Als verschwendete Lebenszeit.
Ich bin ein Flaneur. Ich genieße stundenlange ziellose Spaziergänge durch die Stadt, während ich in ein langes, ebenfalls zielloses, immer wieder neue Themen berührendes Gespräch vertieft bin. Es sind Spaziergänge, auf denen ich stundenlang meine Gedanken treiben lassen kann, als würden die fest gefügten Gewohnheiten meines Alltags mein Denken nur in einem begrenzten Raum möglich machen.
Als ich einmal meinem Freund Julian von dieser Leidenschaft erzählte, sah er mich verständnislos an. Er erklärte mir, dass er mit dieser Ziellosigkeit nichts anfangen könne. Er erkenne ihren Nutzen nicht.
»Wenn ich die Wohnung verlasse, brauche ich immer ein Ziel«, sagt er.
Tätigkeiten, die sich nicht dafür eignen, sie in seiner To-do-Liste zu erfassen, empfindet Julian als wertlos. Seine Tage sind vollkommen durchgeplant. Jeden Tag geht er seinem überladenen Alltag nach. Es gibt ständig etwas zu tun. Und immer muss es schnell gehen. Alltagsoptimierung im Endstadium.
Den Alltag in Zeitabschnitte zu zerstückeln, die abgearbeitet werden müssen, kann sehr beruhigend sein. Man bewegt sich mit einem Navigationssystem durch die Tage. Ein Navigationssystem aus Erledigungen, das Struktur genannt wird. Auch Struktur gibt den Tagen einen vermeintlichen Sinn. Einen To-do-Listen-Sinn sozusagen.
Diese Struktur ist Julians Halt. Sie nimmt ihm die Entscheidungen ab. Sie sagt ihm, was er wann zu tun hat. Sie organisiert seinen Alltag. Sie hat ihn übernommen. Täglich arbeitet er einen festgelegten Plan ab. Am Ende des Tages liegt er erschöpft im Bett und fühlt sich nützlich, weil er all die Erledigungen hinter sich gebracht hat. Die Dystopie eines Lebens.
»Man sollte nie so viel zu tun haben, dass man zum Nachdenken keine Zeit hat«, wusste der Philosoph Georg Christoph Lichtenberg. Das ist eine tiefe, aber offensichtlich auch aus der Zeit gefallene Wahrheit. Wie Julian sind viele sehr eingehend damit beschäftigt, nicht zur Ruhe zu kommen. Denn das ist die eigentliche Idee. Die vielen Erledigungen sind eine Ablenkung. Sie verdecken das Unbehagen, das unter dem Alltag liegt, als Grundierung sozusagen. Aber sobald sie zur Ruhe kommen, spüren sie es.
Wenn man zur Ruhe kommt, kann das schnell belastend werden. Ich kenne nicht wenige Leute, die nervös werden, sobald es nichts zu tun gibt. Langeweile lähmt sie. Sie brauchen die Bewegung. Sie brauchen Ziele, in deren Richtung man sich bewegen kann. Wenn man sich viel bewegt, kann das zwei Gründe haben. Entweder man ist auf der Suche oder man ist auf der Flucht. Und wenn ich es richtig einschätze, sind die meisten auf der Flucht.
Leider behandeln die meisten nicht nur ihren Alltag wie eine To-do-Liste – sie scheinen ihr Leben nach demselben Prinzip zu führen. Sie arbeiten eine To-do-Liste ab. Die Dinge, die man auf einem Lebensweg abhaken muss, um es zu einem erfolgreichen Leben zu machen. Ihr ganzer Lebensweg ist ein Abbild perfekter Planung. Ein wohldurchdachtes, effizient realisiertes Projekt. Abitur, Bachelor, Beziehung, Eigenheim, Kinder. Man spart sich von einer notwendigen Anschaffung zur nächsten. Und kommt nicht auf den Gedanken, sich zu fragen, wie notwendig die Dinge sind, die man für so notwendig hält. Man hat die Kontrolle abgegeben. Das ist der Eindruck, den ich auch mit Julian verbinde: Er lebt nicht sein Leben. Sein Leben lebt ihn.
Und genau daraus bildet sich das seltsam schale Gefühl in mir, das ich mit dieser Art, sein Leben zu führen, verbinde.
Die Überlegungen, die Erledigungen des Tages abhaken zu können, schieben sich über die Frage, ob man diesen Entwurf als lebenswert empfindet. Man fragt sich nicht mehr, ob dieser Entwurf generell zu einem passt, man fragt sich nur noch, wie man seine Tage am effizientesten abarbeitet. Das ist es, was die To-do-Liste im Leben verschiebt. Man organisiert das Leben wie einen beruflichen Alltag.
Der Journalist Sebastian Haffner schrieb in seinen klugen Erinnerungen Geschichte eines Deutschen, »dass unserem Volk das Talent zu persönlichem Glück fehle«. Diesen tragischen Umstand kompensieren wir Menschen mit Erledigungen, die wir für nützlich halten, weil wir sie abhaken können.
Wer sich auf die Erledigungen stürzt, vermeidet damit die Arbeit, auf die es eigentlich ankommt. Seine Persönlichkeit zu erkunden, sich über die eigenen Bedürfnisse klar zu werden, eine gesunde Beziehung zu sich selbst aufzubauen und zu pflegen. All diese Eigenschaften sind die Voraussetzungen, sich der To-do-Liste, die so viele »Leben« nennen, zu entziehen. Es gibt kaum einen steinigeren Weg. Da ist es viel einfacher, den Alltag zu organisieren, wie man einen Job organisiert.
Es erzählt sehr viel über unsere Gesellschaft, dass wir Dinge, die sich im beruflichen Alltag gut bewährt haben, auch in unserem Privatleben anwenden. Aber das Leben ist nun mal kein Unternehmen. Wie viel Tragik liegt doch in dem Umstand, es so zu behandeln. Ich denke, genau dort liegt der Punkt, an dem wir ansetzen sollten.
Um herauszufinden, womit wir unser Leben füllen können, um es zu einem erfüllten Leben zu machen. Um das Leben zu leben – und nicht von diesem gelebt zu werden.
Mir fiel auf, dass ich lächelte
In den sozialen Medien zeigen wir der Welt, wie glücklich wir sind – oder wie unendlich traurig. Je tiefer das ausgestellte Gefühl, desto mehr Likes erhält es. Wenn man sich mit der Darstellung von Gefühlen besser auskennt als mit ihnen selbst.
Im vergangenen Sommer habe ich mal ein Date verpasst, weil ich beinahe starb. Es war ein Samstag im Juni. Wir hatten uns für den späten Nachmittag verabredet, und weil mich der wolkenlose Tag ins Freie zog, beschloss ich, eine morgendliche Fahrradtour zu machen. Ich schaffte 35 Kilometer, bevor ich auf dem asphaltierten Radweg, der sich südlich des Müggelsees durch den Wald zieht, die Kontrolle über mein Rad verlor. Eine Gruppe von Rennradfahrern überholte mich so knapp, dass ich erschrocken auswich und vom Asphalt rutschte. Meine Erinnerungen verließen mich für Sekundenbruchteile, nachdem ich einen Schlag spürte, der mich über den Lenker schleudern ließ. Dann wurde es schwarz.
Eine halbe Stunde später hörte ich mich verzweifelt zu dem Rettungssanitäter, der sich gerade über mich beugte, sagen: »Aber ich hab heute Nachmittag noch ein Date.«
»Dit schaffen Se vielleicht sogar«, entgegnete er. »Dann ham Se ja schon mal wat zu erzähln.«
So konnte man es natürlich auch sehen. Das beruhigte mich. Der Sanitäter half mir, mich aufzurichten, und führte mich behutsam durch den Wald. Nachdem er mir im Krankenwagen eine Halskrause angelegt hatte, begutachtete er fachmännisch die tiefen Kratzer, die der Sturz in meinen Helm geschnitten hatte.
»Ohne Helm wärn Se jetzt schwerstbeschädigt«, sagte er fachmännisch. »Oder tot.«
Schwerstbeschädigt oder tot?, dachte ich und überlegte kurz, was mir lieber wäre. Tot wäre mir lieber. So brutal dieser Gedanke auch war.
Um einige Tests zu machen und innere Verletzungen auszuschließen, fuhren wir ins Krankenhaus Köpenick. Es ist das Krankenhaus, in dem ich geboren wurde. Der Kreis schloss sich, was kein gutes Zeichen war, wenn man es symbolisch sehen wollte.
Im Krankenhaus wurde ein CT von meinem Kopf gemacht, bevor ich auf der fahrbaren Trage in einem der engen Krankenhausflure auf die Diagnose wartete.
Während ich dort lag, hörte ich hinter der halb offenen Tür auf der gegenüberliegenden Seite des Ganges zwei Stimmen, die offensichtlich über mich sprachen. So erhielt ich meine Diagnose ungefiltert. Ich konnte keine vollständigen Sätze verstehen, aber die vereinzelten Worte, die in den Flur drangen, waren schon aufschlussreich genug.
»Mehrere Brüche«, hörte ich sie sagen und: »Unerwartet viele Splitter.« Worte, die ich in Zusammenhängen, die mein Gesicht einschließen, nur ungern höre. Ich ahnte vage, dass wohl nicht mehr damit zu rechnen war, dass ich pünktlich zu meinem Date kommen würde.
Ein Pfleger schob mich in das Zimmer, wo mir von einer Ärztin mittgeteilt wurde, dass ich es tatsächlich nicht schaffen würde. Mein Jochbein sei doppelt gebrochen, sagte sie. Sie würden mich zwei Tage zur Beobachtung dabehalten. Falls innere Blutungen aufträten. Das war bedauerlich, auch weil das Date seit Wochen geplant war. Die Frau, mit der ich schon mehrere stundenlange Telefonate geführt hatte, war für einige Tage aus Hamburg angereist. Ich hatte mich sehr darauf gefreut. Während mich der Pfleger durch die langen Krankenhausgänge zu meinem Zimmer schob, nahm ich mein Handy und sagte ihr ab. Im Fahrstuhl, der uns in die fünfte Etage brachte, entdeckte ich fasziniert, dass die Decke mit einem abgedunkelten Spiegel verkleidet war. Ich blickte praktisch von oben auf mich herab.
»Die Perspektive ist perfekt«, rief ich begeistert. Der Pfleger trat zur Seite, ich machte ein paar Selfies, von denen ich das Beste auswählen würde, um es auf Instagram zu posten. Gerade war ich beinahe gestorben, jetzt schon wieder im Modus. Es ist erschreckend, wie tief diese Mechanismen in einem verankert sind.
Im Zimmer begann ich, die Farben des Fahrstuhlfotos zu korrigieren. Dann schrieb ich einen Text, der zu dem Foto passte. Es war ein etwas kitschiger Text, in dem stand, wie sehr mir dieser Unfall klarmachte, wie wenig ich das Geschenk des Lebens nutzte. Mir fiel erst später auf, dass ich den Text mit einem Gefühl verfasste, das gar nicht zu seinem wehmütigen Inhalt passte. Ich schrieb ihn mit wachsender Euphorie. Diese Euphorie betraf nicht den Inhalt des Textes, sie bezog sich auf die zu erwartenden Reaktionen. Es war die Dopaminausschüttung vor dem nächsten Post. Die Freude auf die Likes.
Dieses Gefühl sollte recht behalten. Das Foto erhielt Tausende Likes und Kommentare. Eine Leserin, die als Krankenschwester einige Etagen in dem Gebäude über mir arbeitete, wünschte mir in einem Kommentar unter dem Foto gute Besserung. Meine Schwester schrieb mir schockiert, dass das Foto aussah, als wäre es in der Pathologie gemacht worden. Ganz kurz dachte sie, es wäre mein letztes Bild. Als hätte ich im Angesicht meines nahenden Todes nicht meinen Glauben an Gott entdeckt, sondern meine Instagram-Zugangsdaten rausgegeben. Für den finalen Post. Die letzte große Inszenierung. Einen moderneren Abschluss eines Lebens gibt es momentan wohl nicht.
Ich öffnete in Minutenabständen Instagram, um die wachsenden Zahlen zu überprüfen. Dieser Zustand kann Stunden zu Viertelstunden machen. Ich registrierte erst, dass es bereits später Nachmittag war, als dieser Rausch unterbrochen wurde. Eine der Schwestern betrat den Raum und überreichte mir einen Briefumschlag. Eine Frau habe ihn gerade unten an der Pforte abgegeben, sagte sie. Dann nannte sie den Namen der Frau, mit der ich jetzt eigentlich auf der Terrasse des Café Schoenbrunn im Volkspark Friedrichshain sitzen wollte.
»Eine Sarah«, sagte sie.
Es war ein seltsames Gefühl, ihren Namen zu hören. In diesem Krankenhauszimmer, unter diesen Umständen. Als würde etwas nicht zueinanderpassen, aber auf eine schöne Art.
Ich öffnete den Umschlag, in dem sich ein handgeschriebener Brief befand. Ich faltete ihn vorsichtig auseinander und begann zu lesen. Während ich ihn las, entstand in mir ein ungewohntes Gefühl: Ich spürte, dass sich etwas in mir löste. Etwas Verkantetes. Als würde ich etwas wiederentdecken, worauf es ankam, das mir aber jahrelang entfallen war. Es war ein Gefühl, das aus dem wahren Leben entsteht.
Es war ein starkes Gefühl. Es hebelte jene aus, die in der digitalen Wirklichkeit entstanden waren. Mein Blick fiel auf das iPhone, das auf der Bettdecke lag. Es wirkte zurückgelassen, vergessen. Und ich hatte es ja auch vergessen. Durch Sarahs Geste war jedes Like ins Bedeutungslose gefallen. Mit jeder Pushmitteilung leuchtete das Display auf. Es rief nach mir, auf seine Art, aber ich hörte nicht mehr zu.
Mir fiel noch einmal das unangemessen euphorische Gefühl ein, mit dem ich den Post verfasst hatte. Ich hatte die Worte zwar geschrieben, aber ich habe den Inhalt nicht gespürt. Es ging mir auch nicht um die gefühlte Erkenntnis eines Moments, sondern darum, wie ich ein Gefühl in den sozialen Netzwerken am besten ausdrücken konnte. Ich wollte es darstellen.
Ich bin ein Gefühlsdarsteller. Ich stelle Gefühle aus, die ich kreiere, aber nicht mehr empfinde. Denn sobald ich darüber nachdenke, wie ich ein Gefühl online vermitteln kann, spüre ich es nicht mehr. Dann habe ich es bereits in meine Selbstvermarktung eingepasst. Durch den vermeintlich emotionalen Post hatte ich ihre Aufmerksamkeit. Meine Follower lasen ihn und fühlten einen kurzen Moment lang, wie ich litt. Aber ich litt gar nicht. Ich zählte ihre Likes.
Die Streams sozialer Netzwerke, über die mein Blick täglich mehrere Male hetzt, sind mit konkurrierenden Gefühlsauslösern gefüllt. Trauer, Mut, Hoffnung, Humor, Schadenfreude, Kinder, Tiere, Choreografien und Kriegsleid, immer unterlegt mit der passenden Musik. Die Welt soll sehen, dass wir glücklich sind oder unendlich traurig. Je tiefer das ausgestellte Gefühl, desto mehr Applaus erhält es. Vielleicht wird man in einigen Jahren feststellen, dass es eine Langzeitfolge sozialer Medien ist, dass sich ihre Nutzer mit der Darstellung von Gefühlen besser auskennen als mit den Gefühlen selbst.
Leider beobachte ich immer häufiger Leute, deren Wesen darauf schließen lässt, dass dieser Prozess bereits begonnen hat. Wenn sie über Glück reden, über ihre seelischen Erkrankungen oder ihr Leid, klingt es eher nach Statement und weniger nach Empfindung. Genauso wie ihre Gesten wirkt auch ihr Lachen aufgesetzt und hinterlässt einen schalen Geschmack von Falschheit. Sie lächeln, als hätten sie es jahrelang vor dem Spiegel geübt. Oder in ihrer Selfie-Kamera.
Vielleicht geht es ihnen wie mir, als ich mich in der verspiegelten Decke des Krankenhausfahrstuhls fotografierte. Ich blickte von außen auf mich. Ich dachte an die richtige Position, die richtige Perspektive, die richtige Wirkung. Ich dachte nicht an mich oder die Situation, in der ich mich befand, ich dachte an mein Publikum.
Mein Blick fiel auf den Brief in meinen Händen. Auf die Worte, die Sarah an mich gerichtet hatte. Es war einer dieser Momente, in denen man etwas über sich selbst begreift.
Was machte ich hier?, dachte ich. Was machte ich seit Jahren? Die vielen Likes und Postings waren keine Verbindung zum wahren Leben. Sie waren ein Ersatz. Eine Kompensation. Seit Jahren konzentrierte ich mich auf Kopien und verstand gar nicht, wie sehr ich das Original aus den Augen verloren hatte. Es gibt so viel zu lesen, zu liken, zu posten und zu streamen. Es ist schon erstaunlich, mit welchen Dingen man sich tagtäglich beschäftigt. Und wie viel man aufgibt, um sich tagtäglich damit beschäftigen zu können.
Ich habe heute ein Date verpasst, weil ich beinahe gestorben bin, dachte ich. Aber ich lebte ja auch nur beinahe. Ich verpasste die Dinge, auf die es ankam. Ich verpasste das wirkliche Leben. Und jetzt – genau jetzt – spürte ich, dass ich das nicht mehr wollte.
Ich las Sarahs Brief noch einige Male, um dieses Gefühl so lange wie möglich in mir zu bewahren. Als es abebbte, faltete ich ihn zusammen und schob ihn behutsam in den Umschlag zurück.
Mir fiel auf, dass ich lächelte. Ganz ungeplant.
Verlassen und Verlassenwerden
Im eigenen Leben spiele ich die Hauptrolle, missverstehe jedoch oft, welche Rolle ich im Leben anderer spiele. Eine Erinnerung daran, empathischer zu sein.
Manchmal muss man noch mal zurück. In einen Teil der Vergangenheit, den man für abgeschlossen hielt. Man hat die damaligen Ereignisse geglättet und poliert – und sie in Erinnerungen verpackt, mit denen man gut leben kann. Sie erscheinen festgelegt und plausibel. Sie schimmern sanft in den Farben der eigenen Wahrheit.
Aber manchmal zwingen einen die Umstände, zurückzukehren. Erinnerungen noch einmal freizulegen und neu zu betrachten. Marcel Proust hat das schon ganz richtig gesehen, als er schrieb, dass die eigentlichen Entdeckungsreisen nicht im Kennenlernen neuer Landstriche bestehen, sondern darin, etwas mit anderen Augen zu sehen.
Im vergangenen Juli begab ich mich auf eine dieser Entdeckungsreisen, die Proust so schätzte. Als ich mich mit Max traf. Max war der Ex-Freund von Luise, der Frau, mit der ich vor acht Jahren zusammen war. Ihr Freund, bevor wir zusammenkamen. Gewissermaßen mein Vorgänger. Ich war der Mann, für den sie ihn verließ.
So viel zum Setting.
Ich weiß, wie seltsam das wirkt. Ich meine, warum sollte ich mich mit dem Mann treffen, den meine Ex-Freundin meinetwegen verlassen hatte? Was hatten zwei Ex-Freunde derselben Frau miteinander zu besprechen? Wenn ich mir vorstelle, zwei meiner ehemaligen Freundinnen würden sich zu einem harmlosen Gedankenaustausch treffen, würde ich das nicht nur merkwürdig finden – ich fände das sogar außerordentlich befremdlich. Ich will jetzt nicht egozentrisch klingen, aber ich halte den Gedanken für nicht allzu weit hergeholt, dass es ein Thema gäbe, was nicht nur gelegentlich berührt, sondern umfangreich erörtert werden würde. Dieses Thema wäre ich. Und zwar nicht in dem Sinne, was für ein wertvoller Mensch ich wäre. Es würde um meine Defizite gehen.
Vor einigen Jahren war ich auf einer Geburtstagsparty Zeuge einer Begegnung zweier Frauen, die mit demselben Mann geschlafen hatten. Als sich diese Gemeinsamkeit herausgestellt hatte, begannen sie sich sehr detailliert über seine sexuellen Vorlieben auszutauschen. In meiner Anwesenheit.
Sie glichen genau ab, inwieweit sich der Sex zwischen ihnen unterschied, und fanden schnell heraus, dass er bei beiden praktisch deckungsgleich war. Der Mann benutzte dieselben Formulierungen, wenn er ihnen Anweisungen gab, er folgte derselben Reihenfolge der Stellungen und Praktiken, er wandte offenbar eine festgelegte Bedienungsanleitung an, die er abrief. Während die Frauen immer indiskretere Einzelheiten austauschten, suchte mein Blick nach dem Mann, den diese betrafen. Dieser Mann war unser Gastgeber. Er war im hinteren Teil des Raums in ein angeregtes Gespräch vertieft und wirkte viel zu gut gelaunt, aber er ahnte ja auch nicht, dass er das Thema unserer Unterhaltung war. Ich dachte daran, wie unbefangen wir uns bei meiner Ankunft begrüßt hatten. Das hatte sich jetzt verändert, obwohl er sich nicht verändert hatte. Die Geschichten der Frauen hatten aus ihm einen anderen Menschen gemacht. Das will man eigentlich nicht. So etwas wollte ich auf gar keinen Fall.
Zwei Ex-Freunde treffen sich zu einem unverfänglichen Gedankenaustausch. Das Wort »unverfänglich« widerspricht dem Rest des Satzes. Das fühlt sich einfach nicht richtig an. Und daran lag es wohl, dass es Jahre gedauert hatte, bis dieses Treffen zustande kam.
Ich hatte mit Luise zusammengearbeitet. Als Kollegen hatten wir kaum Kontakt, aber ein halbes Jahr, nachdem ich die Firma verlassen hatte, meldete sie sich ganz überraschend bei mir. Wir trafen uns und verstanden uns so gut, dass wir uns erneut verabredeten. Die Treffen wurden zu Dates, obwohl wir sie nicht so nannten. Es fühlte sich wie der perfekte Anfang einer Liebesgeschichte an, wenn man ausblendete, dass Luise ja in einer Beziehung war. Mit Max.
Aber so, wie ich das einschätzte, schien es eine in Langeweile erstarrte Beziehung zu sein. Es gab offensichtlich genug Gründe, um aus ihr auszubrechen, jetzt fehlte nur noch ein angemessener Anlass. Dieser Anlass waren die Gefühle, die sich zwischen Luise und mir mit jedem neuen Treffen vertieften. Verglichen mit der Größe dieser Empfindungen war das, was sie über die Jahre mit Max kultiviert hatte, nur ein blasser Ersatz. Davon war ich überzeugt. Luise war nur noch mit ihm zusammen, um ihm einen Gefallen zu tun. Aus Gewohnheit. Aus Vernunft. Ihre Beziehung bestand nur noch aus den Resten einer Beziehung. Das passte alles nicht zu Luise. Sie war schließlich eine Frau, um die es sich zu kämpfen lohnte.
Ich beschloss, sie aus dieser sexlosen Langeweile herauszukämpfen. Es war eine Entscheidung für das Gefühl und gegen die Vernunft.
Als wir dann endlich zusammenkamen, nach Monaten, die uns alle viel Kraft gekostet hatten, hatte die Liebe über die vernünftige Langeweile triumphiert. So empfand ich das. Es war wie in den Filmen. Sie hatten recht. Die klassische Dramaturgie einer romantischen Liebeskomödie. Es war ein wundervolles Gefühl, der Held einer Liebesgeschichte zu sein. Und es war eine dieser Liebesgeschichten, die ein Leben lang halten, davon war ich überzeugt.
Es wurde allerdings dann doch eine dieser lebenslangen Liebesgeschichten, die nur anderthalb Jahre hielt. Mit unserer Trennung verschwand Luise aus meinem Alltag, wie auch ich aus ihrem – allerdings kommt Max seit einigen Jahren hin und wieder in meinem Leben vor.
Wir haben gelegentlich aus beruflichen Gründen miteinander zu tun. Bei jeder Verabschiedung versicherten wir einander, uns demnächst auch mal privat zu treffen. Wir trafen uns nie. Ich empfand diesen Vorsatz auch eher als Höflichkeitsfloskel, mit der wir uns zeigten, dass nichts mehr zwischen uns stand. Aber gelegentlich schrieb Max mir Nachrichten, um mich an unser geplantes Treffen zu erinnern.
Ich habe zwei Jahre gezögert, bevor ich zusagte. Auch wenn unsere Differenzen schon lange zurücklagen, war der Gedanke an ein Treffen mit einem faden Beigeschmack verbunden. Die damaligen Ereignisse waren verarbeitet, die Wunden hatten sich geschlossen, aber trotzdem spürte ich, dass irgendetwas zwischen uns stand. Und auch als wieder einmal eine seiner Nachrichten auf dem Display meines iPhones aufleuchtete, spürte ich diesen inneren Widerstand. Aber etwas zog an mir. Ich war neugierig, auch wenn es eine Neugier war, die sich nicht richtig anfühlte. Ich las seine Nachricht erneut. Dann sagte ich zu.
Wir trafen uns im Biergarten eines Restaurants in Berlin Friedrichshain, das Jäger & lustig heißt.
Max verspätete sich ein wenig, ich bestellte zwei Bier und setzte mich auf eine Bank, über der sich ein großer Sonnenschirm spannte. Als ich Max am Eingang stehen sah, hob ich meine Hand, bis sich unsere Blicke trafen. Er trat an den Tisch, entschuldigte sich für die Verspätung und registrierte angenehm überrascht, dass ich uns bereits Bier bestellt hatte. Er setzte sich, wir stießen an.
Wir sprachen über die Arbeit, Max versicherte mir mehrere Male, dass sich die Wunde, die die Trennung von Luise riss, schon lange geschlossen hatte. Dann bestellte er die nächste Runde.
»Ich hol mal noch zwei Bier«, war ein Satz, der an diesem Abend häufig fiel. Rückblickend kann ich sagen, dass der Alkohol eine Funktion hatte. Mit jedem neuen Bier umkreisten wir ein ganz spezielles Thema enger. Dieses Thema war Luise.
»Ich hab das ja alles schon verarbeitet«, wiederholte Max, als er sein viertes Halbliterglas geleert hatte. »Aber die Dinge müssen jetzt mal auf den Tisch.«
Sein Blick hatte sich verändert. Offensichtlich war das alles noch nicht genug verarbeitet.
Etwas war aufgebrochen, alles schwappte wieder hoch. Die Vergangenheit floss in die Gegenwart. Ich spürte, wie ich mich verspannte. Ich war nicht sicher, ob ich mich auf eine Reise durch Max’ Erinnerungen begeben wollte, aber sein Blick machte klar, dass ich da jetzt durchmusste. Dann begann er detailliert die damaligen Ereignisse zu schildern. Aus seiner Sicht.
Im »Literarischen Quartett« hat Marcel Reich-Ranicki mal gesagt, gute Bücher erkenne man daran, dass sich Menschen darüber unterhalten können, als hätten sie verschiedene Bücher gelesen. Gute Bücher haben die Gabe, in jedes Leben anders zu strahlen. Ich weiß nicht, ob das auch auf das zutraf, was uns verband, aber es gab eine Ähnlichkeit, die mir auffiel: Max schilderte dieselben Geschehnisse, aber es war eine vollkommen andere Geschichte. Zwei unterschiedliche Erzählungen, die sich aus denselben Ereignissen ergaben.
Ich finde es immer interessant, zu sehen, wie sich eine Situation verändert, wenn man sie aus den Blickwinkeln verschiedener Personen betrachtet. Das kann allerdings schnell unangenehm werden, wenn man selbst eine dieser Personen ist.
Wie ich.
Ich habe oft den Fehler gemacht, vergangene Geschehnisse ausschließlich als Teil meiner Vergangenheit zu sehen. Der Vergangenheit, in der ich die Hauptrolle spielte. Dass ich auch Teil anderer Vergangenheiten bin, in denen ich eine andere Rolle einnehme, habe ich stets ausgeblendet. Meiner Erfahrung nach sieht man ausschließlich den eigenen Schmerz, übersieht jedoch schnell die Verletzungen, die man anderen zufügt.
Wir alle spielen in der Geschichte unseres Lebens die Hauptrolle und halten unsere Version der Wahrheit für die Wirklichkeit. In der Wirklichkeit unserer eigenen Geschichte sind wir die Helden. Diese Haltung bildet sich aus dem Bedürfnis, das eigene Dasein als Erfolgsgeschichte zu erleben. Und Max nahm mich auf eine Reise mit, in der er der Held war.
Dieser Abend war eine Trainingseinheit. Eine Lehrstunde in Empathie. Max’ Schilderungen gaben mir die Möglichkeit, meine verklärten Erinnerungen, in denen ich mich so sicher fühlte, mit denen von Max abzugleichen.
Es ist erstaunlich, wie sich die Rollen ändern. Max hatte nicht nur die Charakterzeichnungen vollständig geändert, auch das Genre hatte gewechselt. Die romantische Komödie wurde zu einem verstörenden Psychothriller. Ohne Happy End.
Meine Erinnerungen verzerrten sich. Der sensible Romantiker, der die Hauptfigur in meinen Erinnerungen war, verwandelte sich in Max’ Version unserer Geschichte in eine gewissenlose Nebenfigur. Berechnend, kalt und manipulativ. Ein intriganter Verführer.
Max beschrieb eine zutiefst gestörte Persönlichkeit. Einen Soziopathen, dem die hilflose Hauptfigur in Max’ Geschichte nur seine Moral entgegenstellen konnte. Und natürlich hatte Max keine Chance. Das Böse siegt schließlich immer.
Max’ Wahrheit schnitt sich in meine Erinnerung. Er erklärte mir, wie es wirklich gewesen war. Aus seiner Sicht, in der der Betrogene der Held der Geschichte war. Der moralische Held. Der Gewinner der Herzen sozusagen. Ich wurde zu einer dieser Figuren, gegen die das Publikum schon in der ersten Szene war, in der sie auftauchte. Ich war das Monstrum, das diese heile, wohlgeordnete Welt zertrümmerte.
Es war ganz seltsam, Max sprach über mich, als hätte er sich mich ausgedacht. Und in gewisser Weise hatte er das ja auch. Aber umgekehrt ging es mir genauso. Auch ich sah nur die Beweise, die den Blick auf meine Geschichte untermauerten. Auch ich hatte mir Max ausgedacht. Er war ein langweiliger Mensch in einer langweiligen Welt, aus der Luise gerettet werden musste.
»Ich hab sie wirklich geliebt«, schloss Max vorwurfsvoll und leerte sein sechstes Glas. Ich warf ihm einen mitfühlenden Blick zu. Dieser Blick war echt. Ich fühlte mich tatsächlich, als wäre ich an allem schuld.
Unvermittelt fragte ich mich, wie Luises Version der Geschichte aussah, die, in der sie die Heldin war. Inwieweit sich ihre Erinnerungen über unsere legen würden. Was sie verzerren, entzaubern und entstellen würde. Dieser dritte Blick würde uns eine vollständigere Wahrheit zeigen. Ich fragte mich, inwieweit Max bereit wäre, diese vollständigere Wahrheit zuzulassen. Ob er sie überhaupt wissen will. Oder ich.
Ich könnte jetzt sagen, dass die Michael-Nast-Version, die Max beschrieb, nie existiert hat. Ich könnte seine entstellte Darstellung entrüstet ablehnen. Ich könnte sagen, dass Max alles vollkommen falsch verstanden hat. Der Impuls ist da, aber ich glaube, so einfach ist es dann doch nicht.
Verschiedene Sichtweisen auf Geschehnisse sind immer auch verschiedene Versionen der Wahrheit. Max und ich nahmen an, im Besitz der endgültigen Wahrheit zu sein. Das ist ein Fehler, den nicht wenige machen. Die meisten Zerwürfnisse beruhen auf diesem Prinzip. In Familien, in Freundschaften, unter Kollegen. Unter Ex-Freunden.
Ende der Leseprobe