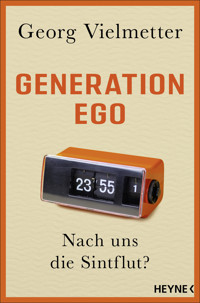
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Boomer, geboren in den 1950ern und 1960ern im Westen der Republik, sind die geburtenstärksten Jahrgänge, die Deutschland jemals hervorgebracht hat. Ihre Generation ist dreifach beglückt: Den Weltkrieg der Eltern hat sie nicht mehr erlebt. Im Kalten Krieg landete sie zufällig auf der geografisch richtigen Seite. Und den hat sie auch noch gewonnen. Sie ist die Cold-War-Generation – geprägt vom Kalten Krieg, vom Wirtschaftswunder und langen Aufstiegsbewegungen.
In seltsamem Kontrast dazu scheinen die Hinterlassenschaften dieser Generation zu stehen: Neben einer alternden Gesellschaft, dem Rentenproblem und dem Klimawandel hinterlässt sie den nachfolgenden Generationen viele weitere Krisen.
Ist die Cold-War-Generation die Generation Ego? Hat sie nur an sich gedacht? Was hat die Generation geprägt und kann man ihr die aktuellen Krisen wirklich anlasten? Und: Was gilt es jetzt zu tun?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch:
Die Boomer, geboren in den 1950ern und 1960ern im Westen der Republik, sind die geburtenstärksten Jahrgänge, die Deutschland jemals hervorgebracht hat. Ihre Generation ist dreifach beglückt: Den Weltkrieg der Eltern hat sie nicht mehr erlebt. Im Kalten Krieg landete sie zufällig auf der geografisch richtigen Seite. Und den hat sie auch noch gewonnen. Sie ist die Cold-War-Generation – geprägt vom Kalten Krieg, vom Wirtschaftswunder und von langen Aufstiegsbewegungen.
In seltsamem Kontrast dazu scheinen die Hinterlassenschaften dieser Generation zu stehen: Neben einer alternden Gesellschaft, dem Rentenproblem und dem Klimawandel hinterlässt sie den nachfolgenden Generationen viele weitere Krisen. Ist die Cold-War-Generation die Generation Ego? Hat sie nur an sich gedacht? Was hat die Generation geprägt und kann man ihr die aktuellen Krisen wirklich anlasten? Und: Was gilt es jetzt zu tun?
Zum Autor:
Georg Vielmetter ist Doktor der Philosophie und Diplom-Soziologe. Er arbeitet als Berater, Coach und Autor. Zuletzt erschienen von ihm die Bücher »Die Post-Corona-Welt« und »Leadership 2030« (mit Yvonne Sell). Er lebt in Berlin.
Georg Vielmetter
GENERATION
EGO
Nach uns die Sintflut?
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2024 by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Ulrike Strerath-Bolz
Umschlaggestaltung: wilhelm typo grafisch, Zürich, unter Verwendung einer Abbildung von Shutterstock.com (MosinGL, redstone)
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-641-31812-3V002
www.heyne.de
Manche halten das für Erfahrung, was sie 20 Jahre lang falsch gemacht haben.
George Bernard Shaw
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte.
Gustav Heinemann
Für Jan – wdjbdbd
Inhalt
Einleitung – Die Boomer – Kinder des Kalten Krieges
ERSTERTEILDie Cold-War-Generation – Wie sie wurde, wer sie ist
1 Die »langen sechziger Jahre« – Die Lebenswelt der Cold-War-Generation
2 Selbstzufriedene Aufsteiger – Ein Psychogramm der Cold-War-Generation
ZWEITERTEILKrisenrepublik Deutschland – Hinterlassenschaften der Cold-War-Generation
3 Alarmistisches Nichtstun – Warum Deutschland den demografischen Wandel verschlafen hat
4 Der Mythos vom Generationenvertrag – Warum unser Rentensystem aus der Zeit gefallen ist
5 Wasch mich, aber mach mich nicht nass – Warum wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen
DRITTERTEILIm Zeitalter der Narren
6 Cold-War-Generation: Normal people oder Generation Ego?
7 Politik für Erwachsene – und andere Dinge, die wir jetzt tun sollten
Dank
Abbildungsverzeichnis
Anmerkungen
Einleitung
Die Boomer – Kinder des Kalten Krieges
Frage: Was haben die Jahre 1964 und 2011 gemeinsam? Antwort: Sie sind die extremsten. Kein anderes Jahr war krasser.
Wenn wir verstehen wollen, warum wir uns allmählich in die Krisenrepublik Deutschland verwandeln, dann ist es eine gute Möglichkeit, bei diesen beiden Zahlen zu beginnen. Besonders, wenn wir dabei den Beitrag der Generation in den Blick bekommen wollen, die sich allmählich in den Ruhestand verabschiedet.
1964 ist mein Geburtsjahr. Genau wie das von 1357304 anderen. Mehr geht nicht. Niemals vorher und vermutlich niemals nachher feiern so viele Menschen in Deutschland ihren Sechzigsten wie 2024. Als wären alle Münchner gleich alt. Herzlichen Glückwunsch zum Massengeburtstag!
2011 ist das Geburtsjahr meines Sohnes. Ihm steht der gegenteilige Rekord bevor. Sein Jahrgang umfasst nur 662685 Menschen – weniger als die Hälfte des meinen und der zahlenmäßig schwächste in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Halbiert in einer – zugegeben sehr langen – Generationsspanne. München, zusammengeschnurrt auf die Größe von Leipzig.
Ist das nicht irgendwie merkwürdig? Wieso hinterlassen gerade diejenigen, die wirklich mit Abstand die Allermeisten waren, wirklich mit Abstand die Allerwenigsten? Obwohl kein Krieg und auch keine andere große Katastrophe dazwischengekommen ist. Und obwohl es doch, so schien es, immer nur bergauf ging? (Spoiler: Am vermeintlichen Pillenknick lag es nicht.) Ist das nun Ironie oder einfach nur blöd, dass man gerade die Generation »Wir-sind-ganz-viele-und-hinterlassen-ganz-wenige« auch noch Baby Boomer nennt beziehungsweise – so viel Effizienz muss sein – einfach nur Boomer?
Boom heißt Aufschwung. Aufschwüngler also. Was wir aber sehen, ist ein Abschwung. Allerdings hätte Baby Crasher auch nicht gerade schmeichelhaft geklungen.
1964. 2011. Boom. Crash. – Generation Ego? Das schoss mir durch den Kopf anlässlich des larmoyanten Wehklagens eines Generationsgenossen über (und hier dürfen Sie gerne auswählen, nichts davon wird Sie überraschen): die Höhe seiner Sozialabgaben, den schlechten Service, die Besteuerung seiner Rente, den Fachkräftemangel, die miese Stimmung in Deutschland, die Ossis beziehungsweise die Wessis, den »Heizungshammer«, den »Rentenhammer«, die Kosten der Tankfüllung für seinen SUV (200 Euro, obwohl er doch schon den schwächeren Motor für seinen BMW X7 genommen hat, und den sogar als Hybrid!).
Lebst du noch, oder klagst du nur?, fragte ich mich oder vielmehr ihn. Und was hast du eigentlich die letzten 60 Jahre so gemacht? Hast du nicht auch ein 20millionstel (ja, 20 Millionen, jeder Vierte! – so groß ist diese Generation) mit dazu beigetragen, dass wir da stehen, wo wir eben gerade stehen? Oder warst du dann mal weg?
Generation Ego. Nach mir die Sintflut! Mit Ausrufe- statt Fragezeichen. Das dachte ich, als er von seiner Tankfüllung anfing. Aber das ist natürlich nicht gerecht. Er fährt den X7, okay, dafür eine Altersgenossin nur Fahrrad – hebt sich das nicht auf? Vielleicht. Und ist das in anderen Generationen nicht auch so? Möglich. Wird nicht gerade die Generation Z, etwa 40 Jahre nach den Boomern geboren und jetzt am Beginn ihrer Berufskarrieren, immer wieder als besonders ichbezogen gebrandmarkt – und zwar, noch eine Ironie, besonders von den Boomern? (Wir werden später noch sehen, dass sich die Generationen gar nicht so gewaltig voneinander unterscheiden, weder in ihren Vorurteilen übereinander noch in ihren Einstellungen. Wohl aber in ihren Prägungen.)
Dennoch: Wir sollten uns vielleicht die Zeit nehmen, einmal auf einige der bisherigen Hinterlassenschaften dieser Generation zu schauen. Immerhin hat sie die letzten 20, 30 Jahre an den Schalthebeln der Macht in Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft gesessen. Jetzt silversurft sie auf der Zielgeraden zum »wohlverdienten Ruhestand«. Dass wir dabei locker an der Pforte zum Garten Eden austrudeln, behauptet allerdings auch schon lange keiner mehr. Vielleicht sind wir in den letzten Jahrzehnten doch irgendwann mal falsch abgebogen?
Das neue Normal ist die Krise oder – neumodisch – die Polykrise, weil die eine Krise irgendwie mit der anderen Krise und die dann wiederum mit der nächsten zusammenhängt. Krisenrepublik Deutschland. Ausrufezeichen Fragezeichen. Dabei muss man noch nicht einmal an die geopolitischen Verwerfungen durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine oder das zunehmend aggressive Verhalten Chinas denken. Auch hier wäre einiges zur Rolle der Generation zu sagen, doch bleiben wir im Land.
Eigentlich hat die Boomer-Generation ja qua Geburt ziemlich viel Glück gehabt. Wer das bestreitet, ist nicht ehrlich. Zumindest dann, wenn wir über Westdeutschland reden. Und meine Perspektive ist die eines Westdeutschen. Ich bin tief im Westen geboren, wo die Sonne verstaubt und es besser, viel besser ist, als man glaubt, wie Herbert Grönemeyer in seiner Hymne auf Bochum dichtete. Auch wenn ich dort schon lange nicht mehr lebe, lässt mir der Song jedes Mal einen Schauer über den Rücken laufen. Viel tiefer im Westen als Bochum geht eigentlich kaum, sonst wäre ich Niederländer. Das prägt. Und obwohl dieses Buch keine Biografie, sondern ein Sachbuch mit einem allgemeinen Geltungsanspruch ist, wäre es – das können Sie sich nun aussuchen – unredlich oder naiv oder vermessen, von der eigenen Geschichte ganz abstrahieren zu wollen. (Es wäre übrigens auch langweilig.) Der Berliner Philosoph Wilhelm Dilthey, ein Wegbereiter moderner Interpretationstheorien in den Sozialwissenschaften, hat dazu schon im 19. Jahrhundert eine weise Erkenntnis formuliert: dass nämlich in der biografischen Erfahrung die Grundform des menschlichen Verstehens liege.1
Sehe ich von meiner Biografie ab, dann verstehe ich Dinge nicht mehr in ihrer Tiefe, sondern mache vielleicht noch ZDF – Zahlen-Daten-Fakten –, ohne diese ganzen ZDF-Puzzleteile zu einem sinnvollen, Bedeutung erschließenden Bild zusammensetzen zu können. Insofern ist die Beschäftigung mit der eigenen Generation immer auch Selbstthematisierung.
Als westdeutscher Angehöriger der Generation der Vielen war und bin ich aktiver Teilnehmer, jemand, der sein Zwanzigmillionstel mit dazu beigetragen hat, dass wir da stehen, wo wir heute eben stehen. Viele der Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, erscheinen mir typisch für meine Generation, deshalb werde ich gelegentlich darauf eingehen. Gleichzeitig versuche ich natürlich, als Autor die Rolle des distanzierten Beobachters einzunehmen. Ohne diesen Spagat geht es nicht.
Wie gesagt, aus dieser Perspektive waren die Startchancen eigentlich bestens. Wir hatten nämlich gleich drei Mal Glück. Als wir vor plus/minus 60 Jahren geboren wurden, sah die Welt natürlich völlig anders aus. Es herrschte der Kalte Krieg, und der heiße, also der Zweite Weltkrieg lag zehn, 20 Jahre zurück. Nicht lange, aber immerhin: Er war vorbei.
Das war unser erstes Glück.
Noch bevor wir geboren wurden, verdreifachte sich das Bruttosozialprodukt; es herrschte Vollbeschäftigung. Während unsere Eltern ihre Kindheit in der Nazi-Zeit und im Krieg verbrachten und dadurch geprägt waren, wurden wir im Westen in das Wirtschaftswunder hineingeboren; viele erlebten Aufstiegsbewegungen. Wir sind die erste Generation, die überwiegend in Frieden und Wohlstand aufgewachsen ist.
Die Geburt in Westdeutschland, im zunehmenden Wohlstand war unser zweites Glück.
Weil wir so viele waren, kam es zwar in den 1980er Jahren zu erhöhter Arbeitslosigkeit und zur »Akademikerschwemme«. Aber zum einen war das nur vorübergehend. Und zum anderen zogen wir noch einmal das große Los. Denn der Westen gewann den Kalten Krieg, und plötzlich ergaben sich unheimlich viele Möglichkeiten im »Beitrittsgebiet«, in Ostdeutschland. Wer wollte, ging in den Osten, und die anderen lebten einfach weiter wie zuvor.
Das war unser drittes Glück.
Man kann es auch anders sagen: Wir sind die Generation der dreifachen Kriegsgewinner: Den Krieg der Eltern haben wir nicht mehr erlebt. Im Kalten Krieg landeten wir zufällig auf der geografisch richtigen Seite. Und den haben wir dann auch noch gewonnen.
Lassen Sie uns der Generation einen Namen geben, der weder geschmacklos noch trivial oder lächerlich ist. Sondern vielleicht sogar etwas aussagt. Nennen wir sie die Generation des Kalten Krieges, die Cold-War-Generation. Die Generation der dreifachen Kriegsgewinner, die drei Mal das Glückslos gezogen hat.
Den Charakter, die Beschaffenheit, den Zusammenhang der Cold-War-Generation macht nicht wesentlich die Tatsache aus, dass sie so groß ist. Oder dass alles so eng und voll war. Oder dass es noch keine Digitalisierung gab. Das mag alles akzidentiell hinzutreten. Wesentlich ist diese Generation aber davon geprägt, dass wir die Kinder des Kalten Krieges sind. Es ist – das werden wir später noch sehen – der Kalte Krieg, der uns zu denen gemacht hat, die wir heute sind.
Die Cold-War-Generation: Dem Weltkrieg entkommen. In Westdeutschland aufgewachsen. Den Kalten Krieg gewonnen. Das sind doch Startchancen, über die man sich nicht beklagen sollte.
Wie war jetzt noch mal der Zusammenhang zwischen den super Startchancen und dem Multiglück auf der einen und der Krisenrepublik Deutschland auf der anderen Seite? Anders gefragt: Hat die Cold-War-Generation da irgendetwas nicht richtig auf die Reihe bekommen?
Das ist jetzt natürlich die Steilvorlage für Boomer-Bashing. Alte weiße Männer, in Starrsinn vereint, die ihr Ding durchgezogen haben und weiter durchziehen, ohne nach links, rechts, oben, unten, vorn und hinten zu schauen. Nach mir die Sintflut eben. Siehe der Typ oben mit dem X7 und der 200-Euro-Tankrechnung (das war übrigens nicht erfunden).
Boomer-Bashing machen wir hier aber nicht. Die Dinge sind, so scheint es, etwas komplexer.
Natürlich müssen wir die Frage nach dem Zusammenhang von Multiglück und Krisenrepublik stellen. Denn die Bilanz der Cold-War-Generation ist, das wird immer deutlicher, mehr als mau. Vielleicht sogar – in einigen wichtigen Punkten – katastrophal. Auch wenn es natürlich Positives zu vermelden gibt: Die Generation hat keinen Krieg angezettelt. Es hat in den letzten 30 Jahren große Fortschritte im Umwelt- und Naturschutz gegeben. Bürger- und Minderheitenrechte sind ausgeweitet worden. Im Index der menschlichen Entwicklung, der von den Vereinten Nationen seit 1990 erhoben wird, hat sich Deutschland von einem sehr guten zwölften Platz im ersten Bericht auf einen noch besseren siebten Platz im 2023/24-Bericht nach vorne geschoben.2 Und Deutschland gehört – anders als beispielsweise die USA, Portugal, Belgien oder Tschechien – zu den zwei Dutzend Ländern mit einer »vollständigen Demokratie« – ausgeprägten Bürgerrechten und einer konstruktiven politischen Kultur (wenn man einen Weltmaßstab anlegt).3 Das alles steht auf der Habenseite. Aber dennoch: Wir durchleben unterschiedlichste Krisenzustände, wenn wir »Krise« so definieren, wie es der legendäre Gründer des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld tut, der Soziologe Wilhelm Heitmeyer: Die herkömmlichen Instrumente funktionieren nicht mehr, und die Zustände vor der Krise sind nicht wiederherstellbar.4 Schauen wir auf drei prägende Krisen:
Über die Allermeisten, die die Allerwenigsten hinterlassen, haben wir schon gesprochen. 1964 versus 2011. Ein Thema, eine Krise, die wir wirklich nicht im Griff haben, ist der demografische Wandel. Wieso ist das so, warum hat die Cold-War-Generation Alterung und Schrumpfung der Bevölkerung, Zu- und Abwanderung nicht schon vor vielen Jahren zu managen begonnen? Zumal das alles seit Jahrzehnten absehbar war.
Dann die fundamentalste Krise überhaupt: Wir gingen gerade in die Grundschule, als bereits dramatisch vor dem Klimawandel gewarnt wurde. »Geht aber die Industrialisierung und die Bevölkerungsexplosion ungehindert weiter, dann wird spätestens in zwei bis drei Generationen der Punkt erreicht, an dem unvermeidlich irreversible Folgen globalen Ausmaßes eintreten.«5 Das schrieb die Deutsche Physikalische Gesellschaft bereits 1971. Genauso ist es gekommen. Und ganz offensichtlich haben wir es zugelassen. Wie konnte es dazu kommen? Haben wir nur unseren Wohlstand gemehrt und uns um den Rest nicht wirklich geschert?
Was uns hingegen immer scherte, war die Aussicht auf den »Ruhestand«. Seit unserer Geburt haben sich die Reallöhne verdreifacht – dennoch waren auch viele, die es sich hätten leisten können, nicht in der Lage, für ihre Rente vorzusorgen, geschweige denn soziale Ungleichheit und Armut abzubauen. Für viele Angehörige der Cold-War-Generation scheint klar, dass für ihren Lebensunterhalt die gesetzliche Rentenversicherung aufkommen soll. Daher werden alle möglichen Mittel bemüht, das Rentenniveau zu halten, obwohl die Anzahl der Beitragszahlerinnen immer weiter absinkt – weil wir weniger Kinder bekommen haben (hier schließt sich der Kreis) und selbstverständlich viele von uns Deutschland lange nicht als ein Einwanderungsland sahen.
Demografie. Rente. Klima. Um diese drei Krisen geht es im zweiten Teil des Buches. Diese Krisen sind von unterschiedlicher Komplexität, einige hängen miteinander zusammen, und wir werden versuchen, ihre Entstehung und Entwicklung in diesem Buch nachzuzeichnen. Was sie alle teilen: Ihre Wurzeln reichen lange zurück. Umso interessanter ist die Frage, welchen Beitrag die Cold-War-Generation dazu geleistet hat, dass wir da stehen, wo wir nun mal stehen.
Denn eines ist klar: Die Bilanz der Generation ist nicht gut. Wir hinterlassen vielleicht keine Sintflut, aber den Garten Eden schon mal gar nicht. Vielleicht wäre – zumindest in Bezug auf die Klimakrise – Vorhölle ganz passend. Die hängt so dazwischen, und keiner versteht so genau, was sie bedeutet und welche Konsequenzen sie hat. Aber zum Glück – oder besser: Gott sei Dank – hat der Vatikan ja 2007 den Limbus, wie die Vorhölle kirchenvornehm heißt, abgeschafft, so dass uns dieses Schicksal nicht mehr ereilen kann.
Wenn wir also kein Bashing einer ganzen Alterskohorte betreiben wollen und etwas differenzierter auf die Dinge zu schauen bereit sind, müssen wir tiefer in die Entstehung und den Verlauf der Krisen hineinschauen. Wie sind die Krisen entstanden, welche historischen, sozialen, politischen Ursachen liegen ihnen zugrunde? Warum sind sie so verlaufen, wie sie es bisher nun einmal sind, und wer oder was hatte darauf den größten Einfluss? Nur wenn wir uns Ursprünge und Entwicklung der Krisen genauer anschauen, sind wir in der Lage, den Beitrag der Cold-War-Generation herauszuarbeiten. Dabei werden wir einige Überraschungen erleben. Zum Beispiel, dass man die Demografiekrise wirklich nicht der Cold-War-Generation anrechnen kann, im Gegenteil: Den demografischen Wandel hat schon die Generation ihrer Eltern verschlafen beziehungsweise Anpassungen aktiv blockiert. Hier war viel Ideologie im Spiel. Die Cold-War-Generation hat versucht, zu retten, was zu retten war.
Auch die Wurzeln der Rentenkrise reichen bis in die Adenauer-Zeit zurück. Hier zeigt sich trotzdem Egoismus, vor allem aber der Beginn der Gerontokratie, der Herrschaft der Alten in Deutschland. Nach mir der Beitragszahler.
Und beim Klima: Totalversagen. Aber sehr komplex und nicht einfach nur einer einzelnen Generation anzulasten. Ohne die Cold-War-Generation von allem freisprechen zu wollen, werden wir ein sehr ungesundes Zusammenspiel finden von Systemzwängen, Ideologie, Lobbyismus, ungünstigen psychologischen und medialen Mechanismen, aber eben auch Schurkentum und Egoismus. Und die spezifische historisch-kulturelle Prägung, das Psychogramm der Cold-War-Generation, ist auch alles andere als hilfreich beim Klimathema. Wenn irgendwo »Nach mir die Sintflut« passend ist, dann hier.
Bevor wir aber die Krisen und die Rolle der Cold-War-Generation in Augenschein nehmen, sollten wir genauer verstehen, was denn diese Generation ausmacht. Das geschieht im ersten Teil des Buches.
Schaut man sich die Publikationen an, die vor etwa zehn Jahren zum 50-jährigen Jubiläum der großen Jahrgänge 1963, 1964 oder 1965 erschienen sind, dann vermittelt sich der Eindruck, dass deren Kindheit und Jugend ganz nett und locker war, aber irgendwie auch banal und spießig.6 Völlig unaufregend und normal. Da wird erzählt von Trimm-dich-Pfaden, Kochgruppen in der WG, Interrail-Reisen durch Europa, Stehblues und Schwarzlicht, Fernsehen ohne Fernbedienung, dass man ohne Handy telefonierte und dass Kinder keine komplizierten Vornamen hatten. Tief geht das nicht. Aber vielleicht ist das auch dem Genre der Jubiläumsbücher geschuldet. Schmunzelbücher, die Anekdötchen erzählen, uns aber nicht wirklich weiterhelfen, wenn wir die Merkmale der Generation besser verstehen wollen.
Dabei gehe ich von zwei Dingen aus. Erstens: Man kann sinnvoll von »Generationen« sprechen. Und zweitens: Die prägende Phase jeder Generation findet in der Kindheit und Jugend statt.
Vor allem Ersteres ist nicht selbstverständlich: In den akademischen Sozialwissenschaften wird der Generationenbegriff nur noch selten verwendet. Er gilt als angestaubt, zu wenig differenzierend und eher übergeneralisierend; zudem bekommt er Fragen der sozialen Schichtung, der Klasse oder des Geschlechts nur schwer in den Blick. Und zu allem Überfluss stellt sich noch folgendes knifflige Problem: Wenn wir Unterschiede im Verhalten oder den Einstellungen zwischen zwei Gruppen unterschiedlichen Alters feststellen, dann können wir das auf wenigstens drei verschiedene Weisen interpretieren:
Erstens einfach als Folge der Tatsache, dass diese Kohorten sich im Alter so deutlich unterscheiden und ältere Menschen häufig andere Einstellungen oder anderes Verhalten zeigen als jüngere. Das wäre dann einfach ein Alterseffekt, für den wir den Begriff »Generation« nicht brauchen.Zweitens könnte eine Veränderung im Verhalten aber auch ein Periodeneffekt sein. Das sind Einflüsse auf Verhalten oder Einstellungen, die zu einer bestimmten Zeit von außen auf Menschen einwirken, ganz generationenunabhängig. Soziale Medien, Kriege oder Inflation zum Beispiel. Das aktuelle Hoch der AfD zum Beispiel sowohl bei Jungen als auch bei Älteren ist ein Periodeneffekt. Auch dafür brauchen wir den Generationenbegriff nicht.Von einem Generationen- oder Kohorteneffekt können wir nur im dritten Fall sprechen: Wenn wir nämlich gute Gründe haben, zu glauben, dass eine spezifische historisch-soziale Konstellation eine Alterskohorte in einer Weise prägt, die sie von anderen Alterskohorten unterscheidet.Einige Sozialwissenschaftler glauben, dass das nicht zu zeigen ist, und halten die Rede von Generationen daher für Unsinn.7 Und in der Tat sind viele Veröffentlichungen zu Generationen vor allem kommerziell getrieben – als Markt- oder Jugendforscherin kann man gutes Geld damit verdienen, alle 15 Jahre eine neue Generation zu erfinden (so wissen einige Jugendforscher bereits heute, dass 2025 bis 2029 die Generation Beta die Bühne betreten wird8 – eine völlig absurde Behauptung, die man aber gut versilbern kann).
Dennoch ist es auch heute noch sinnvoll, von Generationen zu sprechen. Wenn man sich bei Karl Mannheim, einem der Gründerväter der modernen Soziologie, erkundigt, wie ein gehaltvoller Generationenbegriff aussehen kann.
Dass er sich mit dem Thema tief gehend beschäftigte, ist wohl eigener biografischer Erfahrung geschuldet. Karl Mannheim war – in einem Satz zusammengefasst – ein »Soziologe und Philosoph österreichisch-ungarischer Herkunft, jüdischer Religion, deutscher und britischer Staatsbürgerschaft«.9 In Budapest 1893 geboren, in London 1947 gestorben, hat er selbst zwei Mal Vertreibung erlebt – einmal aus Ungarn, einmal aus Nazi-Deutschland. Dass spezifische historisch-soziale Konstellationen seine Persönlichkeit und sein Leben geprägt haben, lässt sich wahrlich nicht bestreiten.
Unser Denken, Wissen und Handeln sei immer abhängig vom sozialen Standort und dem gesellschaftlich-geschichtlichen Lebenszusammenhang, führt Mannheim in seinem bis heute Maßstäbe setzenden Aufsatz »Das Problem der Generationen« aus.10 Um Generationen genauer in den Blick zu nehmen, bedient er sich einiger begrifflicher Unterscheidungen. Grundlegend ist der Begriff der »Generationslage« oder »Generationslagerung«, worunter er die »Zugehörigkeit zu einander verwandten Geburtsjahrgängen« versteht.11 Die Generationslage beschreibt den historisch-gesellschaftlichen Raum, in den Menschen hineingeboren werden und der den Rahmen für ihr Erleben, Empfinden, Denken und Handeln setzt: »Nur ein gemeinsamer historisch-sozialer Lebensraum ermöglicht, daß die geburtsmäßige Lagerung in der chronologischen Zeit zu einer soziologisch-relevanten werde.«12 Er macht das am Beispiel deutscher und chinesischer Jugendlicher fest, die zwar chronologisch gleichzeitig leben, aber in unterschiedlichen historisch-sozialen Räumen aufwachsen und daher keine gemeinsame Generation bilden. In diesem Sinne kann man auch sagen, dass die westdeutsche Cold-War-Generation und ihre Altersgenossen in der DDR keine gemeinsame Generation bilden, weil sie in hinreichend unterschiedlichen historisch-sozialen Räumen aufwuchsen (ihr stärkster gemeinsamer Bezugspunkt sind ihre durch die Erziehung in der Nazi-Zeit geprägten Eltern).
Darauf aufbauend, unterscheidet Mannheim zwischen Generationszusammenhang und Generationseinheit. Ziehen wir Klimaleugner und Klimakleber heran, um die Begriffe zu erläutern: Jede der beiden Gruppen bildet eine Generationseinheit in einem einheitlichen Generationszusammenhang. Beide beziehen sich auf den Klimawandel als ein bedeutendes Zeitereignis (Mannheim spricht von »typischen Ereignissen« oder »Kollektivereignissen«), mit dem sie sich in »polarer Form« auseinandersetzen. »Im Rahmen desselben Generationszusammenhanges können sich also mehrere, polar sich bekämpfende Generationseinheiten bilden.«13
Zentral für uns ist der Begriff der Generationslage, also ein Menschen ähnlichen Alters gemeinsamer historisch-sozialer Lebensraum, auf den gesellschaftlich relevante Kräfte prägend einwirken. Diese historische Lage setzt quasi den Rahmen, den Frame, innerhalb dessen wir uns kognitiv, sozial, emotional und räumlich bewegen. Unser Denken, Handeln, Fühlen und Erleben wird dadurch sozial (mit-)bestimmt, und wenn wir in der Lage sind, diesen Rahmen in Bezug auf bestimmte Alterskohorten von anderen Rahmungen abzusetzen, können wir von einer Generationslage sprechen. Der Einfachheit halber werde ich ab jetzt den Begriff Generation in diesem Sinne verwenden, denn dieser Begriff erlaubt uns, geschichtlichen und sozialen Wandel durch die Abfolge von Generationen zu periodisieren.14
»Generation«, so verstanden, bedeutet also nicht, dass sich die Mitglieder dieser Generation mit den sozialen Phänomenen ihrer Zeit bewusst auseinandersetzen (das wäre »Generationszusammenhang« bei Mannheim) oder gar, dass sie eine inhaltlich einheitliche Gruppe bilden müssen (das wäre »Generationseinheit«).
»Generation« in diesem Sinne bedeutet dagegen, spezifische Einflüsse auf bestimmte Alterskohorten erkennbar zu machen, die auf Menschen prägend einwirken können, die sie grundieren, ohne ihnen damit automatisch einheitliche Einstellungen zuzuschreiben. Der Generationsbegriff ordnet damit Gesellschaft in zeitliche Abfolgen und ist zunächst vor allem ein Angebot der Fremd- und Selbstthematisierung, die auch dazu dienen kann, gesellschaftliche Prozesse oder Krisen zu deuten.15 »Generationen sind in erster Linie jedoch Identitätskonstruktionen, die bestimmte Alterskohorten in der Gesellschaft sichtbar machen und Individuen die Möglichkeit bieten, ihre eigene Lebensgeschichte vor diesem Hintergrund zu deuten und zu reflektieren.«16
Und das ist ja eigentlich genau das, was wir wollen: Die Generation derjenigen, die jetzt in Rente gehen, die Cold-War-Generation, sichtbar zu machen, den Rahmen zu erkennen, innerhalb dessen sie kognitiv, sozial und emotional geprägt wurden. Um mit dieser Selbstthematisierung vielleicht besser zu verstehen, warum wir in so krisenhaften Zeiten leben und inwieweit die Prägung dieser Generation dazu beigetragen hat. Um das beurteilen zu können, müssen wir Genese, Struktur und Charakter der Krisen genau verstehen, und wir werden sie daher im zweiten Teil recht tief gehend beleuchten.
Im ersten Teil des Buches versuche ich aber zunächst, die Cold-War-Generation sichtbar zu machen. Wir werden die »langen sechziger Jahre« – ein Begriff des Kopenhagener Zeithistorikers Detlef Siegfried – in den Blick nehmen, die Zeitspanne von etwa Mitte der 1950er bis Mitte der 1970er Jahre. Hier wurde die Cold-War-Generation geboren, hier wuchs sie auf, hier wurde sie grundiert. Es war eine Zeit, in der der »Grauschleier über der Stadt«, den die Wuppertaler Post-Punk-Band Fehlfarben aggressiv und hart besang, allmählich verschwand, die immer bunter wurde und über der dennoch – im Hintergrund, im Ungefähren, nicht selten in der Familie – eine eigentümliche Trübung lag. Noch mal mit den Fehlfarben: »Die Schatten der Vergangenheit / wo ich auch hingeh sind sie nicht weit.« Schaut man sich diese für die Generation prägende Zeit etwas genauer an, dann wird klar, warum sie die Generation des Kalten Krieges ist – und zwar in kognitiver, emotionaler und sozialer Hinsicht.
Aufbauend auf diese zeithistorischen Betrachtungen, werde ich ein Psychogramm der Cold-War-Generation entwickeln. Wir werden sehen, dass die Angehörigen dieser Generation von bestimmten Merkmalen und Erfahrungen geprägt sind: davon, dass sie die Kinder von Kriegskindern und des Kalten Krieges sind, was zu einem ausgeprägten Stabilitätsbedürfnis, einer gewissen Risikoscheu, einer klaren Westorientierung sowie Wohlstands- und Fortschrittswünschen führte. Sie haben überwiegend eine dreifache Stabilitätserfahrung gemacht und konnten Aufstiegs- und Wohlstandsbedürfnisse oftmals befriedigen. Dies alles hat zu einer selbstzufriedenen Binnenperspektive geführt, einer hohen Selbstgewissheit, auch zu Ignoranz und Überlegenheitsgefühlen, ja manchmal sogar zu einer Art Siegermentalität. Ohne dass damit die »Schatten der Vergangenheit«, das Unsichere, Gefährdete hinter der Selbstgewissheit, vollständig verschwunden wären.
Wir werden diese Interpretation der Cold-War-Generation dann heranziehen, um die Krisenorte Demografie, Rente, Klima auch im Lichte der Merkmale dieser Generation zu deuten und ihren spezifischen Beitrag herauszuarbeiten.
Im Schlussteil werde ich der Frage nachgehen, ob die Cold-War-Generation die Generation Ego ist oder ob es sich bei ihren Angehörigen nicht doch vielmehr um ganz normale Leute, normal people, handelt. Die Antwort sei hier gleich vorweggenommen: Beides ist der Fall. Fast alle Generationen sind selbstzentriert, alle Menschen unterliegen kognitiven Fehlleistungen und Verzerrungen – darin unterscheidet sich die Cold-War-Generation kaum von der Generation Z, die gerade ins Berufsleben einsteigt. Aber es gibt einen Unterschied: Das Psychogramm der Cold-War-Generation hat die Selbstzentriertheit, die Selbstgewissheit verstärkt. Und die Prägung in den langen sechziger Jahren hat dazu geführt, dass die Generation schwere Krisen – mit einer Ausnahme – nur im Rückspiegel beobachtet und aufziehende Krisen nicht hinreichend wahrgenommen und beachtet hat: zu einer Zeit, als konsequentes Handeln zum Eindämmen der Krisen hätte beitragen können. Dieser Verantwortung muss sich die Cold-War-Generation stellen, gerade auch aus Gründen der Gerechtigkeit gegenüber nachfolgenden Generationen.
Analyse und Bewertung mögen ernüchternd sein; umso wichtiger erscheint es, aufzuzeigen, welche Handlungsmöglichkeiten wir haben, um den krisenhaften Zuständen angemessener zu begegnen. Ganz am Ende des Buches werde ich daher – in zugegeben ziemlich idealistischer, vielleicht naiver Weise – Handlungsmöglichkeiten benennen, wie wir alle, aber besonders die Cold-War-Generation, aktiv werden können, um den notwendigen Wandel zu gestalten.
»Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben«, lautet der berühmteste Satz des ehemaligen Kreml-Chefs Michail Gorbatschow, den er so wahrscheinlich nie gesagt hat.17 Oder in den Worten des ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann: »Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte.« Die Veränderung jedenfalls muss in unseren Köpfen beginnen und darf die Herzen nicht aussparen.
George Bernard Shaw soll einmal gesagt haben, dass Menschen gerne Fehler, die sie seit Jahrzehnten machen, Erfahrung nennen. Damit sollten wir aufhören. Und auch damit, den Kopf in den Sand zu stecken oder nur auf das Prinzip Hoffnung zu setzen. Der alle Probleme lösende und ein besseres Leben verheißende Hoffnungsträger heißt in säkularen Zeiten nicht mehr Gott. Für viele aber »technologischer Fortschritt«. Der Unterschied zu Gott: Seine Existenz ist ziemlich unzweifelhaft – ja, es gibt technologischen Fortschritt. Die Gemeinsamkeit: Wir wissen nicht, inwieweit er zur Lösung unserer Probleme beiträgt. Auf ihn zu setzen, hat also etwas Quasireligiöses. Wollen wir darauf die Zukunft unserer Kinder bauen?
Immerhin: Anders als bei der Vorhölle kann keine Kommission vom Schreibtisch aus beschließen, den technologischen Fortschritt einfach abzuschaffen. Aber es kann eben auch kein Gremium verordnen, dass er nun gefälligst kommt. Und zwar genau so, wie wir ihn gerne hätten. Das schafft nicht einmal die FDP.
ERSTER TEIL
Die Cold-War-Generation – Wie sie wurde, wer sie ist
Keine Atempause
Geschichte wird gemacht
Es geht voran!
Fehlfarben, Ein Jahr (Es geht voran), 1980
Es liegt ein Grauschleier über der Stadt
Den meine Mutter noch nicht weggewaschen hat.
Fehlfarben, Grauschleier, 1980
Wenn wir die Cold-War-Generation in ihrer Besonderheit verstehen wollen, sollten wir uns anschauen, welche Erfahrungen die Menschen, die zu dieser Generation gehören, in ihrer Kindheit und Jugend gemacht haben. Zu welchen Merkmalen, Mustern, Persönlichkeitsausprägungen führten diese Erfahrungen? Zwar glaubt die Entwicklungspsychologie heute nicht mehr, dass sich die Persönlichkeit eines Menschen sehr früh abschließend ausbildet und dann bis ins Alter unverändert bleibt. Aufwändige Studien haben aber gezeigt, dass sich wesentliche Merkmale vor allem in der Kindheit und Jugend und im frühen Erwachsenenalter entwickeln und erst etwa ab dem 50. Lebensjahr recht konstant bleiben.18 Zwar können wir auch im hohen Alter noch lernen, die wesentlichen Erfahrungen machen wir aber zumeist weitaus früher, und dabei spielt die Umwelt eine entscheidende Rolle. Der Neurowissenschaftler Gerhard Roth hat das so zusammengefasst:
Wir sehen also, dass das Gehirn des Menschen und damit seine Persönlichkeit auf mindestens drei Weisen von der engeren oder weiteren Umwelt gestaltet und geprägt werden. Die Gene im engeren Sinne spielen hierbei eine nur allgemeine Rolle: Sie legen fest, dass wir im biologischen Sinne Menschen sind und dass wir hinsichtlich unserer kognitiven, emotionalen und sozialen Merkmale von der Gesellschaft geprägt werden können. Wie sich im Einzelnen die Persönlichkeit entwickelt, hängt dann von den epigenetischen Vorgängen vor der Geburt, den frühen Bindungserfahrungen und den späteren sozialen Erfahrungen ab.19
Um diese »frühen Bindungserfahrungen und späteren sozialen Erfahrungen« geht es in diesem Kapitel. Wir können dabei die Umwelt des Menschen als eine Reihe ineinander verschachtelter Strukturen verstehen, wie bei den russischen Matrjoschka-Puppen, die ineinandergesteckt werden. Der US-amerikanische Entwicklungspsychologe Urie Bronfenbrenner unterscheidet dabei vier verschiedene Strukturen, die auf unsere soziale Entwicklung einwirken.20 Das beginnt bei Aktivitäten und Beziehungen, an denen das Kind direkt teilnimmt, also häufig zunächst die Familie, später Gleichaltrige, Lehrer, Nachbarinnen und so weiter (das Mikrosystem), geht weiter über Beziehungen zwischen diesen Bezugspersonen (das Mesosystem) hin zum Exosystem, dem das Kind zwar nicht direkt angehört, dessen Auswirkungen es aber dennoch ausgesetzt ist. Beispiele wären Arbeitsmarktpolitik (Arbeitszeiten, Elternzeit), rechtliche Regeln, Massenmedien. Die vierte Schicht der Puppe ist schließlich das Makrosystem, das allgemeine Bräuche, Normen und Werte einer Gesellschaft umfasst und das über das Exo- und Mesosystem auf Kinder einwirkt.
Wenn wir uns nun auf die Suche nach dem Psychogramm, den prägenden Persönlichkeitsmerkmalen von Angehörigen der Cold-War-Generation machen, können wir uns durch die verschiedenen Umweltstrukturen schlängeln, die sie vor allem in ihrer Kindheit und Jugend umgeben haben, also in den späten 1950er, 1960er und frühen 1970er Jahren. In welche Umgebung ist die Cold-War-Generation hineingeboren worden? Was hat ihre Eltern, Verwandten, Lehrerinnen und Erzieher geprägt und bewegt? Mit einem Satz: In was für einer Lebenswelt ist diese Generation aufgewachsen?
1
Die »langen sechziger Jahre« – Die Lebenswelt der Cold-War-Generation
Von grau nach bunt
Grau. Das ist die Farbe, die ich assoziiere, wenn ich an mein erstes Lebensjahrzehnt in den 60er Jahren im Bochumer Norden denke. Danach zogen wir nach Aachen und lebten dort für drei Jahre, bevor es wieder zurück ins südliche Ruhrgebiet ging, immer der Aufstiegsbewegung der Familie folgend. Das waren dann die 70er Jahre, und wenn ich an diese Zeit denke, fällt mir keine einzelne Farbe mehr ein, sondern ein anderes Wort: bunt.
Von grau nach bunt. Vielleicht kann man so in vier Worten die Dynamik beschreiben, die Radikalität der Veränderung in dieser Zeit – der prägenden Jahre für die Cold-War-Generation. Der Zeithistoriker Detlef Siegfried, Professor für Neuere Deutsche und Europäische Geschichte an der Universität Kopenhagen, nennt diesen Zeitabschnitt »die langen sechziger Jahre« und datiert ihn von 1958 bis 1973.21 An anderer Stelle spricht Detlef Siegfried von der »zweiten Gründung« der Bundesrepublik »ungefähr von der Mitte der 1950er bis zur Mitte der 1970er Jahre«.22 Es sind die langen sechziger Jahre, in denen die Cold-War-Generation geboren, erzogen und geprägt wurde.
Was passierte in dieser Zeit? Welche Grunderfahrungen machte die Cold-War-Generation? Schauen wir uns zuerst die Entwicklung von grau nach bunt an. Das ist die schöne Geschichte. Sie ist wahr, aber sie ist nicht vollständig. Das Graue löste sich nämlich nicht einfach in Luft auf, teilweise wurde es nur schlecht übermalt und schimmerte immer noch deutlich durch. Dann lag ein Grauschleier über der Stadt, den Peter Hein, ebenfalls ein Kind der Cold-War-Generation und der Sänger der – ist das wirklich Zufall? – Fehlfarben aggressiv besang. Das ist die weniger gern erzählte Geschichte vom Grauen hinter dem Bunten. Und die schauen wir uns im Anschluss an.
Das Bunte vor dem Grauen – die schöne Geschichte
Die Rede vom Grauen war zunächst gar nicht metaphorisch, sondern wörtlich gemeint. Mein erstes Lebensjahrzehnt ist das der gedeckten, meist sogar unbunten Farben. Die Häuser in unserem Stadtteil waren fast alle grau, einige sogar schwarz. An unser Nachbarhaus hatten Maler vier Farbproben gepinselt, etwa einen Meter lang und 40 Zentimeter hoch: braun, dunkelgrau, hellgrau und weiß. Es blieb bei diesen Proben, bis wir aus der Stadt wegzogen. Und selbst ein Anstrich in diesen Farben hätte nicht wirklich mehr Buntheit in die Stadt gebracht. Farben sah man kaum, dafür überall Baulücken und Löcher, wo vor dem Krieg noch Häuser gestanden hatten. Die Neubauten: einfach und funktional. Und meistens graue Mäuse; cremeweiß oder schmutzig braun war schon ein mutiges Farbkonzept. Die Betonplattenbauweise und der Waschbeton wurden erfunden. Und welche Farbe hat Waschbeton? Genau. Der Architekt Matthias Gröhne, ehemaliger Professor im Studiengang Farbe an der Hochschule Esslingen, schreibt dazu: »Die Farbwelt der 60er ist vielleicht mit Begriffen wie Monotonie und Farblosigkeit zu umschreiben. Vorherrschende unbunte Farbtöne und Farben aus den Materialien heraus bestimmen neben Weiß das Bild unserer Städte.«23
Der Opel Rekord C meines Vaters war mattweiß, mein rindslederner Schultornister rehbraun. Der Golf 1 meiner Mutter – fünf, sechs Jahre später – war schon kräftig rot (»Phönixrot« nannte Volkswagen das), und der Tornister meines nur drei Jahre jüngeren Bruders schreiend orange. War 1968 noch Weiß die mit Abstand beliebteste Autofarbe, war es in den 1970ern bis in die 1980er Rot. Die Explosion der Autofarben hatte Ferruccio Lamborghini 1966 in Gang gesetzt, wenige Jahre nachdem er seine bald legendäre Automarke gegründet hatte. Die 763 Exemplare seines neuen Luxussportwagens Miura (übrigens benannt nach – und das gäbe es heute wohl auch nicht mehr – einem spanischen Kampfstierzüchter) »spiegeln den Regenbogen wider: Insgesamt 86 verschiedene Farbtöne wurden verwendet.«24 Twiggy, Supermodel der 60er Jahre, bestellte einen in Verde Giallo (Gelbgrün). Allerdings war es 1968 noch gefährlich, zumindest anstößig, in einem gelben Auto durch die Gegend zu fahren. Diese Erfahrung machte der Chefredakteur der Zeitschrift auto, motor und sport, Heinz-Ulrich Wieselmann, als er in einem knallgelben Mercedes-Benz SL durch die Straßen fuhr. Danach berichtete er: »Passanten blieben kopfschüttelnd stehen, ältere Herren fassten sich ans Hirn, Frauen zuckten bei seinem Anblick zusammen und machten ein Gesicht, als hätten sie in eine Zitrone gebissen.«25
Im gleichen Jahr zeigte die 4. documenta in Kassel die bis dahin größte Ausstellung der leuchtend bunten amerikanischen Pop Art in Europa, und nur wenige Jahre später trugen Autofarben dann so fröhliche Namen wie Mexikoblau, Indischrot, Signalorange oder Cliffgrün.26 Und »ans Hirn« fasste sich bald kaum noch jemand; grelle Farben konnten die Leute nicht mehr schockieren. Selbst Autos in krassen Farben mit seltsamen amerikanischen Namen wie Viper Green, Hugger Orange und Grabber Blue27 führten nur noch sehr gelegentlich zu nervösen Zuckungen.
Die Welt war bunt geworden.
Was war geschehen? Deutschland hatte endgültig die Nachkriegszeit und ihre Nachwehen hinter sich gelassen. Wann genau, das lässt sich natürlich nicht auf den Tag datieren. Wenn man aber doch ein Datum herausgreifen möchte, bietet sich der 5. Mai 1955 an. An diesem Tag traten die Pariser Verträge in Kraft, mit denen die Besatzungszeit in Westdeutschland endete, die Bundesrepublik in die NATO aufgenommen wurde und Teilsouveränität erlangte. Das alles war eine Folge politischer, wirtschaftlicher und kultureller Veränderungen, die alle eng untereinander verbunden sind. Schauen wir uns zunächst die wirtschaftlichen Veränderungen an.
»Goldene Jahre«. Das deutsche Wirtschaftswunder28
Recht schnell nach dem Zweiten Weltkrieg und für viele überraschend begann das »Deutsche Wirtschaftswunder«. Wobei dieser Nachkriegsboom gar nichts Singuläres in Deutschland war: Frankreich hatte sein Trente glorieuses, Spanien sein Milagro español, Italien sein Miracolo economico italiano und Österreich sein, klar, Wirtschaftswunder. Die ersten zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges waren dem Wiederaufbau und der Rekonstruktion der Wirtschaft gewidmet. Und dabei waren die Ausgangsbedingungen in Deutschland West in mehrerlei Hinsicht gar nicht so schlecht, wie man angesichts der zerstörten Städte hätte annehmen können. Denn etwa 80 Prozent der Produktionskapazitäten waren im Krieg eben nicht zerstört worden, und insgesamt war die Gesamtkapazität nach dem Krieg sogar höher als 1938, im letzten Vorkriegsjahr. Im Jahr 1948 betrug sie in den Westzonen ganze 111 Prozent der Vorkriegsleistung (in der Ostzone hingegen nur 74 Prozent).29 Nach langen internen Streitigkeiten entschieden sich die westlichen Alliierten schließlich für den Wiederaufbau ihrer Besatzungszonen. Mit der Währungsreform 1948 wurde die D-Mark eingeführt und der Tauschhandel quasi über Nacht beendet. Die Regale füllten sich. Die Produktionskosten in Deutschland waren im Vergleich zu anderen westlichen Ländern gering; der feste Wechselkurs der D-Mark zum US-Dollar wirkte wie eine Exportsubvention. Der Marshall-Plan unterstützte, war aber nicht wirklich wesentlich. Es entwickelte sich eine unglaubliche Dynamik: Die westdeutschen Exportleistungen waren 1960 viereinhalb Mal höher als 1950, das Bruttosozialprodukt drei Mal so hoch. Kaum zu glauben, dass das Realeinkommen einer durchschnittlichen Arbeiterfamilie bereits 1950 das Vorkriegsniveau überschritten hatte. Gab es 1950 noch zwei Millionen Arbeitslose, wurden 1955 schon die ersten »Gastarbeiter« angeworben. Viele Unternehmen wanderten aus der sowjetischen Besatzungszone gen Westen ab; dies war auch der Beginn der Industrialisierung des vormals agrarischen und armen Bayern. Insgesamt stiegen die Investitionen in der Bundesrepublik von 1952 bis 1960 um 120 Prozent.
Wirtschaftswissenschaftler glauben, dass das Wirtschaftswachstum bis zum Ende der 1950er Jahre das Ergebnis eines Rekonstruktionseffekts war. Das Produktionspotential in Deutschland war wegen des Krieges nicht ausgeschöpft worden, der Kapitalstock jedoch im Wesentlichen erhalten geblieben. Es gab genügend qualifizierte Arbeitskräfte, auch durch den ständigen Zustrom aus der DDR bis zum Mauerbau 1961. (Allein zwischen 1949 und 1961 waren das zwei Millionen Menschen, mehr als 13 Prozent der Erwerbstätigen der DDR.)30 Wissen um den Aufbau, die Entwicklung und das Managen von Organisationen waren hinreichend vorhanden – kein Wunder, die Wirtschaftselite hatte die Nazi-Zeit weit gehend schadlos überstanden und im neuen System einfach weitergemacht. Die Wirtschaft musste auf zivile Produktion umgestellt, Investitionsrückstände mussten aufgeholt werden. In dieser Phase gelang es der westdeutschen Wirtschaft, moderne Technologien einzuführen und wieder eine international wettbewerbsfähige Forschung und Entwicklung aufzubauen. Im Laufe der 1950er Jahre näherte sich die westdeutsche Industrie damit immer mehr dem führenden US-Standard an; ab 1953 standen bereits Kapazitätserweiterungen im Vordergrund. Die Rekonstruktion der deutschen Wirtschaft war damit weit gehend bewältigt.
Als die Cold-War-Generation geboren wurde, ging es bereits ans Aufholen. Die USA waren Deutschland (aber auch anderen europäischen Ländern) in der Produktivität weit enteilt. Durch die Rekonstruktion seiner Wirtschaft war Deutschland aber in der Lage, sich an den USA zu orientieren und aufzuholen, und konnte seine Produktivität in einem schnelleren Tempo entwickeln als das Vorbild USA. Dieser Aufholprozess war Anfang der 1970er Jahre abgeschlossen; Deutschland hatte das Produktivitätsniveau der USA erreicht, konnte hier also keine weiteren Vorteile mehr erzielen. Die Wachstumsraten schwächten sich ab, und 1973 kam es zur ersten größeren Wirtschaftskrise, der Ölkrise. Damit war der Nachkriegsboom vorbei.
Wie war es möglich, dass ein Land, das eben noch der Paria der Weltgemeinschaft war, das den Holocaust und Millionen Tote in seinem Angriffskrieg gegen die Welt zu verantworten hatte, dass solch ein Land in nur wenigen Jahren einen so krassen Aufschwung nehmen konnte?
Die zentrale Randbedingung war eine geopolitische: der Kalte Krieg.
Der Kalte Krieg
Westdeutschland hätte, das ist trivialerweise klar, nach dem Krieg nicht diese rasante Entwicklung genommen, wenn es nicht das Wirtschaftswunder gegeben hätte. Und das Wirtschaftswunder hätte es nicht gegeben, wenn die westlichen Alliierten es nicht erlaubt hätten. Der Marshall-Plan war da vielleicht das Tüpfelchen auf dem I, entscheidend waren aber die Währungsreform, die Vereinigung der drei westlichen Besatzungszonen zur Bundesrepublik, die Dollarbindung der D-Mark und die Exportmöglichkeiten. Entscheidend war schlicht die Tatsache, dass Westdeutschland erlaubt wurde, den Rekonstruktionseffekt und den Aufholeffekt seiner Wirtschaft umzusetzen. Es gibt vermutlich eine Reihe von Gründen, warum das ermöglicht wurde. Aber der entscheidende Grund ist sicherlich: Die Bundesrepublik war ein Kind des Kalten Krieges.
Als Beginn des Kalten Krieges, übrigens ein Begriff von George Orwell, gilt das Jahr 1947. US-Präsident Harry S. Truman hatte der Sowjetunion mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht, wenn sie weiterhin versuchen würde, einige Provinzen Irans abzuspalten und unter ihre Kontrolle zu bringen. Die »Truman-Doktrin« war geboren, nach der die USA den Expansionsdrang der Sowjetunion aufhalten und Länder (nicht nur demokratische) im Widerstand gegen den Kommunismus unterstützen wollten. Eine sich anbahnende Revolution in Griechenland spielte eine Rolle, ebenso die neu entdeckten Ölquellen in Arabien. Bald darauf, 1948/49, folgte die Blockade Westberlins durch die Sowjetunion, ein erster Höhepunkt der Eskalation. Schnell wurde dann 1949 die NATO gegründet, in die Westdeutschland 1955 aufgenommen wurde. Die Bundesrepublik sollte eingebunden und damit auch unter Kontrolle gehalten werden: »Keep the Soviet Union out, the Americans in, and the Germans down«, wie Lord Ismay, der erste Generalsekretär der NATO, deren Daseinssinn zusammenfasste.31 Im selben Jahr gründete sich das östliche Pendant, der Warschauer Vertrag. Fortan standen sich zwei feindliche Blöcke gegenüber, das geteilte Deutschland mittendrin. Und genau hier liegt der Grund, warum die BRD (und die DDR) Kinder des Kalten Krieges sind. Die bipolare Teilung der Welt verlief – in etwa dem Stand zu Ende des Zweiten Weltkrieges folgend – genau durch Deutschland. Es lag im Epizentrum des Kalten Krieges, und darum war es für die USA unabdingbar, die Westbindung der Bundesrepublik zu forcieren (genauso wie für die Sowjetunion die Ostbindung der DDR).
Der Kalte Krieg dauerte mehr als 40 Jahre, von 1947 bis 1989/1990, und die Generation, die wir betrachten, wurde mittendrin geboren, in den »langen 60er Jahren«. Als die Cold-War-Generation zur Welt kam, war die Rekonstruktionsphase der westdeutschen Wirtschaft schon abgeschlossen. Die Trümmer waren weggeräumt, die Wirtschaft wiederhergestellt, nun konnte es ans Aufholen gehen. Die gesamte Generation wurde während dieser Aufholphase mit weiterhin großen Wachstumsraten geboren. Und nach dem Ende der Kuba-Krise 1962 auch für viele Jahre in einer relativ entspannten Phase des Kalten Krieges.
Wie fühlten sich die langen sechziger Jahre des Aufschwungs und der relativen geopolitischen Stabilität für die Cold-War-Generation an? Wie sah ihre Lebenswelt aus? Fangen wir mit der schönen Seite an.
Die schöne bunte Seite der Lebenswelt: Wohlstand, Freizeit, Autos, Bildung
Detlef Siegfried, der Zeithistoriker aus Kopenhagen, fasst es in einem Satz so zusammen: »Kein Zweifel, die langen sechziger Jahre, also der Zeitraum zwischen etwa 1958 und 1973, waren in Westdeutschland ›goldene Jahre‹ des wirtschaftlichen Wohlstands, der zunehmenden Freizeit, der Entformalisierung gesellschaftlicher Beziehungen, der politischen Liberalisierung.«32
Die Nettoeinkommen durchschnittlicher Arbeitnehmer stiegen in dieser Dekade um 50 Prozent, gleichzeitig reduzierte sich die Arbeitszeit um fünf Stunden, und die Fünftagewoche wurde Standard.33 Ich erinnere mich noch, dass ich in meinen ersten beiden Grundschuljahren noch jeden zweiten Samstag im Monat zur Schule musste, was meinen Eltern gar nicht gefiel, weil es auch für sie immer normaler wurde, am Wochenende etwas mit den Kindern zu unternehmen (auch wenn mein Vater immer wieder samstags arbeitete und die Familie dann mit ins Büro nahm). Es gab einen »Eigenheimbauboom«; in nur sieben Jahren (1961 bis 1968) erhöhte sich die Zahl der Wohnungsbesitzenden um 18 Prozent.34 Gleichzeitig wurde Westdeutschland zur automobilen Gesellschaft – die Anzahl der PKW verdreifachte sich im Laufe der 60er Jahre von vier Millionen auf 13 Millionen.





























