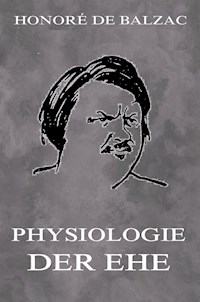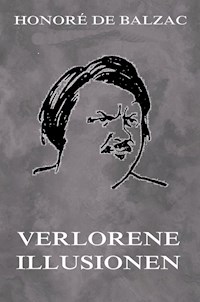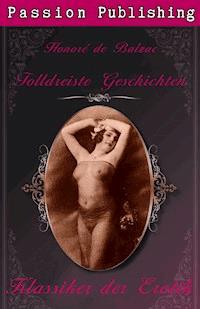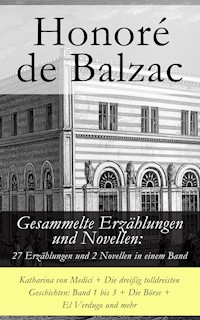
Gesammelte Erzählungen und Novellen: 27 Erzählungen und 2 Novellen in einem Band E-Book
Honore de Balzac
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Gesammelte Erzählungen und Novellen: 27 Erzählungen und 2 Novellen in einem Band" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Honoré de Balzac (1799/1850) war ein französischer Schriftsteller. Sein Hauptwerk ist der rund 88 Titel umfassende, aber unvollendete Romanzyklus La Comédie humaine (dt.: Die menschliche Komödie), dessen Romane und Erzählungen ein Gesamtbild der Gesellschaft im Frankreich seiner Zeit zu zeichnen versuchen. Inhalt: Erzählungen: Der Ball von Sceaux (1830) Sarrasine (1830) Vendetta (1830) El Verdugo (1831) Die Börse (1832) Die Grenadiere (1832) Oberst Chabert (1832) Ein Drama am Ufer des Meeres (1835) Seraphita (1835) Facino Cane (1836) Die Messe der Gottlosen (1836) Die Entmündigung (1836) Katharina von Medici (1836) Das Haus Nucingen (1838) Die Geheimnisse der Fürstin von Cadignan (1839) Eine Evatochter (1839) Die falsche Geliebte (1841) Eine Episode aus der Zeit der Schreckensherrschaft (1845) Tante Lisbeth (1846) Die Kleinbürger (1856) Die dreißig tolldreisten Geschichten: Band 1 bis 3 Tolldreiste Geschichten (Freie verkürzte Nachdichtung von Bierbaum/Riba) Der Diamant Die Königstreuen Der Auftrag Eine dunkle Geschichte Szenen aus dem Landleben: band 1&2 Novellen: Adieu (1830) Lebewohl (1830)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 7118
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gesammelte Erzählungen und Novellen: 27 Erzählungen und 2 Novellen in einem Band
Katharina von Medici + Die dreißig tolldreisten Geschichten: Band 1 bis 3 + Die Börse + El Verdugo und mehr
Inhaltsverzeichnis
Erzählungen
Der Ball von Sceaux (1830)
Le Bai de Sceaux
Der Graf von Fontaine, das Haupt einer der ältesten Familien Poitous, hatte der Sache der Bourbonen mit Intelligenz und Mut während der Kämpfe der Vendéer gegen die Republik gedient. Nachdem er allen Gefahren entronnen war, die die royalistischen Anführer in dieser stürmischen Epoche der zeitgenössischen Geschichte bedroht hatten, pflegte er scherzend zu sagen: »Ich bin einer von denen, die sich auf den Stufen des Throns haben töten lassen!« Dieser Scherz hatte etwas Wahres bei einem Manne, den man an dem blutigen Tage von Quatre-Chemins für tot liegen gelassen hatte. Obgleich durch die Konfiskationen ruiniert, weigerte sich dieser getreue Vendéer beharrlich, eine der einkömmlichen Stellungen anzunehmen, die ihm der Kaiser Napoleon anbieten ließ. Unbeugsam in seinen aristokratischen Anschauungen, handelte er auch blind nach diesen Grundsätzen, als er es an der Zeit hielt, sich eine Lebensgefährtin zu wählen. Trotz der verführerischen Angebote eines reichen republikanischen Parvenüs, der sich eine solche Heirat viel Geld hätte kosten lassen, verehelichte er sich mit einem Fräulein von Kergarouet, die vermögenslos, deren Familie aber eine der ältesten der Bretagne war. Von der Restauration wurde Herr von Fontaine überrascht, als er bereits eine zahlreiche Familie besaß. Obwohl es dem vornehm denkenden Edelmann nicht in den Sinn gekommen wäre, eine Gunst für sich zu erbitten, gab er doch dem Wunsche seiner Frau nach, verließ seinen Landsitz, dessen bescheidener Ertrag kaum für die Bedürfnisse seiner Kinder ausreichte, und ging nach Paris. Angewidert von der Begehrlichkeit, mit der seine alten Kameraden auf die Stellungen und Würden, die die konstitutionelle Regierung zu vergeben hatte, Jagd machten, war er schon im Begriff, auf sein Landgut zurückzukehren, als er einen Brief des Ministers erhielt, in dem ihm eine ziemlich berühmte Exzellenz seine Erhebung zum Range eines Feldmarschalls mitteilte, auf Grund der Ordonnanz, wonach es Offizieren der katholischen Armeen gestattet war, sich die ersten zwanzig Jahre einer fingierten Regierung Ludwigs XVIII. als Dienstzeit anzurechnen. Einige Tage später empfing der Vendéer auch noch, ohne darum gebeten zu haben, sondern von Amts wegen, das Kreuz des Ordens der Ehrenlegion und das Sankt-Ludwigskreuz. Durch diese aufeinanderfolgenden Gnadenbeweise wurde er in seinem Entschlusse wieder schwankend, da er sie dem Umstande zuschreiben zu müssen glaubte, daß der Monarch sich seiner erinnert habe; er begnügte sich nicht mehr damit, seine Familie alle Sonntage, wie er es unverbrüchlich getan hatte, in den Marschallsaal der Tuilerien zu führen und dort, wenn sich die Prinzen in die Kapelle begaben, »Es lebe der König« zu rufen, sondern er suchte um die Gunst einer besonderen Audienz nach. Diese sofort bewilligte Audienz hatte aber keinen besonderen Charakter. Der Saal im Schlosse war voll von alten Dienern, deren gepuderte Köpfe, aus einer gewissen Höhe gesehen, einem Teppich aus Schnee glichen. Hier traf der Edelmann alte Kameraden, die ihn aber etwas kühl begrüßten; die Prinzen allerdings erschienen ihm »anbetungswürdig« – ein Ausdruck, der ihm in seinem Enthusiasmus entschlüpfte –, als der liebenswürdigste seiner Herrscher, dem der Graf nur dem Namen nach bekannt zu sein glaubte, zu ihm herantrat, ihm die Hand drückte und ihn als den echtesten Vendéer bezeichnete. Trotz dieser Huldigung kam aber keiner der erlauchten Persönlichkeiten auf den Gedanken, ihn über die Höhe seiner Verluste oder der Beträge, die er in generöser Weise den Kassen der katholischen Armee hatte zufließen lassen, zu befragen. Er erkannte ein wenig spät, daß er Krieg auf eigene Kosten geführt hatte. Gegen Ende des Abends glaubte er eine geistreiche Anspielung auf den Stand seiner Vermögensverhältnisse wagen zu dürfen, der dem vieler anderer Edelleute glich. Seine Majestät lachte herzlich, weil jedes Wort, das von Geist zeugte, imstande war, sein Gefallen zu erregen; aber sie antwortete nur mit einem der königlichen Scherze, deren Liebenswürdigkeit mehr zu fürchten war, als ein im Zorn ausgesprochener Tadel. Einer der intimsten Vertrauten des Königs zögerte auch nicht, sich dem schlauen Vendéer zu nähern, und gab ihm mit einer feinen höflichen Bemerkung zu verstehen, daß der Moment noch nicht gekommen sei, wo man den Herrschern seine Rechnung präsentieren könne: auch befanden sich auf dem Tische noch viele Denkschriften, die älter waren als sein Anliegen, und die sicher von Wichtigkeit für die Geschichte der Revolutionszeit waren. Der Graf entfernte sich klüglich aus der verehrungswürdigen Gruppe, die respektvoll einen Halbkreis um die erlauchte Familie bildete; dann, nachdem er seinen Degen, der ihm zwischen seine dünnen Beine geraten war, wieder zurechtgeschoben hatte, begab er sich zu Fuß über den Hof der Tuilerien zu seinem Mietswagen, den er am Quai hatte halten lassen. Mit der Halsstarrigkeit, die den Adel vom alten Schlage auszeichnet, bei dem die Erinnerung an die Liga und die Barrikaden noch nicht erloschen ist, schimpfte er in seinem Wagen so laut, daß er sich dadurch kompromittieren konnte, über die Veränderung, die bei Hofe eingetreten war. »Ehemals«, sagte er zu sich, »sprach jedermann frei mit dem Könige über seine privaten Angelegenheiten, die Edelleute konnten nach ihrem Gefallen ihn um eine Gnade und um Geld bitten, und heute soll man, ohne Lärm zu machen, nicht einmal die Rückzahlung von Geldern verlangen können, die man in seinem Interesse vorgestreckt hat? Zum Donnerwetter! Das Sankt-Ludwigskreuz und der Rang eines Feldmarschalls sind doch kein Ausgleich für die dreihunderttausend Franken, die ich rund und nett für die Sache des Königs hergegeben habe. Ich will noch mal mit dem Könige reden, von Angesicht zu Angesicht in seinem Kabinett.«
Dieser Vorgang kühlte den Eifer des Herrn von Fontaine um so mehr ab, als seine Gesuche um eine Audienz beständig unbeantwortet blieben. Andererseits mußte er sehen, wie Eindringlinge vom kaiserlichen Hof her mehrfach Chargen erhielten, die unter der alten Monarchie nur den Mitgliedern der besten Häuser vorbehalten gewesen waren.
»Es ist alles verloren«, sagte er eines Morgens zu sich. »Der König ist unzweifelhaft niemals etwas anderes als ein Revolutionär gewesen. Hätten wir nicht seinen Bruder, der nicht wankt und der Trost seiner getreuen Diener ist, dann wüßte ich nicht, in welche Hände eines Tages die Krone Frankreichs geraten könne, wenn diese Art zu regieren so weiter geht. Ihre verdammte konstitutionelle Verfassung ist die schlechteste aller Regierungsformen, und Frankreich wird sich ihr niemals anpassen. Ludwig XVIII. und Herr Beugnot haben uns in Saint-Ouen alles verdorben.«
Der Graf, der alle Hoffnungen aufgegeben hatte, schickte sich an, auf sein Landgut zurückzugehen und gab großmütig alle seine Ansprüche auf Schadloshaltung auf. In diesem Moment kündigten die Ereignisse des zwanzigsten März einen neuen Sturm an, der das legitime Königtum und seine Verteidiger mit fortzureißen drohte. Gleich den zartfühlenden Leuten, die einen Diener bei Regenwetter nicht ausschicken, nahm Herr von Fontaine Geld auf seine Besitzung auf, um dem auf der Flucht befindlichen Königshause folgen zu können, ohne zu wissen, ob sein Anschluß an die Emigranten für ihn nutzbringender sein würde, als es seine Hingebung in der vergangenen Zeit gewesen war; da er aber bemerkt hatte, daß die Exilgenossen mehr in Gunst standen, als die Tapferen, die einstmals sich gegen die Aufrichtung der Republik mit bewaffneter Hand aufgelehnt hatten, so durfte er vielleicht hoffen, aus diesem Aufenthalt in der Fremde größeren Vorteil zu ziehen, als durch tätige und gefährliche Dienstleistungen im Lande. Diese Erwägungen eines Hofmanns waren keine Spekulationen ins Blaue hinein, die auf dem Papier glänzende Resultate verheißen, aber bei ihrer Ausführung zum Ruin führen. So wurde er, nach dem Ausspruch des geistreichsten und gewandtesten unsrer Diplomaten, einer von den fünfhundert getreuen Dienern, die das königliche Exil in Gent teilten, und die in einer Anzahl von fünfzigtausend aus ihm zurückkehrten. Während dieser kurzen Abwesenheit des Königshauses hatte Herr von Fontaine das Glück, von Ludwig XVIII. zu Diensten verwendet zu werden; und es fand sich mehr als eine Gelegenheit, da er dem Könige den Beweis großer politischer Zuverlässigkeit und treuer Anhänglichkeit geben konnte. Eines Abends, als der Monarch gerade nichts Besseres zu tun hatte, erinnerte er sich an das Bonmot, das Herr von Fontaine damals in den Tuilerien geäußert hatte. Der alte Vendéer ließ sich eine solche Gelegenheit nicht entgehen und erzählte seine Geschichte geistvoll genug, so daß der König, der nichts vergaß, sich zu geeigneter Zeit daran erinnern konnte. Dem erlauchten Literaten fiel auch die gewandte Form auf, die einige Noten zeigten, mit deren Redaktion der diskrete Edelmann betraut worden war. Dieses unbedeutende Verdienst prägte Herrn von Fontaine dem Gedächtnis des Königs als einen der loyalsten Diener der Krone ein. Nach der zweiten Rückkehr wurde der Graf zu einem der außerordentlichen Sendboten ernannt, die die Departements bereisten und die Aufgabe hatten, über die Begünstiger der Rebellion das entscheidende Urteil zu fällen; aber er machte nur mäßigen Gebrauch von seiner furchtbaren Machtvollkommenheit. Sobald diese temporäre Rechtsprechung erledigt war, konnte sich der bisherige Generalprofoß auf einem der Stühle des Staatsrats niederlassen, wurde Deputierter, als welcher er wenig sprach, aber aufmerksam zuhörte, und änderte seine Anschauungen erheblich. Mehrere den Biographen unbekannt gebliebene Umstände ließen ihn mit dem Könige so vertraut werden, daß der boshafte Monarch ihn einmal beim Hereintreten mit den Worten empfing: »Fontaine, mein lieber Freund, ich würde mir nicht einfallen lassen, Sie zum Generaldirektor oder zum Minister zu ernennen! Weder Sie noch ich könnten, wenn wir ein solches Amt hätten, bei unsern Anschauungen darin verbleiben. Das Repräsentativsystem hat die gute Seite, daß es uns die Peinlichkeit erspart, die wir früher empfanden, wenn wir unsere Staatssekretäre selber fortschicken mußten. Unser Staatsrat ist zu einem Wirtshaus geworden, in das die öffentliche Meinung uns häufig seltsame Reisende schickt; aber schließlich werden wir doch immer wissen, wie wir unsre getreuen Diener unterzubringen haben.« Nach dieser boshaften Eröffnung erging eine Ordonnanz, durch die Herr von Fontaine mit der Verwaltung einer Domäne, die Privateigentum der Krone war, betraut wurde. Infolge der verständnisvollen Aufmerksamkeit, mit der er die Sarkasmen seines königlichen Freundes anhörte, kam sein Name immer Seiner Majestät auf die Zunge, sobald eine Kommission gebildet werden mußte, deren Mitglieder reiche Gehälter empfingen. Er war klug genug, über die Gunst, mit der ihn der Monarch beehrte, Stillschweigen zu bewahren, und verstand es, den König durch seine pikante Erzählungskunst bei den vertraulichen Plaudereien gut zu unterhalten, die Ludwig XVIII. ebenso sehr liebte, wie gefällig abgefaßte Billetts, politische Anekdoten und, wenn man sich dieses Ausdrucks bedienen darf, diplomatische oder parlamentarische Kankans, die damals im Überfluß zirkulierten. Man weiß, daß Details über seine »Regierungsbefähigung«, ein Ausdruck, den der erlauchte Spötter aufgenommen hatte, ihn außerordentlich belästigten. Dank der Klugheit, dem Geist und der Gewandtheit des Grafen von Fontaine konnte jedes Glied seiner zahlreichen Familie, so jung es auch war, sich schließlich, wie er sich gegen seinen Herrn scherzhaft ausdrückte, wie ein Seidenwurm auf die Blätter des Etats setzen. So erhielt durch königliche Gnade sein ältester Sohn eine hervorragende Stellung in der unabsetzbaren Richterschaft. Der zweite, vor der Restauration einfacher Hauptmann, bekam unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Gent das Kommando einer kaiserlichen Legion; dann kam er, anläßlich der Umwälzungen im Jahre 1815, während deren man sich nicht an das Reglement hielt, in die königliche Garde, von da wieder zu den Gardes-du-Corps, wurde dann nochmals zur Linie versetzt und war schließlich, nach der Affäre des Trocadero, Generalleutnant mit einem Kommando bei der Garde. Der Jüngste, zum Unterpräfekten ernannt, wurde bald Generalsteuereinnehmer und Abteilungsdirektor bei der Pariser Stadtverwaltung, wo er vor allen Gefahren gesetzgeberischer Umwälzungen geborgen war. Diese unauffälligen Gnadenbeweise, die ebenso geheim blieben wie die Gunst, in der der Grafstand, ergossen sich, ohne Aufsehen zu erregen, über die Familie. Obgleich der Vater und die drei Söhne nun jeder genügend Sinekuren besaß, um sich des Genusses eines sicheren Einkommens zu erfreuen, das fast so groß war wie das eines Generaldirektors, so erregte ihr Glück, das sie ihrer politischen Stellung verdankten, doch niemandes Neid. In dieser Zeit der ersten konstitutionellen Einrichtungen hatten nur wenige einen richtigen Begriff von den friedlichen Regionen des Budgets, in denen geschickte Günstlinge Ersatz für zerstörte Abteien zu finden verstanden. Der Graf von Fontaine, der sich noch vor kurzem gerühmt hatte, daß er die Verfassung nie gelesen habe, zögerte nicht, seinem erhabenen Herrn zu beweisen, daß er ebensogut wie er den Geist und die Hilfsquellen des »Repräsentativsystems« begriffen habe. Aber trotz der sicheren Karrieren, die sich seinen drei Söhnen eröffnet hatten, trotz der pekuniären Vorteile, die sich aus den vier Stellungen ergaben, stand Herr von Fontaine doch an der Spitze einer zu zahlreichen Familie, als daß er schnell und leicht wieder zu Vermögen hätte kommen können. Seine drei Söhne waren reich an Zukunftshoffnungen, Gunst und Begabung; aber er besaß noch drei Töchter und mußte fürchten, die Güte des Monarchen zu ermüden. Er hatte sich daher vorgenommen, immer nur von einer dieser Jungfrauen mit ihm zu reden, wenn sie die Hochzeitsfackel entzünden wollten. Der König besaß einen zu guten Geschmack, als daß er sein Werk hätte unvollendet lassen wollen. Die Heirat der ältesten mit einem Generaleinnehmer, Planat de Baudry, kam zustande auf Grund eines königlichen Ausspruchs, der nichts kostete und Millionen einbrachte. Eines Abends mußte der Monarch, der schlechter Laune war, lächeln, als er von der Existenz eines zweiten Fräuleins von Fontaine hörte, die er dann mit einem jungen Richter verheiratete, der zwar, es ist wahr, von bürgerlicher Herkunft, aber reich und von großer Begabung war, und den er zum Baron machte. Als aber im nächsten Jahre der Vendéer von Fräulein Emilie von Fontaine sprach, da erwiderte ihm der König mit seiner schwachen rauhen Stimme: »Amicus Plato, sed magis amica Natio.« Dann, einige Tage später, verehrte er seinem »Freunde Fontaine« einen ziemlich harmlosen Vierzeiler, den er ein Epigramm nannte, und in dem er über seine drei Töchter scherzte, die er so gewandt unter der Form einer Trinität vorgebracht hätte. Wenn man der Chronik Glauben schenken darf, so hatte der König mit seinem Bonmot auf die göttliche Dreieinigkeit anspielen wollen.
»Würde sich der König nicht herablassen, sein Epigramm in ein Hochzeitsgedicht umzuwandeln?« sagte der Graf, indem er versuchte, diese Laune zu seinen Gunsten zu lenken.
»Wenn ich auch die Reime dazu fände, so könnte ich doch keinen Sinn hineinbringen«, erwiderte scharf der König, der einen solchen Scherz über sein Dichten, wie milde er auch war, nicht liebte. Von diesem Tage an wurde sein Verkehr mit Herrn von Fontaine weniger freundlich. Die Könige sind widerspruchsvoller, als man gewöhnlich glaubt. Wie fast alle spät geborenen Kinder, war Emilie von Fontaine der von aller Welt verwöhnte Benjamin. Die Kühle des Königs war daher dem Grafen um so schmerzlicher, als niemals eine Heirat schwerer zustande zu bringen war, als die dieser geliebten Tochter. Um alle diese Schwierigkeiten zu verstehen, muß man sich in das Innere des schönen Hauses begeben, in dem der Leiter der Domäne auf Kosten der Zivilliste untergebracht war. Emilie hatte ihre Kindheit auf dem Familiengute verbracht, wo ihr alle Wünsche der frühen Jugend reichlich erfüllt wurden; ihr geringstes Verlangen war für ihre Schwestern, ihre Brüder, für die Mutter und selbst für den Vater Gesetz. Alle ihre Angehörigen waren in sie vernarrt. Als sie ins Alter der Erwachsenen gelangt war, gerade zu der Zeit, da die Familie sich der größten Gunst der Geschicke erfreute, setzte sie ihr vergnügtes Leben fort. Der Pariser Luxus erschien ihr ebenso selbstverständlich, wie der Reichtum an Blumen und Früchten und wie der Überfluß auf dem Lande, der das Glück ihrer ersten Lebensjahre ausgemacht hatte. Ebenso wie sie niemals in ihrer Kinderzeit auf einen Widerspruch gestoßen war, wenn sie ihre Wünsche nach irgendeinem Vergnügen erfüllt sehen wollte, ebenso sah sie, daß sie nur zu befehlen brauchte, als sie sich im Alter von vierzehn Jahren in den Strudel des Gesellschaftstreibens stürzte. Schrittweise an die Genüsse, die der Reichtum gewährt, gewöhnt, wurden ihr ausgesucht feine Toiletten, reich geschmückte Salons und kostbare Equipagen ebenso unentbehrlich, wie wahre oder falsche schmeichelhafte Komplimente und die Feste und das nichtige Getriebe bei Hofe. Wie die meisten verwöhnten Kinder tyrannisierte sie alle, die sie liebten, und sparte ihre Liebenswürdigkeit für die Gleichgültigen auf. Ihre Fehler wurden mit den Jahren nur immer schlimmer, und ihre Angehörigen sollten bald die bitteren Früchte einer so verderblichen Erziehung zu kosten bekommen. Mit neunzehn Jahren hatte Emilie von Fontaine noch keine Wahl unter den zahlreichen jungen Männern treffen wollen, die Herr von Fontaine mit Absichten zu seinen Gesellschaften einlud. Obwohl sie noch jung war, erfreute sie sich in der Gesellschaft aller Freiheit, die einer geistvollen Frau zugestanden wird. Wie die Könige, hatte sie keine Freunde und sah überall um sich nur Dienstfertigkeit, ein Verhalten, dem auch eine bessere Natur als sie wohl nicht hätte widerstehen können. Kein Mann, selbst kein alter Mann, war imstande, den Ansichten eines jungen Mädchens zu widersprechen, von dem ein einziger Blick auch ein kaltes Herz zu entflammen vermochte. Sorgfältiger als ihre Schwestern erzogen, malte sie ziemlich gut, sprach italienisch und englisch und spielte Klavier so gut, daß andere Spieler an sich verzweifelten; endlich besaß ihre von den besten Lehrern ausgebildete Stimme eine Süße, die ihrem Gesang einen unwiderstehlichen Zauber verlieh. Geistvoll und in allen Literaturen zu Hause, hätte sie an den Ausspruch Mascarilles glauben machen können, daß bedeutende Leute schon alles wissen, wenn sie zur Welt kommen. Es wurde ihr leicht, über die italienische oder die niederländische Malerei, über Mittelalter oder Renaissance zu sprechen, sie gab aufs Geratewohl ihr Urteil über alte und neue Bücher ab und wußte in grausamer geistreicher Weise die Fehler eines Werkes deutlich zu kennzeichnen. Ihre einfachsten Aussprüche wurden von einer in sie vernarrten Menge aufgenommen wie ein »Fetfa« des Sultans von den Türken. So blendete sie oberflächliche Leute; tiefere Geister erkannte sie mit angeborenem Takt heraus, und ihnen gegenüber entfaltete sie so viel Liebenswürdigkeit, daß sie durch dieses bezaubernde Wesen sich einer strengeren Prüfung entziehen konnte. Hinter dieser verführerischen Oberfläche verbarg sich ein unempfindliches Herz und die vielen jungen Mädchen gemeinsame Anschauung, daß niemand hoch genug gestellt war, um den Adel ihrer Seele begreifen zu können, dazu noch ein Stolz, der sich ebenso auf ihre Herkunft, wie auf ihre Schönheit stützte. Da ihr jedes heiße Empfinden, das früher oder später in dem Herzen einer Frau Verwüstungen anrichtet, fern lag, kam ihr jugendliches Feuer nur in einer maßlosen Sucht nach Auszeichnung, verbunden mit der tiefsten Verachtung der bürgerlichen Kanaille, zum Ausdruck. Sehr hochfahrend gegenüber dem neuen Adel, machte sie alle Anstrengungen, damit ihre Angehörigen sich auf gleichen Fuß mit den berühmtesten Familien des Faubourg Saint-Germain stellen konnten.
Diese Empfindungen waren dem aufmerksamen Auge des Herrn von Fontaine nicht entgangen, der nach der Verheiratung seiner beiden ältesten Töchter mehr als einmal über die Sarkasmen und Bonmots Emilies seufzte. Logisch Denkende werden erstaunt darüber sein, daß der alte Vendéer seine älteste Tochter einem Generaleinnehmer gegeben hatte, der zwar wohl mehrere frühere adlige Güter besaß, vor dessen Namen sich aber der Partikel nicht befand, dem der Thron so viele Verteidiger verdankte, und seine zweite Tochter einem Beamten, dessen Baronie noch zu jung war, um vergessen zu lassen, daß sein Vater Holzhändler gewesen war. Der bemerkenswerte Umschwung in den Anschauungen des Edelmanns, der eintrat, als er sein sechzigstes Lebensjahr erreichte, ein Alter, in dem die Menschen nur selten ihren alten Standpunkt aufgeben, war nicht nur dem Aufenthalt in dem modernen Babylon, wo alle Provinzler schließlich ihre Herbheit einbüßen, zuzuschreiben; die neue politische Meinung des Grafen von Fontaine war auch das Resultat der Ratschläge und der Freundschaft des Königs. Dieser philosophische Fürst hatte Gefallen daran gefunden, den Vendéer zu den Ideen zu bekehren, die der Fortschritt des neunzehnten Jahrhunderts und die Erneuerung der Monarchie forderten. Ludwig XVIII. wollte Parteien schaffen, wie Napoleon Einrichtungen und Männer geschaffen hatte. Der legitime König, der vielleicht ebenso geistvoll war wie sein Rivale, handelte in entgegengesetztem Sinne. Das letzte Haupt des Hauses Bourbon war ebenso bemüht, dem dritten Stand und den Männern des Kaiserreichs, den Klerus inbegriffen, Genüge zu tun, wie der erste der Napoleons sich beeifert hatte, die Grandseigneurs an sich zu ziehen und die Kirche zu bereichern. Vertraut mit den Gedanken des Königs, war der Staatsrat unmerklich einer der einflußreichsten und klügsten Führer der gemäßigten Partei geworden, die im Namen der nationalen Interessen lebhaft eine Einigung der politischen Ansichten wünschte. Er predigte die kostspieligen Prinzipien einer konstitutionellen Regierung und unterstützte mit aller Kraft das Spiel der politischen Schaukel, die seinem Herrn gestaltete, inmitten der Umtriebe die Regierung Frankreichs fortzuführen. Vielleicht schmeichelte sich auch Herr von Fontaine mit dem Gedanken, bei einem der gesetzgeberischen stürmischen Umschwünge, deren merkwürdige Ergebnisse damals auch die ältesten Politiker überraschten, zur Pairswürde zu gelangen. Einer seiner starrsten Grundsätze besagte, daß er in Frankreich keinen andern Adel anerkennen könne als den der Pairs, deren Familien die einzigen seien, die Privilegien besäßen.
»Ein Adel ohne Privilegien«, pflegte er zu sagen, »ist ein Griff ohne Messer.«
Der Partei Lafayettes ebenso fernstehend wie der Partei La Bourdonnayes, versuchte er eifrig, die allgemeine Versöhnung durchzusetzen, aus der eine neue Ära und eine glänzende Zukunft für Frankreich entstehen sollte. Er bemühte sich, die Familien, die in seinem Hause verkehrten, und die, die er besuchte, davon zu überzeugen, wie wenig günstige Chancen zurzeit die militärische und die Beamtenkarriere böte. Er empfahl den Müttern, ihre Kinder freien und industriellen Berufen zuzuwenden, indem er ihnen zu verstehen gab, daß die hohen Stellungen beim Heer und bei der Verwaltung schließlich doch ganz konstitutionellerweise den jüngeren Söhnen der Adelsfamilien der Pairs vorbehalten bleiben müßten. Nach seiner Ansicht habe die Nation sich einen genügend großen Anteil an der Verwaltung durch die gewählte Volksvertretung erobert und durch ihre Plätze in der Richterschaft und der Finanz, die, wie er meinte, immer, wie früher auch, das Erbteil der hervorragenden Männer des dritten Standes sein würden. Diese neuen Ideen des Familienhauptes der Fontaines und die klugen Eheschließungen seiner beiden älteren Töchter, die deren Resultat waren, hatten starken Widerstand in seinem Hause erfahren. Die Gräfin von Fontaine blieb ihren alten Grundsätzen treu, die eine Frau, die mütterlicherseits zu den Rohans gehörte, auch nicht gut verleugnen konnte. Aber wenn sie sich auch eine kurze Zeit dem Glück und dem Reichtum, der ihren beiden älteren Töchtern winkte, widersetzt hatte, so fügte sie sich doch nach einigen vertraulichen Aussprachen, wie sie Eheleute abends miteinander zu halten pflegen, wenn sie auf demselben Kopfkissen ruhen. Herr von Fontaine bewies seiner Frau mit kühler genauer Rechnung, daß der Aufenthalt in Paris, die Verpflichtung, hier zu repräsentieren, der Glanz ihres Hauses, der sie für die Entbehrungen, die sie so tapfer miteinander hinten in der Vendée ertragen hatten, entschädigen sollte, und die Ausgaben, die sie für ihre Söhne gemacht hatten, den größten Teil ihres festen Einkommens verschlangen. Man mußte also die Gelegenheit, die sich bot, ihre Töchter so reich zu verheiraten, wie eine göttliche Gnade ansehen und ergreifen. Würden sie nicht eines Tages ein Einkommen von sechzig-, achtzig- oder hunderttausend Franken Rente haben? So vorteilhafte Partien boten sich nicht alle Tage für Mädchen ohne Mitgift. Es wäre auch schließlich Zeit, ans Sparen zu denken, um das Gut der Fontaines zu vergrößern und den alten Landbesitz der Familie wiederherzustellen. Die Gräfin fügte sich, wie es alle Mütter an ihrer Stelle und vielleicht mit schnellerem Entgegenkommen, getan hätten, so überzeugenden Gründen; aber sie erklärte, wenigstens müßte ihre Tochter Emilie so verheiratet werden, daß der Stolz, den man unglücklicherweise in dieser jungen Seele mit hatte sich entwickeln helfen, zufriedengestellt werden würde.
So hatten die Ereignisse, die eigentlich Freude in dieser Familie hätten hervorrufen müssen, ihr einen kleinen Keim zur Zwietracht eingepflanzt. Der Generalunternehmer und der junge Richter wurden mit zeremonieller Kühle, die die Gräfin und ihre Tochter Emilie um sich zu verbreiten wußten, aufgenommen. Ihr Aufrechthalten der Etikette fand noch ein weit größeres Betätigungsfeld für ihre häusliche Tyrannei: Der Generalleutnant heiratete Fräulein Mongenod, die Tochter eines reichen Bankiers; der Präsident vermählte sich verständigerweise mit einer Dame, deren Vater, zwei- oder dreifacher Millionär, sein Vermögen im Salzhandel erworben hatte; schließlich bekannte sich auch der dritte Bruder zu solchen bürgerlichen Anschauungen, indem er ein Fräulein Grossetéte, die einzige Tochter des Generalsteuereinnehmers von Bourges, zur Frau nahm. Die drei Schwägerinnen und die beiden Schwäger fanden so viel Reiz und persönliches Interesse daran, sich in der hohen Sphäre der politischen Machthaber und in den Salons der Faubourg Saint-Germain bewegen zu dürfen, daß sie alle vereint einen Hofstaat um die hochmütige Emilie bildeten. Dieser auf Interesse und Stolz gebaute Pakt war aber doch nicht so fest gezimmert, daß die junge Souveränin nicht häufig Revolutionen in ihrem Hof kreise hervorrief. Szenen, die sich allerdings in gemessenen Grenzen hielten, hatten bei allen Gliedern dieser einflußreichen Familie einen mokanten Ton entstehen lassen, der, wenn er auch die öffentlich zur Schau getragenen freundschaftlichen Beziehungen nicht wesentlich beeinträchtigte, doch bisweilen im Familienkreise wenig wohlwollende Gefühle zum Ausdruck kommen ließ. So hielt sich die Frau des Generalleutnants für ebenso vornehm wie eine Kergarouet und behauptete, daß ihre schönen hunderttausend Franken Einkommen ihr das Recht gäben, sich ebenso hochfahrend zu benehmen wie ihre Schwägerin Emilie, der sie zuweilen ironisch ihre Wünsche für eine glückliche Ehe aussprach, wobei sie ihr mitteilte, daß die Tochter irgendeines Pairs soeben einen Herrn, der ganz kurz Soundso hieß, geheiratet habe. Die Frau des Vicomte von Fontaine gefiel sich darin, durch den Geschmack und den Reichtum ihrer Toiletten, ihrer Möbel und ihrer Equipagen Emilie auszustechen. Die spöttische Miene, mit der die Schwägerinnen und die beiden Schwäger manchmal die von Fräulein von Fontaine geltend gemachten Prätentionen aufnahmen, erregte bei ihr einen Zorn, den sie kaum durch einen Hagel von boshaften Bemerkungen beschwichtigen konnte. Als das Haupt der Familie die Abkühlung der verschwiegenen und schwankenden Freundschaft des Monarchen verspürte, war er um so mehr in Sorge, als infolge der spöttischen Herausforderung ihrer Schwester seine geliebte Tochter ihre Ansprüche höher schraubte als jemals.
Während die Dinge so lagen, und zu der Zeit, da dieser häusliche Krieg recht ernst geworden war, verfiel der Monarch, bei dem Herr von Fontaine wieder in Gunst zu kommen hoffte, in eine Krankheit, die ihm den Tod bringen sollte. Der große Politiker, der sein Schiff durch alle Stürme zu steuern verstanden hatte, mußte jetzt unabwendbar unterliegen. In Ungewißheit, auf welche Gunst er in Zukunft würde rechnen können, gab sich der Graf von Fontaine die größte Mühe, seiner jüngsten Tochter die Elite der heiratsfähigen jungen Männer vorzuführen. Wer das schwierige Problem, eine stolze und phantastisch gesinnte Tochter zu verheiraten, zu lösen versucht hat, wird vielleicht verstehen, was für Anstrengungen der arme Vendéer machte. Wäre ihm das nach dem Wunsche seines geliebten Kindes geglückt, so hätte dieser letzte Erfolg den Weg, den der Graf seit zehn Jahren in Paris zurückgelegt hatte, in würdiger Weise abgeschlossen. In der Art, wie seine Familie sich ihre Einkünfte von allen Ministerien erobert hatte, konnte sie sich mit dem Hause Österreich vergleichen, das durch seine Verbindungen ganz Europa an sich zu reißen droht. So ließ sich auch der alte Vendéer nicht abschrecken, immer neue Bewerber vorzustellen, so sehr lag ihm das Glück seiner Tochter am Herzen; aber nichts war amüsanter als die Art und Weise, mit der dieses hochfahrende Wesen ihr Urteil abgab und die Eigenschaften ihrer Anbeter kritisierte. Man hätte meinen sollen, Emilie wäre, wie eine Prinzessin aus arabischen Märchen, so reich und so schön, daß sie das Recht hätte, unter sämtlichen Prinzen der Welt ihre Wahl zu treffen; von ihren Einwänden war einer lächerlicher als der andere: der eine hatte zu dicke Beine oder zu knochige Knien, der andere war kurzsichtig, dieser hätte den Namen Durand, jener hinke, fast alle waren ihr zu dick. Lebhafter, reizender und vergnügter als je, stürzte sie sich, nachdem sie zwei oder drei Bewerber abgewiesen hatte, in den Trubel der Winterfeste und Bälle, wo ihr durchdringender Blick die Tagesberühmtheiten prüfte, und wo sie ein Vergnügen darin fand, Bewerbungen herauszufordern, die sie dann immer zurückwies. Für diese Celimenenrolle war sie von der Natur mit den erforderlichen Vorzügen überreich ausgestattet worden. Groß und schlank, besaß Emilie von Fontaine ein nach ihrem Belieben hoheitsvolles oder mutwilliges Auftreten. Ihr etwas langer Hals erlaubte ihr, eine reizende Haltung voller Hochmut und Rücksichtslosigkeit anzunehmen. Sie hatte die mannigfaltigsten Gesichtsausdrücke und weiblichen Gesten, die so grausam und so gut zu ihren halblauten Worten und ihrem Lächeln paßten, zur Verfügung. Schönes schwarzes Haar und sehr starke, kräftig geschwungene Augenbrauen verliehen ihrer Physiognomie einen stolzen Ausdruck, den sie mit Hilfe ihrer Koketterie und ihres Spiegels durch Festigkeit oder Süße des Blicks, durch Starrheit oder leichte Bewegung der Lippen, durch Kühle oder Liebenswürdigkeit des Lächelns schrecklich zu machen oder zu mildern verstand. Wenn Emilie ein Herz erobern wollte, dann hatte ihre klare Stimme einen melodischen Klang; aber sie konnte sie ebenso scharf und schneidend erklingen lassen, wenn sie die indiskrete Sprache eines Kavaliers zum Schweigen bringen wollte. Ihr weißer Teint und ihre Alabasterstirn erinnerten an die durchsichtige Oberfläche eines Sees, die sich abwechselnd unter dem Hauch einer Brise kräuselt und ihre heitere Ruhe wiedergewinnt, wenn der Luftzug nachgelassen hat. Mehr als einer von den jungen Männern, die von ihr abgelehnt worden waren, hatte sie beschuldigt, daß sie Komödie spiele; aber sie war dadurch gerechtfertigt, daß sie auch denen, die übel über sie redeten, den Wunsch einflößte, ihr zu gefallen und sich ihrer koketten Geringschätzung zu unterwerfen. Keins der jungen Mädchen, um die man sich drängte, verstand es besser, den Gruß eines begabten Mannes hoheitsvoll zu erwidern, oder ihresgleichen mit beleidigender Höflichkeit wie Untergeordnete zu behandeln und ihre Nichtachtung alle die fühlen zu lassen, die sich mit ihr auf gleiche Stufe stellen wollten. Wo sie sich auch befand, überall schien sie mehr Huldigungen entgegenzunehmen als Liebenswürdigkeiten, und selbst im Salon einer Prinzessin hätte ihr Wesen und ihre Haltung, den Stuhl, auf dem sie Platz genommen, in einen Kaiserthron verwandelt.
Zu spät erkannte Herr von Fontaine, wie sehr die Erziehung seiner Lieblingstochter durch die zärtliche Verwöhnung der ganzen Familie verdorben worden war. Die Bewunderung, mit der einem jungen Mädchen zuerst von der Gesellschaft gehuldigt wird, für die sie sich aber später unvermeidlich rächt, hatte den Stolz Emiliens noch erhöht und ihr Selbstbewußtsein noch wachsen lassen. Der allseitige Diensteifer hatte bei ihr den natürlichen Egoismus verwöhnter Kinder entwickelt, die, ähnlich den Königen, sich über alles, was sich ihnen nähert, lustig machen. Jetzt verbargen noch ihre jugendliche Grazie und der Reiz ihres Geistes vor allen Augen diese bei einem weiblichen Wesen um so häßlicheren Fehler, als die Frau ja nur durch Hingebung und Selbstverleugnung wahrhaft gefallen kann; da aber dem Blick eines guten Vaters nichts entgeht, so machte Herr von Fontaine oftmals den Versuch, seiner Tochter die ersten Seiten in dem rätselhaften Buche des Lebens zu erklären. Das war aber ein vergebliches Unternehmen. Allzuoft mußte er über die launenhafte Unbelehrbarkeit und die ironische Weisheit seiner Tochter seufzen, als daß er bei den schwierigen Versuchen, eine so schlimme Naturanlage zu bessern, hätte verharren können. Er begnügte sich damit, ihr von Zeit zu Zeit Ratschläge voller Liebe und Güte zu geben; aber er mußte zu seinem Schmerze erkennen, daß auch seine zärtlichsten Worte von dem Herzen seiner Tochter wie von Marmor abglitten. Väterliche Augen öffnen sich so spät, daß es für den alten Vendéer mehr als eines Beweises bedurfte, bis er merkte, mit welcher Herablassung seine Tochter ihm ihre seltenen Zärtlichkeitsbezeugungen zuteil werden ließ. Sie glich darin den kleinen Kindern, die ihrer Mutter zu sagen scheinen: »Mach schnell mit deinem Küssen, ich will spielen gehen.« Gewiß besaß Emilie auch zärtliches Empfinden für ihre Angehörigen. Aber häufig überkam sie eine plötzliche Laune, wie sie sonst bei jungen Mädchen unerklärlich erscheint; sie blieb dann für sich allein und ließ sich nur selten blicken; sie beklagte sich darüber, daß sie die väterliche und mütterliche Liebe mit Allzuvielen teilen müsse und war auf alle, selbst auf Brüder und Schwestern, eifersüchtig. Und wenn sie dann mit größter Mühe Einsamkeit um sich geschaffen hatte, dann klagte das merkwürdige Mädchen die ganze Welt wegen dieser freiwilligen Vereinsamung und wegen ihres Kummers, den sie sich selbst verursacht hatte, an. Mit der Erfahrung einer Zwanzigjährigen beklagte sie ihr Los, ohne zu begreifen, daß die wahren Bedingungen des Glückes in uns selber liegen, und verlangte, daß die Dinge der äußeren Welt es ihr gewähren sollten. Bis ans Ende der Welt wäre sie geflohen, um solchen Heiraten, wie sie ihre Schwestern gemacht hatten, zu entgehen; aber trotzdem verspürte sie eine abscheuliche Eifersucht in ihrem Herzen, daß sie sie reich und glücklich verheiratet sehen mußte. Und manchmal mußte ihre Mutter, die ebensosehr wie Herr von Fontaine das Opfer ihres Verhaltens war, auf den Gedanken kommen, daß sie eine Spur von Irrsinn in sich trage. Eine solche Verirrung ist nicht unerklärlich: denn nichts ist verbreiteter als dieser heimliche Stolz im Herzen junger Personen, die zu Familien gehören, die auf der sozialen Leiter eine hohe Stufe einnehmen, und von der Natur mit großer Schönheit beschenkt worden sind. Fast alle diese sind davon überzeugt, daß ihre Mütter, wenn sie das vierzigste oder fünfzigste Lebensjahr erreicht haben, mit den jungen Seelen weder mitfühlen noch ihre Träume verstehen können. Sie reden sich ein, daß die meisten Mütter auf ihre Töchter eifersüchtig sind, daß sie sie nach ihrem Geschmack kleiden, mit der ausgesprochenen Absicht, sie beiseite zu schieben und ihnen die für sie bestimmten Huldigungen zu rauben. Daher rühren häufig die heimlichen Tränen und die stumme Auflehnung gegen die angebliche mütterliche Tyrannei. Trotz dieses Kummers, der echt ist, obwohl er auf einer imaginären Grundlage fußt, haben sie noch die Manie, sich einen Lebensplan zurechtzumachen und sich selbst ein glänzendes Horoskop zu stellen; ihre Verirrung besteht darin, daß sie ihre Träume für Wirklichkeit halten, sie nehmen sich heimlich, nach langem Grübeln, vor, Herz und Hand nur einem Manne zu schenken, der die und die vortrefflichen Eigenschaften haben würde; sie malen sich in der Einbildung einen bestimmten Typ aus, dem ihr Zukünftiger wohl oder übel entsprechen müsse. Wenn sie dann die nötige Lebenserfahrung gewonnen und mit den Jahren ernsthafter über den Lauf der Welt und ihren prosaischen Gang nachgedacht haben, dann verblassen die schönen Farben ihres Idealbildes; und später finden sie eines Tages im Verlauf des Lebens zu ihrem Erstaunen, daß sie ein eheliches Glück ohne die Erfüllung ihrer poetischen Träume gefunden haben. Aber Fräulein Emilie von Fontaine hatte auf Grund solcher Poesie sich in ihrer leicht zu erschütternden Weisheit ein Programm zurechtgemacht, dem ihr Zukünftiger entsprechen müsse, wenn sie ihm ihr Jawort geben solle. Daher ihr Hochmut und ihre Spöttereien.
»Jung und von altem Adel,« hatte sie sich gesagt, »muß er auch Pair von Frankreich oder der älteste Sohn eines Pairs sein! Es wäre mir unerträglich, wenn ich nicht an meinem Wagenschlag mein Wappen inmitten der wehenden Falten eines himmelblauen Mantels sehen und nicht beim Rennen von Longchamp durch die große Allee der Champs-Elysées ebenso wie die Prinzen fahren könnte. Mein Vater behauptet ja auch, daß dies eines Tages der höchste Rang in Frankreich sein würde. Außerdem soll er Soldat sein, wobei ich mir vorbehalte, ihn seinen Abschied nehmen zu lassen, und dann will ich, daß er dekoriert ist, damit man vor uns präsentiert.«
Aber diese schon an sich seltenen Eigenschaften würden noch nichts bedeuten, wenn dieses erdachte Wesen nicht auch noch besonders liebenswert, von gutem Aussehen, geistvoll und schlank gewachsen wäre. Die Schlankheit, dieser körperliche Vorzug, so vergänglich er auch, besonders unter der Herrschaft des Repräsentativsystems, war, bildete eine unerläßliche Bedingung. Fräulein von Fontaine hatte sich ein gewisses Idealmaß festgesetzt, das ihr als Modell galt. Der junge Mann, der auf den ersten Blick diesen gestellten Bedingungen nicht entsprach, empfing nicht einmal mehr einen zweiten.
»Mein Gott, sehen Sie doch nur, wie dick dieser Herr ist«, das bedeutete bei ihr den Ausdruck äußerster Verachtung.
Wenn man sie hörte, waren schon die Leute von erträglicher Korpulenz keiner Empfindung fähig, schlechte Ehemänner und nicht würdig, zur zivilisierten Gesellschaft zugelassen zu werden. Obgleich ein im Orient hochgeschätzter Vorzug, erschien ihr Fettleibigkeit bei Damen als ein Unglück; beim Manne aber war es ein Verbrechen. Solche paradoxen Ansichten wirkten bei ihr, dank einer gewissen scherzhaften Form der Fassung, amüsant. Trotzdem hatte der Graf das Gefühl, daß die Prätentionen seiner Tochter, deren Lächerlichkeit manchen ebenso klar sehenden, wie wenig nachsichtigen Damen klar werden mußte, später ein verhängnisvoller Anlaß zur Verspottung werden würde. Er fürchtete, daß die merkwürdigen Ansichten seiner Tochter mit dem guten Ton in Widerspruch geraten könnten. Und er zitterte davor, daß die erbarmungslose Gesellschaft sich vielleicht schon jetzt über eine Person lustig machte, die bereits so lange auf der Szene stand, ohne die Komödie, die sie spielte, zu einem befriedigenden Ende zu bringen. Mancher Mitspieler, ärgerlich über seine Ablehnung, schien nur auf irgendeine Gelegenheit zu warten, um sich zu rächen. Die Gleichgültigen und die Bequemen fingen an, der Sache müde zu werden: Bewunderung hat für das menschliche Geschlecht immer etwas Ermüdendes. Der alte Vendéer wußte besser als jeder andere, daß man mit geschickter Kunst den richtigen Moment wählen muß, um auf der Schaubühne der Welt, des Hofes, des Salons oder des Theaters aufzutreten, daß es aber noch schwerer ist, zur rechten Zeit abzutreten. Daher verdoppelte er in dem Winter, der dem Regierungsantritte Karls X. folgte, im Verein mit seinen drei Söhnen und seinen Schwiegersöhnen seine Anstrengungen, um in den Salons seines Hauses die besten Partien, die sich in Paris und unter den Besuchern aus den Departements boten, zu versammeln. Der Glanz seiner Feste, der Luxus seines Speisesaals und seine mit Trüffeln gewürzten Diners rivalisierten mit den berühmtesten Festtafeln, durch die sich die damaligen Minister die Stimmen ihrer parlamentarischen Anhänger sicherten.
Der ehrenwerte Deputierte wurde daher als einer der einflußreichsten Verderber der parlamentarischen Ehrlichkeit der berühmten Kammer bezeichnet, die an einer Magenverstimmung zu Ende zu gehen schien. Ein merkwürdiger Umstand! Die Versuche, seine Tochter zu verheiraten, erhielten ihn auffallend in Gunst. Vielleicht besaß er insgeheim ein Mittel, um seine Trüffeln zweimal zu verkaufen. Aber diese Anschuldigung von Seiten gewisser liberaler Spötter, die mit ihrem Wortschwall über ihren geringen Anhang in der Kammer hinwegtäuschen wollten, fand keinerlei Anklang. Das Verhalten des poitouer Edelmanns war ein so durchaus vornehmes und ehrenhaftes, daß kein einziger der Angriffe, mit denen die boshaften Zeitungen in dieser Epoche die dreihundert Stimmen des Zentrums, die Minister, die Köche, die Generaldirektoren, die Eßfürsten und die offiziellen Verteidiger des Ministeriums Villèle zu überhäufen pflegten, gegen ihn laut wurde.
Am Ende dieser Kampagne, während der Herr von Fontaine mehrmals alle seine Truppen aufgeboten hatte, glaubte er, daß diesmal die Versammlung von Bewerbern von seiner Tochter nicht mehr wie ein Blendwerk angesehen werden würde. Innerlich empfand er eine gewisse Genugtuung darüber, daß er seine Vaterpflicht getreu erfüllt hatte. Nachdem er solche Mühe aufgewendet hatte, hoffte er, daß sich unter so viel Herzen, wie diesmal der launenhaften Emilie dargeboten würden, wenigstens eines fände, das sie auszeichnen würde. Nicht imstande, diese Anstrengungen noch ein zweitesmal zu machen, und im übrigen durch das Benehmen seiner Tochter erschöpft, beschloß er gegen Ende der Fastenzeit eines Morgens, als die Kammersitzung seine Anwesenheit nicht allzu dringlich erforderte, mit ihr zu reden. Während ein Kammerdiener kunstvoll auf seinem gelben Schädel das Delta aus Puder abgrenzte, das zusammen mit den herabhängenden Taubenflügeln die ehrwürdige Frisur vervollkommnete, befahl Emiliens Vater, nicht ohne eine gewisse Aufregung, seinem alten Kammerdiener, dem stolzen Fräulein zu melden, daß es sofort vor dem Familienhaupte erscheinen möchte.
»Joseph,« sagte er, als seine Frisur beendet war, »nehmen Sie die Serviette fort, ziehen Sie die Vorhänge vor, stellen Sie die Sessel an ihren Platz, schütteln Sie den Kaminteppich aus und legen Sie ihn recht ordentlich wieder hin und machen Sie alles sauber. Vorwärts! Und dann machen Sie das Fenster auf und lassen Sie etwas frische Luft herein.«
Der Graf traf noch verschiedene Anordnungen, die Joseph außer Atem brachten, der, die Absicht seines Herrn verstehend, diesem im ganzen Hause naturgemäß am meisten unordentlichen Zimmer einige Frische verlieh, und dem es schließlich gelang, etwas Harmonie in die Haufen von Rechnungen, Mappen, Bücher und Möbel in diesem Heiligtum zu bringen, wo die Geschäfte der königlichen Domäne abgewickelt wurden. Als Joseph endlich einige Ordnung in dieses Chaos gebracht und, wie in einem Magazin von Neuheiten, die Dinge, die am erfreulichsten anzusehen waren oder durch ihre Farbe dem bureaumäßigen Anstrich einen poetischen Hauch verleihen konnten, in den Vordergrund gerückt hatte, blieb er mitten in dem Labyrinth von Papiermassen, die stellenweise bis auf den Teppich herunter herumlagen, stehen, bewunderte sein Werk, schüttelte den Kopf und verschwand.
Der arme Sinekureninhaber teilte die gute Meinung seines Dieners nicht. Bevor er sich in seinem riesigen Lehnsessel niederließ, warf er einen mißtrauischen Blick um sich, prüfte mit unzufriedener Miene seinen Hausrock, entfernte einige Tabaksspuren von ihm, putzte sich sorgsam die Nase, legte die Schaufeln und Feuerzangen zurecht, schürte das Feuer, zog seine Pantoffeln herauf, nahm seinen kleinen Zopf, der sich quer zwischen die Kragen der Weste und des Hausrocks geschoben hatte, heraus und ließ ihn gerade herabhängen; darauf fegte er die Asche des Kamins zusammen, die dessen hartnäckiges Versagen bezeugte. Dann nahm der alte Herr endlich Platz, nachdem er noch ein letztesmal sich in seinem Zimmer umgesehen hatte, und hoffte, daß nun nichts mehr Anlaß zu den ebenso lustigen wie unbescheidenen Bemerkungen geben könnte, mit denen seine Tochter seine weisen Ratschläge zu beantworten pflegte. Diesmal wollte er seine väterliche Würde nicht beeinträchtigen lassen. Zierlich nahm er eine Prise Tabak und hustete mehrmals, als ob er sich zum Sprechen anschickte, denn er vernahm den leichten Schritt seiner Tochter, die jetzt, eine Melodie aus dem ›Barbier‹ trällernd, hereintrat.
»Guten Morgen, lieber Vater; was wünschen Sie denn so früh von mir?«
Nach diesen Worten, die wie ein Refrain zu ihrem Liede klangen, umarmte sie den Grafen, nicht mit der zärtlichen Vertraulichkeit, die ein so süßer Ausdruck kindlichen Empfindens ist, sondern mit der oberflächlichen Gleichgültigkeit einer Mätresse, die überzeugt ist, daß alles, was sie tut, Freude macht.
»Mein liebes Kind,« sagte Herr von Fontaine würdig, »ich habe dich rufen lassen, um sehr ernsthaft mit dir über dich und deine Zukunft zu reden. Es ist jetzt eine Notwendigkeit geworden, daß du einen Gatten wählst, der dir ein dauerhaftes Glück verheißen kann ...«
»Lieber Vater,« unterbrach ihn Emilie und gab ihrer Stimme den schmeichelndsten Klang, »mir scheint, daß der Waffenstillstand, den wir bezüglich meiner Bewerber geschlossen haben, noch nicht abgelaufen ist.«
»Emilie, wir wollen heute über eine so wichtige Angelegenheit nicht scherzen. Schon seit einer gewissen Zeit vereinigen alle, die dich wirklich liebhaben, ihre Anstrengungen, um dich angemessen zu verheiraten, und es wäre undankbar von dir, über diese Beweise von Interesse, die nicht nur ich an dich verschwende, so leicht hinwegzugehen.«
Nach diesen Worten und nachdem sie ihren spöttisch prüfenden Blick über das Mobiliar des väterlichen Zimmers hatte hinlaufen lassen, nahm das junge Mädchen sich einen Sessel, der noch am wenigsten von Bittstellern abgenutzt erschien, schob ihn an die andere Seite des Kamins, so daß sie ihrem Vater gegenübersitzen konnte, nahm eine scheinbar so ernste Haltung an, daß man darin unmöglich einen Zug von Spott übersehen konnte, und kreuzte ihre Arme über der reichen Garnitur einer Pelerine à la neige, deren viele Tüllrüschen unbarmherzig zerdrückt wurden. Nachdem sie die sorgenvolle Miene ihres alten Vaters betrachtet hatte, lachte sie und brach endlich, ihr Schweigen.
»Ich habe Sie niemals sagen hören, lieber Vater, daß die Regierung ihre Mitteilungen im Hausrock macht. Aber«, fügte sie lächelnd hinzu, »das tut nichts, das Volk darf nicht anspruchsvoll sein. Hören wir also Ihre Gesetzesentwürfe und Ihre offiziellen Vorschläge.«
»Es wird mir nicht immer so leicht sein, dir welche zu machen, du junger Tollkopf! Höre mich an, Emilie. Ich habe nicht länger die Absicht, meine Stellung aufs Spiel zu setzen, auf der zum Teil das Vermögen meiner Kinder beruht, indem ich dieses Regiment von Tänzern zusammenbringe, die du dann in jedem Frühjahr laufen läßt. Du bist schon, ohne es zu wissen, der Anlaß zu vielen gefährlichen Feindschaften mit gewissen Familien gewesen. Ich hoffe, daß du heute die Schwierigkeiten deiner und unserer Lage begreifen wirst. Du bist zweiundzwanzig Jahr alt, mein Kind, und seit beinahe drei Jahren hättest du schon verheiratet sein müssen. Deine Brüder und deine beiden Schwestern sind reich und glücklich versorgt. Aber die Ausgaben, mein Kind, die uns diese Heiraten verursacht haben, und die Art, wie du deine Mutter unser Haus zu führen veranlassest, haben unsere Einkünfte dermaßen aufgezehrt, daß ich dir kaum eine Mitgift von hunderttausend Franken geben kann. Von heute ab muß ich an die Zukunft deiner Mutter denken, die für meine Kinder nicht geopfert werden darf. Wenn ich einmal meiner Familie fehlen werde, dann soll Frau von Fontaine nicht von andern Leuten abhängig sein, sondern auch weiterhin die Behaglichkeit genießen können, mit der ich spät genug ihre Aufopferung in meinen unglücklichen Zeiten habe belohnen können. Du siehst, mein Kind, daß deine unbedeutende Mitgift in keinem Verhältnis zu deinen großen Ansprüchen steht. Und auch dies ist noch ein Opfer, das ich für kein anderes meiner Kinder gebracht habe; sie haben großmütig darauf verzichtet, dereinst einen Ausgleich für diese Bevorzugung eines allzu geliebten Kindes zu verlangen.«
»Bei ihren Verhältnissen!« sagte Emilie und schüttelte den Kopf.
»Meine liebe Tochter, du darfst diejenigen, die dich liebhaben, niemals so herabsetzen. Du mußt wissen, daß nur die Armen großmütig sind! Die Reichen haben stets ausgezeichnete Gründe, warum sie nicht auf zwanzigtausend Franken zugunsten eines Verwandten verzichten wollen. Also schmolle nicht, mein Kind, und laß uns ernsthaft miteinander reden. Ist dir unter den jungen Heiratskandidaten nicht Herr von Manerville aufgefallen?«
»Oh ja, er sagt ßön, statt schön, betrachtet immer seine Füße, weil er sie für klein hält und bewundert sich im Spiegel! Außerdem ist er blond, ich liebe die Blonden nicht.«
»Nun, und Herr von Beaudenord?«
»Der ist nicht von Adel. Außerdem ist er schlecht gewachsen und dick. Er ist allerdings brünett. Die beiden Herren müßten ihr Geld zusammentun, und dann sollte der eine seinen Körper und seinen Namen dem andern geben, der aber sein Haar behalten müßte; dann ... vielleicht ...«
»Und was hast du gegen Herrn von Rastignac einzuwenden?«
»Frau von Nucingen hat einen Bankier aus ihm gemacht«, sagte sie boshaft.
»Und der Vicomte von Portenduère, unser Verwandter?«
»Ein Kind, ein schlechter Tänzer, außerdem hat er kein Vermögen. Alle diese Leute, lieber Vater, haben auch keinen Rang. Zum wenigsten will ich doch Gräfin werden, wie meine Mutter.«
»Du hast also in diesem Winter niemanden gefunden, der ...«
»Nein, lieber Vater.«
»Was für einen wünschest du also?«
»Den Sohn eines Pairs von Frankreich.«
»Du bist ja toll!« sagte Herr von Fontaine und erhob sich.
Er erhob die Augen zum Himmel und schien aus frommen Gedanken ein neues Quantum von Ergebung zu schöpfen; dann warf er einen Blick voll väterlichen Mitleids auf seine Tochter, die bewegt wurde, nahm ihre Hand, drückte sie und sagte zärtlich zu ihr: »Gott ist mein Zeuge, du armes, betörtes Geschöpf, daß ich meine väterlichen Pflichten gegen dich gewissenhaft erfüllt habe; was sage ich, gewissenhaft? Voller Liebe, Emilie. Ja, Gott weiß es, ich habe in diesem Winter dir mehr als einen ehrenhaften Mann zugeführt, dessen Fähigkeiten, Sitten und Charakter mir bekannt waren, und alle waren nach meiner Ansicht deiner würdig. Meine Aufgabe ist erfüllt, mein Kind. Von heute ab bist du selbst Herrin deines Geschicks, und ich fühle mich glücklich und unglücklich zugleich, daß ich der schwersten väterlichen Pflicht enthoben bin. Ich weiß nicht, ob du noch lange meine Stimme hören wirst, die unglücklicherweise niemals streng war; denke aber daran, daß das eheliche Glück nicht so sehr auf glänzenden Eigenschaften und auf Reichtum beruht, wie auf gegenseitiger Achtung. Solch ein Glück ist, seinem Wesen entsprechend, bescheiden und ohne äußeren Glanz. Geh, mein Kind; wen du mir als Schwiegersohn bringst, der soll meine Zustimmung haben; solltest du aber unglücklich werden, dann bedenke, daß du nicht das Recht hast, deinem Vater Vorwürfe zu machen. Ich werde mich nicht weigern, Schritte für dich zu tun und dir zu helfen; nur muß deine Wahl ernsthaft und endgültig sein: ich werde nicht zum zweitenmal die Achtung, die man meinen weißen Haaren schuldig ist, aufs Spiel setzen.«
Der Ausdruck warmer Zuneigung, der sich in der Ansprache ihres Vaters äußerte und ihr feierlicher Ton gingen Fräulein von Fontaine ans Herz; aber sie ließ ihre Rührung nicht gewahr werden, setzte sich dem Grafen, der sich, noch zitternd, wieder niedergelassen hatte, auf die Knie, überhäufte ihn mit Zärtlichkeiten und schmeichelte ihm so reizend, daß sich die Stirn des alten Herrn entwölkte. Als Emilie annahm, daß die peinliche Erregung ihres Vaters sich wieder beruhigt hatte, sagte sie leise zu ihm:
»Ich danke Ihnen herzlich, lieber Vater, für Ihre liebenswürdige Aufmerksamkeit. Sie haben Ihr Zimmer aufgeräumt, weil Sie Ihre Tochter empfangen wollten. Sie haben nicht gedacht, daß sie so töricht und so widerspenstig sein würde. Aber ist es denn, lieber Vater, so sehr schwierig, einen Pair von Frankreich zu heiraten? Sie haben doch selbst behauptet, daß solche zu Dutzenden ernannt würden. Ach, Ihren Rat werden Sie mir doch nicht vorenthalten.« »Nein, mein armes Kind, nein, und ich werde dir mehr als einmal zurufen: Hüte dich! Bedenke doch, daß die Pairie ein noch zu neues Hilfsmittel für unsere Regierungsfähigkeit ist, wie der hochselige König zu sagen pflegte, als daß die Pairs schon ein großes Vermögen besitzen könnten. Und die, die reich sind, wollen noch reicher werden. Der reichste unter allen unsern Pairs hat noch nicht die Hälfte des Einkommens, das der ärmste Lord des englischen Oberhauses besitzt. Deshalb werden alle Pairs von Frankreich nach reichen Erbinnen für ihre Söhne suchen, gleichgültig, wo sie zu finden sind. Diese Notwendigkeit, reiche Heiraten zu machen, wird mehr als zweihundert Jahre andauern. Es ist möglich, daß, wenn du auf den glücklichen Zufall, mit dem du rechnest, wartest, was dich aber deine besten Jahre kosten kann, deine Reize (man heiratet in unserm Jahrhundert ja hauptsächlich aus Liebe!), deine Reize ein Wunder zustande bringen können. Wenn sich hinter einem so frischen Gesicht wie dem deinigen auch noch Weltkenntnis verbirgt, kann man ja auf ein Wunder hoffen. Besitzest du nicht zunächst schon die Fähigkeit, an dem größeren oder geringeren Körperumfang die inneren Vorzüge zu erkennen? Das ist kein geringes Talent. Ich brauche daher einer so klugen Person wie dir nicht alle Schwierigkeit eines solchen Versuches vorzuhalten. Ich bin überzeugt, daß du niemals bei einem Unbekannten Klugheit vermuten wirst, weil er ein hübsches Gesicht, oder moralische Vorzüge, weil er eine gute Haltung hat. Und schließlich bin ich ganz deiner Meinung, daß die Söhne von Pairs die Verpflichtung haben, ein eigenes Wesen und sich besonders auszeichnende Manieren zu besitzen. Obgleich man heutzutage niemandem seinen hohen Rang anmerken kann, werden diese jungen Männer für dich vielleicht ein gewisses Etwas haben, woran du sie erkennst. Übrigens hältst du ja dein Herz am Zügel wie ein guter Reiter, der sicher ist, daß sein Pferd nicht stolpern wird. Also viel Glück, meine liebe Tochter!«
»Sie machen sich über mich lustig, lieber Vater. Aber ich erkläre Ihnen, daß ich mich lieber im Kloster des Fräuleins von Condé begraben will, als daß ich darauf verzichte, die Frau eines Pairs von Frankreich zu werden.«
Sie entzog sich den Armen ihres Vaters, und stolz darauf, daß sie Siegerin geblieben war, sang sie beim Fortgehen die Arie »Cara non dubitare« aus der »Heimlichen Ehe«. Zufällig feierte die Familie an diesem Tage den Geburtstag eines Mitgliedes. Beim Nachtisch sprach Frau Planat, die Frau des Generaleinnehmers, die ältere Schwester Emilies, ziemlich laut von einem jungen Amerikaner, dem Besitzer eines ungeheuren Vermögens, der sich leidenschaftlich in ihre Schwester verliebt und ihr ganz besonders glänzende Anerbietungen gemacht hatte.
»Ich glaube, das ist ein Bankier«, warf Emilie hin. »Ich liebe die Finanzleute nicht.«
»Aber Emilie,« sagte der Baron von Villaine, der Mann ihrer zweiten Schwester, »da du den Richterstand ebensowenig liebst, so sehe ich nicht, wenn reiche Leute, die nicht von Adel sind, nicht in Betracht kommen, aus welchen Kreisen du dir einen Mann wählen willst.« »Zumal, Emilie, bei deinem Bestehen auf Schlankheit«, fügte der Generalleutnant hinzu.
»Ich weiß selber, was ich will«, erwiderte das junge Mädchen.
»Meine Schwester verlangt einen schönen Namen, einen schönen jungen Mann, schöne Zukunftsaussichten«, sagte die Baronin von Fontaine, »und hunderttausend Franken Rente, kurz einen Mann, wie zum Beispiel Herrn von Marsay.«
»Ich weiß nur so viel, meine Liebe,« versetzte Emilie, »daß ich keine so törichte Partie machen werde, wie ich solche so viele habe machen sehen. Und im übrigen erkläre ich, um diesen Heiratsdiskussionen ein Ende zu machen, daß ich jeden, der mir noch vom Heiraten redet, als Störer meiner Ruhe ansehen werde.«
Ein Onkel Emilies, ein Vizeadmiral, dessen Vermögen sich kürzlich infolge des Indemnitätsgesetzes um zwanzigtausend Franken Rente vergrößert hatte, ein siebzigjähriger Greis, der sich herausnehmen durfte, seiner Großnichte, in die er vernarrt war, deutlich die Wahrheit zu sagen, erklärte, um der Diskussion ihre Schärfe zu nehmen: »Laßt doch meine arme Emilie in Ruhe! Seht ihr denn nicht, daß sie wartet, bis der Herzog von Bordeaux majorenn ist?«
»Nehmen Sie sich in acht, daß ich Sie nicht heirate, Sie alter Narr!« entgegnete das junge Mädchen, dessen letzte Worte glücklicherweise im allgemeinen Gelächter verlorengingen.
»Kinder,« sagte Frau von Fontaine, um diese unbescheidene Bemerkung zu beschönigen, »Emilie wird ebensowenig, wie ihr alle, sich von ihrer Mutter beraten lassen.«
»Nein, wahrhaftig, in einer Sache, die nur mich angeht, werde ich auch nur auf mich hören«, sagte Fräulein von Fontaine sehr bestimmt.
Alle Blicke richteten sich jetzt auf das Haupt der Familie. Jeder schien begierig zu sein, zu sehen, wie er sich unter Wahrung seiner Würde dazu stellen würde. Der verehrungswürdige Vendéer genoß nicht bloß in der Gesellschaft großes Ansehen; glücklicher als viele andere Väter, wurde er auch von seiner Familie verehrt, deren sämtliche Mitglieder seine bewährte Fähigkeit, für die Seinigen zu sorgen, anerkannten; ihm wurde daher die respektvolle Achtung entgegengebracht, die englische Familien und einige aristokratische Häuser des Kontinents dem Repräsentanten ihres Stammbaums zu bezeugen pflegen. Es entstand ein tiefes Schweigen, und die Augen der Tischgenossen waren abwechselnd auf das schmollende, hochmütige Gesicht des verwöhnten Kindes und auf Herrn und Frau von Fontaines ernste Mienen gerichtet.
»Ich habe es meiner Tochter Emilie überlassen, über ihr Schicksal selber zu entscheiden«, war die Antwort, die der Graf in trübem Tone fallen ließ.
Die Verwandten und die Gäste betrachteten Fräulein von Fontaine mit einem Gemisch von Neugier und Mitleid. Dieses Wort schien anzukündigen, daß die väterliche Güte müde geworden war, gegen einen Charakter anzukämpfen, den die Familie als unverbesserlich kannte. Die Schwiegersöhne sprachen leise miteinander, und die Brüder warfen ihren Frauen ein spöttisches Lächeln zu. Ihr alter Onkel war der einzige, der, als alter Seemann, es wagte, mit ihr eine Breitseite zu wechseln und ihre Launen zu ertragen, ohne daß er jemals darum verlegen war, ihr Feuer zu erwidern.
Sarrasine (1830)
Es ging mir, wie es vielen, selbst oberflächlichen Menschen, geht, wenn sie lärmenden Festen beiwohnen: ich war in tiefes Träumen versunken. Von der Turmuhr des Élysée-Bourbon schlug es eben Mitternacht. Ich saß in einer Fensternische, die schweren Falten eines Moirévorhangs verbargen mich völlig, und ich konnte so ungestört in den Garten des Palastes hinunterblicken, in dem ich den Abend verbrachte. Die Bäume, auf denen spärlicher Schnee lag, hoben sich undeutlich von dem grauen Hintergrunde des Wolkenhimmels ab, der nur schwach vom Mond erhellt wurde. Vor diesen phantastischen Wolkengebilden sahen sie etwa aus wie Gespenster, die nicht recht von ihrem Laken bedeckt wären, und erinnerten an den grauenhaften Eindruck des berühmten Totentanzes. Und wenn ich mich dann umwandte, konnte ich den Tanz der Lebenden erblicken. In einem strahlenden Saal, dessen Wände von Silber und Gold blitzten, beim Schimmer der Kronleuchter, die unzählige Kerzen trugen, schwebten und flogen in buntem Gewimmel die schönsten, die reichsten, die vornehmsten Damen von Paris in all ihrem glänzenden Staat und ihrer Diamantenpracht. Und Blumen überall: auf dem Kopf, im Haar, an der Brust, an den Gewändern oder in Kränzen zu ihren Füßen. Das leichte Beben, das durch die Körper ging, die weichen, wollüstigen Schritte brachten die Spitzen, die Blenden, die Gaze und Seide, die ihre schlanken Leiber verhüllten, in tanzende Bewegung. Hier und da funkelte ein blitzendes Auge auf, verdunkelte die Lichter und das Feuer der Diamanten und brachte einen Sturm über Herzen, die schon allzusehr entflammt waren. Man konnte auch beobachten, wie die Liebhaber leise Zeichen der Ermunterung erhielten, während die Ehemänner abweisender Kälte begegneten. Rufe von Spielern bei einer unerwarteten Karte, das Rollen von Gold, die Musik, das Summen der Gespräche, all das erscholl dem Ohr in wirrem Gedränge; und um den verführerischen Zauber, den dieses tolle Fest auf die Gesellschaft übte, voll zu machen, wirkten noch der Dunst der Wohlgerüche und die allgemeine Trunkenheit auf die aufgepeitschten Sinne. So hatte ich zur Rechten das düstere, schweigende Bild des Todes, zur Linken die von der Sitte gebändigten Bacchanalien des Lebens: hier die kalte, düstere, von Trauer umschleierte Natur, dort die Lust der Menschen. Ich hielt mich auf der Grenze dieser beiden so verschiedenen Gemälde, die sich in den mannigfaltigsten Gestalten in Paris unzählige Male wiederholen und unsere Stadt zur amüsantesten und zugleich zur philosophischsten der Welt machen, und stellte ein seltsames Quodlibet von Ausgelassenheit und Todesstimmung vor. Mit dem linken Fuß folgte ich dem Takt der Musik, und den rechten meinte ich in einem Sarg zu haben. Es ging mir in der Tat, wie es auf Bällen häufig vorkommt: mein Bein war von der Zugluft, die einem die Hälfte des Körpers fast starr macht, während die andere Hälfte der drückenden Hitze der Säle ausgesetzt ist, wie zu Eis geworden. »Herr von Lauty besitzt dieses Haus noch nicht lange?« »O doch. Es sind zehn Jahre her, daß es ihm der Marschall von Garigliano verkauft hat.« »Ah!« »Diese Leute müssen ein ungeheures Vermögen besitzen.« »Das muß wohl so sein.« »Was für ein Fest! Ein wahrhaft unverschämter Luxus.« »Halten Sie sie für ebenso reich wie Herrn von Nucingen oder Herrn von Gondreville?« »Aber wissen Sie denn nicht...?«
Ich bog den Kopf vor und erkannte die beiden Sprecher als Angehörige der Klasse der Neugierigen, die sich in Paris mit nichts anderm beschäftigt als dem Warum? Wieso? Woher kommt er? Wer sind sie? Was gibts Neues? Was hat sie angestellt? Sie fingen an leise zu sprechen und entfernten sich, wahrscheinlich um auf einem stillen Sofa ungestörter plaudern zu können. Niemals hatte sich für Leute, die hinter Geheimnissen her sind, eine ergiebigere Ader eröffnet. Kein Mensch hatte eine Ahnung, aus welchem Lande die Familie Lauty gekommen war oder aus welchem Handel, aus welcher Plünderung, aus welchem Raubzug oder welcher Erbschaft ihr Vermögen stammte, das auf mehrere Millionen geschätzt wurde. Alle Angehörigen dieser Familie sprachen Italienisch, Französisch, Spanisch, Englisch und Deutsch so geläufig, daß man annehmen mußte, sie hätten sich ziemlich lange in all diesen Ländern aufgehalten. Waren es Zigeuner oder Seeräuber?
»Und wenn es der Teufel wäre,« sagten junge Politiker, »ihr Fest ist wundervoll!«
»Und wenn der Graf von Lauty einen marokkanischen Palast geplündert hätte, seine Tochter nähme ich doch zur Frau!« rief ein Philosoph.