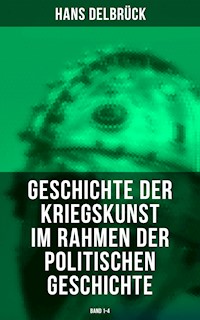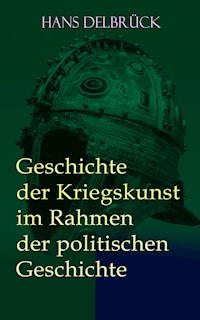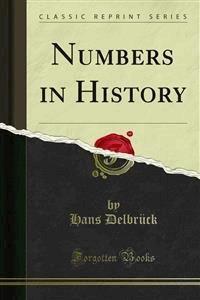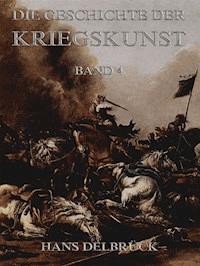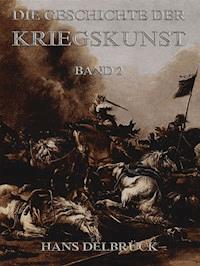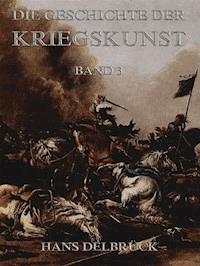
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Die Geschichte der Kriegskunst" von Hans Delbrück (4 Bände) gehört zu den umfassendsten und besten Werke zur Militärgeschichte und Kriegskunst. Sehr detailliert und verständlich werden die Geheimnisse der Kriegsführung durch viele Jahrhunderte aufgearbeitet. Inhalt: Karl der Große und seine Nachkommen. Karl der Große. Die Unterwerfung der Sachsen. Das Karolingerreich, die Normannen und die Ungarn. Der vollendete Feudalstaat. Die Staatenbildung auf den Trümmern des Karolingerreichs. Die Schlacht auf dem Lechfelde. 10. August 955. Schlachten unter Kaiser Heinrich IV. Die Unterwerfung der Angelsachsen durch die Normannen. Die normannische Kriegsverfassung in England. Der Normannenstaat in Italien. Byzanz. Die Araber. Allgemeine Ansicht der Kreuzzüge. Das hohe Mittelalter. Das Rittertum als Stand. Das Rittertum militärisch. Söldner. Strategie. Die italienischen Kommunen und die Hohenstaufen. Die deutschen Städte. Die Eroberung Preußens durch den Deutschen Orden. Das englische Bogenschießen. Die Eroberung von Wales und Schottland durch Eduard I. Einzelne Feldzüge, Schlachten und Gefechte. Das späte Mittelalter. Vorwort. Phalangen-Schlachten. Bürgerwehren und Landsturm-Aufgebote. Abgesessene Ritter und Schützen. Die Osmanen. Die Hussiten. Condottieri, Ordonnanz-Kompagnien und Freischützen. Die Schlachten bei Tannenberg und Montl'héry und einige andere Gefechte der Periode. Die Schweizer. Einleitung. Die Schlacht am Morgarten. 15. November 1315. Schlacht bei Laupen. 21. Juni 1339. Die Schlacht bei Sempach. 9. Juli 1386. Die Schlacht bei Döffingen. 23. August 1388. Eidgenössische Kriegsverfassung564. Die Burgunderkriege.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1172
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geschichte der Kriegskunst - 3. Teil. Das Mittelalter
Hans Delbrück
Inhalt:
Hans Delbrück – Biografie und Bibliografie
Geschichte der Kriegskunst - 3. Teil. Das Mittelalter
Erstes Buch. Karl der Große und seine Nachkommen.
Karl der Große.
Die Scara und die Domänenhöfe.
Der Treu-Eid.
Bewaffnung und Taktik.
Die karolingischen Wehrpflichts-Capitularien.
Strafvorschriften.
Dispensationen.
Das Aufgebot.
Ausrüstung.
Die italienischen Capitularien.
Scara.
Die Unterwerfung der Sachsen.
Das Karolingerreich, die Normannen und die Ungarn.
Die Belagerung von Paris.
Zweites Buch. Der vollendete Feudalstaat.
Die Staatenbildung auf den Trümmern des Karolingerreichs.
Das feudale Kriegsaufgebot.
Bauern-Kriegsdienst.
Die Reformen Heinrichs I.
Die Schlacht auf dem Lechfelde. 10. August 955.
Zur Kritik der Quellen.
Frühere Ungarnschlacht.
Schlachten unter Kaiser Heinrich IV.
Der Krieg zwischen Heinrich IV. und dem Gegenkönig Rudolf.
Die Unterwerfung der Angelsachsen durch die Normannen.
Literatur und Kritik.
Angelsachsen und Engländer.
Hundertschaft bei den Angelsachsen.
Gesiths und Thegns.
Die Fünf-Hufen-Regel.
Die normannische Kriegsverfassung in England.
Assisa de Armis habendis in Anglia.
Writ for the levying of a force.1205.
Assize of arms. 1252.
Statut von Winchester.
Literatur und Zahlen-Berechnungen.
Der Normannenstaat in Italien.
Byzanz.
Schlacht bei Manzikert. 1071.
Die byzantinische Militär-Literatur.
Die Araber179.
Allgemeine Ansicht der Kreuzzüge.
Drittes Buch. Das hohe Mittelalter.
Das Rittertum als Stand.
Schwertleite und Ritterschlag.
Die Nordgermanen.
Das Rittertum militärisch.
Roßkampf und Fußkampf der Deutschen.
Ritter und Knechte.
Söldner.
Einige Geld- und Sold-Sätze.
Strategie.
Die italienischen Kommunen und die Hohenstaufen.
Die deutschen Städte.
Die Eroberung Preußens durch den Deutschen Orden.
Das englische Bogenschießen. Die Eroberung von Wales und Schottland durch Eduard I.
Einzelne Feldzüge, Schlachten und Gefechte.
Die Schlacht bei Tinchebrai. 28. September 1106.
Schlacht von Brémule. 20. August 1119.
Gefecht bei Bourgthéroulde. 26. März 1124.
Die Standarten-Schlacht bei Northallerton. 22. August 1138.
Schlacht bei Lincoln. 2. Februar 1141.
Die Schlachten und Gefechte des ersten Kreuzzuges.
Schlacht bei Doryläum. 1 Juli 1097.
Schlacht am See von Antiochien. 9. Februar 1098.
Gefecht am Brückentor von Antiochien. Anfang März 1098.
Entscheidungsschlacht vor Antiochien. 8. Juni 1098.
Schlacht bei Askalon. 12. August 1099.
Treffen bei Ramla. 7. September 1101.
Treffen bei Ramla. Mai 1102.
Treffen bei Ramla. 27. August 1105.
Schlacht bei Sarmin. 14. September 1115.
Schlacht bei Atharib (Belath). 28. Juni 1119.
Schlacht bei Hab. 13. August 1119.
Schlacht bei Hazarth 1125.
Schlacht bei Merdy-Sefer 1126.
Die Schlacht bei Hittin. 4. Juli 1187.
Die Schlacht bei Accon. 4. Oktober 1189.
Die Schlacht bei Arsuf. 7. September 1191.
Treffen bei Jaffa. 5. August 1192.
Das Fußvolk in den Kreuzzügen.
Die Schlacht bei Muret. 12. September 1213.
Treffen von Steppes. 13. Oktober 1213.
Die Schlacht bei Bouvines. 7. Juli 1214.
Schlacht bei Bornhöved. 22. Juli 1227.
Schlacht bei Monteaparti. 4. September 1260.
Schlacht bei Lewes. 14. Mai 1264.
Schlacht bei Worringen. 5. Juni 1288.
Schlacht bei Certomondo. 11 Juni 1289.
Die Schlacht auf dem Marchfelde. 26. August 1278.
Treffen bei Conway. Januar 1295.
Schlacht bei Göllheim. 2. Juli 1298.
Viertes Buch. Das späte Mittelalter.
Vorwort.
Phalangen-Schlachten.
Bürgerwehren und Landsturm-Aufgebote.
Die Schlacht bei Courtray. 11. Juli 1302.
Schlacht bei Bannockburn. 24. Juni 1314.
Die Schlacht bei Rosebeke. 27. November 1382.
Bürgerwehren und Landsturm-Aufgebote.
Das Treffen bei Reutlingen. 4. Mai 1377.
Abgesessene Ritter und Schützen.
Schlacht bei Crecy451. 26. August 1346.
Schlacht bei Maupertuis. 19. September 1356.
Schlacht bei Azincourt. 25. Oktober 1415.
Ergebnis.
Die Osmanen.
Schlacht bei Nikopolis472. 25. September 1396.
Die Hussiten.
Condottieri, Ordonnanz-Kompagnien und Freischützen.
Die Schlachten bei Tannenberg und Montl'héry und einige andere Gefechte der Periode.
Schlacht bei Tannenberg. 15. Juli 1410.
Monstrelet über Tannenberg.
Die Schlacht bei Montl'héry nach Commines529. 13. Juli 1465.
Schlacht bei Mons-en-Pevèle. 18. Aug. 1304.
Schlacht bei Mühldorf. 28. Sept. 1322.
Schlacht bei Baesweiler. 20. Aug. 1371.
Gefecht bei Nogent sur Seine. 23. Juni 1359.
Schlacht bei Barnet. 14. April 1471.
Schlacht bei Tewksbury. 4. Mai 1471.
Die Schlacht bei Bosworth.
Fünftes Buch. Die Schweizer.
Einleitung.
Die Schlacht am Morgarten. 15. November 1315.
Schlacht bei Laupen. 21. Juni 1339.
Die Schlacht bei Sempach. 9. Juli 1386.
Die Winkelried-Sage.
Die Schlacht bei Döffingen. 23. August 1388.
Eidgenössische Kriegsverfassung564.
Das Reislaufen.
Im Nürnberger Dienst.
Schlacht bei Seckenheim. 30. Juni 1462.
Die Burgunderkriege.
Ursprung.
Literatur.
Treffen bei Héricourt. 13. November 1474.
Schlacht bei Granson. 2. März 1476.
Die Schlacht bei Murten. 22. Juni 1476.
Literatur und Kritik.
Schlacht bei Nancy.613 5. Januar 1477.
Militärische Theorie im Mittelalter.
Theorie.
Anhang über das Werk des Generals Köhler.
Abschluß.
Fußnoten.
Geschichte der Kriegskunst, Band 3, Hans Delbrück
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849609399
www.jazzybee-verlag.de
Hans Delbrück – Biografie und Bibliografie
Deutscher Historiker, geb. 11. Nov. 1848 in Bergen (Insel Rügen), verstorben am 14. Juli 1929 in Berlin. Studierte Geschichte in Heidelberg, Greifswald und Bonn und wurde, nachdem er den Feldzug von 1870 mitgemacht hatte, 1874 Erzieher des Prinzen Waldemar von Preußen, dritten Sohns des damaligen Kronprinzen, in welcher Stellung er bis zum Tode des Prinzen (27. März 1879) verblieb. 1881 habilitierte er sich in Berlin, wurde 1885 außerordentlicher und 1896 ordentlicher Professor. 1882–1885 gehörte er dem Abgeordnetenhaus, 1884–90 dem Reichstag an, wo er sich der Reichspartei anschloss. Seine bekanntesten Schriften sind: »Leben des Feldmarschalls Grafen Neithardt von Gneisenau« (Berl. 1880, Bd. 4 u. 5 des von G. I. Pertz unvollendet hinterlassenen Werkes); eine kürzere selbständige Biographie unter gleichem Titel (das. 1882, 2 Bde.; 2. Aufl. 1894); »Die Perserkriege und die Burgunderkriege« (das. 1886); »Historische und politische Aufsätze« (das. 1887) und als deren Fortsetzung »Erinnerungen, Aufsätze und Reden« (das. 1903); »Die Strategie des Perikles, erläutert durch die Strategie Friedrichs des Großen« (das. 1890); »Friedrich, Napoleon, Moltke, ältere und neuere Strategie« (das. 1892); »Die Polenfrage« (das. 1894); »Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte« (das. 1900–1902, 2 Bde.). 1882–83 gab D. mit G. zu Putlitz die »Politische Wochenschrift« heraus, trat aber 1883 in die Redaktion der »Preußischen Jahrbücher« ein, die er seit 1889 allein führt. 1885–1893 gab D. auch den von Schultheß 1860 begründeten »Europäischen Geschichtskalender« heraus. Mit Adolf Harnack veröffentlichte er die Broschüre »Evangelisch-sozial« (Berl. 1896).
Geschichte der Kriegskunst - 3. Teil. Das Mittelalter
Erstes Buch. Karl der Große und seine Nachkommen.
Erstes Kapitel.
Karl der Große.
Als Kriegerstand hatten sich einst die Germanen in die Provinzen des römischen Weltreichs eingelagert, sie endlich wie eine dünne Schicht, so zu sagen als neue Haut unter ungeheuren Zerstörungen und Schmerzen ganz überzogen und dadurch neue römisch-germanische Staatswesen begründet.
Im fränkischen Reich war in der mit der Gutsleihe verbundenen Vasallität, dem Lehnssystem, die Form gefunden worden, den Kriegerstand dauernd brauchbar zu erhalten, und das karolingische Geschlecht hatte mit dieser Kriegsmannschaft den Staat vor den Muslim gerettet und darauf in einer Arbeit von Generationen neu aufgebaut.
Diese Krieger waren ganz vorwiegend beritten und hatten ihre Verpflegung mitzubringen. Die Ausrüstung auch nur eines einzigen solchen Kriegers ist daher eine sehr schwere Last. In einem der altfränkischen Volksrechte1 ist uns der Wert von Waffen und Vieh im einzelnen angegeben; wenn wir diese Zahlen kombinieren und danach den Wert einer Kriegerrüstung in Kühen ausdrücken, so ergibt sich folgende Liste2:
Der Helm 6 Kühe
die Brünne 12 Kühe
das Schwert mit Scheide 7 Kühe
Die Beinschienen 6 Kühe
Lanze mit Schild 2 Kühe
das Streitroß 12 Kühe
Allein die Ausrüstung eines einzigen Kriegers hatte also den Wert von 45 Kühen oder, da drei Kühe gleich einer Stute gerechnet wurden, 15 Stuten, dem Großvieh eines ganzen Dorfes.
Hierzu kam die Verpflegung, der Karren mit dem Zugtier oder das Saumtier, das sie fortschaffte, und der Knecht zu diesem Tier.
Der fränkische Krieger, der von der Loire gegen die Sachsen ins Feld zog, oder vom Main an die Pyrenäen, ist also etwas ganz anderes, als der Krieger der germanischen Urzeit, der es nicht als Last ansah, sondern als Gewinn, sich Waffen zu verschaffen und nur in seiner Nachbarschaft Krieg führte. Der seßhafte Krieger, der wieder in sein Heim zurückkehren will, ist auch ein anderer, als der Krieger der Völkerwanderung, der nicht mehr zurücksah, sondern nur vorwärts. Das karolingische Kriegertum ist ein Stand, der einen kleinen, einen sehr kleinen Bruchteil der gesamten Volksmenge ausmacht, und nur in der Form der Vasallität und des Lehnsbesitzes konnte dieser Stand bestehen und sich erhalten.3
Der Übergang aus dem alten Aufgebot seines Volkes durch den König als Volkshaupt in das Aufgebot von Vasallen mit ihren Untervasallen durch den König als Oberlehnsherrn vollzog sich sehr langsam und wohl auch nicht in allen Gegenden und Reichsteilen gleichmäßig. Die Anfänge der Vasallität sind schon im ersten Jahrhundert des merowingischen Königtums sichtbar, noch unter Karl dem Großen aber ist das Volksaufgebot staatsrechtlich und der Form nach vorhanden, erst unter seinen Enkeln ist es völlig abgestorben und das Kriegswesen beruht ausschließlich auf der Vasallität. Nur im Landsturm, dem Aufgebot zur Verteidigung bei feindlichem Einfall, lebt die alte allgemeine Wehrpflicht dauernd fort.
In den romanischen Gebieten des fränkischen Reiches muß sich diese soziale Schichtung leichter und deutlicher vollzogen haben als in den germanischen. Die große Masse der Bevölkerung besteht dort noch ganz ebenso wie einst im römischen Reich aus den Kolonen, den hörigen Bauern. Auch die städtische Bevölkerung, die plebs urbana, wird nicht als vollfrei angesehen, und die Handwerker und Krämer waren so wenig Krieger wie die Bauern.4
Freie Männer, liberi, ingenui, oft auch nobiles genannt, sind allein die Krieger, vorwiegend germanischer Abkunft, die äußerst gering an Zahl,5 auf einem Gau von 100 Quadratmeilen nicht mehr als einige hundert, teils auf Kleinbesitz, teils auf Großbesitz, teils auf Eigenem, teils auf Lehen, teils ohne Grundbesitz als Vasallen im Dienste und am Hofe eines Größeren leben.
Daß der freie Mann der Krieger ist und der Krieger der freie Mann, beherrscht den Vorstellungskreis der Zeit so vollständig, daß die Schriftsteller schon des 5. und 6. Jahrhunderts miles schlechtweg für den Laien setzen, dessen Stand sie mit dem des Geistlichen kontrastieren wollen,6 und wenn wir noch im späten Mittelalter hören, daß in den Rechtsaufzeichnungen der Grafschaft Anjou »franchir« »anoblir« bedeutet, nicht etwa »affranchir«, so mutet uns das an, wie eine sprachliche Versteinerung, die noch von einer längst vergangenen Zeit Kunde gibt.7
Rein germanisches Gebiet gehörte zum Frankenreiche vor der Inkorporation der Sachsen nicht viel. Am Rhein wie in Schwaben und Bayern sind ganz erhebliche Reste der Romanen unter den germanischen Eroberern sitzen geblieben und in demselben sozialen Verhältnis, wie jenseits, im romanischen Gebiet. Aber auch bei den Germanen in diesen gemischten Gebieten, und namentlich auch bei den Germanen in den rein germanischen Gebieten, an der Rheinmündung, an der Schelde, in Hessen und am Main, haben sich ähnliche Verhältnisse entwickelt: ein großer Teil der Bevölkerung hat von seiner Vollfreiheit mehr oder weniger eingebüßt und ist aus dem Kriegerstande ausgeschieden. Direkte Beweise haben wir dafür nicht und sehen auch nicht, wann, wie stark und wie schnell sich diese Entwickelung vollzogen hat. Die Tatsache selber aber ist mit Sicherheit zu erschließen, zunächst aus der Einheitlichkeit in dem Charakter der Kriegsverfassung des Gesamtreichs. Aus den Vorschriften über das Heeresaufgebot, die uns urkundlich erhalten sind, ergibt sich, daß die Krieger jedes Gebiets stets ihre ganze Ausrüstung und Verpflegung mitzubringen hatten, und es ergibt sich ferner, daß nicht etwa aus jedem Gebiet nach Einwohnerzahl und Leistungsfähigkeit bestimmte Kontingente gefordert wurden, sondern daß umgekehrt entweder alle oder ein gewisser Teil der vorhandenen Pflichtigen verlangt wurden. Die Voraussetzung war also, daß die kriegspflichtigen Freien ziemlich gleichmäßig über das Land verteilt waren, denn anderenfalls wären ja ganz ungeheuerliche Ungerechtigkeiten entstanden, wenn z.B. ein Gau in Hessen seine erwachsenen Männer fast alle hätte marschieren lassen und ausrüsten sollen, während ein Gau im inneren Gallien, wo über den Kolonen und Städtern nur wenig Vollfreie saßen, nur diese wenigen hätte zu schicken brauchen. Da nun im inneren Gallien bei der Geringfügigkeit der germanischen Einwanderung sicherlich nur wenige Vollfreie in den einzelnen Gauen waren, so muß auch in den östlichen Reichsteilen schon damals die soziale Gliederung sich der westlichen sehr genähert haben.
Noch durch eine zweite indirekte Beweisführung können wir diese Erkenntnis stützen. Wir sehen, daß sogar bei den noch heidnischen Sachsen sich dieselbe Entwickelung vollzogen hatte. Es ist überliefert, daß bei ihnen ein Stand von Minderfreien eine wesentliche Rolle spielt, und unter Ludwig dem Frommen hören wir, daß diese Minderfreien (frilingi et lazzi) eine ungeheure Menge bildeten.8 Sie machten im Jahre 842 eine Verschwörung, um die Rechte, die sie zur Heidenzeit besessen, wieder zu erlangen, den Stellingabund. Man könnte das so verstehen, daß erst die Herrschaft der Franken ihnen die Vollfreiheit genommen, und es ist wohl anzunehmen, daß eine Herabdrückung von Freien in den tieferen Stand durch die Franken tatsächlich stattgefunden – aber die Forderung der Leute geht nicht auf Wiederherstellung ihrer Freiheit, sondern auf Herstellung ihrer alten Standesrechte, die gemindert seien. Es kann also kein Zweifel sein, daß ein großer Stand solcher Minderfreien auch in heidnischer Zeit schon bestand; wir werden darauf bei der Untersuchung der Sachsenkriege noch zurückkommen.
Je geringer die Zahl der Vollfreien durch alle Gaue des Reiches hin war, desto leichter war es möglich, daß die beiden Prinzipien, das ältere, daß der König durch seine Grafen die freien Männer zum Kriege aufbietet, und das neuere, daß der König die Senioren mit ihren Vasallen zum Kriege aufbietet, neben einander hergehen und miteinander streiten. Die endliche und natürliche Lösung ist die, daß von dem alten Stande der Freien diejenigen, die Krieger geblieben, in die Vasallität eingetreten, diejenigen, die Bauern geworden, in einen Status der Minderfreiheit herabgesunken sind, daß also Krieger, die nicht Vasallen waren, nicht mehr existieren. Eine positive Vorschrift, daß jeder freie Mann einen Senior haben sollte, ist uns erst von Karl dem Kahlen im Jahre 847 überliefert. Aber noch im Jahre 864 finden wir wieder Vorschriften9 und sogar noch im Jahre 884 eine Urkunde10, daß ein freier Mann (als solcher, nicht als Vasall) mit den anderen ins Feld ziehen soll. Die Wirklichkeit des Lebens war von solchen Forderungen bereits so weit entfernt, daß Schriftsteller für »kriegerisch« einfach »vasallisch« sagten.11
Zu Karls des Großen Zeit bestanden tatsächlich noch die beiden diametral einander entgegengesetzten Systeme der Kriegsverfassung nebeneinander. Während der Wortlaut einer Reihe von Bestimmungen keinen Zweifel zu lassen scheint, daß die Masse der freien Männer, wenn auch nicht alle zugleich, so doch abwechselnd den Kriegsdienst versah, bezeugen andere, daß schon damals ausschließlich Vasallen in den Krieg ziehen.
Selbst diejenigen Freien, die Vasallen geworden sind, werden von dem Grafen bei Strafe des Heerbannes aufgeboten, und die Quellen geben uns keinen direkten Aufschluß darüber, wie die beiden Prinzipien praktisch miteinander ausgeglichen worden sind. Da schon so bald nach des großen Kaisers Hinscheiden das Vasallitätswesen die Alleinherrschaft errungen hat, so müssen wir annehmen, daß der Kampf, dessen Beginn wir ja schon unter die ersten Nachfolger Chlodwigs setzen müssen, unter Karl bereits im wesentlichen zugunsten der Vasallität entschieden war und das Aufgebot der gesamten freien Männer nur noch als Form und in der Theorie, praktisch nur noch in einzelnen Fällen und bei größeren Besitzern bestand. Es war aber nicht bloß Zähigkeit der überlieferten Rechtsformen, die das allgemeine Aufgebot formell so lange am Leben erhielt, sondern auch ein positives, sehr starkes Motiv. Man hielt so lange daran fest, weil das Aufgebot die einzige Form war, in der sich ein freier Germane zu einer Staatsleistung, namentlich einer Steuerleistung (abgesehen vom Gerichtsdienst) heranziehen ließ. Hätte man das Aufgebot fallen lassen, während noch ein Teil der Untertanen weder in die Vasallität getreten, noch zu einem Status der Minderfreiheit herabgedrückt war, so währen diese Untertanen für die öffentlichen Leistungen gänzlich ausgefallen. Karl, und wahrscheinlich schon seine Vorgänger, erließen deshalb Vorschriften, daß die freien Männer, die nicht auszögen, sich je nach ihrem Vermögen zu Gruppen zusammentun und einen von ihnen ausrüsten sollten. Man hat diese Vorschriften bisher so aufgefaßt, daß, wenn z.B. drei Besitzer von je einer Hufe einen ausrüsten sollen, sich das auf die vollständige Versorgung, auch mit Proviant und Transportmitteln, beziehe. Man hat aber dabei übersehen, daß eine derartige Leistung viel zu groß ist, um von drei Bauernhufen getragen zu werden. Diese eigentliche Heeresversorgung mußte natürlich die ungeheure Masse der Minderfreien und Hörigen liefern, die dazu, sei es von ihren Herren, sei es von den Grafen, herangezogen wurden. Die freien Männer, deren Besitz nicht über ein oder zwei gewöhnliche Bauernhufen hinausging und die einen Standesgenossen unterstützen sollten, leisteten entweder nur eine Geldzahlung oder gaben ein Rüstungs- oder Kleidungsstück für seine persönliche Ausstattung. Auch das werden sie schon ungern genug getan haben, denn bei ihrem sehr niederen wirtschaftlichen Status war jedes Waffenstück, jedes Stück Lederzeug oder Tuch, jeder Schinken oder Käse, der ihnen abverlangt wurde, ein wesentliches Objekt. Das wesentlichste und kostbarste Stück der ganzen Ausrüstung aber war, da wir uns die eigentlichen Krieger ja als Reiter vorzustellen haben, das Pferd. Fast Jahr für Jahr ging man in den Krieg, und oft genug wird der heimkehrende Krieger sein treues Roß auf der weiten Fahrt haben drangehen müssen und es nicht mit zurückgebracht haben. Der Krieg kostet immer Pferde, noch viel, sehr viel mehr als Menschen. Ein Bauer ist aber nicht in der Lage, alle paar Jahre ein brauchbares Kriegsroß zu stellen. Die meisten Bauern besitzen überhaupt keine Pferde, am wenigsten brauchbare Kriegspferde, sondern arbeiten mit Ochsen oder Kühen.
Die Vorschriften der karolingischen Könige über die Gruppenbildung der freien Männer, die immer einen von sich in den Krieg schicken sollen, ist daher wesentlich als eine markierte Steuerumlegung aufzufassen. Es ist in den meisten Fällen nicht ein wirkliches Aufgebot, sondern ein Rechtstitel für den König, von diesen freien Männern Leistungen zu fordern, und zugleich eine Einschränkung dieses Rechts gegen ganz willkürlichen Mißbrauch durch die Beamten. Wenn jene beispielsweise genannten drei Hufner einen von sich in der üblichen Weise ausgestattet, oder, was sie wohl meist vorzogen, die Ausrüstung geliefert hatten, die der Graf dann einem seiner Vasallen zuwandte, oder eine entsprechende Ablösung dafür, so hatten sie das ihrige getan und der Graf konnte nichts weiter von ihnen verlangen.
Wir finden königliche Erlasse über diesen Gegenstand, die sehr genau zu sein scheinen. Im Jahre 807 wird für die Landschaft westlich der Seine einmal vorgeschrieben, daß, wer 5 oder 4 Hufen im Eigentum habe, selbst ausziehen solle; zusammentun sollen sich je drei, die eine Hufe haben, oder einer zu zwei, einer zu einer Hufe; je drei, die eine Hufe haben; zwei zu einer Hufe zusammen mit einem noch kleineren Besitzer; Halbhufner sollen je 6 einen ausrüsten. Nicht-Grundbesitzer sollen 6, die je 5 Pfund besitzen, einen ausrüsten und ihm 5 Solidi geben. So spezialisiert das ist, so darf man sich doch nicht täuschen lassen, als ob mit solchen Vorschriften so sehr viel gesagt sei. Zunächst nach oben hin, den höheren Behörden gegenüber, so gut wie nichts. Man stelle sich eine Verwaltung vor, deren Spitzen sämtlich der Schriftsprache entbehren, die für jede Urkunde, jede Liste, jeden Bericht, jede Rechnung auf ihren Schreiber als Übersetzer angewiesen sind. Es war für die Zentralregierung schlechterdings unmöglich, eine zuverlässige Vorstellung davon zu gewinnen, wieviel Männer und mit wieviel Besitz in jedem Gau vorhanden seien. Als unter König Eduard III. das englische Parlament einmal beschloß, eine Steuer nach einem neuen Modus auszuschreiben, ging es bei der Berechnung des zu erwartenden Betrages von der Annahme aus, daß das Königreich 40000 Pfarreien habe; nachher stellte sich heraus, daß es noch nicht 9000 waren.12 Die Zahl der Ritterlehen schlug man auf 60000, andere, auch königliche Minister, schlugen sie auf 32000 an, und in Wirklichkeit waren es keine 5000. Dabei hatte, wie wir noch sehen werden, England eine wirkliche Zentralverwaltung; das Frankenreich hatte sie nicht, so daß aus ihm auch nicht einmal Schätzungen überliefert sind, die uns als Beispiel dienen könnten. Ähnliche Belege, wie wir sie aus der englischen Geschichte herausgegriffen haben, daß mittelalterliche Verwaltungen schlechterdings jeder Einsicht in die höheren Zahlenverhältnisse des Staatswesens entbehrten, werden uns im Laufe dieses Werkes noch viele begegnen.
Unter Ludwig dem Frommen scheint man im Jahre 829 einen Versuch gemacht zu haben, eine Art Stammrolle mit Vermögensangabe für das Reich anzulegen. In vier verschiedenen Ausfertigungen ist uns dieses Gesetz erhalten, aber charakteristischerweise sind diese vier Ausfertigungen in allen ihren Einzelheiten ganz verschieden ausgefallen. In der einen fehlt der Fall, daß sich zwei, in der anderen der, daß sich sechs zusammentun sollen, in der dritten ist nur die Gruppenbildung zu dreien erwähnt, in der vierten ist über die Gruppenbildung überhaupt nichts vorgeschrieben.
Die Erklärung wird sein, daß bei der Einschätzung und Einteilung in Gruppen überhaupt dem diskretionären Ermessen und der Willkür ein so großer Spielraum blieb, daß selbst solche Differenzen im Regulativ nichts ausmachten. Allenthalben werden gewisse Schablonen und Schätzungen überliefert gewesen sein, die nun fixiert wurden. Auch wenn man die Vorschrift – was zu bezweifeln ist – wirklich ausgeführt hat, wird man nicht weit damit gekommen sein, denn selbst wenn man ein so riesiges Werk einigermaßen zuverlässig zustande brachte, so paßte es doch nur für den Augenblick: in wenigen Jahren war durch Todesfälle und Erbgänge wieder alles verschoben. Aber selbst im ersten Jahr nützte es sehr wenig, weil für den Auszug doch auch die persönlichen Verhältnisse, namentlich der Fall der Krankheit, sehr stark in Betracht kamen und von oben nicht zu kontrollieren waren. Endlich aber konnte es überhaupt nicht in der Absicht des Gesetzes und des Staatsoberhauptes liegen, den Grundsatz, »jeder Freie marschiert« oder »jede vorgeschriebene Gruppe von Freien schickt einen Mann« wörtlich zur Ausführung bringen zu lassen. Denn die Voraussetzung dafür wäre die wirklich gleichmäßige Verteilung der Freien über alle Gaue nach ihrer Leistungsfähigkeit gewesen. Schon eine geringe Ungleichmäßigkeit in dieser Verteilung hätte bei der steten Wiederholung der Kriegszüge und der Kriegslast eine sehr schwere Prägravation der zufällig von mehr Freien bewohnten, also besonders der stärker germanischen Gaue ergeben. Im römischen Reich hatte einst die Zentralbehörde, der Senat, die Kriegslast auf Grund sorgfältig geführter Zensuslisten in den Gemeinden immer neu repartiert. Über einen solchen Verwaltungsapparat verfügte das Imperium Karls des Großen nicht. Hier mußte das Wesentliche zuletzt trotz gewisser regulativer Vorschriften von oben und trotz der Inspektion durch die Waltboten (Missi) doch dem diskretionären Ermessen der Grafen überlassen bleiben. Kam das Heer zusammen, so überschaute der Kaiser oder sein Feldherr die einzelnen Kontingente und erkannte bei der geringen Zahl ohne Schwierigkeit, wer eine gut gerüstete Mannschaft in normaler Zahl und wer etwa weniger oder weniger gut aussehende Gefolgsleute hinter sich hatte. Vorschriften über die Stellung einer bestimmten Zahl von Kriegern13 finden wir auch im ganzen späteren ritterlichen Mittelalter nur sehr selten und das ist ganz natürlich, da eben die Qualität, die man weder zählen noch messen kann, in diesem Kriegertum die Hauptsache ist. Die Form, in der der Monarch auf volle Kontingente drückt, ist immer die, daß er verlangt, alle Pflichtigen sollen kommen. Auch hieraus glaube ich schließen zu können, daß man im Grunde an die freien Männer, die dem Wortlaute nach aufgeboten wurden, kaum dachte, denn trotz allem, was wir oben ausgeführt haben, müssen doch noch immer starke Ungleichheiten in der Verteilung der Freien über das Land bestehen geblieben sein. Dagegen läßt sich annehmen, daß die Vasallen tatsächlich ziemlich entsprechend der Leistungsfähigkeit in den verschiedenen Gauen vorhanden waren, und erst dann hatte die Vorschrift, daß alle Männer vom Kriegerstande auch wirklich ausrücken sollten, einen vernünftigen, ausführbaren Sinn.
Nach dem Wortlaut der oben angeführten Capitularien hätten wir anzunehmen, daß die sämtlichen Heerespflichtigen als militärisch gleichwertig angesehen werden und in einem gewissen Turnus abwechselnd ausziehen. Das war vielleicht noch möglich unter den ersten Merowingern, wo die Masse der Franken eben erst den Übergang aus dem kriegerischen Urzustand in das bäuerliche Leben und den Bauern-Charakter vollzog. Damals mögen zuerst solche Vorschriften über den Auszug erlassen worden sein und sich mit dem wirklichen Leben auch gedeckt haben. In der Zeit aber, aus der uns die Vorschriften erhalten sind, als die Franken schon auf der einen Seite wirkliche Bauern geworden, auf der andern Seite sich die Vasallen als Kriegerstand ausgesondert hatten, da ist das Ausziehen von Bauern im Turnus eine vollständige Unmöglichkeit. Die Lust, Anlage und Fähigkeit zum Kriegertum ist in einer bürgerlich-bäuerlichen Gesellschaft sehr ungleichmäßig und ein tüchtiger Krieger aus bloßer Naturanlage sehr selten. Das vorgeschriebene Kontingent (von den Abweichungen in den einzelnen Bestimmungen dürfen wir absehen) ist noch erheblich geringer, als die dort erscheinenden Zahlen auf den ersten Blick ergeben. Die große Masse sind natürlich nicht die Mehr-Hufen-Besitzer, sondern die Hufner und Halbhufner; auf der Hufe oder Halbhufe sind aber sehr häufig mehr als ein Mann im kriegsfähigen Alter. Kriegspflichtig sind sie alle, aber die Lastenverteilung geht nach dem Besitz. Wenn z.B. auf Grund der Bestimmungen von 807 auch ganz streng ausgehoben wurde, so kommen doch schwerlich mehr als 10% der erwachsenen freien Männer und Jünglinge zusammen. Der Graf aber, der mit wechselnden Zehnteln oder auch Sechsteln oder Vierteln seiner Bauern beim Heere erschienen wär, würde bei seinem kaiserlichen Herrn und seinen Amtsgenossen wohl einen sehr wunderlichen Eindruck hervorgerufen haben. Es liegt kein Grund vor, anzunehmen, daß die kriegerische Brauchbarkeit sich besser bewährt hätte, als wenn später im 30jährigen Kriege in Brandenburg verordnet wurde, daß je ein Dorf oder einige Dörfer zusammen je einen Mann stellen und mit Proviant, Waffen und Munition ausgerüstet zum Sammelplatz schicken sollten: so wenig man im 17. Jahrhundert mit solchem Aufgebot hat etwas ausrichten können, so wenig konnte man es im neunten.14
Dem Modus, daß man dem Wortlaut einer Verordnung nach Bürger zum Kriege aufbot, in Wirklichkeit aber auf diesem Wege eine Steuer eintrieb, werden wir das ganze Mittelalter hindurch noch vielfältig und immer von neuem begegnen.
Im vorigen Bande haben wir nachgewiesen, daß bereits spätestens vom Ende des sechsten Jahrhunderts an nicht die allgemeinen Aufgebote, sondern die Vasallen die Entscheidung in den Kriegen der Merowinger gegeben haben; unter den Enkeln Karls des Großen sind auch die letzten Spuren des alten allgemeinen Aufgebots verschwunden. Da ist es sicher, daß nicht zwischendurch die Kriegsverfassung wieder auf die Bauernschaft, die längst unkriegerisch geworden war, basiert worden ist.
Wir müssen also die Capitularien Karls des Großen dahin auslegen, daß die Hufenbesitzer oder Hufenbesitzergruppen, falls nicht zufällig einer unter ihnen war, der Neigung hatte in den Krieg zu ziehen, die Ausstattung, die sie zu geben hatten, das adjutorium, einem gräflichen Vasallen zuwandten, der für sie die Kriegspflicht übernahm. Das war für beide Teile, die Bauern, die lieber zu Hause blieben, und den Grafen, der nicht bloß einen bewaffneten Mann, sondern einen tüchtigen, willigen und gehorsamen Krieger haben wollte, eine genehme Auslegung der kaiserlichen Vorschrift. Alle die Wendungen, die so bestimmt zu verlangen scheinen, daß einer der Pflichtigen selbst ins Feld ziehe, sind als bloße Kanzleifloskeln anzusehen, die sich durch die Generationen, vielleicht schon durch die Jahrhunderte so hinschleppten. In Wirklichkeit haben wir es in den Aufgebots-Capitularien mit der Ausschreibung von Kriegssteuern zu tun, die in den verschiedenen Jahren und auch nach den verschiedenen Landesteilen verschieden bemessen wurden. Es war ja naturgemäß, daß die Sachsen für einen Krieg gegen die Sorben oder auch die Böhmen stärker herangezogen wurden als für einen Krieg in Spanien.
Vollends den Ausschlag, daß die Capitularien, die von den Vasallen sprechen, die karolingische Wirklichkeit besser spiegeln, als die, die anscheinend das allgemeine Aufgebot bezeugen, geben die Feststellungen über die Heereszahlen. Je kleiner die Heere sind, desto sicherer ist es, daß sie aus Berufskriegern bestanden; ein Graf, der überhaupt nur, sagen wir, 100 Krieger heranführt aus einem Gau, der vielleicht 50000 Einwohner hat, nimmt dazu nicht jedes Jahr 100 andere, sondern hat seinen festen Stamm, von dem er weiß, daß er damit Ehre einlegt.
Die sachlich und namentlich für unsere Erkenntnis wesentlichste Bestimmung des karolingischen Kriegswesens ist die Vorschrift, daß die einzelnen Kontingente ihre gesamten, für einen ganzen Feldzug nötigen Vorräte und Gebrauchsgegenstände von Hause mitbringen und bei sich führen sollen. In den alten römischen wie in modernen Heeren, liefert diese Bedürfnisse der Staat; der Kriegsherr legt dafür an passenden Stellen Magazine an, schreibt Liegerungen aus, kauft Vorräte und schafft sie mit seinen Proviantkolonnen in die Lagerstätten. Was verziehrt ist, wird durch fortdauernde, regelmäßige Zufuhr ergänzt. Der karolingische Krieger soll das, was er für den ganzen Feldzug, Hin- und Rückmarsch gebraucht, von Hause mitschleppen. Die Berechnung, die wir über die Größe dieser Leistung bereits im vorigen Bande aufgemacht haben, führt auf mehr als die ganze Last eines Saumtieres, die volle Last eines Zugtieres für jeden einzelnen gemeinen Krieger; auch das reicht aber erst, wenn wir uns vorstellen, daß jedes Grafschafts-Kontingent noch eine Herde lebenden Schlachtviehes mitbrachte. Machen wir uns nun klar, daß diese Krieger sich als einen bevorrechtigten Stand ansahen, in manchen Gegenden schon rundweg die »Edlen« genannt wurden, daß sie aus den Eroberern hervorgegangen und nicht durch eine strenge Disziplin, wie einst die Legionäre durch ihre Centurionen gezügelt waren, so werden wir uns diese Scharen auch in ihren Bedürfnissen als anspruchsvoll vorzustellen haben. Sie waren nicht zufrieden mit dem bloßen Notdürftigsten und wollten, wenn sie in Wind und Wetter draußen lagen, obgleich gewiß nicht reichlich, doch mit Lagerbedürfnissen aller Art und auch mit einem guten Trunk versehen sein. Karl der Große verbot durch ein eigenes Edikt (811) das gegenseitige Zutrinken (ut in hoste nemo parem suum vel quemlibet alterum hominem bibere roget), und wer im Heere betrunken gefunden wird, dem wird zudiktiert, daß er nur Wasser trinken dürfe, bis er sich bessere (quosque male fecisse cognoscat). Wein- und Bierfässer müssen also den karolingischen Kriegern nicht wenige nachgefahren worden sein; mochten sie sie selbst mitbringen, mochten Kaufleute das Heer begleiten; die Trainkolonnen, die solcher Art Heeren folgen, müssen unabsehbar sein. Die Zahl der Begleitmannschaften und Tiere ist um das Mehrfache größer als die Zahl der Krieger, und nimmt mit den Karren und Säumern einen viel größeren Raum auf der Marschstraße ein, als die Gefechtstruppen selber. Diese urkundlich bezeugte Tatsache, daß die karolingischen Heere ihre ganzen Vorräte aus der Heimat für die ganze Dauer des Feldzuges mitbrachten und mitschleppten, ist ein zwingender Beweis, daß die Heere nur sehr klein gewesen sind.15 Große Heere mit solchen Kolonnen hätten sich weder bewegen, noch ihre Pferde und Zugtiere ernähren können. Wir werden annehmen dürfen, daß Karl der Große selten mehr als 5000 oder 6000 Krieger auf einer Stelle beisammen gehabt hat, da diese mit ihrer Bagage bereits die Länge eines vollen Tagemarsches von drei Meilen einnahmen. Zehntausend Kombattanten werden wir als das Alleräußerste eines karolingischen Heeres anzunehmen haben. Dabei aber ist zu beachten, daß die Grenze des Begriffs der Krieger keine scharfe ist. Jene 5000-6000 Mann haben wir uns vorwiegend als Berittene vorzustellen; die Masse der persönlichen Diener aber, die die Führer, die Grafen, Bischöfe und großen Vasallen umgaben, nicht weniger aber der Troßknechte, die die Maultiere führten und die Wagen lenkten, war bewaffnet16 und mehr oder weniger kriegerisch, brauchbar zum mindesten für die kriegerischen Nebenzwecke, die Fouragierung und die Verwüstung des feindlichen Landes. Auch die älteren griechischen und römischen Leichtbewaffneten haben wir uns ja als ein Mittleres zwischen Knecht und Krieger vorgestellt.
Die Dürftigkeit der Quellen der karolingischen Zeit, die immer nur den Zug der Dinge im Großen angeben, täuscht uns gar zu leicht über die Bedeutung und die Tragweite der Einzelerscheinung und der Einzeltatsache, so auch über die Last, die die jährlichen Kriegsaufgebote für das Land auferlegten. Man wird aber z.B. das Bild ohne weiteres auf eine fränkische Grafschaft unter Kaiser Karl übertragen dürfen, wenn wir hören, wie im Jahre 1240 Kaiser Friedrich II. von seinem Justiziar in Ferre Idronti verlangte, daß er die Lehnsleute seines Bezirks nach ihrer Leistungsfähigkeit aufbiete, dieser aber die größten Schwierigkeiten damit hatte: 18 Belehnte (feudatorii) täten bereits Dienst; der Rest aber sei so reduziert, daß er so bald nicht ausgerüstet werden könne (adeo imminuta erat, quod tam cito non poterat praepari). Achtzehn (nicht mehr als 18!) wurden schließlich, indem man ihnen Subsidien gab, ausgerüstet aus einem Bezirk so groß, daß der Kaiser in direkter Korrespondenz mit seinem Vorsteher stand.
Die Erkenntnis, daß wir uns die karolingischen Heere nicht, wie man es bisher getan hat, als bäuerliche Massenheere, sondern als sehr kleine Qualitätsheere vorzustellen haben, wird bestätigt durch eine Reihe von Einzelnachrichten über ihre Zusammensetzung. Es zeigt sich nämlich, daß die Kontingente aus den entferntesten Gegenden zu einem Heer vereinigt wurden.
Im Jahre 763 wurden Bayern in Aquitanien verwandt. Im Jahre 778 waren die Bayern, Allemannen und Ostfranken auf dem Feldzuge in Spanien; im Jahre 791 die Sachsen, Thüringer, Friesen und Ripuarier auf dem Zuge gegen die Avaren; 793 Aquitanier in Unteritalien; im Jahre 806 die Burgunder auf dem Heereszuge nach Böhmen; 818 die Allemannen, Sachsen und Thüringer gegen die Bretagne. Mehrfach zogen die Aquitanier ins Feld nach Sachsen; 815 kam König Bernhard mit dem longobardischen Heer (cum exercitu) nach Paderborn zum Reichstag; 832 kam Lothar mit den Longobarden, Ludwig mit den Bayern nach Orleans.17
Stellen wir uns jedes einzelne dieser Kontingente als einen noch so sehr beschränkten Volksauszug vor, so wären Riesenheere zusammengekommen. Das ist bei dem Modus der Verpflegung, den wir kennen gelernt haben, ausgeschlossen. Wiederum, um mittelstarke Heere zusammenzubringen, hätte man nicht die Bayern nach Spanien, die Ripuarier an die Theiß, die Burgunder nach Böhmen, die Aquitanier nach Sachsen, die Sachsen in die Bretagne marschieren zu lassen brauchen, wenn noch im Volke etwas, was sich der allgemeinen Wehrpflicht auch nur annäherte, bestanden hätte. Denn Männer mit gesunden Knochen gab es in jedem einzelnen dieser Gebiete 100000 und mehr. Das Zusammenfassen so verschiedener Kontingente, das Hin- und Herschieben, die ungeheuren Märsche mit ihrem Aufwand von Kräften und Mitteln sind nur dann verständlich, wenn der Kriegsherr Wert darauf legte, statt der Bürger- und Bauernscharen Berufskrieger um sich zu versammeln.
Auch die Nachrichten über die einzelnen kriegerischen Ereignisse bestätigen diese Auffassung.
Im Jahre 778 erhoben sich die Sachsen, während Karl in Spanien war, und kamen mordend und brennend bis an den Rhein. Karl erhielt die Nachricht, als er bereits auf dem Rückmarsch war, in Auxerre und sandte sofort die Ostfranken und die Allemannen, die er bei sich hatte, gegen sie ab (Cujus rei nuntium, cum rex apud Antesiodorum civitatem accepisset, extemplo Francos orientales atque Alemannos ad propulsandum hostem festinare jussit. Ipse ceteris copiis dimissis etc., Ann. Lauresh.). Obgleich die einbrechenden Sachsen unmöglich so sehr zahlreich gewesen sein können, und obgleich das ostfränkische Kontingent, das Karl bis über die Pyrenäen führte, an Zahl nur ziemlich gering gewesen sein kann, so waren die Rheinlande dadurch doch schon so sehr von brauchbaren Kriegern entblößt, daß sie sich der Sachsen nicht zu erwehren vermochten, und erst das aus Spanien zurückkehrende Heer brachte die Streitkräfte der Franken so hoch, daß sie ihnen zu Leibe gehen konnten.
Die Scara und die Domänenhöfe.
Eine Kriegsverfassung, die darauf beruht, daß der Kriegerstand über das ganze weite Reichsgebiet zerstreut auf seinen Höfen lebt und für jeden Kriegszug erst aufgeboten, ausgerüstet, gesammelt und in wochenlangen Märschen herangeführt werden muß, eine solche Kriegsverfassung ist von einer sehr großen Schwerfälligkeit und für kleinere Kriegsaufgaben, Grenzschutz und Nachbarfehden unbrauchbar. War auch in Grenzgebieten der angesiedelte Kriegerstand vielleicht zahlreicher, als im Innern des Landes und erstreckte sich das Kriegertum, die Kriegsfähigkeit, Kriegslust und Bewaffnung hier noch über erheblich weitere Kreise, so war und blieb ein Aufgebot bloß aus einem Grenzstrich und seinen Nachbarlandschaften doch immer sehr klein und war, namentlich offensiv, da diese Leute ungern ihre eigenen Höfe ungeschützt ließen, wenig zu gebrauchen. Wir finden daher, daß unter Karl dem Großen das Aufgebot der Lehnsleute ergänzt wird durch eine Truppe, die »scara«, die »Schar« genannt wird. Wir könnten es vielleicht am besten mit »Wache« übersetzen. Es ist eine kleine, sozusagen stehende Truppe, Mannschaft, die nicht angesiedelt ist, sondern am Hofe oder in einem Lager verpflegt wird, eine Leibwache des Kaisers, die groß genug ist, kleinere kriegerische Expeditionen selbständig, ohne die Verstärkung und Unterstützung durch das Landesaufgebot zu machen. Da sie meist junge Leute waren, so werden sie von den Schriftstellern auch »tirones« und »juvenes« genannt18; die deutsche Bezeichnung ist Haistalden oder Austalden, woher unter heutiges Wort »Hagestolz« kommt, da sie keine Familie haben konnten. Auch für die dauernde Besetzung von Burgen in erobertem Gebiet bedarf man ihrer, da die belehnten Vasallen immer nur gewisse Zeit von ihrer Hufe fortgerufen werden können.
Nicht nur zu kriegerischen Zwecken nach außen, sondern auch im Innern, gegen Räuber, zu polizeilichen Diensten wurden diese stets bereiten Scharen verwendet; die Worte »Scharwache« und »Scherge« sind daher entstanden. Auch zu allerhand technischen Zwecken, z.B. der damals sehr wichtigen Grenzabsteckung, wurden sie verwandt oder, wie man wohl besser sagt, für dergleichen Dienste waren geeignete und ausgebildete Leute unter ihnen. Bei König Knut von Dänemark-England finden wir später die »Hauskerle« als analoge Institutionen, und milites aulici, palatini, die uns in späteren Jahrhunderten begegnen,19 sind dem Wesen nach abermals dasselbe.
Die Scharen oder Leibwachen wurden als zur Person des Königs und zum Hofe gehörig auch vom Hofe und in der Art des Hofes verpflegt. Die fränkischen wie die deutschen Könige hatten keine eigentliche Residenz, sondern waren fast fortwährend in Bewegung durch ihr großes Reich,20 um der Natur des Staates gemäß persönlich das königliche Amt auszuüben. Dies Umherziehen wäre von unerträglicher Schwierigkeit gewesen, wenn für den ganzen Regierungsapparat und Hofhalt immer die ganze Verpflegung hätte mitgeschleppt werden müssen. Das geschah nicht nur nicht, sondern umgekehrt, es war noch ein besonderes Motiv für die Beweglichkeit des Königtums, daß es seine Verpflegung allenthalben fand, daß die königlichen Domänen, statt ihre Erträge an entfernte Zentralpunkte zu schicken, sie nur an Ort und Stelle für die Verpflegung des königlichen Hofes bereit zu halten brauchten. Nicht die Verpflegung wurde zu Hofe geschafft, sondern der Hof zog von einer Verpflegungsstelle zur anderen. Konr. PLATH hat nachgewiesen, daß schon die Merowinger-Könige sich zahllose Paläste (Pfalzen) gebaut haben, oft nur eine Tagereise voneinander entfernt, offenbar zu dem Zweck, dem reisenden Hof als Unterkunftsstätte zu dienen. Es war wirtschaftlicher, diese zahlreichen großen Bauten aufzuführen, als Jahr für Jahr die Domänenerzeugnisse auf weite Entfernungen zu transportieren, und viele solcher Erzeugnisse, Fettvieh, Wild, Fische, Eier, waren überhaupt nicht weit transportierbar. Man kann wohl nicht geradezu sagen, das Reise-Königtum sei ein Produkt der Naturalwirtschaft; es ist tiefer in der Natur des germanischen Königtums begründet: aber jedenfalls hängt es eng mit der Naturalwirtschaft zusammen und hat sich wegen dieses Zusammenhangs so tief eingebürgert und so lange behauptet.
Ganz neuerdings hat nun CARL RÜBEL21 nachgewiesen, daß in der Karolingerzeit auf den Wegen, die mit den Sachsenkriegen zusammenhängen, von Etappe zu Etappe Reichshöfe gegründet worden sind, große Domänenhöfe, die die Sammelstellen für die Abgaben der umliegenden Bauernschaften bildeten. Diese Reichshöfe also waren imstande, nicht nur den Hof, sondern auch die ihn begleitende, oder auch eine selbständig marschierende scara auf einen oder einige Tage zu verpflegen, und gaben ihr eine Beweglichkeit, wie sie ein eigentliches Landheer niemals erreichen konnte. Für dieses mußte das Mitbringen und Mitschleppen der Verpflegung beibehalten werden, da für mehrere Tausende die Vorräte der Reichshöfe natürlich nicht ausreichten. Einige Heerstraßen- und Grenzgebiete konnten nicht die Kriegslast für das ganze Reich tragen und das eigentliche Heer mußte also seine Vorräte selbst mitbringen und mitschleppen.
Der Treu-Eid.
Ein getreues Spiegelbild der Geschichte des germanischen Kriegertums gibt uns die Geschichte des germanischen Treueides, die wir, wenn sie auch nicht in jedem Moment urkundlich zu belegen ist, doch mit genügender Sicherheit verfolgen können.22 Die Urgermanen hatten keinen allgemeinen Treueid, sondern kannten nur den Eid, den die Gefolgsmänner ihrem Herrn schwuren. Unter den nächsten Nachfolgern Chlodwigs finden wir den allgemeinen Treueid gegen den König. Die Untertanen schwören ihm »fidelitas et leudesamio«; diese Formel läßt erkennen, daß der Eid dem alten Gefolgschaftseide nachgebildet ist: die ganzen Völkerschaften haben sich einem Kriegsherrn untergeordnet. Es ist wohl möglich, daß die erste Veranlassung, die gesamte Masse der Krieger dem Führer einen Eid leisten zu lassen, gegeben worden ist durch den römischen Dienst, in den ja nicht bloß einzelne Scharen, sondern die ganzen Völkerschaften als solche eintraten. Wir finden den Untertaneneid, den die Germanen ihrem Könige leisten, nicht bloß bei den Franken, sondern auch bei den Ost- und Westgoten und den Longobarden; bei den Angelsachsen aber, die nicht in römischem Dienst gestanden haben, finden wir ihn erst in Anlehnung an fränkische Muster viel später, im zehnten Jahrhundert.
Dieser allgemeine fränkische Untertaneneid ist unter den späteren Merowingern obsolet geworden, und auch die ersten Karolinger, auch Pipin der König, verlangten noch keinen allgemeinen Treueid; er ist aufgesogen worden durch den mittlerweile entwickelten Vasalleneid. Auch den Untertaneneid unter den Merowingern haben ja nicht sämtliche Einwohner, sondern nur das eigentliche wahre Volk im Sinne der Zeit, die Krieger, geschworen,23 und diese Krieger sind in Vasallen verwandelt. Dem König schworen also jetzt nur seine direkten Vasallen, und deren Untervasallen waren ihm nur verpflichtet durch das Mittelglied ihrer Herren. Die Gefährlichkeit dieser Einrichtung erkannte Karl der Große, als bei einer Empörung, wahrscheinlich die des Thüringers Hardrad im Jahre 786, die Verbrecher sich darauf beriefen, daß sie ja dem Könige keinen Eid geleistet hätten. In Veranlassung dieses Falles, wie ausdrücklich in der Einleitung der uns erhaltenen Verordnung gesagt ist, verfügt nunmehr der König, daß alle Untertanen über 12 Jahre ihm direkt einen Eid zu leisten hätten, einen Eid, den er dann noch mehrfach, namentlich als er den Kaisertitel annahm und als er die Nachfolge-Bestimmungen traf, wiederholen ließ.24 Die Untertanen, die diesen Eid schwören sollen, werden im einzelnen aufgezählt: es sollen schwören die Bischöfe und Äbte, die Grafen, die Königlichen Vasallen, die Vicedomini, Archidiaconen, Kanoniker, Kleriker (ausgenommen die Mönche, die ihr Gelübde abgelegt haben), die Vögte, Hunni und das gesamte Volk, alle die über 12 Jahre sind bis in das Alter, wo sie noch rüstig genug sind, daß sie die Gerichtstage besuchen und die Befehle ihrer Senioren ausführen können, auch dann, wenn sie nicht direkte Untertanen des Königs, sondern als Eingesessene oder Knechte von Grafen oder Bischöfen oder Äbten von diesen Lehen haben und mit Roß und Waffen, Schild, Lanze, Schwert und Dolch ausgerüstet sind.
Diese Aufzählung darf uns als ein neuer Beweis gelten, daß die Kriegsverfassung schon damals völlig feudalisiert ist. Zwar haben diejenigen Forscher, die auch unter Karl dem Großen noch die allgemeine Wehrpflicht aller freien Männer annehmen, sich daran gehalten, daß nach dieser Eidesformel das gesamte Volk (cuncta generalitas populi) den Eid zu leisten habe. Aber wenn damit wirklich sämtliche Untertanen gemeint wären, so wäre ja die ausführliche und spezielle Aufzählung aller verschiedenen Kategorien der zu Verpflichtenden überflüssig gewesen. Was gemeint ist, ist die Gesamtheit der Kriegerschaft und daneben die Geistlichkeit; wer nicht Krieger ist, ist nicht im vollen, wahren Sinne ein freier Mann und rechnet nicht zum Volk im politischen Sinne, während umgekehrt auch Unfreie, die in den Kriegerstand eingetreten sind, zur Eidesleistung herangezogen werden. Erst hierdurch werden auch die Wendungen der Chroniken verständlich, wenn sie berichten, daß alle Aquitanier25 oder alle Longobarden26 zum König gekommen wären, sich ihm unterworfen und ihm Treue gelobt hätten. Diese »Alle« sind nicht die Millionen der Bürger und Bauern, sondern die, auf die es ankommt, nämlich die Krieger, die sich tatsächlich annähernd auf einem Fleck versammeln lassen, und die Karl der Große nicht bloß mittelbar, sondern direkt in Pflicht nehmen lassen wollte. Die Formel der Eidesleistung, die nach der Kaiserkrönung festgestellt wurde, lautet dahin, daß der Schwörende verspricht, so treu zu sein, wie von Rechts wegen der Mann dem Herrn sein soll (sicut per drictum debet esse homo domino suo). Es kann nichts Charakteristischeres für den Geist der Zeit geben, als diese Formel: nicht die Treue gegen den König ist das Ursprüngliche, das, was der Mann versteht, woran das Staatsrecht anknüpft, sondern umgekehrt: das, was dem gemeinen Mann das Natürliche und Verständliche ist, das ist die Treue, die der Vasall seinem Herrn schuldet; diese Treue verlangt nun auch der Kaiser von ihnen, damit nicht etwa der Herr, gestützt auf die Treue seiner Leute, sich gegen den Kaiser wenden kann.
In der Folgezeit aber ist diese Überbauung des Vasalleneides durch den Untertaneneid schnell wieder gefallen und mit ihr die Einheit, Geschlossenheit und Autorität der Monarchie.
Bei der erneuten Eidesleistung im Jahre 802 für den nunmehrigen Kaiser ließ Karl eine besondere Belehrung über die aus diesem Eide entspringenden Pflichten verbreiten. Dabei wird besonders hervorgehoben, daß der Eid nicht bloß für die Lebenszeit des Kaisers binde – auch daran erkennt man wieder, daß der Vasalleneid die herrschende Vorstellung ist, aus dem jetzt der Untertaneneid neu herausgebildet wird. Denn der Vasalleneid ist seinem Begriffe nach rein persönlich, schafft keine Verbindung mit den Erben, der Familie, die vielmehr einen neuen zweiseitigen Akt erfordert. Der Untertaneneid aber gilt mit dem Monarchen zugleich seiner Dynastie, und das mußte besonders gesagt werden.
Eben jene Belehrung führt auch noch die besondere Pflicht auf, nicht kaiserliche Lehen in Eigengut zu verwandeln, was abermals auf die Vasalleneigenschaft der Schwörenden hinweist.
Schließlich sei noch bemerkt, daß zur Ausrüstung des Unfreien, der vereidigt werden soll, neben den Waffen auch das Roß gehört. Unmöglich kann gemeint sein, daß Krieger zu Fuß nicht zu schwören brauchten; auch können sie schwerlich bloß vergessen sein, vielmehr ist die Annahme, daß der Krieger der Krieger zu Roß ist. Andere gibt es nicht, oder sie kommen nicht in Betracht.
Bewaffnung und Taktik.
Über die Bewaffnung der fränkischen Krieger unter Karl widersprechen sich unsere Quellen so sehr, daß man daran ein rechtes Beispiel hat, wie wenig auf derlei Einzelheiten überhaupt zu geben ist. In dem Aufgebotsbrief an den Abt Fulrad wird vorgeschrieben, daß jeder Reiter (caballarius) ausgerüstet sein solle mit Schild, Lanze, Schwert, Halbschwert (Dolch), Bogen und Köcher mit Pfeilen. Es ist nicht genannt Helm und Panzer: wir hätten uns die karolingischen Reiter also als leichtgerüstete berittene Bogenschützen vorzustellen; dabei ist aber auffällig die Kombination des Schildes mit dem Bogen. Ein Schild ist störend bei der Handhabung des Bogens und gibt während des Spannens und Schießens nur eine sehr ungenügende Deckung; ein Panzerhemd oder ein fester Lederkoller ist für einen Bogner eine viel natürlichere Schutzwaffe.
Auch sonst ist in den Capitularien noch öfter die Ausrüstung mit dem Bogen gefordert.27 In den erzählenden Quellen kommt er aber nur selten vor.28
Die Krieger der karolingischen sowohl wie der späteren Epoche erscheinen, wie schon die älteren Germanen, als Nahkämpfer mit Schwert und Lanze und gebrauchen auch als Wurfwaffe die Lanze. Als Schutzwaffe wird zwar fast immer nur der Schild erwähnt,29 wenn aber Einhard einmal die Schwere der fränkischen Bewaffnung hervorhebt und der Mönch von St. Gallen in der berühmten Schilderung Karls des Großen und seines Heeres sie als ganz eisern erscheinen läßt, so müssen wir doch wohl auf Panzerhemden schließen. Die Capitularien verlangen eine Brünne einmal nur von Besitzern von mehr als 12 Hufen30, ein andermal in ganz unbestimmter Art.31
Vielleicht vereinigen sich diese auseinanderstrebenden Nachrichten dahin, daß Schild, Lanze und Schwert die aus Urzeiten überlieferte Forderung für die Kriegerbewaffnung war, die man formelhaft wiederholte. Die Forderung von Pfeil und Bogen wurde hinzugefügt, weil gerade diese Waffen bei den Germanen nicht eigentlich volkstümlich waren, die Heeresleitung aber Wert darauf legte, daß sie vorhanden seien. Helm und Panzerhemd dagegen wurden nicht erwähnt, da ohnehin alle, die dazu in der Lage waren, sich diese kostbaren Stücke anzuschaffen, sich gern damit versahen. Wurde einmal, wie bei der Abfassung des Capitulars von 805 daran gedacht, die Brünne besonders zu erwähnen, so wurde die Forderung einerseits auf die Wohlhabenderen eingeschränkt, für diese aber durch die besondere Strafandrohung, daß, wer eine Brünne haben, sie aber nicht einbringe, sein ganzes Lehen zusammen mit der Brünne verlieren solle, verschärft.
Daß Bogen und Pfeil wirklich auf dem Wege dieser Verordnungen zu allgemeinem Gebrauch gebracht worden sein sollten, ist nicht anzunehmen. Ein Bogen ist zwar leicht hergestellt, ein wirklich guter Bogen aber schwer, und auch ein guter Bogenschütze, namentlich aber ein Bogenschütze zu Pferd, kann nur durch sehr fleißige Übung gebildet werden.
Wie auch die einzelnen Quellenstellen zu erklären seien, so viel ist gewiß, daß wir uns die Krieger Karls des Großen in der Mehrzahl vorzustellen haben angetan mit einem mäßig schweren Panzerhemd und einem konischen Helm, ohne Visir, am linken Arm den Schild, kämpfend mit Schwert und Lanze; Pfeil und Bogen werden nur als Hilfswaffe verwandt.32
Über die Taktik der karolingischen Zeit, also hauptsächlich über die Verteilung und das Zusammenwirken der Waffen, Reiter, Bogner, Spießer, haben wir in den Quellen keine Nachrichten und könnten darüber nur aus späteren Nachrichten und Ereignissen Rückschlüsse machen. Exerziert wurde nicht, und eigentliche Schlachten waren so selten, daß sich traditionelle feste Formen für eine Schlachtordnung und eine wirkliche Kunst des Schlachtenschlagens nicht wohl bilden konnten. Schon Karls Biograph, Einhard (cap. 8) hebt hervor, daß in dem Kriege mit Sachsen, der 33 Jahre dauerte, doch nur zwei wirkliche Feldschlachten vorfielen, bei Detmold und an der Hase, beide binnen fünf Wochen im Jahre 783. Weder der Longobardenkönig Desiderius, noch Thassilo, der Bayernherzog, haben es auf eine Schlacht ankommen lassen. Eine Untersuchung über die Taktik ist also an dieser Stelle und für diese Epoche weder geboten, noch unmittelbar durchführbar.
Die karolingischen Wehrpflichts-Capitularien.
Unsere Untersuchung hat dahin geführt, daß die Träger der Wehrkraft im fränkischen Reich von der Völkerwanderung an ein numerisch sehr beschränkter Kriegerstand war. Damit sind alle Vorstellungen, daß noch Karl der Große mit einem »Bauernheer«33ins Feld gezogen sei, sei es nun, daß die Kriegspflicht auf dem Grundbesitz, sei es, daß sie auf der allgemeinen Wehrpflicht beruhte, beseitigt. Die vieluntersuchte Reform des Kriegswesens unter Karl, die den Übergang aus dem Volksheer in das Vasallenheer gebildet haben soll, hat nicht nur, wie schon BORETIUS dargetan hat, nicht stattgefunden, sondern die allmähliche Wandlung des altgermanischen Volksheeres in ein Vasallenheer ist schon unter Karl bis auf gewisse Reste vollendet gewesen. Diesen in dem vorstehenden Kapitel durchgeführten Satz haben wir noch an dem Wortlaut der Urkunden zu prüfen. Boretius hat im Anhang zu seinen »Beiträgen z. Capitularienkritik« die sämtlichen Capitularien über das Heerwesen zusammengestellt. Die für uns wesentlichen Stücke seien hier wiederholt, aber statt in chronologischer Reihenfolge sachlich zusammengestellt. Der Text ist gegeben nach der zweiten Auflage der Capitularien in den Monumenta Germaniae, Capitula regum Francorum denuo ediderunt Alfred Boretius et Victor Krause.
Aus dem allgemeinen Capitulare missorum des Jahres 802. M. G. I, 93.
7. Ut ostile bannum domni imperatori nemo pretermittere presumat nullusque comis tam presumtiosum sit, ut ullum de his qui hostem facere debiti sunt exinde vel alique propinquitatis defensionem vel cuius muneris adolationem dimittere audeant.
Daß »hi qui hostem facere debiti sunt« prinzipiell nicht weniger als alle freien Männer sind, ist heute allgemein anerkannt. Keinen von diesen soll, nach dem Wortlaut des vorliegenden Capitulars, der Graf zu Hause lassen.
Es ist klar, daß wir hier nur eine Kanzleiformel ohne jeden realen Inhalt vor uns haben. Denn in Wahrheit kann immer nur ein Bruchteil, aus einer vorwiegend germanischen Grafschaft sogar nur ein geringer Bruchteil der freien Männer wirklich ausziehen.
Eine Möglichkeit praktischer Durchführung scheinen die Capitularien zu bieten, die die Verpflichteten in Gruppen zusammenfassen.
Aus einem Capitular für die Gebiete westlich der Seine.807. M. G. I, 134.
Memoratorium qualiter ordinavimus propter famis inopiam, ut de ultra Sequane omnes exercitare debeant.
In primis quicunque beneficia habere videntur omnes in hostem veniant.
Quicumque liber mansos quinque de proprietate habere videtur, similiter in hostem veniat, et qui quattuor mansos habeat similiter faciat. Qui tres habere videtur similiter agat. Ubicumque autem inventi fuerint duo, quorum unusquisque duos mansos habere videtur, unus alium praeparare faciat; et qui melius ex ipsis potuerit, in hostem veniat. Et ubi inventi fuerint duo, quorum unus habeat duos mansos, et alter habeat unum mansum, similiter se sociare faciant et unus alterum praeparet; et qui melius potuerit in hostem veniat. Ubicumque autem tres fuerint inventi, quorum unusquisque mansum unum habeat, duo tercium praeparare faciant; ex quibus qui melius potest in hostem veniat. Illi vero pui dimidium mansum habent, quinque sextum praeparare faciant. Et qui sic pauper inventus fuerit, qui nec mancipia nec proopriam possessionem terrarum habeat, tamen in praecio valente [? quinque libras?], quinque sextum praeparent. [Et ubi duo tercium de illis qui parvulas possessiones de terra habere videntur;]34Et unicuique ex ipsis qui in hoste pergunt, fiant conjectati solidi quinque a suprascriptis pauperioribus qui nullam possessionem habere videntur in terra.Et pro hac consideratione nullus suum seniorem dimittat.
Dieses Capitular gibt zunächst ein Rätsel auf durch die Einleitung: »propter famis inopiam« sollen jenseits (westlich) der Seine Alle ausziehen! Boretius (Beitr., S. 118) hat das so auslegen wollen, daß bei einer allgemeinen Hungersnot die Gebiete westlich der Seine am besten dran gewesen wären und deshalb auf diese die Kriegslast des Jahres gelegt worden sei. Das scheint mir denn doch ganz unmöglich, besonders da nun unmittelbar die speziellen Vorschriften folgen, wonach gerade nicht alle, sondern nur gewisse Quoten ausziehen sollen. Ich möchte annehmen, daß in der Überschrift einfach ein »non« vor omnes ausgefallen ist.
Die Inhaber von Lehen sollen alle ausziehen, ebenso alle Freien, die mehr als fünf oder vier oder drei Hufen im Eigentum haben. Zwei mit je zwei Hufen sollen einen ausrüsten; es kann auch einer mit zwei und einer mit einer Hufe zusammengestellt werden. Von drei Hufenbesitzern sollen immer je zwei den dritten ausrüsten, von sechs Halbhufenbesitzern fünf den sechsten. Von den Nicht-Grundbesitzern sollen ebenfalls Gruppen von sechs gebildet werden und einen ausrüsten. Das Vermögen, das dabei zugrunde gelegt wird, ist nicht sicher überliefert, vermutlich fünf Pfund oder 100 Solidi; der Ausziehende soll fünf Solidi mitbekommen.
Capitulare missorum von 808. M. G. I, 137.
1. Ut omnis liber homo qui quattuor mansos vestitos de proprio suo sive de alicuius beneficio habet, ipse se praeparet et per se in hostem pergat, sive cum seniore suo si senior eius perrexerit, sive cum comite suo.Qui vero tres mansos de proprio habuerit, huic adiungatur qui unum mansum habeat et det illi adjutorium ut ille pro ambobus possit. Qui autem duos habet de proprio tantum, iungatur illi alter qui similiter duos mansos habeat, et unus ex eis altero illum adjuvante, pergat in hostem. Qui etiam tantum unum mansum de proprio habet, adjungatur ei tres qui similiter habeant et dent ei adjutorium et ille pergat tantum; tres vero qui ille adjutorium dederunt, domi remaneant.
Dieses Capitular ist dem vorigen zwar ähnlich, weicht aber in allen Einzelheiten auffällig von ihm ab. In dem vorigen ist eine Einheit von drei Hufen zugrunde gelegt, in diesem vier; im vorigen sind auch die Nicht-Grundbesitzer herangezogen, in diesem nicht; im vorigen sollen die Lehnsleute alle ausziehen, in diesem je nach Besitz.
Capitular ungewissen Ursprungs, wohl 807 oder 808.M. G. I, S. 136.
2. Si partibus Hispaniae sive Avariae solatium ferre fuerit necesse praebendi, tunc de Saxonibus quinque sextum praeparare faciant. Et si partibus Beheim fuerit necesse solatium ferre, duo tercium praeparent. Si vero circa Surabis patria defendenda necessitas fuerit, tunc omnes generaliter veniant.
3. De Frisionibus volumus, ut comites et vasalli nostri, qui beneficia habere videntur, et caballarii, omnes generaliter ad placitum nostrum veniant bene praeparati.Reliqui vero pauperiores; sex septimum praeparare faciant, et sic ad condictum placitum bene praeparati hostiliter veniant.
Die Stammrollen-Vorschriften aus dem Jahre 829 in vier Fassungen.M. G. II, S. 7, cap. 7, S. 10, cap. 5, S. 19, cap. 7.
Volumus atque jubemus, ut missi nostri diligenter inquirant, quanti homines liberi in singulis comitatibus maneant, qui possint expeditionem per se facere vel quanti de his, quibus unus alium adiuvet, quanti etiam de his, pui a duobus tertius adiuvetur et praeparetur, necnon de his, qui a tribus quartus adiuvetur et praeparetur sive de his, qui a quattuor quintus adiuvetur et praeparetur eandem expeditionem exercitalem facere possint, et eorum summam ad nostram notitiam deferant.
Volumus atque jubemus, ut missi nostri diligenter inquirant, quanti homines liberi in singulis comitatibus maneant, qui possint expeditionem exercitalem per se facere vel quanti de his qui a duobus tertius adiutus et praeparatus, et de his qui a tribus quartus adiutus et praeparatus, et de his qui a quattuor quintus vel sextus adiutus et praeparatus ad expeditionem exercitalem facere, nobisque brevem eorum summam deferant.
Volumus atque jubemus, ut missi nostri diligenter inquirant, quanti liberi homines in sigulis comitatibus maneant. Hinc vero ea diligentia et haec ratio examinetur per singulas contenas, ut veraciter sciant illos atque describant, qui in exercitalem ire possunt expeditionem; ac deinde videlicet secundum ordinem de his qui per se ire non possunt ut duo tertio adiutorium praeparent.Et qui necdum nobis fidelitatem promiserunt cum sacramento nobis fidelitatem promittere faciant.
Volumus35atque iubemus, ut missi nostri diligenter inquirant, quanti liberi homines in singulis comitatibus maneant, qui possint expeditionem exercitalem facere nobisque per brevem eorum summam deferant.Et qui nondum fidelitatem promiserunt cum sacramento nobis fidelitatem promittere faciant.
Die vorstehenden Capitularien sind seit Boretius so aufgefaßt worden, daß es sich zunächst um singuläre Bestimmungen handelt, die Jahr für Jahr in ähnlicher Weise erlassen und annähernd so auch ausgeführt wurden, bis dann in der »Stammrolle« von 829 eine allgemeine Ordnung versucht wurde, die freilich keinen Erfolg hatte, da ja sehr bald das direkte Aufgebot der Freien überhaupt verschwand. Noch Karl der Kahle wiederholte aber im Jahre 864 (Capitulare Pistense M. G. II, 321) die Bestimmungen über die Stammrolle (nach der ersten Fassung).
Von den für die Sachsen und Friesen erlassenen Bestimmungen muß es dahingestellt bleiben, in welchem Zusammenhang sie erlassen wurden, ob es sich um eine singuläre Bestimmung handelt, oder ob eine dauernde Vorschrift beabsichtigt wird.
Daß die anderen Capitularien nicht als Gesetze, sondern als singuläre Bestimmungen aufzufassen sind, unterliegt keinem Zweifel, aber der Vorstellung, daß sie ihrem Wortlaut entsprechend ausgeführt worden seien, stehen andere Capitularien entgegen.
Schon in dem oben abgedruckten Capitular von 808 haben wir gefunden, daß von dem Mann, der ausrückt, vorausgesetzt wird, daß er einen Senior habe. Ebenso heißt es im Capitular von Boulogne von 811 cap. 9 (M. G. I, 167), quicumque liber homo inventus fuerit anno praesente cum seniore in hoste non fuisse, plenum heribanum persolvere cogatur. Hiernach gibt es keinen freien Krieger, der nicht seinen Senior habe, also Vasall sei. Wenn das Capitular fortfährt »Et si senior vel comis illius eum domi dimiserit, ipse pro eo bannum persolvat«, so heißt das offenbar nicht, daß der Mann entweder unter seinem Senior oder unter dem Grafen stehe, sondern nur, daß sowohl jener als dieser die Durchstecherei gemacht haben kann. Dasselbe ist zu entnehmen aus dem Capitulare von 819 § 27 M. G. I, 291; unten S. 40; von Boretius Beitr. als Capitulare von 817 bezeichnet), wo von Heerversäumnissen freier Männer gar nicht, sondern nur von den Bußen der Vasallen die Rede ist, und auf dem Tage in Meersen i. J. 847 verfügte Karl der Kahle:
»Volumus etiam, ut unus quisque liber homo in nostro regno seniorem, qualem voluerit in nobis et in nostris fidelibus accipiat.«
»Mandamus etiam, ut nullus homo seniorem suum sine justa ratione dimittat nec aliquis eum recipiat nisi sicut tempore antecessorum nostrorum consuetudo fuit.«
Der Wortlaut unserer Urkunden ergibt also auf der einen Seite im Turnus abwechselnde Bauernaufgebote, auf der anderen ausschließlich ein Vasallenaufgebot. Das sind Institutionen, die sich gegenseitig ausschließen. Man könnte sich zur Not ein Vasallenheer vorstellen, ergänzt durch ein Bauernaufgebot. Ein Heer aber, von dem vorausgesetzt wird, daß jeder Krieger in ihm seinen Senior habe und die Krieger doch freie Männer genannt werden, enthält überhaupt keine Bauern, denn der Bauer, der einen Senior hat, ist nicht mehr frei; wer einen Senior hat und zugleich frei ist, ist Krieger. Wie ist der Widerspruch zu heben?
Am handgreiflichsten ist der Widerspruch der urkundlichen Aussagen untereinander in den Edikten Karls des Kahlen. Hier finden wir deshalb auch die Lösung: es ist klar, daß, wenn das Ediktum Pistense von 864 eine alte Vorschrift über Gruppenbildung wiederholt, das eine bloße Reminiszenz ist. Derselbe König, der dieses Edikt erließ, hatte ja schon lange vorher zu Meersen angeordnet, daß jeder freie Mann seinen Senior haben solle, und dasselbe Pistense, das in dem einen Kapitel die Gruppenbildung verlangt, schreibt in einem anderen (cap. 26) vor, daß alle Franken, die Pferde haben oder haben können, mit ihren Grafen ins Feld ziehen sollen. Die eine Vorschrift ist so sehr wie die andere ein bloßes Wortemachen, uns nur lehrreich als Beispiel, wie unsicher der Schluß von Gesetzen auf wirkliche Zustände ist. Ich erinnere an die im vorigen Bande erörterten ebenso hohlen Kriegsgesetze der Westgothen, und verweise auf die Wehr-Assisen des Plantagenets unter Buch II cap. 5.