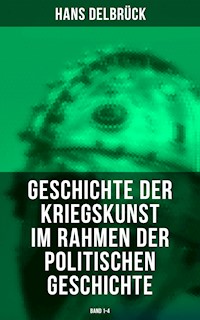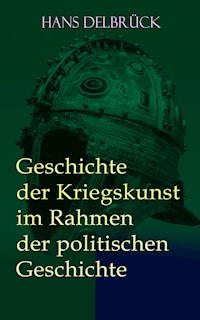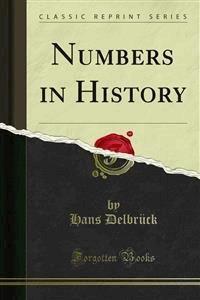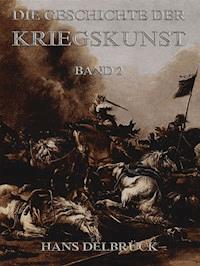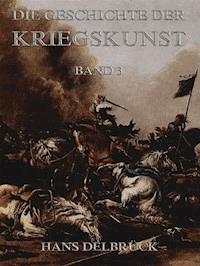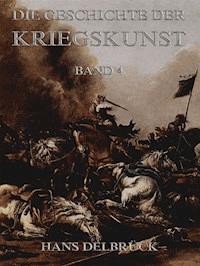
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Die Geschichte der Kriegskunst" von Hans Delbrück (4 Bände) gehört zu den umfassendsten und besten Werke zur Militärgeschichte und Kriegskunst. Sehr detailliert und verständlich werden die Geheimnisse der Kriegsführung durch viele Jahrhunderte aufgearbeitet. Inhalt: Vorwort. Das Kriegswesen der Renaissance. Die Bildung einer europäischen Infanterie. Die Feuerwaffe. Die Taktik der Spießerhaufen. Die innere Verfassung der Söldnerheere. Einzelne Schlachten. Machiavelli. Das Zeitalter der Religionskriege. Die Umbildung der Ritterschaft in Kavallerie. Vermehrung der Schützen. Verfeinerung der Infanterietaktik. Moritz von Oranien. Gustav Adolf. Cromwell. Einzelne Schlachten. Die Epoche der stehenden Heere. Frankreich. Brandenburg-Preußen. Exerzieren. Abwandlungen der Taktik im 18. Jahrhundert. Strategie. Strategische Skizzen und einzelne Schlachten. Friedrich als Stratege. Die Epoche der Volksheere. Revolution und Invasion. Die Revolutionsheere. Napoleonische Strategie. Scharnhorst, Gneisenau, Clausewitz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 897
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geschichte der Kriegskunst - 4. Teil. Die Neuzeit
Hans Delbrück
Inhalt:
Hans Delbrück – Biografie und Bibliografie
Geschichte der Kriegskunst - 4. Teil. Die Neuzeit
Vorwort.
Das Kriegswesen der Renaissance.
Die Bildung einer europäischen Infanterie.
Die Niederländer und die Schlacht bei Guinegate.
Die Landsknechte
Die Feuerwaffe.
Die Taktik der Spießerhaufen.
Die innere Verfassung der Söldnerheere88.
Einzelne Schlachten.
Die Schlacht bei Ravenna
Die Schlacht bei Novara
Die Schlacht bei Bicocca
Die Schlacht bei Pavia
Die Schlacht bei Ceresole
Machiavelli.
Das Zeitalter der Religionskriege.
Die Umbildung der Ritterschaft in Kavallerie133.
Vermehrung der Schützen.
Verfeinerung der Infanterietaktik.
Moritz von Oranien.
Gustav Adolf.
Cromwell.
Einzelne Schlachten.
Schlacht bei St. Quentin.
Schlacht am Weißen Berge
Schlacht bei Breitenfeld
Schlacht bei Lützen
Die Schlacht bei Nördlingen
Schlacht bei Wittstock
Die Epoche der stehenden Heere.
Frankreich.
Brandenburg-Preußen.
Exerzieren. Abwandlungen der Taktik im 18. Jahrhundert.
Strategie.
Strategische Skizzen und einzelne Schlachten.
Die Schlacht bei Höchstädt.
Die Schlacht bei Turin
Die Schlacht bei Malplaquet
1741
Kunersdorf
Friedrich als Stratege.
Die Epoche der Volksheere.
Revolution und Invasion.
Die Revolutionsheere.
Napoleonische Strategie500.
Scharnhorst, Gneisenau, Clausewitz.
Geschichte der Kriegskunst, Band 4, Hans Delbrück
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849609405
www.jazzybee-verlag.de
Hans Delbrück – Biografie und Bibliografie
Deutscher Historiker, geb. 11. Nov. 1848 in Bergen (Insel Rügen), verstorben am 14. Juli 1929 in Berlin. Studierte Geschichte in Heidelberg, Greifswald und Bonn und wurde, nachdem er den Feldzug von 1870 mitgemacht hatte, 1874 Erzieher des Prinzen Waldemar von Preußen, dritten Sohns des damaligen Kronprinzen, in welcher Stellung er bis zum Tode des Prinzen (27. März 1879) verblieb. 1881 habilitierte er sich in Berlin, wurde 1885 außerordentlicher und 1896 ordentlicher Professor. 1882–1885 gehörte er dem Abgeordnetenhaus, 1884–90 dem Reichstag an, wo er sich der Reichspartei anschloss. Seine bekanntesten Schriften sind: »Leben des Feldmarschalls Grafen Neithardt von Gneisenau« (Berl. 1880, Bd. 4 u. 5 des von G. I. Pertz unvollendet hinterlassenen Werkes); eine kürzere selbständige Biographie unter gleichem Titel (das. 1882, 2 Bde.; 2. Aufl. 1894); »Die Perserkriege und die Burgunderkriege« (das. 1886); »Historische und politische Aufsätze« (das. 1887) und als deren Fortsetzung »Erinnerungen, Aufsätze und Reden« (das. 1903); »Die Strategie des Perikles, erläutert durch die Strategie Friedrichs des Großen« (das. 1890); »Friedrich, Napoleon, Moltke, ältere und neuere Strategie« (das. 1892); »Die Polenfrage« (das. 1894); »Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte« (das. 1900–1902, 2 Bde.). 1882–83 gab D. mit G. zu Putlitz die »Politische Wochenschrift« heraus, trat aber 1883 in die Redaktion der »Preußischen Jahrbücher« ein, die er seit 1889 allein führt. 1885–1893 gab D. auch den von Schultheß 1860 begründeten »Europäischen Geschichtskalender« heraus. Mit Adolf Harnack veröffentlichte er die Broschüre »Evangelisch-sozial« (Berl. 1896).
Geschichte der Kriegskunst - 4. Teil. Die Neuzeit
Vorwort.
Dieser vierte und letzte Band der »Geschichte der Kriegskunst« erscheint in dem Jahre, in dem der größte aller Kriege zu Ende ging. Schon im Jahre 1914 war er der Forschung noch so gut wie vollendet und auch zum großen Teil schon ausgearbeitet. Aber der äußere Sturm, statt, wie man vielleicht meinen könnte, mich fortzureißen zur Vollendung gerade dieser Aufgabe, Ausarbeitung dieses Themas, lenkte mich ab und ich habe die Arbeit unterbrochen, um sie endlich zu Ende zu führen, ohne zwischen ihr und der Gegenwart eine Brücke zu schlagen. Wenn in diesem Buche von den Verhältnissen unserer Zeit die Rede ist, so ist damit die Zeit vor dem Weltkriege gemeint, wo die Worte geschrieben wurden, manchmal auch die Zeit, wo ich selber das Kriegswesen praktisch kennen gelernt habe (ich bin im Jahre 1867 Soldat geworden und habe als Premier-Leutnant der Reserve 1885 den Abschied genommen).
Ich habe ursprünglich wohl gedacht, das Werk in den deutschen Einigungskriegen auslaufen zu lassen und noch die Fortentwicklung der Napoleonischen Strategie durch die Moltkesche darzustellen. Aber ich habe diesen Gedanken fallen lassen, da er sofort in die Probleme des Weltkrieges hineingeführt haben würde, die für eine wissenschaftliche Behandlung im Sinne dieses Werkes noch nicht reif sind. Das soll nicht heißen, daß ich der neuesten Zeit überhaupt noch keine Betrachtung zu widmen wagte, sondern nur, daß es noch nicht in der systematischen, abgeschlossenen Weise geschehen kann, wie es ein Werk von der Art des vorliegenden erfordert. Deshalb bricht dieses Werk mit Napoleon und seinen Zeitgenossen ab. Die Fortsetzung bis auf die Gegenwart aber ist bereits da, wenn auch in anderer Form. Was ich über die kriegsgeschichtlichen Erscheinungen des späteren 19. Jahrhunderts, im besonderen über die Strategie Moltkes und endlich über die Erscheinungen des Weltkrieges zu sagen habe und zu sagen vermochte, ist in einzelnen Aufsätzen und in der gleichzeitig mit diesem Buch erscheinenden Sammlung »Krieg und Politik«, 1914 bis 1918 (drei Bände) niedergelegt. Die Moltke-Aufsätze stehen in der Sammlung »Erinnerungen, Aufsätze und Reden«, ergänzt durch einen Artikel über Caemmerers »Entwicklung der Strategischen Wissenschaft im 19. Jahrhundert«, in den »Preuß. Jahrbüchern«, Bd. 115, S. 347 (1904). Hier ist im Anschluß an Schlichting der neue Gedanke Moltkes, der strategische Anmarsch aus zwei Fronten, den dann Schlieffen im Anschluß an meine Analyse der Schlacht bei Cannä zu der Idee der doppelten Umfassung fortgebildet hat, des Breiteren dargelegt und technisch wie psychologisch begründet, und das leitet über in die strategischen Betrachtungen, mit denen ich die Ereignisse des Weltkrieges begleitet habe.
Die Natur der Dinge brachte es mit sich, daß ich das Technische des Kriegswesens, der Bewaffnung wie der Taktik, bei der Behandlung der Neuzeit ganz zurücktreten lassen konnte, nicht weil es weniger zu bedeuten hätte, als früher, im Gegenteil, es ist ja nur immer schneller und immer gewaltiger angewachsen, sondern weil es in seinem Wesen und seiner Bedeutung so klar zutage liegt, daß es keiner Untersuchungen mehr bedarf, reichliche Literatur darüber vorhanden ist und ich mich also begnügen durfte, das praktische Ergebnis festzustellen. Ich durfte mich um so mehr auf das Notwendigste beschränken, als die unschätzbare »Geschichte der Kriegswissenschaften« von MAX JÄHNS dem Suchenden für weitere Belehrung das wohlgeordnete Material darbietet. Bei dieser Einschränkung des Technischen war es mir, wie ich hoffe, um so mehr möglich, den Grundgedanken des Werkes, den Zusammenhang zwischen Staatsverfassung, Taktik und Strategie, »Die Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte«, wie der Titel lautet, plastisch herauszuarbeiten. Die Erkenntnis der Wechselwirkung zwischen Taktik, Strategie, Staatsverfassung und Politik wirft ihr Licht auf den Zusammenhang der Universalgeschichte und hat Vieles, was bisher im Dunkel lag oder verkannt wurde, aufgehellt. Nicht um der Kriegskunst willen ist dieses Werk geschrieben worden, sondern um der Weltgeschichte willen. Wenn Militärs es lesen und daraus Anregungen entnehmen, so kann mir das nur recht sein und ist mir eine Ehre; geschrieben aber ist es für Geschichtsfreunde von einem Historiker. Ich würde sogar nichts dagegen haben, wenn man dieses Werk, das den Krieg behandelt und noch dazu ausdrücklich im Rahmen der politischen Geschichte, doch in die Kategorie der kulturgeschichtlichen Werke einordnen wollte. Denn die Kriegskunst ist eine Kunst wie die Malerei, die Baukunst oder die Pädagogik, und das ganze kulturelle Dasein der Völker wird in hohem Grade bestimmt durch ihre Kriegsverfassungen, die wiederum mit der Technik des Krieges, der Taktik und Strategie zusammenhängen. Alles steht in Wechselwirkung miteinander, der Geist jeder Epoche offenbart sich in ihren vielseitigen Einzelerscheinungen, und die Erkenntnis jedes einzelnen, wie in meinem Falle der Kriegskunst, fördert die Erkenntnis der Menschheits-Entwicklung im ganzen. Keine weltgeschichtliche Epoche, die nicht in ihren Fundamenten durch die Ergebnisse dieser Arbeit berührt würde. Aber es hat Mühe und auch Kampf gekostet, die Idee, daß auf diesem Wege etwas zu gewinnen sei, durchzusetzen. Selbst Leopold Ranke lehnte ihn direkt ab, als ich ihm einmal meinen Plan vortrug; die Fakultät, der ich jetzt die Ehre habe, anzugehören, machte mir Schwierigkeiten bei der Habilitation, da das Kriegswesen nicht auf die Universität gehöre, und Theodor Mommsen, als ich ihm den ersten Band überreicht hatte, der doch recht tief in die alte und besonders in die römische Geschichte eingreift, erklärte mir bei seinem Dank, seine Zeit werde ihm doch wohl kaum erlauben, dieses Buch zu lesen. Da ich auf der anderen Seite auch den Generalstab gegen mich hatte, so wird man mir zugestehen, daß mein Kampf nicht leicht war. Niemand, der dafür bekannt war, mein Schüler zu sein, durfte Lehrer an der Kriegsakademie werden, und Historiker, die sich von dem Zutreffenden meiner Forschungs-Ergebnisse überzeugt hatten, waren doch vorsichtig genug, das möglichst wenig merken zu lassen. Bei Anderen habe ich es, wie man sehen wird, bis in die neueste Zeit nicht erreichen können, daß sie meine Auffassung auch nur richtig wiedergaben. Neue Ideen haben sich durchzusetzen nicht nur gegen den zähen Widerstand des Überlieferten, sondern auch gegen das fast noch unbelehrbarere Mißverständnis.
Wie ich bei der Herausgabe des ersten Bandes einst in der Vorrede das Werk von JULIUS BELOCH, »Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt« nennen mußte, als eine Arbeit, die der meinigen notwendig vorangehen mußte, so darf ich auch diesmal nicht unterlassen, schon hier ein Werk zu nennen, das ebenso sehr eine unerläßliche Vorarbeit, wie die wertvollste Ergänzung dieses Bandes bildet. Es ist »Macchiavellis Renaissance der Kriegskunst« von MARTIN HOBOHM. Ich habe mir die Ergebnisse dieser ebenso gelehrten, wie glänzend geschriebenen Arbeit vollständig zu eigen machen können, und Herr Dr. Hobohm hat mich auch weiter durch Sammlung von Material für die Fortführung der Forschung sehr wesentlich unterstützt. Neben Herrn Dr. Hobohm bin ich Herrn Dr. Siegfried Mette für seine Beihilfe beim Lesen der Korrektur und Herstellung des Registers zu Danke verpflichtet.
Berlin-Grunewald, den 7. August 1919.
Hans Delbrück
Erstes Buch. Das Kriegswesen der Renaissance.
Erstes Kapitel.
Die Bildung einer europäischen Infanterie.
Die erstaunliche Kraft des schweizerischen Kriegertums beruhte auf der Massenwirkung der großen geschlossenen Haufen, in denen jeder Einzelne erfüllt ist von dem durch zweihundert Jahre ununterbrochener Siege genährten Selbstvertrauen. Die durch das ganze Volk verbreitete kriegerische Gesinnung machte es möglich, es als Menge in den Kampf zu führen, und die Massenbildung wiederum wuchtete alle noch so große persönliche Tapferkeit des alten Berufskriegertums nieder. Mit der Schlacht bei Nancy war dieses schweizerische Massenkriegertum aus den Bergen, die ihm für seine bisherigen Siege so wesentliche Bundesgenossen gewesen waren, herausgetreten. Wie schon in dem Kriege, der schließlich bei Branson und Murten entschieden wurde, die Eidgenossen mehr für den König von Frankreich als für ihr eigenes politisches Interesse gefochten hatten, so fing jetzt ihre militärische Kraft an, auch fern von der Heimat in fremden Diensten wirksam zu werden. Schon hierdurch übte dieser kleine Bruchteil eines deutschen Stammes eine wesentliche geschichtliche Wirkung aus; noch viel größer aber, weltgeschichtlich umgestaltend wurde diese Wirkung, indem nun die anderen Völker, die Überlegenheit des schweizerischen Kriegswesens erkennend, es nachzuahmen begannen.
Schon sehr lange hatte es ja neben der schweren, gepanzerten Reiterei nicht bloß Schützen, sondern auch Fußknechte mit blanker Waffe gegeben, die die Ritter im Kampfe unterstützten. Der Fortschritt, der zu machen und die Reform, die zu vollziehen war, bestand darin, diese Fußknechte, die bisher nur Hilfswaffe gewesen waren, sehr vermehrt zu festgeschlossenen Haufen zusammenzuballen.
Voll gelungen ist dieser Fortschritt zunächst nur bei zwei Völkern, den Deutschen und den Spaniern; bei den Franzosen und den Italienern finden wir wohl Ansätze dazu, aber sie sind nicht oder erst später zur Ausbildung gelangt. Das ist gewiß ein sehr merkwürdiger Unterschied, dem eine besondere Betrachtung zu widmen sein wird. Zunächst aber wenden wir uns der Aufhellung der ersten positiven Erscheinung der neuen Zeit zu, die sich auf deutschem Boden vollzieht.
Die Niederländer und die Schlacht bei Guinegate.1.
7. August 1479
Die erste Schlacht, in der die schweizerische Kriegsweise von Nicht-Schweizern angewandt erscheint, ist die Schlacht bei Guinegate, in der 21/2 Jahre nach der Schlacht bei Nanch Erzherzog Maximilian, der Schwiegersohn Karls des Kühnen, ein französisches Heer besiegte – gerade die Burgunder also, die die schweizerische Überlegenheit so sehr am eigenen Leibe erfahren hatten, sind es gewesen, die den ersten und erfolgreichen Versuch machten, diese taktische Kunst nunmehr selber auszuüben.
Maximilian belagerte die kleine Grenzfestung Therouanne und ging einem französischen Entsatzheer, das unter des Cordes von Süden heranzog, entgegen, um es zurückzuwerfen. Das französische Heer bestand in der bis dahin üblichen Weise aus Rittern und Schützen; neben den den einzelnen Rittern zugeteilten Schützen bei Ordonnanz-Kompagnien auch aus zahlreichen Landesschützen (Francs archers). Maximilian war in diesen beiden Waffen erheblich schwächer, hatte aber dafür nicht weniger als 11000 Fußknechte mit blanken Waffen, Spießen und Hellebarden, die ihm Jean Dadizelle, Bailli von Gent und Generalkapitän von Flandern, herangeführt hatte. Maximilian war erst 20 Jahre alt und hatte selber weder die Erfahrung, noch hier in den Landen seiner Gemahlin die Autorität, um das neue Kriegswesen zu schaffen. Aber in seinem Heer war der Graf v. Romont, dessen Besitzungen in der unmittelbaren Nachbarschaft von Bern und Freiburg am Neuenburger See lagen. Im Dienste des Burgunder-Herzogs hatte er die Schlachten gegen die Schweizer mitgeschlagen. Sehr gegen seinen Wunsch und seinen Willen war er ihr Feind geworden; niemand kannte sie im Frieden und im Kriege besser als er. Dieser schweizerische Graf ist es gewesen, der nach dem Zeugnis der Quellen jetzt die flämischen Knechte nach der schweizerischen Art aufstellte. Wir werden annehmen dürfen, daß er es auch gewesen ist, der seinem jetzigen Herrn den Rat gab, sich in Waffen mit solchen Fußknechten zu versehen, und nirgends in der Welt konnte er einen besseren Stoff für die Neugestaltung vorfinden, als eben in den burgundischen Niederlanden. Hier hatte ja schon einmal ein Kriegswesen ganz ähnlich dem Schweizerischen sich aufgetan, als die aufständischen flämischen Städte die französische Ritterschaft in der Schlacht bei Courtray (1302) niederwarfen. Bei Rosebeke (1382) war dieses Kriegertum wieder zugrundegegangen, weil ihm in der flandrischen Ebene gegenüber den Rittern die Gelände-Stützpunkte, die den Schweizern ihre Berge gewährten, fehlten. Immer aber hatte sich viel Kriegertum und viel kriegerischer Sinn in diesen Landschaften erhalten; auch die Heere Karls des Kühnen bestanden zum großen Teil aus Niederländern, und das Schweizer Muster gab nun die Form, in der dieser kriegerische Geist sich von neuem realisieren konnte.
Im Ganzen wird das burgundische Heer um einige Tausend Mann stärker gewesen sein, als das französische, selbst wenn man diesen die Besatzung von Therouanne zuzählt, 4000 Mann, die während der Schlacht die Burgunder im Rücken bedrohten.
Beide Heere hatten die Reiter auf den Flügeln, das Fußvolk, hier Schützen, dort vorwiegend Pikeniere im Zentrum. Die burgundischen Pikeniere waren in zwei große, tiefe Haufen geteilt, deren einen der Graf Engelbert von Nassau, der unter Karl dem Kühnen bei Nanch mitgefochten hatte, deren andern der Graf von Romont führte, und statt nach der überlieferten Rittersitte mit den Rittern zu fechten, trat Maximilian selbst mit einer Anzahl von Edelleuten2 mit dem Spieß in der Hand bei diesen Haufen ein. Maximilian selbst erzählt uns in seinen Memoiren, daß er, nachdem er als junger Fürst in die Niederlande gekommen, lange Spieße habe anfertigen lassen und Waffenübungen ausgeführt habe. So zu sagen systematisch ist also das Fußvolk ausgebildet worden: lange Spieße, eingetretene Edelleute und Übungen. Daß man durch den Eintritt von Edelleuten, die natürlich im ersten Gliede standen, den Haufen der Fußknechte festzumachen suchte, ist ein Vorgang, den wir im späten Mittelalter schon öfter gefunden haben. Der Unterschied, der wesentliche Unterschied aber ist, daß sie jetzt mit dem Langspieß auch die Waffe der Fußknechte annehmen und diesen nicht bloß vorkämpfen, sondern mit ihnen zu einem einheitlichen, taktischen Körper verschmelzen. »Da erstelde«, meldet uns die »Allerexcellentste Cronyk«, »der grave van Romont tvolc im ordinancien unde dade den hertoghe (Maximilian) staan onder dat volc te voet ende onder den pyken.«
Des Cordes gelang es nun, auf dem einem, seinem rechten Flügel, die die Infanteriehaufen begleitenden burgundischen Ritter zu werfen und auch die dort aufgestellten burgundischen Geschütze zu nehmen. Die burgundischen Schützen, obgleich auch ziemlich zahlreich, werden in dem Gefecht gar nicht erwähnt; sie werden vor der französischen Überlegenheit sofort gewichen und entweder geflohen sein oder sich in die Pikenierhaufen gedrängt haben.
Der Sieg seiner Ritter gab des Cordes die Möglichkeit, den linken, von Nassau geführten Pikenierhaufen der Burgunder aus der Flanke anzugreifen. Er brachte ihn dadurch zum Stehen und indem nun die französischen Schützen ihn sowohl von vorne wie von der Seite beschossen und sogar durch die eroberten burgundischen Kanonen unterstützt wurden, in große Bedrängnis, obgleich die Mehrzahl der siegreichen französischen Ritter, statt sich an diesem Kampfe zu beteiligen, den geflohenen burgundischen Rittern nachsetzte und sich dadurch vom Schlachtfelde entfernte.
Wenn der Verlauf auf dem anderen Flügel der gleiche gewesen wäre, hätten die Burgunder unterliegen müssen. Aber hier hielt sich der größere Teil der Ritterschaft gegenüber der französischen und ließ diese nicht den Pikenieren in die Flanke kommen. Der Romant'sche Haufen blieb also im Vordringen, jagte die französischen Schützen in die Flucht, entlastete und befreite dadurch auch den anderen Haufen und entschied die Schlacht.
Einen zeitgenössischen Bericht, der uns mit präzisen Worten sagte, daß wir in den Infanteriehaufen bei Guinegate die übertragene Schweizer Taktik haben, haben wir nicht. Namentlich steht nichts dergleichen in den nicht weniger als vier Berichten über die Schlacht, die von Maximilian selbst herrühren aber auf ihn zurückgeführt werden können. So auffällig das auf den ersten Blick erscheint, so ist es doch nicht so ganz selten, daß Zeitgenossen sich des Moments einer prinzipiellen Abwandlung nicht bewußt werden und erst die Nachwelt die Bedeutung dieses Moments erkennt. In der Kriegsgeschichte des Altertums z.B. haben wir ja gefunden, daß eine so fundamentale Reform wie die Treffenbildung während des zweiten punischen Krieges von den Quellen direkt gar nicht erwähnt wird. Nichts destoweniger ist hier, wie dort der Tatbestand völlig sicher. Dadizeele, Molinet, de But und Basin stimmen darin überein, daß das flämische Fußvolk den Sieg entschieden habe. »Dux Maximilianu, sagt de But, cum picariis fortiter instabat, ut equitatus Francorum, qui ab utraque parte cum aliis suis obpugnare quaerebat eundem, non posset in eum praevalere« und noch anschaulicher Basin: Die flämischen Fußknechte mit ihren langen Spießen wehrten das Eindringen der feindlichen Reiter ab.Nam ipsi Flamingi pedites, cum suis longis contis praeacutis ferramentis communitis, quos vulgo piken appellant, hostium equites, ne intra se se immitterent, viriliter arcebant.
Es gehörte zu dem Siege aber auch, wie nicht zu übersehen, daß wenigstens dem einen burgundischen Pikenierhaufen die Ritterschaft die Flanke deckte. Wäre das nicht geschehen, so hätte das flämische Fußvolk die Schlacht verlieren können, wie einst die von Rosebeke.
Bisher unerklärt ist, daß der Sieg nicht etwa den Fall von Therouanne zur Folge hatte, sondern das Maximilian den Feldzug aufgab und sein Heer entließ. Wäre der Verlauf und Ausgang der Schlacht nicht so vielfältig und sicher bezeugt, so würde man dem Siege überhaupt nach diesem Schlußergebnis wohl den Glauben versagen. Die Vlamen, heißt es, wollten nicht länger dienen; vermutlich ist es der alte Gegensatz zwischen dem Fürsten und den Ständen, der hier mitspielt: die Niederländer fürchteten ihren eigenen Herrn, Maximilian, nicht weniger, als die Franzosen, und wollten nicht, daß er, den Sieg verfolgend, gar zu mächtig werde. Vielleicht waren Maximilians Kassen auch so leer, daß er nicht einmal den Sold für den kleinen Heeresteil, der nunmehr für die Fortsetzung der Belagerung noch notwendig gewesen wäre, aufbringen konnte.
Politisch hat daher die Schlacht von Guinegate seine Bedeutung gewonnen; militärisch aber ist sie ein Wendepunkt. Die Bande der niederländischen Knechte, die die nächste Generation hindurch eine Rolle spielt, wird von den Siegern von Guinegate ihren Ausgang genommen haben, und den Franzosen gab die Niederlage den Anstoß zu einer Reform ihrer Kriegsverfassung, die auf Spanien hinübergewirkt haben dürfte. Vor allem aber sind diese niederländischen Knechte die Vorläufer der Landsknechte.
Die Landsknechte3.
Der Sieg bei Guinegate brachte dem Sieger keine Frucht, weil er das Heer nach dem Siege nicht mehr in der Hand hatte, und bald geriet Maximilian, der ja das Land zunächst nur als Prinzgemahl, dann, nach dem Tode seiner Frau, als Vormund seines und ihres Sohnes Philipp verwaltete, in offenen Kampf mit den Ständen. Um in diesem Kampfe zu bestehen, mußte er sich ein anderes Kriegsvolk als die Bürgeraufgebote beschaffen.
Er warb Knechte aus aller Herren Länder, aus den Niederlanden selbst, vom Rhein, aus Oberdeutschland, aus der Schweiz. Für diese Knechte ist in den Jahren 1482 bis 1486 der Name »Landsknechte« aufgekommen.
Weshalb wurden sie gerade Landsknechte genannt (provinciae servi, patriae, ministri, compagnons, du pays)? Warum nicht Fußknechte, Soldknechte, Kriegsknechte oder sonst eine Zusammensetzung? Die Bezeichnung hat sich etwa ein Jahrhundert lang, bis in den 30jährigen Krieg gehalten; dann verschwindet sie, weil der freie, seine Wirkungsstätte wechselnde Söldner in ein mehr dauerndes festes Verhältnis zu einem Staat oder Kriegsherrn trat und nach ihm benannt wurde.
Mancherlei Deutungen hat das Wort bereits erfahren, die alle abzuweisen sind. Es bedeutet nicht »Knechte des eigenen Landes« im Gegensatz zu den Schweizern, denn sie dienten mit diesen unter denselben Fahnen und in demselben Haufen. Es bedeutet auch nicht »Knechte des platten Landes« im Gegensatz zu dem Schweizer Bergland. Es bedeutet nicht »Knechte zur Verteidigung des Landes«, »Knechte, die dem Lande dienen«. Es bedeutet nicht »Knechte, die nicht von den Ständen gestellt, sondern aus dem Lande geworben sind«. Es bedeutet nicht »Knechte desselben Landes«, also »Landsknechte«. Das Wort hat auch nichts mit der »Lanze« zu tun, denn die Waffe, die diese Knechte führten, wurde »Spieß« oder »Pike« genannt4.
Das Wort »Landknecht« kommt im 15. Jahrhundert sowohl im Hoch- wie Niederdeutschen vor und bedeutet einen Büttel, Gerichtsvollzieher, Gerichtsboten, Gensdarmen zu Pferde oder zu Fuß, der auch kriegerische Funktionen übernimmt. So erzählt Joh. v. Posilge in seiner im Jahre 1417 geschriebenen Chronik, daß eine preußische Burg Bassinhayen »von etlichen Landknechten« an den Polenkönig verräterisch übergeben worden sei. Die Jahre 1482 bis 1486, in denen nun der Name in den Niederlanden seine spezifische Bedeutung erhielt, sind die Jahre, wo Maximilian mit Frankreich Frieden hatte, mit seinen Ständen aber, die ihm die vormundschaftliche Regierung für seinen Sohn Philipp aus der Hand nahmen, Krieg führte. Gerade die Söldner, die Maximilian in steigender Zahl in Dienst genommen, die bezahlt sein wollten und das Land drückten, wollten die Stände los werden. Wozu brauchte man diese Söldner? Man hatte ja Frieden. Eben deshalb wird Maximilian ihnen den harmlosen Namen »Landknechte«, der bis dahin nicht in erster Linie einen Kriegsmann, sondern bloß einen Polizisten bedeutete, gegeben haben.
Die Entwicklung vollzog sich so, daß Maximilian das bunte Gemisch seiner Söldner militärisch erzog in den taktischen Formen, die die Schweizer geschaffen hatten, und nach deren Muster die niederländischen Bürgeraufgebote schon die Schlacht bei Guinegate gewonnen hatten. Das wichtigste Mittel dieser Erziehung war nicht nur oder nicht sowohl, daß eine Anzahl Schweizer in den Soldbanden war, sondern daß der Herzog selbst den Spieß in die Hand nahm und seine Edelleute bewog, in den Haufen der Fußknechte einzutreten, um durch diese Verbrüderung ihr Selbstbewußsein zu geben und von dem im Rittertum überlieferten kriegerischen Geist einen Anhauch auf sie zu übertragen. Kaiser Maximilian, erzählten die Chronisten später, habe den Orden der Landsknechte gestiftet; das will sagen, diese Knechte in den neuen festen, auch äußerlich eingeübten Gefechtsformen, nicht mehr als bloße Hilfswaffe betrachtet, bildeten einen kriegerischen Zunft- oder Korpsgeist aus, der sie als etwas Neues erscheinen ließ und sie von den früheren Soldknechten wesentlich unterschied.
Zu den ältesten, berühmteren Landsknechtsführern gehört Martin Schwarz, der von Herkunft ein Schuhmacher aus Nürnberg war, für seine Tapferkeit zum Ritter geschlagen wurde und unter seinem Befehl Schwaben und Schweizer vereinigte; sein Benner (Fähnrich) war ein auch sonst genannter Schweizer, Hans Kuttler von Bern.
Die erste sichere Erwähnung der neuen Erscheinung unter dem in dieser Bedeutung neuen Namen finden wir in dem Protokoll einer Tagung der Eidgenossen zu Zürich vom 1. Oktober 1486, wo man sich beschwert über die Anwerbungen eines Schwäbischen Ritters in Maximilians Dienst, Konrad Gäschuff, der schmähliche Reden geführt und sich vermessen habe, er wolle die schwäbischen und andern Landsknechte dermaßen ausrüsten und unterrichten, daß einer derselben mehr wert sei, als zwei Eidgenossen.
Aus diesem Aktenstück entnehmen wir, daß im Herbst 1486 der »Landsknecht« bereits ein fester Begriff geworden war, daß er zu seinem Beruf ausgebildet wurde, und daß Schweizer und Landsknechte als ein Unterschied und Gegensatz empfunden wurden.
Noch zehn Jahre früher hatte man von den deutschen Kriegsknechten nichts gehalten. Als René von Lothringen 1476 mit oberrheinischen Söldnern sein Herzogtum wieder erobern wollte, bewährten sie sich nicht, sondern nahmen bei Pont à Mousson vor den Burgundern die Flucht. Die Schweizer mußten kommen, und die Gevierthaufen bei Nancy (5. Juni 1477) aber waren sich so sehr ihrer Überlegenheit bewußt, daß sie die Deutschen verächtlich behandelten und die Beute in diesen Feldzügen fast für sich allein beanspruchten.
Als die Landsknechte durch bewußte Erziehung auf einen Grad der Tüchtigkeit gebracht sind, der ihnen schon Selbstvertrauen gibt, scheiden die Eidgenossen aus ihrer Körperschaft aus, und von Stund an stehen sich Lehrer und Schüler eifersüchtig einander gegenüber. Die Schweizer mit ihrer stolzen Sieges-Tradition wollen den Rang des alles überragenden, unvergleichlichen Kriegertums behaupten; den Landsknechten sagen ihre Führer, sie könnten das gleiche, und sie fangen an, sich selber mit diesem Glauben zu erfüllen. Von den Niederlanden ziehen geschlossene Banden aus nach England, nach Savoyen. Unter Georg Sigismund von Tirol besiegen sie, geführt von Friedrich Kappeler, venezianische Kondottieri in der Schlacht bei Calliano (10. August 1487). Anfänglich hatte Sigismund auch noch Schweizer Söldner, aber statt, daß, wie ehedem, diese geringschätzig auf die Mitkämpfer herabsahen, berichten jetzt die Schweizer Hauptleute nach Hause, daß sie von den Landsknechten bedroht würden und kaum ihres Lebens sicher seien.
Als 1488 ein Reichsheer in die Niederlande zog, um Maximilian gegen die Stände, die ihn zeitweilig gefangen gesetzt hatten, zu Hilfe zu kommen, erschienen vor den Toren Kölns auch Schweizer; man wollte sie jedoch nicht aufnehmen »der Landknechte halber«, um Zwietracht zu vermeiden, und die Schweizer zogen wieder nach Hause.
Zwei Jahre später, 1490, finden wir wieder Schweizer und Landsknechte vereinigt, als Maximilian gegen die Ungarn zog. Ein etwas späterer St. Galler Chronist, Watt, berichtet: »in disem zug sind bey den lanzknechten vil Eidgenossen und auch ettlich uss unser Stat S. Gallen gsin.« So sind sie noch öfter wieder zusammengesperrt worden.
Erst dieser Feldzug 1490, in dem Stuhlweißenburg erstürmt wurde, scheint die allgemeine Aufmerksamkeit auf die neue Erscheinung gelenkt zu haben, so daß die Chronisten sich bewogen sehen, dem Worte »Landsknechte« einige Worte der Erklärung oder der Erläuterung hinzuzufügen.
Im Volkslied erscheint das Wort »Landsknecht« sicher datiert zum ersten Mal im Jahre 1495. »Im Land ist manger Landsknecht«5.
Es sind geworbene Kriegsknechte, wie wir sie seit dem 11. Jahrhundert kennen; im 15. Jahrhundert finden wir mancherlei Namen, wie »Böcke« und »Trabanten« für sie. Der Unterschied ist, daß sie nicht mehr bloße Einzelkrieger sind, sondern den geschlossenen taktischen Körper bilden und daran gewöhnt worden sind, ihre Kraft eben in dieser Geschlossenheit, diesem Zusammenhalt zu finden und zu verstehen. Dem äußeren Zusammenhalt entspricht der innere, der neue Standesgeist. Was bei den Schweizern, die das Muster abgaben, die Landsmannschaft und deren kriegerische Überlieferung war, das ist bei diesen freien Soldbanden die militärische, in den Banden selbst, nachdem sie einmal geschaffen, sich fortpflanzende Erziehung.
Zum erstenmal in der Weltkriegsgeschichte sind wir dem taktischen Körper begegnet in der Phalanx der Spartaner, von denen im bewußten Gegensatz zum Einzelkrieger, Demarat dem König Xerxes gerühmt haben soll, die einzelnen Spartaner seien so tapfer wie andere Männer, ihre eigentliche Kraft aber beruhe darin, daß das Gesetz ihnen gebiete, in Reih und Glied verharrend zu siegen oder zu sterben.
Obgleich es dauernd auch niederdeutsche Banden gab, so hat der Name »Landsknecht« doch wesentlich gehaftet an den Oberdeutschen, den Schwaben und Bayern, wohl damit zusammenhängend, daß hier einerseits die nahe Schweizer Nachbarschaft verlockend wirkte, der Trommel zu folgen, und daß die Hausbesitzungen Maximilians hier lagen und ihm infolgedessen aus diesen Gegenden besonders gern und zahlreich die Knechte zuliefen. Landsmannschaftliche Sonderungen und Gruppierungen waren besonders im Anfang natürlich, und die stärkste Gruppe, die schwäbische, gab schließlich dem Ganzen den Charakter. »Lanczknechti et Hollandrini« sagt einmal Maximilian in seiner Autobiographie und setzt an einer anderen Stelle die »landczknechti« den »alti alimany« (Hochdeutschen) gleich. Auch die »Hollandrini« lebten fort, traten im Jahre 1494 bei den Zügen Karls VIII. nach Italien als »Geldener« neben den Schweizern auf und sind wohl in der Schlacht von Pavia 1525 als »schwarze Bande« zugrunde gegangen.
Aus der Beschwerde der Schweizer über Konrad Gäschuff haben wir ersehen, daß eine förmliche Ausbildung der Landsknechte stattfand. Das wir uns bestätigt durch die Erzählung von einer Waffenübung, die der Graf Friedrich von Zollern am 30. Januar 1488 auf dem Markt von Brügge veranstaltete. Wir haben verschiedene Berichte darüber, die nicht ganz übereinstimmen, namentlich darüber nicht, wer eigentlich exerzierte. Nach dem einen sind es deutsche Edelleute aus dem Gefolge Maximilians, nach dem anderen deutsche Fußknechte, nach noch anderen Niederländer, die sich von den Deutschen unterrichten lassen. Jedenfalls ist die Waffe, die die Schaar trägt, der lange Spieß; dann erfolgt das Kommando zur Bildung einer Schnecke (faisons le limaçon à la mode d'Allemagne), dann das Kommando zum Spießfällen (chacun sa pique). Hierbei wird auch ein Kriegsruf ausgestoßen, »Sta, sta«. Die herumstehenden Bürger glauben zu verstehen »Sla, sla« und stieben voller Schrecken, einen Überfall fürchtend, auseinander.
Unter der »Schnecke« ist jedenfalls eine geordnete Bewegung zu verstehen, in der man aus einer Marsch-Kolonne in eine Angriffs-Kolonne überging und umgekehrt. Das macht sich keineswegs von selbst, sondern muß eingeübt werden, was auf verschiedene Weise geschehen kann6. Mit einem späteren Manöver der Schützen, das ebenfalls »Schnecke« (limaçon, caracole) genannt wird, hat es nichts zu tun.
Der Gebrauch des langen Spießes ist nicht so einfach, wie er scheinen möchte7. Der Schweizer MÜLLER-HICKLER, der es ausgesprochen hat, berichtet darüber:
»... Die unliebsamste Erscheinung war das Vibrieren des langen Schaftes. Ich habe selbst beim Fechten mit dem langen Spieß erfahren, daß es fast unmöglich ist, das Ziel zu treffen, weil die Spitze bei heftigem Stoß so sehr zittert; besonders trifft dies zu bei energischem Zustoßen, am meisten, wenn die volle Länge ausgenutzt und mit dem langgestreckten rechten Arm weit ausgefallen wird. – –«
»Es gehörte ein sicherer, die Gelegenheit abwartender, verhältnismäßig langsamer Stoß dazu, wollte man im Kampfe mit dem geharnischten Doppelsöldner den beliebten Stoß nach Hals und Unterleib so placieren, daß er die Fuge des Harnisches traf8.«
Statt der langen Spieße führten manche Landsknechte auch gewaltige Schwerter, die mit beiden Händen gehandhabt wurden; sie haben aber keine wesentliche Rolle gespielt. Böheim hat darüber gewiß mit Recht gesagt9, es seien nur einige besonders starke Männer damit ausgestattet worden zum speziellen Schuß der Fahne, später des Obersten. Man habe das Fechten damit systematisch ausgebildet, in der Wirklichkeit aber hätten die bramarbasierenden Enakssöhne, die sie führten, gerade so viel Wert gehabt, wie die riesigen Tambourmajors in der Armee Napoleons.
Immer wieder rühmen die Quellen auch die Ordnung, in der die Knechte marschierten. Rotten von vier, fünf und acht Mann Breite werden genannt. Mittelalterliche Quellen wissen niemals dergleichen zu melden.
Im Herbst des Jahres 1495 zogen 10000 Deutsche beim Herzog Ludovico Moro von Mailand zu Hilfe, der den Herzog von Orleans in Novara belagerte. Der Arzt Alessandro Benedetti hat uns ausführlich eine Parade beschrieben, die der Herzog mit seiner Gemahlin über seine Truppen vor Novara abnahm. »Aller Augen, schreibt er, zog dabei auf sich eine Phalanx der Deutschen, welche einen Gevierthaufen bildete und 6000 Fußknechte umfaßte unter Führung Georgs von Eberstein (Wolkenstein) auf einem prächtigen Pferde. Nach deutscher Sitte hörte man in diesem Schlachthaufen eine Menge von Trommeln, daß die Ohren platzten. Nur auf der Brust gewappnet, schritten sie einher mit geringem Zwischenraum zwischen den Gliedern, die vordersten trugen lange Lanzen mit scharfer Spitze, die folgenden trugen die Lanzen hoch, dann folgten Hellebarden und Zweihänder; Fahnenträger waren bei ihnen, nach deren Wink sich der ganze Haufe rechts, links, rückwärts bewegte, als ob er auf einem Floß gefahren würde. Weiter folgten Arkebusiere und rechts und links Armbrustschützen. Im Angesicht der Herzogin Beatrix verwandelten sie den Gevierthaufen plötzlich auf ein Zeichen in einen Keil (d.h. die breite Ausstellung in eine schmale, aber das Landsviereck in ein Mannsviereck), dann teilten sie sich in Flügel, endlich schwenkte die ganze Waffe, indem ein Teil sich ganz langsam, der andere sich schnell bewegte und so der eine Teil um den anderen, der stehen blieb, herumbewegt wurde, so daß sie einen einzigen Körper zu bilden schienen10«.
Neben dem Einüben ist von besonderer Bedeutung für die Bildung der Landsknechte die Teilnahme der Edelleute. Immer wieder wird berichtet, daß sie mit dem Spieß in der Hand in die Reihen des Fußvolks eintreten. In einem Gefecht bei Bethune erleiden die Deutschen von den Franzosen (1486) eine Niederlage. Herzog Adolf von Geldern und Graf Engelbert von Nassau sind bei dem Fußvolk eingetreten, sie sagten, sie wollten mit ihm leben und sterben und vergossen, wie der Chronist sagt, ihr Blut »pour la protection des piétons«.
Eine umgekehrte Erzählung zeigt uns, was das bedeutete. Als Kaiser Maximilian 1509 Padua belagerte und die Landsknechte stürmen sollten, verlangten sie, daß die Edelleute sich daran beteiligten. Aber Bayard sagte: »Sollen wir uns zu Seiten derer in Gefahren wagen, die Schneider und Schuster sind?« Und die deutschen Ritter sagten, sie seien da, zu Pferde zu streiten und nicht zum Sturm. Darauf gab der Kaiser die Belagerung auf. Der erste große Schwabenkrieg 1499. Noch siegt das ältere durch Erfolge und Erfahrungen gefestigte Kriegertum der Schweizer; bei Hard, am Bruderholz, bei Schwaderlow, bei Frastenz, an der Calven, bei Dornach werden die Schwaben geschlagen. Trotzdem stellt, als es zu Verhandlungen kommt, Maximilian die stolzesten Bedingungen, und im Frieden erlangen die Schweizer schließlich kaum etwas Positives, geben sogar etwas zurück. Den Ausschlag für den Frieden gibt freilich, daß Ludwig XII. mittlerweile Mailand eingenommen hat.
Die Franzosen, Spanier und Italiener.
Die Kriegsverfassung Frankreichs im 15. Jahrhundert beruhte auf den Ordonnanz-Companien und den francs-archers. Nachdem die letzteren sich bei Guinegate so schlecht bewährt hatten, wollte Ludwig XI. sie in Fußvolk nach Schweizer Muster umwandeln. Er gab ihnen statt der Bogen lange Spieße und Hellebarden und zog sie, über 10000 Mann stark, zu ihrer Ausbildung in ein Lager bei Hedin in der Pikardie, das nächste Jahr bei Pont de l'Arche, unweit Rouen, zusammen.
Der König lasse eine große Waffe langer Spieße und Hellebarden nach deutscher Weise fabrizieren, meldete der schweizerische Gesandte Melchior Ruß nach Hause11; wenn er auch Menschen fabrizieren könnte, die sie handhabten, würde er Niemandes Dienste weiter gebrauchen. Spätere Historiker haben geglaubt, das Lager von Pont de l'Arche als die Wiege der französischen Infanterie betrachten zu dürfen; man habe dort die Mannschaften systematisch einexerziert, nachdem man 6000 Schweizer als Mustertruppe zugezogen. Drei Jahre soll das Übungslager bestanden haben, ein Jahr die Schweizer Lehrmeister geblieben sein. Aber nähere Prüfung der Zeugnisse hat dies Phantasiebild zerstört12. Es ist in Wahrheit nichts von einem Drill und von einer Schweizer Mustertruppe überliefert. Die Absicht des Königs ist unzweifelhaft auf dasselbe gerichtet gewesen, was eben damals unter Maximilian in den Niederlanden geschaffen wurde. Wir hören auch ausdrücklich, daß 1500 Ritter der Ordonnanz-Compagnien in das Lager geführt wurden, um nach Bedarf zu Fuß zu fechten, was doch wohl heißen soll, bei den Fußknechten einzutreten. Aber solche Reformen sind mit einem bloßen Befehl nicht durchgeführt.
Die Infanterie, die aus jenem Lager hervorging, ist niemals den Schweizern oder Landsknechten gleichgewertet worden. Eine ähnliche Truppe, wie an der belgischen, wurde auch noch an der italienischen Grenze gebildet. Neben diesen Truppen, die später als die »alten Banden« von Pikardie und Piemont bezeichnet wurden, gab es noch andere, mehr oder weniger lockere Soldbanden, die aventuriers genannt werden, auch zum Teil mit blanken Waffen ausgerüstet waren, zum größeren Teil aber als Schützen dienten. Vor Genua im Jahre 1507 zeichneten sie sich einmal aus, als Bayard und andere Ritter sich zum Sturm an ihre Spitze stellten, so daß Susane, der Historiker der französischen Armee, hier den Ursprung der französischen Infanterie feststellen zu können glaubt. Seit jenem Ereignis sei es Sitte geworden, daß junge Edelleute, denen die Mittel für eine Reiter-Ausrüstung fehlten, gegen einen erhöhten Sold bei der Infanterie eintraten. Man nannte diese Edelleute mit einem italienischen Ausdruck lanze spezzate. Der Ausdruck lanspessades habe sich in der französischen Armee bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts gehalten als Bezeichnungen für Soldaten erster Klasse zwischen den Korporalen und den Gemeinen.
In den sog. Memoiren Bieillevilles wird erzählt, daß in jeder Kompanie zwölf lansspessades gewesen seien; sie trugen weder Hellebarden noch Arkebusen, sondern den Spieß.
Aber trotz dieser sozialen Stärkung haben die französischen Infanteriehaufen neben den im Solde ihres Königs auftretenden Schweizern und Landsknechten doch immer nur eine nebensächliche Rolle gespielt. Sie treten auf in den großen Schlachten von Ravenna bis Pavia, auch Gascogner und Burgunder werden genannt, das Zeugnis unbedingter Tüchtigkeit wird ihnen aber nirgends ausgestellt, und die französischen Könige von Karl VIII. an haben ihre großen Schlachten immer wieder vorwiegend mit deutschem Fußvolk geschlagen. Im Jahre 1523 schickte ihr Feldherr Bonnivet die Franzosen aus Italien nach Hause, als er an ihrer Stelle Schweizer haben konnte. Erst 1544, in der Schlacht bei Ceresole, ficht ein gaskognischer Spießerhaufe nicht nur nach Schweizer Art, sondern auch erfolgreich.
Franz I. hat im Jahre 1533 einen anderen Versuch gemacht, eine nationalfranzösische Infanterie, mehr milizartigen Charakters, zu schaffen, der er den stolzen Namen »Legionen« gab. Man wollte mit ihnen sogar neue taktische Formen schaffen, die aus der Phalanx, der römischen Legion und dem Gebrauch der modernen Kriege gemischt sein sollten. Was uns vorgeführt wird, ist der große Gevierthaufe, der auf eine höchst gekünstelte Weise in kleine Abteilungen mit kleinen Intervallen zerlegt ist. Irgend ein Zweck, eine Funktion der kleinen Haufen ist dabei nicht zu erkennen; es handelt sich offenbar um ein bloßes theoretisches Spintisieren. Als im Jahre 1543 10000 französische Legionäre Luxemburg verteidigen sollten, desertierten sie in Waffen und überlieferten den Kaiserlichen die Festung. Dasselbe geschah 1545 in Boulogne. Zum Jahre 1557 steht in den Memoiren des Marschalls Bieilleville, diese Legionäre seien keine Krieger, sie verließen den Acker, um durch eine Dienstzeit von 4-5 Monaten von den Steuern frei zu werden, auf Grund eines Zeugnisses, das in den Akten des Amtsbezirks registriert werde.
Man erkannte in den leitenden französischen Kreisen wohl, wie unerträglich es sei, die französischen Kriege mit Fremden zu führen, aber man fand, der französische Charakter sei einmal für den Infanteriebetrieb nicht geeignet, und indem man Deutsche, Schweizer und Italiener in Sold nehme, habe man nicht nur gute Soldaten, sondern entziehe eben diese guten Soldaten auch dem Feinde.
Um 1500 nannte man in Frankreich die Kavallerie l'ordinaire de la guerre und die Infanterie l'extraordinaire de la guerre, weil im Frieden nur jene vorhanden waren13. Die Bezeichnung »Infanterie« soll aber erst unter Heinrich III. aufgekommen sein; um 1550 habe man noch »fanterie« gesagt, aus dem Italienischen »fante« gleich »Bursche«, »Knecht«.14
Anders als in Frankreich verlief die Entwicklung in Spanien. Schon im Jahre 1483, also gleich nachdem Ludwig XI. das Lager in der Pikardie errichtet haben soll und während noch um Granada gekämpft wurde, soll König Ferdinand von Aragonien eine schweizerische Truppe zu sich berufen haben, die als Modell für die Bildung einer ähnlichen Infanterie dienen sollte. Von schweizerischer Seite ist aber von dieser Truppe jenseits der Pyrenäen nichts bekannt, und die bisherige Forschung hat auch noch nichts über die Neubildung in den nächsten 20 Jahren zutage gefördert.
Da neben den Deutschen es zunächst allein die Spanier sind, die ein brauchbares Fußvolk nach Art der Schweizer gebildet haben, so hat ihr Kriegswesen in dieser Zeit ein besonderes Interesse, und Dr. Karl Hadank hat auf meine Veranlassung und mit Unterstützung des Kultusministeriums eine Reise nach Spanien unternommen, um in den dortigen Archiven wie in der Literatur Nachforschungen anzustellen. Die Ergebnisse sind jedoch nur geringfügig gewesen und führen nicht wesentlich über das hinaus, was schon bei Hobohm gesagt ist. Die Quellen-Literatur über die spanisch-französischen Feldzüge in Unteritalien ist zwar ziemlich umfangreich – an der Spitze steht das Leben des »Gran Capitan« Gonzalo de Cordova von Jovius –, gibt aber für das eigentliche Problem, die Bildung des taktischen Körpers der Infanterie nur wenig. Eine Miliz-Einrichtung, die im Jahre 1495 auf einer Junta und noch mehrfach angeordnet wurde, zeigt nichts von dem Geist der neuen Kriegskunst, und als die Spanier den Kampf mit den Franzosen um den Besitz von Neapel aufnahmen und ihre Truppen unter Gonzalo von Cordova hinüberbrachten (1495), konnten diese es mit den Schweizern, die ihnen die Franzosen gegenüberstellten, nicht aufnehmen. »Weder an Qualität der Waffen noch an Festigkeit der Ordnung« waren sie ihnen gewachsen und nahmen trotz numerischer Überlegenheit die Flucht. Gonzalo aber gab darum seine Sache nicht verloren. Während des Krieges und durch den Krieg selbst bildete er seine Truppen aus und erfocht, unterstützt von Landsknechten, den ersten Erfolg in der Schlacht bei Cerignola 1503. Das Material seiner Truppen soll ursprünglich sehr schlecht gewesen sein. Nicht nur Abenteurer und Vagabunden, die auch sonst der Trommel nachliefen, sondern auch gewaltsam Gepreßte waren darunter. Aber es kam ihm zu Hilfe, daß sie fern von der Heimat im fremden Lande waren; es blieb den Leuten um ihrer selbst willen nichts anderes übrig, als zu ihrer Fahne zu stehen, und wieder einige Jahre später unterliegt es keinem Zweifel, daß die spanische Infanterie den Schweizern und den Landsknechten an Tüchtigkeit nichts nachgibt. Die Schlacht bei Ravenna (1512) wird es zeigen, obgleich sie hier von den Landsknechten, verbunden mit der französischen Ritterschaft, geschlagen wurden, und von da haben die Spanier an die anderthalb Jahrhunderte den Ruf einer ganz hervorragenden Infanterietruppe bewahrt.
Bei ihnen erfahren wir auch einmal etwas von der prinzipiellen Opposition, auf die die Neubildung stieß. Ein Gonzalo von Ayora, der gleichzeitig mit Gonzalo von Cordoba zu Haufe Gevierthaufen aufstellen und einüben wollte, wurde damit verspottet. Einmal erfahren wir, daß er feine Fußknechte den ganzen Tag geübt habe; er bittet den König den dadurch entstandenen Mehrbedarf an Wein und Proviant zu decken und wünscht eine Verstärkung seiner Autorität durch Ernennung zum Oberst und ausdrückliche Anweisung an die Kapitäne, ihm aufs Wort zu gehorchen. In einem großen Kriegsrat wurde darüber debattiert, ob man Ayoras Ideen gutheißen solle. Die Hofleute sollen sich noch lange darüber lustig gemacht haben. Im Jahre 1506 aber brachte der Gemahl der Erbtochter, Philipp der Schöne, der Sohn Maximilians, 3000 Landsknechte mit nach Spanien, und deren Beispiel wird wohl den letzten Widerstand besiegt haben.
Wieder anders als in Spanien gingen die Dinge in Italien. Italien war im 14. und 15. Jahrhundert ein höchst kriegerisches Land. Es brachte die großen Condottieri hervor, die eine schulmäßige Tradition in der Kriegskunst ausbildeten. Man unterschied nach gewissen, wenn schon nicht sehr wesentlichen Differenzen in den strategischen Prinzipien die Schule der Sforza und die Schule der Braccio. Die großen Historiker der Renaissance, Machiavelli, Guicciardini, Jovius sind einig in der Behauptung, daß die Condottieri den Krieg bloß als Spiel und nicht als blutigen Ernst betrieben hätten; in eigenflüchtiger Berechnung, um den Krieg möglichst in die Länge zu ziehen, um möglichst viel Sold herauszuschlagen, hätten sie die Entscheidung nicht aufgesucht, sondern vermieden, und wenn es einmal zur Schlacht kam, so hätten sich die Mannschaften, die sich untereinander als Kameraden ansahen, gegenseitig geschont und kein Blut vergossen. In der Schlacht von Anghiari (1440) z.B. sei wohl ein Mann umgekommen, aber er sei nicht gefallen, sondern im Sumpfe erstickt. Neuere haben wohl gar diese Art Kriegführung dahin charakterisiert, daß durch diese Condottieri der Krieg zu einem Kunstwerk, nämlich des Manövrierens, erhoben worden sei.
Die Prüfung der gleichzeitigen Berichte hat ergeben, daß an dieser ganzen Schilderung trotz der drei großen Autoritäten kein wahres Wort ist. Richtig ist nur, daß die Condottieri den Krieg nicht mit der Grausamkeit führten, wie es Machiavelli und seine Zeitgenossen an den Schweizern sahen, denen es ja verboten war, Gefangene zu machen und die sogar in den erstürmten Städten alle Männer töteten. Die Schlacht der Condottieri war ähnlich der der Ritter, die ebenfalls, wenn es der Kriegszweck zuließ, Schonung walten ließen und auch des Lösegelds wegen Gefangennahmen nicht bloß erlaubten, sondern auch erstrebten. Weiter sind auch die Condottieri in der Schonung nicht gegangen, und ihre Schlachten waren oft recht blutig15.
Eines besonderen Rufes erfreuten sich im ganzen 14. und 15. Jahrhundert die italienischen Schützen, Genuesen und Lombarden, die auch in dem Heere Karls des Kühnen eine große Rolle spielten.
Die Heere der Condottieri bestehen, wie die mittelalterlichen Heere überhaupt, wesentlich aus Reitern. Auch das war ein Grund, weshalb Machiavelli sie haßte und verachtete, da er die Infanterie, nach dem römischen Muster, für die entscheidende Waffe ansah.
Als nun die Nachrichten von den Taten der Schweizer und der Landsknechte auch in Italien erschollen, fanden sich bald einsichtige Kriegsmänner, die die neue Praxis auch auf ihr Land übertragen wollten. Die Bevölkerung bot viel mehr und besseres Material als damals etwa die Franzosen. Jener Spanier Gonzalo de Ayora hatte in Mailand die neue Kunst gelernt, und ein angesehenes Condottieri-Geschlecht, die drei Brüder Vitelli, die in der Romagna die kleine Herrschaft Città di Castello besaßen, nahmen sich vor, die bisher fehlende italienische Infanterie zu schaffen (1496). Sie warben unter ihren eigenen Untertanen, mischten sie mit erfahrenen Kriegsleuten, bewaffneten sie mit Spießen, die noch eine Elle länger waren als die der Deutschen und lehrten sie, wie uns Jovius sehr anschaulich berichtet, »den Fahnen zu folgen, nach dem Trommelschlag Tritt zu halten, die Kolonne zu dirigieren und zu wenden, die Schnecke zu bilden und endlich mit vieler Kunst den Feind zu schlagen und genau die Ordnung zu bewahren.« (Signa sequi, tympanorum certis pulsibus scienter obtemperare, convertere dirigereque aciem, in cocleam decurrere, et denique multa arte hostem ferire, exacteque ordines servare.) Wirklich gelang es Vitellozzo mit einem Haufen von 1000 Mann in einem Gefecht bei Coriano (26. Januar 1497), 800 deutsche Landsknechte im Dienste des Papstes, Alexanders VI., zu schlagen. Aber die Schöpfer überlebten ihr Werk nur kurze Zeit: Camillo Vitello starb schon 1496 in Neapel in französischem Dienst, Paolo wurde 1499 von den Florentinern geköpft, Vitellozo 1503 auf Befehl Cäsar Borgias erdrosselt.
Cäsar Borgia selbst hat das Werk der Vitelli aufgenommen und fortgebildet, und nach seinem Untergang traten in venezianischem Dienst Romagnolen als Söldner auf, die sehr tüchtig waren. Aber schließlich waren die Versuche zu klein und hatten nicht die Hinterhand einer überragenden politischen Macht, die sie auch nach Krisen aufrecht erhalten hätte. Machiavellis Versuch, der Republik Florenz eine einheimische, kriegstüchtige Miliz zu organisieren, war in der Anlage verfehlt und mißglückte. Am günstigsten hätten die Verhältnisse in der Republik Venedig gelegen, die über eine sehr große und anhängliche Bauernschaft gebot. Aber die Regierung scheute sich, die eigenen Untertanen zu militarisieren und warb lieber auswärts, namentlich in der Romagna. Diese Romagnolen, die die Stammtruppe einer national-italienischen Infanterie hätten werden können, wurden in den beiden Schlachten von Vaila (1509) und La Motta (1513), von den Schweizern und dann von den Spaniern und Landsknechten geschlagen und vernichtet. Seitdem gilt das italienische Fußvolk, wo es auftritt, als ebenso minderwertig, oder noch weniger als das französische, obgleich der einzelne Italiener einen so guten militärischen Ruf hatte, daß die Kapitäne der französischen Aventuriers zum geringen Teil Italiener waren.
Es ist hiernach ausdrücklich festzustellen, daß, wenn in der neuen Kriegskunst die Franzosen und Italiener hinter den Deutschen und Spaniern zurückblieben, eine Rassen-Anlage dabei nicht in Betracht kommt, da ja die Franzosen noch in späterer Zeit hervorragende kriegerische Anlagen gezeigt haben und die Italiener bis in die Renaissance-Epoche hinein für sehr tüchtige Krieger galten. Es handelt sich vielmehr um ein Produkt der Umstände und der Abfolge der Ereignisse. Den Deutschen ist zugutegekommen, daß sie zunächst mit Schweizern zusammen unter den Fahnen Maximilians standen. Die Schweizer selbst wurden dadurch die Stammtruppe der Landsknechte, die sie später, als sie sich getrennt hatten, nicht bloß als ihre Rivalen, sondern als ihre grimmigen Feinde ansahen. Einige bedeutende Männer unter Führung Maximilians selber haben, die Aufgabe theoretisch erkennend, sie durch Abhalten von Exerzierübungen durchgeführt, und als ein gewisser Kern von Landsknechten, erfüllt von dem neuen Geist und seinem Selbstvertrauen geschaffen war, als eine Anzahl von Hauptleuten und Obersten, die das allgemeine Ansehen und Vertrauen genossen, sich emporgearbeitet hatten, pflanzte sich das Landsknechttum durch die eigene Kraft unausgesetzt weiter fort.
Weshalb bei den Franzosen nichts Ähnliches geschah, haben die Zeitgenossen schon oft gefragt; man meinte, es stecke die Absicht dahinter, das Volk nicht wehrhaft werden zu lassen, damit man es leicht gehorsam halten könne. Das sei die Auffassung des Adels gewesen, und der König selber habe sich dadurch beeinflussen lassen16. Dem widerspricht, daß man ja immer wieder Versuche gemacht hat, eine national-französische Infanterie zu schaffen. Aber sie sind nicht gelungen, d.h. sie brachten es nicht bis zu der Tüchtigkeit und dem Selbstvertrauen der Schweizer und Landsknechte, und man wird wohl auch nicht daran zweifeln dürfen, daß die französischen Könige, statt der minderwertigen Truppen, lieber vollwertige haben wollten. Der Grund des Versagens der Franzosen ist also, daß zunächst der Ausgangspunkt fehlte: die Anlehnung an die Schweizer. Freilich hatten ja auch die französischen Könige selber Schweizer, aber es war unmöglich, französische Fähnlein wie die Schwaben und Tiroler mit den Schweizern in einem Haufen zusammenzustellen. Die Schweizer haben den Franzosen nur theoretisch als Vorbilder dienen können. Die französische Infanterie mußte aus neuem Samen aufgezogen werden. Hierauf aber die genügende Arbeit und Energie zu verwenden, fühlte man sich nicht veranlaßt, weil das bequeme Mittel zur Hand war, aus der Schweiz die allerbesten Krieger durch Anwerbung zu beziehen. Gerade, daß Schweizer und Landsknechte sich verfeindeten, kam den französischen Königen zu Hilfe. Als Ludwig XII. im Jahre 1509 sich mit den Schweizern erzürnt hatte und sie ihm keine Knechte lieferten, ließ er Landsknechte werben.
Umgekehrt lag es in Spanien. Sobald man einmal die neue Kriegskunst begriffen hatte, trieb die harte Notwendigkeit dazu, die eigenen Mannschaften in ihr auszubilden. Wo hätten die Könige von Aragonien und Castilien, auch wenn es geographisch leichter gewesen wäre, das Geld hernehmen sollen, die anspruchsvollen deutschen Knechte zu bezahlen? Die Quelle des Edelmetalls jenseits des Ozeans begann eben erst angebohrt zu werden. Für Italien ist schließlich noch als sehr wesentlich in Betracht zu ziehen, daß die Bildung des mehr oder weniger stehenden Heeres von Fußknechten die Republiken und sonstigen nur mittelgroßen Gewalten in eine sehr gefährliche Abhängigkeit von den Führern gebracht hätte. Die großen Könige brauchten das als Kriegsherrn nicht so sehr zu fürchten.
Zweites Kapitel.
Die Feuerwaffe.
Erfindung des Pulvers und des Schießens.
Erst an dieser Stelle schiebe ich ein Kapitel über die Feuerwaffen ein, denn obgleich jetzt schon hundertfünfzig Jahre in Gebrauch und oft von mir erwähnt, haben sie doch nicht eher als in der Epoche, mit deren Behandlung wir jetzt beschäftigt sind, eine wirkliche und wesentliche Bedeutung gewonnen17.
Die Ansichten über die Erfindung des Pulvers haben noch in jüngster Zeit stark geschwankt, und die Untersuchung ist auch jetzt noch nicht, weder in bezug auf das Land noch die Zeit abgeschlossen. Vor wenigen Jahren galt als sicher, daß das griechische Feuer, von dem uns zuerst im 7. Jahrhundert berichtet wird (bei der Belagerung von Kyzikos 678 n.Chr.), mit dem Pulver, dem aus Salpeter, Kohle und Schwefel zusammengesetzten Explosivstoff, nichts zu tun habe, sondern als ein wesentlich aus ungelöschtem Kalk oder sonstwie zusammengesetzter Brandsatz aufzufassen sei. Jetzt aber ist wieder in byzantinischen Handschriften eine Zeichnung gefunden worden, die bis ins 10. Jahrhundert zurückgeht und kaum anders zu erklären ist, als durch Pulver-Explosion, und die daraufhin wiederholten Untersuchungen der Beschreibung des griechischen Feuers, sind auch wieder zu dem Ergebnis gekommen, daß eine Pulververwendung doch wohl die beste und natürlichste Interpretation sei18. Ist das richtig, so haben wir hier das älteste historisch bezeugte Vorkommen des Pulvers. Trotzdem spricht Einiges dafür, daß die Erfindung nicht hier, sondern in China gemacht worden ist. Man erhält den Explosivstoff Pulver, indem man etwa sechs Teile Salpeter, einen Teil Kohle und einen Teil Schwefel pulverisiert mit einander mischt. Das ergibt eine mehlförmige Masse, die sehr schnell verbrennt und deren Verbrennungsprodukte, zum größten Teil gasförmig, etwa den tausendfachen Raum des ursprünglichen Pulvers beanspruchen. Der Hauptbestandteil des Pulvers ist also Salpeter. Dieser aber wird in natürlichem Zustand in unserer alten Kulturwelt nur selten gefunden, in der Mongolei und in China dagegen ist er sehr häufig. Hier muß man schon früh darauf aufmerksam geworden sein, wie sehr er die Lebhaftigkeit jeder Verbrennung steigert, und konnte leicht zu der Erfindung des Pulvers kommen, indem man älteren Brandsätzen Salpeter beimischte. Ferner wird bei den Arabern der Salpeter »Schnee von China« genannt und auch das führt darauf, daß die richtige Mischung der drei Bestandteile zuerst in China gefunden und von da zu den Arabern und Oströmern gekommen ist.
Man ist auch in China schon zu einer Verwendung des Pulvers für Kriegszwecke gelangt, aber nicht vor dem 13. Jahrhundert, also lange nachdem die Griechen bereits auf diese Verwendung gekommen und erst kurz bevor wir Pulverrezepte und Feuerwaffen im Okzident genannt finden.
Bei der Verteidigung einer belagerten Stadt Pien-Ring im Jahre 1232 schoß man Raketen, schleuderte eiserne Handgranaten und legte Erdminen an. Im Jahre 1259 wurde das Pulver benutzt, aus Bambusröhren brennende Zündflocken zu schleudern. Die Chinesen nannten dieses Instrument die »Lanze des ungestümen Feuers«; in der heutigen Feuerwerkerei ist es bekannt unter den Namen der »römischen Kerze«. Die Prozedur kann bereits als Schießen bezeichnet werden, denn wir haben ein Rohr, aus dem durch Explosivkraft Geschosse geschleudert werden auf eine Entfernung von etwa 100 Fuß. Da sich der Zweck aber beschränkt auf das Anzünden brennbarer Gegenstände, so kann »die Lanze des ungestümen Feuers« als eine Schußwaffe noch nicht bezeichnet werden, und weiter haben die Chinesen ihre Erfindung nicht getrieben.
Das erste erhaltene richtige Pulverrezept, die drei Bestandteile in dem Verhältnis 6 : 1 : 1, findet sich in einer lateinischen, einem Marcus Gräcus zugeschriebenen Schrift, die um die Mitte des 13. Jahrhunderts anzusetzen ist. Unzweifelhaft handelt es sich um eine lateinische Übersetzung aus einer griechischen Schrift, die von aller Art Feuerwerkerei handelt. Direkt oder indirekt aus dieser Quelle sind auch die Pulverrezepte geschöpft, die sich in Schriften des Albertus Magnus († 1280) und Roger Baco († 1294) finden. Was sich aber über die Anwendung des Pulvers in allen diesen Schriften angegeben findet, zeigt, daß man es zum Schießen damals noch nicht verwandte; schon der Titel des Buches des Marcus Gräcus »liber ignium ad comburendos hostes« zeigt das. Nicht anders steht es mit gleichzeitigen und etwas späteren arabischen Schriften aus Spanien, von Hassan Alrammah (etwa 1290), Jussuf und Schemaeddin-Mohammed, die Pulverrezepte und Gebrauchsanweisungen enthalten, wonach die Kraft des Pulvers als Feuer zum Verbrennen der Feinde, aber nicht, um sie zu erschießen verwendet werden soll. Im Besonderen gilt das von einem »Madfaa« genannten Instrument, das, wie das auch schon die Chinesen getan haben, mit der Kraft des Pulvers einen Brandsatz (kein Geschoß, keine Kugel) gegen den Feind schleudert19.
Aus dem oströmischen Reich, durch Übersetzung aus einer griechischen Schrift, ist also das Geheimnis des Pulver-Rezepts ins Abendland gekommen. Der Name »Römerkerze« für das Instrument, das die Chinesen die »Lanze des ungestümen Feuers« nannten, läßt vermuten, daß mit dem Rezept auch diese Anwendung der neuen Komposition aus Ostrom zu uns gebracht worden ist.
Die gewaltige Wirkung des Pulvers erklärten sich die Alchimisten aus der Hitze des Schwefels und der Kälte des Salpeters, die einander nicht vertragen könnten.
Bemerkenswert dürfte sein, daß sich bei Hassan Alrammah ein Instrument beschrieben findet, das man als einen primitiven, aber in seinem Wesen völlig ausgebildeten automobilen Torpedo ansprechen kann20. Der Torpedo ist also virtuell früher erfunden als das Geschütz oder das Gewehr und das mag uns als Illustration dienen, daß es nicht so einfach war, auch wenn man das Pulver schon hatte, zur Erfindung der Feuerwaffe zu gelangen.21
Die erste historisch sicher beglaubigte Anwendung von Feuerwaffen im Kriege in Europa hat stattgefunden im Jahre 13331 zur Zeit Ludwigs des Bayern, auf dem italienisch-deutschen Grenzgebiet, in Friaul, als die beiden Ritter de Cruspergo und de Spilimbergo, die Stadt Cividale angriffen. Die Ausdrücke der Chronik lauten »ponentes vasa«, das ist auf deutsch »Büchsen« »versus civitatem« und »extrinseci balistabant cum sclopo versus Terram, et nihil nocuit«. Sclopus oder sclopetum, italienisch »schioppo« (Knaller, Donnerer) bedeutet später eine Handfeuerwaffe im Gegensatz zu Geschützen.
Drei Jahre nach jenem Kampf von Cividale, im Jahre 1334, berichtet die Chronik von Este, daß er Markgraf eine große Menge von Geschützen verschiedener Art habe anfertigen lassen (praeparari fecit maximam quantitatem balistarum, sclopetorum, spingardarum). Die Springarden bedeuten um jene Zeit nicht sicher Feuerwaffen, wohl aber die vasa und die sclopeta.
Das drittälteste sichere Zeugnis von Feuerwaffen ist in den päpstlichen Rechnungen erst jüngst entdeckt worden22. Danach wurden im Jahre 1340 bei der Belagerung von Terni von dem päpstlichen Heer probeweise Donnerbüchsen (»edificium de ferro, quod vocatur tromba marina«, »tubarum marinarum seu bombardarum de ferro«) verwandt, die Bolzen schossen, und 1350 bei der Belagerung der Burg Saluerolo Bombarden, die eiserne Kugeln von etwa 300 Gramm Gewicht schossen.
Gleich bei den ersten Erwähnungen der neuen Waffen in den Chroniken finden wir alle verschiedene Bezeichnungen, und das dürfte dafür sprechen, daß schon damals verschiedene Arten in Gebrauch waren, daß also die Erfindung selbst etwas weiter zurückliegt. Da Albertus Magnus, Roger Baco, Hassan Alrammah sie noch nicht kannten, so wird sie ums Jahr 1300 oder bald danach gemacht worden sein.
Beschreibungen der Abbildungen dieser ältesten Feuerwaffe haben wir nicht. Freilich befindet sich in einer englischen Prachthandschrift23 etwas aus den Jahren 1325 bis 1327 eine Illustration, die unzweifelhaft ein Pulvergeschütz darstellen soll, also noch etwas älter als das Ereignis von Cividale. Ein Gefäß von der Gestalt einer großen, bauchigen Flasche liegt auf einer Holzbank; in dem Hals der Flasche steckt ein Klotz und ein daran befestigter, schwerer Pfeil; ein Mann, der sich in einer gewissen vorsichtigen Entfernung hält, bringt eine Lunte an ein in der Flasche erkennbare Zündloch; das Instrument ist gegen ein geschlossenes Burgtor gerichtet. So interessant dieses Bild ist, so ist es doch ausgeschlossen, daß wir darin die Wiedergabe einer jemals wirklich angewandten Feuerwaffe haben. Wäre diese Flasche entsprechend der Schwere des schließenden Klotzes und des Pfeiles darauf, oder gar entsprechend der Stärke des zu beschießenden Burgtores mit Pulver gefüllt gewesen und dementsprechend die Flasche von genügend starkem Metall, so hätte der Rückschlag nicht nur die leichte Holzbank, auf der sie ganz lose liegt, zerschmettert, sondern auch der Schütze, wäre, wenn er sich auch vorsichtig etwas entfernt hält, schwerlich mit dem Leben davongekommen. Es ist daher nicht wohl anders denkbar, als daß der Zeichner selber niemals ein Geschütz gesehen, sondern nur von der wunderbaren neuen Erfindung gehört und nach unklaren Beschreibungen sein Bild konstruiert hat. Immerhin bleibt das Bild als ein Zeugnis, wie und daß man damals in den Kreisen der Gelehrten über die Verwendung der jetzt im Abendland bekannt gewordenen Kraft des Pulvers gesprochen hat, interessant. Die wirkliche Kraft der ältesten Geschütze müssen wir uns aber nicht nach diesem Bilde, sondern nach den später erscheinenden, realistischen Bildern24 und erhaltenen Reliquien rekonstruieren. Danach kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die ältesten Feuerwaffen ziemlich klein und recht kurz waren. Sehr früh erscheinen zwei verschiedene Grundformen: die eine, wo das Rohr mit einem ziemlich langen Stiel versehen ist, den der Schütze unter den Arm nimmt oder gegen den Boden stemmt; die andere etwas größeres Kaliber, das Rohr befestigt auf einem Balken, den man auf die Erde legt oder mit dem hinteren Teil in die Erde eingräbt. Welche von diesen beiden ältesten erkennbaren Formen die eigentliche Urform ist, ist nicht zu entscheiden. Es scheint aber nicht unmöglich, von hier zu den vorhergehenden Verwendungen des Pulvers als Feuer für den Kampfzweck eine Verbindungslinie zu ziehen. Der Stiel, mit dem das Rohr geschäftet ist, ist ähnlich dem Stiel, den wir auch bei der Madfaa finden; für das größere Kaliber aber könnten wir als Vorläufer jenes schon erwähnte byzantinische Kriegsinstrument vermuten, dessen Abbildung sich bis ins 10. Jahrhundert verfolgen läßt. Dieses Instrument hat etwa die Größe und Gestalt einer großen Bierkanne, mit einem Henkel unten und einem Zündloch oben; aus diesem Instrument wollte man den Feind in dem Augenblick, wo man ihm zu Leibe ging, den Feuerstrahl ins Gesicht schießen. Auch hier freilich darf man zweifeln, ob man es mit einer jemals praktisch angewandten Waffe und nicht vielmehr wieder mit einer Phantasie-Konstruktion zu tun hat. Denn da der Feuerstrahl noch nicht ein Meter weit reicht, so setzt sich der Träger des Instruments doch gar zu sehr der Gefahr aus, daß der Gegner ihn mit seiner blanken Waffe, Schwert oder Spieß, schneller erreicht, als er ihm sein Feuer entgegenbläßt, das überdies höchstens Schrecken erregen, aber wenig Schaden tun konnte25.