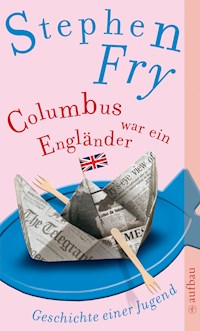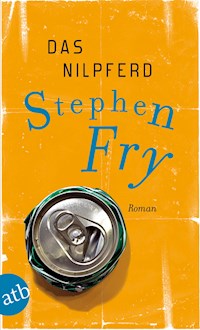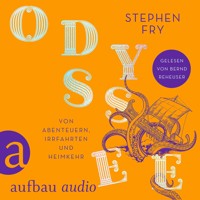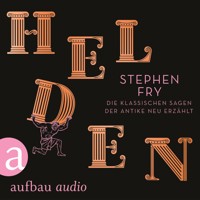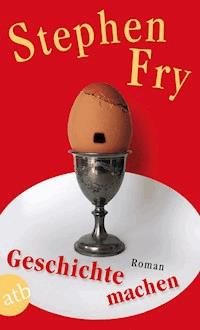
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was wäre geschehen, wenn Hitler nie gelebt hätte?
... diese Frage treibt den jungen Cambridge-Historiker Michael Young und den Physik-Professor Leo Zuckermann um. Beide träumen davon, den Holocaust ungeschehen zu machen. Auf wunderbare Weise schaffen sie den Zeitsprung nach Braunau ins Jahr 1888. Bleibt der Menschheitsgeschichte ihr finsterstes Kapitel erspart?
Frys legendärer Roman ist eine aberwitzige Utopie und ein fulminanter Lesespaß!
"Ein rotzfrecher Roman!" Der Spiegel.
"Irrsinn, erzählt mit der Leichtigkeit eines Popsongs." Stern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 607
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Stephen Fry
Geschichte machen
Roman
Aus dem Englischen von Ulrich Blumenbach
Impressum
Titel der Originalausgabe
Making History
ISBN E-Pub 978-3-8412-0453-0
ISBN Printausgabe 978-3-7466-2333-7
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, Mai 2012
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Bei Aufbau Taschenbuch erstmals 2007 erschienen;
Aufbau Taschenbuch ist eine Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Making History © 1996 by Stephen Fry
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung Preuße & Hülpüsch Grafik Design
unter Verwendung eines Fotos von Bert Hülpüsch
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital - die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
Erstes Buch
Kaffee machen
Es beginnt mit einem Traum …
Frühstück machen
Der Gestank der Ratten
Seinen Weg machen
Parks
Nachrichten machen
Wir Deutsche
Fertig machen
Das Postfach
Ärger machen
Diabolo
Sich Freunde machen
Die Muse der Geschichte
Liebe machen
Federn, Pfoten und Pelz
Reinemachen
Kleine orangefarbene Pillen
Davonmachen
Der Adler ist gelandet
Konversation machen
Kaffee und Schokolade
Die Hölle heiß machen
Schulzeugnis I
Fehler machen
Schulzeugnis II
Wellen machen
Ein Fenster zur Welt
Krieg machen
Adi und Rudi
Musik machen
Kater
Filme machen
T. I. M.
Züge machen
Leo schlägt einen Bauern
Rauch machen
Der Franzose und der Helm des Obersten I
Wiedergutmachen
Axel Bauers Geschichte
Geschichte machen
47° 13’ N, 10° 52’ O
Zweites Buch
Regionalgeschichte
Henry Hall
Militärgeschichte
Der Franzose und der Helm des Obersten II
Medizingeschichte
Der Äskulapstab
Lebensgeschichte
Rudis Kriegstagebuch
Kalendergeschichte
PJs berühmte Pfannkuchen
Revidierte Geschichte
Sir William Mills (1856–1932)
Alte Geschichte
Konsequenzen
Politische Geschichte
Parteigänger
Zeitgeschichte
Firestone
Naturgeschichte
Stille Wasser sind tief
Amerikanische Geschichte
Die Ansprache von Gettysburg
Familiengeschichte
Die Wasser des Todes
Offizielle Geschichte
Im Schlaf sprechen
Geheimgeschichte
Ein einsames Leben
Filmgeschichte
Der Stachel
Geschichte machen
Ratten
Epilog
Der Ereignishorizont
Danksagung
Für Ben, William, George, Charlie, Bill und Rebecca sowie die Gegenwart
ERSTES BUCH
Kaffee machen
Es beginnt mit einem Traum …
Alles beginnt mit einem Traum. Diese Geschichte kann wie ein Kreis überall und nirgends beginnen, aber für mich – und es ist schließlich meine Geschichte, nicht die eines anderen, und wird auch für alle Zeit meine Geschichte bleiben – beginnt sie mit dem Traum einer Mainacht.
Es war ein wüster Traum. Jane kam darin vor, steif und gestärkt wie eine Hotelserviette. Er war auch da, obwohl ich ihn natürlich nicht erkannte. Damals war er mir ja noch praktisch wildfremd, einfach ein alter Mann, den man auf der Straße grüßte oder dem man mit einem höflichen Lächeln die Bibliothekstür aufhielt. Der Traum verjüngte ihn, machte aus dem klapprigen alten Zottelbär mit Leberflecken den Barkeeper eines Mack-Sennett-Films, dem man einen herabhängenden, schwarzen Schnauzbart in das bleiche und hohlwangige Armesündergesicht geheftet hatte.
Ausgerechnet sein Gesicht. Nicht, daß ich es damals erkannt hätte.
Im Traum standen Jane und er im Labor; Janes Labor natürlich – die Prophezeiung des Traums reichte nicht so weit, die Abmessungen seines Labors vorherzusagen, die ich erst später kennenlernen sollte – falls der Traum überhaupt prophetisch war, was keineswegs zwingend notwendig ist. Können Sie mir soweit folgen?
Puh, das wird gar nicht so einfach.
Jedenfalls linste sie in ein Mikroskop, während er sie von hinten begrabschte und unter ihrem langen weißen Kittel zwischen den Beinen streichelte. Sie ignorierte ihn, aber ich war empört, einfach empört, denn als das weiche Kratzen seiner Hände auf dem Nylon aufhörte, wußte ich, daß seine Finger ganz oben an ihren langen Beinen angekommen waren, wo die Strümpfe endeten und das weiche heiße Fleisch begann – weiches heißes Fleisch, das mir gehörte.
»Laß sie in Ruhe!« rief ich von einem unsichtbaren Regiestuhl aus, der sich gleichsam hinter der Kamera des Traums befand.
Er sah mit seinen traurigen Augen zu mir herüber, und ich war wie immer gebannt von ihrem leuchtend blauen Strahlen. Oder ich sollte immer von ihnen gebannt sein, denn im wachen Leben hatte ich ja noch kein einziges Wort mit ihm gewechselt.
»Wachet auf!« sagt er auf deutsch.
Und ich gehorche.
Der sonnige Maimorgen hellt das schmutzige Beige der dreckigen Vorhänge auf, für die wir schon seit Ewigkeiten Ersatz kaufen wollen.
»Morgen, Schatz«, murmle ich. »Das war ein Double Gloucester … meine Mutter hat ihren Träumen immer Käsenamen gegeben.«
Aber sie ist nicht da. Ich meine Jane, nicht meine Mutter. Das heißt, meine Mutter ist auch nicht da. Bestimmt nicht. So eine Geschichte ist das erst recht nicht.
Janes Betthälfte ist kalt. Ich horche auf das Rauschen der Dusche oder das Klirren von Teetassen, die ungeschickt auf der Ablauffläche abgestellt werden. Außerhalb ihres Labors ist Jane die Ungeschicklichkeit in Person. Sie hat die Angewohnheit, den Kopf von dem abzuwenden, womit ihre Hände gerade beschäftigt sind, wie eine zartbesaitete Schwesternschülerin, die einen blutigen Blinddarm hochhält. Sie streckt beispielsweise die Hand mit einem Zigarettenstummel nach links zu einem Aschenbecher aus, sieht dabei jedoch nach rechts und drückt die Zigarette in einer Untertasse, einem Buch, auf dem Tischtuch oder einem Teller mit Essensresten aus. Unkoordinierte Frauen, kurzsichtige Frauen, hoch aufgeschossene, unbeholfene, linkische Frauen haben schon immer eine ungeheure Faszination auf mich ausgeübt.
So langsam werde ich wach. Die letzten Traumbläschen sprudeln davon, und ich stehe vor der allmorgendlichen Aufgabe, mein Selbst neu zu erfinden. Ich starre an die Decke und erinnere mich an alles Nötige.
Wir lassen mich im Bett liegen, bis ich mich wieder zusammengesetzt habe. Ich weiß nicht genau, ob ich diese Geschichte in der richtigen Reihenfolge erzähle. Sie ist, wie gesagt, von jedem Punkt aus zugänglich wie ein Kreis. Sie ist leider auch wie ein Kreis von jedem Punkt aus unzugänglich.
Geschichte ist mein Metier.
Schon der erste Fehlstart. Geschichte ist alles andere als mein Metier. Immerhin beschreibe ich die Geschichte inzwischen nicht mehr als meine »Branche«, wofür ich vielleicht ein paar Punkte verdient habe. Geschichte ist meine Leidenschaft, meine Berufung. Oder um mit der schmerzlichen Wahrheit nicht hinter dem Berg zu halten, sie ist das Gebiet meiner geringsten Unwissenheit. Sie ist die Beschäftigung, der ich im Moment nachgehe. Mit etwas mehr Geduld und Disziplin hätte ich Literatur studiert. Nun kann ich zwar so gut wie jeder andere Middlemarch oder die Dunciad lesen oder mich, was weiß ich, in Julian Barnes oder Jay McInerney vertiefen, aber mir fehlt diese kleine Gehirnpartie, jener zusätzliche Lobus, den jeder Student der Literaturwissenschaft von Natur aus mitbringt, der Lobus, der ihm die Distanz und die Traute gibt, über Bücher (in seiner Ausdrucksweise Texte) zu reden, so wie andere über Vertragsabschlüsse oder Zellstrukturen reden. Ich weiß noch, wie wir in der Schule eine Ode von John Keats, ein Sonett von Shakespeare oder ein Kapitel aus der Farm der Tiere gelesen haben. Ich wurde immer ganz kribbelig und hätte weinen können, nur über die Wörter, über nichts anderes als die Abfolge von Klängen. Aber sobald ich einen dieser gefürchteten Aufsätze schreiben sollte, zappelte und strampelte ich mir einen ab. Ich habe nie herausgefunden, wo man anfangen muß. Wie findet man die Distanz und wie bewahrt man ruhig Blut, um in einem akademisch akzeptablen Stil über etwas zu schreiben, das einen trudeln, eiern und flennen läßt?
Ich erinnere mich an ein Kind in einem Roman von Charles Dickens, Schwere Zeiten, glaube ich, ein Mädchen, das bei Schaustellern aufgewachsen war und ihre gesamte Zeit mit Pferden verbracht, sie gestriegelt, gefüttert, dressiert und geliebt hatte. In dem Roman gibt es eine Szene, wo Gradgrind (es ist Schwere Zeiten, ich habe eben nachgesehen) einem Besucher seine tolle Schule vorführt und das Mädchen auffordert, »Pferd« zu definieren. Das arme Ding verliert natürlich auf der Stelle die Fassung, stottert, ringt nach Worten und starrt verzweifelt auf den Boden wie ein Mongo.
»Mädchen Nummer Zwanzig nicht imstande auseinanderzusetzen, was ein Pferd ist«, sagt Gradgrind und wendet sich mit höhnischem Grinsen an Bitzer, einen Straßenjungen, der es faustdick hinter den Ohren hat. Dieser Schlawiner hat wahrscheinlich in seinem ganzen Leben noch nicht den Mumm aufgebracht, ein Pferd auch nur zu streicheln, ihm macht es wahrscheinlich eher Spaß, mit Steinen nach ihnen zu schmeißen. Der kleine Fiesling steht auf, lächelt süffisant und legt los: »Vierfüßig. Grasfressend. Vierzig Zähne …« und so weiter, wird bewundert und bekommt tosenden Applaus.
»Nun, Mädchen Nummer Zwanzig, weißt du, was ein Pferd ist«, sagt Gradgrind.
Jedesmal, wenn ich in der Schule einen Aufsatz zum Thema »In Wordsworths Prelude manifestiert sich der Egotismus ohne das Erhabene: Diskutieren Sie diese These« schreiben sollte und ihn kurz darauf mit einer Fünf oder Sechs zurückbekam, hatte ich das Gefühl, ich wäre dieser stotternde Pferdefan und alle anderen in der Klasse mit ihren Einsen und Zweien wären die gemeinen Klugscheißer und Papageien, die schon längst keine Seele mehr hatten. Über Bücher, Gedichte und Theaterstücke konnte man nur dann erfolgreich schreiben, wenn sie einen im Grunde kaltließen. Hysterisches Schülergewäsch, keine Frage, eine Einstellung, die allein aus Egotismus, Eitelkeit und Feigheit bestand. Aber wie tief empfunden! Während der ganzen Oberstufe war ich der Überzeugung, »Literaturwissenschaft« sei eine einzige Abfolge von Autopsien, vorgenommen von herzlosen Technikern. Schlimmer noch: Biopsien. Vivisektionen. Sogar mit Filmen – und ich liebe Filme über alles, mehr als mein Leben –, sogar mit Filmen machen die das inzwischen. Wenn man heutzutage noch über Filme sprechen will, geht das nicht mehr ohne Methodologie. Sobald eine Sache zum Lehrstoff wird, ist sie eigentlich gestorben. Ich fand, daß ich in der Geschichte festeren Boden unter den Füßen hatte: Rasputin, Talleyrand, Karl den Fünften oder Kaiser Wilhelm liebt man schließlich nicht. Wie denn auch? Ein Historiker kann sich den angenehmen Luxus leisten, von seinem sicheren Schreibtisch aus darauf hinzuweisen, wo Napoleon Scheiße gebaut hat, wie diese Revolution hätte vermieden, jener Diktator gestürzt oder jene Schlachten hätten gewonnen werden können. Ich stellte fest, daß ich mit vollkommener Leidenschaftslosigkeit an die Geschichte herangehen konnte, wo per definitionem alle mausetot sind. Bis zu einem gewissen Grad. Und damit hätte sich der Kreis zu der Geschichte, um die es hier geht, wieder geschlossen.
Als Historiker sollte ich imstande sein, klipp und klar von den Begebenheiten zu berichten, die sich zutrugen, als … aber wann trugen sie sich denn zu? Da besteht doch Diskussionsbedarf. Wenn Sie sich mit meiner Geschichte eingehender befaßt haben, werden Sie verstehen, daß mir einige Probleme unüberwindbar vorkommen. Der Historiker, hat mal jemand gesagt – Burke, glaube ich, vielleicht aber auch Carlyle –, ist ein rückwärtsgekehrter Prophet. Aber das hilft mir bei meiner Geschichte auch nicht weiter. Das Rätsel, das mir im Nacken sitzt, läßt sich am besten mit den folgenden Thesen formulieren.
A: Das Folgende ist nie geschehen.
B: Alles Folgende ist die reine Wahrheit.
Das sollten Sie sich erst mal reinziehen. Es läuft darauf hinaus, daß ich Ihnen die wahre Geschichte von etwas Ungeschehenem erzählen soll. Vielleicht ist das die Definition aller Fiktion.
Diese Einleitung kommt wahrscheinlich nicht besonders gut an. Ich werde selber immer ungeduldig und kriege schlechte Laune, wenn Schriftsteller ihre Prosatechniken in den Mittelpunkt stellen. Dieser Satz verschwindet noch tiefer als die meisten anderen im dehnbaren Schmutz seines eigenen narrativen Rektums, aber dafür kann ich nichts.
Ich habe neulich ein Schauspiel gesehen (Stücke sind nichts im Vergleich zu Filmen, gar nichts. Das Theater ist tot, aber ab und zu schaue ich dem Leichnam gern beim Verwesen zu), in dem eine Figur dem Sinn nach sagte, manche Wahrheiten wären wie eine Schale voller Angelhaken; man wolle sich nur eine klitzekleine Wahrheit anschauen, und plötzlich hätte man den ganzen Posten als schwarzen, stachligen Klumpen in der Hand. Das muß ich unter allen Umständen vermeiden. Ich muß einiges entflechten und entwirren, und wenn schon alle Haken auf einmal kommen, dann sollen sie wenigstens schön aufgereiht sein wie eine Kette aus Büroklammern.
Ich glaube, nach dieser Vorbemerkung darf ich folgende Verknüpfungen vornehmen: Wenn ein kaputter Schnappverschluß, eine alphabetische Nachbarschaft und Alois’ bekanntermaßen bösartige Kater mit ihrem Nachdurst nicht gewesen wären, dann hätte ich Ihnen nichts zu erzählen. Also können wir den Faden auch gleich an der Stelle wiederaufnehmen, die ich bereits als Anfang ausersehen (und wieder verstoßen) habe.
Ich liege also da wie Keats und frage mich: »War es ein Wachtraum oder ein Phantom? Entflohn die Weise – wache, schlafe ich?« Außerdem frage ich mich, warum zum Donnerwetter Jane nicht warm eingemummelt neben mir liegt.
Der Wecker verrät mir den Grund.
Es ist Viertel vor neun.
Das hat sie mir noch nie angetan. Noch nie.
Ich rase ins Badezimmer und wieder hinaus, in den Mundwinkeln klebt noch Zahnpasta.
»Jane!« rufe ich durch Pastabläschen. »Jane, was zum Geier ist denn los? Es ist ja schon halb zehn!«
In der Küche schalte ich den Wasserkessel ein, suche wie verrückt nach Kaffee und sauge dabei panisch an meinen Pfefferminzfluoridlippen. Eine leere Kencotüte und bergeweise Teeschachteln.
»Himbeerrendezvous«, Herrschaftszeiten. Rendezvous? »Orangenglanz«. »Banane- und Lakritztraum«. »Nächtliches Vergnügen«.
Herrgott, was ist denn in sie gefahren? Alle möglichen Teesorten, bloß kein stinknormaler Tee. Und weit und breit keine einzige Kaffeebohne.
Ganz hinten im Küchenschrank … Triumph, hurra. Schmatz! Ein großer Aquafreshkuß für dich, mein Schatz.
»Safeway, kolumbianischer Kaffee, filterfertig gemahlen.« Na also!
Zurück ins Schlafzimmer, mit einem Sprung in die kurze Jeans. Keine Zeit für Boxershorts, keine Zeit für Socken. Barfuß rein in die Segelschuhe, und um die Schnürsenkel kümmern wir uns später.
Wieder in die Küche, wo sich der Kessel gerade abschaltet. Ganz schön viel Brodeln für so wenig Wasser, aber für eine Tasse wird’s reichen, aber locker.
Nein!
Verdammt noch mal, nein!
Nein, nein, nein, nein, nein!
Schnepfe. Blöde Sau. Dumme Kuh. Engel. Doppelschnepfe. Süße. Schlampe.
»Jane!«
»Safeway, kolumbianischer Kaffee, filterfertig gemahlen: auf natürliche Weise entkoffeiniert!«
»Zum Geier!«
Ruhig, Michael. Gaaanz ruhig. Bleib ruhig, mein Sohn.
Das kann mich doch nicht erschüttern. Ich bin Doktorand. Und bald Doktor. Von so was laß ich mich doch nicht unterkriegen. Nicht von solchem Pipifax.
Ha! Genau! Glühbirne über dem Kopf, fingerschnipsendes Heureka, wer hat hier was auf dem Kasten? Yeah.
Diese Pillen, diese Aufputschpillen. Pro-Doze? No-Doze? Irgendwas in der Richtung.
Bevor ich ins Badezimmer schlittere, fällt meinem Unbewußten noch etwas auf. Etwas Wichtiges. Da stimmt etwas nicht. Spielt vorläufig keine Rolle. Dafür ist nachher noch Zeit.
Wo sind sie hin? Wo sind sie bloß hin?
Da seid ihr ja, ihr kleinen Scheißer … ja, kommt zu Mama …
»No-Doze. Damit Sie wach bleiben. Ideal für Prüfungsvorbereitungen, lange Nächte, zum Autofahren usw. Jede Tablette enthält 50 mg Koffein.«
Auf dem Sideboard in der Küche mache ich mich kichernd wie eine Sniefnase auf einer Londoner Nachtclubtoilette ans Zerstoßen, Zerstampfen und Zermahlen.
Das weiße Pulver platzt und funkelt im Kaffeemehl, als ich es mit kochendem Wasser übergieße.
»Safeway, kolumbianischer Kaffee, filterfertig gemahlen: auf unnatürliche Weise rekoffeiniert.«
Das ist doch noch Kaffee. Vielleicht ein klitzekleines bißchen bitter, aber echter Kaffee und keine »Erdbeermilde« oder »Nessel- und-Kamille-Ptisane«. Und du willst ernsthaft behaupten, ich wäre auf den Kopf gefallen, Jane? Ha! Na warte, bis ich dir das heute abend erzähle! Ich habe Paul Newman in Ein Fall für Harper übertroffen. Der hat bloß eine alte Filtertüte recycelt, hab ich recht?
Viertel vor zehn. Tutorium um elf. Keine Panik. Geruhsam stakse ich mit dem Becher in der Hand ins Gästezimmer. Der hab ich’s aber gezeigt, Mann!
Der Apple ist kalt. Die olle Meckerziege blökt nicht mehr. Wer weiß, wann ich mich wieder dazu herablasse, dich einzuschalten, Maccie Thatcher?
Und daneben, auf dem Schreibtisch, sauber aufgeschichtet in all seiner Pracht und obszönen Dicke: Das Meisterwerk höchstpersönlich.
Ich wahre gebührenden Abstand und verrenke mir nur von weitem den Hals; die glorreiche Titelseite darf von keinem noch so winzigen Kaffeefleck verunziert werden.
Von Braunau nach Wien:
Die Wurzeln der Macht.
Michael Young, MA MPhil
Platz da, jetzt komm ich! Vier Jahre. Vier Jahre und zweihunderttausend Worte. Da steht die blöde Tastatur, so plastifiziert stumm, so komisch nichtssagend.
QWERTZUIOPÜASDFGHJKLÖÄYXCVBNM1234567890!
Mehr stand mir nicht zur Verfügung. Nur diese zehn Ziffern, sechsundzwanzig Buchstaben (plus Umlaute für deutsche Zitate), die sich zu zweihunderttausend Worten permutieren ließen. Außerdem hier ein Komma und da ein Semikolon. Aber ein Sechstel meines Lebens, ein volles Sechstel meines Lebens lang, beim großen schönen Buddha, hat mich diese Tastatur wie ein Krake umklammert.
Dann wolln wir mal! Einmal strecken, und die Morgengymnastik wäre auch geschafft. Ich stöhne vor Behagen und gehe in die Küche zurück. Die 150 Milligramm Koffein sind abgezischt wie eine Rakete und mit voller Sprengkraft im Hirn detoniert. Jetzt bin ich wach. Putzmunter.
Jawohl, jetzt bin ich wach. Und auf alles gefaßt.
Gefaßt auf das irgendwie veränderte Badezimmer.
Gefaßt auf einen Zettel, der zwischen der übriggebliebenen Käserinde und der leeren Weinflasche von gestern abend auf dem Küchentisch liegt.
Gefaßt auf den Grund, warum ich nicht um Punkt acht Uhr wach war wie geplant.
Machen wir uns doch nichts vor, Pup. Wir passen nicht zueinander. Ich rufe im Lauf des Tages wegen meiner restlichen Sachen an. Dann können wir auch besprechen, wieviel ich Dir für das Auto schulde. Herzlichen Glückwunsch zur Dissertation. Wenn du etwas Abstand gewonnen hast, wirst du mir zustimmen. J.
Schon während der obligaten Phasen von Schock, Wut und Gebrüll fällt mir ein kleiner Stein vom Herzen, zumindest macht sich das Bewußtsein breit, daß diese elegante kleine Notiz definitiv auf einen kleineren und unbedeutenderen Gefühlsbereich zugreift als vorhin der fehlende Kaffee oder die Möglichkeit, sie habe mich absichtlich verschlafen lassen, oder am meisten jetzt ihre lässige, arrogante Annahme, sie würde mein Auto bekommen.
Der Zornausbruch soll dann nur noch die Form wahren und macht Jane nachgerade ein Kompliment. Das Zerschmeißen der Weinflasche – der Weinflasche zur Feier des Tages, die ich am Vorabend so sorgfältig bei Oddbins ausgesucht hatte, der Châteauneuf du Pape, auf den ich ein Sechstel meines Lebens hingearbeitet hatte – ist lediglich eine Geste, das erforderliche theatralische Einverständnis, daß das Ende von drei gemeinsamen Jahren wenigstens etwas Lärm und Spektakel verdient hat.
Wenn sie ihre »restlichen Sachen« abholt, wird sie die elegant geschwungene Spur roten Sediments an der Wand entdecken, ihre Plattfüße werden über die knirschenden Scherben laufen, und sie wird voller Genugtuung glauben müssen, es machte mir etwas aus, und damit hat’s sich dann. Jane&Michael sind nicht mehr, und jetzt ist Jane hier und Michael ist dort, und Michael ist zu guter Letzt jemand geworden. Mit John Lennons Worten, jemand in seiner eigenen Schreibe.
Also.
Als ich im Arbeitszimmer stehe und nach dem Meisterwerk greife, es abwäge und behutsam in meine Aktentasche schieben will, bekomme ich plötzlich Stielaugen wie Roger Rabbit, schreie auf und glotze einen kleinen Fleck auf der Titelseite an. Er ist dort wie das Melanom eines alten Surfers aus heiterem Himmel aufgetaucht, während des kurzen Augenblicks, wo ich mich in der Küche mit Weinflaschenschmeißen vergnügt habe. Ein Kaffeefleck ist es ganz bestimmt nicht, vielleicht also bloß ein Papierfehler, der nur in der hellen Maisonne überhaupt sichtbar wird. Keine Zeit, den Computer booten zu lassen und die Seite noch einmal auszudrucken, also schnapp ich mir ein Fläschchen Tippex, betupfe die freche Sommersprosse mit der Pinselspitze und blase sie sanft trocken.
Ich nehme das Blatt zwischen die Fingerspitzen, trete vor die Haustür und halte es in die Sonne. Kaum was zu sehen. Alles in Butter.
Neben dem Telegrafenmast ist die Parklücke, wo der Renault stehen sollte.
»Blöde Schnepfe!«
O je. Schlechter Zug.
»’tschuldigung!«
Das kleine Zeitungsmädchen schert aus und rast davon, beugt sich über den Lenker und erinnert sich an jede einzelne Schreckensmeldung, die es je auf den Titelseiten der Zeitungen gesehen hat, die es allmorgendlich auf den Fußmatten verteilt. Das sag ich meiner Mami.
Ach du meine Güte. Laß ihr lieber einen Vorsprung, sonst glaubt sie noch, du wärst hinter ihr her, und dann bist du bei ihr erst recht unten durch. Ich weiß nicht, wofür wir überhaupt eine Tageszeitung brauchen. Jane ist ein Zeitungsjunkie, das ist es. Wir bekommen sogar die ›Cambridge Evening News‹ im Abonnement. Jeden Nachmittag. Also mal ehrlich: tut das not?
Ich gehe ums Haus und hole das Fahrrad aus dem Durchgang. Ich mag das Surren der Räder. Mann, ich bin jung. Ich bin frei. Ich habe frisch geputzte Zähne. In meinen guten alten Schulranzen schmiegt sich eine Zukunft. Schmiegt sich die Zukunft. Die Sonne scheint. Zur Hölle mit allem anderen.
Frühstück machen
Der Gestank der Ratten
Alois schwang sich in den Sattel, schob den Rucksack über den Schultern zurecht, trat rhythmisch in die Pedale und fuhr den Hügel hinauf. Die grünen Streifen seiner Uniformhose und der goldene Adler an seinem Helm blitzten in der Sonne. Klara sah ihm nach und fragte sich, warum er sich nie in den Pedalen aufstellte, um mehr Schwung zu bekommen, so wie Kinder das machen. Bei ihm war es stets derselbe, absolut mechanische, beängstigend regelmäßige und zielstrebig ruhige Vorgang.
Sie war um fünf aufgestanden, hatte den Ofen angeheizt und den Küchentisch gescheuert, bevor das Dienstmädchen erwachte. Sie hatte immer das Bedürfnis, die Glassplitter zusammenzuklauben und die Weinflecken und klebrigen Schnapslachen wegzuwischen. Als hoffte sie, der Anblick eines sauberen Tisches werde Alois vergessen lassen, wieviel er am Vorabend getrunken hatte. Außerdem sollten die Kinder die Überreste der »häuslichen Abende« des Vaters nicht zu Gesicht bekommen.
Als Anna, das Dienstmädchen, um sechs aufstand, rümpfte es wie immer die Nase, als es den sauberen Tisch sah, und hinter Alois’ Rücken, der vor dem Ofen seine Stiefel wienerte, schien die gerümpfte Nase Klara sagen zu wollen: »Ich kenne dich. Wir sind uns gleich. Auch du hast als Dienstmädchen angefangen. Du warst nicht einmal Hausangestellte, sondern nur Küchenmagd. Und im Grunde deines Herzens bist du das heute noch und wirst es immer bleiben.«
Wie immer hatte Klara ihrem Gatten beim Polieren zugesehen und war eifersüchtig auf die Uniform, der er soviel Liebe, Hingabe und Stolz entgegenbrachte. Vom Hin und Her der Bürste auf dem Leder eingelullt, hatte sie sich wie immer nach Spital zurückgesehnt, nach ihrem Heimatdorf mit seinen Feldern, Milcheimern und dem Silagegeruch, nach ihren Brüdern und Schwestern und deren Kindern, weit weg von dem Ansehen, der Förmlichkeit und Brutalität von Onkel Alois, den Uniformen und Menschen, deren Gespräche und Umgangsformen sie nicht verstand.
Onkel Alois! Er hatte ihr doch verboten, ihn je wieder so zu nennen.
»Ich bin nicht dein Onkel, Mädchen. Allenfalls ein angeheirateter Vetter. Nenn mich ja nicht Onkel. Haben wir uns verstanden?« Aber in ihren Selbstgesprächen war die Gewohnheit stärker. Für sie war er seit frühester Kindheit Onkel Alois, und das würde er auch immer bleiben.
Er hatte am Vorabend nicht mehr getrunken als sonst und war auch nicht roher, ausfallender oder beleidigender geworden als sonst. Bei ihm war es stets derselbe absolut mechanische, beängstigend regelmäßige und zielstrebig ruhige Vorgang.
Wenn er ihr weh tat, unterdrückte sie jeden Laut, der Angela oder den kleinen Alois wecken konnte, denn sie konnte die Vorstellung nicht ertragen, daß sie erfuhren, was der Vater ihr antat. Klara war nicht sonderlich intelligent, aber sie war empfindlich und wußte genau, daß ihre Stiefkinder statt des Mitleids nur Verachtung für sie übrig hätten, sollten sie je erfahren, daß sie sich so gehorsam in die Prügel des Vaters schickte. Schließlich stand sie, so lächerlich das auch war, im Alter den Kindern näher als ihrem Mann. Wahrscheinlich war er deswegen auch so wild entschlossen, mit ihr Kinder zu zeugen. Er wollte, daß sie älter wurde, daß sie von einem einfältigen Mädchen vom Lande zur Mutter heranreifte. Sie sollte den Silagegeruch ablegen. Etwas Fett ansetzen, etwas Substanz und Ansehen gewinnen. O ja, Ansehen war sein ein und alles. Aber er war ja auch ein Bastard. Das war das einzige, was sie ihm voraus hatte. Sie war vielleicht ein einfältiges Mädchen vom Lande, aber sie wußte wenigstens, wer ihr Vater war. Onkel Alois der Bastard wußte nicht, wer sein Vater war. Aber auch sie wollte Kinder von ihm. Sie wünschte sie sich verzweifelt.
Vor drei Jahren war ihr Sohn Gustav nach nur einer Woche gestorben, und in dieser Woche hatte er mit blau angelaufenem Gesicht ununterbrochen gehustet. Im Jahr darauf hatte sie ein totes Mädchen zur Welt gebracht, und erst vor einem Jahr hatte ihr kleiner Josef, tapfer wie ein Kampfhahn, einen Monat lang gerungen, bevor auch er dahingerafft wurde. Danach begannen die Schläge. Onkel Bastard hatte eine Nilpferdpeitsche gekauft und mit schrecklichem Lächeln an die Wand gehängt.
»Das ist Pnina«, sagte er. »Pnina die Peitsche, unser neues Kind.«
Klara stand an der Tür und sah der uniformierten Gestalt nach, die kerzengerade die Hügelspitze erreichte. Nur Alois konnte einem so lächerlichen Gefährt wie dem Fahrrad Würde verleihen. Und wie er es liebte. Jede neue Entwicklung von Patentreifen, Pedalen und Ketten erregte ihn. Gestern hatte er dem kleinen Alois ganz ergriffen aus der Zeitung vorgelesen. In Mannheim hatte ein Ingenieur namens Benz ein dreirädriges Fahrzeug gebaut, das in einer Stunde ohne jedes menschliche Zutun fünfzehn Kilometer weit fuhr, ohne Pferde und ohne Dampf.
»Stell dir vor, mein Sohn! Wie ein kleiner Privatzug, der keine Gleise braucht! Eines Tages werden wir eine solche Maschine mit Selbstantrieb haben, und dann reisen wir zusammen wie die Fürsten nach Linz oder Wien.«
Klara kehrte ins Haus zurück und sah Anna zu, die Eier für die Kinder briet.
»Soll ich das nicht machen?« wollte sie erst sagen. Inzwischen konnte sie diesen Impuls jedoch unterdrücken, ging statt dessen mit aufkeimenden Schuldgefühlen zum leeren Eimer an der Hintertür und spürte mehr, als daß sie es sah, wie sich Anna beim Quietschen des Henkels zu ihr umdrehte.
»Soll ich das …«, setzte Anna an, aber Klara war schon aus dem Haus, und die Küchentür hatte sich geschlossen, noch bevor sie den etwas vorwurfsvollen Satz beendet hatte.
Mit leichter Belustigung stellte Klara fest, daß sie ihren Gang zum Brunnen wieder einmal so abgepaßt hatte, daß im selben Augenblick der Zug nach Innsbruck vorbeibrauste. Sie stellte sich vor, wie er durch Wiesen und an Gehöften vorbeischnaufte, und sah vor ihrem geistigen Auge ihre Neffen und Nichten in Spital auf und ab hüpfen und dem Lokomotivführer zuwinken. Sie pumpte den Schwengel schneller auf und ab, und das in den Eimer schießende Wasser fand zum Gleichtakt mit der mächtigen Dampflokomotive, die ihre kaiserlichen weißen Schnurrbärte hoch in den Himmel stieß.
Dann kam der Gestank. O Gott, welch ein Gestank.
Klara hielt sich die Hand vor Mund und Nase, aber vergebens. Erbrochenes tropfte ihr durch die Finger, als ihr Körper den Gestank, diese entsetzliche Luftverpestung mit Gewalt loswerden wollte. Tod und Verwesung erfüllten die Luft.
Seinen Weg machen
Parks
Es war dumm gewesen, keine Socken anzuziehen. Als ich an der Mill vorbeikam, hatte ich schon schmerzende Käsemauken. Und ich schwitzte am ganzen Körper.
Als ich lustlos über die Brücke an der Silver Street strampelte, laberten sich überall die fröhlichen Studienanfänger voll, hüpften zwischen den Autos über die Straße und stellten jene Melange aus Lebensmüdigkeit und aufgeblasenem Schwung zur Schau, die ihre Existenzberechtigung darstellt. Ich konnte mir das als Student nicht leisten. Ich mußte auf mein Image achten. Allein schon diese Angewohnheit von Studenten, ihre Namen über die Straße zu posaunen.
»Lucius! Biste doch noch zu der Fete gegangen?«
»Kate!«
»Dave!«
»Mark, man sieht sich, Mann!«
»Bridget, hi, Babe!«
Wenn ich nicht dazugehörte, müßte ich kotzen.
Ich erinnerte mich an ein riesiges Graffito in der Downing Street, das ungefähr zur Zeit des Zusammenbruchs des Kommunismus angebracht worden sein mußte und das am Backstein des Museums für Archäologie und Anthropologie immer noch trotzig und deutlich zu lesen war.
HIER KOMMT DIE MAUER NICHT WEG.
KILLAGRAD 85
Einem Kind, das in Cambridge aufgewachsen ist, kann man wohl kaum Vorwürfe machen, wenn es sich wieder als Klassenkämpfer aufführt. Stellen Sie sich vor, Sie sind Ihr ganzes Leben von langhaarigen Fabiern und neureichen Gymnaseweisen mit Baseballmützen umgeben, die Geld und Aussehen, Geld und Wuchs, Geld und Appeal, Geld und Bücher und Geld und Geld mitbringen. Wichser.
Wichser! schrien die Klassenkämpfer einem in Stadionchören zu. Wich-ser! Von anschaulichen Gesten begleitet.
Killagrad 85. Das Museum für Archäologie und Anthropologie sollte die verblichenen Schriftzüge restaurieren lassen und als sein wertvollstes Exponat hegen und pflegen, ein Fresko mit mehr Aussagekraft als all die keltischen Amulette in Vitrinen, all die angestrahlten Gefäße der Inkas und Nasenknochen aus Borneo.
Ein Kollege aus Oxford (es ist einfach herrlich, sein Studium abgeschlossen zu haben, ein Junior Bye Fellow zu sein und Wörter wie »Kollege« benutzen zu können), ein Kollege also, ein Mithistoriker, hat mir von einem Foto erzählt, das dort in einer Galerie hing. Eigentlich waren es zwei Fotos, Seite an Seite, die zwei verschiedene Glascontainer zeigten. Der eine war am Stadtrand von Cowley aufgenommen worden, in der Nähe der Autowerke. Der Container war wie alle Altglascontainer in drei Abteilungen unterteilt, deren Anstrich den Glassorten entsprach, die für sie bestimmt waren. Es gab also eine weiße Abteilung für durchsichtiges Glas, eine grüne für Weinflaschen und schließlich noch – dreimal so breit wie die beiden anderen – eine braune Abteilung für Bierflaschen. Das zweite Foto schien auf den ersten Blick dasselbe Motiv zu zeigen, wieder ein Glascontainer, aber diesmal mitten in Oxford auf dem Campus aufgenommen. Nach der ersten Verwirrung war der Unterschied einfach umwerfend. Eine weiße Abteilung, eine braune Abteilung und, aufgepaßt, dreimal so breit wie die beiden anderen, eine grüne Abteilung. Was braucht man mehr über die Welt zu wissen? Das Foto dieser beiden Glascontainer sollte man zum Sendeschluß als Standbild ausstrahlen, untermalt von der Nationalhymne.
Nicht, daß ich zu einer Generation gehörte, die angesichts sozialer Ungerechtigkeit Bambule machte, alle Welt weiß schließlich, daß Politik uns piepegal ist. Wir alle wollen nur einen Job, und verdammt noch mal, Liebe geht vielleicht durch den Magen, aber Karriere durch den Darm. Im übrigen bin ich Historiker. Ein Historiograph, wenn ich bitten darf.
Ich richtete mich im Sattel auf, kreuzte die Arme vor der Brust, radelte freihändig an der University Press vorbei und summte einen Song von Oily-Moily.
I’ll never be a woman
I’ll never be you
Ich habe irgendwann die Übersicht verloren, wie viele Fahrräder ich im Lauf der letzten sieben Jahre besessen habe. Mein jetziges Modell ist ausnahmsweise so gut ausbalanciert, daß ich freihändig fahren kann, was ich voll abgespacet finde.
Mit dem Fahrraddiebstahl in Cambridge sieht es ähnlich aus wie mit dem Autoradiodiebstahl in London oder dem Handtaschenraub in Florenz – er ist eine Landplage. Jeder Drahtesel trägt auf dem hinteren Schutzblech eine elegante und überflüssige Nummer. In längst vergangenen Zeiten, die für die Stadt schmachvoll hätten sein sollen, hat man sogar ein Projekt angeleiert. Gott bewahre uns vor Projekten, hab ich nicht recht? Die Stadtväter kauften Tausende von Fahrrädern, ließen sie grün lackieren und stellten sie über die ganze Stadt verteilt in kleinen Fahrradparks auf. Dahinter stand die Vorstellung, man könne sich einfach auf ein Rad schwingen, fahren, so weit man wolle, und es dann einfach für den nächsten Benutzer auf der Straße stehenlassen. Welch eine süße Idee, so William-Morris-mäßig, so utopisch, so idiotisch.
Leser, du wirst erstaunt sein, verblüfft, ja wie vom Donner gerührt wirst du sein, wenn du erfährst, daß innerhalb einer Woche all die grünen Fahrräder verschwunden waren. Spurlos. Aber das Projekt hatte etwas so Süßes, Gutgläubiges, Hoffnungsvolles, Edles und Huärgh, daß die Stadt am Ende stolz war und sich nicht etwa schämte. Wir lachten uns ins Fäustchen. Und als der Stadtrat ein neues, verbessertes Projekt vorstellte, wälzten wir uns brüllend vor Lachen am Boden und flehten sie an, ein Ende zu machen.
Das Blöde ist, daß man wegen der vielen Pflasterstraßen in Cambridge nicht Rollschuh laufen kann. Es gibt eine traurige kleine Inline Skating Society und eine Monoblades Society, die so tut, als wäre Midsummer Common der Central Park, aber das kauft euch doch keiner ab, Kids. Es müssen Fahrräder sein, und in der flachsten Landschaft Britanniens, wo schon ein Hundehaufen die Aufmerksamkeit der Mountaineering Society anzieht, sind Mountain Bikes auch nicht der Bringer.
Die Stadtväter von Cambridge lieben das Wort »Park«. Da man nirgends in der Stadt parken kann, benutzen sie das Wort so oft wie möglich in anderen Zusammenhängen. Cambridge muß so ungefähr die erste Stadt mit Park-and-Ride-Bussen gewesen sein. Die Stadt rühmt sich eines Wissenschaftsparks, eines Wirtschaftsparks und natürlich der eben beklagten Fahrradparks. Es sollte mich nicht wundern, wenn wir zur Jahrhundertwende Sexparks, Internetparks und Einkaufparks haben, denen Parkparks mit Schaukeln und Rutschen den letzten Schliff geben.
Es gibt viele Gründe, warum man in Cambridge nicht parken kann. Die Straßenbreite in dieser kleinen, mittelalterlichen Stadt wird von den Collegegebäuden vorgeschrieben, die sich wuchtig und unbeweglich wie Bergketten gegenüberstehen. In den Semesterferien platzt die Stadt vor Touristen, ausländischen Studenten und Tagungsteilnehmern aus allen Nähten. Darüber hinaus ist sie die Hauptstadt der Fens, das einzige ernstzunehmende Einkaufszentrum für Hunderttausende aus Cambridgeshire, Huntingdonshire, Hertfordshire, Suffolk und Norfolk, die armen Schweine. Im Mai hingegen, im Mai gehört Cambridge den Prüfungskandidaten, all den jungen Trendlümmeln mit ihren struppigen Ziegenbärten und gepflegten Koteletten. Die Colleges schließen ihre Tore, und ein einziges Wort erhebt sich über die Stadtmitte und schwillt an wie ein wassergefüllter Luftballon kurz vor dem Platzen.
Büffeln.
Cambridge im Mai ist ein Büffelpark. Die Flußufer und Rasen, Bibliotheken, Courts und Korridore erblühen mit bunten jungen Bregenknospen, die über Büchern aufbrechen sollen. Panik, echte Panik, von einer Sorte, die bis in die achtziger Jahre hinein völlig unbekannt war, überschwemmt die Studenten im dritten Jahr wie eine Sturmflut. Examina fallen plötzlich ins Gewicht. Abschlußnoten zählen.
Außer man hat – wie ich – schon vor einer halben Ewigkeit sein Examen gemacht, ist dem Ruf des Strebers gerecht geworden, hat eine Eins bekommen, seine Doktorarbeit geschrieben und ist jetzt frei.
Frei! schrie ich mir zu.
Freeii! antworteten das Fahrrad im Freilauf und die vorbeiwischenden Gebäude.
Junge, Junge, was habe ich mich an jenem Tage geliebt.
Sogar das Brennen und Drücken der Blasen an den Füßen. Zum Kuckuck, warum hätte ich mir denn auch Sorgen machen sollen? Wie viele Menschen können sich denn schon im Brustton der Überzeugung als frei bezeichnen?
Auch von Jane befreit. Weiß noch nicht genau, wie ich das finde. Schließlich muß ich fairerweise zugeben, daß sie meine erste echte Freundin war. Ich habe als Student nie zur Casanovafraktion gehört, weil ich – es läßt sich ja doch nicht verheimlichen – schüchtern bin. Es fällt mir schwer, den Leuten in die Augen zu sehen. Meine Mutter hat immer über mich gesagt (vor mir allerdings auch): »In Gesellschaft wird er leicht rot, wißt ihr.« Das hat natürlich unheimlich geholfen.
Ich war erst siebzehn, als ich an die Uni kam, und als schnell errötendes Milchgesicht, das besonders auf Mädchen nicht den geringsten Charme ausübte, bin ich nur alle Jubeljahre mal unter Leute gegangen. Schulkameraden traf ich sowieso nicht wieder, weil ich eine Staatsschule besucht habe, die vor mir noch niemanden nach Cambridge geschickt hat, und ich war scheiße in Sport, Journalismus, Schauspielen und allem anderen, was einen bekannt macht. War scheiße, weil es einen bekannt macht, nehm ich an. Nein, ich war scheiße, weil ich scheiße war, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und Jane war dann eben … na ja, mein Leben.
Aber jetzt: Platz da, jetzt komm ich! Wenn ich in vier Jahren eine Doktorarbeit abschließen und eigenhändig Safeway’s auf natürliche Weise entkoffeinierten Kaffee rekoffeinieren kann, dann stehe ich allein meinen Mann.
Jede Fiona und jede Frances, die über ihrem Flaubert die Stirn furchte, erschien dem neuen, freien Michael in neuem, freiem Licht, und freihändig fuhr ich vor den Toren von St. Matthew’s vor, frei stieg ich ab, schob das frei surrende 4857M an der Pförtnerloge vorbei und fühlte mich frei.
Nachrichten machen
Wir Deutsche
Alois schob sein Fahrrad durch das Tor und an der Wachstube vorbei.
»Grüß Gott!«
Klingermanns Fröhlichkeit bei diesen Inspektionsvisiten ärgerte ihn jedesmal. Der Mann hatte gefälligst nervös zu sein.
»Gott«, murmelte er, halb zur Begrüßung und halb als Fluch.
»Heute morgen ist alles ruhig. Herr Sammer hat über das Telephonding eine Nachricht geschickt, daß er nicht kommen kann. Eine Sommergrippe.«
»Na, im Juli wird es wohl kaum eine Wintergrippe sein, was, mein Junge?«
»Nein, Herr Zollbeamter«, sagte Klingermann augenzwinkernd und faßte das als guten Witz auf, was Alois noch mehr aufbrachte. Und dann diese Angst vor dem Telephon, das er stets »das Telephonding« nannte, als handle es sich dabei nicht um die Zukunft, sondern um einen teuflischen Apparat, der die Welt ins Verderben stürzen würde. Ein bäurisches Weltbild. Es waren schon immer die bäurischen Weltbilder gewesen, die den Fortschritt in diesem Lande hemmten.
Betont kühl ging Alois an Klingermann vorbei, setzte sich an den Tisch, zog eine Zeitung und eine Flasche Schnaps aus dem Rucksack und machte sich an die Lektüre.
»Wie meinen, Herr Zollbeamter?« fragte Klingermann.
Alois beachtete ihn nicht und warf die Zeitung beiseite. Er hatte nur »Scheiße« geknurrt. Er trank einen anständigen Schluck Schnaps und starrte aus dem Fenster über die Grenzpfosten nach Bayern, ins Deutsche Reich, wie die Scheißer sich neuerdings nennen durften. Ins Deutsche Reich, wo man in Mannheim bereits an pferdelosen Beförderungsmitteln arbeitete. Wo man Telephonnetze baute, die das ganze Land überzogen, und wo dieses Schwein Bismarck schon noch sein Fett abkriegen würde.
»Wir Deutsche fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt«, hatte das alte Schwein im Reichstag gepoltert und wahrscheinlich erwartet, der Russe und der Franzose würden sich vor der Macht des Dreibunds, seinem Steckenpferd, in die Hose machen. »Wir Deutsche!« Was zum Teufel sollte das denn heißen? Dieser hinterhältige Schweinehund mit seinen Kriegen in Dänemark, der den Österreichern die Zunge rausstreckte: Ätschi-bätschi, ihr dürft nicht mitspielen. »Wir Deutsche« umfaßte nur, was das alte Schwein wollte. Preußen. Stockbesoffene Junker. Die bestimmten das. Westfalen konnten Deutsche werden, aber sicher. Hessen, Hamburger, Thüringer und Sachsen konnten Deutsche werden. Selbst die verdammten Bayern konnten Deutsche werden. Nur die Österreicher nicht. O nein. Die sollten mit den Tschechen, Slowaken, Ungarn und Serben in der Gosse bleiben. Mußte es denn nicht selbst für ein Arschloch wie Bismarck auf der Hand liegen, daß die Österreicher und die Deutschen von jeher … ach, es hatte ja doch keinen Zweck. Es war auch egal, das alte Schwein würde schon noch sein Fett abkriegen.
Wilhelm, diese Pißfresse, war seit einigen Wochen tot, die Trauerzeit war vorbei, und Friedrich Wilhelm hatte als Friedrich III. den Thron bestiegen. Friedrich und Bismarck haßten sich, ha-ha! Lebe wohl, eiserner Kanzler! Verdammtes Glück, daß wir dich bald los sind, altes Schwein. Deine Tage sind gezählt.
Ein Karren kam auf sie zu. Alois erhob sich und strich den Uniformrock glatt. Er hoffte, daß es ein Bayer war und kein zurückkehrender Österreicher. Ein Deutscher. Bei seinen Inspektionen der Zollwachen machte es ihm immer einen Heidenspaß, Deutsche zu drangsalieren.
Fertig machen
Das Postfach
Bill der Pförtner sah an seinem Fenster hoch, als ich mein Fahrrad an ihm vorbeischob. Ich fürchtete schon lange, daß er mich auf dem Kieker hatte.
»Guten Morgen, Mr. Young.«
»Nicht mehr lange, Bill.«
Er sah mich verwirrt an. »Laut Wetterbericht schon.«
»Nicht mehr lange ›Mister‹«, sagte ich lächelnd, wurde rot und hielt die Tasche hoch, die das Meisterwerk beherbergte. »Ich habe meine Doktorarbeit abgeschlossen.«
»Aha«, sagte Bill und widmete sich wieder seinem Schreibtisch.
Wäre ja auch zuviel verlangt, daß er sich über meinen Triumph freuen sollte. Wer wird wohl je die peinliche Dialektik von Herr und Knecht im ausgehenden 20. Jahrhundert durchschauen? Es ist schon riskant, es eine Dialektik von Herr und Knecht zu nennen. Die Pförtner hatten ihre »Sirs«, »Ma’ams« und konnten ihre Melonen lüpfen, und wir hatten unser dümmliches, übertriebenes und katzbuckelndes Grinsen, um die Standesunterschiede zu kaschieren. Wir würden nie erfahren, wie sie uns hinter unseren Rücken nannten. Und sie würden vermutlich nie erfahren, was wir eigentlich den lieben langen Tag so trieben. Vielleicht malten auch die Pförtnersöhne und -töchter das Killagrad 85 an die Wände. Bill wußte, daß die einen Studenten weitermachten, Dissertationen schrieben und als Fellows am College endeten, während die anderen durchfielen oder in die Welt hinauszogen, um reich, berühmt oder vergessen zu werden. Vielleicht machte er sich darüber Gedanken, vielleicht auch nicht. Nichtsdestoweniger wäre mir etwas mehr Denholm Elliott in Trading Places und etwas weniger Judith Anderson in Rebecca ganz lieb gewesen. Finden Sie nicht? Doch? Na also.
»Natürlich«, sagte ich mit hoffentlich reuiger Bescheidenheit und wog die Aktentasche in der Hand, »müssen die Gutachter sie sich jetzt erst einmal anschauen …«
Seine einzige Reaktion bestand in einem Grunzen, also wandte ich mich ab, um nachzusehen, was mir die Post beschert hatte. Ein dickes gelbes Päckchen ragte aus meinem Postfach. Cool! Sanft zog ich es heraus.
Auf dem Absender stand das Logo eines deutschen Verlages mit einem geschichtswissenschaftlichen Programmschwerpunkt. Seligmanns Verlag. Der Name war mir aus meinen Recherchen natürlich ein Begriff, aber verflixt, wie war man dort bloß auf meinen Namen gekommen? Ich hatte nie mit ihnen korrespondiert. Sehr merkwürdig. Und ich hatte bestimmt auch keine Bücher bei ihnen bestellt … aber vielleicht hatten sie ja irgendwie von mir gehört und fragten an, ob ich Interesse hätte, mein Meisterwerk bei ihnen zu veröffentlichen. Megacool!
Die Publikation meiner Doktorarbeit war natürlich mein größter, tiefster, liebster und innigster Herzenswunsch. Und dann auch noch beim Seligmanns Verlag, wow, das wäre wirklich ein roter Tag im Kalender.
Zukunftsträume, Visionen und Wolkenkuckucksheime schossen vor meinem inneren Auge in die Höhe wie der Neubau von Hochhäusern im Zeitraffer; Balken und Giebelsäulen, Stahlträger und Dachsparren flogen zu fröhlicher Xylophonmusik an Ort und Stelle. Ich war schon da, im vollständig eingerichteten und restlos vermieteten Michael Young Tower, nahm Auszeichnungen und Ehrendoktortitel entgegen und signierte liebevoll gestaltete Exemplare meiner beim Seligmanns Verlag erschienenen Dissertation (ich konnte sogar die Farbe des Buches erkennen, die Schrifttype, die Umschlagillustration und das Foto des Autors in würdevoller Pose über dem Klappentext), und all das in der gegen null gehenden Zeitspanne, nachdem ich den Briefkopf gelesen hatte und bevor ich mit quietschenden Bremsen, qualmenden Reifen und sich aufblähendem Airbag den tatsächlichen Adressaten entzifferte. Metaphorisch mittelprächtig verkorkst, aber Sie wissen schon, was ich meine.
»Professor L. H. Zuckermann«, stand da, »St. Matthew’s College, GB – Cambridge CB3 9BX.«
Oh. Also nicht für Michael Young MA.
Ich warf einen Blick auf das Postfach unter meinem. Es war bis zum Platzen gefüllt mit Briefen, Flugblättern und Ankündigungen. Alphabetisch kam an letzter Stelle, noch unter »Young, Mr. Michael D.« »Zuckermann, Prof. Leo«. Ich konnte meine Enttäuschung nicht verbergen, als ich den Adreßaufkleber anstarrte.
»Mist«, sagte ich und versuchte, das Päckchen bei seinem rechtmäßigen Empfänger festzukeilen.
»Sir?«
»Ach, nichts. Da lag bloß eine Sendung für Professor Zuckermann in meinem Postfach, und sein Postfach ist voll.«
»Sie können es mir geben, Sir. Dann sorge ich dafür, daß er es bekommt.«
»Danke, nicht nötig, ich bring’s ihm vorbei. Vielleicht kann er mir sogar helfen … mir ein Empfehlungsschreiben für Verleger mitgeben. Wo hängt er denn rum?«
»Hawthorn Tree Court, Sir. 2A.«
»Wer ist das überhaupt?« fragte ich, während ich das Päckchen in meine Tasche schob. »Ich seh seinen Namen zum erstenmal.«
»Das ist Professor Zuckermann«, lautete die korrekte Antwort.
Paragraphenreiter. Ts.
Ärger machen
Diabolo
»Aber ich bin Deutscher!«
»Nein, Sie sind nichts. Diesen Papieren zufolge sind Sie nichts. Nichts und niemand. Sie existieren nicht.«
»Ein Tag. Sie sind seit einem Tag abgelaufen, das ist alles.«
»Herr Zollbeamter, dieser Mann kommt in regelmäßigen Abständen hier vorbei.« Klingermann warf Alois einen unbehaglichen Blick zu. »Er ist mir … ich kenne ihn gut. Ich kann mich für ihn verbürgen.«
»Soso, Sie können sich für ihn verbürgen, ja, Klingermann? Und warum, glauben Sie wohl, gibt die kaiserlich-königliche Regierung in Wien für Formulare, Briefmarken, Ausweise und Bescheinigungen allmonatlich ein Vermögen aus? Aus Spaß an der Freud? Was glauben Sie eigentlich, was ein Ausweis ist? Das ist ein gestempeltes Dokument, das man jederzeit bei sich haben muß, um sich ausweisen zu können. Oder glaubt dieser nicht existente Bürger des Landes Nirgendwo vielleicht, Sie würden sich als Ausweis in seine Brieftasche legen?«
»Aber als Deutscher habe ich das Recht auf unbehelligte Einreise nach Österreich!«
»Sie sind aber kein Deutscher. Wie aus diesen Papieren zu ersehen ist, mögen Sie gestern ein Deutscher gewesen sein. Heute sind Sie jedoch ein Niemand.«
»Ich muß meinen Lebensunterhalt verdienen und eine Familie ernähren!«
»Ich muß meinen Lebensunterhalt verdienen und eine Familie ernähren …?«
»Ich muß meinen Lebensunterhalt verdienen und eine Familie ernähren, Herr Zollbeamter.«
»Österreichische Tischler müssen ebenfalls ihren Lebensunterhalt verdienen und Familien ernähren, mein Herr! Mit jedem der geschmacklosen deutschen Scheißdinger, die Sie hier verkaufen, rauben Sie einem österreichischen Tischler einen Bissen Brot.«
»Herr Zollbeamter, mit Verlaub gesagt, das ist kein Scheiß, das sind liebevoll und sorgsam von Hand gefertigte Spielzeuge, und meines Wissens gibt es in Österreich niemanden, der sie herstellt, also raube ich wohl kaum irgend jemandem einen Bissen Brot.«
»Aber das Geld, das arme, ehrbare österreichische Eltern für diesen verderbten deutschen Plunder aus dem Fenster werfen, würde sonst für gesunde, von österreichischen Bauern angebaute Lebensmittel verwendet. Ich sehe keinerlei Grund, warum ich als bevollmächtigter Vertreter Seiner Majestät des Kaisers solchen Verhältnissen Vorschub leisten sollte. Sie etwa?«
»Verderbt? Herr Zollbeamter, das sind doch nur unschuldige …«
»Wie nennen Sie sie? Hm? Verraten Sie mir das. Wie nennen Sie sie?«
»Wie meinen?«
»Wie heißt dieser Tand?«
»Diabolos, Herr Zollbeamter. Die haben Sie bestimmt schon einmal …«
»Diabolos, genau. Diabolo heißt auf italienisch der Teufel. Satan. Der Verderber. Und die nennen Sie unschuldig?«
»Aber Herr Zollbeamter, sie werden doch nur Diabolo genannt, weil sie höll- … weil sie schrecklich schwierig zu spielen sind. Sie sind eine Herausforderung, ein Gedulds- und Geschicklichkeitsspiel. Ein Spaß eben!«
»Spaß, Herr Tischlermeister? Sie finden es spaßig, wenn Österreichs Jugend ihre Zeit, die sie sinnvoll auf Lernen oder Leibesertüchtigung verwenden könnte, mit teuflischem Spielzeug aus Deutschland vergeudet?«
»Herr Zollbeamter, vielleicht … möchten Sie vielleicht einmal eines davon ausprobieren? Hier … als Geschenk. Sie finden es bestimmt harmlos und kurzweilig.«
»Herrje«, Alois leckte sich die Lippen. »Da haben wir die Bescherung. Bestechung. Wie dumm von Ihnen. Ein Bestechungsversuch. Herrje. Klingermann! Formular K1 171, ordentlich Siegellack und eine Kaisermarke!«
Sich Freunde machen
Die Muse der Geschichte
Der erste teuflische Gedanke kam mir, als ich zu Zuckermann unterwegs war.
Ich hatte das Pförtnerhäuschen hinter mir gelassen und umrundete den Old Court, um durch den Torbogen zum Hawthorn Tree zu gelangen. Eventuell hatte ich das Recht, die Abkürzung durch den Court zu nehmen, und mußte nicht um den Court herum, aber ich war mir nicht sicher, ob ich den Rasen betreten durfte. Auf dem Schild stand »Nur für Fellows«, und ich hatte mich nie getraut nachzufragen, ob damit auch Junior Bye Fellows gemeint waren. Die Frage klingt so mimosenhaft, finde ich. Als wäre man in der Schule gerade zum Präfekten ernannt worden und wollte wissen, ob man jetzt Turnschuhe tragen oder die Lehrer beim Vornamen anreden dürfe. Blöd, was?
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!