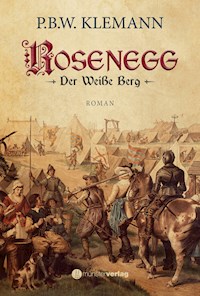Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: MünsterverlagHörbuch-Herausgeber: Münster Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Tod und Trauer begleiten die 15-jährige Kathryn seit ihrer Kindheit. Der selbstsüchtige König, der sich ihr Vater nennt, stößt ihr Leben in den Abgrund, als er Kathryns Mutter wegen Hexerei hinrichten lässt. Die ungeliebte Hexentochter verbannt er kurzerhand zu seinem Bruder. Einsamkeit und Furcht beherrschen fortan Kathryns Prinzessinnendasein, denn ihr Onkel – der Duke of Fargold – hält Distanz zu ihr, und das aus finsteren Motiven: "Stirbt der König, stirbt auch sie!" Für den Duke ist Kathryn nur eine weitere unliebsame Figur im Spiel der Könige und als der König dann tatsächlich stirbt, wird kurze Zeit später ein Attentat auf Kathryn ausgeübt. Das Schicksal hat mit Kathryn jedoch anderes im Sinn: Zwei der Attentäter werden zu ungeahnten Verbündeten, nachdem sich ihnen Kathryns Identität offenbart. Den kampferprobten Brüdern Aris und Bortos war die verstohlene Mission ohnehin nicht geheuer, und die Prinzessin Norlands zu ermorden – dem Land, für das sie im Dienst stehen – widerstrebt ihnen, denn Prinzessinnenmörder leben selten lang. So formt sich eine ungewöhnliche Allianz. Ihre Reise führt sie durch die Tiefen des Greenwoods, wo sie auf eine zwielichtige Hexe treffen, weiter durch die tödlichen Sümpfe der Ewigen Marsch, wo die schrecklichsten Kreaturen Alanas leben, und weiter ins Kriegsgebiet, alles nur mit einem Ziel: Die Hauptstadt Norlands. Denn nur dort wird Kathryn ihr Geburtsrecht einfordern können und nur dort wird sie sich vor ihren Verfolgern retten können, die ihr auf den Fersen sind und mit scharfen, gewaltigen Klingen drohen…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 965
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
P.B.W. Klemann
Geschichten aus Alana
Der Stern des Nordens
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Karte
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
Epilog
Impressum
1. Auflage Juli 2024
© Münster Verlag, Zürich und P.B.W. Klemann
Verlag: Münster Verlag, Zürich und D-Singen
Lektorat: Sibylle Kappel
Umschlag und Satz: Cedric Gruber
unter Verwendung von Bildern: © shutterstock
Klappentext: Nico Klemann
ISBN: 978-3-907301-74-6
Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Buchs darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert werden.
Verlagsanschrift:
Münster Verlag Deutschland
Auf der Höhe 6, D-78224 Singen
Tel: +49 (0)7731-8380
www.muensterverlag.ch
Karte
Für mein Glück,
und meine Seele,
für meine Sonne und meinen Mond,
in Liebe
P.
1. Kapitel
Kathryn
Mittig auf dem weiten Platz stand die Bühne bereit, um das bevorstehende Trauerspiel darauf aufzuführen. Starr blickte Kathryn auf das Schafott. Die Menge darum grölte und jubelte, schrie allerhand Unflätiges. Der Henker, Kopf und Körper von schwarzem Tuch verhüllt, war bereit, sein ehrloses Werk zu verrichten. Die Axtklinge blitzte im Sonnenlicht. Aufrecht stand Kathryn da, die Miene regungslos und steinern, einer Statue gleich, denn sie wusste, sie wurde beobachtet. Das Spektakel würde sogleich beginnen und Kathryn schluckte den bitteren Geschmack in ihrem Mund herunter und fühlte die Last der Todgeweihten. Doch nicht ihren Kopf würden sie heute von seinem Rumpf trennen, und nicht an ihr war es, den letzten Gang anzutreten. Noch nicht. Und nicht im Mindesten würde es sie berührt haben ... wäre nicht die leidige Erinnerung.
In ihren Träumen quälte sie sie, ließ sie den Tag, den Augenblick, ein ums andere Mal wiedererleben, schreckte sie aus dem Schlaf und kalter Schweiß rann ihr dann über den ganzen Körper. Im Wachen manchmal auch. Dann nur dieser Klang, dieses eine Geräusch. Es war ihr geblieben. Ein Klog, anders könnte sie es nicht beschreiben. Jenes Geräusch, als die Axt niederging, sauber Fleisch und Knochen durchtrennte und in das Holz darunter drang. Laut musste es damals gewesen sein, wie es jetzt auch laut war, und doch hallte dieser eine Klang so sauber und fein in ihren Ohren wider, als wäre es das einzige Geräusch überhaupt gewesen. Das Klog würde ihr immer bleiben.
Und der Rest? Er verblasste. Ein klein wenig nur jeden Tag, doch viele Tage waren es seitdem gewesen. Sechs Jahre war sie alt gewesen, und fünfzehn jetzt, und immer undeutlicher schienen ihr die Bilder im Kopf, wenn sie daran dachte. Auch ihre Träume hatten sich verändert. Sie begannen zu variieren und undeutlicher zu werden, und immer öfter war ihr Platz nicht mehr unter den Zuschauern, ihr Platz war auf dem Schafott. Doch auch diese hatten zuletzt abgenommen, waren seltener geworden, und weniger häufig wachte sie des Nachts schweißgebadet auf.
Und nun stand sie erneut hier. Neun Jahre nach jenem Tag stand sie am selben Ort, auf demselben Balkon, mit bester Sicht auf das Geschehen, und selbst durch den Schleier des Vergessens hindurch schien ihr alles gleich. Der grölende Pöbel, der gesichtslose Henker, das Schafott. Der Duke mit seinem Leibdiener zu ihrer Rechten, die Duchess links, und Ann versetzt hinter ihr. Die Träume würden wieder zunehmen.
Der Karren kam. Von zwei Ochsen gezogen, zwischen einem Spalier von Wachen hindurch. Zorn befiel den Pöbel, die Verwünschungen und Unflätigkeiten nahmen zu. Unrat und altes Gemüse flogen durch die Luft, trafen die gebeugte Gestalt, die an einen Pfahl auf dem Karren gefesselt war. Reglos nahm sie es. Lange, braune Haare bedeckten das Gesicht, dass kein Erkennen möglich war.
War es damals ebenso gewesen? Kathryn versuchte sich zu erinnern, doch die Bilder wollten nicht so recht erscheinen. Der Weg jedenfalls musste der gleiche gewesen sein. Womöglich war es sogar der gleiche Wagen. Und hingesehen hatte sie, das wusste sie, doch verschwunden waren die Bilder tief im Reich des Vergessens. Vielleicht war es besser so.
Der Wagen war am Schafott angelangt. Man band die Frau, die ihre Stiefmutter war, vom Pfahl und führte sie aufs Schafott. Zum ersten Mal wagte die Verurteilte einen flüchtigen Blick unter dem Vorhang ihrer Haare hindurch, blickte in ruckartigen Bewegungen zum Pöbel, dann hinauf zum Balkon, als suche sie jemanden.
Da fiel es Kathryn wieder ein! Auch damals war es so gewesen. Dieser suchende Blick. Auch sie hatte aufgeschaut. Aber um was zu sehen? Hatte Kathryn der damalige Blick gegolten? Sie hatte es geglaubt, vielleicht gehofft. Dieser Blick jedenfalls galt ihr nicht, denn sie hatte die Frau, die sie mit Mutter anzureden hatte, nie wirklich gekannt und nie gemocht, und umgekehrt wohl ebenso. Wem also dann? An Vertrauten am Hof waren ihrer Stiefmutter keine mehr geblieben und ihre Tochter lag noch in den Windeln. Er ist es, den sie sucht!, ging es Kathryn durch den Kopf: Der König.
Doch er war nicht gekommen. Heute nicht und damals nicht, und vielleicht hatten beide Frauen ihn gesucht, als der Hoffnung letzter Funken. Beide vergebens!
Der Kopf war wieder zu Boden gerichtet, das Gesicht wieder von den Haaren verdeckt. Neben Richtblock und Scharfrichter wurde sie geführt. Ein Gerichtsschreier trat hervor, entrollte ein Pergament und verlas das Urteil. Reichlich hatten sie sich einfallen lassen, von Blutschande bis hin zum Verrat, und natürlich Hexerei… immer Hexerei. Dabei wusste ein jeder, wessen sie sich wirklich schuldig gemacht hatte. Einer Frau steht es nun mal nicht zu, ihrem Herzen zu folgen. Insbesondere, wenn sie mit dem König verheiratet ist.
Nachdem das Pergament zu Ende gelesen war, rollte der Schreier es zusammen, um zuletzt zu verkünden, dass das Urteil des Königs nun zu vollstrecken sei. Ein eigentümlicher Moment der Ruhe kehrte ein und mit einem Mal war Kathryn wieder dort.
Klein war sie und ängstlich und verwirrt, und starrte zwischen den Gittern des Balkongeländers hinab auf das erbärmliche Schauspiel. Sie spürte die brennende Verzweiflung in sich, die sinnlose Hoffnung auf ein Wunder, den Glauben, dass unmöglich geschehen konnte, was zu geschehen kurz bevorstand, und zugleich das Wissen, dass es keine Rettung geben würde. „Seht nicht hin, Mylady!“, hörte sie die damalige Ann ihr ins Ohr flüstern.
Doch sie hatte hingesehen. Die Sicht von Tränen getrübt, doch sie hatte hingesehen. Sah genau wie jetzt, neun Jahre später, eine Frau sich vor dem Richtblock niederknien, sich vornüberbeugen und den Kopf sachte darauf betten. Sah die vermummte Gestalt des Henkers, das enorme Richtbeil, die blitzende Klinge. Langsam, gefühlvoll beinah, hob er an zum Schlag. Kein Mucks war mehr vom Pöbel zu hören. Stille umgab alles. Klog!
Sauber war der Kopf gekappt und fiel hinab in den bereitgestellten Korb, das Gesicht genau in ihre Richtung gewandt.
Doch der falsche Kopf war es! Und zwischen wirrem, rotem Haar sah sie ins tote Antlitz ihrer Mutter. Kathryn schloss fest die Augen, zwang sich zur Ruhe und ärgerte sich ihrer Schwäche wegen.
Als sie die Augen wieder öffnete, waren die roten Haare braun geworden und das Gesicht der Toten abgekehrt. Sie bemerkte, dass Ann ihr sanft die Hand auf den Arm gelegt hatte. Stocksteif stand sie da, regungslos, immer noch, denn trotz allem hatte sie kaum eine Miene verzogen. Da spürte sie Feuchtigkeit auf ihrer Backe, spürte eine einzelne Träne langsam hinabgleiten. Und sie verfluchte sich innerlich, nicht stark genug geblieben zu sein. Sie drehte sich um, dabei ärgerlich die Träne aus dem Gesicht wischend, und schritt davon.
2. Kapitel
Aris
Nichts als ein Würfelspiel ist das Söldnerleben, dachte sich Aris, während er den Becher schüttelte. Heißt es nicht so? Auf das Glück kam es an. Und Glück war leider etwas, von dem er nie besonders viel besessen hatte. Nicht im Leben und nicht im Spiel, nur im Kampf. Dumpf hallten die Würfel aus dem ledernen Becher. Bortos grinste ihm breit entgegen. Aris hasste dieses Grinsen. Seine Chancen standen schlecht, das wusste er selbst. Doch was gab er schon auf Chancen? Was hatte das Leben ihm für Chancen gegeben? Kräftig schlug er den Becher auf den Holzklotz, den sie zum Tisch bestimmt hatten. Er deckte auf. Teufelsaugen! Natürlich. Aus dem Grinsen Bortos wurde ein schallendes Lachen. Ein Fluch entfuhr Aris Lippen, den Becher warf er wütend gegen die Zeltwand.
„Teufel, ein Glück hat der immer, ein verdammtes Glück, dieser elende Sohn einer dreckigen Hure…“, schimpfte er gen Himmel.
„He, lass Mama aus dem Spiel! Kann nichts dafür, dass du so scheiße würfelst“, erwiderte Bortos und sammelte die gewonnenen Münzen ein.
Er hatte recht. Mama hatte damit nichts zu tun. Man muss die Würfel nehmen, wie sie kommen!
Aris griff nach seiner Pfeife, stopfte sie mit dem letzten trockenen Kraut, das er besaß, und griff nach einem glühenden Zweig im Feuer, um sich die Pfeife zu entzünden. Tief sog er ein, langsam und genussvoll hauchte er aus. Er fuhr sich über seine Narbe, die ihn zu jucken begann, wie oft. Dann sah er sich um. Bald zwei Wochen lagerten sie nun schon hier. Das Jahr war noch jung und die Kälte des Winters auf dem Rückzug. Nur vereinzelt waren kleine Inseln schmelzenden Schnees zu erkennen, bald würde der Boden fest und die ersten Blumen würden seiner Oberfläche erwachsen. Beste Zeit zum Plündern. Die Höfe und Dörfer der Umlande hatten Herbst und Winter gehabt, um sich ein wenig vom Krieg zu erholen, und auch wenn die Vorratskammern gewiss noch leer waren, gab es dennoch genug anderes, was eine schöne Beute abgab. Und trotzdem vertrieben sie sich die Zeit mit Würfeln und Wache halten, und wurde zur Abwechslung einmal der Sold ausbezahlt, ein wenig mit den Huren.
Die Oberen waren am Verhandeln und hatten jede Kriegshandlung untersagt. Den ganzen Winter über schon. Manche sprachen gar von Frieden. Frieden! Aris konnte das Wort nicht ausstehen. Frieden war schlecht fürs Geschäft. Nicht dass er in seinem Leben viel davon erlebt hätte. Er kannte ihn in Wahrheit gar nicht. Und trotzdem verabscheute er ihn. Der Krieg war schließlich seine Heimat, und wer sieht seine Heimat schon gerne in Gefahr?
Seine Augen schweiften über das Feldlager. Ein Meer aus Zelten und Wagen, voller Menschen und Ratten und räudigen Hunden, die sich allesamt mühten, sich die Zeit zu vertreiben und den klammen Bauch voll zu bekommen.
Da fiel ihm der neue Korporal ins Auge. In der Ferne sah er ihn eilig durch das Lager laufen, zielstrebig, genau in ihre Richtung, und Aris schwante irgendwie, dass sie selbst sein Ziel sein würden.
Aris konnte ihn nicht ausstehen. Friedrich von irgendwas, ein edler Kaminhocker, frisch wie Frühlingstau, der zeitlebens noch keine Schlacht, nicht einmal ein Scharmützel miterlebt hatte. Keine achtzehn Jahre dürfte er zählen, und doch war er ihm vorgesetzt und besaß einen Rang, für den Aris zehn Jahre Dienst aufweisen müsste, und bald würde er in Bereiche aufsteigen, die Aris oder Bortos für immer verwehrt waren. Er tröstete sich mit dem Gedanken, dass der Adelsspross wahrscheinlich kein Jahr überstehen würde. Solche Frischlinge starben noch stets wie die Fliegen im Feld.
Er deutete mit dem Kopf in Richtung Korporal: „Da kommt was auf uns zu!“
Bortos grunzte unverständlich, biss ein Stück Bitterblatt ab und begann zu kauen. Er trug wie immer seine seltsame Melone als Hut, von der er sich einfach nicht trennen wollte, und die langen Haare hatte er zu einem Zopf geflochten. Bei einem anderen Mann würde es lächerlich ausgesehen haben, bei Bortos nicht. Er war einen Kopf größer als die meisten großen Männer, und nicht wenige fragten sich, ob sein Erzeuger womöglich ein gorgischer Riese gewesen sei. Sein rundes Gesicht ließ ihn gemütlich und tumb wirken, und täuschte so manchem eine unvorhandene Langsamkeit vor. An seiner Kraft indes zweifelte niemand.
Bei ihnen angekommen, stützte sich der junge Korporal auf seine Knie ab und sog gierig nach Luft. Offenbar war er weit gerannt.
„Der Hauptmann schickt mich“, stammelte er, kaum wieder zu Atem gekommen. „Man will euch hängen!“
Bortos spuckte eine Ladung dunkelroten Bitterblatts aus. Der dunkle Klecks landete knapp neben des Korporals Stiefel: „Schon wieder?“
Der Korporal schaute irritiert. Er hatte mit einer anderen Reaktion gerechnet. „Was heißt hier schon wieder? Passiert euch das öfter?“
Aris blies in Ruhe einen Schwall Rauch aus und zuckte mit den Schultern: „In letzter Zeit jedenfalls zu oft für meinen Geschmack. Was rät der Hauptmann?“
Eilig hatten sie gepackt, dabei das gute Zelt stehen gelassen, damit ihr Verschwinden nicht zu sehr auffalle, genau wie der Hauptmann ihnen empfohlen hatte. Ihre Waffen führten sie freilich mit sich; Bortos seinen großen, gewellten Zweihänder und seinen Katzenkopf, Aris seinen sippanischen Degen und seine storzische Pistole. Ihre Hüte hatten sie aufgesetzt, Bortos seinen dicken Brustpanzer angelegt, ohne den er nicht sein wollte, Aris seinen kettenverstärkten Lederkoller, der schon mehr als eine Klinge aufgehalten hatte. Dazu ihre guten Büchsen samt Pulvergürtel, eines jeden Kriegsknechts Grundausstattung, ihre Beile und Feuersteine, gutes Pulver und Decken, und manches Nützliche mehr, was der Söldner eben so braucht, waren sie doch altgediente Veteranen, obwohl sie beide keine zwanzig Jahre zählten. Nur an Proviant mangelte es ihnen, denn mit dem plötzlichen Aufbruch hatten sie nicht gerechnet.
Auf einer Lichtung im Wald unweit des Lagers warteten sie im Geäst verborgen, wo sie gute Sicht aufs Umfeld hatten. Der Hauptmann wollte sie später aufsuchen, wie der Korporal ihnen mitgeteilt hatte. Es dämmerte beinahe, als er endlich zwischen den Büschen auftauchte, schleichend und offenbar darauf bedacht, dass ihn keiner verfolge. Die Lage ist ernst, dachte Aris bei sich. Sie gaben sich zu erkennen und der Hauptmann kam direkt auf sie zu. Ein letztes Mal sah er sich um.
„Mir scheint keiner gefolgt zu sein.“ Dann an die beiden gewandt: „Teufel, Männer, da habt ihr euch aber eine Suppe geschöpft!“
Was Sache sei?, fragten die beiden, denn sie waren sich keineswegs sicher, was ihnen zur Last gelegt wurde.
„Habt ihr eine Kutsche überfallen? Vor ein paar Tagen muss es gewesen sein. Nicht weit vom Lager bei Roost.“
Die beiden nickten. Bei ihrem Freigang war es gewesen. Sie waren auf Beutesuche gezogen, wie üblich im Krieg, und dabei war ihnen eine mäßig bewachte Kutsche begegnet. Gute Beute hatten sie gemacht.
„War darin eine junge Dame, zu der ihr nicht gerade freundlich wart?“
„Wir befinden uns auf Feindesland, Herr Hauptmann. Ihr wisst, wie es ist“, erwiderte Aris abwehrend.
Der Hauptmann ging darauf nicht ein und fragte weiter: „Das Mädchen mag nicht zufällig erwähnt haben, dass sie zum Reich gehört?“
Bortos zuckte mit den Schultern: „Irgendwas sagen die doch immer.“
Der Hauptmann zog eine Grimasse, die schwer zu deuten war.
„Nun, bei dieser Dame hättet ihr besser zuhören sollen. Denn diese gehörte tatsächlich zu uns. Sie ist die Nichte des Richtenstein.“
„Vom Obristen? Tausend Teufel!“, stieß Aris aus und auch Bortos hatte einen Fluch auf den Lippen.
„Allerdings! Und das hübsche Ding singt nun fleißig ein Liedchen von den zwei üblen Gaunern, die ihr das raubten, was nicht zurückgegeben werden kann, und spricht dabei von räudigen Galgenvögeln, der eine riesig und breit, mit einer Melone als Hut und die Haare zu einem langen Zopf gebunden, der andere blauäugig und schwarzhaarig, mit einer langen Narbe vom Auge bis zur Backe hinab.“
Unweigerlich fuhr sich Aris die Schmarre entlang. Bald ein Jahr war es inzwischen her, als ein Storzer ihm sein Andenken verpasst hatte. Götterschmiss nannte man es unter Söldnern. Ein Zeichen, dass man nochmal davongekommen war. Er war davongekommen, der Storzer nicht. Sie war gut verheilt und schadete seinem Aussehen kaum, verlieh ihm im Gegenteil etwas Verwegenes, wie er fand, doch blieb sie ein unerwünschtes Erkennungsmerkmal.
Aris musterte seinen Hauptmann. Richard von Brennan, so ein solches Adelsgeschlecht überhaupt existierte. Den Glücklichen nannten sie ihn hinter seinem Rücken. Um die dreißig Jahre musste er sein und von so dünnem Blut, dass ein höherer Rang für ihn kaum möglich schien. Ein erfahrener Eisenfresser, hart und streng und ein guter Mann.
„Bekommen die nicht spitz, dass Ihr uns gewarnt habt?“, fragte Aris.
„Ich krieg meinen Hals schon aus der Schlinge, keine Sorge. Euch allerdings erwartet der Strick, und das nur, wenn ihr Glück habt.“
„Was ratet Ihr uns?“, fragte Aris weiter.
„Den Wams werdet ihr ablegen müssen, daran führt kein Weg vorbei.“
Er deutete auf den rot-weißen Wams, den alle Soldaten des Reiches trugen, egal ob sie Söldner waren oder nicht.
“Könnt freilich zu den Barben. Liegen keine zehn Meilen von hier.“ Er spuckte aus. „Aber ich kann den Barbmann nicht ausstehen, und an Kommiss ist da nicht zu denken. Könnt zu den Nordlern. Die führen Krieg gegen Sippan und suchen Männer, wie’s heißt. Sind meine Leute. Da sähe ich euch lieber. Aber ohne Schiff ist’s weit. Im Norden liegt Karlstadt, fünf lange Meilen, vielleicht auch sechs, da ist ein Hafen.“
Bortos und Aris sahen sich an, tauschten einen Blick und verstanden sich. Wieder an den Hauptmann gewandt, sprach Aris: „Ihr wart gut zu uns. Besser als die Meisten. Bekomme ich Euch mal vors Korn, schieße ich daneben, darauf mein Wort!“
Der Hauptmann verzog den Mund zu einem schiefen Grinsen: „Oder du schaust, dass er sauber sitzt!“
„Oder das!“
Die Freunde legten beide die rechte Faust auf die Brust, den Zeigefinger gespreizt, das Zeichen der Kriegsknechte.
„Langes Leben, fette Beute!“, sprachen sie aus einem Mund.
Der Hauptmann tat es ihnen gleich.
„Langes Leben, fette Beute!“
Dann zogen sie ab.
3. Kapitel
Kathryn
Ann hatte ihr Tee gemacht. Dampfend stand die Tasse am Rande des runden Spieltisches. Eine raakischer Tisch, aus dunkler Roteiche gefertigt und reichlich verziert, die Figuren aus hellem Walknochen und schwarzem Holz geschnitzt. Das Königsspiel! Sie liebte es. Auch wenn sie in letzter Zeit nur mit sich alleine spielen konnte. Sogar eine Link hatte sie gefragt, ob sie mit ihr spiele. Ein aufgewecktes kleines Ding, das Tissy hieß, und unter diesen schweigsamen Wesen zu den gesprächigeren gehörte. Doch sie hatte sich nicht getraut, obwohl Kathryn in den großen, bernsteinfarbenen Augen den Wunsch, es zu versuchen, durchaus zu erkennen geglaubt hatte. Vielleicht war es besser so, denn der Duke hätte sie bestimmt bestraft, so er sie dabei gesehen hätte. Einem Link stand es nun mal nicht zu, mit einem Menschen zu spielen, weniger noch mit einem adligen Menschen. Der Duke war streng in diesen Dingen.
In ihrem liebsten Raum von Schloss Steffordsgrave befand Kathryn sich, was immer das heißen mochte, im Wintergarten, einem großen, ganz von feinen Glasfenstern umschlossenen Gewölbe. Fremdländische Pflanzen wuchsen aus Beeten und großen Töpfen, ragten struppig hinauf bis unter die Decke, dass man sich beinahe wie im Freien fühlte. Durch das gläserne Dach sah sie zum Himmel hinauf. Das Jahr war noch jung und es dunkelte früh, und auf dem azurnen Grund zeichnete sich bereits der Komet ab. Seit wenigen Tagen erst war er am Himmel erschienen, groß und leuchtend, mit einem langen, goldenen Schweif. Unheimlich sah er aus und verheißungsvoll. Ann hatte sich bei seinem Anblick sogleich das Dreieck auf die Brust gemalt und voller Angst vom Ende aller Tage gesprochen und mancher Diener hatte ihr furchtsam beigepflichtet. Doch wenn Kathryn ihn ansah, fühlte sie keine Furcht. Schön war er.
Sie senkte den Blick, um sich ihren Figuren zu widmen. Kathryn hatte den schweren Spieltisch von den Links hierherbringen lassen, was gewiss niemanden stören würde, denn außer ihr spielte ohnehin keiner auf ihm, wie auch kaum einer je den schönen Wintergarten besuchte.
Die Duchess hielt sich meist verborgen in ihren Räumlichkeiten auf, war sie doch kränklich und von melancholischem Gemüt, wie es hieß, während der Duke seine Zeit mit politischen Ränkeschmieden in Lidium verbrachte. Heute allerdings war Letzterer da. Er hatte das Frühstück mit Kathryn eingenommen und sogar ein wenig mit ihr geredet.
Jahrelang hatte er Kathryn keines Blickes gewürdigt, geschweige denn mit ihr gesprochen. Und war er anwesend, tat es ihm die Duchess gleich, dass sich Kathryn noch stets wie ein Stück Dekor vorkam, wenn sie sich mal zu dritt in einem Raum befanden.
Über das Spiel gebeugt studierteKathryn die Stellung, die sie selbst verursacht hatte. So sehr war sie in ihr Tun vertieft, dass der ferne Lärm nur nach und nach in ihre Ohren drang. Schließlich hob sie den Kopf und runzelte die Stirn. Offenbar war Besuch eingetroffen. Da kam Johnson schon herein, der erste Diener, und sagte in seiner steifen Art, Kathryn solle sich augenblicklich im vorderen Salon einfinden. Der König sei eingetroffen.
Sie folgte Johnson über den Flur. Jahre war ihre letzte Begegnung mit der Majestät her, drei oder vier bestimmt, sie konnte es nicht einmal mehr sagen, doch so lange es auch her war, es war ihr bei weitem nicht lange genug. Zwei königliche Gardisten standen vor dem Eingang des Salons, ließen sie aber reglos passieren. Johnson hielt ihr die Türe auf. Kathryn trat in den Salon.
Der König stand in der Mitte des Raumes. Jakob Griffin der Achte, König Norlands und Istlands, Herrscher des Nordens und der Ewigen Marsch, und ihr Vater. Die üppige Kleidung mit den geplusterten Schultern und Ärmeln, der Pluderhose und dem dicken Fellumhang, ließ die massige Gestalt noch massiger aussehen. Das aufgedunsene Gesicht, mit den geschwollenen Mandelaugen und dem kurz geschnittenen Bart, der Pausbacken und Kinn wie ein Halbmond umschloss, wandte sich in ihre Richtung. Er sah älter aus, als sie ihn in Erinnerung hatte. Und fetter. Sie machte einen artigen Knicks und sagte: „Seid gegrüßt, Eure Majestät, mein lieber Vater.“
Er erwiderte ihren Gruß nicht, sah hinüber zu seinem Bruder.
„Sie sieht aus wie ihre Mutter.“
Es war nicht zu deuten, ob es positiv oder negativ gemeint war. Der Duke nickte, stammelte etwas, das nach Zustimmung klang, und bat seinen Bruder, Platz zu nehmen. Offenbar war er ebenfalls von dessen Besuch überrascht. Kathryn setzte sich auf den entferntesten Stuhl, derweil der König das kleine Sofa ganz für sich beanspruchte. Der Duke setzte sich ihm gegenüber und erst jetzt bemerkte Kathryn, dass die Duchess ebenfalls da war, neben dem Duke sitzend, den Kopf geziert gesenkt. Ihr Gesicht sah fahl und eingefallen aus.
„Wie kann ich Eurer Hoheit zu Diensten sein?“, fragte der Duke.
Nichts hatten die beiden Brüder gemein. Der Duke entstammte einer anderen Mutter, wie Kathryn wusste, war hager und kantig, mit scharfem Blick und fahler Haut, und wie der König laut und hitzig war, war dieser kalt und berechnend. Nur das rötliche Haar der Griffins besaßen beide.
„Du kannst mir berichten, wie es gewesen ist, Bruder. Wie ist sie gestorben?“
Drei Tage war die Hinrichtung her und Kathryn fragte sich, ob dies die erste Erkundung war, die der König einholte. Der Duke dachte kurz nach, um dann zu erwidern: „Sie ist in Würde gestorben, Eure Majestät. Es verlief alles…“ – kurz suchte er nach dem geeigneten Wort – „ordnungsgemäß. Das Volk schien zufrieden.“
Was es wohl hieß, in Würde zu sterben?, dachte Kathryn bei sich. War es wirklich das, was sie vor drei Tagen bezeugt hatte?
„Sie hat nicht geheult oder gejammert?“
„Nein, Eure Majestät“, antwortete der Duke.
„Hat sie sich selbst über den Block gebeugt, oder musste sie gehalten werden?“, fragte der König weiter.
„Sie beugte sich aus eigenem Antrieb. Ein Zeichen gewiss, dass sie ihre Schuld eingesehen hat.“
Auch ihre Mutter hatte sich gebeugt. Hatte den Kopf brav auf den Richtblock gelegt, wie es von ihr erwartet worden war. War sie auch schuldig gewesen? Nichts von all dem, wessen ihre Mutter angeklagt worden war, hatte Kathryn je bei ihr erlebt. Keine dunklen Kräfte oder seltsamen Rituale, mit denen sie den König verzaubert hätte. Keine Unterhaltungen mit Katzen oder Geistern oder Toten, wie sie den Dienern des Dunklen nachgesagt wurden. Sie war keine Hexe gewesen, das wusste Kathryn. Und dennoch hatte niemand etwas getan, als man ihre Mutter holen gekommen war, und niemand sie verteidigt, als man sie schuldig gesprochen hatte.
„Das ist gut!“, sagte der König. „Immerhin etwas.“
Er schnippte mit dem Finger und einer der beiden Diener im Hintergrund beeilte sich, dem König einen Becher Wein zu reichen. Er trank großzügig.
„Wie konnte sie es wagen, mir das anzutun? Mir!“, stieß der König plötzlich hitzig aus. „Der Teufel hole sie!“
Der Duke räusperte sich. Fragte dann: „So ist denn an den Gerüchten etwas Wahres dran?“
Mit einem Mal bedachte der König seinen Bruder mit einem gefährlichen Blick.
„Du siehst deinen König wohl gern gehörnt vor aller Welt Augen, lieber Bruder?“
Der Duke verzog keine Miene, als er sagte: „Keineswegs, Eure Majestät.“
Dem König schien es zu genügen, denn er wandte die Augen ab und fuhr fort: „Wahr oder nicht, was macht’s? Die Gerüchte sind mir Spott genug.“ Dann plötzlich spie er voller Zorn aus: „Die Eingeweide habe ich dem Räudigen herausschneiden lassen, Stück für Stück, während er selbst dabei zusehen durfte. Seine Männlichkeit sparte ich für den Schluss. Ich selbst habe sie ihm in sein treuloses Maul gesteckt. Ein Kammerdiener!“ – er schrie das Wort – „Kammerdiener! Mich selbst bediente er!“ Wieder nahm er einen tiefen Zug von seinem Wein.
„Kein Mann kommt mehr in meines nächsten Weibes Nähe! Nur Links sollen sie bedienen. Am besten weibliche. Vier weitere Diener habe ich noch aufs Schafott geschickt, weil sie es wussten, aber nichts gesagt haben. Oder zu viel gesagt haben.“ Er hielt den Becher hoch als Zeichen, dass man nachfülle, und als sein Mundschenk dem nachkam, bedachte er ihn mit einem misstrauischen Blick.
„Niemandem kann ich mehr trauen, Bruder. Niemandem! Alle haben sie mich hintergangen. Die Frauen vor allem. Sie vor allem. Was ist nur mit diesen verdammten Weibern? Da ist man gut zu ihnen, erfüllt ihnen jeden Wunsch, überhäuft sie mit Geschenken und Ehren und allem, was man sich vorstellen kann. Und wie vergelten sie es einem? Mit Undank! Undank und Untreue.“
Er schüttelte energisch den Kopf.
„Nur eine verdammte Pflicht haben sie auf Erden und selbst diese können sie nicht anständig verrichten. Uns Söhne zu schenken.“
Er sah zur Duchess, die immer noch den Kopf gesenkt hatte.
„Aber wem erzähle ich das? Entweder werden sie nicht schwanger, oder sie bilden es sich nur ein.“
Ein unterdrücktes Schluchzen kam von der Duchess. Im letzten Jahr war es gewesen, da war der Bauch der Duchess dick geworden, ihre Brüste angeschwollen und bald wurde verkündet, dass man froher Hoffnung sei. Nie hatte Kathryn sie so ausgelassen erlebt, wie in jener Zeit, denn trotz vieler Jahre Ehe waren der Duke und sie kinderlos geblieben. Viel hatte sie gelacht, sich liebevoll den runden Bauch gestreichelt und sogar mit Kathryn Zeit verbracht. Doch die Monate waren vergangen und nichts war geschehen, bis irgendwann klar war, dass auch nichts mehr geschehen würde. Seither hatte sie kaum mehr ihre Gemächer verlassen, in der Hoffnung vielleicht, der Spott möge sie hinter ihren geschlossenen Türen nicht erreichen. Hier jedenfalls traf er sie mitten ins Gesicht.
Der König fuhr fort, das Schluchzen der Duchess ignorierend.
„Oder sie werfen nur ihresgleichen.“ Ein flüchtiger Blick in Kathryns Richtung.
„Nur meine Jade hat alle ihre Pflichten erfüllt. Sie allein war ein anständiges Eheweib. War immer brav. Wusste immer, was sich gehörte und war mir nie eine Last! Wenn sie noch leben würde. Eine solche Schande hätte niemals geschehen können.“
Der König war berüchtigt dafür, schnell das Interesse an seinen Frauen zu verlieren, und Kathryn zweifelte doch sehr, dass es mit dieser anders gewesen wäre, hätte die Ehe mehr als die knappen zwei Jahre gedauert, die sie hatte. Nicht umsonst hatte er seine sechs Ehen gehabt, die fünf der glücklichen Bräute nicht überlebt hatten, ihre eigene Mutter mit eingerechnet.
„Drei Weiße Schwestern waren bei der Geburt dabei. Drei!“, jammerte der König weiter. „Haben gesungen und gesungen, und doch ist sie mir weggestorben. Hingerichtet hätten sie alle drei gehört! Aber nicht einmal das haben sie mich machen lassen. Man dürfe Erleuchtete Javes nicht einfach hinrichten. Da sieht man, was es heißt, in diesem Land König zu sein. Nichts lassen sie einen tun, wie man will.“
Er machte eine Pause und spülte seinen Frust mit einem ordentlichen Schluck hinunter.
„Wenigstens der Junge ist mir geblieben.“
„Wie geht es dem Prinzen?“, fragte der Duke. Er schien seine schluchzende Frau ebenfalls nicht zu bemerken, aber über die Jahre hatte Kathryn gelernt, ihn zu deuten, und wusste es besser. Ein kalter Mann war er, Francis Griffin Duke von Fargold, kalt wie der nordische Winter, und gerade Kathryn hatte keinen Grund, Gutes von ihm zu sprechen, doch seiner Frau gegenüber war er stets liebevoll, und wahrscheinlich war sie der einzige Mensch, der dem Duke etwas bedeutete.
„Es geht ihm gut. So sagt man mir zumindest. Er sei oft kränklich, heißt es. Aber ich lasse viel für ihn beten und singen. Er wird es schon machen. Mehr können mich die Götter unmöglich strafen“, sagte der König und dann, als sei ihm eine Kleinigkeit eingefallen: „Ach, das Mädchen ist aber gestorben.“
Zuerst verstand Kathryn nicht, wen der König meinte, und auch der Duke runzelte die Stirn. Dann dämmerte es beiden.
„Prinzessin Margareth? Ich bedaure Euren Verlust, Eure Majestät“, sagte der Duke.
Wie ein Schatten senkte sich die Bedeutung der Information über Kathryn.
Stirbt der König, stirbt auch sie!
Der König lehnte sich leicht zur Seite und furzte laut, fuhr dann fort, als sei nichts gewesen.
„Ja, sehr bedauerlich. Aber vielleicht auch besser so, es ist nicht leicht für ein Mädchen, ohne Mutter aufzuwachsen“, sagte er und ließ sich wieder nachschenken.
Und in diesem Moment überkam Kathryn eine Welle glühend heißen Hasses, von der sie nicht gewusst hatte, sie in sich zu haben. Pulsierte durch ihren Körper, ließ ihr Blut kochen und erfüllte sie mit einer Erkenntnis, der sie sich noch stets verwehrt hatte. Sie hasste ihn! Bis aufs Blut hasste sie ihn, diesen fetten, widerlichen Menschen, der ihr Vater war. Und sie bohrte ihre Fingernägel in die Oberschenkel vor ohnmächtiger Wut.
„Wie verlaufen die Verhandlungen mit dem Reich?“, fragte nun der Duke, offenbar wollte er lieber das Thema wechseln. „Wird der Imperator Partei nehmen? Ich hörte, Sippan habe fast dreißigtausend Mann aufgestellt.“
Nur mäßig schien der König am Thema interessiert.
„Was Siegdahl macht und denkt, wissen selbst die Götter nicht. Die Berichte, die ich über ihn erhalte, geben aber wenig Grund zur Sorge. Seit über einem Jahr hat ihn niemand mehr zu Gesicht bekommen, außer seinen Leibdienern. Er haust irgendwo in den Tiefen des Steins und will von keiner Menschenseele etwas wissen. Er scheint mittlerweile gänzlich seines Verstandes verlustig. Er war immer verrückt, aber nun… er ist ein lausiger Herrscher, bei den Göttern. König Antonio hat vor kurzem verkündet, dass er die Verlobung seiner Tochter mit dem Obersten gelöst hat. Selbst der eigene Vetter hat die Geduld mit ihm verloren. Seit über zehn Jahren wartet das arme Ding bereits, dass der Imperator sich erbarme und sie endlich bespringe, und doch konnte er sich einfach nicht dazu durchringen. Nun ist es selbst dem Sippaner zu viel. Lägen wir nicht gerade im Krieg, mag die Verschmähte eine passable Partie für mich sein. Ich hörte, sie sei ganz gut anzuschauen.“ Er zuckte mit den Schultern. „Das Haus Warstein befindet sich jedenfalls im Zwist, ein Bündnis ist unwahrscheinlich.“
„Nun, das sind gute Nachrichten. Sippan scheint mir recht entschlossen diesmal. Ein beträchtliches Heer steht bald an unseren Grenzen und die Gooten sind ebenfalls kriegshungrig. Einen weiteren Feind können wir uns wahrlich nicht leisten.“
Der König zuckte gelangweilt mit den Schultern. „Das Piratentum ist, was Antonio nicht schmeckt. Er kann nicht leiden, dass auch wir unseren Teil vom südlichen Gold abbekommen. Soll er seine Truppen schicken. Der Bär wird sich ihnen in Balrust stellen.“
„Das Inland ungeschützt zu lassen, mag ein Fehler sein, Majestät. In solchen Zeiten ist besser Vorsicht geboten.“
Wieder brauste der Zorn des Königs unvermittelt auf.
„Nicht an deinem Kopf ist es, dir darüber Sorgen zu machen! Und nicht deinem Kopf ist es bestimmt, die Bürde der Krone zu tragen! Die Räte jammern mir bereits genug die Ohren voll. Ihr müsst dieses beachten, Eure Majestät, und jenes bedenken, Eure Majestät.“ – der König äffte sie mit verstellter Stimme nach – „Ich weiß schon, was ich tue. Der Norden wird sich schon wieder beruhigen und der Bär wird tun, wozu er geschaffen ist. Und die Tumber hält! Sie hat immer gehalten.“
Der Duke rührte keine Miene über die Schelte.
„Dieser General Spinola ist ehrgeizig und jung. Wenn ihn sein König lässt, wird er zuschlagen. Ihr solltet sie nicht unterschätzen, Eure Majestät. Der Winter war hart und die Ernte schlecht. Wütet dann noch der Goote im Land, wird es kaum mehr für das Hungerbrot reichen. Dann liegen bald die Toten auf den Straßen.“
„Bin ich nun auch noch für das Wetter verantwortlich? Und dass die Bauern gut schaffen? Ist es denn an mir allein, mich um alles zu kümmern? Das Volk muss schon selbst schauen, wo es sein Essen herbekommt. Kochen kann ich nicht auch noch für sie!“
Er knallte beleidigt seinen Becher auf den Tisch.
„Es gelingt dir noch stets, mir auch den letzten Rest an guter Laune zu verderben, Bruder“, schimpfte der König.
„Verzeiht, Eure Majestät, das war keineswegs meine Absicht“, erwiderte der Duke emotionslos.
„Nun weiß ich wieder, warum ich dich nicht mehr im Rat haben wollte.“
„Verzeiht, wenn ich Euch verärgert habe, Eure Majestät“, wiederholte der Duke seine Entschuldigung.
Der König winkte ab.
„Ach, schon gut. Sei’s drum. Genug haben wir geplaudert. Ich bin zur Jagd geladen beim Herzog von Werrington. Sie soll morgen stattfinden, schau doch vorbei, so du Zeit findest. Nur von Erbaulichem wird dann aber geredet! Soll die verdammte Politik mir nicht auch noch die Jagd vergällen.“
Er erhob sich schwerfällig vom Sofa. Nickte der Duchess beiläufig zu, die immer noch betreten zu Boden schaute, sah dann zu Kathryn.
„Hast du für ihre Ausbildung gesorgt, wie ich dir aufgetragen habe?“, fragte der König an den Duke gewandt.
„Natürlich, Eure Majestät. Sie hat eine umfassende Ausbildung erhalten, ganz wie es sich für ihren Stand gebührt. Eine renommierte Gouvernante hat sich ihrer angenommen, sie wird von einem Lehrer der Rhetorik und Standeskunde unterrichtet, spricht die Gemeinsprache so gut wie das Nordisch und Barbisch, beherrscht Runenschrift und wie mir ihre Lehrer versichern, ist selbst ihr Alt-Karnisch passabel. Zudem wird sie in der Juristerei und Politik unterrichtet, und ihr Lehrer der Mathematik und Naturlehre hat inzwischen sogar die Erleuchtung erfahren.“
„Ein Magier also!“ Der König machte eine anerkennende Geste. „Nur Schickliches soll er sie aber lehren. Man weiß ja nie. Wo wir dabei sind; ich denke, es ist an der Zeit, dass sie wieder in den Hof eingeführt wird. Sie ist von meinem Blute immerhin, es schickt sich nicht, sie hier versteckt zu halten.“
Er sagte es, als sei die Situation ganz ohne sein Zutun entstanden. Als sei nicht er es gewesen, der sie verstoßen und über Jahre verleugnet hatte.
„Zum großen Bankett nächsten Monat! Bringt sie dorthin mit. Dann wird sie wieder gesehen. Danach sehen wir weiter.“ Der Duke nickte als Zeichen, dass er verstanden habe.
Dann trat der König vor seinen Bruder.
„Du weißt, es gibt Möglichkeiten.“ Er deutete leicht mit dem Kopf in Richtung der Duchess. „Es ist nicht zu spät. Der alte Glaube ist überkommen. Komm zu uns. Es lebt sich leichter, wenn die Prediger des Guten einem nicht allen Spaß verderben.“ Er nickte dem Duke zu. Die Anspielung war so plump, dass er es auch einfach hätte aussprechen können. Immerhin wurde offen behauptet, dass ihr Vater den Glauben nur gewechselt hatte, weil er sich von seiner ersten Frau hatte scheiden lassen wollen.
„Nun denn, Bruder. Gehab dich wohl.“ Damit marschierte er, von seinen Dienern gefolgt, aus dem Salon.
Kaum war er draußen, erhob sich die Duchess und stürmte zur anderen Tür. Der Duke rief ihr nach.
„Beth!“, so nannte er sie nur, wenn sie sich alleine glaubten. Aber sie reagierte nicht und war schon aus dem Raum gelaufen.
Ärgerlich schüttelte der Duke den Kopf, zog seine Meerholzpfeife, ohne sie aber anzuzünden, blickte dann zur Tür, aus der der König verschwunden war. Er schnaubte verächtlich.
„...einen König zu haben, voll Tugend und Anstand“, zitierte er.
Und, ohne zu überlegen, fügte Kathryn an: „Der um sein Volk sich sorgt, gleich um seine Kinder.“
Überrascht drehte sich der Duke zu ihr um. Offenbar hatte er ganz vergessen, dass Kathryn sich noch im Raum befand. Er betrachtete sie kurz verwundert, dann umspielte ein Lächeln seine Lippen und er nickte ihr zu. Sie lächelte zurück, ein eigentümlich inniger Moment war es. Dann verließer den Raum.
Kaum war er draußen, erstarb das Lächeln auf Kathryns Gesicht, verzog sich zu einer unglücklichen Grimasse. Stirbt der König, stirbt auch sie! Düster blickte sie dem Duke hinterher. Vergiss nie, was er dir ist!, ermahnte sie sich. Vergiss es nie!
Oben, zwischen den Zinnen und verwinkelten Dächern von Steffordsgrave, lag die achtjährige Kathryn auf einem breiten Stützbalken und puhlte gedankenverloren trockenes Moos aus den Ziegelritzen. Es war Sommer und heiß strahlte die Sonne auf die Dächer des Schlosses, dass sich Schlieren dicht über der Oberfläche bildeten. Kathryn genoss die Hitze. Der Platz war ihre neueste Entdeckung. Über den Dachstuhl des Westflügels war sie hinaufgeklettert, und so verwittert wie Ziegel und Balken aussahen, musste seit Jahren niemand mehr hier oben gewesen sein. Sie war allein und würde es auch bleiben, genau, wie es ihr beliebte. Ihr Vater sei krank, hatte irgendjemand gesagt. Es war ihr egal. Soll er doch sterben, dachte sie sich. Der Duft des nordischen Flieders, der entlang der Fassaden des Schlosses emporwuchs, machte die Luft süß und schwer. Zwei Jahre lebte sie schon auf Steffordsgrave, zwei Jahre mit dem verfluchten Duke und der verfluchten Duchess.
Nach der Hinrichtung ihrer Mutter sollte Kathryn aus dem Ivoryhouse, dem königlichen Palast in Lidium, verschwinden. Der König wollte sie nicht länger um sich haben, doch keiner der Höflinge sah sich bereit, die Tochter ihrer Mutter aufzunehmen. Die Tochter einer Hexe.
Bis eines Tages der Duke in ihr Zimmer gekommen war. Eine Pfeife in der Hand, seinen Leibdiener hinter sich, war er dagestanden, hatte sie aus seinen kalten Augen angeschaut und verkündet, dass sie mit ihm kommen werde.
Nur vage vermochte sie sich an jene Zeit erinnern, die Zeit zwischen der Hinrichtung und ihrem Auszug, denn die Trauer hatte sie in einen Zustand versetzt, der sie kaum wahrnehmen ließ, was um sie herum geschah. Fremd und zwecklos war ihr alles erschienen, von jedem Sinn und jeder Freude entleert, und wie ein wandelnder Toter aus den alten Geschichten war sie sich vorgekommen.
Und so fand sie sich irgendwann hier wieder, der riesigen Anlage von Steffordsgrave, auf einer alten Wehranlage erbaut, in der einstmals irgendein König begraben worden sei. Nur Ann hatten sie an ihrer Seite gelassen, ihre Amme, der einzige Mensch auf der Welt, dem sie etwas bedeutete. Der einzige Mensch, der ihr geblieben war. Ansonsten gab es nur stumme Wachen und stumme Diener, die kaum ein Wort mit ihr sprachen, genau wie ihre Herren.
Sie legte sich auf den Rücken, ließ die Sonne auf sich niederbrennen und beobachtete den wolkenlosen Himmel. Ein Milan flog spähend über die Dächer, ein vierflügeliger, ein Göttervogel, und sie folgte seinem Flug mit den Augen. Sie hatte ihn schon öfter über die Anlage fliegen sehen.
Da drangen ferne Stimmen an ihr Ohr. Männerstimmen. Sie richtete sich auf. Waren sie schon auf der Suche nach ihr? Irgendwann suchten sie sie immer. Meistens erst, wenn es dunkel wurde. Dann riefen sie und riefen und es war ihr egal, bis sie die arme Ann hörte, mit ihrer verzweifelten Stimme. Dann zeigte sie sich und Ann nahm sie in den Arm und weinte und Kathryn tat es leid. Und doch tat sie es immer wieder.
Die ersten Male hatte man sie noch vor den Duke geführt. Sie hatte ihn angesehen, gespannt und schuldbewusst, den Kopf gesenkt, die Kinderaugen nach oben schauend. Er dagegen hatte sie wie ein kurioses Tier betrachtet, die Schultern gezuckt, und gemeint, der Hunger werde sie das nächste Mal schon von alleine hervortreiben. Es war ihm egal gewesen, wie alles, was sie tat, ihm egal war. Wie sie selbst ihm egal war.
Die Stimmen waren zu leise, um sie verstehen zu können, klangen aber ruhig und unaufgeregt, dass es sicher niemand war, der sie aufzuspüren versuchte. Die Neugier ließ sie auf allen vieren die Dachsparren entlangklettern, den Stimmen entgegen. Sie wurden deutlicher. Schließlich kam sie an einem Schornstein vorüber, einem alten, rußigen Rohr aus Blech, wie sie vielfach aus den Dächern des Schlosses hervorsprossen, gleich Pilzen aus einem morschen Baumstamm. Sie legte ihr Ohr sacht daran. Nun konnte sie sie besser verstehen. Die Stimmen des Dukes und eines weiteren Mannes waren es. Leise zwar, und doch verstand sie jedes Wort.
„Steht es wirklich so schlecht um ihn?“, fragte die fremde Stimme.
„So heißt es.“ Es war der Duke. „Die Priester sagen, sie könnten nichts mehr tun. Nun haben sie einen Druiden gerufen.“
„Und angenommen, er stirbt tatsächlich. Was dann?“, fragte die fremde Stimme weiter.
„Dann werde ich König!“, sagte die Stimme des Dukes. Alter Gram klang zwischen der Entschlossenheit der Worte hindurch.
Nach einer Pause fragte der Fremde: „Und das Mädchen?“
„Stirbt der König, stirbt auch sie!“, antwortete der Duke.
Eine weitere Pause.
„Einfach so?“
„Ja! Norland kann es sich nicht leisten, von einer Göre regiert zu werden. Ein Weib auf dem Thron! Niemand kann das wollen, noch weniger in diesen Zeiten. Zuviel hat mein Bruder mit seinen Mätzchen dem Land geschadet.“
„Und ihr Tod wird einfach akzeptiert werden?“, fragte der Fremde.
„Es wird sich schon etwas Passendes finden“, sprach der Duke.
„Und meine Rolle in dieser edlen Geschichte?“
„Die kennt Ihr genau. Zusammen kann es uns gelingen, das wisst Ihr.“
„Dann kommen wir doch zur wichtigsten Frage; aus welchem Grund sollte ich Eure Gnaden wohl unterstützen?“, fragte der Fremde.
„Ihr habt viel erreicht, keine Frage. Aber ein Mann, wie Ihr es seid, will immer mehr. Macht mich zum König, und ich erhebe Euch in den Grafenstand. Es sitzt sich besser bei uns Noblen, und wer weiß, wohin Euch Euer Weg von dort aus noch führen kann? Ich bin mir Eurer Fähigkeiten bewusst und gedenke, sie auch einzusetzen. Vergeudet sind Eure Talente, wo Ihr Euch jetzt befindet. Na, was sagt Ihr?“
Der Fremde überlegte geraume Zeit.
„Es kann auch ohne Euch geschehen. Ich bin der beste Kandidat. Dann allerdings habt Ihr, eines guten Freundes statt, einen mächtigen Feind!“, warnte der Duke.
„So sei es denn. Wie sprach nochmal der große Dichter: Bekleckert man sich nicht mit Ruhm, so doch wenigstens mit Titeln.“
4. Kapitel
Aris
Das monotone Lautspiel der Dampfmaschine, dazu die dicke Büffelfelldecke, die ihn angenehm wärmte, hatten Aris in einen Dämmerzustand versetzt. Seine Augen schweiften dröge vom gewaltigen Kessel, der kupfern über ihnen hing, hinüber zum steuernden Fährmann, hinter seinem großen, runden Steuerrad. Ein langer Streifen dunklen Rauchs erstreckte sich hinter ihnen, gleich einem langen, grauen Wurm. Ein milder Nordwind vertrieb den unangenehmen Rauchgeruch und ließ das Schiff angenehm schaukeln, dass Aris bei sich dachte; kein angenehmeres Verreisen könne man sich wünschen.
Er sah zu Bortos. Man hätte ihn nicht fragen brauchen, um zu erkennen, dass dieser gänzlich anderer Ansicht war. Zusammengekauert saß der Hüne da, bleich das Gesicht, die Augen geschlossen und auf den Lippen manchen Fluch ausstoßend.
„Siehst aus wie ausgespuckt, Dicker!“, stellte Aris fest.
„Halt’s Maul!“, gab Bortos zurück. „Kein Mensch sollte so reisen, potztausend. Das ist nicht gut. Wir sind dafür nicht gemacht.“
Aris zuckte mit den Schultern und beschloss, den Dämmerzustand zu vertreiben. Er erhob sich. Die Decke beließ er umgehängt, denn es zog reichlich frisch hier oben. Er trat an die innere Reling und sah hinab auf die Landschaft. Die Fähre flog tief. Felder und Häuser waren noch gut erkennbar, und manches Vieh und manchen Wagen konnte er ausmachen. Während des Krieges wurde nie zu hoch geflogen. Nur hoch genug, nicht vom Boden aus beschossen zu werden.
Seine Augen wanderten über die Passagiere. Über zwanzig Menschen waren an Bord. Die Fähre musste einiges an Flux im Kessel haben, um ein solches Gewicht befördern zu können. Eine Familie stand an der Reling, Vater und Mutter gut gekleidet, die beiden Kinder, ein Junge und ein Mädchen, deuteten aufgeregt in die Ferne. Es war eine gefährliche Zeit, mit seinen Kindern zu verreisen, dachte sich Aris, selbst zu Luft. Ein alter Mann mit rotem Halstuch saß bei einem jüngeren, seinem Gehilfen, mutmaßte Aris, eine kleine Gruppe Männer hatte den Bug für sich beansprucht und mancher lag ausgestreckt auf dem Deck und schlief. Eine alte Dame stand allein an der äußeren Reling, in der Hand eines dieser Fernrohre, um in die Weite sehen zu können, und betrachtete durch ihr Rohr, was dem bloßen Auge entging. Aris wollte schon lange eines besitzen, doch sie waren teuer und selten. Dicht bei der Dame, zu Boden aber, saß ein Mann mit breitem Hut, dessen Krempe derart tief hing, dass man nur Nase und Mund erkennen konnte. Weit in den Südlanden trug man solche, in Asyrien und Tyrien, um sich vor dem Regen zu schützen, doch hier im Norden waren sie ein seltener Anblick.
Der alte Mann mit dem roten Tuch trat an die Reling zu Aris, allein und ohne Gehilfen, die Haare grau, die Haut durchsetzt von tiefen Furchen. Er stopfte sich eine Pfeife und mühte sich vergeblich, sie mit dem Feuerzeug anzuschlagen. Aris fragte ihn, ob er noch Kraut zu verkaufen habe? Der Alte musterte ihn, nickte dann verhalten. Fünf Groschen den Zapfen, verlangte er. Dann ging er zu seinem Begleiter hinüber und kam zurück mit einem kleinen, gebundenen Lederbeutel und reichte ihn Aris.
„Händler?“, fragte Aris. Jeder andere hätte ihm etwas aus dem eigenen Krautbeutel verkauft, keinen verschnürten. Der Alte nickte. Aris zog ein Stück Lunte, wie jeder Soldat sie allzeit mit sich führt, und schlug sie geschickt an. Das Feld hatte ihn gelehrt, unter den widrigsten Gegebenheiten seine Pfeife anzubekommen. Er reichte die glühende Lunte dem Alten. Dieser nickte dankend, als seine Pfeife zu qualmen begann, und gab die Lunte zurück. Bald standen beide da, bliesen genüsslich große, weiße Wolken aus.
„Führt Ihr viel an Ware mit?“, fragte Aris. Das Kraut war gut.
„Nur was ich nicht losgeworden bin“, gab der Alte achselzuckend zurück, die Stimme tief, der Akzent nordisch.
„Ein paar Beutel noch an Kraut und ein, zwei gute Pfeifen dazu, ein wenig Pfeffer, ein wenig Öl.“
Er log. Frische Waren aus dem Süden waren es, die er führte, zweifellos, um sie im Norden zu versilbern.
„Kennt Ihr die Gegend?“, fragte Aris.
„Aye, sind über Balrust schon. Dort. ’S muss Berga sein.“ Er deutete auf eine fortifizierte Stadt in weiter Ferne. Dann hinab.
„Dort ist Charloi, und das dort mag Bolms sein. ’S ist gut Handeln hier. Zumindest früher mal.“
„Jetzt nicht mehr?“, fragte Aris.
„Euer Volk macht’s schwer“, erwiderte der Alte.
Aris runzelte die Stirn.
„Unser Volk?“
Der alte Händler drehte den Kopf zu Aris, musterte ihn kurz von unten nach oben.
„Soldateska!“
Es bedurfte keiner besonderen Ohren, um den Abscheu aus dem Wort herauszuhören, wie keiner besonderen Augen, um in Aris einen Söldner zu sehen. Seinesgleichen waren nicht gerade beliebt, und bei allem, was Aris erlebt hatte, wem wollte er es verdenken? Er nickte ohne Groll. Zog an der Pfeife.
Der Abend war fortgeschritten und das Blau des Himmels verdunkelte sich bereits. Der riesige Komet wurde langsam sichtbar, prangte am Himmelszelt, gleich einer leuchtenden Fackel. Vor zwei Tagen war er zuerst erschienen, vielleicht auch vor drei. Blau und Weiß leuchtete sein Kern, rot und gewaltig war sein Schweif. Etwas Vergleichbares hatte Aris noch niemals gesehen und landauf, landab, deuteten die Leute mit dem Finger in den Himmel und wunderten sich, was er wohl bedeuten möge. Aris gehörte nicht eben zu denen, die schon wieder das Ende aller Zeiten gekommen sahen, doch auch er konnte nicht umhin, zu gestehen, dass der Anblick Eindruck machte.
Kurz überlegte er, dem Alten seine Gedanken mitzuteilen, in letzter Zeit aber hatte er schon zur Genüge darüber gesprochen. Wäre der letzte aller Tage nahe, könnte er ohnehin nichts daran ändern.
Er sagte: „Wie steht die Sache in Norland? Manch seltsame Geschichte über den König ist mir zu Ohren gekommen.“
„Waren sie seltsam, die Geschichten, werden sie wohl stimmen. Der Mann treibt manches merkwürdige Spiel. Hat seinen Glauben gewechselt, bloß um sein Weib loszuwerden. Schimpft sich Unist. Sechs Frauen hat er bereits verbraucht, oder waren es sieben? Die letzte hat er in den Krähenturm gesperrt, als ich los bin. Inzwischen mag er sie gar den Kopf kürzer gemacht haben. Den Göttern sei’s gedankt, dass wir Prinz Edward haben. Der Alte hätte noch halb Norland besprungen, um endlich seinen Thronfolger zu bekommen. Möge Edward lange leben und ihm die Götter einigen Anstand mitgegeben haben.“ Er hob die Pfeife gleich einem Becher zum Trinkspruch.
„So taugt er also nicht, euer Jakob?“, fragte Aris weiter.
„Bei uns heißt’s: Manche Könige sind schlecht und andere schlechter. Dieser gehört zu letzteren. Aber man kann sich seinen König nun mal nicht aussuchen.“ Er sagte es, als gäbe es dazu nicht mehr zu sagen.
„Und wie steht es mit dem Krieg?“, fragte Aris.
„Manche sagen, im Norden braue sich was zusammen.“ Der Alte zuckte mit den Schultern.
„Sie sind ein wildes Volk, die Gooten.“
„Sind Trinisten, oder?“, meinte Aris.
Der Alte warf ihm einen wägenden Blick zu.
„Die meisten von uns sind auch noch vom wahren Glauben.“
„So wie ich!“, sagte Aris.
Der Alte nickte zufrieden.
„Hat damit jedenfalls nix zu tun. So sind die Gooten einfach. Haben so viele Stämme, wie sie Dörfer haben, da oben. Und haben sie genug, sich gegenseitig die Köpfe blutig zu hauen, kommen sie eben hinab, sich an uns zu probieren. Ziehen ein paar Meilen ins Land, schatzen ein paar Dörfer, dann ist’s wieder gut. ’S war immer so. Wird immer so bleiben.“ Er blies einen Schwall Rauch hinaus. Dann fuhr er fort: „Im Süden gibt’s mehr zu bedenken. Sippan ist stark. Sehr stark. Und ihr General Spinola sei ein ehrgeiziger Hund. Vom Blutigen Baron höchstpersönlich soll er gelernt haben. Aber die Tumber hält! ’S ist noch keinem gelungen, hinter dem Fluss eine Stellung zu halten. Auch den Sippanern nicht. Aber sie versuchen es weiter. Und wir schlagen sie weiter zurück. Die Tumber hält! Das alleine zählt.“ Als sei ihm eben etwas eingefallen, bedachte er Aris mit einem misstrauischen Blick.
„Für wen wollt Ihr überhaupt streiten, Soldat?“, fragte er.
Aris lächelte schief: „Na, für euereins.“ Längst bestand kein Zweifel mehr, woher der Alte stammte.
„Immerhin“, gab der Alte zurück.
„So läuft er also gut, der Krieg?“
„Kein Krieg läuft jemals gut, Junge!“ Der Tonfall plötzlich streng. „Kein Krieg!“, wiederholte er.
„’S ist ein Graus, was ihr bei euch da unten anstellt.“ Aris war sich nicht sicher, was der Alte mit euch da unten meinte. Er ordnete Aris jedenfalls dem Süden zu.
„Immer Krieg. Wie lange schon? Zehn Jahre?“
„Es waren verschiedene Kriege“, erwiderte Aris. Es war wahr und auch nicht, denn ein Krieg war dem anderen gefolgt und kein Jahr der letzten zehn war vergangen, ohne dass eine große Schlacht geschlagen wurde.
„Einer, zehn, zwanzig. Was macht’s? Irgendwo ist immer Krieg, die ganze Zeit. Was ist nur aus dem Reich geworden? Statt für Ordnung zu sorgen, kämpfen die Kurfürsten plötzlich untereinander. ’S ist dieser ganze Quatsch mit dem neuen Glauben. ’S steigt den Menschen zu Kopf und macht sie wirr. Macht Streit und zerstört die gute Ordnung. Bin alt genug, mich an ne Zeit davor zu erinnern. Als es nur einen Glauben gab, der allen gut genug war, und das Reich alles beherrscht und für Ruhe gesorgt hat. Als der Imperator noch einer war und sich nicht in seiner Burg verkrochen hat, während sein Land vor die Hunde geht. Als Frieden war, meistenteils jedenfalls. Hab Handel getrieben mein Leben lang. Überall war ich, und überall kannte ich Leute. Gute Leute. Bald die Hälfte ist jetzt tot, tot oder verschwunden. Und nicht das Alter hat sie geholt. Ein wenig Krieg, das ist normal, so ist der Mensch nun mal. Aber was die vergangenen Jahre war, das ist weit über Maß. Man sieht bald mehr von euresgleichen durch die Landschaft ziehen, als normales Volk. Nichts zu beißen gibt’s, schlechte Ernten, allerlei Seuchen. An jeder Ecke lauert der Tod. Eine Schande ist’s, bei den Göttern. Was habe ich für Dinge gesehen, was für Dinge erlebt?“ Er schüttelte den Kopf. „Eine Schande ist’s, was ihr da treibt!“
Deutlich war der Seitenhieb, wie ihn Aris selten hörte, und der Groll in der Stimme des Händlers war unverhohlen.
„Wir treiben Übles, ich werde es nicht leugnen. Aber vergesst nicht, auf wessen Geheiß. Die da oben sind es, die bestimmen. Die spielen die Musik. Wir tanzen nur danach“, erwiderte Aris. Er verstand den Alten, verstand ihn sogar gut, und doch drängte es ihn, sich zu verteidigen.
„Gut gesprochen“, gab der Alte zurück. Die Rage, in die er sich geredet hatte, war abgeflaut, und müde und erschöpft klang er mit einem Mal, als er fragte: „Seit wann bist du im Feld, Junge?“
Schon wieder Junge. Aris mochte nicht so genannt werden und merkte, wie er allmählich ärgerlich wurde. Dennoch antwortete er ruhig: „Bin im Tross geboren.“
„Vom Tross an im Felde?“, der Alte sah ihn an, mitleidig. Er schien zu wissen, was es hieß, im Tross geboren zu sein. Aufzuwachsen zwischen Huren und Soldaten, und nichts anderes zu kennen als Krieg und Feldzug. Kein Heim, das einen solchen Namen verdient. Kein Land, das einem Heimat ist.
„Vom Tross an! Dann musst du nichts mehr sagen. Dann hast du mehr als genug mitgemacht.“ Er machte eine Pause, zog gedankenverloren an der Pfeife.
„Weißt du, ich hatte mal einen Sohn. So alt wie du war er. Sah sogar etwas aus wie du. Ein guter Junge war’s.“ Schmerzvoll war, woran er dachte, Aris konnte es spüren.
„Etwas vorlaut war er, aber im Großen und Ganzen ein guter Junge. Und vielleicht bist du auch ein guter Junge. Aber ich bin alt und habe zu viel gesehen.“ Er sah trübe zu Aris hinüber. „Du allein weißt, was an deinen Fingern klebt, nur du allein. Aber sauber, da bin ich sicher, sind sie nicht. Was wäre wohl, liefen wir uns dort unten über die Quere?“ – er deutete hinab auf das Land, das sich so friedvoll unter ihnen erstreckte. – „Was dann? Meine Waren würdest du mir nehmen, ist’s nicht so? Meine Waren und alles, was ich bei mir führte. Und zum Dank würdest du mir am Ende wahrscheinlich noch die Gurgel aufschneiden.“ Er sah Aris streng an, deutete mit dem Stiel der Pfeife auf ihn. Aris erwiderte kalt den Blick. Widersprechen tat er nicht.
„Die dort oben spielen die Musik, wohl wahr. Die Sünden aber lastet man der eigenen Seele auf, mein Junge.“
„Ich bin nicht Euer Junge!“, gab Aris zum ersten Mal gereizt zurück.
„Will keinen Streit mit dir“, sagte der Alte milde und hielt die flache Hand vor sich. „Könnte ihn ohnehin nicht gewinnen. Ich bin müde, weißt du. Vielleicht ist’s das Alter. Vielleicht vertrage ich das Kraut nicht mehr so gut wie auch schon. Ich seh dich und sehe meinen Sohn. Und denke an ihn, und traurig macht es mich. Ich will dir nichts Böses, glaub mir.“
Er klopfte die Pfeife aus und machte sich dann daran, zurück an seinen Platz zu gehen.
„Mach’s gut, mein Junge“, sagte der Alte und klopfte Aris sanft auf die Schulter. „Und pass auf dich auf.“
Er meinte es ehrlich, das wusste Aris.
Eine Weile noch blieb er an der Reling stehen, vom Kraut benebelt und verwirrt von dem seltsamen Gespräch. Dann setzte er sich wieder zu Bortos, der nicht besser aussah als zuvor.
„Wer war der Kerl, mit dem du gesprochen hast?“, fragte Bortos.
„Ein Händler“, antwortete Aris.
„Mit guter Ware? Nehmen wir ihn uns vor, wenn wir angekommen sind?“, fragte Bortos weiter.
Aris überlegte lange, schüttelte dann den Kopf.
„Ist nicht viel zu holen!“
In der Fährstation hatten sie erfahren, wo das nächstgelegene Werbezelt zu finden sei. Wie in ganz Alana zogen auch hier Kriegswerber durch die Lande, bauten ihre großen, weißen Zelte auf, um kriegswilliges Volk zu rekrutieren. Etliche von ihnen seien unterwegs, hieß es in der Station, ließ Norland doch groß zu den Fahnen trommeln, nachdem der dreijährige Frieden mit Sippan im Frühjahr ausgelaufen war und es im Süden bereits zu Kämpfen gekommen war.
Zahlreiche Kriegsschiffe hatten Aris und Bortos entlang der Tumber entdeckt. Dicht unter der Wolkendecke patrouillierten sie, zogen ihre Bahnen wie flügellose Vögel. Entlang des Flusses gab es keinen Berg und keine Anhöhe, die nicht ein Fort oder eine Festung zierte, die Türme mit Kanonen gespickt, und hohe Säulen mit Warnfeuern standen darauf, bereit, die Umlande zu warnen, falls der Feind es wagte, über die Tumber hinüberzusetzen. Und Aris verstand, was der Alte gemeint hatte. Sich diesseits des Flusses festzusetzen, dürfte selbst für die stärkste Armada eine kaum zu bewältigende Herausforderung sein, denn der breite Fluss versperrte die Zufuhr aus dem Süden und von allen Seiten war man nur von Feind und Festungen umgeben.
Am nächsten Morgen marschierten sie in Richtung des nächsten Werbezeltes. Unterwegs fand sich schon der ein oder andere zukünftige Soldat. Meistenteils nordische Bauern und anderes Landvolk, aber auch einige Kriegsknechte aus dem Süden und Osten. Das Zelt befand sich auf einer Anhöhe, und Aris und Bortos reihten sich in die Schlange der zu Musternden. Ein Feldscher schaute den Männern in Maul und Augen, gab dann seine Zustimmung an den Werber weiter. Dieser war ein herrischer Kerl, mit spitzer Kampfhaube behelmt, strengen Augen und einem gewaltigen Schnauzbart, dessen Enden gezwirbelt waren und beinahe bis zu den Ohren abstanden. Er ließ kaum mit sich feilschen.
„Mach dein Zeichen oder verschwinde!“, herrschte er gerade auf Nordisch einen jungen Burschen an, als letzterer seinen Mund zur Begutachtung weit aufmachte. Der Junge wagte keinen Widerspruch und machte sein Kreuz, wo ihm gewiesen wurde. Dann waren Aris und Bortos an der Reihe. Der Feldscher hatte schon seine Zustimmung signalisiert, wie bei eigentlich jedem der Anwerber. Der Werber sah die beiden an.
„Gehört zusammen, was? Wie heißt ihr Vögel?“ Aris und Bortos antworteten und der Werber schrieb ihre Namen auf eine ausgebreitete Pergamentrolle, die vor ihm auf einem Tisch lag.
„Keine Zunamen? Mir solls recht sein. Vier Kronen Sold den Monat gibt’s. Macht euer Zeichen hier.“
Er deutete auf das Pergament, wo nunmehr ihre beiden Namen standen.
„Musst uns schon etwas mehr bieten. Sind es auch wert!“, sagte Aris, grinste den Werber schief an. Er kannte das Spiel.
„So? Wer sagt das? Für mich seht ihr wie die frischesten Frischlinge aus, die ich je gesehen habe! Macht euer Zeichen!“, forderte er barsch.
„Wisst Ihr, woher das hier stammt?“, fragte Aris und deutete auf seine Narbe.
„Hat dir die Amme verpasst, weil du ihr in den Nippel gebissen hast?“, gab der Werber zurück. Aber Aris wusste, der Kerl war ein alter Haudegen und hatte sie längst richtig eingeschätzt.
„Ist ein Andenken von Grabstett“, sagte Aris und fuhr sich die Narbe entlang. „War ein Storzer Hauptmann. Und der sieht schlechter aus als ich.“
„Grabstett? Das storzische Hauen? Und das soll ich euch glauben?“
„Ob Ihr’s glaubt oder nicht, ändert nichts daran, dass es die Wahrheit ist“, sagte Aris.
„Muss ein ordentliches Spektakel gewesen sein. Welche Seite?“
„Karn!“, antwortete Aris.
„Obrist?“
„Richtenstein. Blaue Kompanie unter Richard von Brennan, ein guter Mann, einer von hier.“
Der Werber sah von einem zum anderen.
„So wie ihr zwei Galgenvögel ausseht, brauch ich nach einem Dienstzeugnis gar nicht erst zu fragen, was? Gebe euch acht, aber seid’s mir ja auch wert.“
Jetzt sprach Bortos zum ersten Mal:
„Die sind wir wert! Und mehr noch. Ihr werdet sehen.“ Und er machte sein Zeichen. Aris auch.
Es war schon spät, als endlich die letzten Bewerber abgefertigt waren. Dann fanden sich alle frisch Rekrutierten neben dem Zelt wieder und der Werber stellte sich vor die Truppe hin.
„Mein Name ist Yorick Rumford, meines Namens Korporal im ehrenvollen Regiment von Lord Henry Stannisford. Und ihr Feldratten seid jetzt meine Kameraden. Nicht, dass es mich mit Stolz erfüllte, denn sehe ich euch räudigen Haufen an, sehe ich mehr Grünschnäbel und Hosenscheißer als in der Priesterschule. Aber keine Sorge. Wir machen schon Männer aus euch Lumpenpack, und wenn nicht wir, dann macht’s der Krieg.“ Er schritt die Reihen entlang, die Arme hinter dem Rücken verschränkt.
„Wem Büchse und Gürtel fehlen, kann sie statt dem Handgeld vom Feldweibel Sheppard bekommen.“ Er deutete auf einen grimmigen Kerl, dem ein Auge und ein Ohr fehlten.