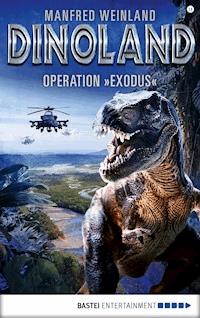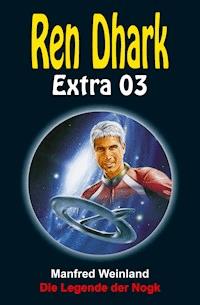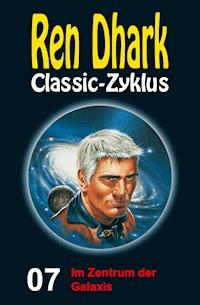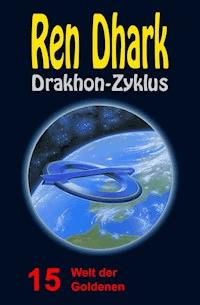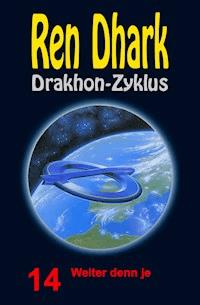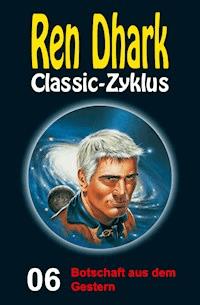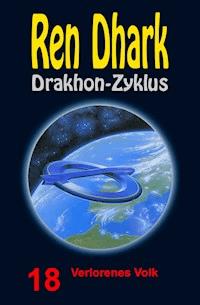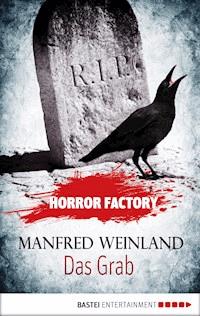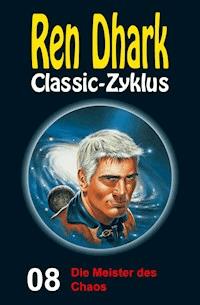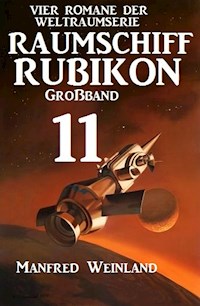1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gespenster-Krimi
- Sprache: Deutsch
Vergangenheit
Der neunte Donner in Folge rollte von den Westhängen des Dorrit Massivs auf Kezar Falls hinab und ließ das hübsche zweistöckige Haus im Ortskern bis in seine Grundfesten erbeben. Einen Blitz hatte niemand gesehen - wie auch die Male davor nicht. Das gewaltige Spektakel, das damit einherging, unterstrich die Gespenstigkeit des Ereignisses. An eine Nacht wie diese - an ein solches Unwetter, das alles im Umkreis zu ertränken drohte - konnte sich niemand in der kleinen Stadt, auch nicht der "Klub der Hundertjährigen", erinnern ...
"Neun Leben hat die Katz", murmelte Kay Marsten scheinbar zusammenhanglos und schmiegte sich an den Arm ihres Mannes, der auf dem Bettrand saß und sich wie schützend über sie beugte. Ihre Stimme war heiser vom Schreien, der Atem ging stoßweise.
"Was sagst du da?" Ben Marsten, der die Donnerschläge gezählt hatte, klang irritiert.
Die Hebamme kam herein und entfernte den Bottich mit dem immer noch dampfenden Wasser, in dem Blutreste schwammen. Kay wartete, bis sie draußen war, dann hob sie ihrem Mann das fiebrig glänzende Gesicht entgegen, lächelte abwesend und flüsterte: "Was geschieht nur mit uns, Ben, Liebling? Diese furchtbare Nacht ..." Sie schloss die Augen und keuchte wie unter nachträglichen Phantomwehen. "Ich wollte - diese Frau - nicht ...!"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Schattenkinder
Vorschau
Impressum
Schattenkinder
von Manfred Weinland
Vergangenheit
Der neunte Donner in Folge rollte von den Westhängen des Dorrit Massivs auf Kezar Falls hinab und ließ das hübsche zweistöckige Haus im Ortskern bis in seine Grundfesten erbeben. Einen Blitz hatte niemand gesehen – wie auch die Male davor nicht. Das gewaltige Spektakel, das damit einherging, unterstrich die Gespenstigkeit des Ereignisses. An eine Nacht wie diese – an ein solches Unwetter, das alles im Umkreis zu ertränken drohte – konnte sich niemand in der kleinen Stadt, auch nicht der »Klub der Hundertjährigen«, erinnern ...
»Neun Leben hat die Katz«, murmelte Kay Marsten scheinbar zusammenhanglos und schmiegte sich an den Arm ihres Mannes, der auf dem Bettrand saß und sich wie schützend über sie beugte. Ihre Stimme war heiser vom Schreien, der Atem ging stoßweise.
»Was sagst du da?« Ben Marsten, der die Donnerschläge gezählt hatte, klang irritiert.
Die Hebamme kam herein und entfernte den Bottich mit dem immer noch dampfenden Wasser, in dem Blutreste schwammen. Kay wartete, bis sie draußen war, dann hob sie ihrem Mann das fiebrig glänzende Gesicht entgegen, lächelte abwesend und flüsterte: »Was geschieht nur mit uns, Ben, Liebling? Diese furchtbare Nacht ...« Sie schloss die Augen und keuchte wie unter nachträglichen Phantomwehen. »Ich wollte – diese Frau – nicht ...!«
Benedicte Hootch kehrte zurück. Sie war eine kleine, stämmige Frau mit Fischaugen und rosigen Wangen, die gesunde Frische vorgaukelten, aber wie aufgemalt wirkten. Ein Damenbart verunzierte ihre Unterlippe, der Flaum schien direkt aus den Nasenöffnungen herauszuwachsen.
Ihr Benehmen insgesamt war untadelig. Sie kam und ging wie ein Schatten. Wer sie eine Weile beobachtete, konnte sie für stumm halten, aber das stimmte nicht. Sie wartete einfach nur, bis sie angesprochen wurde. Von sich aus sagte sie selten etwas. Auch bei Kindern und Neugeborenen machte sie keine Ausnahme.
Ben Marsten glaubte, dass das der Grund war, warum sie in der Gegend einen etwas zwiespältigen Ruf genoss. Sie verstand ihr Handwerk wie kaum eine Zweite, aber ihre Defizite im Zwischenmenschlichen ließen sich für viele nicht in Einklang mit dem Beruf einer Hebamme bringen. Für manche genügte diese Eigenart bereits, sie verdächtig zu finden. Verdächtig wie alles Fremde.
Sie blieb jetzt vor dem Bettende stehen, hob die linke Hand und spreizte drei Finger ab. An dieser Hand hatte sie nur diese drei Finger, zwei waren amputiert. Eindringlich blickte sie die Eltern an.
»Drillinge«, übersetzte Ben das, was sie längst wussten, mit rauer Stimme. Er hatte das Gefühl, die plötzliche Stille, in der nur noch das Plätschern des Regens zu hören war (der Donner hatte aufgehört), überbrücken zu müssen. »Der Doc wird Bauklötze staunen ...«
Er nickte Mrs. Hootch zu und atmete insgeheim auf, als sie den Raum verließ.
»Wo sind meine Kinder?«, seufzte Kay. Die Dreifachgeburt hatte sie begreiflicherweise geschwächt.
»Es geht ihnen gut«, sagte Ben und strich ihr über das verschwitzte Gesicht. »Mrs. Hootch kümmert sich um sie ...«
»Ich will sie sehen«, presste Kay hervor. »Gleich. Bitte, Ben, ich ...«
Es klopfte.
Ehe jemand reagieren konnte, schwang die Tür des Schlafzimmers auf. Eine hochgewachsene Gestalt mit lackschwarzem Haar wirbelte wie ein Bestandteil des draußen tobenden Unwetters herein.
»Doc!« Ben wusste nicht, warum er erleichtert war.
Joshua Dylan wiegelte gestenreich ab und deponierte seine Tasche auf dem Nachttisch. »Verflixtes Missgeschick«, schimpfte er und richtete einen tadelnden Blick zur Decke, als meine er den Himmel darüber. »Die Straße war blockiert. Massenkarambolage. Ein umgestürzter Baum ... Ich konnte nicht früher kommen. Es ging beim besten Willen nicht. Außerdem scheine ich mich ein bisschen verschätzt zu haben ...«
»Es ist ja alles in Ordnung«, beruhigte ihn Ben. »Zum Glück konnten Sie Mrs. Hootch verständigen. Sie war rechtzeitig zur Stelle.«
»Mrs. Hootch?« Doc Dylan sah zuerst Ben, dann Kay Marsten aus verengten Augen an. »Verständigt, ich?« Er schüttelte nachdenklich den Kopf, als hinter ihm Bewegung entstand.
Die Hebamme glitt herein und gesellte sich zu ihnen.
Ben zuckte mit den Schultern. »Dann habe ich da wohl etwas in den falschen Hals gekriegt.« Er musterte Mrs. Hootch, als erwartete er von ihr eine Stellungnahme, die jedoch nicht kam. »Sagten Sie mir nicht ...? Egal. Ich ...«
»Die Kinder«, erinnerte ihn Kay nervös. »Wo sind meine Kinder? Ich will sie hier bei mir haben. Auf der Stelle ...!«
Ben gab Mrs. Hootch ein Zeichen. Während der Doc sich um Kay kümmerte, folgte er selbst der Hebamme hinaus in den gut beheizten Nebenraum, wo die Drillinge nebeneinander in einer Doppelwiege lagen, die eigentlich nur für zwei neue Erdenbürger gedacht gewesen war. Mit mehr hatten sie nach den turnusmäßigen Untersuchungen nicht gerechnet.
Ben beugte sich lächelnd darüber.
Das Lächeln gefror!
Alle drei lagen starr, wie völlig identische Puppenfiguren, auf ihren rosigen Rücken. Erst als Ben Marsten panisch zugriff und das erste Baby heraushob, kam Bewegung in den nackten, zerbrechlichen Körper. Das Baby begann lauthals zu plärren. Derselbe Vorgang wiederholte sich bei seinem Brüderchen.
Nur Nummer drei blieb stumm.
Kay fuhr zusammen, als sie Bens erstickten Aufschrei hörte. Gerade hatte sie sich unter dem Zureden des Docs etwas beruhigt. Kurz darauf taumelte Ben bleich zu ihnen herein. Im Arm hielt er einen der Drillinge, während Mrs. Hootch mit den beiden krakeelenden Geschwistern und ausdrucksloser Miene folgte.
»Tot, Doc«, stammelte Ben. »Es ist ... tot.«
Der Arzt sprang auf und nahm ihm das Baby ab. Aber es war zu spät, um etwas zu ändern. Er konnte nur noch den Tod bestätigen und sich über eine Merkwürdigkeit wundern. Neun der zehn Fingernägel waren rabenschwarz – wie verkohlt – und hatten eine Maserung, die an stilisierte Totenschädel erinnerte. Nur ein einziger war normal geblieben.
Neun Donnerschläge, dachte Ben Marsten zusammenhanglos.
Als Kay es entdeckte, riss sie die Augen auf und wiederholte mit hysterischer Stimme den Bestandteil des Kinderreims von vorhin: »Neun Leben hat die Katz' ...«
Doc Dylan sah beunruhigt auf sie herunter. Ben schob ihn mit dem toten Kind im Arm hinaus auf den Flur.
Benedicte Hootch legte die beiden gesunden Babys neben die Mutter auf das Kopfkissen und lächelte mit einem Ausdruck, der Kay Marsten Albträume für die nächsten Tage und Wochen beschert hätte, hätte sie ihn wahrgenommen.
Aber die hatte sie ohnehin nach dem Tod des Jungen, dem sie im Stillen schon einen Namen zugewiesen hatten.
Rod.
Rod Marsten.
Ein Name, eines quicklebendigen Prachtburschen würdig.
Doch nun war er nur noch – so schien es – gut für den dunklen Stein auf einem schattigen Grab ...
†
Siebzehn verfluchte Jahre später – Gegenwart
Der Schrei zerriss die Stille des Hauses und löste die Lähmung, die Jonathan seit dem Aufstehen zu spüren glaubte.
Er sprang so heftig von seinem Experimentiertisch auf, dass der Stuhl nach hinten wegkippte und zu Boden schlug. Fast gleichzeitig mit Erreichen des Flurs polterte jemand die Treppe herauf.
Der schlanke Mann im Anzug, dessen schlohweißes Haar hinten mit einem Band gebändigt werden musste, stolperte an Jonathan vorbei auf die offen stehende Tür neben dessen Zimmer zu, wo der entsetzliche Schrei mittlerweile zu einem Röcheln abgesunken war.
Das Grauen stand Ben Marsten ins Gesicht gemeißelt, und Jonathan verstand immer noch nicht. Vorhin hatte er schon einmal schnelle Schritte auf dem Korridor gehört – aber eher am Rand seines Bewusstseins. Das neue Experiment aus dem Chemiekasten erforderte alle Konzentration. Die Schwefeldämpfe hingen ihm immer noch in den Klamotten ...
Dicht hinter seinem Vater betrat er Bills Zimmer.
»Doc Dylan ist unterwegs ...« Ben Marsten haspelte die Worte herunter, sodass Jonathan ihn kaum wiedererkannte. Dennoch wusste er plötzlich mit niederschmetternder Gewissheit, dass etwas Furchtbares in die Normalität ihres Lebens hereingebrochen war.
Seine Mutter kauerte auf Bills Bett und verdeckte den Bruder, der dort ausgestreckt wie ein Brett lag, fast völlig.
Kay Marsten, die Mutter, um die die Marsten-Zwillinge von der gesamten männlichen Belegschaft der High-School von Kezar Falls beneidet wurden, hob kurz den Kopf, schien Jonathan aber gar nicht wahrzunehmen. Ihre Augen schwammen in Tränen.
»Nicht schon wieder ...«, quälte es sich über ihre Lippen. Sie sah Ben an und wiederholte mehrere Male: »Nicht noch einmal ... Bitte, Ben, nicht noch einmal ...«
Jonathan fragte mit pulvertrockener Kehle: »Ist etwas – mit Bill?«
Sein Vater wandte sich zeitlupenhaft in seine Richtung. »Geh nach unten.« Er stand da wie zwischen den Plus und Minuspolen eines Magneten hin und her gerissen. »Mach dem Doc auf, sobald er eintrifft. Verlier keine Sekunde!«
Jonathan versuchte, einen letzten Blick an seiner Mutter vorbei auf Bill zu erhaschen. Er sah nur die Beine.
Es verbot sich von selbst, länger zu zögern.
Jonathan spurtete nach unten, aber als der alte Doc Minuten später von ihm eingelassen wurde und gleich die Treppe hoch keuchte, wurde er abermals enttäuscht. Als Doc Dylan in Bills Zimmer tauchte, trat Ben Marsten sofort heraus und dirigierte Jonathan ins Nebenzimmer, wo es immer noch stank wie in Schwefelklüften.
Ben Marstens Weg führte fluchend geradewegs zum Fenster, das er mit Wucht nach oben schob und anschließend frische Luft hereinzufächeln versuchte.
Jonathan stand immer noch wie angenagelt neben der Tür.
»Setz dich«, sagte sein Vater, ohne die Vorwürfe, mit denen er die Experimente seines Sohnes sonst kommentierte (»Du wirst uns noch einmal die Hütte unter dem Hintern anzünden!«).
»Ist Bill krank?«, fragte Jonathan schleppend. Die Lähmung dieses Tages – dieses Gefühl jenseits seiner Erfahrungen – drohte ihn zu infizieren.
Er merkte, dass er zitterte. Mit schweißnassen Händen wischte er sich über das T-Shirt mit der Aufschrift Better days are coming. Fast unbewusst tastete er sich über den Kehlkopf, in dem die Angst pulsierte. Plötzlich hatte er eine starke Empfindung, die ihn auf das Schlimmste vorbereitete. Die Worte seines Vaters waren wie eine Bestätigung.
»Der Doc wird uns sagen können, was passiert ist. Deine Mutter fand Bill vor ein paar Minuten in einem ... komaähnlichen Zustand.«
Die letzten beiden Worte rannen zäh wie Klebstoff über seine Lippen. Er starrte Jonathan an, als erhoffte er sich, dass dieser mit dem Erklärungsversuch fortfahren würde.
Jonathan schwieg.
»Er – atmete nicht mehr.«
Jonathan sog scharf die Luft ein. Der Kloss im Hals blähte sich zu einem monströsen Klumpen auf.
Er lief auf seinen Vater zu, hielt kurz inne, krallte sich dann in dessen Hemd, riss und zerrte halbherzig daran und begann schließlich mit den Fäusten auf ihn einzutrommeln.
»Du lügst!« rief er. Es war Ausdruck von Verzweiflung, deren Ausmaß ihm selbst noch unbekannt war. »Willst du etwa sagen, dass er ... tot ist?«
Von hinten legte sich eine Hand auf seine Schulter und zog ihn zurück. »Ganz ruhig«, sagte Doc Dylan sanft. Sein ledernes Gesicht sah aus wie eine ölig glänzende Maske mit ausgestochenen Augen. Schweiß lief ihm über die Wangen. Er dampfte förmlich. In der einen Hand hielt er eine Spritze.
Als Jonathan die Absicht erkannte, wich er zurück. »Nein ...!«
»Es ist nur zu deiner Beruhigung«, beharrte der Doc.
Erst als Ben Marsten den Kopf schüttelte, ließ er die Nadel schulterzuckend sinken. Aber er wusste, dass er so leicht nicht davonkam.
»Es ist wie damals«, kam er jeder Frage zuvor.
»Damals«, echote Jonathans Vater.
Ehe ihn jemand aufhalten konnte, huschte Jonathan am Doc vorbei durch die Tür.
»Lassen Sie ihn«, hörte er die Stimme seines Vaters – schwach und tonlos, wie er es noch nie erlebt hatte.
Die Schwelle zu Bills Zimmer schien ihm einen Moment lang unüberwindbar. Aber dann stand er neben dem Bett und neben seiner Mutter, die so grau und eingefallen wirkte, als hätte die Zeit einen Sprung um Jahrzehnte voraus vollführt.
Dann sah er Bill und achtete auf nichts mehr sonst.
Obwohl sie sich Mühe gaben, nie dieselbe Frisur und nie dieselbe Kleidung zu wählen, war es, als würde er in einem Spiegel versinken.
Nein, korrigierte er sich. Als könnte ich mich selbst auf meinem Totenbett betrachten ...
»Mum ...« Jonathan sank neben sie auf die Bettkante.
Als er sie berühren wollte, zuckte sie wie elektrisiert zusammen und schluchzte dann hemmungslos. Sie warf sich an Bills Brust und verlor komplett die Kontrolle über sich, wimmerte wie ein getretenes Tier oder ein anderes aus der Bahn geworfenes Geschöpf, was bei Jonathan ein absurdes Schamgefühl auslöste.
Bill rührte sich immer noch nicht.
Jonathan hatte noch nie zuvor einen echten Toten gesehen, und auch jetzt weigerte sich sein Verstand, den Tod als Realität zu akzeptieren.
Nicht Bill, dachte er. Nicht mein Spiegel ...
Dass sein Bruder wirklich tot sein könnte – tot! –, lag jenseits der Vorstellungskraft, und auch als Jonathan in sich hineinlauschte – hieß es nicht immer, Zwillinge hätten eine besondere Affinität zueinander? –, fand er nichts, das einem Verlustschmerz gleichgekommen wäre.
Aber Bill lag mit kalkweißem Gesicht und offenen Augen auf dem Bett. Seine Iris ähnelte einer Milchglasscheibe, in deren Mitte jemand ein kleines Loch mit dem Eispickel gebrochen hatte. Er hatte die Hände über dem Bauch gefaltet.
Jonathan fragte sich, ob Doc Dylan oder seine Eltern dies nachträglich so komponiert hatten, oder ob Bill sich tatsächlich so zum Sterben niedergelegt hatte – als hätte er gewusst, was passieren würde.
Jonathans Blick blieb an Bills Fingernägeln haften. Als er genauer hinsah, glaubte er dunkle Verkrustungen im Nagelbett zu bemerken. Als hätte sich Bill mit einem Hammer wehgetan. Blutergüsse. Nur ein einziger der zehn Nägel sah aus wie immer.
»Junge – komm hierher!«
Doc Dylans schwere Schritte drangen erst in sein Bewusstsein, als der Arzt fast bei ihm war.
Die Hände seiner Mutter fielen von ihm ab, als er sich erhob und mit einem vagen Gefühl der Erleichterung gehorchte. Draußen im Flur wartete sein Vater.
»Wir müssen miteinander reden«, sagte er.
Jonathan starrte ihn ausdruckslos an. Hinter ihm entstand Bewegung, als Doc Dylan seine Mutter zur Treppe nach unten führte.
»Was – ist passiert?« stellte Jonathan noch einmal die einzige Frage, die es im Moment gab.
»Wir ... wissen es nicht, und ich weiß nicht, ob dies überhaupt der rechte Zeitpunkt ist, darüber zu sprechen ...«
»Worüber zu sprechen?«
Ben Marsten rang mit sich. Jonathan hatte das Gesicht seines Vaters noch nie so verlebt gesehen wie in diesem Moment. Auch das schlohweiße Haar gewann dadurch eine neue Dimension, die es eigentlich durch die lange Gewöhnung nicht mehr hätte haben dürfen. Jonathan kannte seinen Vater nur mit diesem Haar. Auf Anspielungen hatte sein Dad immer mit Selbstironie reagiert (»Bei euch muss man ja graue Haare kriegen ...«). Bislang hatte Jonathan nie einen Grund gesehen, sich näher damit zu befassen. Es gab weiß Gott Wichtigeres. Doch nun – in diesem Moment, der nicht länger währte als ein Lidschlag – hatte er plötzlich das intensive Gefühl, dass alles, was er gerade wahrnahm, miteinander verflochten war. Sogar verflochten mit dem, was Bill widerfahren war.
Tot! Sprich es aus: Er – ist – tot ...!
Ben Marsten legte den Arm in einer Geste unbeholfener Zärtlichkeit um die Schulter seines Sohnes und führte ihn wortkarg in sein Arbeitszimmer am Ende des Korridors.
Es war für die Zwillinge immer ein nicht sehr angenehmer Ort gewesen. Die Bücher, die sich hier über alle vier Wände hinweg in altersschwachen Regalen stapelten, staubten beim bloßen Betrachten. Amerikanisches bürgerliches Gesetzbuch, Das Staatswesen von Michigan, Borg gegen den Staat Louisiana ...
Die Liste ließ sich endlos fortführen. Richtige »Schmöker« fanden sich nicht unter den dicken Folianten – auch keine Abhandlungen über Dinge, die Jonathan brennend interessierten. Sein Dad hielt sich lieber an Paragraphen und andere Langweiler – wenn sie nur beweisbar waren. Er arbeitete als Juniorpartner in einer gut gehenden Anwaltskanzlei in Kezar Falls, was ihm gutes Geld und Ansehen, aber wenig Zeit für die Familie einbrachte.
Als Jonathan in einem der Ledersessel Platz nahm, die um einen kleinen Glastisch herum arrangiert waren, wunderte er sich beiläufig darüber, dass sein Vater heute schon so früh zu Hause war.
Ausgerechnet heute.
Vielleicht, dachte er, hatte er auch diese Vorahnung ...
»Er ist nicht – tot, oder?«