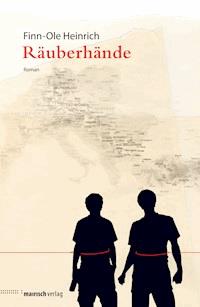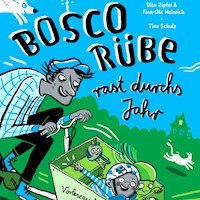Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mairisch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Susan fehlt ein Bein. Tom ist die Treppe runtergefallen. Und Henning lügt so lange, bis er die Wahrheit sagt. Finn-Ole Heinrich erzählt von Menschen, die ins Schwanken gekommen sind, die das Leben mit aller Härte umgeworfen hat. Und die nun wieder aufstehen müssen. Finn-Ole Heinrich zählt zu den großen Talenten der deutschen Gegenwartsliteratur. Bereits seine ersten beiden Bücher, "die taschen voll wasser" (Erzählungen, 2005) und "Räuberhände" (Roman, 2007) sowie sein erstes Kinderbuch "Frerk, du Zwerg" (2011) wurden von Lesern und Presse gefeiert. Mit "Gestern war auch schon ein Tag" erreicht sein Schreiben jetzt eine neue Stufe. Diese Texte hinterlassen in ihrer Ehrlichkeit, sprachlichen Klarheit, ihrer Sensibilität und auch in ihrem Humor beim Leser eine Faszination, die lange trägt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Zeit der Witze
Schubert wäre gern geheimnisvoll
Machst du bitte mit, Henning
Sie hat den Herbst gewonnen
Samstags
Marta
Wessi
Wenn man gesungen sagt
Danke
Finn-Ole Heinrich
Impressum
Widmung
Für meine Geschwister
Jette, Jule, Tjark und Nele
Zeit der Witze
»Ist das ein Gefühl«, sagt sie, »das ist wie alles neu, ganz komisch.« Sie meint, wieder draußen zu sein, denke ich, auf eigenen Beinen, sozusagen.
Ein heller Morgen kurz vor Sommer, Zeit für T-Shirts, Tops und Röcke. Die Straße ist leer so früh, ich beobachte Susan, ohne sie anzusehen. Ich fahre zu schnell, zum ersten Mal seit ich sie ins Krankenhaus gebracht habe, vor Wochen, als man dem Frühling noch nicht traute. Mit achtzig Sachen durch die Ortschaft, sportlich in die Kurven. Das geht wieder. In meinem Augenwinkel guckt Susan in alle Richtungen, als gäbe es da draußen etwas Neues, nicht hier drinnen. Wo ist ihre Angst. Die Neugierde, das Lächeln, alles altbekannt. Neu ist, dass ich es ihr nicht glauben will. Ich fahre zu weit links auf den Mittelstreifen, sehe den weißen Strichen zu, wie sie unter der Motorhaube verschwinden, ein dumpfer Rhythmus.
»Das ist alles so aufregend«, sagt sie und lächelt in meine Richtung. Ich fahre wieder etwas nach rechts, hebe den Kopf und lächle zurück.
»Ich bin so froh, dass ich wieder nach Hause kann«, sagt sie. Warum so fröhlich, denke ich, müssen wir jetzt fröhlich sein.
Ich halte vor der Haustür, steige aus, auch Susan drückt ihre Tür auf. Wie ein Kavalier alter Schule laufe ich um das Auto herum und bin ihr behilflich. Ich ziehe sie hoch aus ihrem Sitz, lege mir ihren linken Arm um den Hals und in einem noch nicht eingespielten Rhythmus laufe ich langsam und hüpft sie eilig auf das Haus zu. Wir stocken, stolpern aber nicht. Ihre langen braunen Locken wippen hin und her, es sind nur ein paar Meter, aber sie sind anstrengend, für uns beide. Sie lacht, als sei es lustig, wie wir humpeln. Dann nimmt sie ihren Arm von meiner Schulter, stützt sich an der Wand ab. Ich schließe auf. Als ich ihren Arm wieder um mich legen will, grinst sie und nickt in Richtung Wagen: »Na los, geh parken, ich pack das schon.« Sie greift nach dem Türknauf und mit der anderen Hand nach dem Türrahmen. Übermütig wie eine Turnerin auf dem Barren schwingt sie sich einbeinig in unsere Wohnung. Sie will mir zeigen, was alles möglich ist, wie viel Zuversicht sie hat.
So zusammengeklappt sieht ein Rollstuhl aus wie ein Fitnessgerät, denke ich und lege ihn auf dem Gehweg ab, die Krücken dazu. Ich schließe den Kofferraum, stehe noch einen Moment. Ich lasse die Geräte einfach liegen, nicht bewacht, und fahre den Wagen in den Hof, wo die Nachbarkinder ihren Fußball gegen die roten Backsteinwände hämmern. Wer sollte Krücken und Rollstuhl klauen.
Wir liegen im Wohnzimmer auf dem Sofa. Der Fernseher läuft. Draußen Regen. Ich hatte mit Depressionen gerechnet. Nur dass jetzt ich es bin, der melancholisch ist. Sie passt sich klaglos in unser neues fremdes Leben. Ihre Energie ist unbegreiflich, sie witzelt über ihre Behinderung, als habe der Friseur ihr einen schlechten Schnitt verpasst, so uneitel. Seltsam, dass ich, der Unversehrte, nicht klarkomme und sie mich aufmuntern soll.
Wenn die Stange sich durch Knie und Bein gestoßen hat, wie der Arzt es mir erklärt hat, müsste der Fuß, der jetzt fehlt, doch verschont geblieben sein. Wo kommen solche Reste hin, frage ich mich.
Susan hängt im Sofa, das Kinn auf der Brust, den Hintern fast auf der Kante, das Bein lang ausgestreckt. Sie gähnt, reckt sich, dann hebt sie die Beine in die Luft. Sie hält sie oben, über ihrem Kopf für einen Moment, es sieht aus wie eine gymnas-tische Übung, und sie sieht ihre Beine an, oder was davon geblieben ist. Ihr Kopf wird rot, sie presst hervor: »Seltsam, ich vermisse gar nichts.«
Ich schon, möchte ich antworten und achte darauf, dass meine Lippen meine Gedanken nicht nachformen. Susan lässt langsam und bedächtig ihre anderthalb Beine sinken, dann schnauft sie übertrieben. Sie macht das jetzt so. Ob sie am Tisch die Butter nimmt oder Schmerzen hat: Versucht immer, etwas Komisches zu finden, einen Witz zu machen. Ich stehe auf und gehe in die Küche. Ich schon, warum ich das nicht einfach sagen kann: Ich glaube dir nicht, wie kann man sein Bein verlieren und behaupten, es würde einem nicht fehlen, man würde es nicht vermissen. Es ist nicht da und es stört so offensichtlich, dass es nicht da ist, warum tut sie so.
»Willst du Wasser?«, rufe ich. »Hab noch«, sagt sie, »aber kannst mal umschalten, ich hab keinen Bock zum Fernseher zu humpeln«, und lacht kratzend.
Ich gehe nicht mehr joggen morgens. Es war Rücksicht in den ersten Tagen. Jetzt ist es Provokation. Es gibt zu reden, aber wir reden nicht. Wir tun wie immer, warum tun wir wie immer, es ist nicht wie immer. Ich möchte, dass sie fragt: Warum joggst du nicht mehr? Ich möchte antworten: Weil ich dich nicht verletzen möchte, und dann will ich wissen, was sie antworten wird.
Der Rollstuhl lehnt zusammengeklappt an der Garderobe, die Krücken zwischen den Regenschirmen, wie ein Strauß
unterschiedlicher Blumen in einer Vase. Ich habe schon Bilder gesehen von der Prothese, die sie gerade anfertigen. Eine Art übergroßer Fingerhut, in den man den Stumpf steckt, darunter ein sichelartiger Fuß, aus Kohlefaser, stoßgedämpft, eine Sportprothese. Natürlich hat sie eine Sportprothese gewählt. Als Zeichen, als Jetzt-erst-recht. Susan und ihre kleinen Manifeste.
Ich sitze im Bett, den Rücken gegen die Wand gelehnt, sie liegt zwischen meinen Beinen, spielt mit ihren warmen Lippen an meinem schlaffen Schwanz. Mein Kopf fällt in den Nacken, automatisch. Ich stöhne, um ihr zu zeigen, dass es mir gefällt, wobei mir eigentlich mulmig zumute ist.
Ich habe gelesen von sogenannten Negativ-Fetischisten, die Verkrüppelung und Amputation sexuell erregen. Wie geht das. Ich habe nur Angst, ihr wehzutun. Ich muss an das verbundene Ende ihres Beins denken, dass ich daran stoßen könnte. Wie wird es sich anfühlen, wenn sie ihre Beine öffnet und links ein Stummel in der Luft zappelt. Würde sie umkippen, wenn sie auf allen vieren vor mir kniet? Über solche Fragen könnte Susan ihr kratziges Lachen lachen. Ich wüsste nicht, wie ich mit ihr lachen sollte und behalte sie für mich.
Ich konzentriere mich auf Susans Mund, ihre Hände an meinen Eiern. Ich möchte hart werden, für sie. Es geht nicht. Was für eine Demütigung, jetzt bei ihr zu versagen, bei der Versehrten, der Behinderten. Ihre Bewegungen sind dieselben wie vorher, ihr Geruch, ihre Stimme, alles fühlt sich an wie immer.
Ich konzentriere mich, mit geschlossenen Augen angestrengt auf der Suche nach Bildern, nach Situationen und Momenten. Aber wenn ich an Susan denke, sehe ich sie mit beiden Beinen, ich ficke sie im Liegen und halte ihre beiden Schenkel in den Händen oder von hinten im Stehen, das rechte Bein gerade, das linke angewinkelt auf dem Tisch.
Es geht nicht.
»Was denn los?«, fragt sie.
Ich lächle. »Nichts, nur müde, muss schlafen, tut mir leid.«
Tut mir leid. Ich drehe mich um, die Worte stehen im Raum. Ich kneife die Augen zusammen. Ich will, dass der Moment vorübergeht. Ihre Hand gleitet zwischen meine Beine. Sie brummt. Das macht alles nur schlimmer. Warum muss sie es sein, von der es ausgeht. Ich sollte es sein. Ich sollte sie ermutigen, ihr zeigen, dass ich zu ihr stehe, dass es weitergeht.
Ich habe Angst, dass das, was ich fühle, Ekel ist.
Sie atmet heiß, sie schnurrt und quiekt und zeigt mir, wie feucht sie ist, sie leckt an mir, sie säuselt, stöhnt und setzt sich auf mich und alles, was ich denken kann, ist, was fehlt, was nicht da ist, was nicht geht.
Du hast eine behinderte Freundin, denke ich und spiele mit einer Büroklammer. Vom Schreibtisch im Büro aus kann ich die Fenster des Fitness-Studios gegenüber sehen. Schon am Morgen trainieren die winzigen Menschen und wuseln wie aufgeregte Ameisen. Hinter mir Bürolärm, Gespräche aus der Ferne. Natürlich habe ich keinen Urlaub genommen, ich bin nicht in ein Loch gefallen, überhaupt nicht. Im Gegenteil: hier bin ich noch sicher, hier gibt es klare Aufgaben, klare Themen, wir reden über die aktuellen Aufträge und Ausschreibungen. Natürlich, Kollegen haben sich erkundigt, die Lippen aufeinandergepresst, mir aufmunternd zugenickt. Bald hat jeder einmal genickt, dann sitze ich wieder an meinen Entwürfen. In der Mittagspause werde ich ausgespart von Sprüchen und Witzen, man bemüht sich um Normalität und meidet mich. In der Kaffeeküche wird es ruhig, wenn ich komme, und in den Blicken, die mich treffen, erkenne ich das, was sie für Verständnis halten.
Wer will eine behinderte Freundin. Ich hätte gerne einen Freund, den ich fragen könnte, ob er falsch findet, was ich denke: Nein, man will keine behinderte Freundin. Wie kann man das wollen. Ich möchte jemandem davon erzählen, der nicht sofort weiß, was zu tun ist. Darf man an Trennung denken. Warum macht mich ein fehlendes Stück Bein am Ende meiner Freundin fast verrückt. Und warum gelingt ihr das Leben so leicht, als wäre nur ein Artikel aus dem Supermarktsortiment verschwunden und durch einen neuen ersetzt worden.
Einmal bin ich mitten in der Nacht aufgewacht, weil sie im Schlaf gewimmert und geweint hat. Ich habe sie nicht geweckt, nicht gestreichelt oder geküsst, habe ihr nur zugesehen. Es war gut, sie wieder weinen zu sehen, sie endlich weinen zu sehen. Ich hatte fast vergessen, wie Susan aussieht, wenn sie weint.
Die Prothese heißt Sportfuß. Ich rühre sie nicht an.
Es gefiel mir besser, als Susan sich auf dem Schreibtischstuhl durch die Wohnung bewegte. Wie sie sich mit ihrem einen Fuß von der Wand abstieß und über unser frisch verlegtes Parkett sauste. Ich mochte die Rillen im Boden und die Abdrücke an der Wand lieber als die feinen Kratzer, die die Sichel jetzt überall hinterlässt. Wie sie mit dem Stuhl über die Türschwellen rumpelte, klang nicht so streng wie das harte Taktak von Kohlefaser und Plastikholz.
Ihr singendes Gurgeln aus dem Bad am Morgen, dass sie nicht aufhören kann zu lachen und zu plappern nach dem ersten Kaffee, die vielen ausgeschnittenen Artikel, die sie in der ganzen Wohnung verteilt wie eh und je, ihr lautes Lachen am Telefon, die Krümel im Bett, das Licht im Bad, das sie immer anlässt, ihr tänzelnd melodisches Zungeschnalzen, wenn sie wartet oder aufgeregt ist, ihr Magengrummeln bei Hunger, das so laut ist wie bei keinem anderen Menschen, den ich kenne. Das ist alles da, wieder und immer noch. Wie sie sich schminkt, wenn sie sich schminkt, als wäre Karneval. So habe ich mich verliebt, in ihr stolzes, amüsiertes Clownsgesicht, in diese Art, immer ein bisschen zu übertreiben, alles mit einem Lächeln sehen zu können. Und jetzt.
Es ist nichts kaputt. Ich kann wichsen. Ich kann mich zwingen, dabei an Susan zu denken. Ich kann sogar, wenn die Erregung groß genug ist, Bilder und Szenen einbauen, in denen Susan den Stumpf statt des Beins hat. Vielleicht ist alles nur eine Frage der Zeit, der Gewöhnung.
Ich möchte das Foto von ihr, das im Bad hängt, abnehmen. Ein Foto, bei dem alles stimmt, das Licht, die Farben, der Ausschnitt, vor allem sie und ihr Körper. Sie drückt mit dem Hintern die Tür zum Balkon auf, zwei Bier in den Händen, im Gesicht ein dreckiges Lachen mit offenem Mund. Sie ist gelb umrandet von der frühen Sonne. Balkonsaufen am Sonntagmorgen, Leute gucken, Kissen unterm Ellbogen. Eine Bluse, Wollsocken, Boxershorts und ihre glatten, weichen Buttermilchbeine mit den Sommersprossen. Ich will, aber ich traue mich nicht, das Foto abzunehmen und wenn ich im Bad bin, versuche ich stattdessen in der Raufasertapete Gesichter oder Muster zu finden.
Ihr Körper ist nicht mehr der Körper, den ich noch im Balkonsommer unbedingt haben wollte. Ich will den neuen nicht. Ich will kein Mensch sein, der vor einer Behinderung flieht. Ich mag so einen Menschen nicht. Ich bin so ein Mensch. Ich wünschte, ich könnte den Gedanken irgendwo ablegen und vergessen. Es geht nicht. Ich schreibe ihn als Satz auf einen Zettel und verbrenne den Zettel. Kaum zu glauben, wie ich mir entgleite.
Susan sitzt in der Mitte des Zimmers, das einmal unser Wohnzimmer war. Ich stehe und atme laut in meinen Joggingsachen, bin verschwitzt und sehe ihr zu. Sie hat den Verband abgenommen und cremt ihren Stumpf ein, in rhythmischen Kreisbewegungen reibt sie eine Salbe auf die jüngste Stelle Haut ihres Körpers. Selbstverständlich, gedankenverloren, logisch. Will ich in diesem Zimmer stehen, frage ich mich, will ich, dass das hier mein Leben ist.
Sie sieht mich an, lächelt: »Wie gehts dir?«
»Geht so«, sage ich.
Ich frage mich, ob sie sich nicht weniger vorkommt. Und als ich ihr diese Frage stelle, nach Wochen, da sieht sie mich lange und ernst an, verzieht langsam den Mund zu einem Lächeln und fasst sich an die Stelle, an der ein Knie sein sollte und sagt: »Stimmt. Ein bisschen ja. Ich hab neun Pfund abgenommen.« Zeit der Witze. Ich nicke. Ich sage ihr nicht, dass sie nachts weint. Tagsüber, offenbar, geht es ihr blendend.
Ihr Blick ist etwas krumm. Sie sieht auf den Marktplatz und trinkt. Ist schon ihr viertes oder fünftes Bier. Ihr Kohlefaserknie wippt zu einem Takt, der in Fetzen von der Wurstbude vor der Kirche zu uns rüberweht. Susan ist hineingewachsen in ihren fremden Körper. Früher habe ich diesen Körper vermisst, wenn ich ihn ein paar Tage nicht fühlen konnte. Jetzt ist mir jeder Abstand recht. Haut an Haut werden unsere Körper warm wie früher, aber von dieser Wärme ist nur die Temperatur geblieben. Ich stelle mir vor: Spaziergänge im Sommer mit kurzen Hosen und Prothese, ihr Sichelfuß im Gras, das Zappeln und Planschen ihres Stumpfs im Wasser. Ich kann keine leichten, keine lässigen Gedanken mehr denken.
Da steht sie plötzlich auf, rührt mir mit ihrem Blick die Gedanken um und küsst mich lange. Dann schnelles Taktak
Schubert wäre gern geheimnisvoll
»Heute Mittag, so gegen zwei«, sagt Schubert, »ist es mir wieder eingefallen. Die ganze Geschichte. Als ich in der Mittagspause die Pommes bezahlt hab. Ich leg der dicken Blonden an der Kasse so die paar Münzen in die Hand und auf einmal, wie aus dem Nichts, sehe ich das alles haarklein vor mir – so, als wärs schon immer da gewesen!« Dabei sei es über neun Jahre nicht da gewesen. Schubert hatte nämlich vergessen, was mit ihm passiert war an diesem Tag vor neun Jahren. Ein kleines Mädchen, ganz schüchtern und mit Schlitzaugen, hatte ihn auf dem Schulweg im Morgengrauen gefunden, wie er über einem Zaun hing. Wenn er nicht überlaut geschnarcht hätte, hätte es ihn wohl für tot gehalten, wie er dort schlaff hing, die Hände in der Lache seines käsigen Erbrochenen. Er war über einen Tag lang verschwunden gewesen und konnte sich an nichts erinnern.
Schubert konnte immer ganz genau die Stelle sagen, an der die Erinnerung abbrach, das wusste er alles ganz exakt, kein Wunder, er hat jahrelang daran herumerinnert. Nur die Stunden danach, davon hatte er angeblich keinen Schimmer. Bis heute Mittag, so gegen zwei.
»Häh«, sagt Schubert und sieht mich an, »häh, wie kann das sein?« Und er guckt, als wüsste ich die Antwort. Dabei weiß ich gar nichts, außer dass Schubert angeblich wieder Bescheid weiß. »Ich kapier das nicht«, sagt Schubert und reibt sich die Augen. »Wo war das die ganze Zeit und wieso ist es ausgerechnet jetzt zurück?« So kennt man Schubert nicht, so aus dem Häuschen, Schubert, den alten Sortierer, den Saubermann. Plötzlich aufgeregt und wirr. Er stammelt, das habe ich noch nie erlebt. Nur Hähs und halbe Sätze, abgebrochen und vernuschelt. Wo ist der Schubert, den ich kenne und nicht leiden kann? Dieser Schubert, der Streichfett sagt und Butter meint, der alles sammelt, Kerzen, Kreuzworträtsel, Pappkartons, und nichts gebrauchen kann. Er lebt allein und ernährt sich von Fischstäbchen, Nudeln und Ketchup, so einer ist das. Schuhe mit Klettverschluss, Hosen mit Gummizug, Funktionswäsche, Hauptsache praktisch. Dazu sein ewiges Schulterzucken. Ich mag Schubert ungefähr so gern wie Nieselregen. Wir sind Kollegen seit vierzehn Jahren, da gewöhnt man sich, trotzdem ist es mir lieber, wenn die Sonne scheint.
Schubert gehört zu diesem Job, aber er hat mich nie interessiert. Und heute benimmt sich dieser Kauz plötzlich wie ein Mensch. Da spüre ich Sympathie für Schubert, das ist mir ganz neu.
Mülltonne von oben, ich weiß nicht, wie oft er mir das erzählt hat, Mülltonne von oben ist das Letzte, an das Schubert sich erinnern kann. Das ist jetzt nicht die Überraschung schlechthin, Schubert ist Müllmann wie ich, er hat jeden Tag Mülltonnen in der Hand, »183,4 im Schnitt«, er hats gezählt und ausgerechnet. Er fasst sie an, er schiebt sie rum, er leert sie aus, er rollt sie zurück. Genauso auch an diesem Tag im April, Schubert weiß sogar noch die Straße, die Hausnummer, »Theodor-straße 3«, er weiß noch, wie das Wetter war, »leichter Nieselregen, grauer Himmel, gefühlte neun Grad.« Schubert war, das hat er hundert Mal erklärt, in keiner besonderen Stimmung, »leichter Durchfall in der Nacht«, er hätte ein paar Mal rausgemusst und nicht besonders geschlafen, er sei grummelig gewesen. »Aber davon«, sagt Schubert dann immer, »verliert man doch nicht das Bewusstsein, das leuchtet mir nicht ein.« Schubert nahm also die schwarze Tonne, die vor der Hofeinfahrt stand, schob sie zum Müllwagen, hängte sie ein, sie ruckelte und spuckte Müllbeutel, Papierschnipsel und einen alten Fahrradschlauch in den stinkenden Mülltanker. Es suppte etwas bräunliche Flüssigkeit hinterher, darüber ärgerte Schubert sich, über die Flüssigkeit und dass die Mülltonne von unten ganz dreckig war. Das interessiert ja keinen normalen Menschen, nicht mal, wenn der normale Mensch Müllmann ist, aber Schubert schüttelte enttäuscht den Kopf und machte ein Kreuz in sein Notizbuch. Schubert betreut die Tonnen, so sagt er das, er ist Dienstleister in der Abfallwirtschaft, nicht einfach Müllmann. Das glaubt er sich selbst und das belastet ihn, diese enorme Verantwortung, die er zu spüren glaubt. Es gibt Tage, da ist Schubert niedergeschlagen, traurig, enttäuscht, verzweifelt. Sooft ich mich über Schubert lustig mache, so wenig ich ihn leiden kann, er kann einem leidtun, wenn er vor mir sitzt und mit seinen ungeschickten Fingern und nassen Augen eine Scheiblette Scheiblettenschmelzkäse aus der Scheiblettenschmelzkäseverpackung popelt und nicht mehr reden kann, nur noch seufzen, weil es ihm zu nahgeht. Was? Die Verkommenheit der Menschen, die Sorglosigkeit, die Verantwortungslosigkeit. Das ist es, was ihm mein Mitleid einbringt: Schubert hat so wenig vom Leben, dass er seinen Weltschmerz von Mülltonnen fremder Menschen ableiten muss.
In den Pausen sitzen wir oft zusammen und reden wenig. Und manchmal, ganz selten, tut er mir wirklich leid und ich möchte Schubert aufmunternd auf die Schulter klopfen. Wie er dasitzt mit seiner ständig piependen Casio-Quarzuhr, als würde es in seinem Leben nur so wimmeln vor wichtigen Terminen. Mit seiner Thermohose, die aus ihm ein asexuelles Wesen macht. Brustbeutel, Taschenmesser, Notizblöcke und Gratis-TV-Zeitschriften – Schubert ist ein Vierjähriger mit Schnurrbart und Bürstenhaarschnitt, der gern Hausmeister wäre. Schubert muss alles im Griff haben, muss alles planen, alles katalogisieren und ordnen. Und ausgerechnet ihm gehen an diesem Tag im April die Lichter aus.
Eben rumpelte diese Tonne, die von unten ganz dreckig war, wieder runter und Schubert rollte sie zurück, wie immer. Und wie er auf den Deckel der Tonne guckt, bricht die Erinnerung ab, mittendrin und ohne Vorwarnung.
»Achtzehn Stunden und ziemlich genau vierunddreißig Minuten, in der die Welt nicht ohne Schubert, aber Schubert ohne die Welt auskommen musste.« So sagt er das, wenn er sich wichtigmachen will, meistens hat er dann ein, zwei Bierchen drin.
»Zaun, wieso Zaun?«, hat Schubert die ganzen Jahre über immer wieder gesagt, als wäre die ganze Geschichte ein kniffliges Rätsel, über das er nur lange genug nachdenken müsste. »Ich träume von einem gelben Anorak und Frauenbeinen, seit Wochen«, hat Schubert in der ersten Zeit gegrübelt. Ich hab dann immer nur die Schultern gezuckt und gesagt:
»Nicht unbedingt beängstigend.«
»Nein, aber das hat doch eine Bedeutung!«
Bedeutung, hätte ich am liebsten gesagt, Bedeutung, Schubert, damit hast du so viel zu schaffen wie eine Kuh mit Seiltanz. Ich habe es aber nie gesagt, sondern mich über seinen Privatdetektivblick amüsiert, seine nachdenkliche Stimmlage, wenn er sagte:
»Nur Zaun, ich meine: Zaun! Das ergibt doch keinen Sinn!«
»Was du nicht weißt, macht dich nicht heiß«, habe ich gesagt, »vielleicht hat dein Hirn einfach mal aussortiert, Frühjahrsputz sozusagen. Vielleicht war dein Gehirn einfach gelangweilt von deinem scheiß immergleichen Tag und hat sich gedacht, so, schwupps, einfach mal die Lichter aus und mal sehen, was dann mit dem Schubert passiert«.
Klappe halten, meinte Schubert, ob ich denn nicht verstehen könne, dass es einem Angst mache, dass es einen misstrauisch gegen sich selbst werden lasse, wenn man plötzlich und ohne Vorwarnung das Bewusstsein verliere und Stunden später, eine ganze Nacht später, im Morgengrauen von einem kleinen Mädchen gefunden werde, wie man im Halbkoma über einem Zaun hänge, dreißig Kilometer entfernt von dort, wo man zuletzt gesehen worden sei. Dann zeigt er mir die Narben, die die spitzen Zaunlatten hinterlassen haben: Schubert hebt das Shirt hoch, zum hundertsten Mal.
»Da muss doch was dahinterstecken, ich bitte dich.« Schubert macht die Lippen spitz, ich vermute, das soll besonders ernst wirken.
»Transiente globale Amnesie«, sagt er und ich bin überzeugt, das ist das Beste, was Schubert in seinem Leben überhaupt nur passieren konnte. Immerhin hat er so seit neun Jahren ein Gesprächsthema, umgibt ihn etwas Geheimnisvolles. Seit neun Jahren war Schubert jemand. Der Typ, von dem keiner wusste, was mit ihm passiert ist, an diesem Tag. Der Typ mit der Lücke.
»Wie ein Film«, sagt Schubert und schüttelt den Kopf, »ich seh das alles plötzlich wie einen Film vor mir.«
»Und wie ist der Film?«, frage ich.
»Ja«, sagt Schubert, »das ist es ja: langweilig.«
»Wie?«, sage ich. »Neun Jahre lang denkst du an dieser Story rum und es kommt nichts dabei raus? Da muss doch was dran sein, so langweilig kann man doch gar nicht sein!«
»Wie meinstn das?«, fragt Schubert, »meinst du etwa, ich denk mir den ganzen Quatsch aus?«
Ich schüttele den Kopf, aber das ist eine Lüge. Eigentlich denke ich das schon. Eigentlich bin ich die ganzen neun Jahre davon ausgegangen, dass Schubert einfach keinen Bock mehr hatte auf Mülltonnen ausleeren und seinen neonorangenen Anzug, auf die ewigselben Straßen, Türen, Tonnen und Tage. Und dann hat er einfach bei irgendeiner Mülltonne gedacht: So, das wars, ich gehe. Und dann ist er gegangen, mitten bei der Arbeit, der Müllwagen bog um die Ecke und Schubert drehte um und verpisste sich. Ich weiß noch, wie ich aus dem Innenhof gegenüber kam und nur noch einen orangefarbenen Wischer am anderen Ende der Straße sah, das war wohl Schubert, wie er um die Ecke bog und sich vom Acker machte. Ich rief nach ihm, aber er kam nicht zurück. Ich bin zum Wagen und hab die letzten Straßen allein gemacht, hab ihn nicht verpfiffen, so einer bin ich nicht. Ich mag Schubert nicht, aber ich scheiße ihn nicht an, wir sind Kollegen. Schubert hätte dasselbe für mich getan, er hätte natürlich ein Riesenfass aufgemacht, mir seine Einträge und Notizen wochenlang unter die Nase gehalten, aber er hätte mich auch nicht verpfiffen. Schubert ist kein schlechter Mensch, nur ein unglaublich langweiliger. Er hat sich dann drei Tage später selbst angezeigt in der Personalabteilung, da hatte er schon ein ärztliches Attest.