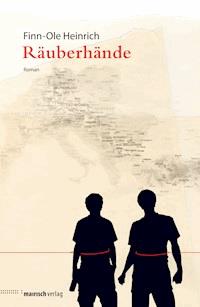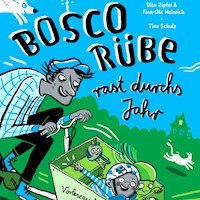Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mairisch Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das mairisch E-Book - ein Best-of aller Kurzgeschichten und Romanauszüge von allen mairisch-Autoren! Von Istanbul bis Berlin, von Südafrika bis in den Harz, von London bis an die Elbe reichen die Geschichten, es geht um Liebe, ums Erwachsenwerden, ums Reisen und ums Kochen. Unter anderem mit den Erzählungen "Zeit der Witze" von Finn-Ole Heinrich, "Nachtschichten" von Stevan Paul, "Avocado" von Michael Weins und "Alleinstehende Herren" von Andreas Stichmann. Außerdem mit dabei: Benjamin Maack, Dorian Steinhoff, Lisa Kreißler, Hannes Köhler, Donata Rigg, Lee Rourke u.a.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Finn-Ole Heinrich - Zeit der Witze
Finn-Ole Heinrich - Räuberhände
Finn-Ole Heinrich - Gummistiefel
Über Finn-Ole Heinrich
Lisa Kreißler - Blitzbirke
Über Lisa Kreißler
Dorian Steinhoff - Ansgar Boos
Über Dorian Steinhoff
Michael Weins - Goldener Reiter
Michael Weins - Goldener Reiter - Nachwort - Das Jahr der Zwiebel
Michael Weins - Lazyboy
Michael Weins - Delfinarium
Michael Weins - Avocado
Über Michael Weins
Benjamin Maack - Viel schlimmer als die dunklen Räume sind die spiegelnden Fenster
Über Benjamin Maack
Stevan Paul - Nachtschichten
Stevan Paul - Der Tanz der Schlachter
Über Stevan Paul
Donata Rigg - Weiße Sonntage
Über Donata Rigg
Hannes Köhler - In Spuren
Über Hannes Köhler
Andreas Stichmann - Alleinstehende Herren
Über Andreas Stichmann
Lee Rourke - Der Kanal
Über Lee Rourke
Radfahren - Vorwort
Radfahren - Steven D. Hales - Auf die Harte Tour - Rad fahren und philosophische Lektionen
Impressum
Finn-Ole Heinrich - Zeit der Witze
»Ist das ein Gefühl«, sagt sie, »das ist wie alles neu, ganz komisch.« Sie meint, wieder draußen zu sein, denke ich, auf eigenen Beinen, sozusagen.
Ein heller Morgen kurz vor Sommer, Zeit für T-Shirts, Tops und Röcke. Die Straße ist leer so früh, ich beobachte Susan, ohne sie anzusehen. Ich fahre zu schnell, zum ersten Mal seit ich sie ins Krankenhaus gebracht habe, vor Wochen, als man dem Frühling noch nicht traute. Mit achtzig Sachen durch die Ortschaft, sportlich in die Kurven. Das geht wieder. In meinem Augenwinkel guckt Susan in alle Richtungen, als gäbe es da draußen etwas Neues, nicht hier drinnen. Wo ist ihre Angst. Die Neugierde, das Lächeln, alles altbekannt. Neu ist, dass ich es ihr nicht glauben will. Ich fahre zu weit links auf den Mittelstreifen, sehe den weißen Strichen zu, wie sie unter der Motorhaube verschwinden, ein dumpfer Rhythmus.
»Das ist alles so aufregend«, sagt sie und lächelt in meine Richtung. Ich fahre wieder etwas nach rechts, hebe den Kopf und lächle zurück.
»Ich bin so froh, dass ich wieder nach Hause kann«, sagt sie. Warum so fröhlich, denke ich, müssen wir jetzt fröhlich sein.
Ich halte vor der Haustür, steige aus, auch Susan drückt ihre Tür auf. Wie ein Kavalier alter Schule laufe ich um das Auto herum und bin ihr behilflich. Ich ziehe sie hoch aus ihrem Sitz, lege mir ihren linken Arm um den Hals und in einem noch nicht eingespielten Rhythmus laufe ich langsam und hüpft sie eilig auf das Haus zu. Wir stocken, stolpern aber nicht. Ihre langen braunen Locken wippen hin und her, es sind nur ein paar Meter, aber sie sind anstrengend, für uns beide. Sie lacht, als sei es lustig, wie wir humpeln. Dann nimmt sie ihren Arm von meiner Schulter, stützt sich an der Wand ab. Ich schließe auf. Als ich ihren Arm wieder um mich legen will, grinst sie und nickt in Richtung Wagen: »Na los, geh parken, ich pack das schon.« Sie greift nach dem Türknauf und mit der anderen Hand nach dem Türrahmen. Übermütig wie eine Turnerin auf dem Barren schwingt sie sich einbeinig in unsere Wohnung. Sie will mir zeigen, was alles möglich ist, wie viel Zuversicht sie hat.
So zusammengeklappt sieht ein Rollstuhl aus wie ein Fitnessgerät, denke ich und lege ihn auf dem Gehweg ab, die Krücken dazu. Ich schließe den Kofferraum, stehe noch einen Moment. Ich lasse die Geräte einfach liegen, nicht bewacht, und fahre den Wagen in den Hof, wo die Nachbarkinder ihren Fußball gegen die roten Backsteinwände hämmern. Wer sollte Krücken und Rollstuhl klauen.
Wir liegen im Wohnzimmer auf dem Sofa. Der Fernseher läuft. Draußen Regen. Ich hatte mit Depressionen gerechnet. Nur dass jetzt ich es bin, der melancholisch ist. Sie passt sich klaglos in unser neues fremdes Leben. Ihre Energie ist unbegreiflich, sie witzelt über ihre Behinderung, als habe der Friseur ihr einen schlechten Schnitt verpasst, so uneitel. Seltsam, dass ich, der Unversehrte, nicht klarkomme und sie mich aufmuntern soll.
Wenn die Stange sich durch Knie und Bein gestoßen hat, wie der Arzt es mir erklärt hat, müsste der Fuß, der jetzt fehlt, doch verschont geblieben sein. Wo kommen solche Reste hin, frage ich mich.
Susan hängt im Sofa, das Kinn auf der Brust, den Hintern fast auf der Kante, das Bein lang ausgestreckt. Sie gähnt, reckt sich, dann hebt sie die Beine in die Luft. Sie hält sie oben, über ihrem Kopf für einen Moment, es sieht aus wie eine gymnas-tische Übung, und sie sieht ihre Beine an, oder was davon geblieben ist. Ihr Kopf wird rot, sie presst hervor: »Seltsam, ich vermisse gar nichts.«
Ich schon, möchte ich antworten und achte darauf, dass meine Lippen meine Gedanken nicht nachformen. Susan lässt langsam und bedächtig ihre anderthalb Beine sinken, dann schnauft sie übertrieben. Sie macht das jetzt so. Ob sie am Tisch die Butter nimmt oder Schmerzen hat: Versucht immer, etwas Komisches zu finden, einen Witz zu machen. Ich stehe auf und gehe in die Küche. Ich schon, warum ich das nicht einfach sagen kann: Ich glaube dir nicht, wie kann man sein Bein verlieren und behaupten, es würde einem nicht fehlen, man würde es nicht vermissen. Es ist nicht da und es stört so offensichtlich, dass es nicht da ist, warum tut sie so.
»Willst du Wasser?«, rufe ich. »Hab noch«, sagt sie, »aber kannst mal umschalten, ich hab keinen Bock zum Fernseher zu humpeln«, und lacht kratzend.
Ich gehe nicht mehr joggen morgens. Es war Rücksicht in den ersten Tagen. Jetzt ist es Provokation. Es gibt zu reden, aber wir reden nicht. Wir tun wie immer, warum tun wir wie immer, es ist nicht wie immer. Ich möchte, dass sie fragt: Warum joggst du nicht mehr? Ich möchte antworten: Weil ich dich nicht verletzen möchte, und dann will ich wissen, was sie antworten wird.
Der Rollstuhl lehnt zusammengeklappt an der Garderobe, die Krücken zwischen den Regenschirmen, wie ein Strauß
unterschiedlicher Blumen in einer Vase. Ich habe schon Bilder gesehen von der Prothese, die sie gerade anfertigen. Eine Art übergroßer Fingerhut, in den man den Stumpf steckt, darunter ein sichelartiger Fuß, aus Kohlefaser, stoßgedämpft, eine Sportprothese. Natürlich hat sie eine Sportprothese gewählt. Als Zeichen, als Jetzt-erst-recht. Susan und ihre kleinen Manifeste.
Ich sitze im Bett, den Rücken gegen die Wand gelehnt, sie liegt zwischen meinen Beinen, spielt mit ihren warmen Lippen an meinem schlaffen Schwanz. Mein Kopf fällt in den Nacken, automatisch. Ich stöhne, um ihr zu zeigen, dass es mir gefällt, wobei mir eigentlich mulmig zumute ist.
Ich habe gelesen von sogenannten Negativ-Fetischisten, die Verkrüppelung und Amputation sexuell erregen. Wie geht das. Ich habe nur Angst, ihr wehzutun. Ich muss an das verbundene Ende ihres Beins denken, dass ich daran stoßen könnte. Wie wird es sich anfühlen, wenn sie ihre Beine öffnet und links ein Stummel in der Luft zappelt. Würde sie umkippen, wenn sie auf allen vieren vor mir kniet? Über solche Fragen könnte Susan ihr kratziges Lachen lachen. Ich wüsste nicht, wie ich mit ihr lachen sollte und behalte sie für mich.
Ich konzentriere mich auf Susans Mund, ihre Hände an meinen Eiern. Ich möchte hart werden, für sie. Es geht nicht. Was für eine Demütigung, jetzt bei ihr zu versagen, bei der Versehrten, der Behinderten. Ihre Bewegungen sind dieselben wie vorher, ihr Geruch, ihre Stimme, alles fühlt sich an wie immer.
Ich konzentriere mich, mit geschlossenen Augen angestrengt auf der Suche nach Bildern, nach Situationen und Momenten. Aber wenn ich an Susan denke, sehe ich sie mit beiden Beinen, ich ficke sie im Liegen und halte ihre beiden Schenkel in den Händen oder von hinten im Stehen, das rechte Bein gerade, das linke angewinkelt auf dem Tisch.
Es geht nicht.
»Was denn los?«, fragt sie.
Ich lächle. »Nichts, nur müde, muss schlafen, tut mir leid.«
Tut mir leid. Ich drehe mich um, die Worte stehen im Raum. Ich kneife die Augen zusammen. Ich will, dass der Moment vorübergeht. Ihre Hand gleitet zwischen meine Beine. Sie brummt. Das macht alles nur schlimmer. Warum muss sie es sein, von der es ausgeht. Ich sollte es sein. Ich sollte sie ermutigen, ihr zeigen, dass ich zu ihr stehe, dass es weitergeht.
Ich habe Angst, dass das, was ich fühle, Ekel ist.
Sie atmet heiß, sie schnurrt und quiekt und zeigt mir, wie feucht sie ist, sie leckt an mir, sie säuselt, stöhnt und setzt sich auf mich und alles, was ich denken kann, ist, was fehlt, was nicht da ist, was nicht geht.
Du hast eine behinderte Freundin, denke ich und spiele mit einer Büroklammer. Vom Schreibtisch im Büro aus kann ich die Fenster des Fitness-Studios gegenüber sehen. Schon am Morgen trainieren die winzigen Menschen und wuseln wie aufgeregte Ameisen. Hinter mir Bürolärm, Gespräche aus der Ferne. Natürlich habe ich keinen Urlaub genommen, ich bin nicht in ein Loch gefallen, überhaupt nicht. Im Gegenteil: hier bin ich noch sicher, hier gibt es klare Aufgaben, klare Themen, wir reden über die aktuellen Aufträge und Ausschreibungen. Natürlich, Kollegen haben sich erkundigt, die Lippen aufeinandergepresst, mir aufmunternd zugenickt. Bald hat jeder einmal genickt, dann sitze ich wieder an meinen Entwürfen. In der Mittagspause werde ich ausgespart von Sprüchen und Witzen, man bemüht sich um Normalität und meidet mich. In der Kaffeeküche wird es ruhig, wenn ich komme, und in den Blicken, die mich treffen, erkenne ich das, was sie für Verständnis halten.
Wer will eine behinderte Freundin. Ich hätte gerne einen Freund, den ich fragen könnte, ob er falsch findet, was ich denke: Nein, man will keine behinderte Freundin. Wie kann man das wollen. Ich möchte jemandem davon erzählen, der nicht sofort weiß, was zu tun ist. Darf man an Trennung denken. Warum macht mich ein fehlendes Stück Bein am Ende meiner Freundin fast verrückt. Und warum gelingt ihr das Leben so leicht, als wäre nur ein Artikel aus dem Supermarktsortiment verschwunden und durch einen neuen ersetzt worden.
Einmal bin ich mitten in der Nacht aufgewacht, weil sie im Schlaf gewimmert und geweint hat. Ich habe sie nicht geweckt, nicht gestreichelt oder geküsst, habe ihr nur zugesehen. Es war gut, sie wieder weinen zu sehen, sie endlich weinen zu sehen. Ich hatte fast vergessen, wie Susan aussieht, wenn sie weint.
Die Prothese heißt Sportfuß. Ich rühre sie nicht an.
Es gefiel mir besser, als Susan sich auf dem Schreibtischstuhl durch die Wohnung bewegte. Wie sie sich mit ihrem einen Fuß von der Wand abstieß und über unser frisch verlegtes Parkett sauste. Ich mochte die Rillen im Boden und die Abdrücke an der Wand lieber als die feinen Kratzer, die die Sichel jetzt überall hinterlässt. Wie sie mit dem Stuhl über die Türschwellen rumpelte, klang nicht so streng wie das harte Taktak von Kohlefaser und Plastikholz.
Ihr singendes Gurgeln aus dem Bad am Morgen, dass sie nicht aufhören kann zu lachen und zu plappern nach dem ersten Kaffee, die vielen ausgeschnittenen Artikel, die sie in der ganzen Wohnung verteilt wie eh und je, ihr lautes Lachen am Telefon, die Krümel im Bett, das Licht im Bad, das sie immer anlässt, ihr tänzelnd melodisches Zungeschnalzen, wenn sie wartet oder aufgeregt ist, ihr Magengrummeln bei Hunger, das so laut ist wie bei keinem anderen Menschen, den ich kenne. Das ist alles da, wieder und immer noch. Wie sie sich schminkt, wenn sie sich schminkt, als wäre Karneval. So habe ich mich verliebt, in ihr stolzes, amüsiertes Clownsgesicht, in diese Art, immer ein bisschen zu übertreiben, alles mit einem Lächeln sehen zu können. Und jetzt.
Es ist nichts kaputt. Ich kann wichsen. Ich kann mich zwingen, dabei an Susan zu denken. Ich kann sogar, wenn die Erregung groß genug ist, Bilder und Szenen einbauen, in denen Susan den Stumpf statt des Beins hat. Vielleicht ist alles nur eine Frage der Zeit, der Gewöhnung.
Ich möchte das Foto von ihr, das im Bad hängt, abnehmen. Ein Foto, bei dem alles stimmt, das Licht, die Farben, der Ausschnitt, vor allem sie und ihr Körper. Sie drückt mit dem Hintern die Tür zum Balkon auf, zwei Bier in den Händen, im Gesicht ein dreckiges Lachen mit offenem Mund. Sie ist gelb umrandet von der frühen Sonne. Balkonsaufen am Sonntagmorgen, Leute gucken, Kissen unterm Ellbogen. Eine Bluse, Wollsocken, Boxershorts und ihre glatten, weichen Buttermilchbeine mit den Sommersprossen. Ich will, aber ich traue mich nicht, das Foto abzunehmen und wenn ich im Bad bin, versuche ich stattdessen in der Raufasertapete Gesichter oder Muster zu finden.
Ihr Körper ist nicht mehr der Körper, den ich noch im Balkonsommer unbedingt haben wollte. Ich will den neuen nicht. Ich will kein Mensch sein, der vor einer Behinderung flieht. Ich mag so einen Menschen nicht. Ich bin so ein Mensch. Ich wünschte, ich könnte den Gedanken irgendwo ablegen und vergessen. Es geht nicht. Ich schreibe ihn als Satz auf einen Zettel und verbrenne den Zettel. Kaum zu glauben, wie ich mir entgleite.
Susan sitzt in der Mitte des Zimmers, das einmal unser Wohnzimmer war. Ich stehe und atme laut in meinen Joggingsachen, bin verschwitzt und sehe ihr zu. Sie hat den Verband abgenommen und cremt ihren Stumpf ein, in rhythmischen Kreisbewegungen reibt sie eine Salbe auf die jüngste Stelle Haut ihres Körpers. Selbstverständlich, gedankenverloren, logisch. Will ich in diesem Zimmer stehen, frage ich mich, will ich, dass das hier mein Leben ist.
Sie sieht mich an, lächelt: »Wie gehts dir?«
»Geht so«, sage ich.
Ich frage mich, ob sie sich nicht weniger vorkommt. Und als ich ihr diese Frage stelle, nach Wochen, da sieht sie mich lange und ernst an, verzieht langsam den Mund zu einem Lächeln und fasst sich an die Stelle, an der ein Knie sein sollte und sagt: »Stimmt. Ein bisschen ja. Ich hab neun Pfund abgenommen.« Zeit der Witze. Ich nicke. Ich sage ihr nicht, dass sie nachts weint. Tagsüber, offenbar, geht es ihr blendend.
Ihr Blick ist etwas krumm. Sie sieht auf den Marktplatz und trinkt. Ist schon ihr viertes oder fünftes Bier. Ihr Kohlefaserknie wippt zu einem Takt, der in Fetzen von der Wurstbude vor der Kirche zu uns rüberweht. Susan ist hineingewachsen in ihren fremden Körper. Früher habe ich diesen Körper vermisst, wenn ich ihn ein paar Tage nicht fühlen konnte. Jetzt ist mir jeder Abstand recht. Haut an Haut werden unsere Körper warm wie früher, aber von dieser Wärme ist nur die Temperatur geblieben. Ich stelle mir vor: Spaziergänge im Sommer mit kurzen Hosen und Prothese, ihr Sichelfuß im Gras, das Zappeln und Planschen ihres Stumpfs im Wasser. Ich kann keine leichten, keine lässigen Gedanken mehr denken.
Da steht sie plötzlich auf, rührt mir mit ihrem Blick die Gedanken um und küsst mich lange. Dann schnelles Taktak, Schuh und Kohlefaser über das Kopfsteinpflaster des Marktes. Sie rennt auf den Baum in der Mitte des Platzes zu. Keinen, seit ich hier wohne, habe ich je daran klettern sehen. Aber jetzt Susan, die Behinderte. Ihr krächziges Lachen, die Sichel an der Rinde, die Hände am Ast, steigt sie hinauf. Hängt sich kopfüber wie ein Kind im Klettergerüst in den Baum. Die Leute gucken. Ich trinke Bier und gehöre nicht dazu.
Aus:
Finn-Ole Heinrich - »Gestern war auch schon ein Tag«
Erzählungen
mairisch Verlag, 2009
Hardcover, 160 Seiten, ISBN 978-3-938539-14-9 (Print)
E-Book, ISBN 978-3-938539-92-7 (E-Book)
Zum Inhalt:
Susan fehlt ein Bein. Tom ist die Treppe runtergefallen. Und Henning lügt so lange, bis er die Wahrheit sagt. Finn-Ole Heinrich erzählt von Menschen, die ins Schwanken gekommen sind, die das Leben mit aller Härte umgeworfen hat. Und die nun wieder aufstehen müssen.
Finn-Ole Heinrich zählt zu den großen Talenten der deutschen Gegenwartsliteratur. Bereits seine ersten beiden Bücher, »die taschen voll wasser« (Erzählungen, 2005) und »Räuberhände« (Roman, 2007), wurden von Lesern und Presse gefeiert.
Finn-Ole Heinrich - Räuberhände
[Alle seine Sachen und alles, was von ihren noch zu gebrauchen war, ist in Kisten verstaut und in unserer Garage untergebracht. Meine Eltern haben mir geholfen. Neun Kisten, vierzehn Müllbeutel. Es hat knapp drei Stunden gedauert.]
Meine Eltern lieben Samuel. Und er liebt sie. Wenn Samuel mich nervt, nenne ich ihn manchmal »Adoptivkind«, das ist sozusagen sein wunder Punkt. Seit Samuel und ich in einer Klasse sind, sind wir befreundet. Fast sieben Jahre jetzt. Und seitdem schläft Samuel fast jede Nacht bei uns. Er hat schon lange ein eigenes Bett in meinem Zimmer. Meine Eltern haben es ihm geschenkt. Natürlich haben sie mich vorher gefragt, ob das in Ordnung für mich ist, sie würden so etwas niemals über meinen Kopf hinweg entscheiden. Aber es ist nicht so, dass ich etwas dagegen hätte. Ich bin nicht eifersüchtig, Samuel ist mein bester Freund und wenn meine Eltern nicht mich gefragt hätten, hätte ich sie wahrscheinlich gefragt.
Sie lieben Samuel, und sie haben ihn aufgenommen. Er ist ein Teil unserer Familie. Sie lieben ihn zum Beispiel dafür, dass er nach dem Essen mit den Händen die Krumen vom Tisch fegt, »das macht sonst keiner«, sagen sie, wenn sie Freunden von Samuel erzählen, und sie mögen auch, wie Samuel seine Schuhe, diese scheißteuren Sneakers, die sie ihm geschenkt haben, vor der Tür abklopft und ganz gerade und exakt in den aufgeräumten, aber nicht zu aufgeräumten Flur meiner ordentlichen, aber nicht zu ordentlichen Eltern stellt. Das mögen sie. Wie er mit den Dingen umgeht. Wofür man Menschen lieben kann. »Und das bei seiner Sozialisation«, sagen sie, »das soll jetzt nichts heißen und überhaupt nicht abfällig klingen, aber zu erwarten und selbstverständlich sei das beileibe nicht.« Was sie nicht sagen wollen, ist, dass Samuels Mutter Irene asozial ist. Sie ist eine Pennerin. Nicht so richtig, weil sie nicht wirklich auf der Straße lebt, sondern dank Samuel noch eine Wohnung hat. Aber sie ist arbeitslos und hängt den Tag über betrunken mit den richtigen Pennern rum. Meistens unter dem Baum vor dem Supermarkt. Da sitzen sie und trinken Tetra-Pak-Wein und leben ihr asoziales Leben. Irene sieht kaputt aus, ausgezehrt. Ihre Wohnung liegt in der Wohnsiedlung am Stadtrand. Es ist müllig bei ihnen, ein wenig kann man den Pennergeruch riechen. Fast so, wie wenn sich ein Penner in der U-Bahn neben einen setzt. Aber Samuel stellt seine Schuhe ganz ordentlich und bedacht in den Flur meiner Eltern. Wer hätte das gedacht.
Samuel ist überhaupt nicht eklig oder runtergekommen, er weiß, wie oft er duschen muss, er putzt sich dreimal am Tag seine Zähne und hat beim Essen beide Hände auf dem Tisch. Er ist mir eigentlich zu ordentlich, zu bedacht. Er kann an keinem Spiegel vorbeigehen, ohne den Sitz seiner Kleidung zu kontrollieren. Er macht jeden Morgen sein Bett. Er bügelt seine Hosen. Es gibt Dinge an Samuel, die verstehe ich nicht. Aber auf jeden Fall hat er nichts Asoziales an sich.
Vor ein paar Wochen noch: Samuel und ich in Stambul. So nennen wir die Laube in unserem Schrebergarten seit ein paar Jahren. Ich habe es irgendwann mal mit alter Farbe auf einen Fetzen Stoff gepinselt und über der Tür angebracht: Stambul. Das Tuch hing dort ein paar Monate, färbte sich im Herbst moosig grün, saugte sich voll Wasser, lag irgendwann im Dreck und landete im Müll. Aber unsere Hütte, unser Garten heißt immer noch Stambul. Wir sind dauernd hier.
Stambul, weil Samuel sich für einen Türken hält, seit er von seiner Mutter gehört hat, sein Vater sei angeblich Türke. Seitdem ist Samuel mindestens ein halber Türke, von einem Tag auf den anderen. Mich wundert, dass er es nicht selbst etwas albern findet. Samuel zelebriert diese Türkennummer ganz schön, ich kann darüber lachen.
Wir sitzen auf der rostigen Hollywoodschaukel vor Stambul und glotzen auf die Beete vor uns, die bald bepflanzt werden müssen. Samuel wischt sich einen Schwung brauner Locken aus dem Gesicht hinter die Ohren, grinst und hält mir eine Zigarette unter die Nase. So lernen wir für das Abitur. Sind nur noch einige Wochen. Ein paar Hunde kläffen, Rentner hacken Unkraut, irgendwo weiter hinten mäht einer seine mickrige Rasenfläche, hier und da klackern Deutschlandfähnchen gegen ihre Masten. Etwa alle zwanzig Minuten donnert ein Zug über die Bahntrasse, die dem Kleingartenverein nach Westen hin eine Grenze gibt.
Samuel sagt, er wolle dieses Jahr endlich Feigen ernten in Stambul. Ich lache ihn aus. Das versucht er seit drei Jahren. Die kleinen, teuren Bäumchen sind allesamt verkümmert und erfroren.
»Siktir lan«, sagt Samuel, »ich hab gelesen, dass es neue Züchtungen gibt, die können minus zwanzig Grad ab.«
»Gut!«, sage ich und zünde die Zigarette an. Er guckt böse, es ist sein aufgesetzter böser Blick. Was er aber ernst meint: er ist empfindlich bei dem Thema, bei dem großen Thema »Heimat und Identität«, da darf man keine Witze machen, das mag Samuel gar nicht.
Er bastelt seit Jahren an der kleinen Laube, inzwischen sieht sie wie eine deutsch-türkische Begegnungsstätte aus, eine Mischung aus islamischem Kulturverein und Wurstbude. Wir sitzen also hier, wie jeden Tag nach der Schule, und rauchen. Samuel kramt in seinem Rucksack, er wirft seinen Türkischlernkurs für sieben Euro neunundneunzig zwischen uns. Er legt sich zurück, die Arme hinter den Kopf und stößt langsam Ringe aus Rauch in die Luft. Sieht aus wie Kinowerbung. Samuel singt, die Augen geschlossen: »Haberin yok ölüyorum.« Als würde er verstehen, was er da singt. Seit ein paar Monaten schon lernt er Türkisch und hört nur noch türkische Musik, türkisches Radio, was albern ist, er versteht ja kaum etwas. Wenn wir Döner essen, bestellt er auf Türkisch. Er singt und tanzt, wie er denkt, dass man als Türke oder halber tanzt und singt, sein Gesicht ist verzogen, das soll bedeuten: Ich bin im Einklang mit dieser Musik, ich bin im Einklang mit diesem Gefühl, endlich verstehe ich die Sehnsucht in meiner Brust. Er meint das tatsächlich ernst, dieser Lump mit der immerbraunen Haut, den Rehaugen und dem fast schwarzen Haar. Samuel, der diese ganze Show gar nicht nötig hätte, die Frauen fliegen auch so auf ihn, diesen melancholischen Halbtürken. Samuel tut, als interessiere er sich gar nicht mehr für Frauen. Seit er Türke ist, sucht er die eine große Liebe – als ob das typisch türkisch wäre. Es macht ihn nur noch interessanter, fürchte ich.
Samuel achtet sehr auf sein Äußeres, nur seine Finger sind zerbissen. Wahrscheinlich ist es die Stelle, an der seine Ordnung am augenfälligsten bröckelt: Das Chaos am Ende seiner Finger. Die zurückgekauten Nägel, die blutig gebissene Haut, die in kleinen Fetzen um die offenen liegenden Nervenenden steht. Er hat kaum noch Haut an den Seiten seiner Nägel. Es sind die Räuberhände, die ihn verraten. Ich kenne seine Bewegungen: Er nimmt die Hand zum Mund. Er tippt in einem geheimen Rhythmus jede seiner Fingerkuppen an die Oberlippe. Das macht er ständig, keine Ahnung warum, dann beißt er in kleinen, schnellen Bewegungen in die Haut seiner Kuppen. Immer fängt er am Daumen der linken Hand an und endet am kleinen Finger der rechten.
Mein zwanzigster Geburtstag. Es kommt mir vor, als wäre es ein anderer Sommer, eine andere Zeit.
Wie immer zu Sommerbeginn war Straßenfest in der Innenstadt. Samuel stand vor mir in der Tür, biss sich ein Stück Haut vom Finger und spuckte es mir vor die Füße. Ich sah ihm zu und als er es bemerkte, lächelte er und steckte die Hand mit dem angekauten Finger in seine viel zu lockigen Haare und wühlte darin herum.
»Hab was für dich«, sagte er und kramte mit der anderen Hand in seiner Hosentasche. Eine kleine Blechdose. Er schüttelte sie und machte große Augen.
Und damit hat es angefangen. Manchmal hat Samuel Ideen, die mir völlig fremd sind. Sein Geschenk war eine dieser Ideen. Ich bin nicht allein verantwortlich. Unter normalen Umständen wäre das alles nicht passiert.
Ich habe die Augen geschlossen, den Nacken gemütlich auf der Lehne der Hollywoodschaukel, die Sonne brennt in mein Gesicht, so liege ich da und genieße unseren Abi-Stress. »Simsalabim«, sagt Samuel. »Simsalabim – und es geschah!« Ich blinzele ihn an, manchmal könnte man denken, er tickt nicht richtig. Er grinst und sagt mit seiner Besserwisserstimme: »Weißt du, woher das kommt? Simsalabim? Von meinen Leuten! Weil wir euch im Mittelalter ewig weit voraus waren und hier in Europa, da haben die Leute geglaubt, die Muslime wären Zauberer.«
»Ach so.«
»Nein, weißt du, so richtige Muslime sagen doch immer Bismillah rahman i rahim, also Im Namen Gottes, des Allbarmherzigen, bevor sie irgendwas besonders Wichtiges tun. Und da haben deine Leute früher echt geglaubt, das wär ein Zauberspruch und haben es nachgemacht, verstehst du: Bismillah – Simsalabim.« Er lacht, ich stehe auf und packe meine Sachen zusammen.
Ich sage: »Du hast ja echt den Plan, was abgeht. Im Mittelalter.« Ich gehe zu den Fahrrädern, Samuel kommt hinterher. »Wo hast du den Quatsch schon wieder her? Aus deiner Türkischfibel vom Grabbeltisch?« Samuel grummelt irgendwas. Ich sage: »Abrakadabra – das heißt eigentlich Amen, das hab…«
»Halt‘s Maul, einfach!«, sagt er.
Zu Hause stopfen wir Essen aus dem Kühlschrank und der Speisekammer in eine alte Plastiktüte. Brot, Dosenfleisch, Milch, Obst und Gemüse, Saft. Mit der Plastiktüte fahren wir dann zum Supermarkt in der Stadt und geben sie Irene. Das machen wir fast jeden Tag so. Meine Eltern wissen natürlich davon und planen es bei ihren Einkäufen großzügig mit ein. Sie verlieren nie ein Wort darüber. Das liegt meinen Eltern: großzügig spenden und kein Wort darüber verlieren. Ich kann sie mir vorstellen, wie sie in der ersten großen Pause gemeinsam im Lehrerzimmer sitzen, der Oberstudienrat und die Oberstudienrätin, gemeinsam einen geheimen Einkaufszettel entwerfen und sich denken, nur denken, sie würden es nicht aussprechen: es gibt nicht Gutes, außer man tut es. Und dann tun sie es, sie packen an, sie retten die Welt, so gut sie können, sie bringen den Pennern Vitamine und Ballaststoffe.
Wenn wir kommen, strahlt Irene über das ganze Gesicht. Sie klatscht in die Hände, steht auf und wankt. Ein bisschen wie ein kleines Kind, nur besoffen. Und alle freuen sich mit ihr, alle Pennerfreunde. Weil Samuel das Essen bringt. Er begrüßt jeden einzelnen und sie alle klopfen ihm auf die Schulter und versuchen, gerade zu stehen und nüchtern zu wirken. Mit dem Beutel in der Hand verteilt Irene das Essen und alle wissen, dass es Irenes wohlgeratener Sohn ist, dem sie es zu verdanken haben. Alle mögen Samuel. Mich mögen sie auch, glaube ich. Wenn ich komme, kommt das Essen. Konditionierung. So bringt man Papageien das Sprechen bei: die immer gleichen Tätigkeiten mit einem laut gesprochenen Wort versehen. Irgendwann sprechen sie das Wort dann mit. Meinen Namen kennen die wenigsten. Sie können ihn sich nicht merken. Dabei ist Janik wirklich kein schwieriger Name.
Irenes Stolz in diesem Moment erinnert mich an meine Mutter, als ich in der dritten Klasse nach der Zeugnisvergabe zum Gymnasium gelaufen bin und am Lehrerzimmer geklopft und ihr mein Zeugnis unter die Nase gehalten habe. Klassenbester, sieben Einsen, drei Zweien. Hinterher war es ihr wahrscheinlich richtig peinlich, aber sie hat den Lappen im ganzen Lehrerzimmer rumgezeigt. Irene stolpert auch von Penner zu Penner und verteilt das Essen. So verkehrt kann sie es also nicht gemacht haben in ihrem Leben. Sie schwankt so stolz dann.
Wir schwingen uns wieder auf die Räder und fühlen uns gut, wie wir unter dem schnell leiser werdenden Johlen der Penner in Richtung Neubaugebiet fahren. Wir sind auf dem Weg zu Lina. Manchmal kommt Samuel mit und bleibt in ihrem Zimmer, macht irgendwas im Internet. Lina und ich hängen uns in den Garten. Sie ist vor ein paar Tagen achtzehn geworden, natürlich hat sie nicht gefeiert, ihr Teppich könnte Flecken bekommen. Lina hat manchmal etwas unangenehm Steifes an sich und ich mag sie nicht, wenn ich sie mir zwanzig Jahre älter denke, aber ich weiß ja auch, dass ich nicht mein Leben mit ihr verbringen will, sondern nur noch diesen Sommer. Auch wenn ich ihr das eine erzählen muss, damit das andere klappt. Das ist schon okay. Wir sind fast ein Jahr zusammen, die schöne Lina und ich. Es ist in Ordnung mit ihr, wir reden wenig und küssen viel. Eigentlich dürfte ich niemals mit Lina zusammen sein. Ihre Eltern sind streng und unglaublich spießig. Aber weil mein großartiger Vater zufällig Linas Lehrer ist und ich nun mal der Sohn meines großartigen Vaters, geht das schon. Schon wieder dankbar sein. Ich komme aus gutem Haus, bin anständig und gebildet, ich darf kommen, wann ich will und sogar abends mit Abendbrot essen. Sie geben mir die Hand und lächeln mich an und lassen meinen Eltern stets die besten Grüße ausrichten. Ich hasse, dass sie beim Abendbrot den Käse mit der Gabel nehmen, dass sie Servietten benutzen. Ich hasse, dass sie gebügelte Stofftaschentücher benutzen und dass sie ihren Klodeckel mit Stoff überzogen haben. Ich hasse ihre Eichenholzimitat-Küche und ihre angestrengten Dialoge, am Tisch und an der Tür. Nur der Lehrersohn darf Lina küssen. Kein anderer dürfte das.
Ich hätte Lina längst von Istanbul erzählen sollen. Aber auch heute haben wir kein Wort geredet, nur dagelegen, in den Himmel geguckt und geknutscht. Ich hab versucht, ihre Hand in meine Hose einzufädeln. Sie wollte nicht.
Später gehe ich in die Küche, um Linas Mutter noch Auf Wiedersehen zu sagen, höflich, wie ich es in diesem Haus ganz von selbst bin. Sie bietet mir ein geschältes Stück Apfel an und natürlich nehme ich es und lächle freundlich. Meine Oberlippe zuckt dabei, ich bin sicher, sie sieht es.
»Grüß deine Eltern schön«, sagt sie.
»Ja, klar, mache ich, die werden sich freuen.«
»Ach, und«, sie hält mir noch ein Stück Apfel hin, »bring doch Samuel auch eins mit.« Sie lächelt. Sogar für den Pennersohn hat sie noch ein Stück Obst.
»Oh, danke.«
Als ich Samuel das Apfelstück hinhalte, reibt er sich den Bauch. »Mh, lecker! Soll ich kotzen oder was?« Er geht zum Fenster, öffnet es und ich werfe das Äpfelchen hinaus. Wir lachen ein bisschen und Lina lacht mit.
»Bubu, wie die Scheiße«, meinte Bubu, als er sich mir vorstellte. Ein wirklich ramponierter Typ. Ich kenne Bubu länger, als ich Samuel kenne. Natürlich, Samuel kennt ihn noch länger als ich, über seine Mutter, aber ich kenne ihn besser. Und ich habe ihn selbst entdeckt, ich war elf oder zwölf. Meine Mutter hatte mich Milch holen geschickt, ich stand vor der Kühltheke im Supermarkt und Bubu nur zwei, drei Schritte neben mir. Er machte einen Kakao auf, trank ihn aus und stellte die Verpackung zurück. Ich nahm eine Tüte Milch und ging ihm hinterher. Bubu pflückte sich Weintrauben beim Obst, Radieschen beim Gemüse. Bei den Süßigkeiten riss er eine Tüte mit Keksen auf und schob sich mehrere Male den Mund voll. Ich ging die Milch bezahlen und wartete draußen auf ihn. Als Bubu aus der Tür kam, ließ ich ihm eine halbe Straße Vorsprung, dann lief ich ihm nach. Ich folgte ihm so lange, bis ich Angst bekam, mich zu verlaufen. Dann drehte ich um und brachte meiner Mutter die Milch. Ich traf Bubu immer wieder in den nächsten Wochen. Auch, weil ich viel vor dem Supermarkt rumstand. Wir begannen uns zu grüßen, dann erzählte ich ihm irgendwann, wer ich bin.
Ich halte die Füße still und Samuel tut es auch, weil der glatte, frisch gebohnerte Fußboden der großen Wartehalle quietscht und laut knartscht bei jedem Schritt, den man macht. Wir sitzen und gucken auf den hellgrauen Boden. »Wenn er wenigstens Muster hätte«, sagt Samuel, er meint den Fußboden. Ich lache und weiß nicht, was ich antworten soll. Es ist nur noch stiller, nachdem er etwas gesagt hat. Ich öffne meinen Mund leicht, um nicht durch die Nase zu atmen. Es ist übertrieben, aber ich atme so leise wie möglich, um keine Aufmerksamkeit auf mich zu lenken.
In ungefähr dreißig Minuten geht unser Flieger nach Istanbul, die Stadt Istanbul. Türkei. In gut dreißig Minuten hört etwas auf und fängt etwas anderes an. Wir haben ewig davon geredet, aber ich hätte nicht geglaubt, dass wir keine Woche nach dem Abitur tatsächlich hier sitzen würden. Fliegen wir also nach Istanbul, eröffnen wir ein Café, einen Imbiss oder verkaufen wir Maiskolben am Bosporus. Hauptsache weg hier, wo mich alles an diese wenigen falschen Minuten erinnert, weg auch von Lina, zum Glück. Samuel macht mir keine Vorwürfe, wir reden ja kaum. Manchmal versuchen wir es mit Humor. Es ist gut, dass wir fliegen und neu starten, vielleicht sogar notwendig.
Ich möchte Samuel anfassen, ihn nur ein kleines bisschen berühren, wie zufällig. Aber ich traue mich nicht. Was plötzlich alles anders ist und nicht mehr sicher. Mir fehlt das bisschen Mut, das nötig wäre. Und sei es nur, um endlich aufzustehen, schnaubend zu atmen und unsere Stille in dieser lauten Wartehalle mit einem knartschenden Tanz auf dem glänzenden Plastikfußboden zu zerfetzen.
Er hätte es Lina erzählen können und auch meinen Eltern, hätte sich auf ihr Lieblingssofa setzen und weinen und sich bemitleiden lassen können. Das wäre sein Recht gewesen, verletzt wie er war und vielleicht noch immer ist. Aber der mit den Räuberhänden hat nichts gesagt, ganz selbstverständlich, kein Wort.