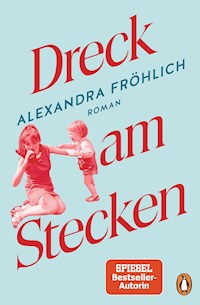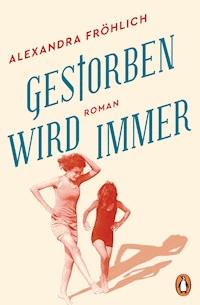
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Frauen. Drei Leben. Eine Geschichte, die endlich erzählt werden muss.
Der Tod war Agnes’ Geschäft. Über Jahrzehnte hinweg führte sie den Steinmetzbetrieb Weisgut & Söhne in Hamburg und lenkte gebieterisch die Geschicke der Familie. Mit 91 Jahren nun hat Agnes von allem und jedem genug, sie will reinen Tisch machen und endlich das Geheimnis lüften, das sie viel zu lange schon mit sich herumträgt. Da ihre Tochter das Weite gesucht hat, beauftragt sie ihre Enkelin Birte, die Einzige, die aus demselben harten Holz geschnitzt ist wie sie, den ganzen Clan zusammenzutrommeln – kein einfaches Unterfangen, denn alle sind sich spinnefeind. Es ist Zeit für die Wahrheit.
»Alexandra Fröhlich kann viel mehr als grandiose Komödien.« Für Sie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Drei Frauen - drei Leben - eine Geschichte
Mit 91 Jahren hat Agnes Weisgut endgültig genug. Über Jahrzehnte hinweg hat die steinreiche Matriarchin, Inhaberin des Steinmetzbetriebs Weisgut & Söhne und Besitzerin zahlreicher Immobilien, die Geschicke ihrer Hamburger Familie gebieterisch bestimmt. Jetzt mag sie nicht mehr. Sie will zurück nach Hause, nach Groß Hubnicken in Ostpreußen, das längst nicht mehr Groß Hubnicken heißt.
Doch vorher muss sie reinen Tisch machen. Sie bittet ihre Enkelin Birte, die aus demselben Holz geschnitzt ist wie sie, alle und auch ihre Tochter Martha, die seit Jahren verschwunden ist, zusammenzutrommeln. Ihre Familie muss endlich erfahren, was damals passiert ist, im Krieg, auf der Flucht über die Ostsee und in der neuen Heimat. Agnes muss ihnen erzählen von all den Toten und dass sie Schuld auf sich geladen hat. Immer wieder. Aber das geschah nur, um ihre Lieben zu schützen. Ein Leben lang hat sie für diese Schuld gebüßt.
Alexandra Fröhlich lebt als Autorin in Hamburg und arbeitet als freie Textchefin für verschiedene Frauenmagazine. Ihr Roman Meine russische Schwiegermutter und andere Katastrophen (2012) stand wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Auch in ihrem neuen Buch, Gestorben wird immer, erzählt sie augenzwinkernd eine ungewöhnlich tragische Familiengeschichte.
ALEXANDRA FRÖHLICH
GESTORBENWIRDIMMER
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen
von Penguin Books Limited und werden hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2016 Penguin Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: any.way, Heidi Sorg
Covermotiv: © Ullstein Bild
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-18629-6V008
www.penguin-verlag.de
»Recht als ein Palmenbaum über sich steigt,
hat ihn erst Regen und Sturmwind gebeugt,
so wird die Lieb’ in uns mächtig und groß
durch Kreuz, durch Leiden und traurigem Los«
Ännchen von Tharau, ostpreußisches Volkslied
HAMBURG, MAI 2008
»Es wird auch langsam Zeit, dass du kommst.«
Begleitet wurden diese Worte durch ein dringliches Pock-pock-pock. Birte zuckte zusammen. Warum hatte sie nur geglaubt, dass sie an einem Sonntag ins Haus schlüpfen könne, ihre Unterlagen schnappen und schnell wieder raus, ohne von ihrer Großmutter bemerkt zu werden?
»Ich habe dir schon vorgestern auf den Anrufbeantworter gesprochen.«
Sie bemerkte, wie sich ihr Körper instinktiv anspannte, bereit zum Angriff. Oder zur Flucht. »Mailbox, das heißt Mailbox – Omi …«, antwortete sie.
»Es ist mir gleich, wie das heißt. Und nenne mich nicht Omi. Du weißt, wie sehr ich das hasse.«
»Ja, ich weiß«, sagte sie zufrieden und schaute die Treppe hinauf, auf deren oberem Absatz sie stand, Agnes, den schwarzen Gehstock mit dem Elfenbeinknauf fest umklammernd und noch einmal mit einem abschließenden Pock auf den Boden stoßend. Wofür sie dieses Ding seit zwei Jahrzehnten mit sich schleppte, war allen schleierhaft.
Für ihr Alter war sie beängstigend gut in Form, auch jetzt ragte sie über Birte auf, ihr Körper so gerade, als hätte sie ein Stahlrohr verschluckt. Auf ihre Haltung bildete sie sich viel ein, in ihrer Jugend war sie Leichtathletin gewesen, nicht ohne Erfolg, wie sie stets betonte. Eine Gehhilfe hatte sie nicht nötig. Birte vermutete, dass dieser Stock bloß eine Insignie war, mit der sie ihre majestätische Attitüde unterstrich und noch mehr Angst und Schrecken verbreitete.
Erst kürzlich hatte sie versucht, damit einen Nachbarsjungen zu verdreschen, der sich auf der Wiese hinter der Werkstatt herumtrieb und ein paar Steine aufklaubte, die sowieso für den Abfall bestimmt waren. Erst entwischte ihr der Knabe, schließlich war sie mit einundneunzig keine zwanzig mehr. Kurzerhand nutzte sie deshalb ihren Stock als Wurfgeschoss und traf das Kind damit direkt am Kopf. Wie sich nur wenig später herausstellte, war es der jüngste Spross der Jensens – ausgerechnet der Jensens, mit denen man seit Ewigkeiten im Clinch lag.
»Hat den Richtigen erwischt«, sagte Agnes knapp und lehnte es rundweg ab, sich bei den Eltern zu entschuldigen. »So weit kommt es noch! Dieses Pack hat auf meinem Grund und Boden nichts zu suchen. Gar nichts.«
Birte fiel die unschöne Aufgabe zu, bei den Jensens zu Kreuze zu kriechen, damit sie von einer Anzeige absahen, noch eine konnte Agnes nicht gebrauchen. Eine Dreiviertelstunde hörte sie sich das Gezeter an, was für eine abgrundtief böse Person ihre Großmutter doch sei und dass sie sich jetzt sogar schon an Kindern vergreife. Insgeheim gab sie den Aufgebrachten Recht, versuchte jedoch, den Vorfall auf Agnes fortgeschrittenes Alter zu schieben, sie werde halt langsam ein wenig wunderlich, auch ihre Augen seien nicht mehr die besten, nein, natürlich hätte sie den Jungen nicht verletzen, sondern ihm lediglich einen Schrecken einjagen wollen.
»Das glaubst du doch selbst nicht«, meinte Matthias Jensen, der Vater, trocken.
Nein, das glaubte sie selbst nicht, aber das konnte sie schlecht sagen. Deshalb ignorierte sie ihr inneres Widerstreben, entschuldigte sich wieder und wieder und sah Matthias dabei tief in die Augen, darauf hoffend, dass er sich an jene Jugendtage erinnerte, in denen sie so hoffnungslos für ihn geschwärmt hatte. Schließlich konnte sie ihn mit zwei Kisten Rotwein und einem großen Sack Marmorbruch für das Opfer besänftigen.
»Deine Familie ist wirklich die Pest«, gab ihr Matthias zum Abschied mit auf den Weg.
Auch damit lag er nicht falsch.
»Birte!« Agnes riss sie aus ihren Gedanken. »Was stehst du eigentlich da unten herum, wie zur Salzsäule erstarrt? Hilf mir endlich die Treppe hinunter.«
Als ob Agnes Hilfe brauchte! Sie ging betont langsam die Stufen hinauf und reichte ihrer Großmutter den Arm. Kurz malte Birte sich aus, wie es wäre, wenn sie ins Straucheln geriete, wenn sie ihren Fuß wie zufällig vor Agnes’ stellte und sie zum Stolpern brächte. Für einen Oberschenkelhalsbruch müsste es mindestens reichen. Und wenn Menschen ihres Alters einmal im Krankenhaus waren, kamen sie so schnell nicht wieder heraus. Mit etwas Glück nur in der schwarzen Kiste.
»Birte, hörst du mir überhaupt zu? Wo bist du denn nur mit deinen Gedanken?«
»Das möchtest du nicht wirklich wissen«, entgegnete sie und lächelte dabei.
Agnes schüttelte unwirsch den Kopf. »Lass das dämliche Grinsen. Wie siehst du überhaupt aus? Es ist Sonntag. Kannst du dir da nicht etwas Anständiges anziehen?«
Birte strich sich eine verschwitzte Strähne hinter das Ohr, schaute an sich herunter und kam sich in ihrem teuren Laufdress plötzlich nackt vor. »Ich komme vom Joggen. Dafür fand ich das kleine Schwarze eher unpassend.«
»Du bist hierher gerannt? Warum hast du dir eigentlich gerade diesen teuren Sportwagen gekauft?« Agnes schüttelte erneut den Kopf. »Jetzt komm endlich. Ich habe etwas mit dir zu besprechen.«
Ihre Großmutter schritt voran durch den langen Flur, natürlich war sie tadellos gekleidet und frisiert. Auf ihr Äußeres legte sie viel Wert, immer noch, stets waren ihre pechschwarzen Haare ordentlich onduliert, stets trug sie Perlenohrringe und die dazugehörige Kette über ihren schwarzen Kleidern, die in ihrer Schlichtheit doch elegant wirkten. Birte konnte sich nicht erinnern, ihre Großmutter jemals in einer anderen Farbe als Schwarz gesehen zu haben. Schwarz wie ihre Seele. Schwarz wie der Tod. Eine angemessene Farbe, insbesondere in ihrer Branche.
Agnes öffnete die Tür zum Anbau, ging durch die Geschäftsküche und die sich anschließende Werkstatt, in der feiner Steinstaub durch die Luft flirrte und an deren Ende sich das Büro befand. Dort setzte sie sich hinter den schweren Eichenschreibtisch und deutete auf den kleinen Drehhocker davor, der so niedrig eingestellt war, dass man sich darauf vorkam wie ein Kind.
»Ich stehe lieber«, sagte Birte, lehnte sich abwartend an die Wand und strahlte dabei ein gewisses Desinteresse aus. Sie wusste doch schon, was jetzt passierte. Wahrscheinlich würde Agnes in der nächsten Sekunde die rechte Schreibtischschublade aufziehen und ihr kleines schwarzes Notizbuch herausholen. Jenes Büchlein, in das sie alles in zittrigem Sütterlin niederschrieb: Geschäftstermine, Telefonnummern von Lieferanten und Kunden, Preisabsprachen, Aktienkurse, aber auch wer ihr welches Geheimnis anvertraut und vor allem wem sie wie viel geliehen hatte.
Agnes würde das Büchlein öffnen, einen kurzen Blick hineinwerfen und ihre Forderung stellen. Sie würde sie keinesfalls als Bitte formulieren. Vielleicht würde ihr Gegenüber, je nach charakterlicher Disposition, anfänglich Widerworte geben – natürlich ohne Aussicht auf Erfolg, sondern allein um einen Rest Selbstachtung zu wahren. Am Ende einer kurzen fruchtlosen Diskussion jedoch würde man sich fügen. Agnes saß am längeren Hebel, immer.
Diesmal blieb die Schublade zu. Agnes sagte nur: »Ich habe eine Entscheidung gefällt, die unsere ganze Familie betrifft. Du wirst alle zusammenholen.«
»Alle? Wie meinst du das?«
»Mein Gott, wenn ich alle sage, meine ich auch alle. Meine Kinder. Meine Enkelkinder. Das dazugehörige angeheiratete Gesocks. Die Urenkel.«
Birte zog die Augenbrauen in die Höhe, soweit es ihre mit Spritzen lahmgelegte Stirn erlaubte. »Was soll denn der Quatsch? Deine Söhne reden seit Ewigkeiten kein Wort mehr miteinander …«
»Das ist mir gleich«, unterbrach Agnes sie. »Sie sollen nicht miteinander reden, sie sollen sich hinsetzen und zuhören.«
Birte zuckte mit den Schultern. »Wenn du meinst. Ich kann’s probieren. Aber warum fragst du sie nicht …«
»Ich werde wohl meine Gründe haben«, fiel Agnes ihr erneut ins Wort. »Wie gesagt: alle meine Kinder. Das schließt auch Martha mit ein.«
Birte stieß sich von der Wand ab und registrierte, wie sie eine Gänsehaut bekam. »Vergiss es. Mit der Irren will ich nichts zu tun haben.«
»Rede nicht so von deiner Mutter.«
»Mutter? Diese Frau hat vor über dreißig Jahren aufgehört, Mutter zu sein!« Birte wurde lauter und stellte sich breitbeinig mitten in den Raum. »Das kannst du nicht von mir verlangen. Das kannst du einfach nicht.«
»Ich kann«, sagte Agnes.
Einen Moment lang maßen sie sich mit Blicken, zwei Alphatiere, kurz vor dem Sprung, kurz davor, die Kehle des Unterlegenen zu zerfleischen.
»Nein«, presste Birte schließlich mit zusammengebissenen Zähnen hervor. »Nein.«
»Meinst du nicht, dass es an der Zeit ist zu verzeihen?« Agnes’ Stimme war unerwartet weich.
»Das sagt die Richtige!« Birte lachte auf. »Wenn du plötzlich Sehnsucht nach deiner verlorenen Tochter verspürst, dann such sie doch selber.«
Agnes schwieg, und als sie endlich antwortete, war alle Weichheit verschwunden. »Ich muss sie nicht suchen. Du wirst schon wissen, wo sie ist. Und du wirst sie davon überzeugen, nach Hause zu kommen.«
»Warum ich? Warum nicht Peter?«
»Dein Bruder, dieser Schwächling? Ausgeschlossen. Das ist eine Aufgabe für dich. Und du wirst sie erledigen.«
Birte verschränkte die Arme vor der Brust. »Nein«, wiederholte sie.
»Nein«, äffte Agnes sie mit hoher Stimme nach. »Du hörst dich an wie ein dummes, trotziges Kind. Es reicht jetzt. Muss ich dich etwa daran erinnern, wem du dein schönes Leben zu verdanken hast?«
Birte schaute aus dem Fenster.
»Dein schönes Penthouse? Deine schöne Firma? Deine schönen Reisen?«
»Ach, wieder die alte Leier?« Birte bemühte sich, möglichst gelangweilt zu klingen.
»Genau, die alte Leier. Weil ich damit Recht habe.«
»Einen Scheißdreck hast du! Aber das geht in deinen alten Schädel nicht mehr rein.«
Agnes schürzte süffisant die Lippen. »Das mag sein. Dafür versucht mein alter Schädel sich gerade vorzustellen, was geschieht, wenn ich dir deinen Kredit kündige. Oder beschließe, meine Häuser einer anderen Immobilienverwaltung anzuvertrauen als deiner. Und dann fragt mein alter Schädel sich, was noch übrig bleibt von deinem schönen, sorglosen Leben.«
»Das ist Erpressung«, zischte Birte. »Außerdem hast du versprochen …«
»Versprechen werden von Zeit zu Zeit gebrochen.«
Sie blickte in Agnes’ klare blaue Augen und wusste, dass sie verloren hatte. Ihre Großmutter war genauso hart wie der Granit, den ihre Familie in der vierten Generation bearbeitete. Sie sparte sich eine erneute Erwiderung.
»Na also«, sagte Agnes mit einem kleinen Lächeln, das jeglichen Humor vermissen ließ. Sie erhob sich, offensichtlich war das Gespräch beendet. »Anstatt hier Wurzeln zu schlagen, solltest du dich in Bewegung setzen. Du hast zehn Tage Zeit.« Pock-pock-pock. »Und nimm den hinteren Ausgang. Nicht, dass du den ganzen Schmutz durchs Haus trägst.« Dann ging sie, ohne ein weiteres Wort zu verlieren.
»Verdammtes Miststück«, murmelte Birte. Sie verließ das Gebäude wie angeordnet durch die Seitentür, knallte diese mit ordentlichem Krach zu, ging über den dreckigen Hof, auf dem sich in der linken Ecke die Marmor- und Granitplatten stapelten, in der rechten der Schutt türmte und mittig ausrangierte Maschinen vor sich hin rosteten. Müsste aufgeräumt werden, dachte sie. War die Auftragslage so gut, dass dafür keine Zeit blieb? Oder fehlte schlichtweg mal wieder eine Arbeitskraft?
Birte wusste, dass Agnes vor Kurzem einen der zwei Gesellen rausgeschmissen hatte. Hochkant. Angeblich war ihm bei der Bearbeitung des teuren Statuario-Marmors ein Fehler unterlaufen. Aber Birte wusste auch, dass das Unsinn war. Entweder hatte der arme Mann ihrer Großmutter nicht den gebotenen Respekt gezollt, oder sie fand, dass man gut und gern ein Gehalt einsparen und Onkel Klaus noch mehr arbeiten könne. Um Dinge wie Arbeitnehmerrechte scherte sie sich einen Dreck. Und auch darum, dass sie de facto und de jure gar nicht mehr berechtigt war, jemanden zu entlassen. Birtes Onkel war seit zig Jahren Geschäftsführer und Inhaber des Familienunternehmens. Zumindest auf dem Papier. Doch mit solchen Nebensächlichkeiten hatte sich Agnes noch nie aufgehalten.
Birte öffnete das große schmiedeeiserne Tor zur Straße hin und schloss es sorgfältig hinter sich. Einen Augenblick lang blieb sie noch stehen und betrachtete das Firmenschild, das über der Einfahrt hing: »Steinmetzbetrieb Weisgut & Söhne«. Dann machte sie sich langsam auf den Weg und fragte sich, was ihre Großmutter mit dieser Familienzusammenkunft bezweckte. Dass sie sich alle gegenseitig an die Gurgel gingen?
Martha, Martha, Martha, rauschte es durch ihren Kopf. Agnes hatte natürlich Recht. Birte wusste, wo ihre Mutter sich aufhielt, wenigstens hatte sie eine ungefähre Ahnung. Martha schrieb ihr Postkarten, die Birte nicht las, aber sorgfältig in einer schwarzen Kiste unter ihrem Bett verwahrte. Anhand der bunten Sightseeing-Motive hatte sie eine Vorstellung von dem scheinbar planlosen Zickzackkurs, den ihre Mutter durch Europa nahm. Martha, Martha, Martha.
Birte stellte das Rauschen ab und wandte sich gedanklich den anderen Familienmitgliedern zu. Dass Onkel Klaus sich mit seinem älteren Bruder Karl an einen Tisch setzte, war unvorstellbar. Ihr Streit schwelte, solange sie denken konnte, und nährte sich aus Eifersüchteleien, Zurückweisungen und Dominanzgehabe. Wirklich verstanden, was die beiden letztlich entzweite, hatte Birte nie. Vordergründig ging es um die Ausrichtung des Betriebs. Karl hätte gern das Geschäftsfeld erweitert; Gartenskulpturen, Marmorbäder, Treppen – was man nicht alles aus Steinen machen konnte! Klaus hielt dagegen. Alles nur vorübergehende Moden, zu unsicher, zu kostenintensiv, nur die Fertigung der Grabmäler sei im wahrsten Sinne des Wortes ein todsicheres Geschäft – ganz nach Agnes’ Leitspruch: »Gestorben wird immer.«
Auch wenn Karl und Klaus seit nunmehr zwölf Jahren beruflich getrennte Wege gingen, hatte sich ihr Verhältnis nie entspannt. Im Gegenteil. Es war, als hätte ein steter Strom unausgesprochener Vorwürfe den Graben zwischen den Brüdern immer weiter vertieft.
Wie sollte Birte die Streithähne an einen Tisch bekommen? Sie brauchte eine Finesse, ein Druckmittel. Ganz hinten in ihrem Hirn regte sich etwas, eine vage Erinnerung, eine Begebenheit aus Kindertagen. Da war etwas. Etwas Unangenehmes.
Sie hatte schon die Kollaustraße am Niendorfer Marktplatz überquert, als sie spontan beschloss, nicht nach Hause zu joggen, sondern ihr strenges sonntägliches Sportprogramm zu verkürzen und zu ihrem Cousin Bosse zu laufen. Vielleicht hatte er eine Idee, wie man Klaus, seinem Vater, Agnes’ Wunsch schmackhaft machen konnte. Außerdem brauchte sie jemanden zum Reden. Nicht irgendjemanden, sondern einen, der sich mit ihrer Familie auskannte. Der genauso unsäglich mit ihr verstrickt war wie sie selbst.
Agnes schob die Wohnzimmergardine ein wenig zur Seite und beobachtete, wie ihre Enkelin die Straße hinaufging, mit federnden, kraftvollen Schritten, unter ihrem knappen Trikot zeichnete sich die Rückenmuskulatur ab. Wiederholt fuhr sie sich durch die kurzen blondierten Haare – als könnte sie damit die Gedanken in ihrem Kopf ordnen.
Birte hatte nichts mehr gemein mit dem fetten Entlein, das sie in ihrer Kindheit einmal gewesen war. Heute, mit Anfang vierzig, glich sie einem stolzen, sehnigen Schwan, und Agnes wusste, dass dieses Ergebnis Blut, Schweiß und Tränen gekostet hatte. Ihre Enkelin war ein Mensch, der seine Ziele mit verzweifelter Hartnäckigkeit verfolgte und ein Scheitern schlichtweg ausschloss. Sie war ihr nicht unähnlich.
Agnes wusste, dass es eine Zumutung war, was sie von Birte verlangte. Insbesondere die Sache mit Martha. Sie lächelte in sich hinein. Natürlich hätte sie auch selbst alle einladen können. Aber das war unter ihrer Würde.
Und natürlich würden sie alle angerannt kommen, diese Memmen, dieser Haufen von Schmarotzern. So gut es ging, hielt sie sich die Bande vom Leib. Aber diesmal ging es nicht anders.
Sie zog die Gardine zu und geriet kurz ins Wanken. Da war er wieder, dieser leichte Schwindel, der sie in der vergangenen Zeit so oft überfallen hatte. Gestorben wird immer, dachte Agnes, bald bin ich dran. Doch vorher war es an der Zeit, die Dinge zu regeln. Es war Zeit für die Wahrheit.
HAMBURG, JULI 1978
Birte schwitzte wie ein Schwein. Die salzige Suppe lief ihr aus den Haaren Nacken und Rücken hinunter und sammelte sich in ihrer Poritze. Es juckte fürchterlich. Trotzdem duckte sie sich noch tiefer unter den Holzstapel im alten Schuppen hinter der Werkstatt und betete zu Gott, dass keine dieser schwarzen, haarigen Spinnen über ihre Füße krabbeln würde. Von draußen hörte sie ihn wieder rufen. »Komm endlich raus! Du hast auch gewonnen. Komm schon …« Er klang jetzt richtig sauer.
Sie hatte nicht vor, herauszukommen. Und wenn sie bis zum Ende der Sommerferien hier hocken musste, der kleine Pupser konnte sie suchen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag.
Was hatte sie sich auf die Ferien gefreut! Endlich raus aus der Schule, weg von Herrn Sturm, ihrem Klassenlehrer, der immer so missbilligend auf ihre abgekauten Fingernägel starrte und sie im Sportunterricht schikanierte. Noch in der letzten Stunde hatte er sie gezwungen, den Aufschwung am Reck zu üben, wieder und wieder. Und wieder und wieder hatte sie ihren Körper über die Stange gewuchtet, ohne jegliches Gelingen, bis ihr schwindlig wurde und sie wie ein nasser Sack auf den Boden klatschte und einfach liegen blieb. Herr Sturm hatte nur tief und theatralisch geseufzt und sich kopfschüttelnd abgewandt. Das war fast schlimmer als eine seiner gemeinen Bemerkungen, bedeutete es doch, dass er sie für eine hoffnungslose Versagerin hielt, an die jedes weitere Wort verschwendet war.
Dafür hatten die anderen nicht geschwiegen, natürlich nicht. Schon während Birtes demonstrativer Demütigung hatte sich das Gros der Mädchen zusammengerottet und einen Pulk gebildet. Mit kleinen, hämischen Kommentaren begleiteten sie ihre verzweifelten Anstrengungen. Allen voran Sybille, die schöne Sybille, zart und feingliedrig, das lange blonde Haar seidig glänzend, die blauen Kulleraugen weit aufgerissen. Birte wunderte sich, wie jemand so Hübsches so bösartig sein konnte. Und dass alle, sogar die Lehrer, sich von Sybilles äußerer Erscheinung blenden ließen.
Kaum war Herr Sturm zu den Jungs in den hinteren Teil der Turnhalle gegangen, um deren Fußballspiel zu unterbrechen, war Sybille an Birte herangetreten, hatte sich zu ihr gehockt und ihr mit einer scheinbar tröstenden Geste die Hand auf die Schulter gelegt. »Na, du hässlicher Fettklops«, hatte sie gezischt, »das war wohl wieder nix. Du wirst es nie lernen. Du bist einfach zu dumm und zu dick.«
In der Umkleidekabine waren die Gemeinheiten in die nächste Runde gegangen. Sybille hatte den Chor der ihr Ergebenen dirigiert, und es erklang der Singsang, der Birte in jeder Pause auf dem Schulhof begleitete: »Birte Babyspeck, da kommt Birte Babyspeck, Birte Babyspeck frisst ganz viel Dreck.« Birte hatte sich ihre Sachen geschnappt, auf dem Klo eingeschlossen und gewartet, bis die anderen weg waren.
Als sie sich heraustraute, sah sie, dass Peter auf sie wartete.
»Kommst du endlich«, sagte ihr Zwillingsbruder und sah ihr dabei nicht in die Augen.
Schweigend marschierten sie nach Hause, mit keinem Wort erwähnte Peter den Vorfall aus dem Sportunterricht. Und Birte fragte sich, warum ausgerechnet sie einen Bruder hatte, der ihr nie zur Seite stand und der immer so tat, als ginge ihn das alles nichts an.
Aber eigentlich war ihr das am letzten Schultag auch egal. Jetzt war es Sommer. Und das bedeutete sechs lange Wochen ohne Hänseleien und ohne Schikane. Sechs lange Wochen süßen Nichtstuns. Irgendwo im Schatten lümmeln, völlig unbehelligt, und abtauchen in die verheißungsvolle Welt der Bücher. Mark Twains Die Abenteuer des Tom Sawyer lag schon bereit, ebenso Stevensons Schatzinsel, die sie zum dritten Mal lesen wollte. Und Tante Anna hatte ihr kürzlich die Vorstadtkrokodile geschenkt, weil sie wusste, wie sehr Birte den Film mochte.
Papa, und da war er sich mit Herrn Sturm einig, fand, dass derartige Lektüre nichts für ein Mädchen war und sie nur auf dumme Gedanken brachte. Als Birte ihn einmal fragte, was sie stattdessen lesen solle, kam er mit Hanni und Nanni um die Ecke. Doch diese blöden Internatsgeschichten interessierten Birte nicht. Sie wollte in Abenteuern versinken, in denen die Helden mutig, frei und unbeirrt waren. Ganz genau so, wie sie wünschte zu sein.
Vielleicht stand nun sogar ein echtes Abenteuer an. Eine Woche Ostsee hatte Papa in Aussicht gestellt, und das war ein wirklich dickes Ding, weil sie noch nie weggefahren waren. Immer gab es zu viel Arbeit in der Gärtnerei, und außerdem waren da Mamas »Zustände«, die eine Reise eigentlich unmöglich machten. Aber diesen Sommer wollten sie es wagen, echter Urlaub, wie ihn ganz normale Familien machten, am Meer.
Selbstverständlich kam wieder alles anders. »Eurer Mutter geht es nicht so gut«, hatte Papa ihr und Peter erklärt und mit den Augen gerollt. Sie hatten beide nur mit den Achseln gezuckt, denn ihrer Mutter ging es oft nicht so gut. »Die Nerven«, sagten die Erwachsenen und warfen einander bedeutungsvolle Blicke zu. Birte konnte sich nicht recht vorstellen, was für eine Krankheit das sein sollte – »die Nerven«. Aber es musste etwas Schlimmes sein, so viel war ihr klar. Denn immer, wenn es Mama nicht so gut ging, wurden sie und ihr Bruder zu den Verwandten geschickt.
Also hatten sie das Notwendigste in ihre kleinen Koffer gepackt, Peter ging rüber zu Onkel Karl; Birte wurde zu Onkel Klaus und Tante Anna geschafft. Erst fand sie, dass sie das bessere Los gezogen hatte, denn Tante Anna war immer richtig nett zu ihr, und außerdem gab es ihre Cousine Astrid, mit der sie spielen konnte. Doch Astrid war nicht da, sondern verschickt in ein Ferienlager mit dem Sportverein.
Birte musste mit ihrem Cousin Bosse vorliebnehmen. Und Bosse war ein echtes Problem. Er war erst neun, über zwei Jahre jünger als sie, quasi ein Kleinkind. Er las Fix & Foxi, spielte mit Plastik-Cowboys und sammelte tatsächlich noch Schlümpfe. Zwischen ihnen lagen Welten.
Nach den strengen Ermahnungen ihres Vaters, sie solle bloß artig sein und ihm keine Schande machen, hatte Birte sich fest vorgenommen, trotzdem nett zu ihrem Cousin zu sein. Doch gleich gestern, kurz nach ihrer Ankunft, hatten sie sich schon gestritten.
Bosse hatte sie wichtigtuerisch in sein Zimmer geführt, um ihr seine neuesten Schlümpfe zu präsentieren, die ordentlich aufgereiht auf der Fensterbank standen. Birte hatte pflichtschuldigst »Oh« und »Ah« gemacht und sich eine der Figuren gegriffen. »Nicht anfassen, hörst du, nicht anfassen!«, hatte ihr Cousin gebrüllt und ihr den blöden Schlumpf aus der Hand gerissen.
Daraufhin hatte Birte einen Schlumpf nach dem anderen von der Fensterbank geschnipst, denn von diesem kleinen Pupser ließ sie sich schon mal gar nichts sagen. Bosse hatte nach ihr getreten, sie hatte ihn geschubst, er hatte sie an den Haaren gezogen, und sie war heulend zu Tante Anna gelaufen, um zu petzen. Zur Strafe mussten sie die Werkstatt ausfegen.
Der Abend war nicht viel besser gelaufen. Tante Anna hatte ihnen erlaubt, Fernsehen zu schauen; es lief Spiele ohne Grenzen. Die Sendung hatte eben begonnen – Deutschland maß sich mit Italien, die Kontrahenten sollten versuchen, sich mit Schaumstoffrollen von schwimmenden Baumstämmen zu hauen –, und Tante Anna servierte ihnen einen Schnittchenteller mit Leberwurstbroten und sauren Gürkchen, dazu Milch mit Honig. Birte liebte heiße Milch mit Honig.
»Iiiih, Milchhaut!«, hatte Bosse gerufen, sie mit einem Teelöffel aus seiner Tasse gefischt und in Birtes Becher plumpsen lassen.
Birte ließ sich nicht lumpen und fing an, unauffällig Gürkchenscheiben in Bosses Richtung zu werfen, woraufhin er seine Leberwurstfinger in ihre Milch tunkte. Onkel Klaus haute auf den Tisch und brüllte: »Aufhören, alle beide, aber sofort!«
Tante Anna schaltete einfach den Fernseher ab und holte das Malefiz-Spiel heraus. »Ich glaube, es ist besser, wenn ihr eure Kräfte beim Würfeln messt«, sagte sie.
Natürlich hatte Bosse keine Chance gegen sie. Birte türmte Stein auf Stein vor seine Durchgänge und gewann haushoch. Ihr Cousin bekam einen Wutanfall, schmiss das Spielbrett durchs Wohnzimmer und stürzte sich auf sie. Tante Anna steckte sie beide kurzerhand ins Bett. Wenigstens durfte Birte in Astrids Zimmer schlafen und musste die Nacht nicht bei dem kleinen Pupser verbringen.
»Birteeeeee! Wenn du jetzt nicht rauskommst, geh ich zu Mama und sag, dass du mich wieder geschubst hast!«
Mach doch, dachte Birte, von mir aus feg ich die ganzen Ferien die Werkstatt. Dann muss ich wenigstens nicht mit dir spielen.
Gleich nach dem Frühstück hatte sie sich mit Tom Sawyer ins Bett gelegt und las gerade atemlos, wie er sich mit Becky in der McDouglas-Höhle verlief und auch noch Indianer-Joe begegnete, da stand Tante Anna in der Tür und schickte sie zu Bosse in den Garten. Kinder gehörten ihrer Meinung nach an die frische Luft.
Birte hörte, wie Bosse hinter dem Schuppen durch das hohe Gras raschelte und vor Wut keuchte. Er suchte sie jetzt schon über eine halbe Stunde lang, aber es war unwahrscheinlich, dass er in den Schuppen kam. Der war dunkel und muffig, und Bosse hatte Angst im Dunkeln.
Die Schuppentür öffnete sich plötzlich mit einem widerlichen Knarzen. Unwillkürlich hielt sie die Luft an. Sollte Bosse es doch wagen? Dann hörte sie die Stimme ihres Onkels. Er klang besorgt.
»Du musst dich beruhigen, Karl! Erst einmal sollten wir herausfinden, was der hier will.«
»Was wird der Bastard schon wollen? Geld, nehme ich an«, antwortete Onkel Karl.
»Das glaube ich nicht. So einfach werden wir den nicht los …«
Die Männer schwiegen einen Moment lang, und Birte versuchte, möglichst flach und geräuschlos zu atmen. Worüber sprachen die beiden?
»Dreißigtausend. Wir bieten ihm dreißigtausend, damit er verschwindet«, sagte Onkel Karl. »Das kriegen wir zusammen, bevor Mutter misstrauisch wird.«
Onkel Klaus lachte freudlos. »Warum soll er sich mit dreißigtausend zufriedengeben, wenn ihm viel mehr zusteht?«
»Dem steht gar nichts zu!« Onkel Karl schrie nun. »Wir schuften uns seit Jahren krumm und buckelig und ertragen Mutters Kapriolen. Und der kommt einfach und setzt sich ins gemachte Nest?«
»Hör auf zu brüllen, Karl. Es nützt ja nichts. Mutter hat ihn geholt, das müssen wir respektieren.«
»Respektieren? Du hast sie doch nicht mehr alle! Seit Ewigkeiten terrorisiert sie uns, immer tanzen wir nach ihrer Pfeife, nichts kann man ihr Recht machen. Und jetzt das!«
»Ja«, sagte Onkel Klaus schlicht. »Und jetzt das. Aber wir werden nichts daran ändern können.«
»Das wollen wir doch mal sehen! Den Bastard schlag ich tot, wenn es sein muss, das schwör ich dir …«
Onkel Karl drehte sich auf dem Absatz um und stürmte aus dem Schuppen. Sein Bruder blieb noch einen Augenblick lang stehen, reglos und in sich zusammengesunken. Dann straffte er sich und ging ihm hinterher.
Birte kroch unter dem Holzstapel hervor. Ihr Herz schlug wie nach einem Tausend-Meter-Lauf. »Den Bastard schlag ich tot.« Onkel Karl war dafür berüchtigt, dass er bei der kleinsten Kleinigkeit durch die Decke ging. Das war sonst nicht weiter schlimm, weil seine Ausbrüche keine Konsequenzen nach sich zogen. Solange er tobte, ging man einfach in Deckung. Und sobald er Dampf abgelassen hatte, war alles wieder gut. »Hunde, die bellen, beißen nicht«, sagte ihr Vater immer.
Aber mit Mord und Totschlag hatte Onkel Karl noch nie gedroht. Und wer war dieser »Bastard«, den er umbringen wollte? Was war überhaupt »ein Bastard«?
Es konnte sich nur um Großmutters Besuch handeln. Sie hatte ihn noch nicht zu Gesicht bekommen, nur gehört. Eine dunkle Stimme, die eindringlich, aber so leise, dass man kein Wort verstand, durch das Treppenhaus schwebte. Schwere Schritte, die im ersten Stock über ihr vibrierten. Eine mysteriöse Angelegenheit, denn Großmutter hatte sonst nie Besuch.
Birte beschloss, Tante Anna danach zu fragen, öffnete die Schuppentür und rannte los Richtung Haus.
»Hab ich dich!« Bosse sprang ihr in den Weg. Fast hätte sie ihn beiseitegeschubst, aber dann blieb sie einfach stehen.
»Kommste mit?«, fragte er.
»Wohin?«
»Nach oben, zu Großmutter.«
Sie starrte ihn mit offenem Mund an. Man ging nicht zu Großmutter, einfach so. Man wurde zu ihr zitiert, um sich eine Belehrung abzuholen, die Schulnoten vorzuzeigen oder Strafarbeiten zu bekommen. Ansonsten ging man ihr aus dem Weg.
»Hat sie uns gerufen? Müssen wir?«, wollte Birte wissen.
»Nee, müssen wir nicht. Aber da ist doch dieser Mann. Den wollt ich mir mal angucken. Also, kommste mit?«
Birte tippte sich nur an die Stirn.
»Traust dich nicht, oder was?«
»Pfff«, machte Birte.
»Angsthase, Pfeffernase, morgen kommt der Osterhase«, sang Bosse.
»Na gut«, meinte sie von oben herab. »Damit du aufhörst zu nerven. Aber nicht, dass Großmutter uns erwischt …«
»Quatsch, wir schleichen uns an wie die Indianer«, sagte Bosse leichthin. Aber sie sah ihm an, dass seine Zuversicht nur aufgesetzt war.
Geduckt flitzten sie zum Haus, und sofort fühlte Birte sich wie einer der Helden ihrer Bücher, auf dem Weg in ein großes Abenteuer. Sie huschten durch die Eingangstür der alten Jugendstilvilla, die im Sommer sperrangelweit offen stand, und kauerten sich unter den Absatz der Treppe, die zu der Wohnung im ersten Stock führte. Sie spähten hoch und sahen, dass auch die obere Tür nur angelehnt war.
Großmutter schloss diese Tür grundsätzlich nicht, angeblich weil sie sonst Beklemmungen bekam. Tante Anna jedoch sagte, Agnes sei mitnichten klaustrophobisch, sondern krankhaft misstrauisch.
Sie schlichen die Stufen hinauf, Bosse voran, mit einer Handbewegung bedeutete er ihr, möglichst in der Mitte zu bleiben, wo der dicke rote Treppenläufer lag, der das Knarren der Holzdielen einigermaßen schluckte. Oben angekommen, gab er der Tür einen winzigen Stups, sodass sie ein paar Zentimeter aufschwang. Der Flur empfing sie dunkel und leer, er roch nach den Lavendelsäckchen, die ihre Großmutter zwischen die Wäsche stopfte, und nach gekochten Kartoffeln. Es war sehr still.
Birte begann, auf dem Bauch zur Küche zu robben, darauf vertrauend, dass Bosse ihr folgte. Auch die Küchentür stand einen Spalt offen, sodass sie bequem hineinlinsen konnte. Der einzige Laut, den sie nun hörte, war das Ticken der alten goldenen Uhr auf dem schweren Küchenbuffet. Links davon, direkt vor dem Fenster, befand sich der runde Esstisch. Unter ihm stand ein brauner Koffer. Auf ihm lagen, umgekippt, zwei Wassergläser, eine Flasche unbekannten Inhalts mit merkwürdigen Schriftzeichen und ein Paar nackter Männerfüße.
Birte erstarrte. Das war unerhört. Erwachsene legten ihre Füße nicht auf den Tisch, niemals – und schon gar nicht bei Großmutter. Sie drehte sich zu Bosse um, der seinen Kopf schwer auf ihre Schulter gelegt hatte, um diese Sensation besser betrachten zu können. Er zeigte nach hinten auf den Ausgang. Birte schüttelte den Kopf. »Angsthase, Pfeffernase.« Dem würde sie mal zeigen, wie mutig sie war. Außerdem musste sie erst sehen, wer zu diesen Füßen gehörte, bevor ein Rückzug infrage kam.
Dann sah sie ihn, den Mann, der am Küchentisch saß, ihr halb den Rücken zukehrte und aus dem Fenster schaute. Er war vielleicht so alt wie Onkel Klaus oder auch jünger, sehr groß und hager und hatte schwarzes Haar, das ihm wild und ungekämmt ins Gesicht fiel. Seine Haut war dunkel von der Sonne, seine Wangenknochen hoch, die Nase groß und gebogen. Er trug merkwürdige Kleidung, ein kobaltblaues Hemd aus grobem Leinen, ohne Kragen und mit weißen Ornamenten bestickt, dazu eine braune, weite Hose aus einem noch derberen Stoff, der aussah, als ob er fürchterlich kratzte.
Das war keiner aus dem Viertel, so viel war klar. Das war noch nicht einmal einer aus Hamburg, dachte Birte. Der Mann sah verwegen aus, wie ein Zigeuner oder wie einer der Artisten aus einem Wanderzirkus, und passte so gut in Großmutters Küche wie ein Wolf in einen Schafstall.
Plötzlich drehte der Mann seinen Kopf und schoss aus der Küche, packte mit der einen Hand Birte am Kragen und mit der anderen Bosse. Vollkommen mühelos hielt er sie in die Luft und schüttelte sie ein wenig. Dabei lachte er, Birte konnte kurz sehen, dass ihm ein Schneidezahn fehlte, und sagte etwas in einer fremden Sprache.
»Was habt ihr Blagen hier zu suchen?« Großmutter stand hinter ihnen im Flur, angelockt von dem Mordsradau. »Euch werd ich Beine machen! Ihr wisst doch, dass ihr nicht …«
»Schsch …«, machte der Mann und setzte Birte und Bosse sacht auf dem Boden ab.
Und dann geschah das, was an diesem erstaunlichen Tag das Erstaunlichste war. Ihre Großmutter lächelte. »Na, wo ihr schon mal da seid, könnt ihr Gregor auch anständig Guten Tag sagen. Das haben euch eure Mütter hoffentlich beigebracht. Und mögt ihr ein Glas Zitronenlimonade?«
Birte und Bosse löcherten seine Eltern. Wer war dieser Gregor? Woher kam er? Wie lange blieb er? Und was wollte er bei Großmutter? »Besuch. Von früher«, war alles, was Onkel Klaus zu antworten bereit war.
Früher? Wie viel früher denn? Und was für ein Früher? »Gregor ist der Sohn von Bekannten, die Agnes kurz nach dem Krieg mal geholfen haben. Er ist auf der Durchreise und ruht sich hier nur ein wenig aus«, log Tante Anna ihnen unverfroren ins Gesicht.
Stundenlang hockten sie unter dem schattigen Kirschbaum auf der Wiese, und Birte erzählte Bosse im Flüsterton von dem Vorfall im Schuppen. »Den Bastard schlag ich tot.« Immer neue Geschichten sponnen sie um den geheimnisvollen Gregor. Birte war davon überzeugt, dass er ein verwunschener Kalif aus dem fernen Arabien war, auf der Suche nach einer entführten Haremsdame, die ihn um die halbe Welt führte.
Bosse fand zwar, dass ihre Theorie einiges für sich hatte – diese Kleidung, diese Sprache! Er glaubte jedoch, dass der Besuch ein amerikanischer Geheimagent war, der in direkter Linie von den Apachen abstammte – was erklärte, warum er barfuß lief. Hundertpro hatte Gregor den Auftrag, eine Geheimwaffe unschädlich zu machen, die die Menschheit vernichten konnte.
Auch wenn sie sich über Gregors Herkunft nicht einig werden konnten, stritten sie sich nicht darüber. Birte sah den Cousin auf einmal mit anderen Augen. Ihre Mutprobe hatte sie zusammengeschweißt, gemeinsam waren sie nur knapp dem Tod entronnen.
Außerdem wollten sie beide unbedingt mehr über den Besuch erfahren. Sie drückten sich in der Werkstatt herum, möglichst unauffällig, und belauschten die Erwachsenen, bis man sie hinausschmiss, immer dann, wenn es interessant wurde. Also hefteten sie sich an Gregors Fersen, sobald er das Haus verließ. Der entdeckte sie sofort, anscheinend war er im Besitz eines unsichtbaren Radargerätes, Bosse hatte vielleicht doch Recht.
Im Gegensatz zu den anderen, die sie verscheuchten wie lästige Fliegen, freute sich Gregor über ihre Gesellschaft. Er schien ein wenig einsam, außer Großmutter kümmerte sich keiner um ihn. Onkel Klaus begegnete dem Gast zwar mit ausgesuchter, aber ebenso kalter Höflichkeit; Onkel Karl sah bei Gregors Anblick so aus, als wolle er ihn gleich erschlagen, und stapfte, Zornesfalten auf der Stirn, davon.
Gregor sprach kaum Deutsch, wenigstens tat er so; wollten sie etwas von ihm wissen, lächelte er freundlich und zuckte mit den Schultern. Was ihm an Worten fehlte, machte er mit seinen Händen wett. Im Nu hatte er das morsche Schaukelgestell im Garten repariert; für Birte schnitzte er aus Ahornholz eine zierliche Flöte, die er ihr mit feierlicher Geste überreichte. Die Röte schoss ihr ins Gesicht, alles in allem, dachte sie, liefen die Ferien doch besser als angenommen.
Es braute sich etwas zusammen. An einem Dienstag hingen schwarze Gewitterwolken schwer am Himmel, im Radio sprachen sie von einem ausgewachsenen Unwetter. Birte und Bosse verzogen sich in die hinterste Ecke der Werkstatt und schauten den Männern bei der Arbeit zu. Die Luft war zum Schneiden. Onkel Karl fiel ein Marmorblock auf den Fuß, er hörte überhaupt nicht mehr auf zu fluchen und hüpfte wie das HB-Männchen auf und ab.
Die Tür zum Büro öffnete sich, und heraus kamen Gregor und Großmutter, mehrere eng beschriebene Zettel in der Hand. Onkel Karl hielt mit dem Fluchen inne, warf einen flüchtigen Blick auf die Papiere und pöbelte: »Das wagst du nicht …«
Agnes maß ihren Sohn mit einem eisigen Blick und entgegnete ruhig: »Karl, mäßige dich. Und vergiss nie, wem das hier alles gehört und wer es aufgebaut hat.«
Onkel Karl öffnete schon den Mund, um weiter zu brüllen, da trat Gregor hervor, machte »Schsch« und wollte ihm beruhigend die Hand auf den Arm legen. Das war zu viel.
»Du Drecksau, fass mich nicht an!«, schrie Onkel Karl und schwang die Fäuste. Bevor Onkel Klaus dazwischengehen konnte, war Gregor schon geschickt ausgewichen und hatte den Wütenden so in den Schwitzkasten genommen, dass der sich nicht mehr rühren konnte.
Großmutter blickte zu Birte und Bosse, die den Vorfall mit vor Schreck geweiteten Augen verfolgten, und herrschte sie an: »Raus mit euch. Aber dalli!«
Am Abend war das Gewitter anscheinend über die Stadt hinweggezogen, nur in der Ferne hörte man noch ein dumpfes Grollen. Mitten in der Nacht wurde Birte wach, weil es über ihr donnerte und rumpelte und krachte. Sie hörte Onkel Klaus’ Stimme, sie hörte Onkel Karls Brüllen, dazwischen ein Scheppern und Knirschen, das sie nicht einordnen konnte. Plötzlich stand Bosse im Zimmer. »Ich hab Angst. Das ist so laut. Kann ich bei dir schlafen?«
Birte nickte. Sie hielten einander im Arm und horchten in die Dunkelheit. Nun war es wieder still. Aber es war eine Stille, die sie noch lange am Einschlafen hinderte.
Die Stille hielt sich am nächsten Tag. Bosses Eltern und Onkel Karl redeten nicht miteinander, schweigend gingen sie ihren Verrichtungen nach. Birte lauschte, ob sie Gregors Schritte auf der Treppe hörte, sie suchte nach ihm auf der Wiese, im Schuppen, in der Werkstatt. Als Tante Anna mit Bosse zum Einkaufen ging, schwindelte sie, dass sie jetzt endlich ihr Buch zu Ende lesen müsse. Als die beiden weg waren, nahm sie all ihren Mut zusammen, stieg die Stufen hoch und klopfte an Großmutters Tür. Sie bekam keine Antwort.
Dennoch trat sie ein. Ein Stuhl lag zertrümmert auf dem Küchenboden, eine Tür des Buffets hing schief in ihren Angeln, das Linoleum war mit Scherben übersät. In der Ecke stand Gregors Koffer, aufgerissen, die Sachen verstreut.
Ihre Großmutter saß am Fenster und schaute reglos hinaus. Birte räusperte sich verlegen und fragte mit einer Stimme, die ihr selbst viel zu zittrig vorkam: »Wo ist denn Gregor?«
Agnes drehte sich um, über ihr Gesicht liefen Tränen. »Weg.«
Birte machte einen Schritt auf sie zu, doch ihre Großmutter hatte sich schon wieder dem Fenster zugewandt. »Geh jetzt«, sagte sie. »Und komm nicht mehr hoch.«
Birte rannte die Treppe hinunter und aus dem Haus hinaus, als wäre der Teufel hinter ihr her. »Den Bastard schlag ich tot.«
Später dachte sie oft, dass der Sommer von Anfang an unter keinen guten Vorzeichen gestanden hatte. Mamas Zustände. Gregors Besuch. Das Weinen ihrer Großmutter. Lauter Hinweise, lauter Omen. Sie hätte es merken müssen. Und dann hätte sie all das Fürchterliche, das in diesem Jahr noch geschehen sollte, abwenden können. Aber sie hatte nichts gemerkt.
GROSS HUBNICKEN, AUGUST 1935
»Nein, nein, nein!« Agnes stampfte mit dem Fuß auf. Am liebsten wäre sie aufgesprungen und hätte gegen die Frisierkommode getreten, vor der sie sitzend das Ziepen der Bürste ertrug, mit der ihre Mutter ihr ungeduldig durch die Haare fuhr.
»Ich werde nicht heiraten. Ich bin viel zu jung!«
»Kind, du bist achtzehn. Und Wilhelm ist ein guter Mann. Du wirst ein gutes Leben an seiner Seite haben.«
»Woher willst du das wissen, Mama? Du kennst ihn doch kaum.«
»Dein Vater hat es so entschieden. Und du wirst dich fügen.«
»Papa kennt ihn auch nicht. Und nur weil es in seine merkwürdigen Überlegungen passt, werde ich nicht mein Leben ruinieren!«
»Agnes, es reicht.« Ihre Mutter zog noch ein wenig mehr an ihren Haaren und begann behände, einen Zopf zu flechten, den sie sorgsam mit einem Seidenband schloss. »Gut, das sieht ordentlich aus«, sagte sie zufrieden, »komm jetzt, wir wollen die Herren nicht weiter warten lassen.«
Agnes stand widerwillig auf, strich sich ihr frisch gestärktes hellblaues Sommerkleid glatt und starrte wütend in den Ankleidespiegel. Wie sie aussah! Wie eine Landpomeranze. Ihre schwarzen Locken in diesen albernen Zopf gezwungen, das Kleid oben hochgeschlossen und unten sittsam weit unter den Knien endend. Immerhin betonte es ihre Taille. Aber Agnes hätte für diesen Anlass lieber ihren Hosenrock angezogen und dazu die cremefarbene Bluse. Doch dieses Ensemble hatte ihre Mutter als zu modern verworfen.
»Agnes, bitte komm!«
Sie streckte ihrem Spiegelbild die Zunge heraus und stapfte ihrer Mutter hinterher. Alle hatten sich gegen sie verschworen. Ihr Leben war tatsächlich ruiniert.
Zu Beginn des Sommers hatte dieses Leben noch funkelnd vor ihr gelegen. Gerade eben hatte sie ihr Abitur auf dem Oberlyzeum der Königin-Luise-Schule gemacht, gerade eben hatte sie bei einem Wettkampf des Akademischen Sportclubs Königsberg sowohl im Achtzig-Meter-Hürdenlauf als auch beim Speerwurf triumphiert. Gerade eben hatte ihr Vater in Aussicht gestellt, das alte Klavier durch einen echten Steinway zu ersetzen, wenn sie weiterhin so fleißig übte.
Agnes war durchaus bewusst, dass sie ein sorgenfreies Leben führte. Ihre Eltern waren nicht reich, nein, aber als leitender Ingenieur in der Staatlichen Bernsteinmanufaktur hatte ihr Vater es zu einigem Wohlstand gebracht. Und selbstverständlich, so sah es Agnes, las ihr Vater, ein ernster, aber auch nachgiebiger Mann, seinem einzigen Kind jeden Wunsch von den Augen ab.
Trotzdem war sie nicht traurig gewesen, als er entschied, dass die Familie dieses Jahr nicht in die Sommerfrische nach Rauschen fuhr. Königsberg bot genug Zerstreuung, zumal auch ihre beiden besten Freundinnen Gertrud und Hedwig in der Heimatstadt blieben. Im Neuen Schauspielhaus hatten sie Shakespeares Kaufmann von Venedig gesehen, sie hatten Tanzveranstaltungen auf der Klapperwiese besucht und sich von den Kerlen hofieren lassen. Tagsüber hatten sie träge am Strand gelegen und sich von den Avancen und Aufregungen der Nacht erholt. Und sie hatten Pläne für eine glänzende Zukunft geschmiedet.
Gertrud war fest entschlossen, demnächst reich zu heiraten.
»Aber warum hast du dich dann durchs Latinum und mit Algebra gequält?«, fragte Agnes. »Um zu heiraten, brauchst du kein Abitur.«
»Weil mein zukünftiger Mann Wert auf gepflegte Tischgespräche legen wird. Und weil ich an seiner Seite repräsentative Aufgaben übernehme. Dafür braucht es Bildung, meine Liebe«, hatte Gertrud geantwortet.
»Ach, hast du schon jemand Bestimmtes im Auge?«, wollte Agnes erstaunt wissen.
»Nein, nein, wo denkst du hin«, wich Gertrud aus, sprang auf und rannte kichernd ins Wasser.
Hedwigs weiterer Weg war vorgegeben. Sie sollte im Herbst die Handelshochschule besuchen und danach im Kontor ihres Vaters, eines Getreidehändlers, mithelfen – und vielleicht sogar, eines fernen Tages, aufgrund eines fehlenden männlichen Erbens das Geschäft übernehmen. Aber natürlich hoffte Hedwigs Vater darauf, dass die Tochter in absehbarer Zeit einen akzeptablen Schwiegersohn präsentierte, den er zum Nachfolger aufbauen konnte. Er war guter Dinge, dass Hedwig an der Handelshochschule einen derartigen Aspiranten kennenlernte, sonst hätte er sie kaum zum Studieren geschickt.
Hedwig war zufrieden mit ihren Aussichten, Agnes fand die Pläne unmöglich. »Und was ist mit deinem freien Willen?«, wollte sie von der Freundin wissen. »Vielleicht möchtest du die Welt bereisen?«
Die kleine, pausbäckige Hedwig stemmte ihre Hände in die Hüften. »Freier Wille, so ein Unsinn, Agnes. Und was soll ich denn in der Welt? Ich weiß, wo mein Platz ist.«
Heiraten! Im Kontor arbeiten! Agnes lachte Gertrud und Hedwig aus. Das waren Dinge, die für sie in ferner Zukunft lagen und nach erdrückender Verantwortung klangen. Doch manchmal beneidete sie ihre Freundinnen. Sie waren so sicher, so unerschütterlich in ihrem Glauben an das, was kommen sollte.
Agnes dagegen schwankte wie ein Fähnchen im Wind angesichts der Fülle an Möglichkeiten, die sich ihr bot. Sollte sie an die Kunstakademie gehen? Immerhin zeichnete sie sehr schön. Oder doch besser an die Albertina, um Philosophie zu studieren? Andererseits liebte sie die Literatur. Goethe, Schiller, Kleist, sie kannte alle Klassiker. Und kürzlich hatte sie atemlos unter der Bettdecke das verbotene Kunstseidene Mädchen von Irmgard Keun verschlungen und sich ins Berliner Lotterleben geträumt.
Mit ihrem Lotterleben sollte bald Schluss sein. »Agnes, du hast nur Flausen im Kopf«, hatte ihr Vater kürzlich beim Abendbrot festgestellt. »Aber die Zeiten sind nicht mehr nach Flausen.«
»Ach, Papa, was du nur immer mit deinen Zeiten hast!«, hatte Agnes gekichert. Sie wusste, dass ihr Vater der Regierung skeptisch gegenüberstand, bei Tisch hatte sie mit halbem Ohr die eine und andere Bemerkung aufgeschnappt. Sie fand, dass er übertrieb. Ja, ein paar Bücher waren verboten worden. Ja, es gab Aufmärsche in der Stadt. Ja, man sollte nicht mehr in jüdischen Geschäften einkaufen. Aber das waren doch auch Verbrecher, das konnte man allerorts lesen und hören. Und all das war doch eher nicht ernst zu nehmen oder gar bedrohlich. Das war eben Politik, eine sehr langweilige Angelegenheit.
»Wir ziehen um. In ein eigenes Haus.« Nervös hatte ihre Mutter die Hände bei dieser Eröffnung geknetet.
Agnes juchzte. Nicht, dass sie sich in der geräumigen Vier-Zimmer-Wohnung in der Gluckstraße nicht wohlfühlte. Aber ein eigenes Haus! »Wohin, Mama? Wohin genau? Hat es einen großen Garten? Habe ich ein eigenes Bad?«, bestürmte sie ihre Mutter mit Fragen und malte sich schon aus, dass es in Amalienau läge, einem der nobelsten Viertel der Stadt.
»Groß Hubnicken«, sagte ihre Mutter schlicht und seufzte.
»Wohin?« Agnes dachte, dass sie sich verhört hätte.
»Dein Vater hat eine neue Anstellung. Ein sehr verantwortungsvoller Posten mit großen Aufstiegsmöglichkeiten. Im Bernsteintagebau bei Palmnicken. Er wird direkt dem Werksdirektor unterstellt sein. Zu der Anstellung gehört auch das Haus im Nachbardorf. In drei Wochen ziehen wir um.«
»Dorf? Mama!«
»Kind, es ist wirklich sehr schön dort. Diese Natur! Und du gehst nur fünfzehn Minuten zur Ostsee, stell dir vor! Das Haus ist groß und hell, und du bekommst dein eigenes Bad, versprochen. Es wird dir gefallen, ganz bestimmt.« Ihre Mutter seufzte erneut.
Als sie wenige Tage nach dieser unglaublichen Ankündigung mit ihrer Mutter zu einer Stippvisite gen Groß Hubnicken aufbrach, wurden ihre Befürchtungen noch übertroffen. Mit dem Zug fuhren sie bis Fischhausen, dort mussten sie geraume Zeit warten, bis die nächste Eisenbahn sie nach Palmnicken brachte. Auf der Fahrt deutete ihre Mutter wiederholt aus dem Fenster und rief: »Schau doch mal!«
Doch Agnes hatte keine Augen für die Schönheiten der Landschaft, die sattgrünen Wälder, die winzigen Dörfer, das in der Sonne grüngolden schimmernde Haff. Sie sah lediglich, dass der Zug sie Kilometer um Kilometer von ihrem geliebten Königsberg in die tiefste Provinz entführte.
Am Bahnhof in Palmnicken wurden sie erwartet. Ein rotblonder Hüne, die kurzen Haare gescheitelt und mit Pomade in Form gebracht, schritt entschlossen auf sie zu. Sein Auftreten hatte etwas von einem Gutsherren, er trug hohe schwarze Reitstiefel zur engen Hose, unter den Hosenträgern blitzte das blütenweiße Hemd. Doch sein gewaltiges Kreuz, die breite Brust und die groben Hände verrieten, dass er schwere Arbeit gewohnt war.
Er knallte die Hacken zusammen, riss den rechten Arm in die Höhe und brüllte: »Heil Hitler!«
Agnes bemerkte, dass ihre Mutter unwillkürlich zusammenzuckte. Nun deutete der Riese eine Verbeugung an und fragte: »Frau und Fräulein Tharau nehme ich an, die Familie des Herrn Ingenieur?«
Sie nickten, und Agnes erwiderte kess: »Sie nehmen richtig an, außer uns ist ja weiter keiner ausgestiegen. Und mit wem haben wir das unerhörte Vergnügen?«
Ein kleines Lächeln stahl sich in das Gesicht des Mannes, er klappte sich erneut zu einem Diener zusammen. »Wilhelm Weisgut. Ihr Vater bat mich, Sie abzuholen. Und verzeihen Sie mir meine Frechheit, aber Sie sind noch schöner, als Ihr Herr Papa es angedeutet hat. Wenn Sie mir bitte folgen mögen.«
Auf dem Bahnhofsvorplatz wartete tatsächlich ein Pferdefuhrwerk auf sie. Agnes verdrehte die Augen, wie im vergangenen Jahrhundert. Wilhelm Weisgut reichte den Damen nacheinander seinen Arm, sie kletterten auf den Bock. Ihr Begleiter schnalzte mit der Zunge, und das Pferd setzte sich gemächlich in Bewegung.
Von Palmnicken fuhren sie etwa einen Kilometer durch einen dichten Wald, der sich plötzlich öffnete und den Blick frei gab auf Felder und eine schäbige Ansammlung kleiner Höfe.
»Ihr neues Zuhause«, sagte Wilhelm Weisgut mit einer großartigen Handbewegung.
Agnes merkte, wie ihr Blut vom Kopf in die Füße sackte. »Ist Ihnen nicht gut, Fräulein Tharau?«, fragte Wilhelm Weisgut. »Sie sehen auf einmal so blass aus.«
»Nein, nein«, stammelte sie. »Es ist nur so warm heute.«
Der Wagen rumpelte über das staubige Kopfsteinpflaster und hielt vor einem lang gestreckten, zweigeschossigen Haus aus rotem Backstein, das direkt hinter einem weißen Holzzaun an der Dorfstraße lag. Wilhelm Weisgut sprang vom Bock und betrachtete Agnes mit einer Mischung aus Besorgnis und Amüsement. »Nicht, dass uns das Fräulein Tharau gleich in Ohnmacht fällt. Möchten Sie sich für einen Augenblick in den Schatten setzen?«
»Es geht schon wieder«, sagte Agnes unwirsch, ignorierte seine helfend ausgestreckte Hand und warf nur ihrer Mutter einen bösen Blick zu. Das konnten ihre Eltern nicht ernst meinen – vom kapitalen Königsberg in dieses klägliche Kaff!
Entschieden, ohne die zornige Tochter weiter zu beachten, marschierte ihre Mutter auf das Haus zu, öffnete die große, weiß gestrichene Eingangstür und verschwand im Inneren.
Wilhelm Weisgut räusperte sich verlegen. »Nun, Sie möchten bestimmt in Ruhe Ihr zukünftiges Heim inspizieren. Wenn Sie Fragen haben oder meine Hilfe benötigen, kommen Sie einfach zu mir. Ich wohne nur zwei Häuser weiter.« Er deutete die Straße hinauf. »Wir werden also Nachbarn«, sagte er noch mit einem Augenzwinkern, nahm das Pferd am Halfter und schaute Agnes abwartend an.
»Danke«, sagte sie knapp und ging ihrer Mutter hinterher.
Das Haus war genau, wie ihre Mutter versprochen hatte – geräumig und hell, und wirklich gab es im oberen Stockwerk ein fantastisch großes Zimmer. »Das wird dein Reich«, sagte ihre Mutter, mied dabei aber Agnes’ Blick.
»Mama, unter keinen Umständen, unter gar keinen Umständen, ziehe ich mit euch hierher. Du glaubst doch nicht, dass …«
»Natürlich wirst du mitkommen«, sagte ihre Mutter sanft und ließ sie einfach stehen.
Agnes ging zum Fenster und schaute hinaus. Das Zimmer lag nach hinten heraus, unten konnte sie die Terrasse sehen, einen riesigen Garten mit alten Obstbäumen, der einen leicht verwahrlosten Eindruck machte und an den sich die Felder anschlossen. Sie zog die Schultern hoch wie ein trotziges Kind. Dann ging sie mit großem Getöse die geschwungene Holztreppe hinunter, setzte sich in der fast leeren Küche auf einen Stuhl, verschränkte die Arme und weigerte sich, die Mutter bei ihrem Rundgang zu begleiten.
Eine Stunde später steckte Wilhelm Weisgut seinen Kopf zur Tür herein. »Hier sind Sie! Ich habe Sie schon gesucht. Und wie gefallen Ihnen das Haus und die Umgebung? Idyllisch, nicht wahr?«
»Wenn man es dörflich mag«, antwortete Agnes spitz. »Ich bin aus Königsberg allerdings anderes gewohnt.«
Wilhelm Weisgut lachte unbekümmert, als hätte er ihren Unterton nicht wahrgenommen. »Ach, Sie werden sich schnell eingewöhnen. Und wenn Sie Abwechslung brauchen, dann fahren Sie einfach mit dem Rad nach Palmnicken. Dort gibt es Geschäfte, ein Café, alles, was Ihr Herz begehrt. Es wird mir ein Vergnügen sein, Ihnen die Umgebung zu zeigen, wenn Sie erst umgezogen sind. Nun kommen Sie aber, Ihr Zug geht in einer Stunde.«
Schweigend setzte sich Agnes neben ihre Mutter aufs Fuhrwerk, schweigend zockelten sie nach Palmnicken zurück. Nach einem kurzen Adieu von ihrem Fahrer – Wilhelm Weisgut schien etwas gekränkt, dass Agnes sich so schroff verabschiedete – verlief auch die Rückfahrt nach Königsberg schweigend. Zuhause in der Gluckstraße rannte Agnes in ihr Zimmer und schmiss die Tür hinter sich zu.
Sie kam erst wieder heraus, als sie hörte, wie ihr Vater am Abend die Wohnung betrat, und fiel ihm weinend um den Hals. »Papa«, schluchzte sie theatralisch, »es ist ganz fürchterlich dort. Eine vollkommene Einöde! Dort gibt es nichts, gar nichts. Nur Dreck und Vieh und ungehobelte Bauern! Auf keinen Fall können wir dorthin ziehen. Lieber sterbe ich!«
Ihr Vater fasste sie sacht an den Schultern und schob sie ein kleines Stück von sich. »Mein Liebes, so schlimm ist Groß Hubnicken nun wirklich nicht. Wenn du dich dort eingelebt hast, wirst du es sehr schön finden.«
Agnes bat und bettelte, sie trotzte und jammerte, und als alles nichts half, verlegte sie sich aufs Argumentieren. »Schau, Papa, ich kann bestimmt bei Hedwig unterkommen. Und ich suche mir eine Arbeit, ich verdiene mein eigenes Geld. Und jedes Wochenende besuche ich euch.«
Doch ihr Vater schüttelte nur müde, aber bestimmt den Kopf. »Ausgeschlossen, Agnes. Was willst du auch arbeiten? Du kommst mit uns. In diesen Zeiten muss die Familie zusammenbleiben.«
Vom vielen Weinen erschöpft, zog sich Agnes in ihr Zimmer zurück und mochte auch nicht zum Abendessen herauskommen. Sie hörte ihre Eltern in der Küche, das Klappern des Geschirrs, das Rücken der Stühle, die gedämpften Stimmen, die von Zeit zu Zeit anschwollen und wieder leiser wurden. Stritten sich ihre Eltern? Sie huschte durch den Flur und presste ihr Ohr an die schwere Küchentür, verstand aber nur Satzfetzen, die für sie keinen Sinn ergaben.
»Die richtige Entscheidung.« – »Aus der Schusslinie gehen.« – »In Sicherheit.«
Und dann hörte sie unterdrückte Schluchzer. Weinte ihre Mutter? Das geschah ihr Recht, dachte Agnes.
Nur zwei Wochen später fand der Umzug statt. Arbeiter rückten an und verluden das Tharausche Hab und Gut auf Lastwagen. Agnes kam auch an diesem durchaus aufregenden Tag nicht aus ihrem Schmollwinkel heraus, in dem sie seit ihrem Besuch in Groß Hubnicken saß. Irgendwie hoffte sie immer noch, dass die Nichtbeachtung, mit der sie insbesondere ihren Vater strafte, etwas bewirken könne. Doch ihr Vater ignorierte sie mit einer Unnachgiebigkeit, die Agnes ihm nicht zugetraut hatte. Und ihre Mutter ging geschäftig in der Angelegenheit des Räumens und Packens auf, nur ihre dunklen Augenringe und ihre plötzliche Blässe verrieten, dass auch sie der Ortswechsel mehr beschäftigte, als sie zugab.
Voller Empörung hatte Agnes ihren Freundinnen von der Entscheidung der Eltern erzählt. Hedwig konnte Agnes’ Zorn nicht nachvollziehen. »Du bist schließlich noch nicht volljährig«, sagte sie. »Du musst mit deinen Eltern gehen. Was willst du auch allein in Königsberg?«
»Aber was soll ich in Groß Hubnicken?«, jammerte Agnes.
»Das wird sich finden«, meinte Hedwig lapidar.
Gertrud dagegen erging sich in idiotischen Schwärmereien. »Wart’s nur ab! In null Komma nichts hast du dort einen Baron kennengelernt oder vielleicht sogar einen Grafen! In den verliebst du dich, ihr heiratet, du ziehst auf sein Gestüt und züchtest Trakehner.«
In Groß Hubnicken warteten mitnichten Barone oder Grafen. Dafür wartete Wilhelm Weisgut mit seinem alten Klepper. Schon beim Einzug machte er sich unentbehrlich, scheuchte die Arbeiter im neuen Haus treppauf und treppab, war sich aber nicht zu schade, selbst mit anzupacken. Insbesondere Agnes’ Habseligkeiten widmete er sich höchstpersönlich, schulterte ihre Frisierkommode, als wäre sie eine Feder, rückte ihre Möbel hin und rückte sie her, unablässig fragend: »Fräulein Tharau, ist es gut so? Oder doch lieber ein Stück weiter nach links?«
Eigentlich hatte Agnes beschlossen, auch und gerade an diesem Tag, der immerhin das Ende ihres Lebens markierte, mit niemandem ein Wort zu wechseln. Angesichts von Wilhelm Weisguts unbedingtem Willen, ihr zu gefallen, besserte sich ihre Laune jedoch, und sie ließ sich sogar dazu herab, gemeinsam mit ihren Eltern am Abendbrottisch Platz zu nehmen. »Was macht dieser Wilhelm Weisgut eigentlich?«, wollte sie wissen. »Ist er auch im Tagebau beschäftigt?«