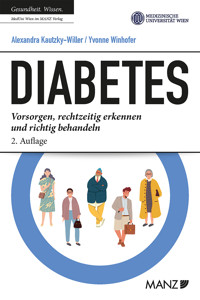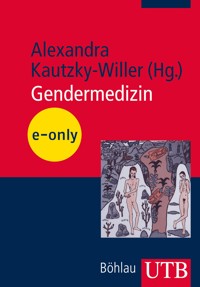Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Orac
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Warum Männer-Medizin für Frauen nicht taugt: Bei Frauen zerbröseln die Knochen, bei Männern versagt das Herz, sagt das Klischee. Wie es sich wirklich verhält, steht in diesem Buch. In der Medizin wurde jahrhundertelang so getan, als gäbe es nur ein Geschlecht, das männliche. Außer in der Gynäkologie und Geburtshilfe wurde kein Unterschied gemacht, ob der zu behandelnde Mensch männlich oder weiblich war. Kein Wunder, dass Herzinfarkte bei Frauen deshalb oft unerkannt blieben, denn die Symptome sind anders als bei Männern. Männer sterben dreimal so häufig an Lungenkrebs und begehen dreimal so oft Selbstmord wie Frauen. Sogar die Säuglingssterblichkeit ist bei männlichen Babys höher als bei weiblichen. Frauen leben zwar länger, erleben aber weniger Lebensjahre gesund: Zeit für eine geschlechtsspezifische Medizin. Alexandra Kautzky-Willer, international renommierte Professorin für Gender Medicine an der Universität Wien, und Wissenschaftsjournalistin Elisabeth Tschachler zeigen in diesem spannend geschriebenen Sachbuch, warum es wichtig ist, dass die Medizin einen Unterschied macht zwischen Mann und Frau.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexandra Kautzky-Willer • Elisabeth Tschachler
Gesundheit: Eine Frage des Geschlechts
Alexandra Kautzky-Willer Elisabeth Tschachler
Gesundheit: Eine Frage des Geschlechts
Die weibliche und die männliche Seite der Medizin
www.kremayr-scheriau.at
ISBN 978-3-7015-0545-6 Copyright © 2012 by Verlag Kremayr & Scheriau KG, Wien Alle Rechte vorbehalten Schutzumschlaggestaltung: Kurt Hamtil, Wien Illustration auf dem Schutzumschlag: iStockphoto.com/bubaone Typografische Gestaltung: Kurt Hamtil, Wien Datenkonvertierung E-Book: Nakadake, Wien
Inhalt
Ungleich besser
Die Sache mit den Genen
Von Autos und Puppen
Zähe Frauen, waghalsige Männer
Der Kämpfer und die Kümmerin
Die Seele, ein weites Land
Auf Herz und Nieren
Im Kampf gegen Krebs
Kaum erforscht – gleich behandelt
Danksagung
Literatur und Anmerkungen
Ungleich besser
„Wir werden nicht als Frauen geboren – wir werden dazu gemacht“, sagte die französische Philosophin Simone de Beauvoir vor mehr als 60 Jahren. Aus den Emanzipationsbestrebungen der Frauen entwickelte sich die Frauengesundheitsforschung und schließlich die Erkenntnis, dass Frauen und Männer eine geschlechtsspezifische Medizin brauchen.
Gleichstellung. Das ist seit langem das Zauberwort in Politik und Gesellschaft. Denn der „kleine Unterschied“ war es, der lange Zeit als Hauptgrund dafür herhalten musste, dass Frauen und Männern unterschiedliche Rollen in der Gesellschaft zugeteilt wurden. Vor mehr als 100 Jahren begannen die Frauen, organisiert gegen die Diskriminierung anzukämpfen, die auf diesem Unterschied gründet. Sie wehrten sich dagegen, dass sie aufgrund ihrer biologischen Ausstattung das schwache und deshalb untergeordnete Geschlecht sein sollten, das „andere Geschlecht“, wie die französische Feministin und Philosophin Simone de Beauvoir in ihrem 1949 erschienenen gleichnamigen Buch es nannte. Und sie wehrten sich dagegen, dass aufgrund ihrer biologischen Ausstattung fragwürdige Schlüsse auf ihre „Natur“, ihren Charakter, ihr Wesen und ihre Leistungsfähigkeit gezogen wurden. Ende des 19. Jahrhunderts sprach der deutsche Arzt Rudolf Virchow von der „Dependenz der Eierstöcke“, die den Frauen die Energie nähmen, weshalb er es kategorisch ablehnte, dass Frauen zum Medizinstudium zugelassen würden. 1900 veröffentlichte der Neurologe Paul Julius Möbius sein Pamphlet „Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes“, in dem er in dieselbe Kerbe schlug.
In zwei Anläufen konnte die Frauenbewegung im 20. Jahrhundert einiges an der Einstellung ändern, dass Frauen Männern unterlegen seien. Doch die Gleichstellungsdebatte ist in die Jahre gekommen und schwerfällig geworden. Immer noch wird um gleichen Lohn für gleiche Arbeit gestritten und immer noch darum, dass die männlichen Partner doch endlich die Hälfte des Haushalts übernehmen, wenn schon die Frauen nach wie vor um die Hälfte der Welt kämpfen müssen. Wendungen wie „gläserne Decke“ und „Beruf und Familie unter einen Hut bringen“ kann schon niemand mehr hören, obzwar beides Tatsachen sind, die Frauen weiterhin daran hindern, es den Männern gleichzutun. Die Erfolge der Emanzipation sind zaghaft, die Frauen jeder Generation wollen etwas anders, besser machen als ihre Mütter, und fangen doch wieder von vorne an.
Den Feministinnen der 1960er und 1970er Jahre ging es aber nicht nur darum, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebensumstände der Frauen zu ändern. Sie richteten ihren Blick auch auf die Gesundheit der Frauen und verlangten die Selbstbestimmung über ihren Körper. Jahrhundertelang war die Medizin männlich geprägt gewesen. Sogar die Schwangerenbetreuung und Geburtshilfe, seit alters eine Domäne der „weisen Frauen“ – Hebammen –, rissen männliche Mediziner ab dem 14. Jahrhundert weitgehend an sich. Bis heute ist, so erstaunlich es klingt, in unseren Breiten die Frauenheilkunde von Männern dominiert: Es gibt bedeutend mehr Gynäkologen als Gynäkologinnen.
Gesundheit, erforscht
Im Jahr 1969 trafen sich im US-amerikanischen Boston Woche für Woche zwölf Frauen, die einander auf einer Emanzipationsveranstaltung kennengelernt hatten. Sie sprachen über ihren Körper, ihre Gesundheit und ihre Erfahrungen, die sie mit Ärzten gemacht hatten und immer wieder machten. Ihnen gemeinsam war, dass sie sich vom männerdominierten Medizinsystem entmündigt fühlten, aber wie die meisten Menschen selbst nicht über genügend Wissen verfügten, um sich in Gesundheitsfragen zu emanzipieren. Das wollten sie ändern.
Bereits ein Jahr später veröffentlichten die zwölf Frauen die erste Ausgabe eines Buches, das sich seither von einem dünnen Bändchen zur fast tausendseitigen Bibel unter den Frauengesundheitsbüchern in Amerika und zahlreichen anderen Ländern gemausert hat: „Our Bodies, Ourselves“ (deutsch: „Unser Körper – Unser Leben“1). Das Boston Women’s Health Book Collective, so nennt sich die Gruppe aus Journalistinnen, Soziologinnen und Anthropologinnen seit damals, ist von einer kleinen, engagierten Truppe, die sich am Küchentisch zusammenfand, zu einer Institution in Sachen Frauengesundheit geworden. Ihr Anliegen ist es, Frauen gesicherte (im Fachjargon: „evidenzbasierte“) Informationen über sämtliche Themen der Frauengesundheit – von Ernährung bis Wechseljahre, von Geburtsvorbereitung bis Abtreibung – und weiblichen Sexualität zu liefern, aber auch alternative Versorgungsangebote und Zufluchtsstätten für Gewaltopfer zu schaffen.
Sex und Gender
Der US-amerikanische Psychiater und Sexualforscher John Money war einer der Ersten, der sich in den 1950er Jahren wissenschaftlich mit Geschlechtsidentität beschäftigte. Er benutzte auch als einer der Ersten das Wort „gender“, das im Englischen ursprünglich das grammatikalische Geschlecht bezeichnete, im Zusammenhang mit den Rollenmustern, d.h. mit dem sozialen Geschlecht, den Verhaltensweisen, die durch die Umwelt und die Erfahrungen geprägt und erlernt, gelebt und weitergegeben werden.2 Kurz zuvor hatte Simone de Beauvoir es so ausgedrückt, dass man nicht als Frau geboren, sondern dazu gemacht werde. Im Unterschied zu diesen als weiblich – und männlich – definierten Rollen bezeichnet „sex“ im Englischen das biologische Geschlecht, das durch Chromosomen, innere und äußere Geschlechtsorgane und Hormone bestimmt und angeboren ist. Im deutschen Wortschatz gibt es eine Unterscheidung zwischen „gender“ und „sex“ nicht, hier ist von „sozialem“ und „biologischem“ Geschlecht die Rede. Das englische „gender“ für die erworbene Geschlechtsidentität hält aber nach und nach Einzug in den allgemeinen deutschen Sprachgebrauch. Allerdings wird es oft in falschem Zusammenhang verwendet, und selbst bei Fachleuten ist nicht immer klar, ob sie nun das biologische oder das soziale Geschlecht eines Menschen meinen, wenn sie von Gender sprechen. Und tatsächlich beeinflusst das eine das andere, was eine Unterscheidung zuweilen schwierig macht.
„Gender Mainstreaming“ ist ein Konzept, das darauf abzielt, die Unterschiede, die aufgrund gesellschaftlicher Konventionen bestehen, abzubauen. Gender Mainstreaming – Gleichstellungspolitik und die Berücksichtigung der Geschlechter – ist leise, aber doch mit einiger Wirkung bis in die Regierungsprogramme vorgedrungen und zu einem allgemeinen Bildungsanliegen geworden. In jedem Unternehmen, das etwas auf sich hält, gibt es Gleichbehandlungsbeauftragte, und mit dem Binnen-I ist die Geschlechtersensibilität auch in der Sprache angekommen. „Sprache beeinflusst unser Denken“, gibt die Leiterin des Wiener Frauengesundheitsprogamms Beate Wimmer-Puchinger als Grund für die gendergerechte Sprache an. Die Klinische und Gesundheitspsychologin war in Österreich eine Pionierin der Frauengesundheit und löste schon mit ihren ersten Forschungsarbeiten in den 1970er Jahren heftige Diskussionen aus. „Es macht einen Unterschied aus. Für mich ist das nicht banal und trivial, für mich drückt es etwas aus: Es heißt, das Geschlecht mitzudenken, die Frau mitzudenken.“3
Ähnliche Frauengesundheitszentren sind inzwischen auch in Deutschland und Österreich entstanden, und sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur die gesundheitliche Lage von Frauen zu verbessern, sondern auch Forschung zu betreiben.
Gesundheit, männlich und weiblich
Im Licht der Erkenntnisse der Frauengesundheitsforschung begann auch die Weltgesundheitsorganisation WHO in den 1980er Jahren, sich mit den in der Medizin wichtigen Unterschieden zwischen Mann und Frau abseits der Geschlechtsorgane zu beschäftigen. Allerdings brauchte es 16 Jahre bis zur Einrichtung eines eigenen Departments for Gender, Women and Health der WHO. Und es dauerte noch bis 2001, bis die WHO empfahl, in allen Belangen des Gesundheitswesens lokale Strategien für eine geschlechtergerechte Gesundheitsversorgung zu entwickeln und umzusetzen.
Eine der Vorkämpferinnen und bis heute führenden Expertinnen auf dem Gebiet der geschlechtsspezifischen Medizin ist die US-amerikanische Kardiologin und Medizinwissenschaftlerin Marianne Legato. Schon Ende der 1980er Jahre hatte sie sich mit Herzkrankheiten bei Frauen beschäftigt und war immer öfter auf Besonderheiten im Vergleich zu Männern mit denselben Erkrankungen gestoßen. Immer mehr Fälle entdeckte sie, in denen Frauen nicht nur falsch diagnostiziert, sondern auch falsch behandelt worden waren. „Es schockierte mich, als ich erfahren musste, wie viele Frauen vom Arzt mit der (Fehl-)Diagnose ‚Angstattacke‘ oder ‚hysterischer Anfall‘ wieder weggeschickt wurden, obwohl sie mit ernsten Anzeichen eines Herzinfarkts zur Untersuchung gekommen waren“, schreibt sie in ihrem Buch „Evas Rippe“4. Dieser Schock war sozusagen die Initialzündung für die New Yorker Medizinerin, sich fortan der „Gender-Medizin“ zu widmen.
Die Bezeichnung „Gender-Medizin“ führt ein wenig in die Irre. Zu Anfang ging es diesem neuen Forschungszweig hauptsächlich darum, die Unterschiede in der Gesundheitsversorgung und Behandlung von Männern und Frauen zu beseitigen, die aufgrund von gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Einflüssen entstehen. Denn auch erlernte und von der Gesellschaft erwartete Verhaltensweisen beeinflussen die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden oder gesund zu bleiben. So haben beispielsweise mehrere Forschungsergebnisse gezeigt, dass sich die Ehe positiv auf die Gesundheit auswirkt. Allerdings nur auf die der Männer. Die leben, wenn sie verheiratet sind, zwei Jahre länger als ihre Single-Geschlechtsgenossen. Frauen kostet der Ehestand jedoch eineinhalb Lebensjahre. Für Stefan Felder, Professor für Gesundheitsökonomik an der Universität Duisburg-Essen, der die Daten von 100.000 Schweizern und Schweizerinnen ausgewertet hat5, hat das hauptsächlich finanzielle Gründe: Die Gesundheit des Mannes koste das Paar mehr als die Gesundheit der Frau, sagt er. Männer leiden beispielsweise früher und häufiger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dann brauchen sie nicht nur ärztliche Betreuung, sondern auch Pflege. Die bekommen sie von ihren Ehefrauen. „Die Frauen opfern ihre Gesundheit für ihre Männer“, resümiert Felder.
Frauen leben zwar insgesamt gesundheitsbewusster als Männer, reagieren eher auf Körpersignale und kümmern sich zudem nicht nur um das gesundheitliche Wohlbefinden ihrer Partner, sondern auch um das der anderen Familienmitglieder. Allerdings werden ihre Gesundheitsprobleme weniger ernst genommen, wenn sie medizinische Hilfe suchen.6 Mit ein Grund, warum beispielsweise Herzprobleme bei ihnen oft als „psychosomatisch“ fehlgedeutet werden. All diese Faktoren des sozialen Geschlechts haben also Einfluss auf den Gesundheitszustand.
Die Gender-Medizin nimmt aber nicht nur Rücksicht auf die gesellschaftlichen, ökologischen und vor allem ökonomischen Arbeits- und Lebensbedingungen, die ebenfalls einen großen Einfluss auf den Gesundheitszustand haben.
Die Gender-Medizin widmet sich verstärkt auch den unterschiedlichen Symptomen und Ausprägungen ein- und derselben Krankheit bzw. den unterschiedlichen Krankheiten bei Mann und Frau, die durch die unterschiedliche genetische und biologische Ausstattung – Hormone, Erbanlagen, Anatomie, Stoffwechselvorgänge – begründet sind. An die 30.000 wissenschaftliche Artikel mit dem Stichwort „Gender medicine“ zählte die medizinische Datenbank PubMed im Frühjahr 2011. Vor allem in den Fachgebieten, die sich mit Hormonen (in der Medizinersprache: „Endokrinologie“) und Stoffwechsel („Metabolismus“) beschäftigen, macht die Gender-Medizin enorme Fortschritte.7 Diese Erkenntnisse sind gerade bei jenen Erkrankungen, die immer häufiger diagnostiziert werden – beispielsweise sogenannte Lebensstil-Erkrankungen wie solche des Herz-Kreislauf-Systems, aber auch psychiatrische Störungen wie Depressionen, enorm wichtig.
Freilich lassen sich biologische und psychosoziale Ursachen von Gesundheitsproblemen nicht immer klar voneinander trennen, manchmal beeinflussen oder bedingen sie einander. Mit ein Grund, warum aus dem Bereich der Gender-Medizin fast täglich neue Erkenntnisse kommen.
Bekannt ist bisher unter anderem:
Die bis in die 1990er Jahre aufrechte Ansicht, dass Frauen vor einer koronaren Herzgefäßerkrankung (in der Fachsprache zu „KHK“ abgekürzt) geschützt sind, ist ein Mythos.
Das Risiko von Frauen, an Alzheimer zu erkranken, ist höher als das der Männer.
Frauen neigen während ihrer Menstruation vermehrt zu Schleimhauterkrankungen im Magen-Darm-Trakt und Asthmaanfälle häufen sich kurz vor der Periode.
Frauen weisen vier- bis zehnfach häufiger als Männer Schilddrüsenfunktionsstörungen auf.
Frauen sind zwei- bis viermal so häufig von rheumatischen und anderen Autoimmunerkrankungen betroffen.
Blasenkrebs ist bei Frauen seltener, dafür aber oft aggressiver als bei Männern.
Der Gender-Aspekt betrifft jedoch nicht nur Frauen, sondern beide Geschlechter, und so widmet sich die Gender-Medizin auch der Männergesundheit. Denn auch Männer sind einerseits von ihrer Biologie geprägt und verhalten sich andererseits entsprechend ihrer gesellschaftlichen Rolle. Seit Generationen gilt die Frau als das schwache, der Mann als das starke Geschlecht. Doch die vermeintlich kraftstrotzenden Männer sind alles andere als nachahmenswert in ihrem Gesundheitsverhalten. Im Gegenteil: Sie nehmen seltener an Vorsorgeuntersuchungen teil, und ihre im Vergleich zu Frauen um rund sechs Jahre kürzere Lebenserwartung ist nur zu einem ganz geringen Teil in der biologischen und genetischen Ausstattung begründet. Männer sind öfter Opfer von Verkehrsunfällen, weil sie Schnellfahren als Beweis von Männlichkeit sehen; sie trinken mehr Alkohol und rauchen öfter und mehr als Frauen – mit den entsprechenden Folgen für ihre Gesundheit. Männer leben aber nicht nur in ihrer Freizeit, sondern auch in der Arbeitswelt gefährlicher: Rund 90 Prozent der tödlichen Arbeitsunfälle haben Männer zum Opfer. Auch sind Männer, das zeigen viele Statistiken und Studien, an einer gesunden Lebensführung und an ihrer eigenen Gesundheit weit weniger interessiert als Frauen.
Aber auch Besonderheiten, die größtenteils auf biologische Gegebenheiten zurückzuführen sind, werden nach und nach deutlich:
So betrifft der plötzliche Herztod unter Sportlern fast ausschließlich Männer.
Wesentlich mehr Männer als Frauen erkranken an Leukämie.
8
Bei Männern entstehen Darmpolypen – mögliche Vorläufer von Darmkrebs – bedeutend früher als bei Frauen.
Mehr Männer als Frauen sterben an Infektionserkrankungen.
Auf solche geschlechtsspezifische Gesundheitsprobleme von Männern wurde bisher kaum eingegangen. Denn trotz ihrer Männerzentrierung ist die Medizin auf einigen Gebieten regelrecht geschlechterblind, das zeigt ein weiterer Blick in die medizinische Datenbank PubMed. Dort sind mehr als 30.000 Fachartikel mit dem Stichwort „Women’s Health“ gelistet. Mit dem Stichwort „Men’s Health“ gibt es bloß rund 3000, also ein Zehntel davon.9 Nach wie vor existieren wenige Einrichtungen, die speziell für Männer bestimmt sind, sieht man von urologischen Abteilungen und Fachpraxen ab, wo es hauptsächlich um Potenzschwierigkeiten geht. Deshalb gibt es seit einigen Jahren auch Forschungsschwerpunkte auf dem Gebiet der Männergesundheit, und die Gender-Medizin rückt vermehrt auch den Mann in ihren Fokus.
Pillen für Männer
Wenn neue Wirkstoffe auf ihre Wirkung und Sicherheit geprüft werden, geschieht das in großangelegten klinischen Tests mit vielen Hunderten Patienten. Bis vor Kurzem stand der Mann – und hier wiederum vor allem der rund 30-jährige, weiße Mann – bei solchen Arzneimittelstudien im Mittelpunkt, selbst wenn es um Mittel ging, die später auch Frauen helfen sollten. Der Grund dafür ist ebenso simpel wie unlogisch: Seitdem das Schlafmittel Contergan Anfang der 1960er Jahre bei Ungeborenen zu gravierenden Fehlbildungen geführt hat, befürchtet die Pharmaindustrie, dass Kinder geschädigt werden könnten, wenn eine Probandin während einer Medikamentenstudie ungewollt schwanger wird. Das bedeutet, dass bei vielen auf dem Markt befindlichen Arzneimitteln gar nicht bekannt ist, ob sie für Ungeborene potenziell schädlich sind und ob sie bei Frauen überhaupt anders wirken als bei Männern.
In der ersten großen Vergleichsstudie zum Thema Arzneimittelforschung an Frauen im Jahr 2001 stellte sich heraus, dass nur in einem Viertel der 442 in den vorangegangenen Jahren veröffentlichten Studien überhaupt Frauen miteinbezogen waren. Und inwieweit Frauen anders auf das Medikament reagierten als Männer, wurde gar nur in 14 Prozent dieses Viertels untersucht.10 Dass eine solche einseitige Forschung Folgen hat, bedarf keiner weiteren Erläuterung. So hat sich erst in der Praxis herausgestellt, dass verschiedene Antibiotika bei Frauen eher Herzrhythmusstörungen auslösen als bei Männern; oder dass Frauen schon auf eine geringere Dosis von Beruhigungsmitteln ansprechen als Männer – unabhängig von ihrem geringeren Körpergewicht.
Langsam ist hier jedoch eine Änderung im Gange. Sowohl auf EU-Ebene als auch von den Wissenschaftsministerien in Deutschland und Österreich wurden Richtlinien erarbeitet, die vorschreiben, dass der Gender-Aspekt in Forschungsvorhaben zu berücksichtigen ist: auch das ein Bereich der Gender-Medizin.
Wer geschlechtsspezifische Unterschiede zu seinem Forschungsgegenstand macht, gerät schnell in die Diskussion um politische Korrektheit. Und ebenso schnell kommt der Vorwurf, allein schon die Suche nach solchen Unterschieden beweise eine sexistische Haltung und zementiere gewisse Vorurteile ein, die die jahrhundertelange Diskriminierung der Frauen beförderte. Das Gegenteil ist der Fall. In der Gender-Medizin geht es darum, den Unterschieden auf den Grund zu gehen, um sie in der Vorsorge, dem Erkennen und Behandeln von Krankheiten zu berücksichtigen und damit Frauen wie Männern ein gesünderes Leben zu ermöglichen.
Die Sache mit den Genen
Wann ist ein Mann ein Mann? Und eine Frau eine Frau? Vielleicht gibt es nicht nur zwei Geschlechter, sondern unendlich viele, sagen Genetikerinnen und Genetiker. Und ist das, was in den Genen steht, wirklich unabänderlich?
Eigentlich war Nettie Stevens Lehrerin, viele andere Berufsaussichten gab es im ausgehenden 19. Jahrhundert für Frauen nicht. Doch die Biologie faszinierte sie so sehr, dass sie ans College zurückkehrte und schließlich an der Stanford University ihren Doktor in Zytologie machte, der Lehre von den Zellen. Die Chromosomen interessierten Nettie Stevens am meisten, die Träger der Erbsubstanz im Zellkern, die Mitte der 1850er Jahre entdeckt worden waren. 1905 fiel ihr ein bedeutender Unterschied auf: Der Chromosomensatz des weiblichen Mehlwurms sah anders aus als der des männlichen. Und da es in der Wissenschaft vom Mehlwurm zum Menschen oft nur ein kleiner Sprung ist, war die Annahme, dass auch beim Menschen der Geschlechtsunterschied auf einem Chromosom sitzt, nicht weit – und nicht falsch.
Aus 23 im Kern (fast) jeder Zelle gelegenen Chromosomenpaaren besteht die Erbsubstanz des Menschen, auf denen die Gene sitzen. 22 Paare davon setzen sich aus jeweils gleichen Chromosomen zusammen. Das hat den Vorteil, dass bei einem beeinträchtigten Gen auf einem Chromosom sozusagen sein Pendant auf dem zweiten Chromosom einspringen kann. Das letzte Paar bestimmt das Geschlecht. Bei Frauen sind die beiden Geschlechtschromosomen ebenfalls gleich, sie werden als X-Chromosomen bezeichnet. Bei Männern sind sie verschieden: ein X- und ein wesentlich kleineres Y-Chromosom. Ausnahmen sind Eizellen und Samenzellen. Sie enthalten jeweils nur einen einfachen Chromosomensatz.
Erst 1990 wurde klar, was den kleinen Unterschied tatsächlich ausmacht: Der britische Genetiker Peter Goodfellow entdeckte ein Gen, dem er das Kürzel SRY verpasste (für Sex determining Region Y – geschlechtsbestimmende Region Y).11 Es liegt, wie der Name vermuten lässt, auf dem Y-Chromosom und enthält den Bauplan für einen Eiweißstoff, der so etwas wie ein Signalgeber ist. In den ersten Wochen sind weibliche und männliche Embryonen abgesehen von ihren Geschlechtschromosomen völlig gleich. Ungefähr in der siebenten Entwicklungswoche des Embryos wird das SRY-Gen angeschaltet, und es setzt eine ganze Kaskade von molekularen Signalen in Gang, die die weitere Entwicklung vorantreiben: Hoden bilden sich, in denen das Geschlechtshormon Testosteron produziert wird, das wiederum in verschiedenen Zellen des Körpers und des Gehirns wirkt. Existiert das SRY-Gen nicht – also bei Mädchen –, bildet der Organismus weibliche Geschlechtsmerkmale und das Hormon Östradiol. Allerdings sind die Geschlechtshormone nicht ausschließlich männlich bzw. weiblich. Bei Frauen und Männern zirkulieren sowohl Testosteron als auch Östradiol im Blut, bloß in unterschiedlicher Menge, da das meiste Testosteron in den Hoden und das meiste Östradiol in den Eierstöcken produziert wird.
Natur oder Kultur?
„Bei dem, was wir das biologische Geschlecht nennen, ist die Genetik extrem relevant“, sagt der Humangenetiker Markus Hengstschläger, Leiter des Instituts für Medizinische Genetik der Medizinischen Universität Wien.12 „Menschen mit den Geschlechtschromosomen XX sind weiblich, jene mit XY sind männlich.“ Doch ganz so einfach ist die Sache nicht: „Wir wissen, dass es Menschen gibt, die, obwohl sie biologisch einem Geschlecht zugehörig sind, trotzdem dieses tiefe innere Gefühl haben, dem anderen Geschlecht anzugehören. Man nennt das Transsexualität.“
Transsexualität ist für die Gender-Frage deshalb so interessant, weil daraus zwei Theorien ableitbar sind. „Die eine ist, dass die Gene, also der Chromosomensatz allein, das Geschlecht doch nicht so hundertprozentig bestimmen“, sagt Hengstschläger. Denn wenn es Menschen gibt, die zwar genetisch weiblich sind, aber doch das Gefühl haben, ein Mann zu sein – und umgekehrt –, dann muss es auch andere Faktoren geben, die zumindest dieses Gefühl steuern. Die zweite Theorie erinnert laut Hengstschläger an den Witz, in dem sich zwei Freunde in der Nacht treffen, der eine sucht seinen Schlüssel unter einer Laterne. Der andere sagt: „Du hast aber Glück, dass du in der Nacht deinen Schlüssel gerade unter einer Laterne verloren hast.“ Sagt der erste: „Hab ich gar nicht, der muss irgendwo dort drüben liegen.“ Sagt der zweite: „Warum suchst du dann hier?“ Antwort: „Weil hier Licht ist.“ Genauso verhält es sich möglicherweise mit der Transsexualität: „Sie ist vielleicht genetisch mitbestimmt, aber wir wissen noch nicht, welches Gen da eine Rolle spielt, weil wir vielleicht an der falschen Stelle suchen“, meint Genetiker Hengstschläger. Eine familiäre Häufung von Transsexualität, die auf eine vererbbare Anlage schließen lassen könnte, wurde bisher jedenfalls noch nicht gefunden.
Zur Frage, wie die Geschlechtsidentität entsteht, gibt es jedoch auch noch andere Beobachtungen. Etwa den Fall, den der amerikanische Psychiater und Sexualforscher John Money eigentlich als Beweis seiner These der Umweltprägung sehen wollte. Im entschiedenen Gegensatz zu den radikalen Erblehren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war Money von der Ansicht ausgegangen, dass Sexualverhalten und männliche und weibliche Rollenorientierung einzig und allein anerzogen sind. Er vertrat die Meinung, dass das Kleinkind im zweiten Lebensjahr seine äußeren Geschlechtsorgane entdeckt und anfängt, andere Menschen, die genauso aussehen wie es selbst, nachzuahmen und in diesem Verhalten auch von seiner Umwelt bestärkt wird. Dieser Theorie folgend, empfahl Money den Eltern des kleinen Bruce, dessen Penis 1965 durch einen Kunstfehler bei einer Beschneidung verstümmelt worden war, ihm die Hoden entfernen zu lassen und ihn als Mädchen aufzuziehen. Doch Brenda, wie Bruce anschließend genannt wurde, konnte sich schon als Kind nicht mit der Mädchenrolle anfreunden, riss sich das Rüschenkleidchen vom Leib und war auch als Jugendliche kreuzunglücklich. Anfang der 1980er Jahre unterzog sich Brenda mehreren Operationen, die sie wieder zum Mann machten. Er hatte sich einfach immer wie ein Mann gefühlt, sagte Bruce-Brenda, der sich später David nannte, in mehreren Interviews.13, 14
Mehr als zwei Geschlechter
Ist das ein Beweis dafür, dass allein die Biologie das Geschlecht bestimmt und sich auf jeden Fall gegen die Umwelt durchsetzt? „Ich glaube, man kann es nicht auf diesen Biologismus reduzieren, man muss immer auch akzeptieren, dass Umweltfaktoren eine wesentliche Rolle spielen“, sagt Hengstschläger. Und für den Genetiker ist die Sache noch weit komplizierter. In den letzten 20 Jahren wurde neben dem Thema Transsexualität noch etwas anderes heiß diskutiert: die Intersexualität. Durch bestimmte, meist genetische Veränderungen ist ungefähr jedes 4000. Kind, das zur Welt kommt, nicht eindeutig einem der beiden Geschlechter zuzuordnen, nicht durch seine äußeren Geschlechtsmerkmale und oft auch nicht durch seine genetische Ausstattung. Zwitter nannte man sie früher, als Hermaphroditen werden sie in der Mythologie bezeichnet. Ein spektakulärer Fall war jener der damals 18-jährigen südafrikanischen Mittelstreckenläuferin Caster Semenya, die 2009 bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Berlin die Goldmedaille im 800-Meter-Lauf errang. Wegen ihrer tiefen Stimme und ihres maskulinen Aussehens wurden Gerüchte laut, dass Semenya intersexuell sein könnte. Unzählige Medienberichte mit immer neuen Spekulationen erschienen überall auf der Welt, Semenyas Mutter beteuerte in Fernsehinterviews, dass ihr Kind weiblich sei. Schließlich ordnete der Leichtathletikverband IAAF medizinische und genetische Tests zur Überprüfung des Geschlechts an, was von Menschenrechtsgruppen scharf kritisiert wurde. Die Ergebnisse der Tests wurden nicht veröffentlicht, allerdings hieß es aus dem IAAF kryptisch: „Es ist klar, dass sie eine Frau ist, aber nicht zu 100 Prozent.“15 Caster Semenya startet jedenfalls weiter bei Frauenwettbewerben.
Mann liebt Frau liebt Frau liebt Mann
Drei Jahre, nachdem Genetik-Fachleute auf der ganzen Welt mit dem ehrgeizigen Projekt begonnen hatten, das menschliche Genom zu entschlüsseln, gab es eine der in den 1990er Jahren auf diesem Gebiet zahlreichen Sensationsmeldungen: Homosexualität ist genetisch, hieß es. Im renommierten Wissenschaftsjournal „Science“ war eine Studie erschienen, in der Dean Hamer vom biochemischen Labor am US-amerikanischen National Cancer Institute die Familien von 114 homosexuellen Männern untersucht hatte und auf eine genetische Ähnlichkeit gestoßen war.16 Allerdings handelte es sich dabei nicht, wie von den bunten Blättern weltweit kolportiert, um ein „Homosexuellen-Gen“, sondern bloß um einen so genannten Marker, einer auffällig veränderten Stelle am X-Chromosom. „Wahrscheinlich haben selten so viele Leute so heftig auf so ein Bisschen reagiert“, schreibt Hamer in seinem Buch „Das unausweichliche Erbe“17. Von Genetiker-Kolleginnen und -kollegen über kirchliche Würdenträger bis zu Homosexuellenorganisationen meldeten sich alle zu diesem vermeintlichen Sensationsfund zu Wort. Die Sache hatte allerdings einen Haken: Hamers Entdeckung konnte von anderen Forschungsgruppen nicht bestätigt werden. Auch eine genetische Anlage für weibliche Homosexualität wurde bis heute nicht nachgewiesen.
War es früher üblich, diese Kinder nach Beratung mit den Eltern in eine Richtung zu operieren, um ihnen eine geschlechtliche Identität zu geben, gibt es seit zehn Jahren ausgehend von Amerika Bestrebungen, Intersexuelle als eigenes Geschlecht anzusehen. „Intersexuelle Menschen, die umoperiert wurden, hatten oft große Schwierigkeiten mit ihrer Identitätsfindung und ihrem Leben“, sagt Markus Hengstschläger. „Im Prinzip spricht nichts dagegen, diese Menschen so zu belassen, wie sie auf die Welt kommen, abgesehen davon, dass die Eltern vielleicht nicht wissen, was sie mit der Tatsache anfangen sollen, dass ihr Kind kein Bub und auch kein Mädchen ist.“ Doch was die gar nicht seltenen Beispiele zeigen, ist, dass es biologisch vielleicht nicht nur drei Geschlechter, nämlich männlich, weiblich und intersexuell, gibt, sondern unendlich viele. Denn es gibt zahlreiche Übergänge zwischen dem einen und dem anderen, von denen längst noch nicht alle bekannt sind.
Rund eines von 2500 Mädchen kommt mit nur einem X-Chromosom zur Welt. Diese Besonderheit wird als „Turner-Syndrom“ bezeichnet oder als „Monosomie X“. Die Betroffenen sehen weiblich aus, haben aber später keine Menstruation, zudem sind sie meist kleinwüchsig. Gelegentlich bestehen Fehlbildungen der inneren Organe, besonders des Herzens oder der Nieren, die Lebenserwartung ist jedoch nicht vermindert.
Sowohl bei Männern als auch bei Frauen können zusätzliche X-Chromosomen vorkommen. Die Folgen sind unterschiedlich. Frauen mit dieser Chromosomenvariation – bei rund jeder 1000. ist das der Fall – sind schmal gebaut und werden meist sehr groß. Abgesehen davon entwickeln sie sich unauffällig und haben eine normale Menstruation. Je mehr X-Chromosomen vorhanden sind, desto wahrscheinlicher werden gesundheitliche Beeinträchtigungen. Haben Männer ein zusätzliches X-Chromosom, so nennt die Medizin das das „Klinefelter-Syndrom“, von dem rund einer von 500 Männern betroffen ist. Bei ihnen ist die Produktion des Geschlechtshormons Testosteron vermindert, was sich unter anderem darin äußert, dass sie geringeren Bartwuchs haben und die Fruchtbarkeit beeinträchtigt ist.
Es kommt auch vor, dass Männer zwei oder mehr Y-Chromosomen haben. Bei ihnen fällt schon in der Kindheit ein schnelleres Wachstum auf als bei anderen Gleichaltrigen, hingegen können sie in ihrer geistigen Entwicklung mitunter verzögert sein.18
Vorteile, männlich und weiblich
Zwischen 900 und 1200 Gene sitzen auf dem X-Chromosom, das für die menschliche Entwicklung ungeheuer wichtig ist. Ohne X-Chromosom kann sich eine befruchtete Eizelle nicht weiterentwickeln. „Allerdings spielt nur ein einziges Gen auf dem X-Chromosom eine Rolle in der weiblichen Entwicklung“, erklärt die amerikanische Biologin Tara Rodden Robinson, alle anderen Gene, die für die weibliche Ausprägung („Phänotyp“ nennen die Fachleute das) wichtig sind, liegen auf den anderen Chromosomen. Dagegen sind fast alle 70 bis 300 Gene auf dem wesentlich kleineren Y-Chromosom mit der Geschlechtsdifferenzierung und den Geschlechtsfunktionen beschäftigt.19