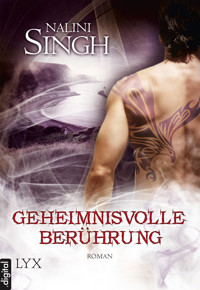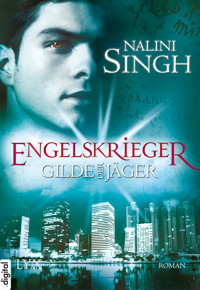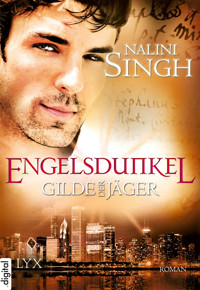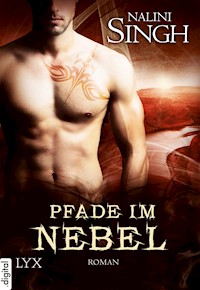8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Elena-Deveraux-Serie
- Sprache: Deutsch
Die große Schlacht um New York hat tiefe Wunden in der Stadt und bei ihren Bewohnern hinterlassen. Das Letzte, was der Erzengel Raphael und seine Geliebte Elena nun brauchen, ist ein weiterer Todesfall - besonders wenn dieser die Handschrift eines wahnsinnigen Erzfeindes trägt. Die Jägerin Ash, eine begabte Fährtensucherin, und der attraktive Vampir Janvier sollen gemeinsam in dem rätselhaften Mordfall ermitteln und begeben sich dabei in größte Gefahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 687
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Titel
Über dieses Buch
Schattenteam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
FUTTER
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Epilog
Anmerkungen der Autorin
Danksagung
Über die Autorin
Die Romane von Nalini Singh bei LYX
Impressum
NALINI SINGH
Gilde der Jäger
Engelsseele
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Dorothee Danzmann
Über dieses Buch
Menschen und Engel leiden immer noch unter den Nachwirkungen der großen Schlacht. Das Letzte, was der Erzengel Raphael und seine Geliebte Elena nun brauchen, ist ein weiterer Todesfall – besonders wenn dieser die unheimliche Handschrift einer wahnsinnigen Erzfeindin trägt. Denn alles deutet daraufhin, dass die Unsterbliche Lijuan die Tat begangen haben könnte. Die Jägerin Ash und der Vampir Janvier sollen in dem rätselhaften Mordfall ermitteln. Ash ist eine Fährtensucherin mit einer besonderen Gabe – sie kann die Geheimnisse der Menschen, die sie berührt, wahrnehmen. Doch eine Person kennt sie auch ohne den geringsten Hautkontakt in- und auswendig: Janvier, den ebenso charmanten wie attraktiven Vampir aus den Südstaaten, der sie schon seit Jahren fasziniert, aber auch immer wieder zur Weißglut bringt. Auf der Jagd nach dem gnaden-losen Killer treiben sie ihr Katz-und Maus-Spiel aus Anziehung und Provokation weiter auf die Spitze und geraten gleichzeitig in größte Gefahr. Dabei ahnen sie nicht, dass ihnen der schwerste Kampf noch bevorsteht und die wahre Bedrohung aus einer ganz anderen Richtung kommt …
Schattenteam
Leise und so schnell sie konnte hastete Ashwini die Treppe hinauf. Sie durfte auf keinen Fall Lärm machen und das stockfinstere Treppenhaus, in dem sich die Stufen in einer Art quadratischer Spirale um einen Lichtschacht herum vom Keller bis in den vierundsiebzigsten Stock hochzogen, war ideal für Echos. Hier prallte jedes Geräusch vielfach verstärkt von den Wänden ab.
Zwar tobte am Himmel über New York eine Schlacht zwischen Erzengeln, und unten auf der Erde waren die Vampire der Stadt gegen die Geißel der Wiedergeborenen angetreten, aber Vorsicht war doch angebracht, fand Ashwini, obwohl vermutlich niemand etwaigen Lärm hier im Treppenhaus hören würde. Aber zu große Unbekümmertheit konnte sich rächen und einen das Leben kosten. Deswegen hatte Janvier auch die Stromzufuhr zu diesem Teil des Gebäudes unterbrochen und Naasir ihre Feinde durch ein paar nette kleine Sprengungen abgelenkt.
Als ein Stockwerk weiter oben eine Tür aufging, presste sie sich dicht an die Wand. Ein dünnes Rinnsal Schweiß rann ihr den Rücken hinunter.
»Das Treppenlicht funktioniert nicht.« Überdeutlich dröhnte die verärgerte Männerstimme durch das als Bürohaus konzipierte Gebäude, für dessen grauenhafte Akustik ein für seine »gewagten« Arbeiten bekannter Architekt verantwortlich zeichnete. »Anscheinend hat das Haus bei Raphaels letztem Angriff etwas abbekommen.«
»Nein.« Die Frauenstimme war ebenso klar zu verstehen. »Er hat Leute auf dieser Seite der Front. Lass einfach auf diesem Stockwerk beide Zugangstüren verriegeln, und ich gebe Bescheid, dass das im restlichen Gebäude genauso gehandhabt wird.«
Ashwini grinste: Bei dem, was sie hier vorhatte, brauchte sie keinen Zugang zu den Stockwerken.
Sie stieg weiter nach oben, sobald die feindlichen Wachen sich verzogen hatten. Naasir hatte ihrer kleinen Truppe den Namen Schattenkämpfer gegeben, was Ashwini gefiel. Schattenkämpfer klang viel besser als Spion und in ihren Ohren auch besser als Soldat. Sie, Janvier und Naasir hatten als Gruppe die Aufgabe übernommen, aus dem Herzen des gegnerischen Lagers heraus ihren Feinden Unannehmlichkeiten zu bereiten, sie zu verwirren, zu ärgern und zu reizen. Für ein lediglich aus drei Personen bestehendes Team machten sie ihre Sache verdammt gut, fand Ashwini.
Was sie jetzt vorhatte, sollte das Tüpfelchen auf dem i werden.
Inzwischen war sie in dem Stockwerk direkt unter dem Dach angekommen, setzte ihren kleinen Rucksack ab und nahm die darin befindliche Sprengladung heraus. Zehn Sekunden, mehr brauchte sie nicht, um die Ladung anzubringen und scharf zu machen. Die zu erwartende Explosion würde vielleicht nicht gleich das ganze Dach in die Luft fliegen lassen, dürfte aber genügend Schaden anrichten, um die Invasionsstreitkräfte aus dem Takt zu bringen. »Fertig!«, flüsterte sie in die Sprechmuschel des schlanken, eleganten Funkgeräts, das sie sich ans rechte Ohr gehängt hatte.
»Dann nichts wie raus mit dir, Cher.« Für den, der den stählernen Kern darin nicht hörte, klang Janviers Stimme so träge wie ein dunstverhangener Sommertag. »Sie haben gemerkt, dass du da bist.«
»Ich bin so gut wie weg.« Sie setzte sich den Rucksack wieder auf, schaffte es aber gerade mal zwei Treppenabsätze weit, als in einiger Entfernung unter ihr das Trampeln schwerer Kampfstiefel hörbar wurde, vermischt mit hektischen Rufen und Kriegsgebrüll.
Zeit für Plan B.
Rasch setzte sie den Rucksack wieder ab, um das darin befindliche, zusammengerollte Kletterseil herauszuholen, das sie nur am Geländer einhängen musste, um sich im selben Moment an den Verfolgern vorbei abzuseilen, ohne dass diese etwas mitbekamen. Schließlich trug sie ihre Handschuhe, die nur die Fingerspitzen frei ließen, nicht aus modischen Erwägungen heraus, sondern in Vorbereitung auf ebendiesen Notfall. Ohne Handschuhe hätte ihr die Haut in Fetzen von den Fingern gehangen, wenn sie nach einem solchen Abseilmanöver unten angekommen wäre.
Sie prüfte schnell, ob das Metall des Geländers ihr Gewicht zumindest so lange tragen würde, bis sie unterhalb der Verfolger angekommen wäre, hängte den Karabinerhaken des Kletterseils direkt an dem Geländer ein und warf das Seil in den Lichtschacht. Es wickelte sich blitzschnell und fast lautlos ab, nur, wenn das Metall des Hakens gegen das Geländer stieß, konnte man ein leises Kratzen hören, das jedoch im Lärm der näher kommenden feindlichen Kämpfer fast unterging. Ashwini wollte sich gerade über das Geländer schwingen – der leere Rucksack sollte zurückbleiben –, als sie im Nacken einen warmen Luftzug spürte.
Natürlich fuhr sie sofort herum und griff von unten her an, aber sie war zu langsam. Der Mann, der lautlos durch die Tür in ihrem Rücken gekommen sein und sich von hinten an sie angeschlichen haben musste, prallte mit ihr zusammen. Der Karabinerhaken schepperte lautstark gegen das Geländer und bohrte sich Ashwini in den Rücken, als der Angreifer sie gegen das Geländer warf und ihr seinen Unterarm an den Hals drückte.
Fangzähne blitzten auf. »Wie nett! Taucht mein Lunch einfach so vor mir auf!«
Den eitlen Spruch hätte sich der Vampir lieber sparen sollen, denn Ashwini nutzte die Zeit, um aus den in den Ärmeln ihrer Jacke verborgenen Unterarmschienen ein Messer in jede Hand gleiten zu lassen, mit denen sie jetzt zustieß und zwar nach oben, auf seinen Unterleib gerichtet. Eingeklemmt, wie sie war, ließ sich ein zielgenauer Stich nicht hinbekommen, aber zumindest nahm er sie jetzt ernst, und sein Blut klebte an ihren Klingen. Vor Wut aufheulend, versetzte er ihr einen Fausthieb in den Magen – und wich einen Schritt zurück.
Mehr brauchte sie nicht.
Sie atmete an dem Schmerz vorbei, den sein Schlag ihr eingetragen hatte, und stieß erneut zu, diesmal so kräftig und treffsicher, dass es ihr gelang, eine Lunge zu punktieren. Einen Sterblichen hätte Ashwini auf diese Weise ausschalten können, aber ihr Gegner war kein Sterblicher.
Seine Stimme gurgelte vor Zorn, seine Augen glühten in der Dunkelheit. »Schlampe!« Als er diesmal ausholte, geschah das nicht mit der Faust.
Ashwini war zwar für den Nahkampf ausgebildet, aber hier war es stockdunkel, eng und ihr Gegner eindeutig in dieser Kunst kein Neuling. Gerade holte er mit einer Waffe zum Schlag gegen sie aus, bei der es sich allem Anschein nach um ein Breitschwert handelte. Sie riss beide Messer hoch, um den Schlag zu parieren, doch dazu kam er zu wuchtig und gut gezielt: Ihm gelang ein brutaler Treffer. Das Schwert schickte ihre Messer klirrend zu Boden, ritzte ihr mit der Spitze die linke Handfläche und die Innenseite des rechten Oberarms auf – dann spürte sie die ganze Klinge wie kaltes Feuer auf ihrer Brust.
Ein Geruch wie von Eisen, nass und dunkel, drang ihr in die Nase, ihr Atem ging flach und stoßweise.
Der Vampir lachte.
Als ihr klar wurde, dass sie hier nicht mehr herauskommen würde, denn das Getrampel der feindlichen Stiefel war jetzt gerade ein Stockwerk tiefer zu hören und vor ihr schwang dieser Vampir sein Schwert – als ihr klar wurde, dass das hier das Ende war, zwang sie irgendwie ihre rechte Hand dazu, die Pistole aus dem Schenkelhalfter zu ziehen. Kriegsgefangenschaft kam für sie nicht infrage, sie würde sich nie wieder von jemandem einsperren lassen. Wobei Lijuan auch kaum Gefangene machte, da sie gern Leute aß – im wahrsten Sinne des Wortes verzehrte. Was übrig blieb, wenn der Erzengel von China gespeist hatte, zerfiel noch in Lijuans Händen zu Staub.
»Tut mir leid, Cher«, flüsterte sie in das Funkgerät und damit in die Ohren des Mannes, der sie wieder spielen gelehrt hatte, lange nach dem Ende ihrer nur als absurd zu bezeichnenden Kindheit. Sie feuerte. Ihre Pistole spie Feuer, die Schüsse hallten durch das Treppenhaus, drangen durch den Angreifer, prallten an der Wand hinter ihm ab. Der Vampir wankte leicht unter dem Kugelhagel, wich auch zurück – hatte sich aber schnell wieder gefangen und überhäufte Ashwini mit wüsten Flüchen. Und dann sah sie ihn im hektisch flackernden Mündungsfeuer ihrer Pistole das Schwert zum letzten, entscheidenden Schlag heben.
Doch zu diesem kam es nicht mehr, denn ehe die scharfe Schneide auf sie niederfahren konnte, landete das Schwert mit lautem Geklirr auf dem Boden, und eine heiße Blutfontäne ergoss sich über Ashwinis Gesicht. Als sie das Feuer einstellte, konnte sie deutlich die dumpfen, nassen Schläge hören, mit denen der Kopf die Treppen hinuntersprang, und wusste: Diese Rettung hatte sie einer Klinge zu verdanken, die weder Schwert noch Messer war, sondern etwas dazwischen. Scharf wie eine Sense, nur tödlicher.
»Bei mir musst du dich nie entschuldigen, Süße!« Janvier riss sie in seine Arme und stürmte die Treppe hinauf.
Widerspruch war zwecklos, Ashwini war viel zu schwer verletzt. Wenn sie jetzt darauf bestand, aus eigener Kraft weiterzukommen, hielt sie sie nur beide auf. Also griff sie wortlos mit blutverschmierter Hand um Janvier herum, auf der Suche nach der Pistole, die er immer in einem Halfter an seiner Taille trug. Es dauerte eine Sekunde, bis sie sie gefunden und fest genug gepackt hatte. Sein Atem strich warm über ihren Hals, seine Muskeln spannten sich an, bewegten sich, während er mit seiner Last die Treppe hinaufhastete.
Irgendwie blendete sie die Tatsache aus, dass ihre Brust praktisch in zwei Stücke gehauen war, richtete sich, so gut es ging, auf und zielte mit beiden Pistolen, seiner und ihrer, über seine beiden Schultern hinweg. »Gleich wird es hart für deine Ohren!«
»Ich werd es überleben.«
Sie feuerte los.
Unter dem Kugelhagel gleich zweier Pistolen blieben die Verfolger zurück, was jedoch nicht von Dauer sein konnte. Ashwini würden bald die Kugeln ausgehen, trotz der beiden mitgeführten Ersatzmagazine, die hatte sie schon eingerechnet. Außerdem musste ein Vampir mit der Pistole direkt ins Herz oder Gehirn getroffen werden, um ausgeschaltet zu werden, und selbst dann noch hing das Resultat von Alter und Stärke des betreffenden Vampirs ab. Ashwini hatte schon einmal ein ganzes Magazin in das Hirn eines psychopathischen Vampirs gepumpt, nur um erleben zu müssen, wie er sich auf sie stürzte.
In diesem Moment zuckte Janvier zusammen, ohne allerdings auch nur eine Spur langsamer zu werden.
Hastig tastete sie seine Schultern ab: Blut! Warmes, klebriges, frisches Blut. Ihr drehte sich der Magen um. »Du hast einen Querschläger abbekommen!«
»Hör bloß nicht auf zu schießen!«, befahl er. »Lenk sie ab!«
Sein Blut zu riechen weckte in ihr tief sitzende, natürliche Instinkte. Sie mähte den Vampir nieder, der sich gerade mit Schwung auf sie hatte stürzen wollen, schaffte es sogar, ihm im Schein ihres eigenen Mündungsfeuers drei gut gezielte Kugeln ins Hirn zu verpassen. Als der Vampir umkippte und liegen blieb, wurden seine Kumpane langsamer. Das passte Ashwini gut, denn gerade klickte es bei beiden Pistolen nur noch, wenn sie feuern wollte – sie musste nachladen. Aber als sie die kurze Atempause nutzen wollte, um neue Magazine einzuschieben, wäre ihr eine der Waffen fast aus der Hand gefallen.
»Ich werde fahrig«, sagte sie. Wieso fühlte sich ihre Zunge so dick und schwer an? »Lass mich hier, geh.«
Janvier konnte das Hochhaus auf dieselbe Weise verlassen, wie er es ohne Zweifel auch betreten hatte: indem er an der Seite hinunterkletterte. Janvier schaffte jede Wand, auch die glatteste. Seine Bewegungen waren ebenso anmutig, wie sie anders waren und erinnerten daran, dass er eben kein Mensch war.
»Du könntest mein Blut trinken.« Inzwischen nuschelte sie ziemlich, aber immerhin hatte sie bei einem feindlichen Vampir, der seinen Kopf zu weit vorgestreckt hatte, doch noch einen Treffer landen können, was ihnen wieder ein paar Sekunden Zeit verschaffte. »Du könntest Kraft tanken.«
»Das würde ich echt gern machen.« Als ihr Gesicht auf seine Schulter sank, spürte sie deutlich den Puls an seinem Hals. »Aber lieber wäre es mir, du würdest dabei meinen Schwanz in den Mund nehmen.«
Wie gern hätte sie eine deftige Antwort geknurrt, aber es gelang ihr einfach nicht.
»Bleib hier, Ash! Wage bloß nicht, abzuhauen!« Harte, mitleidlose Worte! Sie waren inzwischen auf dem letzten Treppenabsatz angekommen, dort, wo Ashwini den Sprengsatz angebracht hatte.
»Bin ja hier.« Mit letzter Kraft und blutiger Hand tätschelte sie seine Wange. Sie war so schwach, und er war so sündhaft hübsch, dieser Janvier mit seinen grünen Augen und dem dunkelbraunen Haar, das die Sommersonne kupfern färbte. Sie wünschte, sie hätte ihn einmal richtig geküsst, wünschte, sie hätte ihn in ihr Bett geschleift und in den süßen, knackigen Po gebissen.
»Können wir später alles nachholen!«, sagte er, indem er sie umbettete, bis er ihren ganzen Körper an sich drücken konnte. Einen Arm hatte er um ihre Taille geschlungen. »Leg die Arme um meinen Hals. Komm, Schatz! Lass mich jetzt nicht im Stich!«
Ihre Glieder waren so schwer, das Blut tropfte ihr in den Hosenbund ihrer Jeans, der schon völlig durchnässt war. Aber sie schaffte es, ihm die Arme um den Hals zu legen. »Fenster?«
»Nein. Da wo ich rein bin, haben sie bestimmt alles dichtgemacht. Wir gehen runter.« Er hatte wohl gleich bei seiner Ankunft ein Seil hier oben festgemacht, denn jetzt schwang er sich über das Geländer und glitt mit atemberaubender Geschwindigkeit in die Tiefe.
Über ihnen wurde gebrüllt und geschrien, aber Ashwini hatte nur einen Gedanken im Kopf: Janvier trug keine Handschuhe.
Mit einem Ruck hielten sie bei einem der tiefer gelegenen Stockwerke, unterhalb der Verfolger, aber noch nicht in Sicherheit. Das Timing war perfekt: Nur einen Herzschlag später fiel neben ihnen ihr Seil in die Tiefe, das die Gegner oben abgeschnitten hatten. Aber da hatte Janvier Ashwini längst schon wieder an seine Brust gedrückt und raste die Treppe hinunter.
Mit Raketengeschwindigkeit schossen sie am Erdgeschoss vorbei in die Tiefgarage, wo ein Vampir mit metallisch glänzenden silbernen Haaren, genauso aufregend silbernen Augen und samtbrauner Haut, die viele zum Streicheln verlockte, neben der offenen Tür auf sie wartete. Sie rannten hindurch, er zog die Tür hinter ihnen zu und demolierte ihren Schließmechanismus, indem er Teile davon mit brachialer Gewalt verbog. »Los! Ich kümmere mich um etwaige Verfolger.«
In diesem Moment gab es eine Detonation, ein Ruck ging durch das Hochhaus, und vom Garagendach rieselte es Ashwini Betonstaub ins Gesicht. »Geschafft!«, wollte sie flüstern, aber ihre Kehle streikte, und ihr Herz schlug langsamer, als eine Schnecke kriecht. Als hätte ihr Körper kein Blut mehr, das noch gepumpt werden müsste.
»Ashwini!«
Janviers Stimme war das Letzte, was sie hörte. Dann gingen die Lichter aus.
1
Stinkender Atem hinten im Nacken.
Eiseskälte in den Knochen. Kalt zieht ein Flüstern durch die Düsternis.
Es sind die Dinge, die es nicht geben dürfte. Sie sollten nicht gehen, nicht atmen, nicht genannt werden dürfen.
Es gibt Albträume, die, hat man sich ihnen einmal gestellt, nicht mehr ins Reich der Träume verbannt werden können.
(Schriftrolle des unbekannten Uralten, aufbewahrt in der Bibliothek der Zuflucht)
Es hatte einen Krieg gegeben: Erzengel gegen Erzengel. In der Luft hatten die Schwadronen der Engel gekämpft, am Boden Vampirtruppen. Das hatte er ihm nach seiner Rückkehr erzählt, diesem Ding, das seinen eigenen Namen nicht mehr wusste, das nicht mehr sagen konnte, ob es noch lebte oder im endlosen Fegefeuer gefangen saß. Es hatte die Kämpfe wohl gehört, aber sie waren ihm gleichgültig gewesen. Kriege wie dieser existierten in einer anderen Welt, nicht in der bedrängten Dunkelheit, die seine Welt war.
Hier kämpfte es seinen eigenen Krieg, schrie, wenn es die schlurfenden Schritte hörte, die das Kommen des Monsters ankündigten. Aber obwohl es schrie, mit trockener, rauer Kehle schrie, so laut es konnte, wusste es doch, dass es keinen Laut von sich gab. Die Brust tat ihm weh, weil es keine Luft bekam. Panik hielt mit grausamer Hand seinen Hals umklammert und drückte zu, drückte fest zu.
»Nein, nein, nein!«, flüsterte das gefangene Wesen, aber die Worte existierten nur in seinem Kopf, sein Mund schien wie in einem lautlosen Schrei erstarrt.
Ein Teil dessen, was es einst gewesen war, wusste schon noch, dass man ihm unwiederbringlich den Verstand geraubt hatte. Der Teil, der solche Dinge wusste, war nur ein winziger Keim, der sich in einem weit entfernten Bereich seiner Psyche versteckte. Der Rest war Panik. Wild um sich schlagende panische Angst, Furcht und Trauer. Tränen rannen ihm die Wangen hinunter, fingen sich in der zerstörten Kehle, aber das quälende Gefühl der Verzweiflung wurde bald schon von nackter Furcht erstickt.
Dann traf grell blendendes Licht Augen, die wohl seine eigenen waren, und sein Puls fing an zu rasen. Das Monster war da.
2
Drei Wochen nachdem ihr Körper fast alles Blut verloren hatte, dachte Ashwini gerade darüber nach, ob sie die Wände ihres Wohnzimmers nicht doch vielleicht rosa mit kleinen violetten Punkten streichen sollte, als ihr Telefon klingelte. Sie holte es sich von dem kostbaren hölzernen Couchtisch, dessen zerkratzte Platte sie erst im vergangenen Jahr restauriert hatte, und nahm den Anruf entgegen.
Am anderen Ende war Sara. Die Gilde-Direktorin hatte einen Job für sie. »Irgendetwas geht im Vampirviertel vor sich«, erklärte sie. »Hunde und Katzen verschwinden. Der erste Bericht stammt aus der Zeit nach der Schlacht, aber vielleicht läuft die Sache schon viel länger mit herumstreunenden Tieren, bei denen keiner die Übersicht hat.« Leises Rascheln – im Hintergrund wurden Seiten umgeblättert. »Aber jetzt ist in einem Kanalisationsrohr ein Hundekadaver aufgetaucht, und der Hund scheint ausgedörrt zu sein. Völlig blutleer. ›Wie eine Mumie‹, sagte die Tierärztin, die bei mir angerufen hat. Ich möchte, dass du dir die Sache mal ansiehst.«
»Du willst, dass ich herausfinde, wieso es zu einem mumifizierten Hundekadaver gekommen ist?« Ashwini liebte Tiere und wäre bestimmt selbst mit einem sabbernden Riesenköter herumgelaufen, wenn sie nicht in einer Wohnung mitten in Manhattan gelebt hätte, aber mumifizierte Hunde waren wirklich nicht ihr Spezialgebiet. »Ich bin keine Ägyptologin. Und ich hasse die Kanalisation.«
»Da befindet sich der Hund ja auch nicht mehr, du bist also sicher.« So schnell ließ sich Sara nicht abwimmeln. »Könnte sein, dass wir einen durchgeknallten Vampir haben, der sich von Haustieren ernährt. Sieh dir das Tier einfach mal an.«
Ashwini stand mit dem Rücken zu der Wohnzimmerwand, die sie eben noch rosa mit violetten Pünktchen hatte streichen wollen, und betrachtete mit zusammengekniffenen Augen durch das Sicherheitsglas der gegenüberliegenden Fensterwand hindurch den Erzengelturm, dessen Spitze sich in die Wolken bohrte. Das leuchtende, einem in sattem Öl gemalten Orange ähnelnde Licht der späten Nachmittagssonne färbte die Flügel der Engel goldbraun und siena. Ellie hatte ihr damals von dieser Wohnung erzählt. Sie hatte als Jägerin eine Wohnung in einem ähnlichen Haus gleich nebenan bewohnt – bis sie sich in einen Mann verliebte, der so gefährlich war, dass man gar nicht genauer darüber nachdenken mochte, und der von dem gegenüberliegenden hohen Turm aus Nordamerika regierte.
»Mal ehrlich, Sara!« Ashwini verfolgte den bedenklich wackligen Flug eines Engels, der wohl seinen gerade erst verheilten Flügel ausprobierte. »Etwas Ungefährlicheres hast du wohl nicht für mich finden können? Zum Beispiel alten Damen die verlorenen Stricknadeln wiederzubeschaffen?«
Die Gilde-Direktorin lachte nur. »Hey, du hältst bei uns den Rekord für die längste genähte Narbe! Genieße die freie Zeit gefälligst.«
»Aber danach will ich eine echte Jagd!« Ashwini tat erbost, drückte im Geist aber gleichzeitig dem unbekannten schwankenden Engel die Daumen, der gerade auf einem Dach neben dem Turm zu landen versuchte. »Oder ich werde einfach Janvier jagen.« Der verdammte Vampir war sehr nett zu ihr gewesen, nachdem sie in der Schlacht, in der sich New York erfolgreich gegen eine Invasionsarmee unter dem Kommando der Erzengelfrau Lijuan verteidigt hatte, fast zweigeteilt worden wäre.
In dieser Schlacht war wahrscheinlich auch der Engel verletzt worden, der seine Landung auf dem Dach jetzt zwar ein wenig zittrig, aber erfolgreich hinter sich gebracht hatte.
»Wunderbar«, jubelte Sara, als hätte Ashwini ihr gerade verkündet, Einhörner gäbe es wirklich und sie würden derzeit noch dazu im Central Park Wünsche erfüllen. »Sag rechtzeitig Bescheid, damit ich Tickets kaufen kann. Und jetzt zieh los, die Hundemumie anschauen.«
»Grrr!« Mit diesem Grummeln, das sich Ashwini während ihrer Zeit als Schattenkämpferin hinter den feindlichen Linien bei Naasir abgeguckt hatte, legte sie auf.
Sie ging ins Schlafzimmer, wo sie die lebhaft zitronengelben Vorhänge vor die Glasschiebetür zog, die auf ihren winzigen Balkon führte. Dieses Balkons wegen hatte Ellie sie auf die gerade auf den Markt gekommene Wohnung aufmerksam gemacht. Ellie selbst hatte damals auch einen Balkon gehabt und wusste von Ashwini, wie sehr diese das Gefühl der Freiheit mochte, die ihr dieser vermitteln konnte.
Die kräftige Farbe der Vorhänge hob sich gut ab gegen das frische Weiß der Wände, die Ashwini beim Einzug so vorgefunden hatte, und bildete einen hübschen Kontrast zum leuchtend dunklen Rosa der Kissen auf ihrem Bett. Die Laken waren cremefarben mit feinen rosa Streifen, der Teppich helles Gold. In einer Ecke stand auf einem hohen schwarzen Hocker eine spiralförmige Skulptur aus durchsichtigem blauen Glas. Ashwini hatte sie in Greenwich Village auf der Straße gefunden, der Vorbesitzer hatte sie sicher nicht mehr haben wollen, weil unten am Fuß ein Stück Glas abgesplittert war. Sein Problem, wenn er die Schönheit im Zerbrochenen, Vernarbten nicht zu sehen vermocht hatte.
Viele würden dieses Zimmer zu bunt finden, aber nach der vornehmen Eleganz des Hauses, in dem Ashwini als Vierzehnjährige fünf Monate lang gelebt hatte, konnte sie nichts Steriles oder Minimalistisches mehr leiden. Sie wollte Stoffe und Farben um sich, sie wollte Geschichten. Deswegen sammelte sie Stücke, die andere fortgeworfen hatten, und gab ihnen ein neues Leben. Weil sie selbst einmal als etwas gegolten hatte, das zu zerbrochen war, um noch zu taugen.
Als sie ihr graues T-Shirt auszog, strichen ihre Finger wie unabsichtlich über die Narbe, die ihre Brust diagonal in zwei Hälften teilte und sie an das Ereignis erinnerte, bei dem sie fast endgültig zerbrochen wäre. Sie riss die Schranktür auf, bis der große Spiegel an ihrer Innenseite zum Vorschein kam, und betrachtete sich darin. Die gerade Linie quer über ihre Brust zeugte von der Geschicklichkeit des Vampirs, der das Schwert geführt hatte, aber die Wunde war gut verheilt. Die Narbe sah nicht mehr rot und dick aus und würde mit der Zeit wie die anderen, kleineren Narben auf ihrem Körper zu einem dunklen Honiggelb verblassen.
Nur die Erinnerung, die würde für immer unverändert sein.
»Bleib hier, Ashwini! Wage verdammt noch mal nicht, dich davonzumachen!«
Janviers Stimme – die letzte, die sie gehört hatte, ehe sie das Bewusstsein verlor, die erste, die sie nach dem Aufwachen vernahm. »Was zischst du den netten Doktor so an, Ashblade? Das ist ganz schlechter Stil.«
Sie war viel zu schwach gewesen, um irgendwen anzuzischen, aber ihre Abneigung gegen die Institution Krankenhaus hatte man ihr wohl auch so angemerkt. Jedenfalls hatte Janvier sie nach Hause geschafft, sie in ihr eigenes Bett gelegt und ihr eine Suppe gekocht. Richtige Suppe, weder aus der Tüte noch aus der Dose. Wer machte denn so etwas? Für sie jedenfalls hatte zuvor noch nie jemand Suppe gekocht, und jetzt wusste sie nicht, wie sie mit dem seltsamen, verlorenen Gefühl umgehen sollte, das die Erinnerung daran in ihr weckte. Also knallte sie der Erinnerung die Tür vor der Nase zu, wie sie es jetzt schon seit zwei Wochen tat, seit sie nämlich Janvier aus der Wohnung geworfen hatte, und konzentrierte sich stattdessen auf ihre Narbe.
Anfangs hatte sie Angst gehabt, der Schwerthieb könnte Muskeln verletzt haben und ihre Beweglichkeit auch nach der Heilung eingeschränkt bleiben, aber diese Bedenken hatten ihr ein Besuch beim Vertrauensarzt der Gilde sowie ihr eigenes Körpergefühl bald nehmen können. Und wenn es nach ihr ginge, würde ihre Genesung auch weiterhin planmäßig und zügig verlaufen, weswegen sie sich noch mit dem speziellen Öl einreiben wollte, das Saki ihr gegeben hatte, ehe sie sich aufmachte. »Damit reibst du die Narbe zweimal täglich ein, sobald der Faden sich aufgelöst hat«, hatte die alte, erfahrene Jägerin ihr erklärt. »Das Öl hilft bei der Heilung des tiefer gelegenen Gewebes.«
Saki war so oft verletzt worden, dass man es schon nicht mehr zählen konnte, hatte also jede Menge Erfahrung. Wer wollte da einem solchen Rat widersprechen!
Nachdem sie das süß duftende Öl gründlich einmassiert hatte, bürstete sich Ashwini die Haare, flocht sie zu einem Zopf, tauschte die Yogahose gegen eine dem Winterwetter angemessenere Jeans und zog ihre Jägerstiefel an. Sie suchte sich ein dünnes, langärmliges T-Shirt heraus, das wunderbar die Körperwärme speicherte, zog einen leuchtend orangefarbenen Mohairpullover mit Rollkragen darüber und ergänzte das Ganze durch eine gefütterte schwarze Lederjacke, die ihr bis zur Hüfte reichte. Ihre Handschuhe fand sie in die Jackentaschen gestopft, was ihr die Mühe ersparte, erst nach ihnen suchen zu müssen.
Die großen, baumelnden Ohrringe durften bleiben, fand sie. Wenn der arme tote Hund eine Auferstehung hinlegte und sie angriff, sollte er ihr ruhig die Ohrläppchen abreißen dürfen, das hatte er sich redlich verdient. Jetzt noch die Waffen, die natürlich alle über feste Halfter und Scheiden verfügten: Die Messer kamen in Armschienen und ihren linken Stiefel, eine Pistole hatte ihren angestammten Platz in einem verdeckten Halfter, die andere in einem sichtbaren Halfter an ihrem Oberschenkel.
Den Gilde-Ausweis steckte sie in eine Jackentasche, an die sie im Notfall schnell herankam. Die meisten Streifenbeamten kannten die Jäger, die in ihrem Revier lebten oder arbeiteten, aber es gab immer wieder Neuzugänge von der Polizeischule. Und da es wirklich ätzend wäre, von einem schießwütigen jungen Hitzkopf erschossen zu werden, nachdem sie gerade einen Krieg zwischen Unsterblichen überlebt hatte, wollte sie lieber jederzeit problemlos ihre Identität nachweisen können.
Jetzt galt es nur noch, die Frage mit der Armbrust zu klären: Mitnehmen oder nicht? Sie liebte diese Waffe ebenso sehr wie den tragbaren Granatwerfer, den sie in ihrem Waffenspind im Gilde-Hauptquartier aufbewahrte, aber vielleicht wäre sie bei einem Tierarztbesuch doch ein wenig zu viel des Guten.
»Sara, Sara!«, murmelte sie leise, denn eine ungefährlichere Aufgabe hätte die Gilde-Direktorin ihr kaum zuweisen können. »Ich glaube fast, du willst mich für dumm verkaufen.«
Aber alles war besser, als zu Hause herumzusitzen, Däumchen zu drehen und womöglich noch aus lauter Langeweile mit verrückten Renovierungsprojekten ihre Wohnung zu verschandeln.
Ehe sie den hinten in ihrem Kleiderschrank versteckten Waffensafe endgültig abschloss, holte sie sich schnell noch den glänzenden schwarzen Armreif heraus, den Janvier ihr vor etwa einem Jahr mit der Post geschickt hatte. Den streifte sie sich auch noch über: Wenn man den Reif aufbrach, kam ein darin verborgener feiner, aber fester Draht zum Vorschein, und schon verfügte man über eine äußerst tödliche Garotte. Dieser verdammte Janvier kannte sie und ihre Vorlieben viel zu gut! Und gerade deswegen konnte sie auch sein Verhalten nach ihrer Verwundung so gar nicht verstehen. Sie waren sich doch einig: Sie neckten sich und forderten einander heraus, und sie flirteten natürlich auch miteinander. Aber dieses andere, dieses Nettsein, diese Sanftheit – damit hatte er eine Grenze überschritten.
Als sie Probleme beim Aufsetzen gehabt hatte, hatte er sich neben sie aufs Bett gesetzt, sie an seiner Brust geborgen und mit Suppe gefüttert, ganz geduldig, immer einen Löffel nach dem anderen. Sie hatte sich warm und sicher gefühlt, was sie schrecklich beängstigend gefunden hatte – das hatte sie wütend gemacht. Weil er das Einzige war, das sie niemals haben durfte. Weil er mit seiner Haltung ihr ganzes mühsam errungenes Gleichgewicht ins Wanken gebracht hatte, indem er ihr zeigte, was ihr fehlte, was sie entbehren musste.
Allein daran zu denken ließ sie so sauer werden, dass sie gleich noch ein paar Messer mehr an ihrem Körper versteckte, ehe sie die Wohnungstür aufriss.
»Da bist du ja, Schatz«, begrüßte sie der zweihundertsiebenundvierzig Jahre alte Vampir, der lässig im Türrahmen lehnte. Seine Haare hatten den satten Farbton des Zichorienkaffees, den er ihr einmal gekocht hatte, seine Haut schimmerte wie gebranntes Gold.
Ashwini zeigte Zähne, aber auf eine Art, die man beim besten Willen nicht als Lächeln interpretieren konnte. »Ich hab dir doch gesagt, du sollst verschwinden.« Als er das letzte Mal »zufällig in der Gegend« gewesen war, hatte er ihr ihr Lieblingseis vorbeigebracht, Pfefferminze mit Schokostückchen. Sie hatte ihm das Eis aus der Hand gerissen und ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen – irgendwie musste sie ihm doch verständlich machen, dass sie es ernst meinte. Er jedoch hatte nur gelacht, hatte vor der geschlossenen Tür sein wildes, ungeniertes Lachen ausgestoßen, das ihr durch das dünne Holz hindurch bis in die Knochen gedrungen war und ihr in der Seele wehtat.
»Ich war ja weg«, erklärte er in seinem unverwechselbaren Tonfall, in dem immer noch die Sprachmelodie seiner Heimat mitschwang. »Eine ganze Woche lang.« Als er die Arme vor der Brust verschränkte, konnte sie deutlich sehen, wie sich unter dem butterweichen braunen Leder seiner alten Motorradjacke die Muskeln abzeichneten.
»Von wegen! Bei welcher Version von ›Bleib mir vom Hals‹ darf man Leute vorbeischicken, die einem Essen bringen?«
Seine Augen waren grün, wie das Moos in den Bayous, wenn sich Sonnenlicht über die Schatten schiebt. »Wie sollte ich denn sonst herausfinden, ob du nicht ohnmächtig im Badezimmer liegst, weil du zu dickköpfig bist, um Hilfe herbeizurufen?«
»Ich bin in den letzten zwei Wochen nicht zum Volltrottel mutiert!« Außerdem hatte sie Freunde, trotz der finsteren Prophezeiungen, mit denen ihr Vater sie damals als Kind gequält hatte. Honor war jeden zweiten Tag vorbeigekommen, hatte sich immer mit Ransom, Demarco und Elena abgewechselt. Naasir hatte ihr den Gefrierschrank voll Fleisch gestopft, ehe er achtundvierzig Stunden nach Ende der Schlacht Richtung Japan hatte aufbrechen müssen.
Wobei sein Kommentar zu dieser guten Tat recht lakonisch ausgefallen war: »Protein hilft bei der Heilung, also iss das Zeug.«
Auch andere Jäger waren nach ihrer jeweiligen Entlassung aus dem Krankenhaus zu Besuch gekommen, um ihre Narben zu zeigen und Ashwinis zu bewundern. Saki war gleich zwei Nächte geblieben und hatte Ashwini auf den neuesten Stand über ihre Eltern gebracht, die in Oregon lebten. Die alten Leutchen hatten Ashwini einmal mit großer Güte bei sich aufgenommen, und auch wenn sie damals zu verletzt gewesen war, um ihnen zu ganz zu vertrauen und eine emotionale Bindung zuzulassen, würde sie die Großzügigkeit des Paares nie vergessen. Ebenso wenig konnte sie vergessen, wie Janvier mit ihr auf dem Schoß im alten Ohrensessel vor dem Fenster gesessen und ihr Haar gestreichelt hatte, während die Stadt draußen im Schneegestöber vor ihnen lag.
Ein Moment, in dem sie ewig hätte leben mögen – aber das ging nicht, sie konnte einfach nicht. »Aus dem Weg!«, zischte sie, denn der Zorn auf ihr Schicksal war ein eiskaltes Ding mit Zähnen und Klauen, das in ihrem Innern wütete und das sie nie hatte zähmen können, trotz der Entscheidung, das Leben mit ganzer Kraft zu leben. »Ich bin unterwegs zu einem Job.«
Sofort wich das lässige Grinsen in seinem Gesicht gespannter Aufmerksamkeit. »Du bist noch nicht wieder ganz gesund.«
Sie trat aus der Wohnung, schloss die Tür hinter sich ab und eilte den Flur hinunter. »Das sieht der Doktor anders, er hat mir völlige Wiederherstellung bescheinigt.« Das hatte er zwar nicht getan, aber Ashwini kannte ihren Körper: Er war vor ihrer Verwundung in perfekter Jägerkonstitution gewesen, und sie trainierte, seit nicht mehr die Gefahr bestand, dass die Wunde wieder aufging.
»Ash!« Janvier legte ihr die Hand auf den Rücken.
»Nicht anfassen!« Zähneknirschend schlug sie auf den Fahrstuhlknopf.
Janvier stellte sich vor sie. »Ich komme mit.«
Das hatte er schon einmal zu ihr gesagt – Ashwini konnte nicht verhindern, dass ihr die Erinnerung daran durch den Kopf schoss. Sie hatten damals zum ersten Mal zusammen einen Auftrag übernommen, waren erklärte Feinde, die sich auf einen vorübergehenden Waffenstillstand geeinigt hatten, und der Auftrag hatte sie nach Atlanta und ins Desaster geführt. Inzwischen stand Janvier ganz offiziell in Verbindung zum Turm und somit rein theoretisch auf derselben Seite wie sie. Sie hatten in Atlanta sehr gut zusammengearbeitet und auch während der Schlacht gleich wieder in denselben fließenden Rhythmus gefunden. Als wäre es ihnen schon immer bestimmt gewesen, ein Paar zu sein.
Und das war einfach scheiße!
»Okay.« Sie wollte sich nicht mit der fürchterlichen, schmerzhaften Trauer auseinandersetzen müssen, die hinter ihrer Wut lag, sie schaffte es nicht. Als der Fahrstuhl ankam und eine ihrer Nachbarinnen entließ, trat sie ohne jeden weiteren Kommentar in die Kabine.
Janvier wartete, bis die andere Frau außer Hörweite war. »Das geht mir zu schnell«, sagte er, die Augen misstrauisch zusammengekniffen. »Ich traue dem Braten nicht, wenn du so bereitwillig kooperierst.«
»Dann lass es doch, komm einfach nicht mit.«
»Nee, so rasch wirst du mich nicht los, Cher.« Er hielt die Tür auf, als sie sich zu schließen drohte, und stieg auch in den Fahrstuhl.
Zum ersten Mal hatte er sie Cher genannt, weil er harmlos ein bisschen hatte flirten wollen, aber daraus war mit den Jahren mehr geworden. Inzwischen war dieses Cher allein ihr vorbehalten, Ashwini hatte ihn nie jemand anderen so anreden hören.
Auf der Fahrt nach unten stand er viel zu dicht neben ihr, duftete viel zu sexy. Ein Angriff auf ihre Sinne, den sie als ärgerlich empfand. Ein zu großer Teil von ihr wollte seinen Kopf zu sich herunterziehen und ihn küssen, wobei ihr durchaus bewusst war, wie das enden würde: Ein Kuss von ihr, und er würde sie gegen die Wand schleudern, sie würde ihm die Beine um die Taille schlingen, und er würde in sie eindringen, während Hände und Münder gierig leckten, berührten, schmeckten …
Die Chemie zwischen Janvier und ihr war nie das Problem gewesen.
Er stieg vor ihr aus dem Fahrstuhl. Sie kam nicht umhin, die Gefahr in der geschmeidigen Gestalt zu bewundern, die ihr innewohnte. Er war groß und schlank gebaut, seine Muskeln waren die eines Langstreckenläufers oder Schwimmers, und er bewegte sich mit einer sinnlichen Anmut, die den Leuten einredete, er sei in Wahrheit keine Bedrohung
Ashwini wusste es besser.
Vor knapp einem Jahr hatte er drei Vampirköpfe an den Turm geschickt, um so die Vollstreckung eines Exekutionsbefehls zu melden. Diese Köpfe hatten vorher auf den Schultern von Vampiren gesessen, die sich als Rudel zusammengetan und Ashwini aufgelauert, sie in die Enge getrieben und aufgeschlitzt hatten. Zwei der Feiglinge hatte sie töten, die anderen verwunden können, und die Köpfe dieser anderen hatte Janvier dann dem Turm geliefert.
Natürlich nicht offen, und natürlich hatte er nie offiziell die Verantwortung für diese Tat übernommen. In der Öffentlichkeit ging man allgemein davon aus, dass die Vampire von ihrem Engel exekutiert worden waren. Auch Ashwini wusste nur deswegen darüber Bescheid, weil Sara die Geschichte direkt von Dmitri erfahren hatte, und Dmitri war als rechte Hand des Erzengels Raphael der mächtigste Vampir im Land.
Mit spöttisch hochgezogener Augenbraue hatte die Gilde-Direktorin Ashwini gegenüber wiederholt, wie Dmitri auf ihre Ankündigung reagiert hatte, die Gilde werde ein Team losschicken, um die gewalttätigen Vampire zu fangen. »Nicht nötig«, hatte Raphaels Stellvertreter trocken bemerkt, »der Cajun hat sich darum gekümmert, die Schwachköpfe hatten sich an seiner Jägerin vergriffen. Jetzt sind sie tot.«
Damals hatte Ashwini zum ersten Mal versucht, eine gewisse Distanz zwischen sich und Janvier zu schaffen, die Verbindung zu kappen, der man doch nicht erlauben durfte, zu wachsen. Aber Janvier hatte das zu verhindern gewusst. Er war ihr bis in die entlegensten Winkel der Welt nachgereist und hatte sie einmal so gereizt, dass sie ihn gefesselt und einen Topf Honig über seinem Kopf ausgeleert hatte, ehe sie so tat, als würde sie gehen und ihn den Insekten überlassen, die bestimmt ihre helle Freude an ihm gehabt hätten.
Er hatte ihre Bemühungen mit einem entzückten Lachen quittiert, seine Fesseln mit einem Messer durchgeschnitten, das ihr entgangen war, und sie anschließend durch den Wald gejagt. Dann hatte er gedroht, er werde sie zwingen, ihm jeden einzelnen Tropfen des süßen, klebrigen Zeugs vom Körper zu lecken. Nach dieser Begegnung hatte sie sich so lebendig gefühlt wie nicht ein einziges Mal in all den Wochen, seit sie beschlossen hatte, von ihm fortzugehen. Danach war sie egoistisch geworden: Sie hatte weiter mit ihm gespielt, ohne ihm zu sagen, dass aus ihrem Flirt nie etwas Dauerhaftes werden konnte.
Ashwinis Wünsche spielten da keine Rolle. Janviers auch nicht. Es gab einfach keine andere Wahl.
3
Janvier saß rittlings auf dem knallroten Motorrad, das er wieder einmal verbotenerweise direkt vor ihrem Haus abgestellt hatte und das von den breiten, orangefarbenen Strahlen, die aus dem Winterhimmel fielen, praktisch vergoldet wurde. Er nahm den Helm vom Lenker, der dort auf ihn gewartet hatte, während er oben bei Ashwini war, und streckte ihn ihr hin.
»Dir ist doch wohl klar, dass wir hier in Manhattan sind?«, fragte sie mit spöttischem Blick auf die zahlreichen Fußgänger um sie herum. Sollte sie wirklich zu ihm auf das Motorrad steigen, so dicht hinter ihm sitzen? In Gegenwart von Janvier traute sich Ashwini selbst nicht mehr. Jedenfalls nicht, solange der wütende Teil ihrer Seele sich einfach nur Zeit für ihn stehlen wollte, egal wie.
Gerade wieder flüsterte ihr ein Stimmchen zu, wie viel angenehmer es doch wäre, den Mann selbst zu reiten und nicht bloß sein Motorrad. Ashwini verschränkte die Arme vor der Brust. »Und hast du auch den Schlüssel in der Zündung stecken lassen?«
Er zuckte die Achseln, den Mund zu einem lässigen Grinsen verzogen. Aber sein Blick blieb wachsam. »Dieses schicke Bike braucht keinen Schlüssel, oh du meine khoobsurat Ash. Spring auf, und ich zeig dir, wie bei meinem Liebling die Elektronik funktioniert.«
Manchmal ließ er Worte aus der Sprache in seine Sätze einfließen, die Ashwini auf dem Schoß ihrer Großmutter gelernt hatte, aber das wunderte sie nicht. Immerhin hatte Janvier seine hundert Jahre Vertragszeit an Nehas Hof abgedient. »Chaque hibou aime son bébé«, erwiderte sie sarkastisch. Diesen etwas verschrobenen Spruch hatte sie beim Stöbern im Internet gefunden, als sie eine von Janviers Bemerkungen übersetzt haben wollte.
Ein anzügliches Feixen ließ seine Augen aufleuchten und ihren Magen Purzelbäume schlagen. »Nenn mich nicht Eule, ich habe schon lange keine Mäuse mehr gefressen! Aber dieses Biest hier liebe ich wirklich. Komm, lass es mich dir vorführen.«
Da nahm sie ihm endlich trotz aller Vorbehalte den Helm ab und setzte ihn auf. Er selbst schien allerdings ohne Helm fahren zu wollen. »Spinnst du?«, knurrte sie ihn an. »Du magst Vampir sein, aber vor Hirnquetschungen schützt dich das auch nicht.« Sie klopfte an seinen Hinterkopf. »Wehe, du hast keinen zweiten Helm dabei.«
»Ich wollte ja bloß wissen, ob dir noch was an mir liegt.« Er zauberte einen zweiten Helm herbei, der anscheinend an einem Teil des Motorrades gehangen hatte, den man nur aus einem bestimmten Blickwinkel heraus sah. Himmel, der Mann legte es wirklich darauf an, dass ihm sein Zeug geklaut wurde. Allerdings zierten den Tank seines Lieblings rechts und links zwei unverwechselbare schwarze Flügelpaare. Vielleicht verließ er sich auf die, denn um sich an Turmeigentum zu vergreifen, musste man als Dieb schon ziemlich dumm sein.
»Junkies ist das egal.« Ashwini deutete auf das Emblem. »Bei denen sind die Hirndrähte falsch verlötet.«
»Weswegen ich auch deinen Portier gebeten habe, meine Schöne ein bisschen im Auge zu behalten.« Er zwinkerte ihr glücklich zu – wie hatte er sie doch lange und erfolgreich auf den Arm nehmen können! Seine Wimpern waren lang, dicht und bogen sich vorn leicht nach oben … »Wo möchten Sie hin, edle Dame? Ich bin heute nur das getreue Ross.«
Sie nannte ihm die Adresse der Tierklinik, schwang sich hinter ihn auf das Motorrad und legte ihm die behandschuhte Rechte auf die Schulter. So von Nahem duftete er womöglich noch köstlicher, irgendwie bissig und gefährlich, aber eine zusätzliche erdige Note machte erst seine ganz eigene Persönlichkeit aus. Janvier konnte gewiss als gebildeter, geschliffener Mann von Welt durchgehen, wenn er es darauf anlegte, steckte aber im Kern seines Wesens voll rauer, sexy Ecken und Kanten.
Mit einem kehligen Röhren erwachte das Motorrad zum Leben. Zwischen Ashwinis Beinen vibrierte es, was sie nach Luft schnappen ließ. Aber als Janvier ihr die Hand auf den Oberschenkel legen wollte, hatte sie ihn schnell wie der Blitz am Handgelenk gepackt. »Augen und Hände bleiben vorn.«
Leise lachend streifte er sich Handschuhe über, ehe er die Hände brav auf den Lenker legte. »Halt dich fest.«
Sie fädelten sich in den dichten Verkehr ein. Ashwini schaffte es, sich nur mit den Schenkeln festzuhalten, die rechte Hand auf Janviers Schulter diente ihr lediglich zur Wahrung des Gleichgewichts. Das reichte aber auch schon, denn seine abgetragene Jacke bot keinen Schutz vor intimem Körperkontakt: Unter ihrer Hand bewegten sich Muskeln und Sehnen, spürte sie Knochen, während er sein Bike geschickt durch das Automeer lenkte.
Nach einer Weile schwebte ein Engel mit bestechend blauen Flügeln herbei, flog dicht über den Autos und brachte einige der Fahrer dazu, langsamer zu werden, so beeindruckend war sein Anblick. Janvier hob die Hand zum Gruß, aber statt einfach zurückzugrüßen, deutete Illium auf den Straßenrand, woraufhin Janvier sein Motorrad aus dem Verkehrsfluss an den Bordstein lenkte und genau dort hielt, wo er nicht hätte halten dürfen, nämlich vor einem Hydranten.
Fast zeitgleich landete Illium auf dem Bürgersteig. Seine Flügel flüsterten leise beim Zusammenfalten. Mit den goldenen Augen, den pechschwarzen Haaren mit dem leichten Blauschimmer und der makellosen Gestalt gehörte Illium zweifellos zu den schönsten Engeln, die Ashwini je gesehen hatte. Doch bei seinem Anblick regte sich bei ihr nichts, er hätte genauso gut eine von Meisterhand erschaffene Marmorstatue sein können.
Nur Janvier drang durch den Stahlpanzer, den sie um ihr Herz errichtet hatte, nur er brachte es fertig, sich in ihrem Innern einzurichten. So, wie er sich vor zweieinhalb Wochen auf ihrer Couch eingerichtet hatte, einen Arm um Ashwini gelegt, den anderen auf der Rücklehne des Sofas. Sie hatten sich einen alten Schwarz-Weiß-Film angesehen, und als sie einzuschlafen drohte, weil ihr Körper noch nicht wieder zu seiner alten Kraft zurückgefunden hatte, hatte er sie ins Bett gebracht und ihr einen Kuss auf die Stirn gedrückt, den sie heute noch spürte.
»Ash!« Illiums goldene Augen funkelten. »Und ich war mir sicher, Janvier unterschreibt seinen eigenen Totenschein, wenn er dich wieder in deinem Bau belagert! Ich hatte dem Bestatter schon Bescheid gesagt.«
»Den werden wir eines Tages bestimmt noch brauchen.« Ashwini schob das Visier ihres Helmes hoch. »Wirf die Nummer nicht weg.«
»Und wieder einmal hast du mich tief verwundet!« Janvier legte sich mit dramatischer Geste die Hand aufs Herz, ehe er sein Visier hochschob. »Warum hast du mich an den Straßenrand gewunken, mein süßes Glockenblümchen? Konntest du nicht sehen, dass ich für meine Ashblade den Chauffeur spiele?«
Illium schob sich ein paar überlange Haarsträhnen aus dem Gesicht. »Gib mir ein Messer«, bat er. »Ich muss das Zeug hier abschneiden, ehe es mich blind macht.«
»Aber nicht hier und jetzt!«, mahnte Janvier. »Das gibt Mord und Totschlag, weil jeder eine Strähne haben will. Ganz zu schweigen von den Qualen, die ein solch barbarischer Akt dem zarten Herzen all jener zufügt, die jeden Millimeter deiner noblen Erscheinung anbeten.«
Illium murmelte etwas von Leuten aus Louisiana, die man schon vor Jahren von hohen Gebäuden hätte werfen sollen, was Janviers guter Laune jedoch keinen Abbruch tat. Ihm reichten die Haare ebenfalls bis in den Nacken, aber er fühlte sich wohl dabei, und Ashwini mochte ihn so. Sie mochte ihn viel zu sehr – ihm mit allen zehn Fingern durch das schwere, seidige Haar zu fahren erfüllte sie mit einer tiefen, reinen Freude, die sie sich bisher nur wenige Male gegönnt hatte. Sie ahnte, wie schnell sie danach süchtig werden könnte.
»Es gibt da ein Problem, mit dem du dich befassen müsstest.« Illium wischte sich schon wieder die Haare aus dem Gesicht. »Die Details sind an dein Handy gegangen.«
»Soll ich mir lieber die Ohren zuhalten?«, fragte Ashwini. Die Jäger hatten Seite an Seite mit Unsterblichen ihre Stadt verteidigt und würden auch wieder gemeinsam mit ihnen antreten, wenn es die Situation verlangte, aber im Alltag war es für die Gesundheit eines Sterblichen oft nicht zuträglich, sich zu sehr in Turmangelegenheiten verwickeln zu lassen. »Ich kann auch gern mit der U-Bahn weiterfahren.« Sie nahm die Hand von Janviers Schulter.
»Nein!«, antworteten Illium und Janvier wie aus einem Munde.
»Siehst du!« Janvier lachte sie an. »Du würdest uns doch nicht gleich allen beiden das Herz brechen wollen, Cher.«
»Um was für ein Problem geht es denn?« Ashwini sah lieber Illium an und versuchte, gar nicht zu beachten, wie sich Janviers Stimme um sie legte. Sinnlich und süß, wie köstliches Karamell. Obwohl er vor über zweihundert Jahren erschaffen worden war, sah und hörte man ihm seine Herkunft aus den Sumpfgebieten Louisianas immer noch deutlich an. Seine Sprache war wie Musik, auch wenn sich ihr Rhythmus im Laufe der Zeit bestimmt geändert hatte.
»Die Rinder eines Vampirs werfen ihm schlechte Behandlung vor.«
Ashwini zuckte zusammen. »Rinder« oder »Vieh«, so nannte man Menschen, die sich frei dafür entschieden hatten, die lebende Nahrungsquelle eines bestimmten Vampirs zu sein. Der Begriff drückte Verachtung aus, und Ashwini hörte ihn nicht gern, konnte es Illium allerdings kaum verdenken, wenn er ihn benutzte. Immerhin hatten die so Bezeichneten sich freiwillig bereit erklärt, von ihren Vampiren wie Nutztiere gehalten zu werden, und durften sich daher nicht wundern, wenn man sie mit Rindern verglich, auch wenn sie in den meisten Fällen sehr gut behandelt und oft auch verwöhnt wurden. »Ich wusste gar nicht, dass Vieh sich beschweren kann, ich dachte, die Leute hätten gar keine Rechte.«
Janvier las sich einen Text auf dem Display seines Handys durch, während er ihr antwortete. »Nicht jedem Vampir macht es Spaß, sein Essen jeden Abend erst einmal verführen oder andernfalls auf Blutbanken zurückgreifen zu müssen. Und wenn mit solchen Arrangements Missbrauch getrieben wird, schadet das der ganzen Vampirbevölkerung.«
Illium reckte das Kinn vor und verschränkte die Arme vor der Brust. »Genau. Wenn sich so etwas herumspricht, bekommen die Sterblichen womöglich kalte Füße.«
»Das könnte sein, nicht wahr?«, sagte Ashwini. Hunderttausende stellten Jahr für Jahr den Antrag auf Erschaffung, obwohl jeder von ihnen bestimmt unzählige Male Zeuge der Brutalität und Gewalt geworden war, die ihr Schicksal werden konnte. Vampir zu werden und damit so gut wie unsterblich zu sein hatte einen Preis: hundert Jahre Dienst bei einem Engel. Erst danach erwartete einen ein ewiges Leben.
Wenn man die Vertragszeit überstand, ohne wahnsinnig zu werden.
»Es wird in dieser Welt immer selbstzerstörerische Idioten geben.« Damit meinte Ashwini nicht Janvier, weswegen sie ihm rasch die Schulter drückte. Sie wusste, warum er Vampir geworden war: Nicht aus der Gier nach endlosem Leben heraus, sondern weil er sich als Grünschnabel in eine Vampirfrau verliebt hatte. Der Begriff Grünschnabel stammte von ihm selbst. Ashwini fühlte mit dem Sterblichen, der Janvier einmal gewesen war, denn sie wusste, er und sie hatten allerhand gemeinsam: Wenn sie liebten, dann mit ganzem Herzen und ganzer Seele. Sie hielten an einer Liebe auch dann noch fest, wenn sie zerstörerisch zu werden drohte.
»Ist es dringend?« Janvier schmiegte sich in ihre Berührung. »Ash muss fast in die gleiche Richtung. Wir könnten uns erst um ihren Auftrag kümmern und dann mit dem hier weitermachen.«
»Es handelt sich erst einmal nur um ein Gerücht«, sagte Illium. »Eine Stunde oder zwei machen da den Kohl auch nicht fett.« Er breitete die Flügel aus, sehr zum Entzücken einiger Teenager, die sich unter dem Vordach des Hauses hinter ihnen versammelt hatten. »Ach, fast hätte ich es vergessen: Es soll nächsten Monat eine Feier geben.«
Ashwini zog die Brauen hoch. »Doch nicht etwa ein Engelsball?« Soweit sie wusste, bekannte sich Elena offen zu ihrer heftigen Abneigung gegen diese »entsetzlich formellen« Veranstaltungen. Angeblich hatte man sie sogar murmeln hören, lieber stäche sie sich eine Gabel ins Auge, als noch einmal bei einem solchen Fest mitzumachen. Ashwini konnte sich nicht vorstellen, dass ihrer Jägerkollegin dieser Standpunkt in der Folge des Krieges abhandengekommen war, trotz ihrer Liaison mit einem verdammt Furcht einflößenden Erzengel.
Illium lachte herzlich, was seine Augen aufleuchten und eine Dame in seiner Nähe so schwanken ließ, dass sie ohne die starken Arme eines Streifenpolizisten umgekippt wäre. »Ellie droht, jeden zu erschießen, der eine solche Farce auch nur vorzuschlagen wagt.«
»Dem Himmel sei Dank.« Ashwini seufzte erleichtert auf. »Ich dachte schon, sie hätte den Verstand verloren und wir müssten intervenieren.«
»Es soll ein ›Stadtteilfest‹ werden, wie Ellie das nennt, und auf den Straßen und Dächern rund um den Turm stattfinden. Alle sind willkommen.«
»Tolle Idee!« Ashwini selbst stand zwar nicht so auf Massenveranstaltungen, hatte aber nichts dagegen, sich mit ein paar Freunden auf irgendeinem Dach zu treffen. Jeder von ihnen hatte in diesem Krieg Freunde verloren, sterbliche Kämpfer oder unsterbliche, sie alle hatten getrauert und trauerten noch. Aber jetzt war es an der Zeit, die Gläser zu heben, auf die verlorenen Kameraden anzustoßen und sich die Stadt aus der Dunkelheit des Krieges zurückzuholen und den Feinden, die New York zum Krüppel hatten machen wollen, alle zusammen den Stinkefinger zu zeigen.
Janvier ließ das Bike aufheulen. »Ich melde mich zurück, sobald ich mir die Misshandlungsgeschichte angesehen habe.«
»Ich bin im Turm.« Mühelos schwang sich Illium mit seinen mächtigen blauen, von feinem Silber durchzogenen Schwingen in die Lüfte.
4
Während der Engel mit den blauen Flügeln auf den Winterwinden direkt zum Balkon vor Dmitris Büro ritt, fragte er sich, ob der Cajun wohl diesmal bei seiner dunkeläugigen Jägerin landen würde. Der Balkon war gerade vom Schnee befreit worden, eine Arbeit, mit der man gewöhnlich die jüngsten Zugänge der Truppe betraute, und zwar Vampire und Engel gleichermaßen. Momentan allerdings, da so viele der Jungen verwundet auf der Krankenstation lagen, kümmerte sich jeder darum, der zwischendurch einmal zehn Minuten Zeit und keine Angst vor körperlicher Arbeit hatte.
Dmitri stand in schwarzer Cargohose und schlichtem schwarzem T-Shirt neben seinem Schreibtisch, hatte aber wohl gerade höchstpersönlich den Schnee von seinem Balkon entfernt, wenn man nach seinen feuchten Haaren gehen wollte. Das würde bestimmt nicht jeder tun, der als rechte Hand und Stellvertreter eines Erzengels fungierte, aber genau deswegen genoss Dmitri solches Vertrauen bei Raphaels Leuten. Trotz der enormen Macht, die er in Händen hielt, war er einer von ihnen geblieben.
Als Illium ins Büro kam, blickte er von der Landkarte auf, die die aktuellen Positionen von Lijuans Streitkräften in China zeigte. »Hast du es gefunden?«
»Trace hat es gefunden.« Illium hatte den schlanken Vampir gebeten, eine bestimmte Spur zu verfolgen, weil die meisten Vampire draußen in der Stadt nicht wussten, dass Trace einer von Raphaels Männern war. »Sie nennen es Umbra.« Er legte eine winzige Ampulle vor Dmitri auf den Schreibtisch, deren Inhalt in der Farbe seinem Namensgeber glich, von der Struktur her aber eher ungewöhnlich war.
Der Stoff in der Ampulle glitzerte wie winzige Glassplitter oder zerstoßene Bonbons.
Dmitri nahm das Fläschchen und hielt es schräg gegen das Licht.
Auf den ersten Blick wirkte der Inhalt erstaunlich schön, aber bei näherem Hinsehen entdeckte man den kränklichen gelben Schimmer der einzelnen Minikristalle.
»Man kaut es?«, wollte Dmitri wissen.
Illium nickte. »Das scheint die bevorzugte Art der Einnahme zu sein. Zumindest bei den Usern, die Trace benennen konnte. Man kommt sehr schlecht an das Zeug heran, der Lieferant gibt sich große Mühe, die Existenz der Droge geheim zu halten und sie nur einer ausgesuchten Kundschaft zugänglich zu machen.«
»Wodurch sie natürlich nur noch wertvoller wird. Exklusivität schafft Nachfrage.« Dmitri legte die Ampulle zurück. »Wirkung?«
»Ein erstaunliches sexuelles Hoch – und man wird gleich beim ersten Mal abhängig.« Trace hatte von der Frau berichtet, der er diese Musterampulle unter erheblichem Einsatz seines Charmes und seiner Verführungskünste hatte abluchsen können: Ein Körnchen Umbra hatte sie in sexuelle Ekstase versetzt, sie hatte ihre Brüste geknetet, die Augen verdreht. »Langzeitfolgen sind unbekannt, Trace zufolge ist die Droge aber auch erst seit zwei Tagen in Umlauf. Wir hatten Glück, dass wir so schnell Wind davon bekamen.«
»Nein, wir hatten kein Glück, wir waren darauf vorbereitet.« Dmitri hatte in den Tagen vor Ausbruch des Krieges mit dem Aufbau eines die ganze Stadt überziehenden Informanten-Netzwerks begonnen, und einige dieser Informanten hatten von wachsender Unruhe in den wohlhabenderen Vampirkreisen berichtet, die wohl mit einer neuen, geheimnisvollen Droge zusammenhing.
Viele dieser Informanten waren Menschen. Einige von ihnen arbeiteten als Blutspender, weil sie sich genetisch gesehen besonders gut dafür eigneten, und das bedeutete einen regelmäßigen Kontakt zu älteren, mächtigen Vampiren. Der besondere Clou des Systems bestand darin, dass den Informanten gar nicht bewusst war, für wen sie arbeiteten, sie gaben ihre Berichte nicht direkt an den Turm weiter. Eine Gruppe der exklusiven Spender arbeitete zum Beispiel mit der Frau als Kontaktperson, die den beliebtesten Vampirclub der Stadt leitete, und ihre Belohnung bestand darin, zum engeren Kreis dieser Frau zu gehören.
Die Idee zu diesem fein gesponnenen, aber mächtigen Netzwerk stammte von Raphael.
»Elena hat mir gezeigt, dass wir nicht all unsere Aktivposten voll nutzen«, hatte der Erzengel seinem Stellvertreter erklärt.
Raphael und Dmitri hatten bei dieser Unterhaltung oben auf dem Dach des Turms gestanden, wo der Wind wie ein wildes Tier an ihren Haaren zerrte und Raphael Strähnen des mitternachtsblauen Haars ins Gesicht schlugen, als er sich zu seinem Stellvertreter umdrehte. »Die Sterblichen sehen Dinge, die wir nicht sehen, achten auf Menschen, die wir nicht beachten.« Raphael hatte sein Gesicht wieder in den Wind gehalten. »Wir brauchen diese Informationen, aber ich werde Elenas Freunde nicht zu tief in die unsterbliche Welt hineinziehen.« Ein durchdringender Blick nach hinten. »Denn das könnte schlimm für sie enden.«
Dmitri wusste, Raphael redete nicht mehr von Elenas Freunden, sondern von den grauenhaften Schrecken in Dmitris eigener Vergangenheit. »Ich mache Ihnen keine Vorwürfe, Sire, das habe ich noch nie getan.« Verantwortlich war der heimtückische Engel, der sie beide gequält hatte. »Ohne Sie hätte ich mir schon vor Ewigkeiten das Herz aus der Brust gerissen und wäre jetzt tot.«
»Ich mache mir selbst Vorwürfe, Dmitri. Elena soll sich nie so fühlen müssen. Bau das Netzwerk mit Menschen auf, die sich freiwillig für eine Existenz am Rande der unsterblichen Welt entschieden haben.«
»Raphael?« Als sich ihm Raphael mit flammendem Blick zuwandte, streckte Dmitri seine Hand nach ihm aus. »Die Vergangenheit ist vorüber, und wenn es je so etwas wie eine Schuld gegeben haben sollte, dann wurde sie an dem Tag getilgt, an dem Sie Honor erschufen.« Vampire, die ein Erzengel erschuf, waren vom ersten Tag an stark, es war schwerer, sie zu verwunden oder zu töten. »Sie sind mein Fürst, aber Sie werden auch immer mein bester Freund sein.«
Raphael hatte seine Hand um den Oberarm seines Stellvertreters gelegt, eine Geste, die Dmitri erwiderte. »Diese Worte hoffe ich auch in tausend Jahren noch von dir zu hören, Dmitri.«
»Darauf können Sie sich verlassen.« Sowohl Raphael als auch Dmitri hätten sich um ein Haar in der heimtückischen Kälte der Unendlichkeit verloren, doch diese Gefahr bestand nun nicht mehr.
Heute machte sich Dmitri mehr Sorgen um Illium. Die meisten Sterblichen und auch Unsterblichen sahen nur den Charme und die unbändige Lust am Leben, die der Engel mit den blauen Flügeln verströmte, aber Dmitri sah auch eine wachsende Kraft und zunehmende Dunkelheit in ihm. Die Dunkelheit wurde eigentlich nur noch von Illiums engem Zusammengehörigkeitsgefühl mit Raphael, Elena und den Sieben in Schach gehalten. Irgendwann jedoch würde eine Zeit kommen, in der seine Macht zu groß sein würde und er nicht mehr in der Stadt bleiben konnte.
Wer würde dann dafür sorgen, dass er … menschlich blieb?
»Wie lange hält so ein Umbrakick vor?« Jetzt musste erst einmal diese Drogensache angegangen werden. Gleichzeitig nahm sich Dmitri fest vor, möglichst bald mit Raphael über Illiums langsamen und fast unmerklichen Abstieg in die Abgründe ihrer Stadt zu sprechen. Sein Erzengel und er kannten diese Abgründe nur zu gut, denn sie wären beide einmal fast darin untergegangen. Anders als andere aus der Gruppe der Sieben konnte man Illium nicht einfach zurück in die Zuflucht beordern, damit er dort Galen und Venom unterstützte. Bei der Art von Macht, die Illium besaß, würde eine Trennung von Elena und besonders auch Aodhan einen etwaigen psychischen Verfall nur noch begünstigen.
»Länger als ein High beim Honigsaugen«, antwortete der blau geflügelte Engel.
Dmitri runzelte die Stirn. Der Stoffwechsel eines Vampirs unterschied sich sehr von dem eines Menschen, und normale Drogen, egal wie stark sie waren, wurden zu schnell abgebaut, um die zu ihrer Beschaffung notwendigen Kosten und Mühen zu rechtfertigen. Beim Honigsaugen trank ein Vampir direkt aus der Vene eines sterblichen Drogenkonsumenten, der sich gerade einen Schuss gesetzt, geschnupft oder sich anderweitig mit dem Gift seiner Wahl versorgt hatte, und verhalf sich damit zu einem Trip, der bis zu zehn Minuten dauern konnte.
»Um wie viel länger?«
»Eine Stunde pro halbem Gramm Umbra.«
Dmitri erstarrte. »Eine Stunde.« Eine solch intensive Wirkung bei Vampiren war noch bei keiner anderen Droge auf dem Planeten beobachtet worden. »Kein Wunder, dass sich das rasend schnell herumgesprochen hat.«
»Trace hat bisher zehn Konsumenten benennen können, allesamt vergoldete Lilien.«
Dmitri wusste, wie das gemeint war: Vergoldete Lilien waren hübsch, aber nutzlos. Ältere, reiche Vampire, deren Sinne nur noch darauf ausgerichtet waren, immer wieder neue Gelüste und Sünden zu entdecken, um der Langeweile zu entgehen, die alles tun würden, um irgendetwas zu fühlen. Dmitri hatte damals, als seine Schmerzen unerträglich wurden, versucht, sich mit ihnen zusammenzutun, hatte aber feststellen müssen, dass er es einfach nicht schaffte, seine Tage mit Nichtstun zu verbringen. Auf eine derart fade, leere Existenz hatte er sich nicht einlassen können, wie selbstzerstörerisch er auch zu der Zeit gewesen war. »Das sind wahrscheinlich die Einzigen, die sich diese Droge leisten können.«
»Es ist aber nicht alles eitel Freude und Sonnenschein bei dem Zeug hier.« Illium strich sich ungeduldig die Haare aus der Stirn. »Während des Hochs hat ein Teil der Junkies das heftige Bedürfnis, sich zu nähren, und zwar ohne alle Hemmungen. Einer der Süchtigen macht momentan einen höllischen Entzug durch, weil er Umbra auf keinen Fall noch einmal anfassen will, und ich weiß nicht, ob er der Einzige ist.«
Dmitri zog eine Braue hoch. »Wie das denn? Denen ist doch alles egal, Hauptsache es ist neu und turnt sie an.« Nachdem sie sich jahrhundertelang jeden Wunsch hatten erfüllen können, waren manche Lilien derart abgestumpft, dass ihr krankhaftes Verlangen nach Neuem, Hellem etwas von einer bedauernswerten Verzweiflung hatte.
»Diese Lilie lebt schon lange in einer Paarbeziehung«, erklärte Illium. »Er hat auf dem Höhepunkt des Highs bei seiner Partnerin getrunken und zwar nicht gerade sanft – ihre Kehle war am Ende nur noch rohes Fleisch, selbst die Halswirbelsäule war bloßgelegt. Man konnte sie richtig sehen. Nur noch wenige Augenblicke, und er hätte sie womöglich durchtrennt und seine Partnerin getötet.«
Dmitri wusste, wie diesem Vampir zumute war, und konnte sich lebhaft vorstellen, wie tief ihm der Schreck in den Gliedern steckte. Echte, tiefe und vertrauensvolle Bindungen waren unter Unsterblichen und besonders unter den Lilien selten, man musste sie schützen. Dmitri würde eher das eigene Leben beenden, als gewaltsam Hand an Honor zu legen. »Gib das unten ab.« Er tippte auf die Ampulle. »Sie sollen das Zeug auf alle nur erdenklichen Inhaltsstoffe testen.«
Illium nahm das Fläschchen.
»Sag Trace, er kann mir in Zukunft direkt Bericht erstatten«, fügte Dmitri hinzu. »Ich möchte, dass du dich auf die Arbeit mit den Männern und Frauen konzentrierst, die die Heiler entlassen haben.« Bedeutende Teile der Turmtruppen waren nach wie vor nicht einsatzfähig, obgleich eine ganze Reihe der verwundeten Krieger inzwischen zumindest schon mal wieder laufen konnte. Dmitri brauchte Illium jetzt, damit er sich um das Training dieser Leute kümmerte. Nur unter kundiger Anleitung und mit viel harter Arbeit würden sie es schaffen, innerhalb kurzer Zeit wieder kampffähig zu werden.
»Berate dich mit Galen, und dann legt ihr beide mir einen brauchbaren Plan vor«, fuhr Dmitri fort. Nach den Spannungen, die es in jüngster Zeit in der Zuflucht gegeben hatte, war der Waffenmeister dort noch unentbehrlicher als sonst. Er stand den anderen aus der Gruppe der Sieben natürlich trotzdem aus der Ferne mit Rat und Tat zur Seite. »Die ersten Befehle hat er bereits durchgegeben.«
Illium verneigte sich tief, begleitet von einer anmutigen Handbewegung. »Jawohl, oh mein dunkler Herr und Meister.«