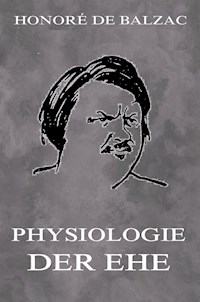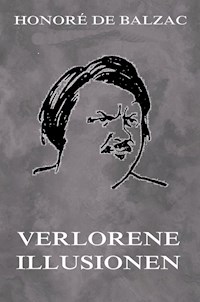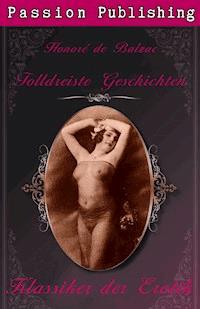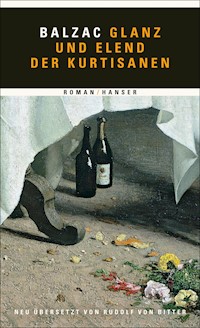
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Wer die Gegenwart verstehen will, muss Balzac lesen!“ Deutschlandradio Kultur – Ein Klassiker in neuer Übersetzung
Balzacs Herzstück der ‚Comédie humaine‘. Mit der Julirevolution 1830 ist die Monarchie in Frankreich geschlagen. Ein entfesseltes Bürgertum übernimmt die Macht, und alles wird käuflich; Liebe, Ansehen, Einfluss. Eine Gesellschaft entsteht, die unserer heutigen in vielem ähnelt, bestimmt von Vergnügungs- und Verschwendungssucht auf der einen Seite, durch Einsamkeit und Armut auf der anderen. Und es gibt neue Medien – die Presse! Balzac sagt darüber: „Man richtet die Presse zugrunde, wie man eine Gesellschaft zugrunde richtet: indem man ihr alle Freiheit lässt.“ Alle Freiheiten nimmt sich auch Vautrin. Er schreckt vor kaum einem Verbrechen zurück und hat dennoch immer das bessere Ende für sich. Oder doch nicht?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1067
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
»Wer die Gegenwart verstehen will, muss Balzac lesen!« Deutschlandradio Kultur — Ein Klassiker in neuer ÜbersetzungBalzacs Herzstück der ›Comédie humaine‹. Mit der Julirevolution 1830 ist die Monarchie in Frankreich geschlagen. Ein entfesseltes Bürgertum übernimmt die Macht, und alles wird käuflich; Liebe, Ansehen, Einfluss. Eine Gesellschaft entsteht, die unserer heutigen in vielem ähnelt, bestimmt von Vergnügungs- und Verschwendungssucht auf der einen Seite, durch Einsamkeit und Armut auf der anderen. Und es gibt neue Medien — die Presse! Balzac sagt darüber: »Man richtet die Presse zugrunde, wie man eine Gesellschaft zugrunde richtet: indem man ihr alle Freiheit lässt.« Alle Freiheiten nimmt sich auch Vautrin. Er schreckt vor kaum einem Verbrechen zurück und hat dennoch immer das bessere Ende für sich. Oder doch nicht?
Honoré de Balzac
Glanz und Elend der Kurtisanen
Roman
Herausgegeben und übersetzt von Rudolf von Bitter
Hanser
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Fußnoten
Über Honoré de Balzac
Impressum
Inhalt
Teil I
: Wie leichte Mädchen lieben
Teil II
: Was die Liebe alte Männer kostet
Teil III
: Wohin die schlechten Wege führen
Teil IV
: Vautrins letzte Wandlung
Anhang
Bibliografische Angaben
Vorworte
Verzeichnis der Figuren
Verzeichnis historischer Persönlichkeiten
Zeittafel
Anmerkungen
Teil I
Wie leichte Mädchen lieben
Eine Szene beim Opernball
Beim letzten Opernball des Jahres 1824 fiel einigen der Maskierten die Schönheit eines jungen Mannes auf, der auf den Fluren und im Foyer umherging wie jemand, der nach einer Frau schaut, die aufgrund unvorhergesehener Umstände nicht gekommen ist. Das Geheimnis eines solchen Umhergehens, mal hastig, mal gelassen, kennen nur alte Frauen und wenige altgediente Müßiggänger. Bei dieser riesigen Zusammenkunft hat kaum jemand Augen für die anderen, jeder folgt seiner Leidenschaft, selbst der Müßiggang ist geschäftig. Der junge Dandy war so in Anspruch genommen von seiner unruhigen Suche, dass er gar nicht bemerkte, was für einen Anklang er fand: Die scherzhaft bewundernden Ausrufe bestimmter Masken, das aufrichtige Staunen, die gehässigen Gebärden, die beifälligsten Bemerkungen sah und hörte er nicht. Obwohl er durch seine Schönheit den außergewöhnlichen Persönlichkeiten vergleichbar war, die den Opernball besuchen, um dort ein Abenteuer zu erleben, und die das erwarten, wie man zu Zeiten von Frascatis Spielcasino auf die richtige Zahl im Roulette wartete, schien er, selbstgewiss wie ein Bürger, seines Abends sicher zu sein. Er musste der Held eines jener Drei-Personen-Geheimnisse sein, die den Maskenball der Oper prägen, die aber nur denen bekannt sind, die darin ihre Rolle spielen. An diesen Abenden muss die Oper für die jungen Frauen, die hingehen, um sagen zu können: Ich war auch da, für die Leute aus der Provinz, für die unerfahrene Jugend und für die Fremden ein Palast der Langeweile und Ermüdung sein. Diese träge und dichte schwarze Menge, die kommt, geht, sich schlängelt, wendet und wieder umwendet, treppauf und treppab steigt und die man allenfalls vergleichen kann mit Ameisen auf ihrem Haufen, ist für sie nicht besser zu verstehen als die Börse für einen bretonischen Bauern, dem die Existenz eines Hauptbuchs unbekannt ist. Bis auf seltene Ausnahmen maskieren sich in Paris die Männer nicht: Ein Herr im Domino-Kostüm sieht lächerlich aus. An diesem Punkt zeigt sich das Geniale im Wesen der Franzosen. Diejenigen, die ihr Glück verbergen wollen, können zum Opernball gehen, ohne dort zu erscheinen, und die Masken, die dort absolut hinmüssen, kommen bald wieder heraus. Eins der unterhaltsamsten Schauspiele ist mit der Eröffnung des Balls das Gedränge am Einlass, das der Strom der Leute verursacht, die hinauswollen und die auf die stoßen, die hineinwollen. So sind die maskierten Herren vermutlich eifersüchtige Ehemänner, die ihren Frauen nachspionieren, oder attraktive Ehemänner, die ihrerseits nicht überwacht werden wollen; zwei gleichermaßen lachhafte Situationen. Dem jungen Mann folgte, ohne dass er es ahnte, ein auffälliger Maskenträger, kurz und stämmig und in einer fließenden Bewegung wie ein rollendes Fass. Für jeden, der sich beim Opernball auskannte, ließ dieser Umhang auf einen Verwaltungsbeamten, einen Geldwechsler, einen Bankier, einen Notar schließen, irgendeinen Bürger voll Verdacht gegen seine Ungetreue. In der höheren Gesellschaft hat nämlich niemand Interesse an demütigenden Beweisen. Mehrere Masken hatten einander schon lachend auf diese monströse Gestalt aufmerksam gemacht, andere hatten sie angeherrscht, ein paar junge Leute hatten sie verspottet. Seine breiten Schultern und seine Haltung strahlten deutliche Geringschätzung für diese gehaltlosen Sticheleien aus; wie ein verfolgtes Wildschwein, das sich um die Kugeln nicht kümmert, die ihm um die Ohren pfeifen, oder um die Hunde, die ihm hinterherbellen, ging er, wohin ihm der junge Mann vorausging. Obwohl alles auf dem Opernball durcheinandergeht und das Vergnügen und die Sorge auf den ersten Blick dieselbe Verkleidung tragen, die bekannte venezianische schwarze Robe, finden und erkennen sich die unterschiedlichen Kreise, aus denen die Pariser Gesellschaft besteht, und beobachten einander. Es gibt für ein paar Eingeweihte so präzise Merkmale, dass man dies Buch mit sieben Siegeln lesen könnte wie einen Roman, der unterhaltsam wäre. Für die geübten Ballbesucher konnte dieser Mann also nichts mit einer Frau ausgemacht haben, denn sonst hätte er ein verabredetes Zeichen, rot, weiß oder grün, getragen, das auf die lang geplanten Freuden hinweist. War hier Rache im Spiel? Beim Anblick des Maskierten, der so dicht hinter einem Mann herlief, der den Frauen gefiel, wandten sich ein paar der Müßigen wieder dem schönen Gesicht zu, auf das die Freude ihren göttlichen Schimmer gelegt hatte. Der junge Mann machte neugierig: Je länger er umherschritt, desto mehr Interesse weckte er. Alles an ihm ließ auf die Gewohnheiten eines eleganten Lebens schließen. Gemäß einem unausweichlichen Gesetz unserer Zeit gibt es kaum einen Unterschied, äußerlich oder innerlich, zwischen dem vornehmsten, besterzogenen Sohn eines Herzogs oder Pairs und diesem reizenden Jungen, den das Elend eben noch mitten in Paris in seinen eisernen Klauen gehalten hatte. Die Schönheit, die Jugend konnten bei ihm die tiefen Abgründe überdecken wie bei vielen jungen Leuten, die in Paris eine Rolle spielen wollen, ohne das für ihre Ansprüche nötige Geld zu haben, und die jeden Tag alles auf eine Karte setzen, indem sie dem meistverehrten Gott dieser königlichen Stadt opfern, dem Zufall. Wie auch immer, seine Kleidung, seine Manieren waren vollendet, er schritt über das edle Parkett des Foyers wie ein regelmäßiger Opernbesucher. Wer hat noch nicht bemerkt, dass es hier wie überall in Paris eine Art des Auftretens gibt, aus der sich ableiten lässt, was Sie sind, was Sie tun, woher Sie kommen und was Sie wollen?
»Was für ein schöner junger Mann! Hier können wir umkehren, um ihn anzuschauen«, sagte eine Maske, in der die geübten Teilnehmer des Opernballs eine Dame der besseren Gesellschaft erkannten.
»Erinnern Sie sich nicht an ihn?«, antwortete ihr der Herr, der ihr den Arm bot, »Madame du Châtelet hat ihn Ihnen doch vorgestellt …«
»Was! Das ist dieser Apothekersohn, in den sie sich verknallt hatte, der dann unter die Journalisten gegangen ist, der Liebhaber von Mademoiselle Coralie?«
»Ich hätte gedacht, er sei zu tief gefallen, um jemals wieder hochzukommen, ich fasse es nicht, wie er in der Pariser Gesellschaft wieder auftauchen kann«, meinte Graf Sixte du Châtelet.
»Er tritt auf wie ein Prinz«, sagte die Maske, »und das hat er bestimmt nicht von der Schauspielerin, mit der er zusammen gelebt hat; meine Cousine hat ihn zwar entdeckt, hat ihn aber zu nichts Besserem machen können. Die Geliebte dieses Ritters ohne Tadel würde ich zu gerne kennenlernen, sagen Sie mir etwas über sein Leben, womit ich ihn neugierig machen könnte.«
Dieses Paar, das dem jungen Mann tuschelnd folgte, wurde aufmerksam beobachtet von dem Maskierten mit den breiten Schultern.
»Lieber Monsieur Chardon«, sagte der Präfekt der Charente und nahm den Schönling am Arm, »darf ich Sie einer Dame vorstellen, die die Bekanntschaft mit Ihnen erneuern möchte …«
»Lieber Graf Châtelet«, erwiderte der junge Mann, »diese Dame hat mir klargemacht, wie albern der Name war, mit dem Sie mich ansprechen. Auf Anordnung des Königs wurde mir der der Vorfahren meiner Mutter zurückgegeben, der Rubempré. Auch wenn die Zeitungen das gemeldet haben, ist die betreffende Person so unbedeutend, dass es mir gar nicht peinlich ist, es meinen Freunden, meinen Feinden und den Außenstehenden in Erinnerung zu rufen. Sie können sich selbst einschätzen, wie Sie möchten, aber ich bin mir sicher, dass Sie ein Verhalten nicht verurteilen werden, zu dem mir Ihre Frau Gemahlin geraten hat, als sie noch einfach Madame de Bargeton war. (Dieser hübsche Seitenhieb, über den die Marquise lächeln musste, verursachte dem Präfekten der Charente ein nervöses Zucken.) — Richten Sie ihr doch aus«, fügte Lucien hinzu, »dass ich jetzt als Wappen einen wilden Stier in Silber auf weidengrün vor rotem Grund trage.«
»Wild auf Silber«, wiederholte Châtelet.
»Die Marquise wird es Ihnen erklären, wenn Sie nicht wissen, warum dies alte Wappenschild um einiges besser ist als der Kammerherrenschlüssel und die Bienen in Gold aus dem Kaiserreich, die Sie zum großen Leidwesen von Madame Châtelet, geborene Nègrepelisse d’Espard, im Wappen tragen …«, fügte Lucien rasch an.
»Nachdem Sie mich schon erkannt haben, kann ich Sie wohl kaum noch überraschen; ich kann Ihnen aber gar nicht sagen, wie sehr Sie mich überraschen«, sagte ihm die Marquise d’Espard leise, ganz erstaunt über die Aufsässigkeit und die Selbstsicherheit, die der junge Mann an den Tag legte, auf den sie früher herabgeblickt hatte.
»Erlauben Sie mir doch, Madame, die einzige Möglichkeit zu wahren, die ich habe, Sie in Gedanken zu beschäftigen, indem ich in dieser geheimnisvollen Ungenauigkeit verbleibe«, sagte er mit dem Lächeln eines Mannes, der ein sicheres Glück nicht gefährden will.
Die Marquise konnte ein abruptes Zucken nicht unterdrücken, so sprachlos war sie über Luciens Bestimmtheit.
»Mein Kompliment zu Ihrem Standeswechsel«, sagte ihm Graf du Châtelet.
»Das nehme ich an, wie Sie es mir machen«, gab Lucien zurück und verneigte sich in vollendeter Höflichkeit vor der Marquise.
»Der Schnösel!«, meinte der Graf mit gesenkter Stimme zu Madame d’Espard, »hat er es doch noch geschafft, seine Vorfahren zu kapern.«
»Dünkelhaftigkeit uns gegenüber zeugt bei jungen Leuten fast immer von einer Liebschaft in sehr hoher Stellung, wogegen sie bei jemandem wie Ihnen auf missglückte Liebe schließen lässt. Darum würde ich gerne wissen, welche von unseren Freundinnen diesen schönen Vogel unter ihre Fittiche genommen hat; dann hätte ich heute Abend vielleicht etwas zu lachen. Mein anonymes Briefchen wäre womöglich eine Gehässigkeit, die sich eine Konkurrentin ausgedacht hat, es geht darin nämlich um diesen jungen Mann; seine Unverschämtheit wird ihm jemand vorgegeben haben. Behalten Sie ihn im Auge. Ich nehme inzwischen den Arm von Herzog de Navarreins. Sie wissen, wo Sie mich finden.«
In dem Moment, als sich Madame d’Espard ihrem Verwandten zuwenden wollte, drängte sich der geheimnisvolle Maskierte zwischen sie und den Herzog, um ihr ins Ohr zu sagen: »Lucien liebt Sie, er hat das Briefchen geschrieben; Ihr Präfekt ist sein größter Feind, wie hätte er sich Ihnen in dessen Gegenwart erklären können?«
Der Unbekannte entfernte sich und hinterließ Madame d’Espard im Bann einer doppelten Überraschung. Die Marquise kannte niemanden auf der Welt, der fähig gewesen wäre, die Rolle dieser Verkleidung auszufüllen; sie fürchtete eine Falle, suchte nach einem Sitzplatz und verbarg sich. Graf Sixte du Châtelet, dessen ehrgeiziges du Lucien derart deutlich ausgelassen hatte, dass es nach einer lang ersehnten Rache klang, lief in gewissem Abstand diesem wundervollen Dandy hinterher und traf bald auf einen jungen Mann, von dem er glaubte, dass er mit ihm offen sprechen könne.
»Ja sieh an, Rastignac. Haben Sie Lucien gesehen? Er ist ein ganz neuer Mensch.«
»Sähe ich auch so gut aus, wäre ich noch reicher als er«, antwortete der junge elegante Mann leichthin in einem durchtriebenen Ton, mit dem er eine Doppeldeutigkeit durchklingen ließ.
»Nein«, sagte ihm der breitschultrige Maskierte ins Ohr und gab ihm mit der Art, wie er die eine Silbe aussprach, sein Scherzwort tausendfach zurück.
Rastignac, der nicht der Mann war, eine Beleidigung zu schlucken, stand wie vom Blitz getroffen und ließ sich von einem eisernen Griff, aus dem er sich nicht lösen konnte, in eine Fensternische ziehen.
»Junger Gockel, der gerade mal aus Mama Vauquers Hühnerstall raus ist, Sie, dem das Herz in die Hose gerutscht ist, als es darum ging, die Millionen von Papa Taillefer zu greifen, nachdem die Hauptarbeit getan war, lassen Sie sich zu Ihrer persönlichen Sicherheit sagen, dass, wenn Sie sich nicht zu Lucien verhalten wie zu einem geliebten Bruder, wir Sie in unserer Hand haben und nicht Sie uns in Ihrer. Schweigen und Gehorsam, oder ich mische mich in Ihr Spiel und werfe Ihre Kegel um. Lucien de Rubempré steht im Schutz der größten Macht unserer Zeit, der Kirche. Wählen Sie zwischen Leben und Tod. Ihre Antwort?«
Rastignac erfasste ein Schwindelgefühl wie einen Mann, der im Wald eingeschlafen ist und neben einer ausgehungerten Löwin erwacht. Er hatte Angst, und keine Zeugen: Dann nämlich verfallen auch die Mutigsten der Angst.
»Er ist ja der Einzige, es zu wissen … und es zu wagen …«, murmelte er.
Der Maskierte presste seine Hand, um ihn daran zu hindern, den Satz zu Ende zu bringen: »Verhalten Sie sich, als wäre er das«, sagte er.
Weitere Masken
Rastignac verhielt sich wie ein Millionär auf der Landstraße, auf den ein Räuber seine Waffe richtet: Er gab nach.
»Mein lieber Graf«, sagte er zu Châtelet, zu dem er sich wieder gesellte, »wenn Ihnen an Ihrer Position gelegen ist, behandeln Sie Lucien de Rubempré wie jemanden, der eines Tages weit höher steht als Sie.«
Der Maskierte zeigte fast unmerklich seine Zufriedenheit, dann machte er sich wieder an die Verfolgung Luciens.
»Da haben Sie Ihre Meinung über ihn aber schnell geändert, mein Lieber«, erwiderte der Präfekt mit berechtigtem Staunen.
»Genauso schnell wie die, die zum Zentrum gehören und mit der Rechten stimmen«, erwiderte Rastignac diesem Abgeordneten und Präfekten, dessen Stimme im Parlament seit wenigen Tagen der Regierung fehlte.
»Gibt es heute überhaupt noch Meinungen? Es gibt nur noch Interessen«, warf des Loupeaulx ein, der sie hörte. »Worum geht es?«
»Um den Monsieur de Rubempré, den mir Rastignac als Persönlichkeit verkaufen will«, meinte der Abgeordnete zum Generalsekretär.
»Mein lieber Graf«, gab des Loupeaulx gravitätisch zurück, »Monsieur de Rubempré ist ein höchst verdienstvoller junger Mann und er hat so viel Rückendeckung, dass ich mich sehr glücklich schätzen würde, wenn ich mit ihm wieder in Kontakt kommen könnte.«
»Da! Schaut mal, wie einer ins Wespennest der losen Vögel unserer Zeit tappt«, sagte Rastignac.
Die drei Gesprächspartner wandten sich in Richtung einer Ecke, wo ein paar Schöngeister standen, mehr oder minder berühmte Männer, und mehrere modische Gecken. Diese Herren tauschten ihre Bemerkungen, ihre Witzchen und Bosheiten in dem Bestreben aus, sich zu amüsieren, oder in der Erwartung, etwas Amüsantes zu erleben. In dieser kurios gemischten Gruppe gab es welche, zu denen Lucien Beziehungen gehabt hatte, die aus zur Schau gestellten guten Taten und verdeckten Bärendiensten bestanden hatten.
»Ja, Lucien! Mein Junge, mein Lieber, da sind wir ja wieder, neu in Schuss und Form gebracht. Woher des Wegs? Da haben wir uns also mithilfe der Gaben aus Florines Boudoir wieder in den Sattel geschwungen. Gratuliere, mein Bester!«, wandte sich Blondet an ihn und ließ Finots Arm los, um Lucien vertraulich zu umfassen und an sein Herz zu drücken.
Andoche Finot war der Eigentümer einer Zeitschrift, für die Lucien beinah gratis gearbeitet hatte, und die Blondet durch seine Mitarbeit bereicherte, mit der Klugheit seiner Ratschläge und der Durchdachtheit seiner Ansichten. Finot und Blondet waren wie Bertrand und Raton; mit dem Unterschied, dass La Fontaines Kater erst am Ende bemerkt, dass er hereingelegt worden ist, während Blondet im Wissen, dass er ausgenutzt wurde, weiterhin für Finot arbeitete. Dieser glänzende Held der Feder sollte tatsächlich für lange Zeit Sklave sein. Finot verbarg einen brutalen Willen unter seinem plumpen Äußeren, unter schläfrig dreister Dummheit, die mit Witz versetzt war wie das mit Knoblauch eingeriebene Brot eines Tagelöhners. Er verstand es, einzuheimsen, was er auflas, die Gedanken wie die Taler, quer über die Felder des flatterhaften Lebens, das die Literaten und die Politiker führen. Zu seinem eigenen Unglück hatte Blondet seine Kraft in den Dienst seiner Laster und seiner Bequemlichkeit gestellt. Immer überrascht von der Not, gehörte er dem armen Stamm der herausragenden Personen an, die für den Erfolg der anderen alles bewirken können und für den eigenen nichts; Aladine, die ihre Lampe weggeben. Diese bewundernswerten Ratgeber haben einen umsichtigen und genauen Verstand, wenn er nicht von persönlichen Interessen hin- und hergerissen wird. Bei ihnen ist es der Kopf, und nicht der Arm, der handelt. Daher das Durcheinander ihrer Sitten und daher auch der Tadel, mit dem kleinere Geister sie überziehen. Blondet teilte sein Geld mit dem, den er am Vorabend gekränkt hatte; er dinierte, trank und bettete sich mit dem, den er tags darauf niedermachen würde. Seine amüsanten Paradoxe rechtfertigten alles. Indem er die ganze Welt als einen Spaß auffasste, wollte er nicht ernst genommen werden. Jung, geliebt, beinah berühmt, glücklich, kümmerte er sich nicht, wie Finot, darum, das Vermögen zu erwerben, das ein älterer Mann benötigt. Der größte Mut ist wahrscheinlich der, dessen Lucien in diesem Moment bedurfte, um Blondet das Wort abzuschneiden, wie er es soeben mit Madame d’Espard und Châtelet getan hatte. Leider stand bei ihm das Auskosten der Eitelkeit dem stolzen Anspruch im Weg, der wohl die Voraussetzung für viele große Dinge ist. Seine Eitelkeit hatte in der vorhergegangenen Begegnung triumphiert: Er hatte sich reich, glücklich und herablassend gegenüber zwei Personen gezeigt, die ihn früher als arm und elend geringeschätzt hatten; aber konnte ein Dichter, wie ein gealterter Diplomat, zwei sogenannte Freunde vor den Kopf stoßen, die ihn, als es ihm schlecht ging, aufgenommen hatten, bei denen er in Tagen der Not hatte übernachten dürfen? Finot, Blondet und er hatten sich gemeinsam treiben lassen, sie hatten Orgien gefeiert, bei denen nicht allein das Geld ihrer Gläubiger draufging. Wie Soldaten, die mit ihrem Mut nichts anfangen können, tat Lucien das, was in Paris viele Leute tun: Er verriet erneut seinen Charakter und nahm Finots Händedruck an und verweigerte sich nicht der Liebkosung Blondets. Wer immer im Journalismus gelandet war oder noch ist, unterliegt dem grausamen Zwang, die Leute zu grüßen, die er verachtet, seinem schlimmsten Feind zuzulächeln, sich mit der stinkendsten Niedertracht gemein zu machen, sich die Hände zu beschmutzen, wenn er es Angreifern mit gleicher Münze heimzahlen will. Man gewöhnt sich daran zu sehen, dass Übles getan wird, und es geschehen zu lassen; man fängt an, es gutzuheißen, und tut es am Ende selbst. Auf die Dauer wird die verschmutzte Seele von den ständigen beschämenden Kompromissen klein, die Kraft zu edlen Gedanken erlahmt und die banalen Phrasen dreschen sich ganz ungewollt von selbst. Die Alcestes werden Philintes, die Charaktere weichen auf, die Talente verkommen, der Glaube an große Werke schwindet. Wer auf seine Seiten stolz sein wollte, verplempert sich in trostlosen Artikeln, von denen ihm sein Gewissen sagt, dass sie nichts anderes sind als Übeltaten. Man war angetreten, wie Lousteau, wie Vernou, um ein großer Schriftsteller zu werden, und endet als bedeutungsloser Schreiberling. Dementsprechend kann man gar nicht genug die Leute ehren, deren Charakter sich auf der Höhe ihres Talents gehalten hat, die d’Arthez, die imstande sind, sich sicheren Schritts zwischen den Klippen des literarischen Lebens zu bewegen. Lucien wusste keine Antwort auf Blondets Geschmeichel, dessen Witz ihn unwiderstehlich verführte, der die Wirkung eines Verderbers auf seinen Schüler behalten hatte und der außerdem bestens in der Gesellschaft etabliert war durch sein Verhältnis mit der Gräfin de Montcornet.
»Haben Sie von einem Onkel geerbt?«, fragte Finot belustigt.
»Ich habe mit System, wie Sie, die Dummen geschröpft«, gab Lucien in demselben Ton zurück.
»Der Herr hätte also eine Zeitschrift, irgendein Blatt?«, fuhr Andoche Finot mit der unverschämten Selbstgefälligkeit fort, die der Ausbeuter gegenüber seinem Ausgebeuteten entfaltet.
»Noch besser«, gab Lucien zurück, dem seine von der aufgesetzten Überlegenheit des Chefredakteurs gekränkte Eitelkeit half, in die Haltung seiner neuen Position zurückzufinden.
»Ja, und was, mein Lieber?«
»Ich habe eine Partei.«
»Es gibt eine Lucien-Partei?«, lächelte Vernou.
»Siehst du, Finot, da hat dich der Junge schon hinter sich gelassen, ich habe es dir vorausgesagt. Lucien hat Talent, du hast ihn nicht geschont, du hast ihn verschlissen. Gehe in dich, grober Flegel«, versetzte Blondet.
Listig wie ein Moschustier witterte Blondet mehr als ein Geheimnis in Tonfall, Haltung, Auftritt Luciens; mit seiner Beschwichtigung gelang es ihm, die Zügel straffer zu ziehen. Er wollte die Gründe für Luciens Rückkehr nach Paris erfahren, seine Pläne und seine Existenzgrundlage.
»Beuge das Knie vor einer Erhabenheit, die du niemals erlangen wirst, auch wenn du Finot bist!«, fuhr er fort. »Nimm den Herrn, und zwar sofort, in den Kreis der starken Typen auf, denen die Zukunft gehört, er ist einer von uns. Muss er nicht, so geistreich und schön, über die quibuscumque viis ans Ziel gelangen? Da steht er in seiner Mailänder Rüstung, den mächtigen Dolch halb gezogen und sein Banner gehisst! Potztausend! Lucien, wo hast du diese schicke Weste geklaut? Nur die Liebe ist imstande, solche Stoffe zu entdecken. Haben wir schon eine Wohnung? Gerade jetzt brauche ich die Adressen aller meiner Freunde, ich weiß nicht, wo ich schlafen kann. Finot hat mich für heute Abend vor die Tür gesetzt unter dem primitiven Vorwand einer guten Gelegenheit.«
»Mein Lieber«, antwortete Lucien, »ich habe ein Prinzip umgesetzt, mit dem man sicher und in Frieden lebt: Fuge, late, tace. Ich gehe jetzt.«
»Ich lasse dich aber nicht gehen, solange du mir nicht eine heilige Schuld beglichen hast, dies kleine Nachtmahl, nicht wahr?«, sagte Blondet, der ein wenig zu sehr das gute Essen liebte und sich selbst einlud, wenn er ohne Geld dastand.
»Welches Nachtmahl?«, fragte Lucien mit einer ungeduldigen Geste.
»Das erinnerst du nicht? Daran erkenne ich, wie gut es einem Freund geht: Dass er sich nicht mehr erinnert.«
»Er weiß, was er uns schuldig ist, ich bürge für sein Herz«, griff Finot Blondets Spaß auf.
»Rastignac«, sagte Blondet und fasste den jungen Stutzer am Arm, als er im Foyer zu der Säule kam, an der die angeblichen Freunde beisammenstanden, »es geht um ein Nachtessen: Sie sind dabei … Vorausgesetzt, der Herr«, fuhr er ernst fort und wies auf Lucien, »will nicht eine Ehrenschuld in Abrede stellen; er wäre imstande.«
»Monsieur de Rubempré, ich lege die Hand ins Feuer, ist dazu nicht imstande«, sagte Rastignac, der an alles andere als einen schlechten Scherz dachte.
»Und da kommt Bixiou«, rief Blondet, »er kommt mit: ohne ihn sind wir nicht vollzählig. Ohne ihn macht mir der Champagner die Zunge schwer und ich finde alles langweilig, sogar meine eigenen Sprüche.«
»Meine Freunde«, sagte Bixiou, »wie ich sehe, habt ihr euch um das Wunder des Tages versammelt. Unser lieber Lucien hat sich darangemacht, die Metamorphosen des Ovid fortzusetzen. So wie sich die Götter in einzigartige Gemüse und anderes verwandelt haben, um die Frauen zu verführen, hat er sich von einer Distel in einen Edelmann verwandelt, um wen zu verführen? Charles X.! Mein kleiner Lucien«, meinte er und fasste Lucien an einem Jackenknopf, »ein Journalist, der hochherrschaftlich wird, verdient, groß rauszukommen. An deren Stelle«, meinte der gnadenlose Spötter und wies auf Finot und Vernou, »würde ich mir dich in ihrer kleinen Zeitung vornehmen; du brächtest denen um die hundert Franc, zehn Spalten guter Sprüche.«
»Bixiou«, sagte Blondet, »vierundzwanzig Stunden vor und zwölf Stunden nach der Feier ist uns ein Amphitryon heilig: Unser berühmter Freund lädt uns zum Diner.«
»Wie! Wie!«, fuhr Bixiou fort, »was wäre nötiger als die Rettung eines großen Namens vor dem Vergessen, als die Ausstattung des notleidenden Adels mit einem Mann von Talent? Lucien, die Presse schätzt dich, deren schönster Schmuck du gewesen bist, und wir halten zu dir. Finot, eine Notiz bei den Pariser Lokalmeldungen! Blondet, eine hinterhältige Glosse auf Seite vier deiner Zeitung! Verkünden wir das Erscheinen des schönsten Buchs unserer Zeit, Der Bogenschütze Karls IX.! Beknien wir Dauriat, uns bald mit den Margeriten zu beschenken, diesen göttlichen Sonetten des französischen Petrarca! Heben wir unseren Freund auf den Schild des besteuerten Papiers, das Ruhm verschafft und vernichtet!«
»Wenn du ein Abendessen willst«, sagte Lucien zu Blondet, um sich von dieser Schar freizumachen, die anzuwachsen drohte, »finde ich, wäre es nicht nötig gewesen, Hyperbel und Parabel auf einen alten Freund anzuwenden, als wäre der ein Garnichts. Bis morgen Abend bei Lointier «, sagte er lebhaft, als er eine Frau kommen sah, zu der er eilig aufbrach.
»Oh! Oh! Oh!«, spöttelte Bixiou in drei Tonlagen, als erkenne er die Maskierte, zu der Lucien trat, »dies verlangt nach einer Klärung.«
La Torpille
Und er folgte dem hübschen Paar, schritt ihm voraus, musterte es mit wachem Blick und kehrte zur großen Befriedigung all derer zurück, die neidvoll wissen wollten, was es mit Luciens neuem Glück auf sich hatte.
»Meine Freunde, das große Glück des Herrn de Rubempré kennt ihr schon längst«, sagte ihnen Bixiou, »es ist die frühere Ratte von des Lupeaulx.«
Eine der heute vergessenen Abartigkeiten, die aber zu Beginn des Jahrhunderts noch üblich waren, bestand im Luxus der Ratten. Ratte, als Ausdruck schon außer Gebrauch, hießen Kinder von zehn, elf Jahren, Komparsen auf der Bühne, vor allem an der Oper, die die Wüstlinge zu Laster und Gemeinheit erzogen. Eine Ratte war eine Art Höllenplage, ein weibliches Straßenkind, dem man seine Streiche verzieh. Die Ratte konnte sich alles greifen; man musste sich vor ihr in Acht nehmen wie vor einem gefährlichen Tier, sie trug eine Fröhlichkeit ins Leben wie früher die Scapin, die Sganarelle und die Frontin in die Komödie. Eine Ratte war teuer: Sie brachte weder Ehre, noch Nutzen, noch Vergnügen; die Ratten waren derart aus der Mode gekommen, dass heute nur noch wenige dieses intime Detail des eleganten Lebens von vor der Restauration kannten, bis sich ein paar Schriftsteller der Ratte als eines neuen Themas annahmen.
»Wie, nachdem er Coralie zur Strecke gebracht hat, hätte uns Lucien La Torpille geraubt?«, sagte Blondet.
Als er diesen Namen hörte, entfuhr dem Maskierten mit den athletischen Formen eine Bewegung, die Rastignac, obwohl minimal, wahrnahm.
»Das ist nicht möglich!«, erwiderte Finot, »La Torpille hat keinen Heller zu teilen, sie hat sich von Florine tausend Franc geliehen, sagt Nathan.«
»Aber meine Herren, meine Herren! …«, sagte Rastignac im Versuch, Lucien vor gehässigen Unterstellungen zu schützen.
»Ja, was«, rief Vernou, »dann ist er, der sich von Coralie hat aushalten lassen, wirklich so tugendhaft …?«
»Ach was, an den tausend Franc sehe ich doch«, meinte Bixiou, »dass unser Freund Lucien mit La Torpille lebt.«
»Was für ein unwiederbringlicher Verlust für die literarische, die wissenschaftliche, die künstlerische und politische Elite!«, sagte Blondet. »La Torpille ist das einzige Freudenmädchen, in dem das Zeug zu einer schönen Kurtisane steckt; die Schule hat sie nicht verdorben, sie kann weder lesen noch schreiben: Sie hätte uns verstanden. Unsere Zeit wäre bereichert mit einer dieser prächtigen aspasischen Erscheinungen, ohne die ein Jahrhundert nicht groß ist. Schaut doch, wie gut die Dubarry ins 18. Jahrhundert passt, Ninon de Lenclos ins siebzehnte, Marion de Lorme ins sechzehnte, Imperia ins fünfzehnte, Flora in die römische Republik, die sie zu ihrer Erbin machte und die mit diesem Vermächtnis die Staatsschulden begleichen konnte! Was wäre Horaz ohne Lydia, Tibull ohne Delia, Catull ohne Lesbia, Properz ohne Cynthia, Demetrius ohne Lamia, die ihm heute zur Ehre gereicht?«
»Blondet, im Foyer der Oper von Demetrius zu reden ist schon ein bißchen zu sehr Débats«, meinte Bixiou ins Ohr seines Nachbarn.
»Und was wäre das Reich der Cäsaren ohne all diese Königinnen?«, redete Blondet weiter. »Lais, Rhodope sind Griechenland und Ägypten. Alle machen doch die Poesie des Jahrhunderts aus, in dem sie jeweils gelebt haben. Diese Poesie fehlt Napoleon, seine Grande Armée als Witwe ist ein Kasernenhofscherz, und der Revolution hat sie eben nicht gefehlt, die ihre Madame Tallien hatte! Jetzt, wo es in Frankreich darum geht, wer auf den Thron kommt, ist natürlich ein Thron frei. Wir alle hätten eine neue Königin kreieren können. Ich für mein Teil hätte der Torpille eine Tante gegeben, nachdem ihre Mutter zu nachweisbar auf dem Feld der Ehrlosigkeit gestorben ist. Du Tillet hätte ihr ein Palais bezahlt, Lousteau eine Kutsche, Rastignac die Diener, des Loupeaulx einen Koch, Finot die Hüte (Finot konnte eine sichtbare Reaktion auf diesen Volltreffer-Scherz nicht unterdrücken), Vernou hätte Anzeigen geschaltet, Bixiou hätte ihr zu Worten verholfen! Der Adel wäre gekommen, um sich bei unserer Ninon zu amüsieren, und wir hätten unter der Androhung mörderischer Kritiken Künstler auftreten lassen. Diese zweite Ninon wäre von großartiger Aufsässigkeit gewesen und von erdrückendem Luxus. Sie hätte Meinungen vertreten. Man hätte bei ihr irgendein verbotenes dramatisches Meisterwerk lesen lassen, das unter Umständen eigens zu diesem Zweck verfasst worden wäre. Sie wäre nicht liberal gewesen, eine Kurtisane ist ihrem Wesen nach königlich. Ah! Was für ein Verlust! Sie, die ihr ganzes Jahrhundert in die Arme hätte schließen sollen, liebt jetzt ein Jüngelchen! Lucien wird aus ihr einen Apportierhund machen!«
»Keine der mächtigen Frauen, die du aufzählst, hat die Straße beackert«, sagte Finot, »diese hübsche Ratte hat sich im Morast gesuhlt.«
»Wie der Same der Lilie im Kompost«, griff Vernou auf, »ist sie dort schön geworden; sie ist dort aufgeblüht. Von da her rührt ihre Macht. Muss man nicht alles erlebt haben, um das Lachen und die Freude zu schaffen, die jeden anstecken?«
»Er hat recht«, meinte Lousteau, der bis jetzt schweigend zugeschaut hatte, »La Torpille kann lachen und zum Lachen bringen. Das ist die Fähigkeit großer Autoren und großer Schauspieler und gehört zu denen, die in alle Tiefen der Gesellschaft vorgedrungen sind. Mit achtzehn hat dieses Mädchen den üppigsten Luxus, das tiefste Elend, Männer aller Schichten erlebt. Wie mit einem Zauberstab löst sie bei den Männern, die noch was draufhaben und sich mit Politik oder Wissenschaft, mit Literatur oder Kunst befassen, die brutalen Gelüste aus, die sie so massiv unterdrücken. Es gibt keine Frau in Paris, die wie sie dem Tier sagen könnte: ›Komm raus!‹, und das Tier verlässt sein Loch und wälzt sich in Exzessen; sie fährt bei Tisch im Überfluss auf und hilft einem beim Trinken und beim Rauchen. Kurzum, diese Frau ist wie das von Rabelais besungene Salz, das alles, worauf es gestreut wird, belebt und in die wundervollen Höhen der Kunst erhebt: Ihr Kleid eröffnet nie gesehene Pracht, ihre Finger verschenken im rechten Moment ihre Edelsteine wie ihr Mund ein Lächeln; sie verleiht allem das Flair des Augenblicks; ihre Rede perlt von witzigen Einfällen; sie verfügt über das Geheimnis der farbigsten und malerischsten Lautmalerei; sie …«
»Du verplemperst Feuilleton für hundert Sou«, unterbrach Bixiou Lousteau, »La Torpille ist unendlich viel besser als all das: Ihr alle wart mehr oder minder ihre Liebhaber, aber keiner kann sagen, sie wäre seine Geliebte gewesen; sie kann euch jederzeit haben, ihr sie aber nie. Ihr rennt ihr die Tür ein, ihr seid es, die sie um einen Gefallen bitten …«
»Oh, sie ist großzügiger als ein Räuberhauptmann, der gute Beute macht, sie ist ergebener als der beste Schulkamerad«, sagte Blondet: »Man kann ihr sein Geld anvertrauen und sein Geheimnis. Weswegen aber ich sie zur Königin wähle, das ist ihre bourbonische Gleichgültigkeit gegenüber dem gefallenen Günstling.«
»Sie ist wie ihre Mutter viel zu kostspielig«, sagte des Loupeaulx. »Die schöne Holländerin soll die Einkünfte des Bischofs von Toledo aufgezehrt haben, sie hat zwei Notare kahlgefressen …«
»Und Maxime de Trailles ernährt, als er noch Page war«, sagte Bixiou.
»La Torpille kostet zu viel, wie Raffael, wie Carême, wie Taglioni, wie Lawrence, wie Boulle, wie alle genialen Künstler zu kostspielig waren …«, erklärte Blondet.
»Esther ist niemals so damenhaft aufgetreten«, meinte da Rastignac und wies auf die Maske, die sich bei Lucien eingehakt hatte. »Ich wette, das ist Madame de Sérisy.«
»Ohne jeden Zweifel«, setzte du Châtelet an, »so erklärt sich Monsieur de Rubemprés Erfolg von selbst.«
»Ah, die Kirche versteht es, sich ihre Priester auszusuchen; was für einen schmucken Botschaftssekretär gäbe er nicht ab!«, sagte des Loupeaulx.
»Um so mehr«, sagte Rastignac weiter, »als Lucien ein Mann von Talent ist. Das hat er den Herrschaften mehr als einmal gezeigt«, fügte er mit Blick auf Blondet, Finot und Lousteau hinzu.
»Ja, der Junge hat das Zeug, es weit zu bringen«, sagte Lousteau, der vor Eifersucht platzte, »um so mehr, als er über das verfügt, was wir ein weites Gewissen nennen …«
»Dazu hast du ihn doch gebracht«, sagte Vernou.
»Wie auch immer«, warf Bixiou mit Blick auf des Loupeaulx ein, »ich appelliere an das Erinnerungsvermögen des Herrn Generalsekretärs und Vortragenden Staatsrats; diese Maske ist La Torpille, ich wette ein Abendessen …«
»Ich halte mit«, sagte du Châtelet, weil er es genau wissen wollte.
»Also, des Loupeaulx«, sagte Finot, »gehen Sie und prüfen Sie, ob Sie die Ohren Ihrer Ex-Ratte wiedererkennen.«
»Nicht nötig, einen Verstoß gegen die Maskenordnung zu begehen«, sagte Bixiou, »La Torpille und Lucien kommen auf ihrem Weg durchs Foyer zurück bei uns vorbei. Ich übernehme es, Euch zu beweisen, dass es sie ist.«
»Er hat also wieder Oberwasser, unser Freund Lucien«, sagte Nathan, der sich zu der Gruppe gesellte, »ich hätte gedacht, er sei für den Rest seiner Tage nach Angoulême zurückgekehrt. Hat er ein geheimes Mittel gegen Gläubiger entdeckt?«
»Er hat getan, was du so bald nicht hinkriegen wirst«, antwortete Rastignac, »er hat alles bezahlt.«
Der breitschultrige Maskierte nickte zustimmend.
»Wer in seinem Alter alles regelt, gerät aus dem Takt und verliert seinen Mumm, er wird Privatier«, meinte Nathan weiter.
»Oh, der da wird immer feiner Herr sein, und er wird gedanklich immer auf einer Höhe stehen, die ihn über einige sogenannte gehobene Herrschaften stellen wird«, antwortete Rastignac.
Jetzt musterten alle, Journalisten, Dandys, Müßiggänger, den köstlichen Gegenstand ihrer Wette wie Pferdehändler ein Pferd begutachten, das zum Verkauf steht. Diese mit der Erfahrung der Pariser Ausschweifungen altgewordenen Schiedsrichter, jeder nach jeweils anderen Kriterien von überlegenem Verstand und alle gleichermaßen verdorben und Verderber, die sich allesamt unmäßigen Ambitionen verschrieben hatten, gewohnt, mit allem zu rechnen und alles zu durchschauen, starrten mit glühendem Blick auf eine maskierte Frau, eine Frau, die nur von ihnen entlarvt werden konnte. Sie und ein paar geübte Besucher des Opernballs konnten als Einzige unter dem langen Grabtuch des schwarzen Domino, unter der Kapuze, hinter dem weiten Kragen, die die Frauen unerkennbar machen, die Rundungen der Formen, die Besonderheiten von Gang und Haltung, die Bewegung der Hüfte, die Haltung des Kopfes, all das erkennen, was den Blicken der Menge am wenigsten fassbar, für sie aber am leichtesten zu sehen war. Trotz dieser unförmigen Hülle konnten sie also das bewegendste aller Schauspiele erkennen, nämlich das, das eine von echter Liebe erfüllte Frau dem Auge bietet. Ob es nun La Torpille war, die Herzogin de Maufrigneuse oder Madame de Sérisy, die unterste oder die oberste Stufe der sozialen Leiter, diese Frau war ein wunderbares Geschöpf, ein Aufleuchten glückseliger Träume. Diese alten jungen Leute verspürten, wie jene jungen Greise, eine derartige Erregung, dass sie Lucien beneideten um das erhebende Vorrecht auf diese Verwandlung der Frau zur Göttin. Die Maskierte verhielt sich, als sei sie mit Lucien allein, für diese Frau gab es die zehntausend Leute nicht mehr und auch nicht die lastende und verstaubte Atmosphäre; nein, es umgab sie ein Gewölbe der Liebe wie die Madonnen Raffaels ihre Aureole von Gold. Sie spürte nichts von dem Gedränge, das Leuchten ihres Blicks trat aus den beiden Löchern ihrer Maske und vereinte sich mit dem Luciens, die Schwingungen ihres Körpers schließlich schienen der Bewegung ihres Freundes zu folgen. Woher stammt dieses Leuchten, das eine liebende Frau umgibt und sie von allen anderen unterscheidet? Woher stammt diese Leichtigkeit eines Luftgeistes, die die Gesetze der Schwerkraft aufzuheben scheint? Ist es die Seele, die sich befreit? Hat das Glück eine Wirkung auf den Körper? Unter dem Domino verrieten sich die Arglosigkeit einer Jungfrau, die Anmut der Kindheit. Obwohl sie nebeneinander und getrennt gingen, ähnelten diese beiden Wesen Flora und Zephyr, wie sie von Bildhauern ineinander verschlungen gekonnt dargestellt werden; aber dies war mehr als Bildhauerei, die höchste der bildenden Künste, Lucien und sein hübscher Domino ließen an die Engel denken, die der Pinsel des Giambellino unter die Bilder der unberührten Mutter Gottes gesetzt hat, wo sie mit Blumen oder Vögeln spielen; Lucien und diese Frau waren ein Traumbild der Fantasie, die über der Kunst steht wie die Ursache über der Wirkung.
Als diese Frau, die alles um sich vergessen hatte, einen Schritt von der Gruppe entfernt war, rief Bixiou: »Esther?« Die Unglückliche wandte spontan den Kopf wie jemand, der hört, dass er gerufen wird, erkannte den boshaften Mann und ließ den Kopf sinken wie ein Sterbender, der seinen letzten Seufzer getan hat. Ein schrilles Lachen erhob sich, und die Gruppe verlief sich inmitten der Menge wie ein Pulk verschreckter Waldmäuse, die vom Wegrand in ihre Löcher schlüpfen. Allein Rastignac ging nicht weiter als nötig, um nicht den Eindruck zu erwecken, er gehe in Deckung vor Luciens funkelnden Blicken; so konnte er zweimal eine gleich tiefe Bestürzung trotz der Verschleierung beobachten: erst die arme, wie vom Blitz geschlagene Torpille, dann den geheimnisvollen Maskierten, der als Einziger der Gruppe geblieben war. Esther sagte Lucien in dem Augenblick, als ihr die Knie versagten, etwas ins Ohr, Lucien stützte sie und verschwand mit ihr. Rastignac folgte dem hübschen Paar mit dem Blick, während er, in Gedanken versunken, dastand.
»Woher hat sie den Spitznamen La Torpille«, fragte ihn eine dunkle Stimme, die ihn ins Innerste traf, weil sie nicht mehr verstellt war.
»Das ist der doch, und wieder ausgebrochen …«, sagte Rastignac zu sich selbst.
»Schweig, oder ich mach dich kalt«, gab der Maskierte mit einer veränderten Stimme zurück. »Ich bin zufrieden mit dir, du hast Wort gehalten, so kommt dir mehr als ein Arm zuhilfe. Also schweig wie ein Grab; aber vorher gib mir Antwort auf meine Frage.«
»Nun ja, dies Mädchen ist so attraktiv, dass selbst Kaiser Napoleon schwach geworden wäre, und auch einer schwach würde, der noch schwerer zu verführen ist: du!«, antwortete Rastignac und wandte sich ab.
»Einen Moment«, sagte der Maskierte. »Ich zeige dir jetzt, dass du mich niemals je irgendwo gesehen hast.«
Der Mann nahm seine Maske ab, Rastignac stutzte einen Augenblick, da er nichts sah von der hässlichen Person, die er seinerzeit im Hause Vauquer kennengelernt hatte.
»Der Teufel hat Ihnen erlaubt, alles an sich zu verändern, außer Ihre Augen, die kann man nicht vergessen«, sagte er ihm.
Der eiserne Griff drückte seinen Arm, um ihm zu ewigem Schweigen zu raten.
Um drei Uhr früh trafen des Loupeaulx und Finot den eleganten Rastignac an derselben Stelle, an die Säule gelehnt, wo ihn der schreckliche Maskenträger hatte stehen lassen. Rastignac hatte sich selbst gebeichtet: Er war Priester und Beichtkind gewesen, Richter und Angeklagter. Er ließ sich zum Frühstück mitnehmen und kehrte vollkommen blau, aber verschwiegen nach Hause zurück.
Eine Pariser Landschaft
Die Rue de Langlade und die Straßen der Umgebung verunzieren das Palais-Royal und die Rue de Rivoli. Dieser Teil eines der prächtigsten Viertel von Paris wird noch lange den Makel der Erhebungen bewahren, die der vom alten Paris hervorgebrachte Müll hinterlassen hat und auf denen früher Windmühlen standen. Diese engen, schattigen und schlammigen Gassen, wo Gewerbe betrieben werden, die wenig auf ihr Äußeres achten, nehmen des Nachts eine geheimnisvolle und kontrastreiche Erscheinung an. Jeder, der das nächtliche Paris nicht kennt und von der lichtvollen Rue Saint-Honoré, der Rue Neuve-des-Petits-Champs und der Rue de Richelieu kommt, wo sich unablässig die Menge drängt, wo die Meisterstücke des Handwerks, der Mode und der Kunst glänzen, würde von einem düsteren Schrecken erfasst, wenn er in das Geflecht schmaler Gassen geriete, das dieses bis in den Himmel strahlende Licht umsäumt. Ein dichter Schatten folgt auf die Ströme von Gaslicht. Hin und wieder verbreitet eine blasse Laterne ihr fahles und rauchiges Licht, das einige schwarze Sackgassen nicht mehr erreicht. Die Passanten sind rar und gehen beschleunigt. Die Geschäfte sind geschlossen, und die, die geöffnet haben, wirken verdächtig: eine schmuddelige unbeleuchtete Schenke, der Laden einer Näherin, die Kölnisch Wasser verkauft. Eine ungesunde Kälte legt einem ihren klammen Mantel über die Schultern. Wenige Kutschen fahren vorbei. Es gibt da finstere Winkel, unter denen die Rue de Langlade, die Einmündung der Passage Saint-Guillaume und noch ein paar Kurven besonders auffallen. Der Stadtrat hat noch nichts tun können, um dieses riesige Seuchenareal zu bereinigen, denn die Prostitution hat hier seit Langem ihr Hauptquartier. Vielleicht ist es ein Segen für die Pariser Gesellschaft, diesen Gassen ihr verschmutztes Aussehen zu lassen. Wenn man hier tags entlanggeht, kann man sich nicht vorstellen, was aus all diesen Straßen in der Nacht wird; es streifen hier wunderliche Wesen umher, die keiner Welt angehören; halb nackte weiße Formen möblieren die Mauern, die Schatten sind lebendig. Es schleichen Kleider zwischen Mauer und Passant geschmiegt herum, die sich bewegen und sprechen. Aus angelehnten Türen fängt es schallend an zu lachen. Es gelangen Worte ins Ohr, von denen Rabelais sagt, dass sie gefroren seien und dort auftauen. Abgenutzte Lieder steigen zwischen den Pflastersteinen auf. Der Lärm ist nicht unbestimmt, sondern bedeutet etwas: Ist er rau, dann ist es eine Stimme, wenn es aber einem Gesang ähnelt, hat es nichts Menschliches mehr, sondern eher etwas von einem Zischen. Es ertönen häufig Pfiffe. Dazu klingen die Absätze von Stiefeln wie Spott und Herausforderung. Dies alles zusammen macht einen schwindlig. Die atmosphärischen Gegebenheiten sind hier vertauscht: Es wird einem heiß im Winter und kalt im Sommer. Doch welches Wetter auch herrscht, diese befremdliche Welt bietet stets dasselbe Schauspiel: Hier ist sie, die fantastische Welt Hoffmanns, des Berliners. Der akkurateste Kassierer findet nichts Relles, wenn er die engen Stellen durchquert, die zu den anständigen Straßen führen, wo es Passanten gibt, Geschäfte und Zylinderlampen. Geringschätziger oder verklemmter als die Königinnen und Könige der vergangenen Zeiten, die keine Berührungsangst vor dem Umgang mit Kurtisanen hatten, wagen es die moderne Verwaltung oder Politik nicht mehr, diese Wunde der Großstädte in Angriff zu nehmen. Gewiss müssen die Methoden mit der Zeit gehen, und die, die den Einzelnen und seine Freiheit berühren, sind heikel; aber vielleicht sollte man großzügig und beherzt sein bei den rein materiellen Dingen wie Luft, Licht und Wohnraum. Der Moralist, der Künstler und der weise Verwaltungsmann werden den alten hölzernen Galerien des Palais-Royal nachtrauern, wo sich diese Schäfchen ansammelten, die sich immer da einfinden, wo Leute entlanggehen; aber ist es nicht besser, dass die Leute dort hingehen, wo die sind? Was ist passiert? Heute sind die strahlendsten Teile der Boulevards, diese verzauberte Promenade, abends für Familien unmöglich geworden. Die Polizei hat es nicht geschafft, die Möglichkeiten zu nutzen, die ein paar Gassen in dieser Hinsicht boten, um die Straßen der Öffentlichkeit zu erhalten.
Das von dem einen Wort beim Opernball geknickte Mädchen wohnte seit ein oder zwei Monaten in der Rue de Langlade, in einem heruntergekommenen Haus. An die Mauer eines riesigen Gebäudes geklebt, bezieht dieser schlecht verputzte Bau ohne Tiefe, aber von erstaunlicher Höhe, sein Licht von der Gasse und ähnelt einem Papageienbauer. In jedem Stockwerk befindet sich eine Zweizimmerwohnung. Begehbar ist das Haus über eine winzige, an die Wand gedrückte Treppe, deren sonderbare Beleuchtung von den Fensterluken ausgeht, die nach außen die Treppe markieren, mit einem Ausgussrohr auf jeder Etage, einer der schlimmsten Besonderheiten von Paris. Den Laden und das Zwischengeschoss mietete damals ein Klempner, der Eigentümer wohnt im ersten Stock, in den vier Etagen darüber lebten sehr dezente Modistinnen, die aufseiten des Eigentümers wie der Hausmeisterin eine Wertschätzung und Freundlichkeit genossen, die die Schwierigkeit, ein so eigenartig gebautes und gelegenes Haus zu vermieten, nötig machte. Der Charakter dieses Viertels erklärt sich mit dem Bestand einer ziemlich großen Anzahl ähnlicher Häuser, in die der Handel nicht will und die nur für anrüchige, unsichere oder würdelose Gewerbe nutzbar sind.
Ein Wohnungsinterieur, den einen so bekannt wie den anderen unbekannt
Die Hausmeisterin hatte gesehen, wie Fräulein Esther um zwei Uhr morgens zu Tode erschöpft von einem jungen Mann heimgebracht worden war. Um drei Uhr nachmittags beratschlagte sie sich mit der Modistin von der Etage darüber, die ihr jetzt, bevor sie auf dem Weg zu einem Vergnügen in eine Kutsche stieg, ihre Beunruhigung bezüglich Esther mitteilte: Sie hatte kein Geräusch von ihr gehört. Esther schlief bestimmt noch, aber dieser Schlaf schien verdächtig. Allein in ihrer Loge, tat es der Hausmeisterin leid, dass sie nicht hingehen konnte und nachsehen, was sich im vierten Stockwerk tat, wo Fräulein Esther ihre Bleibe hatte. Als sie gerade beschloss, sich vom Sohn des Klempners in ihrer Loge vertreten zu lassen, einer im Zwischengeschoss in eine Höhlung der Mauer gequetschten Nische, fuhr eine Droschke vor. Ein von Kopf bis Fuß in einen Mantel gehüllter Mann, der offensichtlich seinen Anzug oder seinen Status verbergen wollte, stieg aus und fragte nach Fräulein Esther. Die Hausmeisterin war daraufhin vollkommen beruhigt, das Schweigen und die Ruhe der Zurückgezogenen erschienen ihr bestens erklärt. Als der Besucher die Stufen vor ihrer Loge emporstieg, bemerkte die Hausmeisterin die silbernen Schnallen, die seine Schuhe zierten; sie meinte, die schwarzen Fransen eines Zingulums bemerkt zu haben; sie stieg hinunter und fragte den Kutscher, der ohne Worte Antwort gab, woraufhin die Pförtnerin erst recht verstand. Der Priester klopfte, erhielt keine Antwort, hörte leise Seufzer und drückte mit der Schulter die Tür auf, mit einer Wucht, die ihm wohl die Barmherzigkeit verlieh, die bei jedem anderen wie eingeübt erschienen wäre. Er stürmte in das zweite Zimmer und sah die arme Esther vor einer kolorierten Gipsmadonna knien, oder besser: zusammengesunken, die Hände gefaltet. Das leichte Mädchen lag im Sterben. Ein Becken mit den Resten von Kohle erzählte die Geschichte dieses schrecklichen Morgens. Kapuze und Umhang des Domino-Kostüms lagen am Boden. Das Bett war unbenutzt. Das arme Geschöpf, im Herzen tödlich getroffen, hatte sich das wohl zurechtgestellt, nachdem sie von der Oper zurückgekommen war. Ein im Wachs der Tropfenschale steif gewordener Kerzendocht zeugte davon, wie sehr Esther in ihre letzten Überlegungen vertieft gewesen war. Ein tränengetränktes Taschentuch bewies die Ernsthaftigkeit der Verzweiflung dieser Magdalena, in deren klassischer Haltung die gottvergessene Kurtisane nun dasaß. Diese vollkommene Reue verursachte dem Geistlichen ein Lächeln. Zu ungeschickt, um zu sterben, hatte Esther die Tür offen gelassen, ohne zu bedenken, dass die Luft zweier Räume mehr Kohle benötigte, um den Atem zu rauben; die Gase hatten sie bloß betäubt; die frische Luft vom Treppenhaus brachte ihr nach und nach das Bewusstsein ihrer Übel zurück. Der Priester blieb stehen, ungerührt von der göttlichen Schönheit dieses Mädchens, versunken in einen düsteren Gedankengang, und beobachtete ihre ersten Regungen, als wäre sie irgendein Tier. Sein Blick wanderte mit offensichtlicher Teilnahmslosigkeit von dem zusammengesunkenen Körper zu gleichgültigen Gegenständen. Er betrachtete das Mobiliar dieses Zimmers, dessen zerkratzten roten kalten Kachelboden ein schäbiger und fadenscheiniger Teppich schlecht bedeckte. Eine altmodische Bettstatt aus bemaltem Holz, umhüllt mit Vorhängen aus mit roten Rosenmustern bedrucktem Nessel; ein einzelner Sessel und zwei ebenfalls bemalte und mit demselben Nessel bezogene Holzstühle, der auch den Vorhangstoff an den Fenstern hergegeben hatte; eine mit der Zeit schwarz und fettig gewordene, mit Blumen auf grauem Grund bedruckte Tapete, ein Nähtisch aus Mahagoni; der Kamin vollgehängt mit Küchengerät der schäbigsten Sorte, zwei angebrochene Bündel Brennholz, ein Steingesims, auf dem Glas- und Schmuckstücke und Scheren verstreut herumlagen; ein schmutziges Nadelkissen, parfümierte weiße Handschuhe, ein entzückender Hut, der über den Wasserkrug geworfen war, ein Schal aus billigem Kaschmirimitat, der das Fenster abdichtete, ein elegantes Abendkleid an einem Nagel, ein kahles kleines Sofa ohne Kissen; eklige kaputte Holzsandalen und süße Schuhchen, Stiefel, die eine Königin hätten neidisch werden lassen, angeschlagene billige Porzellanteller, auf denen die Reste der letzten Mahlzeit zu sehen waren, überhäuft mit Alpakabesteck, dem Silber des armen Mannes in Paris; ein Korb mit Kartoffeln und noch zu bleichender Wäsche, weiter darüber eine saubere Haube aus Tüll, ein offenstehender leerer schäbiger Spiegelschrank, in dessen Fächern Quittungen vom Leihhaus zu sehen waren: Das war das Gesamtbild trauriger und heiterer, elender und wertvoller Gegenstände, die ins Auge sprangen. Die Spuren von Luxus in diesen Scherben, dieser Haushalt, der so gut zum Bohème-Leben dieses niedergeschlagenen Mädchens passte, das in seiner verrutschten Unterwäsche dalag wie ein totes Pferd im vollen Harnisch unter der gebrochenen Deichselstange und verwickelt in die Zügel — gab dieses befremdliche Schauspiel dem Priester zu denken? Sagte er sich, dass dieses irregeleitete Wesen jedenfalls uneigennützig sein musste, wenn sie derartige Armut in Einklang bringen konnte mit der Liebe eines jungen reichen Mannes? Schloss er von der Unordnung des Mobiliars auf die Unordnung des Lebens? Empfand er Mitgefühl, Schrecken? Rührte sich sein Erbarmen? Wer ihn gesehen hätte, mit verschränkten Armen, die Stirn gerunzelt, die Lippen geschürzt, der Blick streng, hätte gemeint, er sei versunken in feindliche Gefühle, widersprüchliche Überlegungen, finstere Absichten. Er war natürlich unempfänglich für die hübschen Rundungen eines unter dem Gewicht des vorgebeugten Brustkorbs fast zerdrückten Busens und die anmutigen Formen einer kauernden Venus, die sich unter dem Schwarz des Rocks abformten, so sehr war die Sterbende in sich zusammengesunken; dieser hingesunkene Kopf, der, von hinten gesehen, dem Blick einen weißen, weichen und gelenkigen Nacken offenbarte; die von Natur kühn entwickelten schönen Schultern rührten ihn gar nicht; er half Esther nicht auf, er schien die zerreißenden Atemstöße nicht zu hören, die ihre Rückkehr ins Leben zu erkennen gaben: Es bedurfte eines entsetzlichen Schluchzers und des erschütternden Blicks, den ihm das Mädchen zuwarf, dass er sich herabließ, sie aufzuheben und mit einer Leichtigkeit, die unglaubliche Kraft offenbarte, auf das Bett zu legen.
»Lucien!«, murmelte sie.
»Kommt die Liebe zurück, ist das Weib nicht mehr fern«, meinte der Priester mit einer gewissen Bitterkeit.
Da bemerkte das Opfer der Pariser Verkommenheiten das Gewand seines Retters und sagte mit dem Lächeln eines Kindes, das einen begehrten Gegenstand anfasst: »So sterbe ich also nicht, ohne mich mit dem Himmel versöhnt zu haben!«
»Sie können Buße tun für Ihre Verfehlungen«, sagte der Priester, wobei er ihr die Stirn anfeuchtete und sie an einem Kännchen Essig riechen ließ, das er in einer Ecke fand.
»Ich spüre, wie das Leben, statt mich zu verlassen, in mich zurückfließt«, sagte sie, nachdem sie die Fürsorge des Priesters empfangen und ihm ihre Dankbarkeit in vollkommener Natürlichkeit mit Gesten ausgedrückt hatte.
Dieses reizvolle Gebärdenspiel, das die Grazien entfaltet hätten, um zu verführen, rechtfertigte vollkommen den Spitznamen dieses seltsamen Mädchens.
»Geht es Ihnen besser?«, fragte der Kirchenmann und reichte ihr ein Glas Zuckerwasser.
Dieser Mann schien sich auszukennen mit derlei sonderbaren Haushalten, er kannte alles daran. Er war da wie zu Hause. Das Privileg, überall zu Hause zu sein, ist allein den Königen, den Huren und den Dieben vorbehalten.
Das Bekenntnis einer Ratte
»Wenn es Ihnen wirklich wieder gut geht«, fuhr dieser eigentümliche Priester nach einer Pause fort, »dann nennen Sie mir die Gründe, die Sie dazu gebracht haben, Ihre jüngste Sünde zu begehen, diesen versuchten Selbstmord.«
»Meine Geschichte ist ziemlich einfach, ehrwürdiger Vater«, antwortete sie. »Vor drei Monaten lebte ich in der Unordnung, in die ich geboren wurde. Ich war das Allerletzte und Infamste, aber jetzt bin ich nur noch die Unglücklichste von allen. Erlauben Sie, dass ich nicht von meiner armen Mutter spreche, die umgebracht wurde …«
»Von einem Hauptmann in einem zwielichtigen Haus«, unterbrach der Priester seine Büßerin … »Ich kenne Ihre Herkunft und es ist mir klar, dass, wenn einer Person Ihres Geschlechts jemals ihr schandbares Leben entschuldigt werden kann, dann Ihnen, der die guten Vorbilder fehlten.«
»Leider! Ich bin nicht getauft und in keinem Glauben unterwiesen worden.«
»Dann lässt sich ja alles wiedergutmachen«, sagte der Priester weiter, »solange Ihr Glaube und Ihre Reue ernsthaft und frei von Hintergedanken sind.«
»Lucien und Gott erfüllen mein Herz«, sagte sie mit anrührender Offenheit.
»Sie hätten sagen können: Gott und Lucien«, gab der Priester lächelnd zurück. »Sie erinnern mich, warum ich hier bin. Verschweigen Sie nichts, was diesen jungen Mann betrifft.«
»Sie kommen seinetwegen?«, fragte sie mit einer verliebten Miene, die jeden anderen Geistlichen gerührt hätte. »Oh! Er hat es geahnt.«
»Nein«, gab er zurück, »was beunruhigt, ist nicht Ihr Tod, sondern dass Sie leben. Also, erklären Sie mir Ihre Beziehung.«
»Mit einem Wort«, sagte sie.
Das arme Mädchen zitterte unter dem ruppigen Ton des Geistlichen, allerdings wie eine Frau, die mit Grobheit schon lange nicht mehr zu überraschen war.
»Lucien ist Lucien«, fuhr sie fort, »der schönste junge Mann und der beste aller Lebenden; wenn Sie ihn kennen, muss Ihnen meine Liebe doch ganz selbstverständlich vorkommen. Ich habe ihn durch Zufall kennengelernt vor drei Monaten an der Porte Saint-Martin, wo ich an einem freien Tag hingegangen bin. Wir hatten nämlich einen Tag pro Woche Ausgang im Haus von Madame Meynardie, wo ich war. Am Tag darauf, verstehen Sie, habe ich mir unerlaubt frei genommen. Die Liebe hatte mein Herz besetzt und hatte mich so verändert, dass ich mich bei der Rückkehr vom Theater selbst nicht mehr wiedererkannt habe: Es graute mir vor mir selbst. Lucien hat nie etwas erfahren können. Statt ihm zu sagen, wo ich war, habe ich ihm die Adresse dieser Unterkunft hier gegeben, wo zu der Zeit eine Freundin von mir wohnte, die so lieb war, sie mir zu überlassen. Ich schwöre Ihnen bei meinem heiligen Wort …«
»Man soll nicht schwören.«
»Ist es denn schwören, wenn man sein heiliges Wort gibt! Also: Seit jenem Tag habe ich in diesem Zimmer gearbeitet wie eine Verdammte und Hemden für achtundzwanzig Sous genäht, um von einer anständigen Arbeit zu leben. Einen ganzen Monat lang habe ich nichts gegessen als Kartoffeln, um anständig und Luciens würdig zu sein, der mich liebt und achtet wie die Tugendhafteste der Tugendhaften. Ich habe eine formelle Erklärung bei der Polizei abgegeben, um meine Rechte wiederzuerlangen, und habe mich für zwei Jahre der Überwachung unterworfen. Die, die sich so leicht tun, Sie in die Register der Schande einzutragen, sind von einer unglaublichen Kleinlichkeit, wenn es darum geht, Sie daraus zu streichen. Alles, worum ich den Himmel gebeten hatte, war Hilfe für meinen Beschluss. Im April werde ich neunzehn: Ab dem Alter hat man mehr Möglichkeiten. Ich komme mir vor, als sei ich vor drei Monaten neu geboren … Jeden Morgen habe ich zum lieben Gott gebetet und ihn gebeten, Sorge zu tragen, dass Lucien nie etwas erfährt von meinem früheren Leben. Ich habe diese Madonna, die Sie da sehen, gekauft; ich habe auf meine Art zu ihr gebetet, wo ich doch keine Gebete kenne; ich kann weder lesen noch schreiben, ich habe noch nie eine Kirche betreten, ich habe den lieben Gott noch nie gesehen außer aus Neugierde bei Prozessionen.«
»Was haben Sie denn der Jungfrau gesagt?«
»Ich rede zu ihr wie ich mit Lucien spreche, mit der Erregung, die ihn zum Weinen bringt.«
»Ach, er weint?«
»Vor Freude«, sagte sie lebhaft. »Der Arme! Wir verstehen uns so gut, dass wir von ein und derselben Seele sind! Er ist so anständig, so liebevoll, so warm von Herzen, Geist und Verhalten …! Er sagt, er sei Dichter, ich sage, er ist Gott … Entschuldigung, aber Sie Priester, Sie wissen nicht, was Liebe ist. Es sind übrigens sowieso nur wir, die die Männer genug kennen, um einen Lucien zu schätzen. Ein Lucien, sehen Sie, ist so selten wie eine Frau ohne Sünde; wenn man ihm begegnet, kann man nur noch ihn lieben: Das ist es. Ein solcher Mensch, der braucht seinesgleichen. Ich wollte also würdig sein, von meinem Lucien geliebt zu werden. Daher kommt mein Unglück. Gestern in der Oper bin ich von jungen Leuten wiedererkannt worden, die nicht mehr Herz haben als ein Tiger Mitleid; und mit einem Tiger käme ich noch zurecht! Der Schleier der Unschuld, den ich trug, ist gefallen, ihr Lachen hat mir Kopf und Herz zerrissen. Glauben Sie nicht, Sie hätten mich gerettet. Ich werde vor Kummer sterben.«
»Ihren Schleier der Unschuld? …«, sagte der Priester, »Sie haben Lucien also unnachgiebig hingehalten?«
»Oh! Mein Vater, wie können Sie, der ihn kennt, mir eine solche Frage stellen!«, gab sie mit einem köstlichen Lächeln zurück. »Einem Gott widersteht man nicht.«
»Lästern Sie nicht Gott«, sagte der Kirchenmann sanft, »niemand kann Gott vergleichbar sein. Übertreibung passt schlecht zur wahrhaften Liebe, Sie empfanden für Ihren Götzen keine reine, echte Liebe. Wenn Sie sich tatsächlich so verändert hätten, wie Sie behaupten, dass Sie sich verändert haben, dann hätten Sie die Tugenden, die die Jugend auszeichnen, erlangt, Sie hätten die Wonnen der Keuschheit kennengelernt, die Zartheit der Scham, diese beiden Ruhmesattribute junger Mädchen. Sie lieben nicht.«
Esther zuckte vor Schreck, was der Priester sah, was aber die Gleichmut dieses Beichtvaters nicht erschütterte.
»Ja, Sie lieben ihn für sich selbst und nicht seinetwegen, wegen der vergänglichen Freuden, die Sie faszinieren, und nicht um der Liebe selbst willen; wenn Sie ihn so erobert haben, dann haben Sie nicht diesen heiligen Schauer verspürt, den ein Wesen eingibt, dem Gott das Siegel der liebenswertesten Vollkommenheit aufgedrückt hat: Haben Sie bedacht, dass Sie ihn durch Ihre unreine Vergangenheit beschädigen, dass Sie dabei waren, ein Kind durch die entsetzlichen Genüsse zu verderben, die Ihnen Ihren Spitznamen, Gipfelpunkt der Verdorbenheit, eingebracht haben? Sie waren leichtfertig mit sich selbst und mit Ihrer Eintagsleidenschaft …«
»Eintags…!«, wiederholte sie und hob den Blick.
»Wie sonst eine Liebe nennen, die nicht für die Ewigkeit ist, die uns nicht bis zum jüngsten Tag mit dem vereint, den wir lieben?«
»Ach! Ich möchte katholisch werden«, stieß sie mit einer dumpfen Heftigkeit hervor, die ihr die Gnade unseres Erlösers eingebracht hätte.
»Ist ein Mädchen, das nicht die Taufe der Kirche und auch nicht die Weihen der Wissenschaft empfangen hat, das weder lesen noch schreiben noch beten kann, das nicht einen Schritt tun kann, ohne dass sich die Pflastersteine erheben und es anklagen, das bemerkenswert nur durch das flüchtige Privileg einer Schönheit ist, die eine Krankheit ihr womöglich morgen schon raubt; ist es diese verkommene, entwürdigte Kreatur, die sich außerdem ihrer Würdelosigkeit bewusst war … (unwissend und mit weniger Liebe hätte man es Ihnen eher nachgesehen), ist es die Beute eines künftigen Selbstmordes und der Hölle, die die Frau von Lucien de Rubempré sein könnte?«
Jeder Satz war ein Dolchstoß, der in die Tiefe des Herzens drang. Mit jedem Satz zeugten die immer lauteren Schluchzer, die Ströme von Tränen des verzweifelten Mädchens von der Gewalt, mit der die Erkenntnis gleichzeitig in ihren Verstand, der rein war wie der eines Wilden, in ihre endlich erwachte Seele, in ihr Wesen vordrang, über das die Verkommenheit eine Schicht schmutzigen Eises gelegt hatte, das nun unter der Sonne des Glaubens dahinschmolz.
»Warum bin ich nicht tot!«, war der einzige von den wilden Strömen an Gedanken, die ihren Verstand heimsuchten, den sie äußerte.
»Meine Tochter«, sagte der furchtbare Richter, »es gibt eine Liebe, die man unter Menschen nicht eingesteht und deren Geheimnisse mit dem Lächeln des Glücks von den Engeln empfangen werden.«
»Welche?«
»Die Liebe ohne Hoffnung, wenn sie das Leben eingibt, wenn sie dem Prinzip der Aufopferung folgt, wenn sie jede Tat durch den Gedanken veredelt, zu idealer Vollkommenheit zu gelangen. Ja, die Engel heißen eine solche Liebe gut, sie führt zur Erkenntnis Gottes. Sich ständig vervollkommnen, und dessen würdig zu werden, den man liebt, ihm Tausende geheimer Opfer zu bringen, ihn aus der Ferne zu verehren, sein Blut Tropfen für Tropfen zu geben, und ihm die Eigenliebe zu opfern, ihm gegenüber keinen Stolz und keinen Zorn mehr zu empfinden; ihm alles Wissen von der grausigen Eifersucht, die er im Herzen weckt, zu ersparen, ihm alles zu geben, was er wünscht, und sei es zum eigenen Schaden, lieben, was er liebt, ihm ständig zugewandt sein, um ihm zu folgen, ohne dass er es merkt; diese Liebe hätte Ihnen der Glaube verziehen, die nicht gegen die Gesetze Gottes und der Menschen verstieße und Sie auf eine andere Bahn geführt hätte als die Ihrer unreinen Wollust.«