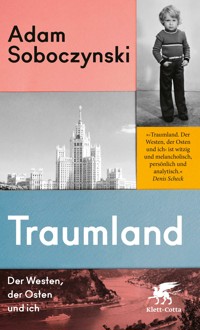9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Ein glänzendes Buch.« Tobias Becker, Der Spiegel Sie müssen schön, nett und kerngesund sein, doch die Männer und Frauen in Glänzende Zeiten leiden an den Zwängen unserer Zeit. Erhellend und mit viel Ironie führt Adam Soboczynski an die Sackgassen des Daseins, wo Askese und brutale Selbstoptimierung nur dazu führen, dass Leben auf der Strecke bleibt. »Es handelt sich bei ›Glänzende Zeiten‹ um reines, um klassisches, um großartiges Feuilleton, das hohen Lesegenuss bietet, aber immer wieder auch verstört.« Cicero »Ein Buch, das Freude macht.« Marcus Weber, Deutschlandfunk Kultur
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Adam Soboczynski
Glänzende Zeiten
Klett-Cotta
Impressum
Der vorliegende Titel ist erstmals 2010 im Aufbau Verlag erschienen.
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
© Adam Soboczynski 2023. Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung einer Abbildung von © Stocksy / VISUALSPECTRUM
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-96587-2
E-Book ISBN 978-3-608-12239-8
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Ich leide doch erstaunlich.
Hannes Maria Wetzler
1 Stolz
Vor wenigen Monaten wurde das Mehrparteienhaus, in dem ich eine Zweizimmerwohnung angemietet hatte, an eine, ich glaube, britische Immobilienfirma verkauft. Sogleich war der bisherige Hausmeister, ein untersetzter Mann, dem das Alter und der Alkohol zugesetzt hatten, entlassen worden. Er reparierte immer, sobald in der Wohnung etwas zu reparieren war, mit zumindest vorgetäuschter Emsigkeit, wenn man ihm eine Flasche Bier reichte. Rief man ihn zu Unzeiten an, gegen zehn Uhr abends etwa, da eine Sicherung durchgebrannt war, hielt er einen kurzen, aber zornigen Vortrag darüber, dass es in diesem Haus unüblich sei, Waschmaschine und Wasserboiler gleichzeitig in Betrieb zu nehmen. Und gar unüblich sei es, zudem noch zu staubsaugen, gerade zu dieser Uhrzeit, was die Stromleitungen vollends überlastet hätte. Dann tauschte er im Keller mit allen Anzeichen des Unmuts die Sicherung aus.
Der Hausmeister war auf eine herausfordernde Weise untüchtig gewesen, wie aber, bei Lichte besehen, ja alle Hausmeister auf eine herausfordernde Weise untüchtig sind. Man klagte im Haus über Wasserrohre, die trotz der unter allerhand Verwünschungen betriebenen Reparaturversuche leckten, über eine fehlerhaft eingestellte Zentralheizung und dergleichen mehr. Auch soll es vorgekommen sein, dass ein nur kleiner Schaden, der defekte Stromschalter in der Küche meiner Nachbarin, der ältlichen Frau Hansen, durch einen wütenden Einsatz des Hausmeisters überhaupt erst sich zu einem ganz bedenklichen Schaden auswuchs, so dass unter anderem der Strom des gesamten Hauses über Stunden ausfiel.
All dies aber schmälerte des Hausmeisters Selbstgerechtigkeit keineswegs, sondern befeuerte sie, wie mir schien, nur noch. Auf einen Missstand oder eine seiner Liederlichkeiten angesprochen, erwiderte er knapp, das sei ein altes Haus, die Miete sei niedrig, oder er sagte: Das gehört so. Als sei es nicht irgendeine Leistung oder zumindest Befähigung, die ihn zu seinem Stolz berechtigte, sondern einzig der Umstand, dass er eben der Hausmeister war, so wie einst Adlige keine Rechenschaft abgeben mussten über die Pracht ihres Standes, der Gottes Ordnung gemäß war.
Diese völlig aus der Zeit gefallene Selbstgerechtigkeit, mit der er schlampig sein Werk verrichtete, rührte mich an. Vielleicht auch deshalb, da der Hausmeister gespensterhaft in die Gegenwart hineinragte als sozusagen verlebendigtes Museumsstück, wie eine Skulptur, die sich mit einem Mal regte nach langer Todesstarre, so kam er mir manchmal vor mit seiner im ganzen Haus verhassten Untüchtigkeit. Vollkommen beherrschte er die Kunst, ganz ohne Verdienst stolz zu sein.
Ganz früh morgens muss es gewesen sein, gegen acht (ich hatte kurz und schlecht geschlafen und wollte nur die Zeitung aus dem Briefkasten nehmen), dass ich im Hausflur die Ankündigung über die Entlassung des Hausmeisters und die Einstellung eines »Facility Managers« hinter einer Glasvitrine las, noch von Kopfschmerzen geplagt, da ein alter Freund, der erfolgreich etwas mit Kultur macht und den ich schon lange nicht gesehen hatte, mich am Vorabend besucht und zwei, zu meiner Verblüffung, gar nicht gute Flaschen Wein mitgebracht hatte.
Lange hatten wir in der Küche gesessen, herumgeredet und die zwei unguten Flaschen Wein aus Südfrankreich geleert, wo er drei Wochen lang mit seiner Freundin einen, wie er erzählte, für die Beziehung aus mancherlei Gründen unförderlich langen Urlaub absolviert hatte. Doch sah er auf beinahe anstößige Weise erholt, gebräunt und erschlankt aus, was man von mir nicht behaupten konnte, der ich in einer mühsamen Schreibarbeit verfangen war, einer endlos, wie mir schien, sich in die Länge ziehenden Reportage, die mehrere Zeitungsseiten füllen sollte und die mir für zwei volle Wochen eine von allen mir ansonsten willkommenen Vergnügungen abgewandte Lebensweise aufnötigte. Womöglich, denke ich mir heute, war es diese mir aufgezwungene, von allen Vergnügungen abgewandte Lebensweise gewesen, die mir das Schreiben zu einer selten erlebten Qual machte. Schrieb ich mit größter Kraftanstrengung halb besinnungslos ein, zwei Absätze in der Nacht herunter, so entdeckte ich bereits am nächsten Morgen darin Ungereimtheiten, furchtbare Entgleisungen, die albernsten Grammatikfehler.
Als größtmöglich denkbare Ausnahme von der Abgewandtheit waren der gerade aus Südfrankreich zurückgekehrte Freund und ich nach den zwei unguten Flaschen Wein auch noch in eine jener Bars gegangen, in der das Rauchen noch geduldet wurde, weshalb an diesem Morgen das ohnehin schon schlechte Gewissen, das mich plagte, deutlich gesteigert und mit Kopfschmerzen angereichert war.
Der Facility Manager, der den Hausmeister ersetzte und gleich für sehr viele Wohnhäuser im Viertel zuständig wurde, die der Immobilienfirma gehörten, sollte sich, ganz wie ich es, als ich vor der Vitrine stand, auch erahnt hatte, als ein junger, vielleicht etwas blasser, aber überaus zuvorkommender Mann entpuppen, der selbst gar nichts mehr reparierte und von dem man auch nicht wusste, wo er wohnte. Einmal nur, ganz kurz, sollte ich ihn sehen, da ein Abflussrohr im Badezimmer verstopft war. Er notierte, an der Wohnungstür stehend, mit dünnen Fingern das Übel und rief dann den entsprechenden Handwerksbetrieb an. Er lispelte leicht, wenn ich mich recht erinnere, was aber keineswegs unsympathisch klang. Effizienz, professionelle Verbindlichkeit, frischer Atem, sehnige Schlankheit waren an die Stelle der schwankenden Laune, der Willkür, des Übergewichts, der Bierseligkeit, des Zorns getreten.
Frühmorgens, mit Kopfschmerzen und einem gesteigerten schlechten Gewissen, stand ich vor der Wandnotiz, und ich weiß noch ganz genau, wie sehr mich die Ankündigung der Entlassung des Hausmeisters, wie um mein Unglück zu vervollkommnen, in die allerentsetzlichsten Gedanken stürzte. Immer wieder las ich, was die Kopfschmerzen natürlich verstärkte, das Wort »Facility Manager«. Diese monströse Geschmacklosigkeit der neuen Berufsbezeichnung, die schon dem Namen nach bereits die vergänglichste und überholteste war! Warum nur hat man den untüchtigen Hausmeister – nicht nur, dass man ihn entließ – auch noch umbenannt?, fragte ich mich, als ich vor dem Aushang stand. Weil es ein Gewaltakt ist, sagte ich mir. Weil Gewalt ja die Leute immer so befriedigt. Namen, die geändert wurden, zeugten immer von furchtbaren Verheerungen, aus St. Petersburg wurde Leningrad, aus der Poststraße die Horst-Wessel-Straße, aus dem Hausmeister wurde der Facility Manager.
Würde man die Stadt, in der ich wohnte, bald umbenennen? Würde ich selbst bald umbenannt werden, da mein Nachname irgendwann irgendwem zu sperrig klang? Überall, dachte ich, wird das Unwirsche, das Untüchtige, das Zornige abgeschafft, was mir, da ich mich auch in mancherlei Hinsicht, wenn auch nicht auf des Hausmeisters Weise, als unwirsch, untüchtig und zornig dachte, ganz und gar empörend erschien. Ganz langsam zunächst, aber dann doch, wie man im Nachhinein ja auch sieht: sehr zielstrebig, wurden, sagte ich mir, die kleinen Fluchten des Alltags, die Nachlässigkeiten, der menschliche Makel aus unserem Leben verbannt. Ich rauchte und sollte bald in keiner Kneipe mehr rauchen dürfen. Ich mochte es eher dunkel und verwegen, dachte mir die Stadt immer als einen Ort des Abenteuers, in dessen Seitenstraßen die schönsten Mätressen warten, da tauchten auch schon die hell erleuchteten, jede Ahnung eines Schattens vernichtenden Einkaufszentren auf, die alles Zwielichtige immer und überall zerstörten. Ich begriff mich als höflichen, eher zurückgenommenen Menschen, doch es schlug mir nicht selbstverständliche Höflichkeit entgegen, sondern allerorts jene berüchtigte Service-Sprache, das laute, jeden empfindsamen Menschen erschreckende »Aber gerne!«, wenn man sich einen Kaffee bestellte, das beständige, jedes gesunde Maß überschreitende Wünschen eines schönen Tages sogar an der Frittenbude, in der neuerdings auch noch gelächelt wird, usw.
Die Leute, dachte ich, die sind so, die wissen es nicht anders. Die denken, ist doch schön, wenn ich nicht mehr Journalist, sondern Content Manager heiße. Ist doch schön, wenn ich nicht mehr Vermögensverwalter heiße, sondern Asset Manager, und ab jetzt lächle, wenn’s der Chef mir sagt.
Alles Ständische und Stehende verdampft. Rosi’s Haarstudio, das die alten Damen meiner Straße mit ihrem Gehstock immer in lustig anzuschauendem holprigem Eifer aufsuchten, war, wie mir nun einfiel, kürzlich einem windigen Händler gewichen, der den jüngeren Bewohnern der Gegend, was die älteren aufs Äußerste verwunderte, ganz und gar gewöhnliche, aber etwas abgenutzte Möbel aus den 60er und 70er Jahren als Antiquitäten verkaufte. Asiaten, die Sushi servierten, verdrängten nach und nach die Türken mit ihrem hochkalorischen Döner. Die Welt ist freundlicher geworden, heller, glatter und gesünder, während ich immer älter (Mitte dreißig), faltiger (unter den Augen) und mürrischer (morgens) werde.
Das ist nicht gut, sagte ich mir jetzt, sich in die Dinge so hineinzubohren. Übertreib nicht!, sagte ich mir noch und war schon auf dem Weg in meine Wohnung, um trotz der Kopfschmerzen frühmorgens meine Schreibtätigkeit wiederaufzunehmen. Da aber auch der Ekel eine wenngleich verderbliche Anziehungskraft hat, machte ich noch einmal kehrt und stellte mich wieder vor den Aushang, murmelte »Facility Manager« und empfand die ganze Niedertracht der Immobilienfirma, die gewiss nicht nur dieses Haus, sondern den ganzen Straßenzug aufgekauft hat, wenn nicht die halbe Stadt, um überall die untüchtigen Hausmeister zu entlassen. Ich sah die Angestellten der Immobilienfirma, wie sie mit hässlich zuckender Oberlippe vor ihren Listen saßen. Wie sie mit Lineal und Rotstift fein säuberlich die untüchtigen Hausmeister wegstrichen, hier Herrn Hammerschmidt wegstrichen und da Herrn Mayer wegstrichen. Ich sah meinen Namen auf einer der Listen. Fein säuberlich wurde er unter höhnischem Gekicher weggestrichen von einem der Angestellten.
Ich entsinne mich nicht mehr, wie lang ich noch vor der Vitrine stand auf derart entrückte Weise und mich in die Dinge so schadhaft hineinbohrte. Ich weiß aber noch, dass ich manchmal den Entlassenen vor dem Hauseingang oder im Hausflur noch traf, keineswegs gramgebeugt war er, wie ich vermutet hatte, noch immer in einen Blaumann gekleidet und, ganz wie vormals, mit dem in seinem Berufsstand üblichen unverschämten Gesichtsausdruck.
2 Freundlichkeit
Günstig war der Flug, der mich und die Frau, die mich gut kennt, im letzten Sommer nach Barcelona brachte. Wären die Hitze und die architektonischen Entgleisungen Antoni Gaudís nicht gewesen, die daran erinnerten, dass man sich tatsächlich in Barcelona befand, man hätte meinen können, wir wären gar nicht verreist. Die Trams waren von derselben schnittigen Bauart wie zu Hause, in den Cafés saßen Freelancer mit ihren dickrandigen Brillen an Notebooks und Lesegeräten, die sich so geheimnisvoll und so magisch mit dem Zeigefinger auf dem Display bedienen lassen. Im Taxi vom Flughafen erspähten wir auf der Autobahn ein Schild eines Möbelgeschäfts, das uns sehr vertraut war. Die kleinen weißen Plastikkarten, die die Schlüssel in Hotels abgelöst haben, glichen vollkommen denjenigen in Wuppertal oder Frankfurt, selbst die Toilettenschüssel und Armaturenbretter im Badezimmer waren vom selben Fabrikat wie in meiner Wohnung. Das womöglich allerletzte Distinktionsmerkmal des Südens gegenüber dem Norden, so schien es mir, war die deutlich höhere Verbreitung des Bidets.
Alles Halbseidene der Stadt, das ich meinte vor zehn Jahren, während meines letzten Besuches, noch erblickt zu haben, war vertrieben worden: die kleinen Ganoven in den Seitenstraßen, die sich dem Glücksspiel hingebenden Rentner in Tabakläden, die Hausfrauenprostitution in den Gassen, die man der sittlich empfindsamen Besucher wegen unterdrückt hatte. Die Sprache war jene abgezweckte, die man aus jeder dem Tourismus verpflichteten Großstadt kennt: allerorts jenes beharrliche »You are welcome!« und »Have a nice day!«. Eine Freundlichkeit, die keine mehr war. Keine jedenfalls mehr des Überflusses, des Spiels, der Unbeschwertheit. Sie entsprang nicht neugieriger, unbedarfter, bisweilen fremdsprachenunkundiger Gastfreundschaft, sondern diente dem Tauschgeschäft.
Noch vor zehn Jahren, sagte ich zu der Frau, die mich gut kennt, während wir auf der Rambla dels Caputxins herumspazierten, war das anders. Vor zehn Jahren hatte ich mich eines späten Nachmittags in Barcelona verirrt. War ich auf der Suche nach diesem Kloster mit den etwas schlichten Skulpturen, die Fische und Vögel darstellten, am Hauptportal, das wir gestern besichtigt haben? Egal. Eigentlich weiß ich auch gar nicht mehr, ob es in Eixample oder Gràcia oder El Raval gewesen war, dass ich mich – mit meinem Stadtplan eindeutig als Tourist erkennbar – erschöpft und verschwitzt mit, wie ich mir heute denke, verwirrtem Gesichtsausdruck an eine Hauswand lehnte, als sogleich ein älterer Herr mir nicht nur den Weg wies, den ich vergeblich gesucht hatte, sondern mit einer Geste, die keinen Widerspruch duldete, nachdem wir etwas ins Gespräch gekommen waren, mich in sein Haus einlud, das ich als das prächtigste in Erinnerung behalten habe und in dem mir nicht nur, sagte ich, die allerköstlichsten Speisen in fünf Gängen vorgesetzt wurden und der kostbarste Wein, sondern zur vollständigen Abrundung des Abends sogar, wenn mich nicht alles täuscht, die ungeheuer hübsche 25-jährige Tochter, die aufreizend am Türrahmen lehnte und mich neugierig anblickte, auf verbindliche Weise zur Gesellschafterin des Nachtlebens ans Herz gelegt wurde.
Das ist heute undenkbar, sagte ich. Heute sind alle auf ganz gleichförmige, ganz erwartbare Weise freundlich, aber die 25-jährige Tochter wird einem nicht mehr ans Herz gelegt! Heute wird die alle Beziehungen durchwebende Eigenliebe nicht mehr galant verborgen, sondern offen zur Schau gestellt. Das ist das Gegenteil von Schönheit. Das Schöne, sagte ich, ist immer das Überflüssige. Die Gastfreundschaft, die ich vor zehn Jahren erfuhr, war ja im Grunde auch ganz und gar überflüssig.
Überfluss ist Luxus, sagte ich zu der Frau, die mich gut kennt, während wir die Rambla dels Caputxins auf- und abgingen. Überflüssig waren die vergoldeten Säle einst, die Teeräume, in denen man die Zeit verplemperte, das Geld verjubelte, mit Garderobe protzte. Jeder Luxus, sagte ich, ist nach Maßgabe der Rechenschieber unvernünftig und dumm. Luxus ist eine Geste, die uns die Illusion abringt, dass sie keine Gegenleistung verlangt. Luxus ist eine sozusagen unerwartete Geste, zu der jene Schmeichler unfähig sind, die immerzu »Aber gerne!« sagen.
Immer wurde einem geraten, in allen Benimmbüchern vergangener Jahrhunderte, sich von dem leicht zu durchschauenden Schmeichler fernzuhalten, hinter dessen Worten und Handlungen die Absicht steht, zu gefallen und einen dergestalt zu überlisten. Wir alle sind vielleicht im Abgrunde unseres Herzens Schmeichler, sagte ich, während wir die Rambla dels Caputxins auf- und abgingen. Mag sein, dass sich noch in die großherzigste Offerte, in den Blick jedes Verliebten eine Spur von Eitelkeit mischt, aber gerade dann sollten wir niemals auf gleichförmige und erwartbare Weise freundlich sein.
Die ganz und gar gleichförmige und erwartbare Freundlichkeit, sagte ich, die einem überall entgegenschlägt, ist es, die einem jeden Urlaub verdirbt und, wenn man es recht bedenkt, eigentlich auch schon das Leben zu Hause. Einige Wochen vor der Reise nach Barcelona hatte ich am Hauptbahnhof ein Plakat erblickt, das Teil einer städtischen Kampagne war. Abgebildet war eine große Sprechblase, in ihr stand »Wat kiekstn so, Fatzke«, was ironisch gemeint war. Berlin sollte durch Flyer, Aufkleber und Poster freundlicher werden. Ein Senatssprecher, wie ich dann wenige Tage darauf in einem Artikel mit Schrecken las, frohlockte: Man sei auf dem Weg zu einer Service-Stadt. Es ist schon so weit, sagte ich noch, dass ich richtig hässliche Zudringlichkeiten, die mir widerfahren, Flüche, sogar Tätlichkeiten der gleichförmigen und ganz und gar erwartbaren Freundlichkeit vorziehe.
Ich erinnerte mich, während wir die Rambla dels Caputxins auf- und abgingen, an ein flüchtiges Bild der Kindheit: Aus kühner Lust an Reizung war ich eines Nachmittags in die Bäckerei unserer Straße getreten und hatte der Bäckerin gesagt, dass ihre Brötchen nicht schmeckten (mein Vater hatte dies, womöglich nicht einmal ernst gemeint, beiläufig am Küchentisch beklagt). Sie hatte die Arme verschränkt und mit überraschender Schärfe gesagt, ich solle augenblicklich das Geschäft verlassen, niemand zwinge mich, hier einzukaufen, ich solle nicht auf die Idee kommen, mich noch einmal blicken zu lassen, usw. Erblasst ging ich hinaus. Es bedurfte, wie man leicht begreift, des diplomatischen Aufwandes meiner Eltern, um die Ehrverletzung zu sühnen. Die völlig geschäftsuntüchtige Bäckersehre aber war nur die wunderbare Kehrseite der überschwänglichen Gastfreundschaft, die mir in Barcelona vor zehn Jahren zuteil wurde.
Ich mag auf der Rambla dels Caputxins im vergangenen Sommer, auch aus Gründen, die hier nichts zur Sache tun, hier und da die Dinge, wenn auch nur unwesentlich, zugespitzt haben, doch scheint es mir tatsächlich, als sei Freundlichkeit einst dem Muster der Erotik gefolgt. Sie war eruptiver Natur, war geizloser Überfluss. Bisweilen musste sie erst zögerlich entkleidet, musste erobert, der keuschen Höflichkeit, dem Zeremoniell abgerungen werden.
Das Rohe ist immer intim, wir lassen es nur vertrauensvoll zu, jede ungewollte Umarmung beschmutzt. Der Stalker bedrängt mit Blumensträußen die sich Sträubende. Jene von Kämmerern geplante Herzlichkeit aber, die einem noch in der entlegensten Tankstelle entgegenschlägt, würdigt jeden Bürger zum Kunden herab. Der Kunde wiederum entfaltet sogleich jenes hässliche Anspruchsdenken, das ihn eine erworbene Platzreservierung im Zug als Menschenrecht begreifen lässt. Er toleriert eine menschliche Nachlässigkeit der Erzieherin im privatisierten Kindergarten, den seine talentierte Tochter besucht, nicht mehr. Dem Standesbeamten nötigt er jene feierliche Stimmung ab, mit der seine Service-Stadt wirbt. Unerlöster Zorn ist auf beiden Seiten der Front.
Der Mensch ist immer und überall ein Verstellungskünstler. Er vermag es, einmal sich der Gabe der Verstellungskunst bewusst geworden, fein oder grob zu täuschen. Mit Ehre oder mit Gier. Mit gerechtem Zorn oder feiger Freundlichkeit. Mit der Fülle seiner Ausdrucksmöglichkeiten oder mit geschäftstüchtiger Abgerichtetheit. Mit dem Takt des aufmerksamen Verführers oder mit der rohen Aufdringlichkeit des Zukurzgekommenen.
Taktlos ist jene Freundlichkeit, die ihren Zweck vulgär verrät. Sie ist roh, wie sie auch Rohheit gebiert. Wenn wir Schauspieler sind durch und durch, in nahezu jeder Faser unseres Daseins, wenn die Maske unsere zweite Natur ist, dann zeigt sich Freundlichkeit, der wir mit Freude verfallen, nur wie selbstvergessen.
3 Helligkeit
Meine Jugend war unfassbar düster. Ich erinnere mich noch genau an den außerhalb des Bauernhofs gelegenen Abort meiner Großeltern, zu dem ich mich nachts nur mit namenloser Furcht hinbewegte, da keine Lampe den Schotterweg beleuchtete. Ich erinnere mich an die Höhlen aus Holzstöcken und Decken, die ich mir im Zimmer provisorisch baute, um darin mich zu verstecken vor der herannahenden Erwachsenenwelt. An die dunkelsten Unterführungen und Hinterhöfe, in denen Tore geschossen wurden, bis die Nachbarn aus den Fenstern lugten und sich lauthals über das Ballspiel beschwerten, an die holzvertäfelten Kneipen der Pubertät, an darin von Kerzenlicht bestrahlte Gesichter, denen jede Glühbirne die Schönheit geraubt hätte. Im Kerzenlicht konnte, so die Hoffnung, Sabine, die in der Schule einen Jahrgang über mir und für alle unerreichbar war, weder Akne noch Fahrigkeit erahnen.
Ja, so finster war es noch vor nicht einmal zwanzig Jahren, dass man, wie sich jeder erinnert, das Haus nach dem Abendessen immer nur mit einer Taschenlampe verließ, wie sie auch schon an manchen wolkenverhangenen Tagen überaus nützliche Dienste tat. In den Geschäften hingen 20-Watt-Glühbirnen, wenn überhaupt, weshalb man das Paar Schuhe, das man sich zuzulegen gedachte, zunächst tastend begutachtete und es sich dann ganz nah ans Gesicht hielt, um es beschauen zu können. Die Decken der Wohnzimmer waren, den Kneipen gleich, mit Holz verkleidet, auf der Wandtapete sah man den Schwarzwald, der Teppich war, als einziger Lichtblick im restlichen Inventar, von einem nicht allzu dunklen, melierten Grau.
Ja, selbst noch das Einkaufszentrum unserer Stadt, die sich rühmen konnte, eines der ersten Einkaufszentren Deutschlands überhaupt zu haben, das man auf einem von schweren Luftangriffen zerstörten Gelände errichtet hatte (auf welchem zuvor das Artillerie-Depot des VIII. preußischen Armee-Korps stand), wurde zu einem Tempel der Helligkeit erst nach entschiedenen Renovierungen späterer Jahre, indem alles Nichtgleißende und Nichtspiegelnde in den Innenräumen mit Eifer abmontiert wurde und es nunmehr darin einem scheint, als sei die Schrecksekunde des Blitzlichts verewigt. Heute zeugt nur noch die in ganz unzeitgemäßem Braun gekachelte Außenfassade von der dunklen Vergangenheit.
Im Leben gibt es bekanntermaßen Zufälle, die man niemals in einem Roman oder Film darstellen würde, da sie als viel zu unwahrscheinlich angesehen würden. Als viel zu unwahrscheinlich, um es zu erzählen, muss jedenfalls zweifellos angesehen werden, dass ich Sabine, die in ihrer Schulzeit für alle unerreichbar war, beinahe fünfzehn Jahre später in einer ganz anderen Stadt, in einem mir bis heute unfasslichen Zusammenhang wiedertraf.
Der Freund, der erfolgreich etwas mit Kultur macht, hatte vor längerer Zeit am Telefon, nach einer ihn aufs Äußerste belastenden Phase der Beziehungslosigkeit, während der er in den unglücklichsten nächtlichen Unternehmungen auf Abhilfe seines Status drängte, in entrückter Weise von einer ihn auf der Vernissage eines Künstlers, der (in Fachkreisen durchaus gerühmte) düster-surreale Bilder malte, anlächelnden Frau gesprochen, die er, entgegen seinem gewohnt forschen Auftritt, sich anzusprechen nicht traute. Sabine selbst hatte ihn angesprochen, als die beiden schließlich wie ganz zufällig und in ernsthafter Versenkung gemeinsam vor einem Bild standen, das einen Raben am Strand zeigte, der auf eine ganz verlorene Weise vor wolkenverhangenem Himmel im Sand herumpickte. Auch auf den anderen Bildern in den Ausstellungsräumen sah man Strände, mit jeweils unterschiedlichen Tieren, die lagen, krochen oder standen.
Wie Leonora Carrington, sagte Sabine nur, den Raben betrachtend. Ganz geistesabwesend und wie nur zu sich selbst, woraus sich aber rasch ein Wortwechsel entspann, zunächst Kunstgeschichtliches betreffend, der, sozusagen umstandslos, wie man im Rückblick weiß, in eine langjährige Beziehung mündete.
Es war, wie sich denken lässt, als ich das Paar vor einigen Jahren in einem Café verabredungsgemäß traf, in dem vorzugsweise Salat mit hauchdünnen Ziegenkäsescheiben serviert wurde und das von gleißend heller Innenbeleuchtung geprägt war, die Überraschung natürlich mehr als groß. Wir erkannten uns sogleich wieder und standen mit weit aufgerissenen Augen voreinander, was der Freund, der erfolgreich etwas mit Kultur macht, unwissend, wie er war, nur mit erheblichem Stirnrunzeln kommentierte. Sie hatte sich kaum verändert, gewiss hier und da ein Fältchen, ansonsten: dasselbe, schon vor fünfzehn Jahren alle ihre Mitschüler verwirrende, ganz helle, ganz stark an Porzellan und entsprechende Puppen erinnernde Gesicht.