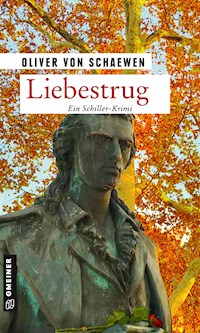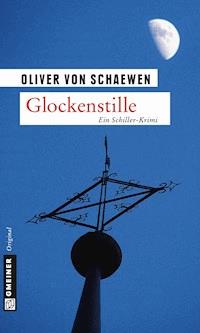
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalkommissar Struve
- Sprache: Deutsch
Der ausgebrannte Kommissar Peter Struve pilgert, doch sein Weg endet abrupt in der Marbacher Alexanderkirche. Die Leiche des Pfarrers Hans-Peter Roloff baumelt im Kirchturm an der Schillerglocke, Struve findet sich vom Messwein vergiftet im Krankenhaus wieder. Als ihn dort nachts ein Killer besucht, rappelt sich Struve auf und ermittelt. In seinen Fokus rücken ein Kirchenoberer und die radikalen Sektenmitglieder der Christuskriegerinnen. Die Lösung des Falles führt aber nur über die Schillerglocke.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oliver von Schaewen
Glockenstille
Peter Struves dritter Fall
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Markus Pantle
ISBN 978-3-8392-4508-8
Widmung
Für meinen Vater
Friedrich Schiller: Das Lied von der Glocke (Auszug)
Hört ihr’s wimmern hoch vom Turm?
Das ist Sturm!
Rot wie Blut
Ist der Himmel,
Das ist nicht des Tages Glut!
Kapitel 1: Eine schockierende Entdeckung
Immer wurde gemordet. Empört legte Gudrun Schlipf das Buch zur Seite. Die Mesnerin mochte keine Krimis – und doch hatte Sohn Gerold ihr zum Geburtstag ein noch dazu besonders blutrünstiges Machwerk untergejubelt. Angewidert quälte sie sich an diesem Abend durch die ersten 100 Seiten. Drei Leichen hatte der amerikanische Bestseller-Autor bereits platziert. In schillernden Farben beschrieb er die bestialische Vorgehensweise des Serientäters. Wenn sie den Roman nicht von ihrem Sohn geschenkt bekommen hätte, er läge längst im Kellerregal, der Vorstufe zum Exitus in der Mülltonne. Aber noch hieß es Durchhalten, schließlich hoffte die 59-Jährige, ihrem verhätschelten Filius mit einigen wohl gewählten Zitaten aus seinem, wie sie fand, etwas selbstbezogenen Geschenk beim nächsten Familientreffen ein gutes Gefühl zu geben. Gudrun Schlipf, ganz in der Tradition des schwäbischen Pietismus aufgewachsen und vor zehn Jahren zum katholischen Glauben konvertiert, wählte ihre Worte sorgfältig, mochte ihr der Alltag auch noch so viel abverlangen. Sie wusste um die zerstörerische Kraft unbedachter Äußerungen und gebot sich Einhalt, wo sie konnte. Damit war sie bisher gut gefahren. Jedenfalls konnte ihr in der Kirchengemeinde niemand nachsagen, sie sei eine Schwatzliese. Und früh ins Bett stieg sie auch. Die Mesnerin zog die Decke höher, um sich zu wärmen, und blickte auf die rote LED-Anzeige ihres Radioweckers, der seit 30 Jahren tadellos seinen Dienst erfüllte. Er zeigte 22 Uhr an. Höchste Zeit, das Abendgebet zu sprechen und das Licht zu löschen. Der morgige Tag würde ihr einiges abverlangen. Seit einem Jahr durfte die katholische Kirchengemeinde in Marbach die evangelische Alexanderkirche mitnutzen. Simultankirche nannte sich das im Kirchenbeamtendeutsch, wenn sich zwei konfessionell verschiedene Pfarrgemeinden ein Gotteshaus teilten. Aber die Fusion brachte Gudrun Schlipf keine Erleichterung. Sich für zwei Kirchengemeinden um das Gotteshaus zu kümmern, zehrte an ihren Kräften. Ein Unbehagen beschlich sie nicht nur heute, wenn sie daran dachte, wie die Grenzen zwischen katholischem und evangelischem Glauben immer mehr verwischt wurden.
»Am Ende feiern wir alle nur noch Ringelpietz mit Anfassen«, murmelte sie und erinnerte sich mit Grausen an den Familiengottesdienst des Vikars am vergangenen Sonntag. Da hatte der junge Mann doch allen Ernstes Yoga-Übungen in den Kirchenbänken machen lassen. Diese komischen Verrenkungen – der Vikar stand in Talar und Schlabberhose im Altarraum – kannte Gudrun Schlipf nur vom Krankengymnasten am Bahnhof und da gehörten sie auch hin.
»Wir müssen Buße tun«, brummte sie und dachte an den Pfarrer, der im Ruf stand, mit seiner Haushälterin unzüchtig zusammenzuleben. »Eine wahre Schande«, befand Gudrun Schlipf voller Verachtung, nicht ohne ihren Schöpfer für solche Schmähworte dreimal um Verzeihung zu bitten. Sie betete ihren Rosenkranz zu Ende, löschte das Licht und schlummerte bald darauf ein, mit sich und dem lieben Gott im Reinen.
Die Mesnerin schlief jedoch schlecht. Sie träumte, Gerold würde im mittelalterlichen Paris als Ketzer auf einem baumhoch lodernden Scheiterhaufen verbrannt. Die gellenden Schreie ihres Sohnes vermischten sich mit ihren eigenen Rufen zu einem windsäuselnden, schaurigen Choral der Verlorenen. Dazu läuteten die Glocken von Notre Dame Sturm. In dem immer bedrohlicher werdenden infernalischen Spektakel riss sie schließlich ein letzter dumpfer Glockenschlag aus dem Schlaf. Jäh schlug sie die Augen auf. Nur langsam realisierte sie, dass in ihrer Schlafkammer keine Hinrichtung stattfand und ihr Bett kein Pariser Balkon war. Erleichtert atmete sie auf. Sie knipste das Licht an und griff zum Wasserglas, das sie in Reichweite gestellt hatte. Es war 3.50 Uhr, der Wind rüttelte heftig an den Fensterläden des kleinen Hauses im Wilhelm-Schenk-Weg. Im Wetterbericht war von einem Sturm die Rede gewesen. Wieder hörte sie das mechanisch schlagende Geräusch. Es drang direkt aus dem Glockenturm. Etwas stimmte nicht. Sie öffnete das Fenster und hielt die Luft an, um die ungewöhnliche Klangkulisse besser aufnehmen zu können. Und sie hatte richtig gehört: Eine einzelne Glocke schlug.
Ungewöhnlich, dachte die Mesnerin. Hatten sich doch die Kirchengemeinden schon vor langer Zeit darauf geeinigt, den nächtlichen Glockenschlag zur Zeitansage abzustellen. Ein Geläut, wie es jetzt erklang, passte nicht zu dieser Absprache. Gudrun Schlipf ging davon aus, dass sich nicht nur sie in ihrer Nachtruhe gestört fühlte. Nach einer kurzen Pause schlug die Glocke wieder, dong, dong, dong, es war ein seltsamer, unregelmäßiger Schlag, der sich anhörte wie der von der Schillerglocke. Ungläubig und zugleich müde rieb sich die Mesnerin die Augen. Die Concordia erklang sonst nur zweimal im Jahr, zum Geburtstag Schillers am 10. November und zum Todestag am 9. Mai, was am Dichterkult lag. Schiller-Verehrer aus Moskau hatten die Glocke zum 100. Geburtstag des Dichters im Jahre 1859 gestiftet. Offenbar drang starker Wind in den Glockenturm. Aber dieser Klang – wie auf einem Geisterschiff! Eine Gänsehaut überlief sie. War heute nicht der 30. April, Walpurgisnacht? Ach, sie war doch nicht abergläubisch! Von solchem heidnischen Kram hielt sie überhaupt nichts. Schlimm genug, dass ihr Gerold am Tag vor Allerheiligen in seinem lächerlichen Latex-Spinnenkostüm immer zu diesen affigen Halloween-Partys ging.
Die Glocke schlug lauter. In einigen Häusern gingen bereits Lichter an. Gudrun Schlipfs Herz begann merklich schneller zu klopfen. Eine Anzeige wegen Ruhestörung fehlte ihr noch. Sie musste nach dem Rechten sehen, ob sie wollte oder nicht. Die Mesnerin zog sich an, nahm die Taschenlampe und keine zwei Minuten später öffnete sie das schwere schmiedeeiserne Kirchenportal. Ein eisiger Schauer durchfuhr sie, als der Strahl ihrer Lampe eine Fledermaus erfasste, die aus dem Glockenturm flog. Dong, dong, dong – immer schneller und lauter schallten die Schläge von oben herab. In ihrer Aufregung vergaß die nächtliche Besucherin, den Schalter zu betätigen, der das Kirchenschiff in ein beruhigendes Licht getaucht hätte. Sie näherte sich dem Glockenturm und öffnete die Türe. Plötzlich erschien über ihr ein Schatten.
Der schrille Schrei der Mesnerin durchdrang den Turm. Eine Eule breitete ihre mächtigen Schwingen aus. Kalter Schweiß stand auf der Stirn der pflichtbewussten Frau. Noch nie hatte sie um diese Uhrzeit ihre geliebte Alexanderkirche betreten. Es kostete sie Überwindung, die engen Stiegen der steilen Treppe emporzusteigen. Die Hoffnung, es würde ihr gelingen, die vorlaute Glocke rasch zum Schweigen zu bringen, trieb sie voran.
»Ist da jemand?«, fragte sie mit zittriger Stimme in die Dunkelheit. Nichts regte sich. Heftig schlug der Klöppel auf die Glocke ein, deren Klang seltsam gedämpft wirkte. Endlich hatte es Gudrun Schlipf geschafft. Oben angekommen, inspizierte sie die Glocken. Fünf waren es, die der Verein für die Erhaltung der Alexanderkirche im Jahr 1997 hatte anbringen lassen. Als die Mesnerin nach oben schaute, erschrak sie fast zu Tode.
»Großer Gott!«, keuchte sie mit weit aufgerissenen Augen.
Keine fünf Meter über ihr baumelte ein menschlicher Körper leblos an einem Seil an der Schillerglocke. Der Erhängte starrte sie mit ausdruckslosen Augen an. Ein entferntes Scheppern erinnerte sie daran, dass ihr die Taschenlampe vor Sekundenbruchteilen aus der Hand geglitten war. Gudrun Schlipf wankte, suchte am Geländer Halt. War das nicht Pfarrer Roloff? Unfassbar! Er mochte ja ein Zölibatsbrecher sein, aber ein solches Ende hatte er nie und nimmer verdient, fand die völlig verängstigte Kirchenangestellte. Schritt für Schritt tastete sie sich nach unten. Sie musste jetzt endlich Licht machen. Aufgewühlt lief sie durch das Kirchenschiff auf die Sakristei zu. Als sie im Sicherungskasten alle Schalter umgelegt hatte, machte sie eine zweite schockierende Entdeckung: Ein Mann lag leblos auf dem Boden.
Der Aufseher
Verzeihung, geschätzter Leser. Ich bin mir bewusst, ich störe Ihren Lesefluss. Aber ich tauche an dieser Stelle des Krimis nicht ganz freiwillig auf. Einzig mein Erschaffer, der Autor dieses Buches, verlangt von mir diesen Auftritt. Er ist davon beseelt, etwas Neues in einem Krimi zu erfinden: das Gespräch des Verbrechers mit dem Leser. Interaktiv sozusagen. Das Genre sprengen, wie es in den Kritiken im Feuilleton immer so schön heißt. Dabei bin ich mir sicher, dass irgendeiner dieser Krimi-Schreiberlinge nach dem zweiten Glas Wein schon einmal den Trick versucht hat, um originell zu wirken. Jedenfalls scheut der Verfasser dieser Zeilen sich nicht, mich direkt auf Sie zu hetzen. Mich, den Verantwortlichen, den geheimen Grund dieses Buches. Den, dessen Identität Sie erst durch aufmerksames Lesen und intelligentes Schlussfolgern, noch lange, bevor es der Kommissar schafft, herausfinden sollen. Dieser Regelbrecher macht das, was man auf keinen Fall tun sollte: Er lässt mich aus der Geschichte heraustreten. Stellen Sie sich einen Theaterschauspieler vor, der dem Publikum zwischendurch erklärt, wie er es findet, in dem Stück mitzuspielen. Grausam! Sie wissen, Krimischreiber haben die verrücktesten Ideen. Lassen Schweine ermitteln. Oder erfinden einen Mord, der in einem Eisenbahn-Abteil von allen Verdächtigen begangen worden ist. Greifen aktuelle Themen wie Fußball-Weltmeisterschaften oder Bahnhofsumbauten auf. Geschickt sind sie ja schon, diese Taschenbuchvollkleckser, sie heischen nach Aufmerksamkeit, wollen ihre Auflage erhöhen. Fast könnte man sie für Journalisten halten. Mein Erfinder zum Beispiel möchte mit Schiller punkten. Was für ein lächerlicher Versuch, in einer Welt, in der Facebook und Twitter längst viel mehr interessieren als schwer verständliche Dichter und langatmige Schwarten aus vergangenen Jahrhunderten. Vielleicht will er ja einen Gegentrend einleiten. Aber lassen wir das. Mich beschäftigt viel mehr, wie ich jetzt mit Ihnen umgehen soll, wenn ich das tue, was mein Kreator von mir verlangt: Sie ein bisschen am Nerv zu kitzeln, ohne zu viel zu verraten. Nun ja. Man kann mir ja alles vorwerfen, aber ein Spielverderber bin ich nicht. Um diesen Schiller zu bemühen: Der Mensch ist vor allem da Mensch, wo er spielt. Na, so ähnlich hat er es doch gesagt, oder? Sie werden das schon googeln!
Natürlich fragen Sie sich, wer ich bin. Aber das verrate ich nicht. Schon gar nicht am Anfang des Krimis. Ich werde auf keinen Fall ein Geständnis ablegen. Nicht hier und auch nicht später. Ich werde alles geben, damit man mich nicht lebend ergreift. Denn meine Tat, das haben Sie schon bemerkt, ist ein solcher Frevel, dass Gott selbst mich zum Vogelfreien erklärt hat. Aber fangen wird mich niemand und schon gar nicht wird mich ein Polizist in eine dieser stickigen Zellen mit schmalem Waschbecken und Klo stecken. Eher …
Jetzt sind Sie überrascht, nicht wahr? Der Akteur identifiziert sich also doch mit seiner Rolle, werden Sie denken. Aber um ehrlich zu sein: Ich wäre viel lieber der Kommissar. Seine Chancen, heil aus dieser Handlung herauszukommen, stehen um ein Vielfaches höher als meine. Halten Sie sich vor Augen: Kommissare werden selten aus Fortsetzungsserien geballert. Täter dagegen finden ihr gerechtes Ende. Natürlich liegt das an uns. Wir sind nicht einfach nur böse, sondern dazu noch richtig fiese Gestalten. Das liegt aber auch an den Schreiberlingen. Ich weiß, dass ich viel netter sein könnte als auf diesen Papierseiten. Ich bekomme aber keine Chance. Bin ein Verbrecher aus verlorener Ehre, um wieder diesen Schiller zu bemühen, der damals in Leipzig, als er blank war, mit Krimischreiben über die Runden kommen wollte. Dann hat er das aber sein lassen und sich auf Theaterstücke konzentriert. War wohl die richtige Entscheidung, jedenfalls hat er es zu Ehren gebracht.
Falls Sie mein Bildungslevel hinterfragen: Ich bin wirklich belesen und intelligent. Das sollten Sie sich merken, wenn Sie in diesem Buch mit mir mithalten wollen. Und auch wenn Sie mich am Ende kriegen werden, weil Krimi-Autoren nicht anders können, als dem Gesetz und der Ordnung zum Happy End zu verhelfen – ich werde dem entgegenwirken. Sie wollen mich erraten? Versuchen Sie’s doch!
Kapitel 2: Was ein Kommissar am Pilgern findet
So also fühlte es sich an, wenn man pilgerte. Mit schmerzverzerrtem Gesicht betastete Peter Struve seine rechte Ferse. Die neuen Wanderschuhe hatten sich seit einer Stunde unangenehm in Erinnerung gerufen. Erschöpft setzte sich der schmale Endvierziger mit den vollen, grau melierten Haaren auf eine Bank und betrachtete den Hautfetzen, unter dem eine nasse, dunkelrote Wunde klaffte. Er rieb etwas Rasierwasser auf die Stelle – was höllisch brannte und ihm ein gepresstes »Herrgottsakramentofixhalleluja« entlockte. Aber alle Ablenkung half nichts: Auch mit dem schnell aufgedrückten Heftpflaster würde er die Tour an diesem Tag kaum fortsetzen können. Er schaute auf die Karte. Nur noch wenige Kilometer trennten ihn vom Ziel seiner ersten Etappe, sein grünes Flanellhemd war schon ziemlich durchgeschwitzt. Er bedauerte, nicht auf den Rat der Kollegen gehört zu haben, die ihm Funktionsunterwäsche empfohlen hatten. Der Westfale war mal wieder dickköpfig geblieben, hatte sein altes Angorahemd genommen – und brauchte jetzt bald eine Dusche.
Voller Erwartungen war er am Morgen vom Ludwigsburger Bahnhof aufgebrochen und in Marbach in den Bus nach Beilstein gestiegen. Er wollte über Marbach und Winnenden auf den Hauptweg der Jakobspilger von Rothenburg ob der Tauber nach Rottenburg gelangen. Er hatte gehört, dass der Wein-Lese-Weg durchs Bottwartal ein alter Jakobsweg gewesen sein könnte. Kürzlich war an der Marbacher Stadtkirche auch ein Jakobus als Außenfigur angebracht worden – den wollte er sich auf jeden Fall anschauen.
Auf der Wandertour den Kopf freibekommen, das war sein Ziel. Nach der Trennung von Marie hatte er die Wohnung im 17. Stock des Marstall-Centers behalten. Jetzt war er froh, die Frühlingslandschaft in diesem April durchstreifen zu können, zumal ihm die Abwesenheit seiner Frau mehr zu schaffen machte, als er geglaubt hätte. Vielleicht war er auch deshalb zurückgekehrt, hier in sein Einsatzgebiet im nördlichen Landkreis Ludwigsburg, wo er schon lange keinen Fall mehr hatte bearbeiten müssen. Marbach hatte er seit Monaten auch privat gemieden. Marie lebte dort, er war an diesem Morgen mit einem unguten Gefühl gestartet und nicht so recht in Tritt gekommen. Während er grübelte, lief er müde vor sich hin und ließ sich nach einem ausgiebigen zweiten Frühstück in einer Bäckerei in Oberstenfeld mit dem Taxi zum Großbottwarer Harzberg chauffieren. »Ein guter Start ziert alles«, beruhigte er sein Gewissen und legte mit dem theologischen Spruch der Marke Eigenbau ›Liebe dich selbst wie deinen Nächsten‹ in seinem Pilgertagebuch nach.
Eigentlich wäre er am liebsten auf dem spanischen Jakobsweg gewandert. Aber er fürchtete überfüllte Pilgerherbergen und deren schnarchende Nutzer. Und wo blieb, bitte schön, noch der eigene Weg, wenn Millionen vor ihm die gleiche Strecke gelaufen waren? Er schätzte sich nicht als elitär ein, aber mit der Menge zu marschieren, behagte ihm überhaupt nicht. Dazu kam, dass er sich nicht für religiös hielt. Aus der Kirche war er schon mit Anfang 20 ausgetreten. Damals hielt er jeglichen Glaubenskram für eine Massenverdummung, gemacht für verklemmte Neurotiker und Weicheier. Er hatte gelernt, sich auf sich selbst zu verlassen. Inzwischen sah er die Sache anders. Vielleicht, weil es mehr geben musste, als seine vier Wände abzubezahlen und auf die Rente zuzusteuern. Struve war sich in diesen Fragen nicht sicher, aber er spürte, es war der richtige Zeitpunkt, sich neu auf den Weg zu machen.
Der Kommissar schaute auf sein Handy. Schon bald 16 Uhr. Es lagen noch einige Kilometer vor ihm. Er würde nach Marbach hineinlaufen, sich ein Zimmer nehmen und einen Happen essen gehen. Das Summen seines auf lautlos gestellten Mobiltelefons riss ihn aus seinen Gedanken. Der Nummer nach zu urteilen, musste es sein Kollege Littmann sein.
»Na, mein lieber Struve, wie läuft’s denn so auf den ersten Kilometern?«
»Danke, ganz gut. Aber hatten wir nicht vereinbart, nur in absoluten Notfällen miteinander zu telefonieren?«
»Sorry. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass wir in zwei Wochen zu Kottsiepers 60. ein kleines Ständchen bringen.«
Ausgerechnet Kottsieper. Die Arroganz des Polizeipräsidenten hatte Struve schon viele Male zur Weißglut gebracht. Und jetzt sollte er seinen Urlaub auch noch dafür verwenden, sich ein Liedchen für den wenig geliebten Chef auszudenken? Der Kommissar hätte sein Handy am liebsten sonst wohin geworfen.
»Na schön, dann machen Sie mal, Littmann«, schnarrte er ins Telefon.
»Freut mich, dass Sie die Idee gut finden«, flötete der Kollege. »Weil’s ein runder Geburtstag ist, haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen.«
»Moment mal«, versuchte Struve einzuhaken.
»Lassen Sie es mich kurz erklären«, bat der andere und seine Stimme überschlug sich fast. Struve hielt inne, er gestand sich ein, doch ein wenig neugierig zu sein.
»Der Alte hat doch neulich von diesem Schiller-Musical so geschwärmt, das er sich im Ludwigsburger Forum angeschaut hat.«
»Ja, und?« Struve fand, dass Kottsieper und Kultur nicht wirklich zusammenpassten. Umso mehr hatte es ihn überrascht, dass der Polizeipräsident das Musical nach dem Besuch in den höchsten Tönen lobte. Wie sich später herausstellte, hatte Kottsiepers Schwester in dem Stück als Statistin mitgewirkt.
»Na, erinnern Sie sich nicht?«, half Littmann nach, weil er glaubte, Struve auf dem falschen Fuß erwischt zu haben. »Das Lied von der Glocke, eine der bekanntesten Balladen vom Schiller.«
»Schön und gut, aber was habe ich damit zu schaffen, Littmann?«
»Ganz einfach: Sie und ich, wir werden unseren Chef damit überraschen.«
»Vergessen Sie’s!« Struve legte auf.
Wenige Sekunden später war Littmann wieder am Apparat.
»Sie müssen ja nicht viele Strophen auswendig lernen. Die anderen machen auch mit.«
Struve schwieg. Ihm schien es unwahrscheinlich, dass der Schleimer Littmann die hartgesottenen Kollegen der Mordkommission mobilisieren konnte. Er selbst lehnte solche Geburtstagsaktionen nicht grundsätzlich ab, aber bei Kottsieper, dem erklärten Gegner jeder polizeigewerkschaftlichen Perspektive, war er nicht bereit, den Claqueur zu mimen.
»Ich überleg’s mir noch bis nach dem Urlaub«, erklärte er, um Littmann hinzuhalten.
»Schön«, antwortete der Kollege, »ich habe Ihnen übrigens in einer Marbacher Buchhandlung eine Ausgabe der Balladen bestellt. Sie brauchen sie nur noch abzuholen, es ist in der Marktstraße. Schlagen Sie dann einfach Seite 5 auf. Diese Strophe habe ich für Sie reserviert.«
Nach dem Anruf Littmanns wusste er: Es war ein Fehler, nicht das Weite gesucht zu haben. Die Schlinge des Gewohnten zog sich zu, wollte ihn festhalten. Und war er nicht auch im bisherigen Arbeitsleben viel zu nachgiebig? In seinen Ermittlungen trat er nicht selten auf der Stelle und oft kam es ihm vor, als ob ihn die Tatverdächtigen an der Nase herumführten. Struve fragte sich allen Ernstes, ob die Arbeit, die er leistete – oft waren es Bagatellfälle –, überhaupt irgendjemandem nutzte. Längst hatten im Team andere das Lösen komplexer Fälle übernommen. Kottsieper, der ihn noch nie gemocht hatte, ließ sich noch seltener als zuvor in seinem Büro blicken, das im abgelegenen Teil des Stockwerks lag, gleich neben den Toiletten. Was den Vorteil hatte, dass sich wenigstens ab und an Kollegen zu einem kleinen Plausch einfanden und dies auch noch in einem erleichterten Zustand.
Der letzte Mordfall, mit dem Struve betraut worden war, datierte aus dem Jahr 2010. Seitdem kümmerte er sich um Körperverletzungen, Kneipenschlägereien und andere Rohheitsdelikte, die sie ihm übertragen hatten. Nicht, dass er darunter litt, zu wenig zu tun zu haben. Sein Schreibtisch war immer voll. Aber er spürte, dass er älter wurde und nach Dienstschluss auf der Couch versumpfte, den dumpfen Betäubungen des Fernsehprogramms willig erliegend. Natürlich hatten die Kollegen bemerkt, dass er sich nach der Trennung von Marie verändert hatte und sich zurückzog. Oft luden ihn seine Teampartnerin Melanie und ihre Freundin Bianca ein, und sie verbrachten in dem alten Winzerhäuser Bauernhaus, das die WG renoviert hatte, lange Abende bei Ciabatta, Bio-Käse und Bottwartaler Wein. Diese Begegnungen waren Balsam für den einsamen Wolf, wie sich Struve seitdem selbst gerne ironisch nannte. Ob er sich nicht gerne eine Freundin suchen wolle, fragte ihn die Kollegin bei einem der Treffen. Das wäre heutzutage überhaupt nicht schwierig. Die Partnervermittlungen im Internet boomten. Kochkurse, Speeddatings und Gemeinschaftsreisen lägen im Trend. Man müsse die Nase nur mal rausstecken und sich auf den Weg machen. Von solchen gut gemeinten Ratschlägen hielt Struve jedoch überhaupt nichts. Liebe ließ sich nicht mit der Masse an Begegnungen erzwingen, davon war er mehr denn je überzeugt. Außerdem fühlte er sich allein durchaus wohl. Eine Feststellung, die ihm seine Umgebung zwar nicht abnahm, aber vom Urteil anderer ließ er sich schon lange nicht mehr leiten. Nur – wie entkam er der Routine? Dem Abstellgleis, der Bedeutungslosigkeit, die in ihm mehr Raum einnahm, als er wahrhaben wollte. Er musste etwas tun. Aufbrechen. Genau deshalb pilgerte er ja. Aber ob Littmann und das Auswendiglernen einer Glocken-Strophe von Schiller die richtige Medizin für ihn waren, wagte er zu bezweifeln.
Kapitel 3: Böses Erwachen im Krankenhaus
Blinzelnd öffnete Peter Struve die Augen. Ein milchiger Schleier vernebelte seinen Blick. Wenig später registrierte er, dass er in einem Bett lag. Um ihn herum weißes Bettzeug, weiße Schränke und weiße Wände, sogar sein Nachthemd war weiß. Sie hatten ihn also in ein Krankenhaus gesteckt. Wieder trübte sich sein Blick. In seinem Kopf hämmerte es, als ob ein Buntspecht einen Baum abklopfte. Eine bleierne Schwere verhinderte, dass der Schmerz vollends durchdrang und zwang ihn in den Schlaf. Als er wieder aufwachte, wusste er nicht, wie viel Zeit vergangen war. Vor seinem Bett stand jemand. Es war ihm, als ob Stimmen leise durch das Zimmer hallten. Er verstand nur Wortfetzen.
»… wird es wohl schaffen …«
»… relativ robust …«
»… aber auch nicht mehr der Allerjüngste …«
Es waren Männerstimmen, die zu den weißen Kitteln gehörten, die vor seinem Bett eine textile Wand bildeten. Er konnte seine Augen nicht heben, sodass er die Gesichter nicht sah. Gelähmt, ich bin gelähmt, durchfuhr es ihn. Auch Arme und Beine gehorchten ihm nicht. Sogar seine Mimik war zum Erliegen gekommen. So mussten sich Menschen fühlen, die einen Schlaganfall erlitten hatten. Nur seine Gedanken funktionierten noch, wenngleich sie lediglich auf den Augenblick fixiert waren. Und er konnte minimal hören. Das Piepsen eines Gerätes etwa, an das sie ihn angeschlossen hatten. Schmale Plastikkabel mit Sensoren aus dünnem Stahl drückten unangenehm auf seine linke Armbeuge. Rechts hatten sie ihm eine Infusion gelegt. Die Tropfen lösten sich wie in Zeitlupe.
Struve versuchte, aus dem Stimmenmischmasch Informationen zu filtern.
»… Identität geklärt … Polizist.«
Aha, immerhin das hatten sie herausgefunden. An seinen Namen erinnerte er sich wenigstens noch selbst, es hätte schlimmer kommen können, dachte er. Wieder zuckte er unter einem jähen Kopfschmerz zusammen.
»Herr Struve, können Sie mich hören?« Ein Arzt, er musste um die 40 sein, braun gebrannt und glatt rasiert, beugte sich zu ihm herunter. Ein moderat riechendes Aftershave verbreitete seine Duftnote. Der Mediziner blickte ihn erwartungsvoll an, Struve hätte ihm gerne geantwortet, aber mehr als ein schwacher Lidschlag war nicht drin. Vermutlich starrte er ihn an wie der Frosch eine Schlange. Sekundenbruchteile später war das freundliche Gesicht aus seinem Blickfeld verschwunden.
Die Wortfetzen »minimale Reaktionen« und »braucht jetzt Ruhe« drangen zu ihm, bevor der medizinische Tross weiterzog. Er fiel wieder in einen tiefen Schlaf und träumte, er wäre ein Engel. Ganz leicht fühlte es sich an, als er über die Dächer seines Wohnortes Ludwigsburg flog. Und dann trieb ihn der Wind zum Marstall-Center. Hoch oben, im 17. Stock, schaute er durch ein Fenster und erkannte seine vertraute Umgebung. Er sah seine CD-Sammlung, in der sich im Laufe der Zeit vermehrt Tonträger mit Bluesstücken angesammelt hatten. Eine Musik, die so gar nicht in seine schwäbische Umgebung passte, in der Fleiß und Sparsamkeit ein Leben in Eigenheim und Wohlstand versprachen. Grundsätze, die ins allgemeine Bewusstsein eingemeißelt schienen und den Schwaben als geborenen Angstsparern Immunkräfte gegen den proletarisierenden Sog von Finanzkrise und Euro-Schwäche versprachen. Der Wucht solcher Werte hatte Struve nur die Flucht ins musikalische Offroadgebiet schwarzer Musik entgegenzusetzen.
Der Kommissar wunderte sich, dass er in seinem Traum schon wieder zu solchen Gedanken fähig war. Sollte sich sein Zustand entscheidend bessern, würde er versuchen, das Gleitschirmfliegen zu erlernen. Das hatte er schon lange vor, und er deutete das erhebende Fluggefühl im Traum als Einladung, sich den Erdkräften des Alltags zu widersetzen.
An Entgrenzung war freilich jetzt überhaupt nicht zu denken. Er fühlte sich wie ein Klumpen Fleisch, unbeweglich und fast taub, ein Pflegefall. Die Tür öffnete sich. In Struves Blickfeld tauchten sein Chef, Polizeipräsident Hans Kottsieper, und seine Kollegin Melanie Förster auf. Mit von der Partie war auch Karl Littmann, der neuerdings in der Stuttgarter Zentrale nur noch Innendienst schob, weil er seiner nicht ganz ernstzunehmenden chronischen Sonnenallergie mit einem ärztlichen Attest Nachdruck verliehen hatte. Es gab Tage, da beneidete Struve seinen Kollegen um dieses Privileg, aber er wusste, sein Spürsinn brauchte den Staub der Straße und das damit verbundene Berufsrisiko, auch einmal im Staub zu landen. Er war froh, dass sein Langzeitgedächtnis funktionierte. Warum aber war er hier? Und wie war es dazu gekommen? Er hätte sich am liebsten mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Die Wut über seine Ohnmacht wich der Erkenntnis, sich besser nicht aufzuregen und sich damit zu schwächen. Er begann, sich mit aufbauenden Gedanken zu trösten: Du hast Glück gehabt, lebst noch. Du hast durch deinen Schlaf eine Verbesserung erzielt und erkennst deine Umgebung deutlicher. Du wirst kämpfen, durchhalten, dann kommst du wieder auf die Beine und zeigst es ihnen. Autosuggestion, eine Technik, die er vor vielen Jahren im Kolleg der Jesuiten kennengelernt hatte. Tja, dachte Struve, wenn einen niemand lobte, was im Schwabenland ja durchaus vorkam, musste man es eben selbst tun. Und zwar möglichst, ohne dass man von anderen dabei gehört wurde.
Keiner der Besucher verstand seine mit dünner Stimme ausgestoßenen und kaum hörbaren Elaborate, mit denen er wie ein Fisch auf dem Trockenen nach Lebensluft schnappte. Der alte Haudegen Kottsieper, ein dank permanenten Lauftrainings immer noch drahtiger Zwei-Meter-Mann mit grauen kurzen Haaren und ebenso grauem oversized Anzug von der Stange, musterte ihn mit unbewegter Mimik. Als kerniger Oberbergischer aus Wuppertal galt er im Kollegenkreis als nicht gerade zartbesaitet. Und offenbar wähnte er seinen Mitarbeiter schon halb im Jenseits, er nahm jedenfalls kein Blatt vor den Mund.
»Um Gottes willen, schauen Sie sich den Struve an, der schaut ja völlig wirr aus der Wäsche.«
Vermutlich stimmt das sogar, dachte der Kommissar.
»Jetzt mal langsam, Herr Präsident, wir besuchen einen Kranken, da sollten Sie vielleicht besser auf ihn eingehen, statt so negativ über ihn zu reden.« Melanie Förster ergriff also Partei. Die Kollegin, etwa 30 Jahre alt und mit ihren dunkelblonden Haaren, blauen Augen und einem modischen weißen Pullover mit dem aufgenähten Großbottwarer Wappentier, einem Storchen, sowie eng sitzender dunkler Jeans nett anzuschauen, blickte sorgenvoll auf ihn herab. Struve gefiel ihre direkte, impulsive Art, mit der sie bei Vorgesetzten zuweilen aneckte.
»Meinen Sie wirklich, der versteht uns?«, fragte Kottsieper unverblümt zurück. »Nach dem, was uns dieser Chefarzt erzählt hat, kann es im schlechtesten Fall sein, dass er plemplem wird.«
»Ja, prima, nur weiter so!«, regte sich die junge Kommissarin auf. »Wenn Sie hier am Krankenbett so schwätzen, als ob Peter als Mensch nicht existiert, können wir gleich das Bestattungsinstitut anrufen.«
»Herr Kottsieper, erlauben Sie mir eine Bemerkung«, schaltete sich der 55-jährige Littmann, ein korrekt gescheitelter Hornbrillenträger mit gemütlich hervortretendem Hängebauch und Neigung zu trachtenartigen Anzügen, ein. »Mit Kranken sollte man tatsächlich sehr rücksichtsvoll umgehen, das hat mir schon meine Großmutter – Gott habe sie selig – eingebläut.«
»Also gut, kommen wir zum Punkt«, bestimmte Kottsieper forsch. »An eine Vernehmung des Kollegen ist wohl nicht zu denken, da er laut Arzt nicht ansprechbar ist. Oder, Herr Struve?« Mit einem leichten Blick streifte er den Bettlägrigen, dessen Augenlider wie zur Bestätigung genau in diesem Moment kraftlos nach unten fielen. Kottsieper sah sich in seinem Urteil bestärkt und wandte sich mit einem selbstzufriedenen Lächeln seinen Untergebenen zu. »Wie weit sind Sie, Frau Förster?«
»So weit, wie man am Morgen nach einer Mordnacht eben sein kann: am Anfang.«
»Was wissen Sie über den Toten?«
»Hans-Peter Roloff, 45 Jahre, der katholische Pfarrer der Stadt.«
»Hmm …, alles keine Gründe, um jemanden im Kirchturm aufzuhängen.« Kottsieper zupfte sich einen Streifen Kaugummi aus der Innentasche seines Jacketts, packte ihn aus und schob ihn sich in den Mund, wie er es immer bei Besprechungen machte. Für alle Beteiligten war das stets ein Signal, sich durch kluge Gedanken in der rituell eingeleiteten Konzentrationsphase Anerkennung zu verschaffen.
»Noch dazu am Seil der Schillerglocke«, ergänzte Littmann mit gespielter Empörung, um auf die Besonderheit des Mordwerkzeugs aufmerksam zu machen.
Struve starrte ihn mit regungslosem Gesicht an. Langsam dämmerte ihm, in was er da reingeraten war. Er hatte den Pfarrer an dem Abend unmittelbar vor der Messe angesprochen und sich, beseelt von seiner Aufbruchstimmung, als Pilger zu erkennen gegeben. Der Geistliche schien ihm aufgeschlossen und sie hatten sich gleich angeregt über den Sinn des Pilgerns unterhalten. Und hatten sie sich nicht verabredet? Gleich nach dem Gottesdienst wollten sie sich in Schillers Café gegenüber vom Geburtshaus des Dichters zusammensetzen. Dazu war es offenbar nicht mehr gekommen. Jedenfalls erinnerte sich Struve nicht mehr daran. Das, was Kottsieper von sich gegeben hatte, beseitigte alle Restzweifel. Ein furchtbares Verbrechen hatte sich ereignet.
»Jemand muss den Mord von langer Hand geplant haben«, meinte Melanie Förster. Sie hielt das Arrangement im Glockenturm für eine regelrechte Hinrichtung. »Da war lang schwelender Hass im Spiel, warum sollte sich sonst jemand die Mühe machen, einen 70 Kilo schweren Leib nach oben zu tragen und ihn dann noch an einer Glocke demonstrativ zur Schau zu stellen?«
»Das mit dem Seil und dem Aufwand kann ich nur unterstreichen, Frau Förster.« Littmann hatte den Zeigefinger gehoben, um das Ergebnis einer seiner Telefonrecherchen zu verkünden. »Ich habe mit dem Vorsitzenden des Vereins zur Erhaltung der Alexanderkirche gesprochen: Da oben gibt es sonst kein Glockenseil, da läuft alles automatisch ab. Der Täter hat das Seil oben an der Glocke befestigt – zu diesem Ergebnis ist übrigens auch die Spurensicherung gekommen.«
»Aha – stellt sich die Frage nach dem Motiv. Der Mann hat sicher nicht nur Freunde gehabt«, bemerkte Kottsieper.
»Wir sind dabei, das zu klären«, antwortete die Kommissarin. »Hat Besold schon die Leiche obduziert?«
»Noch nicht«, antwortete Littmann. »Er ist sich bis jetzt noch nicht sicher, ob Roloff erst am Strang oder schon vorher ums Leben kam.« Der Kriminaltechniker werde aber im Lauf des Tages einen Bericht liefern.
»Peter war offenbar zur falschen Zeit an der falschen Stelle.« Melanie Förster blickte besorgt auf den regungslosen Kollegen. »Peter, kannst du uns hören?« Sie fuhr ihm mit der Hand behutsam über die Wangen, ihr standen die Tränen in den Augen. Struve wollte etwas sagen, schaffte es aber nicht.
»Also gut, halten wir fest«, hob Kottsieper an. »Kollege Struve pilgert nach Marbach, er besucht am Abend den Gottesdienst und bricht anschließend in der Sakristei zusammen.«
Ja, so war’s, dachte Struve. Dieser Pfarrer hatte ihm angeboten, eine Lesung vorne, am Ambo, zu übernehmen. Eine Bibelstelle aus dem ersten Petrus-Brief, es ging darum, in Gottesfurcht zu pilgern und sich nicht von seinen Begierden leiten zu lassen. Tja, das hätte er sich besser gleich hinter die Ohren geschrieben.
»Nach Auskunft der Mesnerin hat Struve da vorne im Chorraum eine Aufgabe übernommen«, erzählte Littmann richtigerweise, »er war ja früher bei den Jesuiten in Münster so was wie der Obermessdiener.« Der Kollege konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Als ihn der vernichtende Blick Melanie Försters traf, schob er ein halbherzig klingendes »Oh, sorry, mein lieber Struve« nach.
Melanie Förster ignorierte den Fauxpas und versuchte, den Faden weiterzuspinnen. »Dann ist Peter in der Sakristei zusammengebrochen, seltsam! Gut, dass man ihn wenigstens noch rechtzeitig gefunden hat. Er lag völlig unterkühlt stundenlang da rum.« Sie streichelte ihrem Teampartner erneut über die immer noch tauben Wangen. Struve, dessen Pupillen kaum reagierten, hätte heulen können. Würde er jemals wieder der Alte werden?
»Ja, und die Mesnerin – die hat Pfarrer und Lektor gefunden, sie aber nach der Messe allein gelassen? Das ist doch ungewöhnlich, oder nicht? Kennt sich denn niemand in Kirchensachen aus, verflucht noch mal?« Kottsieper blickte Melanie Förster an.
»Seltsam ist das schon, dass die Schlipf nicht da war, als die beiden zusammenbrachen«, antwortete die Kommissarin und strich sich mit der Hand durch ihr langes, dunkelblondes Haar.
»Zumal wir davon ausgehen müssen, dass sie Zugriff auf den Messwein hatte.« Littmann, selbst erbaut von seinem weiterführenden Gedanken, zwinkerte seiner Kollegin mindestens eine Spur zu selbstsicher zu.
»Sie ist uns auf jeden Fall eine Erklärung schuldig«, bestätigte Kottsieper.
Das Handy von Melanie Förster dröhnte mit der AC/DC-Melodie Hells Bells los.
»Himmel und Hölle!«, entfuhr es dem Polizeipräsidenten, der einen Schritt zurückwich.
»Es ist Besold!«, rief die Kommissarin, als sie die Nummer auf dem Display erblickte. Sie nahm ab und stellte den Lautsprecher an.
»Wir haben ein wichtiges Ergebnis«, gab der Kriminaltechniker durch. »Die Leiche hing nicht nur an dem Seil dieser Schillerglocke, sondern vorher offenbar auch an einem Seilzug, der ebenfalls im Turm angebracht worden war. Wir haben Hanfspuren an der Kleidung des Toten gefunden, während das Seil, das der Täter an der Glocke befestigt hatte, ein Bergseil aus beschichteten Nylonfasern war.«
»Er ist mit einem Seilzug da hochgehievt worden?«, hakte die Förster nach.
»Ja, Bauarbeiter haben den dort wegen Sanierungsarbeiten angebracht, Hanf ist eine sehr starke Naturfaser mit hoher Traglast. Es wird bevorzugt in dunkler und trockener Umgebung verwendet. Es ist sehr witterungsanfällig. Sonnenlicht oder Nässe würden dem Material schaden. Aber bei der Sanierung des Kirchturms bewährt es sich natürlich. Neulich stand ja was über das Projekt im Marbacher Kurier und der Ludwigsburger Gazette.«
»Und was ist mit dem Bergseil?«, fragte die Kommissarin.
»Stinknormales Zwillingsseil, wie es beim Bergsteigen verwendet wird. Es hat einen Doppelstrang und eine Belastungsgrenze von zwölf Stürzen à 80 Kilogramm.«
»Da hat jemand ganze Arbeit geleistet«, staunte Kottsieper.
»Ja«, meinte Besold, »vor allem ist diese Seilart so verbreitet, dass wir praktisch keine Chance haben, die Stecknadel im Heuhaufen zu finden.«
»Lassen Sie vom Landeskriminalamt trotzdem im Internet alle Bestellungen der letzten beiden Wochen checken«, wies ihn der Polizeichef an. »Wenn der Täter durch die Zeitungsartikel auf den Seilzug aufmerksam wurde, könnte er sich das Bergseil kurzfristig bestellt haben.«
»Oder einfach in ein Geschäft gegangen sein«, hielt Littmann dagegen, der prompt die Aufgabe zugeteilt bekam, entsprechende Läden abzuklappern. Mit der Rolle des Erfüllungsgehilfen gab sich der Innendienstler aber nicht zufrieden. »Wenn wir eins und eins zusammenzählen, haben wir eine Tatverdächtige.«
»Sie meinen die Mesnerin?« Kottsieper hob die Augenbrauen.
Littmann nickte. »Da ist der Wein mit irgendeinem Zeug drin, dann wird der Pfarrer umgebracht. Schließlich ermöglicht ein Seilzug, den etwa 70 Kilo schweren Gottesmann ohne Probleme in den Himmel, Pardon, in den Glockenturm zu befördern.«
»Gewagte These, mein lieber Littmann – aber eine Frau als Täterin ist nicht auszuschließen«, kommentierte Kottsieper. »Was sagen Sie dazu, Besold?«
»Ist machbar – der Seilzug im Glockenturm funktioniert ja meines Wissens hydraulisch und noch dazu per Knopfdruck.«
»Macht das keinen Lärm?«, wollte Melanie Förster wissen.
»Kaum, die neuen Hebemaschinen sind alle stark gedämmt, die Arbeitsschutzrichtlinien werden immer strenger.«
»Braucht man für so etwas nicht einen Schlüssel wie für ein Auto?«
»Streng genommen schon, aber viele Bauarbeiter machen sich auf einer gesicherten Baustelle im Innern eines Raumes nicht die Mühe, solch eine Maschine abzuschließen.«
Genussvoll beobachtete Littmann, wie die Bedenken seiner Kollegin ausgeräumt wurden. Schweigen machte sich breit. Melanie Förster wiederum schüttelte den Kopf und zog damit die Blicke der anderen auf sich.
»Das Motiv der Mesnerin ist nicht klar, außerdem hat sie die Leiche gefunden.«
»Sie wäre nicht die Erste, die damit versucht, sich aus dem Kreis der Verdächtigen zu stehlen«, entgegnete Littmann trocken.
»Es ist noch zu früh für Verdächtigungen«, widersprach die Förster. »Was ich nicht verstehe, ist dieser enorme Aufwand, jemanden nach da oben zu bugsieren, wenn man einen Mord auch viel einfacher haben kann.«
»Dieser Frage können wir immer noch nachgehen, wenn wir die genaue Todesursache haben – für solche metaphysischen Fragestellungen wie die Ihre ist es noch zu früh«, schickte Littmann mit süßlichem Lächeln nach.
»Gut, werter Herr Kollege«, hob Kottsieper an, »wenn Sie so scharf auf eine Tatverdächtige sind, klären Sie das Umfeld. Besorgen Sie sich Informationen, welche Stellung die Mesnerin in der Kirchengemeinde einnimmt. Insbesondere, wie sie zum Pfarrer stand, und so weiter und so fort. Frau Förster, wir knöpfen uns die Frau jetzt erst einmal vor und hören uns ihre Variante an.«
Der Aufseher
Also gut, ich korrigiere mich. Auch Kommissare leben gefährlich. Was muss er sich auch in der Kirche herumtreiben, dieser Struve! Ich kann mich ja gut in den Autor hineinversetzen. Holt den Ermittler mitten hinein ins Geschehen. Gab’s zwar schon mal bei der Tatort-Lady Lena Odenthal, als sie in einen Banküberfall hineingeriet, aber hier nimmt der Kommissar als zweites Opferlamm eine viel passivere Rolle ein. Um ehrlich zu sein: Ich habe nicht vorhersehen können, dass da vorne ein Polizist am Altar mitmischt. Es ist mir entgangen. Was aber trotzdem nichts daran ändert, dass der Mord funktioniert hat. Vermutlich kommt Ihnen das Arrangement etwas umständlich vor, mit der Leiche im Glockenturm. Gerade darauf kam es mir an. Ich töte nämlich mit Stil. Sie finden einen Mord an sich geschmacklos? Dann sind Sie voreingenommen. Ich gebe zu, ich habe schon öfter mit solchen Straftaten zu tun gehabt. Manche Mörder tun sich ja schwer und werden von Gewissensbissen geplagt. Ich kann dagegen nur sagen: Es ist interessant, sich selbst in der Verarbeitungsphase zu beobachten. Glauben Sie mir, auch ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut und deshalb melden sich die Toten bei mir sogar in den Träumen zu Wort, was ich als ausgesprochen lästig empfinde. Sind natürlich alles biochemische Reaktionen, die nichts zu sagen haben. Wie auch immer: Es hat für Sie, lieber Leser, keinen Sinn, wenn Sie die Mesnerin verdächtigen, die jetzt unter die Lupe genommen wird. Ein armes Ding, das der Autor bewusst am Anfang als kleine, unbedeutende Randfigur eingesetzt hat, ohne die nötige Ausstrahlung, um wirklich ernst genommen zu werden. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber es ist, wie es ist. Sie wollen ja schließlich keinen Gärtner als Mörder. Außerdem wäre der Krimi im Nu vorbei und Sie müssten auf den restlichen Seiten zwar hochinformative, aber letztlich langweilige Ergüsse über Schillers Leben lesen. Dann doch lieber eine heiße Spur, die sich erst im weiteren Verlauf des Krimis herauskristallisiert und dann aber auch zum Ziel führt. Oder glauben Sie etwa, der Autor lässt mich das jetzt hier erzählen, damit ich Sie auf die völlig falsche Fährte führe? Was für ein unerhörter Verdacht! Erlauben Sie mir zu bemerken: Sie haben es zwar mit einem Mörder zu tun, aber ein Lügner bin ich deshalb noch lange nicht.