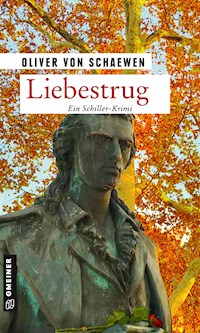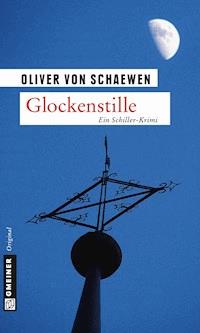Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalkommissar Struve
- Sprache: Deutsch
Eine Leiche treibt auf dem See des Schlosses Monrepos in Ludwigsburg. Ist Altverleger Hermann Moosburger Opfer eines Gewaltverbrechens geworden? Verdächtig sind die beiden Söhne des Unternehmers. Frank Moosburger sollte das Zeitschriftenimperium des 76-Jährigen übernehmen, war aber möglicherweise in Ungnade gefallen. Kai Moosburger hat den Absprung aus der Yellow-Press-Welt geschafft und lebt fernab des Familienclans im Wald, wo er Survival Camps anbietet. Kommissar Peter Struve aus Stuttgart fischt im Trüben. Doch dann wendet sich das Blatt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oliver von Schaewen
Räuberblut
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2010 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Oliver von Schaewen
ISBN 978-3-8392-3524-9
Widmung
Gewidmet den Opfern des Nationalsozialismus
»Ich bin zutiefst davon überzeugt: Nur wenn sich Deutschland zu seiner immerwährenden Verantwortung für die moralische Katastrophe in der deutschen Geschichte bekennt, können wir die Zukunft menschlich gestalten. Oder anders gesagt: Menschlichkeit erwächst aus der Verantwortung für die Vergangenheit.«
Bundeskanzlerin Angela Merkel am 18. März 2008 vor der Knesset in Jerusalem
Zitat
»Was sind überhaupt Reiche, wenn die Gerechtigkeit fehlt, anderes als große Räuberbanden? Sind doch auch Räuberbanden nichts anderes als kleine Reiche. Sie sind eine Schar von Menschen, werden geleitet durch das Regiment eines Anführers, zusammengehalten durch Gesellschaftsvertrag und teilen ihre Beute nach Maßgabe ihrer Übereinkunft. Wenn eine solche schlimme Gesellschaft durch den Beitritt verworfener Menschen so ins Große wächst, dass sie Gebiete besetzt, Niederlassungen gründet, Staaten erobert und Völker unterwirft, so kann sie mit Fug und Recht den Namen ›Reich‹ annehmen, den ihr nunmehr die Öffentlichkeit beilegt, nicht als wäre die Habgier erloschen, sondern weil Straflosigkeit dafür eingetreten ist.«
Augustinus, De Civitate Dei, Liber IV, IV
1.
Neugierig öffnete Peter Struve die Balkontür im 17. Stock. Er atmete tief durch, als er auf die Stadt schaute. Hier oben im Marstall-Center hörte er wenig vom Ludwigsburger Verkehrslärm. Er blickte auf den schönsten Teil der Stadt und erkannte das Barockschloss mit seinen weitläufigen Gärten. Auch den Favoritepark und das Großklinikum entdeckte er sofort. Bis ins Remstal reichte die Sicht an diesem milden, sonnigen Septembermorgen. Ein Tag, wie geschaffen für einen Neubeginn. Ein Tag ohne Marie.
»Von hier oben sieht die Welt anders aus«, bemerkte Corinne Lennert fast so, als ob sie seine Gedanken lesen könnte. Die Maklerin musste Anfang 30 sein, sie trug ihr langes rotbraunes Haar hochgesteckt. Struve fand, nicht viele Frauengesichter eigneten sich für improvisierte Strenge, vor allem nicht so ein entzückendes wie dieses mit den großen blauen Augen, die ihn an die Klarheit entlegener Gebirgsseen erinnerten. Er gestand sich ein, ihr Haar lieber offen sehen zu wollen und stellte sich vor, darin zu wühlen, es zu riechen. Und doch ging es darum, die Sache hier möglichst unaufgeregt hinter sich zu bringen. Ihr dunkelbrauner Nadelstreifenanzug war ihm drei Spuren zu businesslike, trotzdem regte das Outfit seine Fantasie an, denn er stellte sich vor, was sie darunter trug. Nein, dieses Gesicht passte nicht zu biederem Stoff und Marketinggetue, darauf würde er seine Beamtenpension verwetten.
Corinne Lennerts kontrollierter Gesichtsausdruck entspannte sich, als sie zu dem Interessenten auf den Balkon hinaustrat. Die Maklerin hatte den Anflug von Struves Begeisterung für die Immobilie und sie selbst längst bemerkt. Allerdings schien die Wohnung irgendwie nicht zu ihm zu passen. Er hatte sich ihr als Polizist vorgestellt, was wollte er hier oben – den Adler spielen? Diese Glashütte war doch eher was für Leute aus dem Kreativmilieu, dachte sie. Erst vor einem Jahr hatte sich hier der Regisseur einer Fernsehsoap eingemietet. Aber die Serie war inzwischen aus dem Vorabendprogramm wieder abgesetzt worden. Mein Gott war der Filmfuzzi damals anstrengend. Wollte Vollverpflegung, fast jeden Abend Shrimps oder irgendein Meeresgetier auf die Pizza. Es gab Momente, in denen sie bereute, neben der Hausverwaltung noch verschiedene andere Dienste übernommen zu haben. Doch sie brauchte das Geld, sie studierte nebenher. Vor allem hoffte sie, dass der Gebäudekomplex nicht etwa abgerissen würde. Die Gerüchte mehrten sich, seitdem der Auszug von Karstadt im Erdgeschoss als beschlossene Sache galt. Im Gespräch war unter anderem ein großes Seniorenzentrum. Schon jetzt wohnten viele ältere Menschen in den Hochhäusern. Na, dieser Struve könnte wenigstens ein bisschen frischen Wind ins Obergeschoss bringen. Schließlich hatte sie selbst hier ein Appartement – direkt unsympathisch wirkte dieser große, wortkarge Mann jedenfalls nicht.
Struve starrte sekundenlang in die Ferne.
Corinne Lennert schwieg mit ihm und versuchte zu ergründen, was in ihm vorging. Mögliche Mieter brachten die unterschiedlichsten Vorgeschichten mit. Eigentlich könnte ihr das völlig egal sein, sie war eingestellt worden, um Wohnobjekte an den Mann zu bringen. Nur Vertragsabschlüsse brachten Provisionen. Blieben diese Prämien aus, könnte sie bei dem mickrigen Grundgehalt gleich Sozialhilfe beantragen. Ein Scheißspiel, sagte sie sich in ruhigen Minuten, aber sie fand da nicht raus. Manchmal genoss sie ihren Erfolg und hielt sich geradezu für verkaufssüchtig. Mit ihrer Vermittlungsquote lag sie bei Geercke und Partner nicht gerade im hinteren Drittel. Das trieb sie voran.
Der Kommissar wendete sich ihr zu: »Stimmt, es ist schön hier oben. Prima Aussicht.« Struve brauchte sich nicht zu verstellen. Ihm gefiel die Wohnung. Er fühlte sich gut wie schon lange nicht mehr. Er lächelte ihr zu. Sein Blick rutschte in ihr Dekolletee, was ihm peinlich war, ihr jedoch offenbar nichts ausmachte.
»Ich dachte mir schon, dass Sie es mögen.« Corinne Lennert war sich ihrer Wirkung auf Männer bewusst. Sexuelle Anziehung förderte den Geschäftsabschluss. Das lernten bei Geercke und Partner bereits die Azubinen. Dieser Struve roch gut, er benutzte ein Aftershave mit Zwischentönen. Der Herbstwind frischte auf und wehte ihnen durchs Haar. Sie blickte ihn gleichfalls lächelnd an, es schien ihr ganz natürlich, er gefiel ihr mit seiner herben und zugleich sensiblen Art.
Struve waren ihre Reflexe wohl nicht entgangen. »Ach, tatsächlich? Wirke ich so kosmopolitisch?« Er sprach dieses Wort mit ironischem Unterton aus. Bei Verhören setzte er diesen Tonfall regelmäßig ein. Er prüfte damit den Humor, aber auch die Schlagfertigkeit seines Gegenübers.
»Nein, kosmopolitisch trifft’s nicht«, antwortete die geschäftstüchtige Maklerin. »Aber welcher Mann steht nicht gern oben?« Sie schmunzelte. Hatte auf seine Karriere angespielt, um bei ihm einen Nerv zu treffen. Jetzt würde sich zeigen, wie viel dieser seltsame Einzelgänger aushielt. »Vielleicht behagt Ihnen das gediegene Ambiente hier oben auf den ersten Blick nicht«, warf sie ein, um ihn noch mehr zu provozieren, »aber Sie schauen so aus, als ob Sie in diesem Punkt – na sagen wir – ein bisschen Nachholbedarf hätten.«
Struve schaute sie überrascht an. Wie kam diese Frau zu einer solchen Einschätzung? Vielleicht hatte Melanie Förster aus dem Nähkästchen geplaudert. Die junge Kollegin hatte ihm den Tipp gegeben, sich hier oben, mitten in der Ludwigsburger City, einzuquartieren. Da es zwischen Marie und ihm nicht so gut lief, hatte er beschlossen, sich für einige Monate eine Unterkunft zu suchen. Melanie war ja keine Plaudertasche, aber man konnte bei ihr nie wissen. Struve kratzte sich am Kopf.
Sein Handy klingelte. Es war seine Frau.
»Marie? Was gibt’s?«
»Ich habe deine Sachen zusammengepackt. Du kannst sie holen.«
Peter Struve verzog entschuldigend das Gesicht und wendete sich von Corinne Lennert ab. Marie wollte ihn also möglichst schnell loswerden. Verübeln konnte er es ihr nicht. Gestern hatte es ziemlich gekracht. Wieder einmal war er tagelang unterwegs gewesen. Ein Entführungsfall, er musste bei der Familie bleiben. Dann diese Gardinenpredigt: Eheleute müssten bedingungslos füreinander da sein. Er dagegen treibe sich rum, nutze das ›Schaffa‹ als Ausrede. Oh, er hasste es, wenn sich der harte Dialekt ihrer Großmutter von der Trochtelfinger Alb in ihre Streitgespräche mischte. In der Theorie klang das, was Marie vorbrachte, ganz nett, doch es strengte ihn an. Er war explodiert – und das nicht zum ersten Mal. Gerade hatten sie den Punkt erreicht, an dem sie beide eine Pause brauchten.
»Gut, ich hole sie später.« Struve schluckte. Marie nach zehn Jahren zu verlassen, wenn auch nur für eine befristete Zeit, kostete ihn Überwindung.
»Am besten, du kommst gleich, die Sachen stehen im Flur. Ich gehe jetzt auch, es ist besser, wir sehen uns nicht.«
Wieder schluckte der Kommissar. Das klang endgültig, er rang nach Worten. Kapierte er erst in diesem Augenblick, wie viel sie ihm bedeutete? Aber noch war sein Stolz größer als sein Schmerz.
»Komm runter, Marie, du bist zu hart zu mir.«
»Hart? Ich? Dass ich nicht lache«, antwortete seine Frau. »Du hast jetzt viel Zeit, über dich nachzudenken, nutze sie, Peter!«
Es klickte. Marie hatte aufgelegt. Sie hatten sich nichts mehr zu sagen. Drei Monate Trennung, das hatten sie gestern vereinbart. Das sind klare Bedingungen, daran gab es nichts zu rütteln. Peter Struve steckte das Handy weg und blickte Corinne Lennert entschlossen an.
»Sieht so aus, als ob ich die Wohnung nehme.«
Die Maklerin hielt ihm die Schlüssel vor die Nase. »Ich wünsche Ihnen viel Glück. Sie können sofort hier einziehen. Den Vertrag bringe ich Ihnen später vorbei – ach, und übrigens, ich wohne auf der anderen Seite dieses Stockwerks. Wenn Sie möchten, können Sie gern mal auf eine Tasse Kaffee vorbeischauen.« Wieder lächelte sie, und Peter Struve fühlte sich gleich ein wenig zu Hause.
Der Kommissar schaute auf seine Armbanduhr. Sie zeigte halb zehn. Die Minuten verstrichen quälend langsam. Er wartete bereits seit einer halben Stunde am Eingang des Klärwerks in Hoheneck. Der Nebel wollte sich hier unten im Neckartal nicht lichten. Gern säße er noch oben auf der Terrasse und würde mit seiner neuen Bekanntschaft ein Tässchen Cappuccino schlürfen. Struve schlug den Kragen seiner Lederjacke hoch. Dummerweise hatte er den Schal in seiner Wohnung liegen lassen. Auch wenn sich der Herbst hier unten im Neckartal oft von seiner milden Seite zeigte, pfiff doch manchmal ein rauer, unangenehmer Wind durchs Tal. Struve wurde bewusst, die Tage des Spätsommers waren gezählt, die kühleren Monate standen vor der Tür. Der 48-Jährige witterte den Herbstblues, die bevorstehende Farbenpracht der Bäume konnte ihn nicht trösten, er wusste, die Blätter würden fallen. In dieser Zeit deckte er sich auf dem Ludwigsburger Krämermarkt meistens mit Wollsocken ein. Neulich kaufte er sich gleich ein Dutzend, als ob er die heranziehende Kälte gerochen hätte. Marie blickte ihn belustigt an. Sie fand es offenbar etwas peinlich, als Komplizin seines Hamsterkaufes dazustehen.
»Deine Schränke sind doch voll«, hielt sie ihm entgegen. »Was willst du mit so vielen Socken? Du hast doch genug.«
»Sind das deine oder meine Füße, die auf dem Jakobsweg abfrieren?«, war es ihm unwirsch entfahren. Er liebte es, auf deutschen Wanderwegen des spanischen Heiligen unterwegs zu sein, eine Leidenschaft, die Marie nicht teilte und deshalb mit mühsam erarbeiteter Toleranz billigte. Natürlich tat es ihm leid, mal wieder aus der Haut gefahren zu sein, und deshalb gelobte er wenig später, seinen Kleiderschrank bis zum Jahreswechsel auszumisten, da er im Laufe der vergangenen Jahre zwar tatsächlich wenig gekauft hatte, sich jedoch von keinem einzigen Wäschestück trennen konnte.
Na, im Moment sah es so aus, als ob er sein Sortiment an Unterhosen, Socken und Hemden gleich auf einen Schlag reduzieren könnte. Wieder kroch der alte Ärger in ihm wie Herbstnebel hoch und verwandelte seine gute Laune in eine trübe Waschküche verschiedenster Gefühlslagen. Ach, soll Marie doch warten, bis er irgendwann seine Kleider abholte. Der Dienst ging jetzt vor. Schließlich hatte er nach dem Anruf eines Kollegen schnell zum Klärwerk fahren müssen.
Erneut klingelte Struves Handy und riss ihn aus seinen Gedanken. Er schaute auf das Display, das musste sein Kollege Littmann vom Stuttgarter Morddezernat sein. Früher sein Lieblingsfeind, inzwischen konnten sie ganz gut miteinander, was auch daran lag, dass sie neuerdings ein gemeinsames Hobby pflegten, Schach spielen. Fast zufällig hatte es sich ergeben. Ein Buch lag auf Littmanns Schreibtisch: ›Meine 60 denkwürdigen Partien‹, von Bobby Fischer. Struve kannte es, weil er es in seiner Jugend durchgearbeitet hatte. Einige Tage später trafen sie sich zu einem Schachabend, spielten einige Themenpartien zur Sizilianischen Verteidigung und schlossen bei einem Glas Trollinger Frieden.
»Hallo Littmann, hier Vorpostenspringer d5«, meldete sich Struve schmunzelnd.
»Ahhhh, sehr gut«, tönte Littmann und hustete amüsiert in den Hörer. Es dauerte, bis Struves Kollege antwortete. Er schien sich eine Pointe zu überlegen, was eine gewisse Zeit beanspruchte, da er nicht gerade schlagfertig war.
»Was macht der Springer denn, ich hoffe, er steht nicht am Rand, denn Springer am Rand, das wär wahrlich eine Schand’!« Littmann, froh einen Spruch der Marke Phrasendrescher anwenden zu können, freute sich, seine laute Lache dröhnte. Struve nahm das Handy noch weiter weg vom Ohr.
»Na, mit dieser alten Schachweisheit haben Sie nicht ganz unrecht, mein Bester«, antwortete der Kommissar. »Hier ist tote Hose, schätze mal, da hat uns jemand ins Leere laufen lassen.«
»Hab’s beinahe vermutet. Unser Informant hat wohl kalte Füße bekommen.«
»Vielleicht. Jedenfalls habe ich mittlerweile auch welche. Ich fahre zurück ins Dezernat nach Bietigheim-Bissingen.«
Struve beendete das Telefonat und setzte sich ans Steuer seines schwarzen VW Passats. Wenig später legte er eine CD mit Jazz-Klassikern von Charly Parker ein. Der ruhige Klang des Saxofons tröstete ihn über die verlorene Zeit hinweg. Außer einigen Radfahrern, die aus Richtung Marbach nach Ludwigsburg unterwegs waren, hatte sich dort nichts abgespielt. Wer auch immer ihn dahin gelotst hatte, es gab bessere, wärmere Orte. Stätten, an denen man sich einen Kaffee bestellen konnte. Struve fuhr zur Jet-Tankstelle an der Marbacher Straße und bestellte sich das Getränk, das ihm in einem Pappbecher gereicht wurde. So trank er den Kaffee am liebsten. Ungesüßt und ohne anbiedernden Italo-Milchschaum.
»Möchten Sie noch eine Butterbrezel?«, fragte ihn die Kassiererin, die Struve offenbar anmerkte, dass er mies drauf war.
»Ja, mit dick Butter. Und noch ein Laugenweckle dazu«, antwortete der Kommissar, der gierig den ersten Schluck Kaffee herunterkippte. Weckle, dieses komische Wort, wo es wohl herkam? Brötchen sagte man bei ihm daheim im Westfälischen. Auch nach 15 Jahren im Raum Stuttgart fühlte er sich manchmal noch fremd.
Ein Kollege vom Drogendezernat in Stuttgart hatte ihm das Treffen mit dem Junkie an der Hohenecker Kläranlage vermittelt. Struve sollte einen alten Fall nach 20 Jahren wieder aufrollen. Ein Mord, der im Klärwerk begangen, aber niemals aufgeklärt wurde. Er war einigermaßen motiviert hingefahren und hoffte, dass der Drogenabhängige Genaueres wusste. Schließlich war damals ein Industrieller ermordet worden: Edwin Schaller, Nestor des Schaller-Clans, der sich mit mehreren Stuhlfabriken ein kleines Imperium aufgebaut hatte, sein Firmensitz lag im Stadtteil Poppenweiler. Schallers Wagen war damals im Klärbecken untergegangen, mitsamt dem Besitzer. Zwar hatten die Spezialisten der Polizei seinerzeit herausgefunden, dass der Opel Admiral an den Bremsen manipuliert worden war, doch wer dahintersteckte, war niemals herausgekommen. Die Ursachen von Schallers Herzstillstand blieben ebenfalls im Dunkeln. Den Opel hatte später ein Museumsbetreiber in Horrheim, einem kleinen Weindorf am Fuße der Stromberge westlich von Bietigheim-Bissingen, günstig gekauft. Die Kiste stand dort immer noch im Keller seines Heimatmuseums. Die Staatsanwaltschaft ließ zwischenzeitlich DNA-Spuren im Innenraum sichern. Dabei kam wenig heraus, aber der Fall war wieder auf dem Markt – und Struve sollte sich darum kümmern. Es gab Spannenderes als solche ollen Kamellen, fand der Kommissar und biss in die Butterbrezel.
Wieder klingelte das Handy. Es war Melanie Förster, seine junge Kollegin, mit der er seit etwa einem Jahr zusammenarbeitete.
»Na, wie sieht’s aus, Peter, hat der Vogel gezwitschert?«
»Von wegen: Der einzige Vogel dort war eine fette Krähe – und die hat nur dumm gekrächzt.«
»Verstehe, du hast also einen rabenschwarzen Tag erwischt.«
»Das zwar noch nicht, aber wenn du weiter auf die Tränendüse drückst, glaube ich noch daran und fang wirklich an zu flennen.«
»Na, das muss ja nicht sein. Wann kommst du nach Bietigheim zurück?«
»Bin schon auf dem Weg. Hab noch einen kleinen Boxenstopp eingelegt. Wie weit bist du?«
»Och … die Statistik für die Direktion in Ludwigsburg steht so weit.«
»Na, bestens. Das wird Kottsieper freuen. Wenn der Tabellen sieht, steht er doch immer kurz vor einem Orgasmus.«
Melanie Förster kicherte. »Wusste nicht, dass du Kottsieper so aufmerksam beobachtest.«
»Der Mann braucht Aufmerksamkeit, das kannste mir glauben.« Struve erinnerte sich an sein 25-Jahr-Dienstjubiläum vor nicht allzu langer Zeit. Kottsieper hatte die örtliche Presse eingeladen – und keine Gelegenheit ausgelassen, seine eigenen Verdienste herauszustellen.
»Schlage vor, wir fahren gemeinsam nach Horrheim, damit du ein bisschen besser in den Tag findest«, schlug die junge Kommissarin vor.
»Super Idee, du darfst auch fahren.«
»Kein Problem.«
Unscheinbar reihten sich die Häuser an der Horrheimer Hauptstraße aneinander. Der Nebel hatte sich noch immer nicht gelichtet. ›Horr‹ stand für Sumpf, das mochte die trübe Stimmung in dem kleinen Ort erklären.
Wenig später standen sie an der Eingangstür des Museums, in dem hauptsächlich Gegenstände der 50er und 60er Jahre ausgestellt waren. Die Tür öffnete sich.
»Oh, Polizei, ist wieder etwas passiert?«, fragte ein etwa 40-jähriger Mann. Seine wuscheligen Haare standen in alle Himmelsrichtungen ab, sodass sein fleckiger weinroter Schlabberpulli und seine löchrige Jeans nicht weiter auffielen. Manfred Klostermann, ein Berufsschullehrer, der das Museum nebenbei betrieb, starrte verwundert auf den Ausweis, den Struve ihm unter die Nase hielt. Klostermanns Birkenstock-Schlappen merkte man die vielen Kilometer an, die sie zurückgelegt haben mochten. Der Kommissar konnte sich schwer vorstellen, dass die Sandalen im Museum verschlissen wurden. Große Menschenmassen strömten in dieses kleine Landmuseum wohl kaum. Doch vermutlich musste der Museumsbetreiber weite Wege gehen, um den Staub zu wischen, der sich hier ansammelte.
Sie betraten die Garage, in der einige Fahrzeuge eng nebeneinander geparkt waren. Ein weißer Audi Quattro stand neben einem hellbraunen Ford Capri mit Fuchsschwänzchen und einem giftgrünen NSU Prinz.
Fehlt nur noch ein Manta, überlegte Struve, kurz bevor er plötzlich vor dem Opel Admiral des Mordopfers stand.
»Wo haben Sie den eigentlich her?«, fragte der Kommissar.
»Ach, den hat damals mein Vater bekommen, als er das Museum hier eröffnet hatte. Das war 1989, als wir anfingen, die Dinge auszustellen.«
»Lebt Ihr Vater noch?«
»Nein, er ist vor zwei Jahren gestorben. Herzattacke …«
»Können Sie sich noch daran erinnern, warum er ausgerechnet diesen Wagen in seinem Museum ausstellen wollte?«
»Er hatte die Berichte in der Zeitung gelesen, ich war damals so um die 20, und er hat mir erklärt, dass solche Fahrzeuge meistens preiswert zu bekommen sind – er stank ja entsetzlich, als sie ihn aus der Kläranlage in Hoheneck geholt hatten.«
Peter Struve nickte und stellte sich seine Schwimmversuche in einer Kloake vor. Das ebenfalls in Hoheneck gelegene Freibad schien ihm die bessere Wahl zu sein. »Dann haben Sie ihn selbst sauber gemacht?«
»Ja, das haben wir. Mein Gott, hat mein Vater geflucht. Diese Schallers in Poppenweiler wollten nichts mehr mit der Karre zu tun haben. Dann sind wir hingefahren. Wir hatten ja damals noch das Abschleppunternehmen.«
Melanie Förster öffnete eine Tür. »Und die Polizei hat den Wagen nicht mehr untersucht?«
»Doch, doch, da waren Leute von der Spurensicherung in Hoheneck. Die haben dann auch das mit den Bremsen herausgefunden. Es stand ja alles in der Zeitung.«
Peter Struve blickte auf einen Artikel, der hinter dem Auto eingerahmt hing: ›Klärwerk wird zur tödlichen Falle‹, stand da in fetten Lettern. Der Journalist des Bietigheimer Kuriers hatte bereits damals den Verdacht geäußert, dass es kein Unfall gewesen sein konnte. ›Da wollte jemand nicht nur das Auto entsorgen‹, stand im Vorspann. Die Ermittlungen verliefen dann aber im Sande. Schaller war offenbar bewusstlos gewesen, anschließend musste jemand den Admiral bis zum Rand des Klärbeckens gefahren und reingeschoben haben.
»So einen Opel Admiral bewegt man nicht mit dem Zeigefinger«, stellte Struve fest.
»Nee«, meinte kopfschüttelnd der Museumsbesitzer, »der hat schon seine 1600 Kilo.« Manfred Klostermann tätschelte mit der flachen Hand anerkennend das Dach. Er erzählte von einer A-Version des Wagens, die von 1964 bis 1968 hergestellt wurde. Danach sei die B-Version auf den Markt gekommen, »und die ist zehn Jahre später durch den Opel Senator abgelöst worden.«
»Ist ja alles hochinteressant«, murmelte Struve, der sich darüber ärgerte, diesen alten Fall nochmals aufrollen zu müssen. Aber Kottsieper hatte nicht lockergelassen und Struves Ausflüchte mit der gewohnten Ich-kann-auch-anders-Mimik schnell erstickt. In solchen Augenblicken wünschte sich der Kommissar, dass Morde im deutschen Strafrecht verjähren könnten, aber diesen Passus hatte der Bundestag 1979, wenn auch spät, so doch bis heute wirksam, gestrichen. Na, es wäre interessant zu wissen, warum Kottsieper den Fall nochmals aufs Tapet brachte. Vielleicht wollte er sich mit vielen gelösten Fällen durch die DNA-Methode für eine höhere Aufgabe empfehlen. Man munkelte im Präsidium, dass Kottsieper vor dem Sprung ins Innenministerium stünde. Vermutlich wollte er die Blamage seines Rivalen von der Stuttgarter Polizeidirektion ausnutzen, der erst kürzlich kleinlaut eingestehen musste, dass die heiße DNA-Spur des Heilbronner Phantoms durch unsaubere Wattestäbchen entstanden war. Wegen des Mordes an einer Polizistin musste nun neu ermittelt werden. Struve durfte also jetzt im Trüben fischen, um diese Scharte auszuwetzen. Er lachte bitter in sich hinein. Ich habe Besseres zu tun, als Steigbügelhalter zu spielen.
Melanie Förster meldete sich zu Wort. »Also, eine zierlich gebaute Frau scheidet als Täterin aus – so weit waren die Kollegen vor 20 Jahren auch schon«, sagte sie mit schnippischem Unterton. An die langsame Art von Struve musste sie sich noch gewöhnen. Wie umständlich er den Fall anpackte. Sie hatte sich in der Zwischenzeit altes Porzellan auf einem Regal angeschaut, dabei aber genau zugehört. Sie vergötterte alte Kaffeekannen und würde am liebsten fragen, ob sie einige der ausgestellten Exemplare mitnehmen konnte. Ihre Freundin Katja, mit der sie in Winzerhausen in einer Land-Kommune lebte, teilte ihre Leidenschaft und schleppte immer wieder altes Geschirr von irgendwelchen Flohmärkten an.
»Stimmt, hast die Akte gut im Griff«, lobte Struve sie, der sich vorgenommen hatte, seine Kollegin öfter mal mit netten Worten zu motivieren, nachdem er die 26-Jährige anfangs als hektisch und wenig belastbar erlebt hatte.
»Dannnkeee, Herr Scheffe.« Melanie Förster verzog ihr Gesicht säuerlich, ihr war die Schleimerei ihres Kollegen bereits vor einigen Tagen aufgefallen. Was er sich dabei dachte? Na, sie würde mit ihm darüber gelegentlich reden.
»Leider gab’s damals überhaupt keinen Tatverdächtigen«, erklärte sie, »was mich wundert, Schaller hatte jede Menge Geld im Sparschwein.«
»Kann schon sein«, meinte Struve, »aber alle Nutznießer hatten lupenreine Alibis, da kam man nicht weiter.«
»Mein Vater hat immer gemeint, der Bruder vom Schaller war’s«, erzählte Manfred Klostermann.
Peter Struves Mundwinkel zeigten nach unten. »Naheliegend wäre es, doch der war ja zur Tatzeit in Baden-Baden und hat Roulette gespielt.«
»Das hat er zumindest allen erzählt«, meinte Klostermann mit süffisanter Miene.
»Es wurde auch bezeugt«, wendete Struve ein.
»Ha, glauben Sie doch nicht, dass jemand wie Helmut Schaller sich selbst die Finger schmutzig macht«, hielt Klostermann dem Polizisten entgegen.
Melanie Förster pustete eine dicke Staubschicht von einer Kaffeekanne. »Schön, dass Sie uns einen Verdächtigen nennen, aber verraten Sie uns, wie wir da weiterkommen – damals konnte man ihm nichts nachweisen.«
»Vielleicht ist Schaller nach 20 Jahren etwas gesprächiger«, hoffte Struve und bewegte seinen Kopf in Richtung Tür. Als sie hinausgingen, fiel sein Blick sofort auf einen weißen Wagen, der im Hof stand. »Das ist ja ein Porsche 911 Targa.« Struve war entzückt. Er bekam seine Augen gar nicht mehr von dem schnittigen Oldtimer weg.
»Soll’s ja sogar in den besten Haushalten geben«, scherzte Melanie Förster.
»Lass nur, Melanie – dieser hier ist etwas Besonderes, der hat noch das alte Stoffverdeck, der ist vielleicht sogar aus dem Jahr 1965. Herrlich!«
»Ich wusste gar nicht, dass du ein Auto-Fetischist bist.«
»Bin ich auch nicht, aber Porsche fahren, das ist nicht irgendetwas, das ist Kult!«
Melanie Förster schüttelte den Kopf und verdrehte die Augen.
Verständnisvoller reagierte Manfred Klostermann. »Mögen Sie etwa solche Oldtimer?«
»Eigentlich nicht, aber ein Porsche 911 wäre schon ein Traum.«
»Ich möchte ihn verkaufen.«
»Was? Das ist nicht Ihr Ernst, damit berauben Sie sich des schönsten Stücks.« Struve zeigte in Richtung Museumsgarage. »Also wenn Sie Platz brauchen, dann sollten Sie zuerst den Stinke-Admiral in die Presse geben – für den kriegen Sie mindestens zwei solcher Schätzchen in Ihren Schuppen.«
Klostermann konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. »Sie haben recht, aber ich bekomme bald einen neuen Porsche, und ich hänge irgendwie am Admiral. Kann’s mir selbst nicht genau erklären – aber unsere Kinder setzen sich manchmal in den Schlitten und hören Radio, vielleicht liegt’s daran.«
»Kaum zu fassen«, antwortete Struve und reichte ihm zum Abschied die Hand.
»Möchten Sie ihn mitnehmen?«
Struve blickte ihn überrascht an. »Ich?« Er überlegte. »Wie teuer wäre denn der Spaß?«
»Ach, da werden wir uns schon einig. Wollen Sie ihn nicht erst einmal probehalber ein, zwei Wochen fahren? Dann merken Sie, ob das Feuer noch brennt.«
Für den Vorschlag erwärmte sich Struve. Für einen Moment vergaß er die Herbstkühle und die Aussicht auf blätterlose Bäume. Melanie Förster würde den Dienstwagen nehmen, er den Porsche. Eine günstigere Abholsituation konnte er sich nicht vorstellen. Und dieser Museumsmensch wirkte auf ihn wie das Gegenstück zu den lackierten Affen aus den teuren Autosalons. »Wissen Sie was, Herr Klostermann. Ich mach’s!«
Struve setzte sich ans Steuer. Der Tag nahm endlich Fahrt auf.
Januar 1942
Silberstein liegt tot im Schnee. Seine Augen, weit geöffnet, starren himmelwärts. Ihn hatten sie herausgezogen, ihn – nicht mich. Warum ihn? Wieso nicht mich? Ein Zufall, natürlich, was sonst. Ich blicke entsetzt auf Silberstein, Joshua Emmanuel Silberstein, meinen Freund. Ausdruckslose Augen, während seine Seele himmelwärts fährt und noch nicht angekommen sein kann. Für kurze Zeit vergesse ich, wo ich stehe. Blende die Todesangst aus. Werde eins mit seinen ungläubig dreinblickenden Augen. Ein absurder Moment, ich fühle den Schmerz. Fühle aber auch, wie sein Tod mir mein Leben schenkt. Wie beim Erwachen aus einer Narkose erreicht mich wieder die Realität. Appellplatz Buchenwald, Januar 1942. Bittere Kälte, tiefer Schnee, Hundegebell, laute Kommandos. Überall Uniformierte. Schwarze Kragen mit Totenköpfen. Scharfrichter, die dem blinden Zufall gehorchen. Jenem Würfelspiel, das über Leben und Tod entscheidet. Silberstein ist mit neun anderen wegen eines gescheiterten Fluchtversuchs einiger Häftlinge auf der Stelle erschossen worden. Hat neben mir gestanden. Die Luft angehalten. Wie ich. Wie alle. Blickte zu Boden, denn wer den Totenköpfen in die Augen schaute, provozierte sie. Und wenn sich die kalten Augen zu sehr für einen interessierten, konnten sie ihre Arme nach einem ausstrecken. Joshua hatte nichts verbrochen, das nur nebenbei bemerkt. Wir alle hatten nichts getan, was den Genickschuss gerechtfertigt hätte. Natürlich bin auch ich mit ihm in diesem Moment erschossen worden, so wie alle anderen der Hundertschaften von Häftlingen, die an diesem Abend auf dem Appellplatz standen, zuschauen mussten und froren. Entsetzlich froren. Weil der Offizier nicht kam. Nicht kommen wollte, um uns Verbliebene des Tages nach menschenfressendem Steinschleppen abzuzählen. Mein Gott Joshua. Wo bist du hingegangen? Wo haben dich die Totenköpfe hingeschickt? Wohin gehen wir, wenn unsere letzte Reise beginnt?
Einen Tag später melde ich mich für den nächsten Transport. Irgendeine Zugfahrt. Ich kenne diese Viehwaggons. Vabanque. Sie werden mich ins Gas bringen – oder ins Leben. Ein Würfelspiel. Totenköpfe haben keinen Mund aus Fleisch. Sie spucken Flüche. Oder Kommandos. Peitschenhiebe. Tödliches Blei. »Saujude …« Entkommen unmöglich. Vielleicht im Waggon, für den es keine Lebensversicherung gibt. Aber er fuhr nicht nach Auschwitz, sondern in ein Werk. Besser als zu sterben. Auch wenn ich es fast als Erlösung gesehen hätte. Hauptsache raus aus der Hölle. Jetzt nur nicht ausgebombt werden. Dann weiter als Sklave. Patronenhülsen herstellen. Der Untermensch sorgt für seine Unterdrückung, denn er kann sich nicht wehren, ohne daran zu sterben. Macht weiter. Plagt sich, lässt sich ausbeuten. Ist nicht Herr seiner Arbeit, denn Arbeit macht frei …
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!