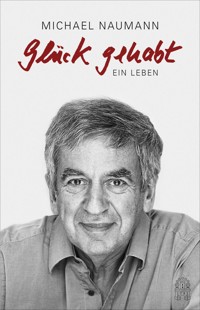
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Ein zielstrebiges Leben habe ich nie geführt«, schreibt Michael Naumann über sich selbst. Was ihn antrieb, war eine unstillbare Neugier auf die Welt. Als Kind erlebte er in seiner Geburtsstadt Köthen den Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs, sein Vater fiel bei Stalingrad. Im Alter von elf Jahren floh er 1953 mit seiner Mutter aus der DDR nach Hamburg. Die wilden Sechziger verbrachte er als Student in München. In seinen glänzend geschriebenen, durchaus selbstkritischen Erinnerungen blickt Michael Naumann zurück auf ein bewegtes Leben als Journalist, Hochschullehrer, Verleger und Politiker. Er erzählt von Begegnungen mit Helmut Schmidt, Marion Gräfin Dönhoff und Heinrich Maria Ledig-Rowohlt, mit Gerhard Schröder, Oskar Lafontaine, Otto Schily und Joschka Fischer. Seine Erinnerungen an bedeutende Autoren wie Harold Brodkey, Herta Müller, Paul Auster, Siri Hustvedt, Peter Nádas oder Thomas Pynchon gleichen Glücksmomenten eines Büchernarren. Als Gründungsdirektor der Barenboim-Said Akademie in Berlin stößt er schließlich auf das deutsche Baurecht und die erstaunlichen Auflagen des labyrinthischen Hochschulrechts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Michael Naumann
Glück gehabt
Ein Leben
Hoffmann und Campe
Vorwort
Autobiographien sind Er- oder Sie-Findungen. Sie entspringen der eigenen Neugier auf ein gelebtes Leben – was war da eigentlich? –, und sie verlassen sich auf persönliche, manchmal selbstgerechte Erinnerungen, wie auch dieses im Grunde genommen altmodische Buch. Es erfindet einen chronologischen Zusammenhang, einem Kursbuch gleichend, als sei das eigene Leben auf geraden Gleisen dahingerollt, zufallslos und vorhersehbar. Jeder Lebensabschnitt scheint in einem eigenen Waggon untergebracht zu sein. Statt in Fahrtrichtung zu blicken, schaut man nach hinten. Aber leider sind jene Erinnerungen unzuverlässig; denn unsere Fähigkeit, die unangenehmsten Erfahrungen zu vergessen oder zu verdrängen, gehört zu den angenehmsten Eigenschaften des Bewusstseins. Unser Gehirn scheint von der Evolution auf Optimismus programmiert zu sein. Und dennoch – Niederlagen im Beruf und schmerzhafte private Erlebnisse jeder Art zählen zum Leben. Sie sind der geeignete Stoff für Romane. Dieses Buch ist aber kein Roman, sondern allenfalls die nachgereichte, ungenaue Konstruktionszeichnung einer Lebenswirklichkeit, die nicht mehr zu ändern ist. »Ich bin, was ich erinnere«, sagt Augustinus. Aber wer war ich, der vieles vergessen hat? Auf alle Fälle bin ich derjenige, der sich hier seine eigenen Geschichten erzählt, am liebsten in Form von Anekdoten, denn sie sind es, die sich am schnellsten im Gedächtnis einnisten, weil sie aus dem Alltagsgeschehen herausragen. Warum das so ist, wissen vielleicht Mythenforscher und Neuropsychologen, aber es ist so. »Mythos« heißt allerdings im Griechischen nicht nur Legende, Sage und Erzählung, sondern auch »Lüge«.
Wir haben von Kindesbeinen an gelernt, unsere moralischen Entgleisungen, erlittenen Verletzungen und unglückseligen Momente im hintersten Depotwinkel unseres Bewusstseins zu verbergen. Manchmal kehren sie im Traum zurück und werden schnell wieder vergessen. So erfinden wir im Rückblick unser eigenes Alltagsglück, auch wenn es sich rarmachte. Wer sich bemüht, jene schwarzen Erlebnisse aus der Vergessenheit heraufzubeschwören, wird auf Ironie nicht verzichten können. Ernst ist nur der Tod, und ernst sind die Traumata von Kindern, die Verbrechen gesehen oder gar erlitten haben. Ich habe Glück gehabt.
Dieses Buch hat viele Schwächen. Manch Privates wird verschwiegen. Ich habe auch darauf verzichtet, Akten zu wälzen. Insofern sind meine Erinnerungen ungenau im Sinne der strengen Geschichtswissenschaft. Allerdings habe ich einige Texte aufgenommen, die ich im Lauf der Jahre in der ZEIT veröffentlicht habe, weil sie auf autobiographischen Antrieben beruhten oder mit meinem Leben als Journalist und Politiker im engen Zusammenhang standen – zum Beispiel die Geschichte eines NS-Richters, dessen mörderische Rechtsprechung in die Weltliteratur einging, genauer, in die »Blechtrommel« von Günter Grass. Jenen Richter hatte ich als junger Reporter in Mölln aufgespürt. Seine Geschichte hat mich niemals losgelassen. Eine Kabinettepisode – es ging um ein Milliardengeschenk der Regierung Schröder an deutsche Banken – habe ich zuerst in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geschildert. Sie ist aktuell geblieben.
Natürlich war es ein narzisstisches Vergnügen, auf diverse berufliche Lebensstationen zurückzuschauen – bis ich auf zahlreiche peinliche Momente stieß, die ich nicht alle verschweigen will. Ich war – in dieser Reihenfolge – Student, Redakteur, wissenschaftlicher Assistent und Privatdozent (und später Honorarprofessor), Auslandskorrespondent, Verleger in Deutschland und in Amerika, Politiker und gescheiterter Bürgermeister-Kandidat, Chefredakteur und Herausgeber und schließlich Gründungsdirektor einer Musikakademie in Berlin. An die (eher abfällig gemeinte) Beschreibung meiner Person als »Paradiesvogel« in diversen Feuilletons habe ich mich gewöhnt. Deren Federn schmückten um 1900 herum die teuersten Damenhüte.
Ich hoffe, dass in diesem Buch ein Widerschein der Zeitgeistgeschichte Deutschlands zu erkennen ist. Ein wissenschaftliches Werk ist es aber keineswegs, und für alle Fehler und Auslassungen bin ich selbst verantwortlich. Einige Namen lebender Personen oder Familien habe ich aus guten Gründen verändert. Meinen Freunden Klaus Harpprecht, Manfred Henningsen, Karsten-Uwe Heye, Gunter Hofmann, Peter Merseburger, Hartmut Palmer, Stephan Sattler, Peter Schneider und ganz besonders meiner Frau Marie Warburg danke ich für Kritik und Anregungen. Dass ich das Buch meinen Kindern und drei Enkeln widme, die es vielleicht später einmal lesen, wird niemanden überraschen.
Große Wäsche
»Der Mensch ist frei …
Und würd’ er in Ketten geboren.«
Friedrich Schiller
»Der Mensch ist frei,
und würd’ er in Köthen geboren.«
Heinrich Heine
Es stimmt, dass ich mich an meine zweifellos schmerzhafte Geburt am 8. Dezember 1941 in der Kleinstadt Köthen selbst nicht erinnere. Andere Menschen haben mir von ihr erzählt. Nachdem mir mein sieben Jahre älterer Bruder Jürgen später berichtete, dass es an jenem Tag mitten im Weltkrieg »große Wäsche« gab, was lästig genug gewesen sei, habe ich mir im Keller unseres Hauses den großen Waschkessel genauer angeschaut. Ich konnte gerade über seinen Rand schauen. Der Bottich stand auf einem Zementsockel und war aus Zinn oder einem anderen hellgrauen Metall. Später, ich muss schon mindestens vier oder fünf Jahre alt gewesen sein, habe ich den Geruch von Seifenlauge und Kochwäsche als etwas Besonderes empfunden, das mit mir selbst zu tun hatte.
Irgendwann, als jener Geruch schon längst aus der Welt des mechanisierten deutschen Haushalts verflogen war, roch ich ihn einmal wieder, ich weiß nicht mehr, wo, aber es ist das Einzige, was ich seitdem mit dem Tag meines Eintritts in die Welt verbinden kann – eine eher unangenehme Vorstellung. Es war eine Hausgeburt, urkundlich bezeugt von einer Hebamme der fast neunhundert Jahre alten anhaltinischen Kleinstadt Köthen. Die Geburtsurkunde ziert ein Adler mit Hakenkreuz zwischen den bösen Krallen.
Umgeben von den fruchtbaren Äckern der Magdeburger Börde, wenige Kilometer von der Elbe entfernt, zehrt die kleine Stadt heute noch von dem Ruf, dass Johann Sebastian Bach dort sechs Jahre seines Lebens verbracht hat und einige seiner schönsten Kompositionen notierte, unter anderen die Brandenburgischen Konzerte und die Französischen Suiten. Ein bescheidenes Marmordenkmal steht auf der Wallstraße, wo er angeblich (auch) gewohnt hat. Im Sommer fotografieren sich japanische Touristen, die zu den lokalen Bachfestspielen um die halbe Welt gereist sind, vor der weißen Halbbüste. Bachs erste Frau Maria Barbara war in Köthen gestorben, ihr inzwischen unbekanntes Grab liegt untergepflügt und verloren unter einem Parkrasen, und seine zweite Frau, die »Singjungfer« Anna Magdalena Bach, folgte ihr im Bett und im Leben des großen, dicken Genies nach. Sie war Sopranistin am fürstlichen Hof und zog mit dem Kapellmeister 1723 weiter nach Leipzig.
Europäische Landkarten markierten das Herzogtum »Coethen« vor dem Wiener Kongress als eigenständigen Staat. Hier verschrieb der Homöopath Samuel Hahnemann dreizehn Jahre lang bis 1835 als Herzoglicher Leibarzt seinen Patienten die von ihm entwickelte zweifelhafte Medizin. Sein kleines Krankenzimmer lag über einem Kuhstall, durch Öffnungen im Fußboden drang die Tierwärme nach oben. Hier öffnete das erste Kino schon 1908 seine Tore, und hier wählten im Jahr 1930 bereits 25,5 Prozent die NSDAP – sieben Prozent über dem Landesdurchschnitt. An vielen Hauswänden und Balkons ragen heute noch Fahnenhalter aus verrostetem Blech hervor, kleine erigierte Erinnerungsposten an staatlich verordnete Fest- und Feierstimmung.
Aus Köthen stammt der SS-Offizier und Urheber von zehntausendfachen Gaswagen-Morden, Walter Rauff, der nach dem Krieg mit Hilfe des Vatikans nach Südamerika entkommen konnte, wo er jahrelang als Agent beim Bundesnachrichtendienst im Sold stand. Unbehelligt starb er unter dem Schutz der mörderischen Regierung Pinochet (angeblich als Konserven-Fabrikant) 1984 in Chile. Sein Name ist der schrecklichste Stolperstein meiner Geburtsstadt. Andere erinnern an seine Opfer.
In der Stadt steht immer noch ein schönes kleines Wohnhaus, das dem zarten Heimwehdichter Joseph von Eichendorff gehörte; doch er wohnte hier nur wenige Monate und blieb in seinen Gedichten der Erinnerung an seine wohlbehütete Kindheit im Schlesischen treu. Ein Dachfenster in Form einer großen Augenbraue blickt auf die Straße, und kaum jemand, der vorübergeht, wird ahnen, wer dort einmal lebte. An Fenstern ist in seinen Gedichten kein Mangel.
Kann es sein, dass Straßen, Plätze, Kirchen, Amtsgebäude, Schulen, kurzum das ganze urbane Ensemble einer Stadt durch ihr einfaches Dasein Einfluss nehmen auf die Gedanken und Tätigkeiten ihrer Kinder? Lassen sich die architektonischen Eindrücke der Kindheit und Jugend in Lebensspuren eines Komponisten, eines Massenmörders oder eines Poeten wie Eichendorff wiederfinden? Machen schöne Gebäude moralische Menschen? Oder verhält es sich umgekehrt? Hässliche Städte – was tun sie ihren Bewohnern an? Dass ganze Landschaften Menschen verzaubern, ja verzücken können, ist bekannt. Aber was heißt das, »verzaubern«? Was hat Italien Goethe wirklich angetan? Sein geschätzter Winckelmann hat das gelobte Griechenland nie gesehen, und doch hat er es als eine Art Widerspiel des nordeuropäischen Verzichts auf heitere Schönheit neu erfunden. Die Anschauung der antiken Statuen von Rom reichte ihm dazu aus; die »dicken Wolken über Theben« hat er erfunden.
Köthen ist weder schön noch wirklich hässlich, sondern eine Stadt aus dem Architekturbaukasten des 19. Jahrhunderts. Es ist übersichtlich und nahezu geruchlos, seitdem die Braunkohle nach der Wende aus den heimischen Öfen verbannt wurde. Wäre die Stadt ein Mensch, hätte sie das Aussehen eines Angestellten aus einem Rechnungshof, der sein Leben mit Rechenschiebern vermessen hat.
In meiner Kindheit wuchs die Stadt – wenngleich nur scheinbar – im gleichen Maß mit den von Jahr zu Jahr erweiterten Streifzügen mit Freunden aus der Nachbarschaft, um jetzt in der Nachbetrachtung des Erwachsenen wieder zu schrumpfen auf die mikroskopisch genauen, kleinteiligen Bilder des Langzeitgedächtnisses. Lange Schulwege verkürzen sich bei der Nachbesichtigung, und der ferne Magermilchladen der Nachkriegsjahre liegt plötzlich wenige Meter vor der eigenen Haustür. Er steht leer. Und da meldet sich zum Beispiel in der Erinnerung der Anblick winziger Staubwölkchen, die zwischen den nackten Zehen des vielleicht Fünfjährigen aufstiegen wie feinste Explosionen, als er an einem heißen Sommertag über einen sandigen Feldweg lief. Oder der Anblick vom Penis eines erwachsenen, zweifellos pädophilen Mannes, der eine kleine Truppe von Jungens in einem Schützengraben neben einer ehemaligen Flakstellung auf dem Müllberg – der einzigen Erhebung weit und breit – ermunterte, ihre kleinen Schwänze vorzuzeigen. Sie kramten in ihren kurzen Hosen, und ich tat es bestimmt auch. Das seltsame Erlebnis behielt ich für mich, aus Scham oder aus einem Gefühl heraus, etwas prinzipiell Geheimes erlebt zu haben, das niemanden sonst etwas anging.
Aus den Wänden der Schützengräben ragten die Müllreste der Stadt hervor, Fetzen von Stoff, Blechkanten, es roch süßlich nach Verfall.
Die Beamten und Fabrikanten, die Ärzte und höheren Angestellten Köthens sprachen Hochdeutsch, die anderen waren an einem breiten, fast dumpfen Sächsisch zu erkennen. Dabei konnte sich die Stadt doch der zweitältesten europäischen Wissenschaftsakademie rühmen, der 1617 vom Fürsten Ludwig I. und anderen gegründeten »Fruchtbringenden Gesellschaft« zur Pflege der deutschen Sprache, die in der Stadt allerdings bis heute malträtiert wird. Unvergessen ist die Ohrfeige der Großmutter, als ich zum ersten Mal statt »nein« »näh« sagte. Sie war damals in den Augen ihres kleinen Enkels eine graue, unfreundliche Kreatur mit stechenden Augen, einem stramm geflochtenen Dutt und einer harten knochigen Hand. Einen Kuss hat sie mir nie gegeben, das hätte mich auch erschreckt.
Ein Hauch von selbstzufriedener Genügsamkeit hing noch in den fünfziger Jahren über Köthen, und der ist weiterhin auf dem Friedhof zu verspüren. Der jüdische Friedhof liegt abgegrenzt, aber gut erhalten auf dem Gelände am Rand der Stadt. Die moosbedeckten Grabmale der christliche Bäcker und Müller, der Ingenieure und Angestellten aus der Vorkriegszeit wetteifern miteinander in versteinertem Stolz auf das im arbeitsamen Leben Erreichte, direkt neben einigen dorischen, langsam ergrauten Grabtempeln längst vergessener Großbürger. Inzwischen verweist nur noch ihre marmorne Haltbarkeit auf die Illusionen der Nachfahren, die bis 1945 auf familiären Zusammenhalt und Dauer setzten, jetzt aber wie die Naumanns und Schönfelds und Friedheims oder Mendershausens längst in alle Winde verstreut sind. Auf die gelegentlichen Besucher dieser Familien wirkt Köthen wie ein abgetragener Anzug.
Einer dieser »Abkömmlinge« aus Köthen ist der ehemalige Finanzvorstand des Axel-Springer-Konzerns und ein Urenkel des Holzfabrikanten Naumann (nicht verwandt!). Als ich einmal das Köthener Rathaus besuchte, stellte ich fest, dass die prachtvolle Holztäfelung des Festsaals aus der Werkstatt seines Urgroßvaters stammte; finanziert wurde sie vom Bankier Max Friedheim, einem jüdischen Verwandten meiner Mutter. Friedheim war wie viele andere bürgerliche Juden Deutschlands getauft worden, er war Ehrenbürger der Stadt, und so hatte das Namensschild am Kopf des Rathaussaals den rassistischen Bildersturm des Dritten Reichs überstanden.
Der Ingenieur Max Naumann, mein Großvater, hatte die Tochter des Hoffotografen Eduard von Spoenla geheiratet. Dessen Foto zeigt einen vollbärtigen Mann. Sein schmales Gesicht lässt einen halblustigen, im Kern unseriösen Charakter vermuten. Es kann aber auch die offenkundige Abwesenheit von Ernsthaftigkeit sein, die sein Porträt durchaus sympathisch macht. In Wirklichkeit war er wohl einer der soliden, fotografierenden Halbkünstler des 19. Jahrhunderts. Seine Karriere begann in Köln, die Liebe führte ihn in die anhaltinische Provinz. Sein Geschäft war die Eitelkeit der anderen. Bevor sein Metier in den Dienst der visuellen Staatskontrolle jedes Passbesitzers geriet, diente es dem Aufstieg eines Bürgertums, das sich auf kleinen Visitenkarten endlich einen modernen, preiswerten Porträtmaler leisten konnte. Mit heimlich produzierten Aktfotos erfüllte er höchstwahrscheinlich private Sehnsüchte, die noch bis zur Jahrhundertwende in Guckkästen auf Jahrmärkten befriedigt wurden.
Die Stadt Köthen, nicht weit von Dessau, Halle und Magdeburg entfernt, wuchs während des 19. und 20. Jahrhunderts mitten im Anhaltinischen zu einem kleinen Industriezentrum mit Theater, Oper und mehreren Gymnasien heran. Von der Zigaretten- zur Maschinenindustrie, von einem Provinznest zum Standort einer Junkers-Motorenfabrik und einer Zuckerfabrik (ringsum lagen die weiten Rübenfelder) – die Stadt war sichtbar wohlhabend geworden in ihrer relativen Abgeschiedenheit. Die Villen der wilhelminischen Großbürger sollten den Zweiten Weltkrieg überstehen, bis sie während der Herrschaft der SED dem Verfall preisgegeben wurden. Nur ein Haus in der Akazienallee erhielt sich als Stasi-Quartier in anständigem Zustand. Selbst die Bierbrauerei, Stolz der Stammtische, schloss irgendwann während der Jahre der realsozialistischen Kommandowirtschaft ihre Tore.
Als die Mauer in Berlin fiel, waren die Häuser ergraut wie alt gewordene Menschen. Der erste Sekretär der SED-Kreisleitung erschoss sich in seinem Dienstzimmer. Die Spitzengenossen der Regierungspartei waren offenbar bewaffnet wie alle ihre Vorgänger seit 1933. Vorangegangen war eine Demonstration von Tausenden Bürgern im Stadion, die sich vor allem über die Privilegien der höheren Genossen erregten. Sie hatten, so erzählte später ein Teilnehmer, im West-Fernsehen die Ledergarnitur des Gewerkschaftsbosses Harry Tisch gesehen und waren empört. Derlei Luxus (auf Ikea-Niveau) entsprach so gar nicht den Konsummöglichkeiten von Köthen mitsamt seiner ländlichen, heruntergekommenen dörflichen Umgebung. Die D-Mark konnte kommen.
Der gerade eingeleitete Abriss Hunderte Jahre alter Gebäude in der Innenstadt kam in jener Wendezeit zum rechtzeitigen Ende. Die Straßennamen hatten sich im Lauf der Jahre verändert, von der Bismarck- über die Hitler- zur Stalin- oder Thälmann- bis hin zur Friedensallee. Deutsche Straßenordnungsämter gehen stets mit der Zeit und bleiben sich dennoch treu.
Lauter erste Tote
Meine Mutter Ursula Naumann, geborene Schönfeld, hatte mich von ihrem Ehemann, dem Rechtsanwalt Eduard Naumann, während dessen Fronturlaub im März 1941 in einem ländlichen Gasthaus bei Rheydt am Niederrhein empfangen. Ich war nach der Geburt zweier Söhne und einer Tochter das vierte Kind. Dreißig Jahre später, sie wohnte inzwischen in Köln, zeigte sie mir nach einer kurzen Autofahrt aus einer seltsamen Laune heraus das Gasthaus. Psychologen mögen ihre Gründe deuten. Es war ein gelblich angestrichenes Gebäude mit grünen Fensterläden, und es war mindestens einhundert Jahre alt. Der Anblick dieses schönen Hauses beförderte in mir eine peinliche Vorstellung des elterlichen Geschlechtsverkehrs. Ich schwieg. Ihre Mutter empfahl ihr, das ungeborene Kind abzutreiben: Mitten im Krieg noch ein Kind, was soll aus dir werden, wenn dein Mann fällt? Der Hausarzt Hellwig weigerte sich. Ihm verdanke ich mein Leben – zumindest fast so sehr wie meinen Eltern.
Er wurde mein Patenonkel, ein wuchtiger, großgewachsener Mann mit einem kugelrunden haarlosen Kopf, der seine Frau Lill in den dreißiger Jahren mit Hilfe einer Zeitungsannonce gesucht und gefunden hatte: Sie kam aus Bombay, wo sie als Tochter eines norwegischen Kaufmanns wohnte, nach Köthen. Die Gattin Lill trug bis an ihr Lebensende einen goldgefassten Tigerzahn als Amulett an ihrer Halskette, vielleicht um damit die Verbindung mit ihrer zweifellos interessanteren Jugend als Abgesandte des europäischen Imperialismus aufrechtzuerhalten. Sie sollte als achtzigjährige Witwe in einem Hamburger Krankenhaus an einer sinnlosen Nierentransplantation sterben, die ein junger, ausgerechnet indischer Chirurg vorgenommen hatte. Ihr Mann war schon lange vorher gestorben. Was aus dem mattgelben Tigerzahn wurde, ahne ich nur – vielleicht wurde er gestohlen und ist jetzt wieder im Land seiner Herkunft zusammen mit dem Operateur? (Und wo ist die schöne Jensen-Brosche, die ich meiner Mutter zu ihrem 90. Geburtstag schenkte und die sie noch auf ihrem Sterbebett in einem Kölner Krankenhaus trug?)
Ich schreibe hier von Toten. Es werden immer mehr in meiner Erinnerung. Dem »Ich« wird bange. Der erste Tote, den ich sah, war ein vielleicht zehnjähriger Junge, der in Köthen von einem Zirkuswagen überrollt worden war. Das muss 1949 gewesen sein. Die Hartgummireifen hatten seinen kleinen Leib wie eine reife Frucht geöffnet, aber seinen Kopf verschont, und da lag er nun kurz nach Schulschluss vor dem Friseurladen Sack auf dem Asphalt. Eine gelblich fette Haut, die seine Knochen umhüllte, war die erste anatomische Überraschung meines Lebens. Leider träume ich noch heute von ihr.
Der nächste Tote war ein Motorradfahrer, der in einer innerstädtischen Straßenkurve gegen eine Eiche geprallt war. Auf Google Earth ist der Baum in seiner grünen Unschuld immer noch zu sehen. Anders als im Fall des toten Jungen floss das Blut in Strömen über sein Gesicht, es war kaum zu erkennen. Die Menge der Zuschauer sah schweigend auf den leblosen Körper. Gaffer reden nicht. Und die dritte Leiche meines jungen Lebens war eine alte Frau, die sich im Kaiserteich ertränkt hatte, einem dunklen Gewässer der sogenannten Fasanerie Köthens. Ihr Körper schwamm wie ein schwarzer Sack auf der Wasseroberfläche, Kopf und Füße waren nicht zu sehen. Was mag in ihrem Leben geschehen sein, das vom Kaiser- bis zum »Dritten Reich« und darüber hinaus gewährt hatte? Warum konnte sie ihr eigenes Ende in aller schlechten Ruhe nicht abwarten? Ich weiß nicht, ob ich mich derlei gefragt hatte, als Feuerwehrmänner sie aus dem Wasser zogen, aber ich weiß auch, dass im selben städtischen Busch, der »Fasanerie«, zahlreiche Hundebesitzer ihre Tiere töteten, als die Köthener Hundesteuer in den frühen fünfziger Jahren rabiat erhöht wurde. Andere banden die Hunde an Bäumen fest, in der Hoffnung, dass Kinder sie fänden und nach Hause brächten, und so kam ich in den Besitz eines Langhaardackels, der mich am nächsten Morgen in die Schule begleitete und dann verschwand. Er wollte nicht warten.
Der vierte und letzte leibliche Tote meiner Kindheit war unser Nachbar; ein alter, mindestens achtzigjähriger Mann namens Steinhauer. Er lag in seinem Bett, und wir Kinder aus der Nachbarschaft waren hintereinander auf einen Fenstersims im Erdgeschoss geklettert, um ihn anzuschauen. Er schlief fest, und seine Gesichtshaut schimmerte weiß, seine Hände lagen ordentlich gefaltet auf der glattgezogenen Bettdecke. Alles sah sehr manierlich und aufgeräumt aus.
Seine Witwe hatte seine überflüssig gewordenen Kleider und Schuhe in eine Mülltonne geworfen, und extra für die Kinder legte sie die Orden des Toten, die er offenbar im Ersten Weltkrieg erworben hatte, obenauf. So trug ich den einzigen Orden meines Lebens, ein Eisernes Kreuz, als Achtjähriger ein paar Tage lang spazieren, ehe ich ihn gegen eine Trompete tauschte. Nein, das stimmt nicht – die habe ich für zwanzig Mark gekauft, die ich aus dem Portemonnaie meiner Mutter gestohlen hatte.
Den Diebstahl hatte ich über Jahrzehnte hinweg vergessen, bis er eines Tages unvermittelt wie eine böse Überraschung als verspäteter Gewissensbiss wieder zum Vorschein kam. Ist das kindliche Verbrechen, denn das war es ja, verjährt? Das Prinzip der Verjährung dient der Rechtssicherheit im Lande, doch im eigenen Gewissen gibt es keine Verjährung. Wo genau verbirgt sich das Gewissen? Und warum meldet es sich plötzlich mit unerhörter Verspätung? Welche Synapsen sind zuständig für derlei unangenehme Rückblenden? Die Rede von »Verdrängungen« hatte ich nie geglaubt. Doch es gibt sie, das wusste ich jetzt.
Der interessanteste Tote meiner Erinnerung ist allerdings mein Vater. Aber sie ist eine Erinnerung aus zweiter Hand. Ich habe ihn nie gesehen, jedenfalls nicht so, dass ich es erinnern könnte. Sein gerahmtes, großformatiges Foto hing jahrelang in wechselnden Wohnzimmern in Köthen. Sein Gesicht schaute liebevoll auf seine vier Kinder, die abstehenden Ohren und ein dicker Schmiss über der linken Backe waren auffällig, seine Augen wirkten gütig, sein Mund war sehr weich, sein lächerlicher kurzer Haarschnitt entsprach der Uniform. Die Arme hielt er stilsicher gekreuzt vor der Brust, die zartgliedrigen, sehr langen Finger der linken Hand lagen auf dem rechten Ärmel. Das Einzige, was fehlte, war ein Einstecktuch. Der Wehrmachtsadler mit Hakenkreuz blieb unbedeckt. Er hatte vor dem Kameraverschluss wohl gelächelt, jedenfalls war eine Spur solcher gerade verflogenen Heiterkeit noch deutlich zu erkennen. Nahm er sich selbst oder seine Uniform nicht ernst?
Jahrelang war ich davon überzeugt, dass er eines Tages wiederkommen würde, bis ich in einer grauen Papprolle im Schreibtisch meiner Mutter eine Urkunde auf festem, dickem Papier fand: »Für Führer, Volk und Vaterland gefallen …« Das Todesjahr war 1942, und das glatte Blatt, der goldgedruckte Adler mit Hakenkreuz imponierten mir, es wirkte alles unheimlich, feierlich und endgültig. Enttäuscht war ich nicht. Es war nur eine halbe Gewissheit einer ganzen gewichen. Das Wort »gefallen« gefiel mir. Wir spielten damals oft »Soldaten« und imitierten auf den Straßen und Wiesen den Heldentod unserer Väter mit sorgsam einstudierten Gesten, die Knie sanken zu Boden, und man ließ sich vorsichtig zur Seite fallen. Ich habe die Urkunde wieder eingerollt und zurückgesteckt, ohne jemals mit meiner Mutter darüber zu sprechen. Dieses Schwermutsdokument, warum hatte sie es aufbewahrt? Nach ihrem Tod stellte sich heraus, dass sie ein umfangreiches Archiv zahlloser amtlicher Dokumente angelegt hatte, als gelte es, irgendwann einem staatlichen Gerichtsverfahren gegen ihre gesamte Existenz mit Beweisen ihrer Rechtschaffenheit gut gewappnet begegnen zu können. So viel war in ihrem Leben verloren gegangen, was blieb, war die Korrespondenz mit dem ominösen Staat mitsamt seinen Unterabteilungen, den Meldeämtern, Versicherungen und Rentenanstalten.
Auch meine drei Geschwister, die unseren Vater gekannt haben, habe ich nie gefragt, was sie über ihn wussten. Und niemals kam ihre Rede auf ihn zurück. Eduard Naumanns Abwesenheit war ganz offensichtlich die große Kränkung der Familie, und all jene Männer, die nach 1945 die hübsche Mutter umwarben, wurden zielstrebig und gemeinsam von uns Kindern abgelehnt. Der stumme Tote schaute auf die verstummte Familie. Kein Wort über mich, sagte das Bild, »ich bin da«. Es wird geschwiegen. Ich mochte ihn gern, so wie ich meine Katze gern mochte; sie kam nach Hause, wann sie wollte. Erst als fast Siebzigjähriger sollte ich mehr über ihn erfahren – mehr, als ich eigentlich wissen wollte.
Unter diesem Bild, unter seinen niemals geschlossenen Augen saß seine Frau abends manchmal am Klavier und spielte Chopins Etüden und Schuberts Sonaten, eine höhere Tochter, die als einziges Mädchen ihrer Klasse Abitur gemacht hatte und auf die Berliner Lette-Schule geschickt worden war, um sie auf ein Frauenleben im gehobenen Mittelstand nach Maßgabe des 19. Jahrhunderts vorzubereiten. Im Nebenfach studierte sie Metallurgie. Es kam dann ganz anders.
Sie war nach den Rassegesetzen des Nationalsozialismus eine Halbjüdin (und in Wirklichkeit eine gläubige Protestantin) und hatte bei Kriegsende eine Todesfurcht, von der sie erst Jahrzehnte später sprach. Ihre Angst vor Behörden dokumentierte sich in jener obsessiven Aktenführung ihres ganzen Lebens, mit der sie sich gegen allfällige staatliche Eingriffe in ihre von Jahr zu Jahr reduzierte Existenz rüstete. Als ihr einmal eine junge Kölner Steuerbeamtin erklärte, sie müsse auf die mickrigen Zinsen ihres mageren Sparbuchs Steuern bezahlen, was nicht stimmte, brach sie zusammen und drohte mit Selbstmord. Es war nicht die erste Drohung.
Erst nach ihrem Tod wurde mir klar, dass sie nach Kriegsende offenbar einen Liebhaber hatte, Horst Mendershausen, einen jüdischen Schulkameraden aus Köthen, der als einziger Junge ihrer gemeinsamen Abiturklasse den Krieg überlebt hatte, weil er den NS-Mördern rechtzeitig entkommen war. Seine Mutter blieb, wurde deportiert und starb in Auschwitz. Nach 1945 kam Horst M. als Offizier der U.S. Army zurück nach Berlin, ein Nationalökonom (und ehemaliger Marxist), und zwei Jahre lang muss er sich heimlich mit meiner Mutter getroffen haben. In der zerbombten Hauptstadt befreundete er sich mit Willy Brandt. Meine Mutter fuhr damals häufig ohne einen Grund zu nennen nach Berlin. Wenige Wochen vor ihrem Tod schickte er ihr aus Kalifornien einen Strauß mit fünfzig roten Rosen ans Kölner Krankenbett, und in einem stundenlangen Telefonat verabschiedeten sich die beiden über Neunzigjährigen. Einige Wochen nach ihrem Tod erschoss er sich in seiner Wohnung im kalifornischen Santa Monica. Jene Nachkriegsjahre, so schrieb er in einem kurzen Lebensabriss, den mir sein Sohn überließ, seien die glücklichsten seines Lebens gewesen. Wir Kinder ahnten nichts.
Mein Vater Eduard Naumann hat mich wahrscheinlich nur einmal gesehen, irgendwann auf einem Fronturlaub im Sommer 1942 aus Russland kommend. Eine Nachbarin aus Köthen, die es nach dem Krieg nach Klagenfurt verschlagen hatte, erzählte mir auf einem der unseligen Literaturfestivals dieser Stadt im Jahr 1986, dass sie meinen uniformierten Vater beobachtet habe, als er mich in meinem Kinderwagen spazieren schob. Das sei damals ungewöhnlich gewesen. Er hatte zu diesem Zeitpunkt den höchsten Rang seiner Militärlaufbahn erreicht, er war Unteroffizier. Mehr konnte er wohl aufgrund seiner nicht-arischen »Versippung« nicht werden. Im Oktober 1942 ist er tief in Russland bei Stalingrad gefallen, genauer gesagt, er ist an Ruhr und allgemeiner Erschöpfung gestorben. Seinen letzten Brief an meine Mutter hat er einem Freund am Bett diktiert und mit zitternder Hand, aber voller Hoffnung auf ein Wiedersehen unterschrieben.
»Eigentlich«
Meine Mutter bewahrte jahrelang eine kuriose Fotografie auf, eine Amateuraufnahme mit gezackten Rändern. Sie zeigt ihren Mann neben einem Dromedar am Fuß des Kaukasus. Auf die Rückseite hatte er nur einen Satz geschrieben: »Weiter möchte ich eigentlich nicht.« Das ironische »eigentlich« ist das einzig mir bekannte Anzeichen seines inneren Widerstands gegen den Krieg oder seine Urheber. Seine Frau hingegen erzählte einem Bekannten, dass er »gern Soldat« bei den Pionieren gewesen sei. In einem Feldpostbrief aus Frankreich (»Wo sind die Franzosen?«) schrieb er angesichts der eingekesselten englischen Kontinentalarmee von der »Tragödie Dünkirchen«. Für den Rest der Deutschen war »Dünkirchen« ein Triumph.
Er hatte in Marburg studiert und war der schlagenden Verbindung »Teutonia« beigetreten. Sein Freund und »Fuchsmajor« Karl August Eckhardt, ab 1928 Professor für Rechtsgeschichte, war bereits seit 1931 Parteigenosse der NSDAP, dann auch SS-Mitglied im Stab Heinrich Himmlers. Er stieg 1938 zum SS-Sturmbannführer auf und forderte die Todesstrafe für Homosexuelle (»widernatürliche Unzucht ist todeswürdig«). Eckhardt bewarb sich vergeblich um die Stellung eines »Kronjuristen«, also um eine Stelle, die auch Hitlers intelligentestem Apologeten, Carl Schmitt, versagt geblieben war. Nach Kriegsende verlor er seine Professur. Ich sollte ihn in den fünfziger Jahren während der Sommerferien kennenlernen: In seinem Keller im hessischen Witzenhausen stöberte ich zwischen NS-Literatur und Karl-May-Bänden, die er mir lebhaft empfahl. Auf einem Bücherregal lag eine perfekt skelettierte Maus. Im Garten graste eine Kuh. Sie versorgte die verarmte Familie mit Milch. Eduard Naumann, so erfuhr ich später, wollte bei ihm über germanische Femegerichte promovieren, ließ es aber bleiben. Wäre er ein überzeugter Nazi geworden?
Als Mitherausgeber füllte Eckhardt bis zu seinem Tod im Jahr 1979 Seite auf Seite der Monumenta Germaniae. Von meinem Vater sprach er nicht, ich habe ihn auch nicht gefragt. Der alte Mann und seines toten Freundes kindlicher Sohn wohnten für einige Wochen gemütlich im allgemeinen Nachkriegsschweigen in seinem kleinen Haus am Waldesrand. Was bleibt, ist das Staunen, dass dieser Mann fließend Lateinisch sprechen konnte, ein hoch gebildeter Barbar, der die römischen Quellen deutscher Rechtsprechung mit ihrer rassistischen Auslegung so furchtbar verunreinigt hatte: »Gegenüber Führerentscheidungen, die in die Form eines Gesetzes oder einer Verordnung gekleidet sind, steht dem Richter kein Prüfungsrecht zu.« Ich aber lernte im Stadtbad von Witzenhausen schwimmen. In der seltsam opferstolzen Sprache jener Jahre nannte ich mich gerne »Halbwaise«. Als ich schließlich »Vollwaise« wurde, habe ich das Wort nicht mehr benutzt, denn ein Kind war ich nun nicht mehr, und Vollwaisen sind die meisten Menschen irgendwann einmal sowieso. Es sei denn, sie sind viel zu jung gestorben oder im Krieg gefallen.
Im Sommer 1996 spielten in einem Dorf in der Nähe von Stalingrad, das nun Wolgograd hieß, russische Kinder auf einer Wiese mit einem Schädel Fußball. Ihre entsetzten Eltern informierten die Ortspolizei, die informierte die Deutsche Kriegsgräberfürsorge, und deren Mitarbeiter fanden dort die Reste von mehreren verscharrten Wehrmachtssoldaten samt Hundemarken, unter ihnen Eduard Naumann, und sie informierten seine Witwe. Sie war bereits sehr krank und nahm die Nachricht mit Verbitterung zur Kenntnis. Was sollte sie mit ihr anfangen? »Zehn Jahre lang verheiratet, ein halbes Jahrhundert Witwe, und dann das!«, sagte sie. Ganz offenkundig war sie verärgert über diese unangenehme Falltür in eine längst verarbeitete Vergangenheit. Sie war eine schöne, sehr junge Frau, als sie Eduard Naumann geheiratet hatte, nun war alles vergangen, die Schönheit, die Jugend, das ganze Leben.
Als kleines Kind, so erzählte sie gern, habe sie aus einem Dachfenster heraus den Kaiser gesehen, der einmal ihre Geburtsstadt Trier besuchte. Sie wohnte gegenüber der römischen Porta Nigra. Ihr Vater Georg Schönfeld war dort nach 1918 Garnisonskommandeur; sein Vater, ein westfälischer Unternehmensgründer mit Fortune, hatte ihn nach dem »Radau-Antisemitismus« der 1880er-Jahre taufen lassen und als Neunjährigen in die Kadettenanstalt Bensberg bei Köln gesteckt. So wurde er Berufssoldat, zuletzt als Major im Berliner Stab des heimlichen Militärdiktators der letzten Weltkriegsmonate 1918, des Antisemiten Ludendorff. Während des Krieges war er vorübergehend in Straßburg stationiert, zuständig für den Munitionsnachschub der Schlacht um Verdun. Stand der Wind richtig, so schrieb er seiner Frau, konnte er den Geschützdonner aus der Ferne hören. Das Stöhnen der Verwundeten und Sterbenden drang über die Krater und Schützengräben nicht hinaus.
Seine Frau, meine Großmutter, bewahrte eine seltsame Nachtaufnahme von Artillerie-Einschlägen auf dem »Toten Mann« auf, einer blutig umkämpften, befestigten Höhe bei Verdun. Warum nur hing das Bild (dunkle Hügelumrisse vor schwarzem Himmel, besprenkelt mit blitzenden weißen Flecken) in ihrem Wohnzimmer, lange nachdem ihr Mann gestorben war – wie vor ihm Hunderttausende deutsche und französische Soldaten jener wahnsinnigen Monate? Fühlte sie sich mitverantwortlich? War sie stolz auf die Karriere ihres Mannes? Jetzt ist es zu spät, sie zu fragen. Sie war es, die auf meine Abtreibung gedrängt hatte.
Einmal fuhr ich als begleitender Reporter der ZEIT im Dienstfahrzeug des FDP-Wirtschaftsministers Hans Friderichs in rasender Fahrt durch den hessischen Ort Wabern bei Kassel, wohin sie mit ihrem einzigen Sohn und dessen Familie gezogen war. Sie ging, weit über achtzig Jahre alt, mit gekrümmtem Rücken an der Straße entlang, und ich habe nicht darum gebeten, anzuhalten. Danach habe ich sie niemals wiedergesehen. Ja, für mein Verhalten damals schäme ich mich noch heute. Immer wieder.
Als französische Truppen das Rheinland und das Ruhrgebiet besetzten, um sich der Versailler Reparationszahlungen Deutschlands zu versichern, organisierte ihr Mann, jener Major Georg Schönfeld, den »passiven Widerstand« seiner Stadt. Er wurde aus Trier mit der Auflage verwiesen, den Ort binnen 24 Stunden zu verlassen. So geriet er schließlich über einen Zwischenaufenthalt in Berlin nach Köthen. Befohlen hatte die Ausweisung der Koblenzer Kommandeur der französischen Besatzer. Er war der Vater Giscard d’Estaings, Frankreichs Staatspräsident zwischen 1974 und 1981, dem ich anlässlich des Fests zu Helmut Schmidts neunzigstem Geburtstag für den Zufall meiner Existenz dankte.
Die alten Herren hatten sich in Hamburg versammelt, um über die schönen Zeiten ihrer Machtausübung zu reden. Henry Kissinger war auch dabei, gleich einer stillen Landschildkröte saß er ruhmüberglänzt im Festsaal: »Mr. Kissinger, why did you order the bombing of Cambodia and Laos?« Ich habe mich nicht getraut, ihn das zu fragen. Wenn Feigheit auf Zynismus trifft, entsteht eine Art krankes Einverständnis. Hunderttausend Tote hätte seine Antwort nicht zum Leben erweckt. Kissinger hatte den Friedensnobelpreis für seine Vietnamverhandlungen erhalten, und die Erinnerungen an die Kriegsverbrechen, die ihnen während seiner Amtszeit im Weißen Haus von Richard Nixon vorausgingen, versanken im allgemeinen Respekt vor dem genialen Selbstdarsteller.
Die zwangsweise Umsiedlung meiner Mutter und ihrer Familie nach Köthen hatte sie jedenfalls Jahre später zur Frau meines Vaters Eduard Naumann gemacht. Als ältester Sohn des Fabrikanten Max Naumann führte er dort eine Anwaltskanzlei und wartete auf sein Erbe. Er war, so heißt es, faul. Ursula Schönfeld hatte er im Tennisclub kennengelernt. »Bei uns wurde nicht geschnitten«, sagte sie später.
Dort spielte auch gelegentlich Hitlers späterer Finanzminister Lutz Graf Schwerin von Krosigk, ein Verwandter von Jenny Marx, geborene von Westphalen. Ich sollte ihn in den siebziger Jahren als Reporter aufstöbern – er wohnte in Essen, ein wohlhabender, hellwacher Greis, der in Nürnberg zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt worden war und der sich gerne daran erinnerte, dass sein Mitinsasse Alfried Krupp die schönsten Fresspakete erhielt, die er mit seinen Schicksalsgenossen solidarisch teilte, während draußen Zehntausende verhungerten. Er war einer der ersten Rhodes-Scholars in Oxford gewesen, und der britische Chefankläger bei den Nürnberger Prozessen, Hartley Shawcross, war ihm nach Kriegsende wohlgesinnt. Schwerin von Krosigk sei ein unpolitischer Mensch gewesen.
Als er freigelassen wurde, zog er mit seiner Familie ins Rheinland. Die Industriellenfamilien, die Hitler einst ergeben waren, unterstützten ihn, und er wurde Wirtschaftslobbyist während der Adenauer-Ära. »Jedes Steuergesetz, das im Bundestag verabschiedet wurde, hat vorher auf meinem Schreibtisch gelegen«, sagte er mir. Und Hitler habe er während des ganzen Krieges nicht gesehen. Auf alle Fälle sei der Reichshaushalt niemals defizitär gewesen. Alle Lücken wurden geschlossen durch die Plünderung der Staatskassen Polens, Frankreichs, der Tschechoslowakei und all der anderen überfallenen und ausgeraubten Staaten. Er lächelte verschmitzt, drei Jahrzehnte nach Kriegsende, als er mir dieses Finanzierungswunder eines ganzen Krieges erzählte. Es ging ihm gut. Einige seiner Kinder waren im Staatsdienst untergebracht.
Giscard d’Estaing, dem ich das alles (unter Auslassung der vielen binnendeutschen Details) in sehr groben Zügen erzählte, war bereits ein alter Mann, und ihm schienen diese verworrenen, kriegs- und zufallsgebannten Familiengeschichten offensichtlich zu kompliziert; er blickte höflich, aber desinteressiert auf meine winzige Fußnote des sogenannten europäischen Narrativs. Womöglich war sie ihm peinlich; er selbst war 1926 in Koblenz als höheres Besatzungskind zur Welt gekommen.
Der Major a.D. Georg Schönfeld fand als Direktor in einer Zuckerfabrik Anstellung, die Anfang des 19. Jahrhunderts von einem anderen Schönfeld am Rand von Köthen gegründet worden war. Ihm oblag es fortan, die sechswöchige »Kampagne« zu organisieren – jene kurze Frist, in der die granatenförmigen Zuckerrüben in langen Wagentrecks angeliefert wurden, um in Zucker und Sirup verwandelt zu werden. Den Rest des Jahres lag die Fabrik still wie der »Tote Mann« nach der sinnlosen Schlacht im Osten Frankreichs. Jener Georg Schönfeld, den ich niemals bewusst kennenlernte und von dem ich jahrelang dachte, dass er noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges gestorben sei, überlebte offenbar unbehelligt das Kriegsende trotz seiner jüdischen Herkunft. Vielleicht weil er einst Major des Kaisers war? Unwahrscheinlich. Vielleicht weil er getauft war und weil ihn und seine Familie die maßgeblichen Nazis der Stadt protegierten? Jedenfalls erlag er 1946 einer Krankheit. Auf dem guterhaltenen jüdischen Friedhof der Stadt ist er nicht zu finden. Er war als assimilierter deutscher Protestant und Major a.D. gestorben, seine Frau war katholisch, sein Grab wurde vor Jahrzehnten eingeebnet.
Eine mögliche Erklärung für sein Glück in mörderischen Zeiten sollte mir erst Jahrzehnte später von meinem älteren Bruder Jürgen offenbart werden: Irgendwann nach dem Tod seines Freundes Eduard Naumann, meines Vaters, war jener Karl August Eckhardt in einer Dienstlimousine mit SS-Standarte und schwarz uniformierter Entourage vor dem Haus meiner Mutter aufgefahren und hatte danach ganz offensichtlich seinen Einfluss auf die örtliche Nazi-Elite geltend gemacht.
Bomben und ein Tornado
Als der Krieg endete, war ich dreieinhalb Jahre alt. Die Stadt, genauer, die Junkers-Werke waren bombardiert worden. Vierzehn Jahre später ging der Krieg, »mein« Krieg, noch einmal los. Die Sirenen hatten mich mitten in der heißen Sommernacht des Jahres 1959 in der amerikanischen Kleinstadt Mexico im US-Staat Missouri geweckt. Im Halbschlaf hatte ich mein Kopfkissen aus dem Schlafzimmer im Obergeschoss mitgenommen, und auf der Kellertreppe muss ich es fallen gelassen haben; denn dort fand es mein amerikanischer Bruder Scott, als er mich wenig später suchte. Da war ich schon vollends verwirrt aufgewacht. Es war dunkel. Das grelle Sirenengeheul draußen war verklungen. Ich wusste nicht genau, was ich da unten verloren hatte. Ich hatte aber das Richtige getan.
Auf Mexico, wo ich als Austauschschüler lebte, raste ein Tornado zu, und die Warnung hatte einen längst unterdrückten Fluchtreflex ausgelöst. Er war Teil einer verschütteten, plötzlich auftauchenden Erinnerung an die Bombennächte meiner Kindheit.
Die moderne Hirnforschung behauptet, dass die Synapsen von Kleinkindern erst im Alter von drei Jahren so weit gediehen seien, dass man von Denken sprechen könne. Ich weiß nicht mehr, was ich mit knapp drei Jahren dachte. Aber meine Synapsen in jener tornadogefährdeten Nacht wussten irgendetwas aus der Zeit ihrer Entstehung. Und ganz gewiss weiß ich heute wieder, was ich hörte und was ich tat, als sich alliierte Bomberflotten in den letzten Kriegsmonaten jene kleineren Städte Deutschlands aussuchten, die noch nicht zerstört waren, obwohl in ihnen Kriegsgut hergestellt wurde. So interessierten sich die amerikanischen und englischen Piloten für die Fabrikhallen des Flugzeugproduzenten Junkers in Köthen, für einen Eisenbahnknotenpunkt und leider auch für das anhaltinische Schloss in der Stadtmitte. Heute weiß ich auch – ohne es selbst erlebt zu haben –, dass sich ein paar Soldaten der Waffen-SS im Garten von Verwandten hinter einer halbhohen Ziegelsteinmauer verschanzt hatten, um den Krieg in Sachsen-Anhalt gegen die vorrückenden Amerikaner doch noch zu gewinnen. Sie kamen alle um.
Kurz zuvor war noch ein KZ-Todesmarsch durch die Stadt gezogen. Er stammte aus dem KZ Langenstein-Zwieberge bei Halberstadt. Ich hatte ihn von unserem Wohnzimmerfenster aus gesehen und mich gewundert, warum so viele Menschen im Schlafanzug unterwegs waren. Sie zogen einen riesigen Leiterwagen mit sich, auf dem noch mehr Schlafanzüge lagen. Es müssen aber Tote oder Kranke gewesen sein. Am Bahnhof in Köthen fand man am gleichen Tag Dutzende Leichen – die Menschen, so hieß es damals unter den womöglich schockierten Bürgern, seien »an einer Methylalkoholvergiftung gestorben«. SS-Wachen hatten sie erschossen. Niemand hatte etwas gehört, und erblindet war man schon seit einer halben Ewigkeit, als hätte die ganze Stadt, das ganze Land jenen giftigen Alkohol getrunken.
Zu den Überlebenden der mörderischen Prozession durch Köthen zählte Arno Lustiger – er blieb in Deutschland, gründete in Frankfurt ein Unternehmen für Damenmode, wurde Historiker des jüdischen Widerstands und ein bewunderter, wenngleich ferner Freund. Dass sein in Polen geborener jüdischer Cousin konvertierte und schließlich als Kardinal in Paris fromme Karriere machte, nahm er mit belustigtem Stolz zur Kenntnis.
Die Verteidigung Köthens sollte 1945 ein Offizier vom Fliegerhorst übernehmen, der kein Flugzeug mehr hatte. Es war der spätere ZEIT-Redakteur Rudolf Walter Leonhardt, »Leo«. In dem Hamburger Wochenblatt lernte ich ihn 1970 kennen und nannte ihn den »Löwen von Köthen«, was er nicht schätzte. »Seine« Soldaten, aber auch die Reste einer versprengten Division von der Ostfront (die inzwischen bei Berlin lag) warfen 1945 ihre Waffen in die Büsche und Teiche der Stadt und verkrümelten sich, während Hitler in seinem Berliner Bunker auf ihren rettenden Einsatz hoffte. Sie hatten endlich alles verstanden, die amerikanischen und russischen Panzer waren überzeugender als ihr sagenhafter Eid auf den »Führer«.
Während der Bombardierung, die erst seit jenem Tornado-Alarm in Missouri einen festen Platz in meinem Gedächtnis zurückeroberte, wohnten wir in der Magdeburger Straße. Sie führte an einem mittelalterlichen Stadttor vorbei zum Marktplatz und zur gotischen St.-Jakobs-Kirche. Unser graugelbes, zweistöckiges Haus, unter dessen Putz sich das ortsübliche Fachwerk verbarg, lag in der Straßenmitte gegenüber einem Schlachterladen. Es hatte eine Toreinfahrt und war im 18. oder 19. Jahrhundert auf älteren Fundamenten errichtet worden. In der Wohnung gab es zur Freude der Kinder eine Tapetentür und einen prachtvollen Kachelofen. Hinter dem Garten des Hauses stand eine graue Holzhütte, eine Sargtischlerei, die in jenen jämmerlichen Monaten viel zu tun hatte. Das Kreischen der Kreissäge war unüberhörbar. Höre ich heute dieses Geräusch, öffnet sich ein großes Tor in meine Kindheit.
Die Reste einer uralten Mauer im Garten und andere mittelalterliche Befestigungen erinnerten die Bürger Köthens womöglich an längst vergangene Ängste, die nun im Krieg wieder aufstiegen. Im nahen Magdeburg hatte es während des Dreißigjährigen Kriegs das erste genozidale Gemetzel der Neuzeit gegeben. Zwanzigtausend Menschen wurden an einem einzigen Tag von Tillys Truppen in einem Blutrausch geschlachtet. Derlei hatte es bis dahin in Deutschland noch nie gegeben, und wenn doch, dann war es längst in der Vergessenheit versunken. Mehrere Wochen lang war auch Köthen in jenen religiösen Kriegsjahren belagert worden, und mehrere Pestwellen reduzierten die Bevölkerung.
Ich lernte, auf der Mauer im Garten zu balancieren. Da war das nahe Magdeburg schon in einem Bombardement fast restlos zerstört worden. Nur der Dom blieb stehen. Auch die Nachbarstadt Dessau gab es Anfang 1945 nur noch in ihren Fundamenten.
Der alte Gewölbekeller unseres Hauses diente den Menschen aus der Nachbarschaft als »Luftschutz« – eine jener neuen Wortbildungen des »Dritten Reichs«, die unterstellte, man schütze sich nicht etwa vor feindlichen Bombenabwürfen, sondern vor dem Allernotwendigsten, vor Luft.
Köthen liegt nicht weit entfernt von der Hauptstadt, und die Flying Fortresses und Liberators der Alliierten überflogen die alte Residenzstadt auf ihren regelmäßigen Kraut Runs, stets begleitet vom Sirenengeheul tief unter ihnen. Für die vier Kinder meiner Mutter entwickelte sich während der Bombenalarme mit ihrem bösartigen Sirenengejaule die immer gleiche Routine. Sie nahmen ihre Bettdecken, ihre Puppen, ein paar Spielzeuge und liefen die Treppen hinunter in den Keller, »holterdiepolter«, wie es im Märchen hieß. Meine fünfjährige Schwester und ich durften in einer großen Kartoffelkiste weiterschlafen. Kartoffeln gab es nicht mehr, und schlafen wollten wir auch nicht.
An dem Tag, als die Junkers-Fabrik und der Bahnhof angegriffen wurden, als das dumpfe Wummern der Bombeneinschläge näher kam und die Nachbarn stumm und angstvoll aneinandergeschmiegt ausharrten, stahl sich mein zehnjähriger Bruder Jürgen davon, verließ heimlich den dunklen Untergrund ins Licht des Krieges und verschwand. Was ich nicht erinnere, aber inzwischen weiß: die helle Aufregung meiner Mutter, ihre Qual, sich zu entscheiden – den Sohn im Bombenhagel zu suchen oder bei den anderen drei Kindern zu bleiben. Sie blieb. Mein Bruder wollte Bombensplitter sammeln, ein Hobby der Kinder jener Zeit, und er kam zurück mit einem bizarren Metallstück von der Größe einer Bratpfanne, doch da war der Luftangriff bereits vorbei. Was er gesehen hatte: Eine Bombe hatte einen Behelfsbunker getroffen, der war zusammengesackt und hatte viele Menschen unter sich zerquetscht. Es waren Sklavenarbeiter der Junkers-Fabrik.
Jener Tornado, der mich so unerwartet zurückversetzt hatte in meine Kindheit, zog nahe an der kleinen Stadt in Missouri vorbei und ruinierte das Haus eines Zahnarztes. Auch fällte er einen Baum, und in dem Baum wohnte eine Waschbärenfamilie. Übrig blieb ein Waschbärbaby, das mein amerikanischer Bruder adoptierte, mit Milch fütterte und »Chico« nannte. Als es zu bissig wurde, setzten wir es am Stadtrand aus.
Nach dem Krieg sind wir in eine kleinere Wohnung umgezogen. Das eigentliche Zentrum der Familie war die weiße Villa meines Großvaters Max Naumann. Sie wurde 1952 beschlagnahmt, die örtliche Kommandantur der Roten Armee zog ein. Als ich sie im Februar 1990 wenige Monate nach dem Fall der Mauer wiedersah, stand sie leer und war innen kaum noch zu erkennen. Auf dem Dachboden stand eine Flügelgranate, neben ihr lag ein russischer Stahlhelm. Ein junger Volkspolizist, den ich vor der Villa traf und auf die Granate hinwies, sagte recht schneidig: »Kommen Sie mit aufs Revier!«, überlegte es sich aber anders, als ich ihm sagte, dass das Haus eigentlich meiner Familie gehöre, und seufzte mit einem Blick auf meinen westdeutschen Wagen mit Hamburger Nummernschild bekümmert: »Schrecklich, wie die das haben verkommen lassen.«
Den Keller in der Magdeburger Straße wollte ich mir danach nicht mehr anschauen. Aber Köthen betrachte ich immer noch als meine Heimat, einem sentimentalen Impuls folgend, vielleicht weil jedermann eine Heimat haben sollte, auch wenn sie keine Sicherheit, keine Familienzusammenhänge mehr anzubieten hat, sondern höchstens noch die Hoffnung auf eine ordentliche Familiengrabstätte. Viele Jahre lang hatte meine Mutter deren Pflege einer ihr unbekannten Frau in Köthen anvertraut, gegen gutes Geld. Sie hatte es eingesteckt und sich die Mühen erspart.
Mein Großvater, der Ingenieur Max Naumann, hatte noch vor dem Ersten Weltkrieg eine Stahlscheren-Fabrik gegründet. Die Idee, Konservendosen mit einem kreisrunden Messer zu öffnen, mag nicht von ihm stammen, aber er hatte sie gleichsam vergrößert: Ein mächtiges, scharfgeschliffenes Messerrad aus Edelstahl konnte Eisenblechplatten, die mit hydraulischen Pressen festgehalten wurden, mit größter Passgenauigkeit durchschneiden. Schiffsplanken konnten nun verschweißt statt vernietet werden. Die Maschinen standen auf Werften in aller Welt, selbst in Tokio. Nachdem die Firma Anfang der fünfziger Jahre verstaatlicht wurde, floh der jüngere Bruder meines Vaters, also mein Onkel, mit einem Teil der Belegschaft nach Essen, baute die Fabrik neu auf und verkaufte sie schließlich in den späten Sechzigern an einen Werkzeughersteller in Dortmund. Es gibt sie heute nicht mehr.
Als ich nach der »Wende« zum ersten Mal nach Köthen zurückkehrte, besuchte ich die leeren Hallen der Firma, und ein leitender Angestellter sagte mir: »Kommen Sie zurück, Herr Naumann, wir werden alle arbeitslos. Mannesmann war schon da.« Doch statt Mannesmann kam die Treuhand und dann auch noch die Arbeitslosigkeit. Die Fabrik selbst diente 1989 nur noch der Lehrlings-Ausbildung und war, nunmehr Teil des DDR-Mammutkombinats Takraf, seit einem halben Jahrhundert nicht mehr renoviert worden. In Hamburg, wo ich nach dem Mauerfall wohnte, ermunterte ich die Generalvertreterin einer französischen Baukranfirma, in der Fabrik meines Großvaters Baukräne herzustellen; denn die würden jetzt en masse gebraucht werden. Doch ihre Verhandlungen mit den Köthener Geschäftsführern endeten mit deren Forderung nach einer Beteiligung ohne eigene Sicherheiten. Daraus wurde dann nichts. Stattdessen folgte Arbeitslosigkeit in zweistelliger Prozenthöhe.
Trostkinder, Waffen und ein Zeichen Gottes
Die meisten Kinder der Nachkriegszeit, die ohne Väter aufgewachsen sind, waren geliebte Trostkinder ihrer Mütter. Meine Mutter jedenfalls überhäufte mich und meine zwei Jahre ältere Schwester Ulli mit Zärtlichkeit, Zuwendung und Lob, die sie den beiden älteren Söhnen aus irgendeinem Grund nicht in gleichem Maße zubilligte. Ihre Liebe hielt täglich Hof, wir beide waren zugelassen. Den beiden Älteren galt die mütterliche Sorge, eine Art familienpolitische Distanz, sie wurden verwaltet. Je älter sie wurden, desto zorniger reagierten sie auf mütterliche Ermahnungen.
In einer formellen Zeremonie wurde der HJ-Dolch des fünfzehnjährigen Bruders Klaus im Mai 1945 eingewickelt in ein gelbes, dickes Wachstischtuch und im Garten beigesetzt. Da liegt er gewiss noch heute, ein archäologisches Fundstück in Warteposition auf zukünftige Grabungen.
Andere Relikte jener finsteren Jahre sollten sich als hochgefährliches Spielzeug bewähren: Tellerminen, Maschinengewehrgurte mit frischer Munition, Mauser-MPs, Pistolen, kurz, die halbe Bewaffnung einer aufgelösten Wehrmachtseinheit, auf die Hitler in seinen letzten Stunden noch wartete. Die Waffen fanden sich in Teichen und Büschen noch Jahre später wieder und zählten zur Grundausrüstung der Jugendlichen und Kinder Köthens, bis besorgte Eltern einschritten. Meine verrostete Mauser-Maschinenpistole war mein ganzer Stolz (ich war sechs Jahre alt). Doch als eine Ladung Panzerabwehrgranaten, die zwei Jungen aus der Nachbarschaft auf einem kleinen Leiterwagen in die Stadt zogen, explodierte und die beiden in den Tod riss, geriet das Kriegsspielzeug außer Mode.
Köthen war zuerst von amerikanischen Truppen besetzt worden, die in Sherman Tanks vorrückten und nach wenigen Monaten gemäß der alliierten Verabredung von Jalta wieder abzogen. In der kurzen Zeit ihrer Anwesenheit sollte mein Bruder Jürgen, ein hübscher, aufgeweckter blonder Junge, zum Ernährer der Familie werden: Mit immer neuen Packungen von Trockenmilch, Kakao- und Eipulver aus GI-Beständen versorgte er die Naumanns mit Beweisen amerikanischer Großzügigkeit. Als dann die Russen einmarschierten – eine endlose Kette kleiner Panjewagen hinter struppigen Pferden rollte stundenlang durch die Stadt –, verschob sich die Versorgungslage: Uns Kindern schenkten die kurzgeschorenen jungen Soldaten Zigaretten, Machorkas genannt, und mit fünf Jahren war ich ein ausgebildeter Raucher.
Die furchtbare Zeit der Vergewaltigungen der deutschen Mädchen und Frauen war vorbei, die russischen Soldaten blieben in ihrer Kaserne am Rand der Stadt. Nur einmal sollte ich Zeuge eines Gewaltausbruchs werden: Zwei womöglich betrunkene Soldaten erschossen einen Schwan, der auf dem Kaiserteich in all seiner Schwanenschönheit schwamm, mit krachenden Salven aus ihren Maschinenpistolen mit den kreisrunden Patronenbüchsen. Die Explosion von blutrot gefärbten Federn faszinierte und erschreckte mich gleichermaßen. Sie fielen wie Schneeflocken auf das Wasser zurück, verwandelten sich in kleine Seerosen rings um den Kadaver des Vogels. Die beiden Soldaten lachten und gingen davon, ohne mich zu beachten.
Als die russische Luftwaffe, die auf dem Fliegerhorst Köthens stationiert war, ein Fallschirm-Manöver abhielt, stand ich in einer Gruppe von Erwachsenen und bewunderte die Schirme, die sich wie weiße Blüten öffneten. Doch einer öffnete sich nicht, und der Soldat stürzte hinter den Bäumen der Fasanerie in rasendem Tempo zur Erde. »Ein Russe weniger«, sagte ein Mann. Alle schwiegen, ich auch. Aber ich habe den Anblick nie vergessen, und jenen Satz auch nicht.
Das erste und wahrscheinlich auch letzte religiöse Erlebnis meines Lebens verdankte ich einem unbekannten russischen Piloten. An einem heißen, blauen Sommertag zog er einen perfekten Kreis aus Kondensstreifen über Köthen, und ich war der festen Überzeugung, dass es sich um ein Signal Gottes an die im Elend versinkende Stadt handele – ein Heiligenschein über einer unheiligen Gemeinde. Hätten meine Brüder mich nicht über die physikalischen Grundlagen von Kondensstreifen aufgeklärt, hätte mich dieses Wunder bis zur Konfirmation begleitet. So aber habe ich nie wieder an einen Gott geglaubt. In der St.-Agnes-Kirche war es kalt, das Heiligenbild aus der Werkstatt Cranachs hinter dem Altar langweilte mich wie die längst vergessenen Predigten. Damals entstand wohl die lebenslange Neigung, erst einmal »nein« zu sagen. Als ich schließlich meiner Mutter sagte, dass Gott mich nicht mehr interessiere, weil es ihn gar nicht gebe, weinte sie, was mich verstörte und mir leidtat. Gleichzeitig aber schien mir ihr Kummer eine Bestätigung meiner frischen Erkenntnis zu sein, denn warum sollte meine Mutter weinen, wenn sie doch überzeugt davon war, dass es einen gnädigen Gott gibt, den meine Ungläubigkeit nicht scherte? Mit jeder Träne schien sie zu sagen, dass sie sich selbst auch nicht so sicher sei.
Was blieb, waren die Texte der Kirchenlieder. Und was im Lauf der Jahre wuchs, waren Zweifel an meinem Glaubensverlust. Wie konnte man sich freuen, etwas verloren zu haben? Das scheußliche Folterbild des gekreuzigten Christus stieß mich frühzeitig ab, gewiss, aber die berühmte Frage der Gegenaufklärung »Warum ist nicht nichts, sondern etwas?« sollte mich später zum neugierigen Leser astrophysikalischer Artikel auf den Wissenschaftsseiten der Zeitungen machen. Doch eine Antwort auf die Frage nach den Ursachen des kosmischen Anfangs, nach dem Anfang vom Anfang, also die Frage nach dem Grund allen Seins fand ich dort nicht. Was das »Sein« eigentlich ist, sollte sich später in meiner Studienzeit als eine der langweiligsten Fragen entpuppen. Steckt hinter der akademischen oder privaten Suche nach dem »Seinsgrund« nichts weniger als eine Sehnsucht, absolute Gewissheit von allem und über alles zu besitzen?
Andererseits wusste ich als Student aber auch, dass es kein Recht auf philosophische Dummheit gibt. Ich nahm es mir dennoch und kam mir dabei schlau vor. Und doch genieße ich bis heute den wohligen Schauer angesichts der Milchstraße in einer klaren Nacht auf dem Land, der alle Fragen nach dem Grund solch kosmischer Schönheit überdeckt mit einer seltsamen Zufriedenheit, die auf Fragen und Antworten verzichtet. Die aristotelische Trennung zwischen dem Schönen und dem Erhabenen löst sich in solchen Momenten spurlos auf.
Später stellten sich ein paar andere, nicht ganz so mächtige Fragen. Dass Staunen der Anfang aller Philosophie sei, wusste Aristoteles. Was aber, wenn es beim Staunen bleibt, weil die Fragen, die ihm entspringen sollten, unter ein kulturelles oder gar politisches Verbot geraten? Und was, wenn der Staunende ganz zufrieden ist angesichts des Unerklärlichen? Mehr noch, gibt es eine legitime Faulheit, eine geistige Leichtfertigkeit, die sich einer Philosophie des Grunds entgegenstellt? Gäbe es sie, existierte dann auch ein Recht auf geistige Faulheit, das sich auf die Schönheit des Firmaments berufen kann? Und wäre diese Schönheit dann doch die Wurzel allen Glaubens? Können wir Schönheit empfinden, ohne zu glauben? Diesen Fragen und ihren Antworten bin ich ein Leben lang aus dem Weg gegangen, aber dass andere sie stellten und fanden, fand ich bewundernswert.
So wurde ich wahrscheinlich zu einer Art Existenzial-Hedonisten. Ich empfand und empfinde Schauer beim Hören bestimmter Musik, doch Noten konnte ich nie lesen. Es gibt wohl eine besondere Form der Halbbildung, die als fauler Verzicht auf Genauigkeit überlebt. Gäbe es in den Orchestersälen der Welt einen Rang für die musikalisch Halbgebildeten, hätte ich einen festen Platz in der Mitte. Strenge Experten wie der ausgebildete Pianist Theodor W. Adorno haben diese Art Zuhörer mit einem Bannfluch belegt: Sie »genießen« Musik, und »Genuss« war für ihn ein Charakterfehler der Konsumgesellschaft. Unfehlbar war der Großdenker aber nicht; seine Verachtung für amerikanischen Jazz grenzte für mich an Rassismus.
Dass Bachs Matthäus-Passion inzwischen, entkleidet ihres frommen Inhalts, zu einer Ersatzreligion geworden ist, die Atheisten, Buddhisten, Juden, Moslems, Hindus wie Christen gleichermaßen berührt, öffnet das akademische Feld für eine Anthropologie der globalisierten Musik. Warum ist das so? Irgendwo wird es im Rahmen »interkultureller Forschung« entsprechende Dissertationen geben.
Doch sie bestehen nur aus Wörtern.
1949 verschwanden meine Brüder Klaus und Jürgen aus meinem täglichen Blickfeld. Aus ihrem westdeutschen Internat kehrten sie nur in den Sommerferien zurück. Sie wurden mir fremd, anders als meine geliebte Schwester. Meine sorglose Kindheit in der Kleinstadt ohne elterliche Überwachung blieb ihnen verwehrt. Unsere Mutter, nunmehr beschäftigt in einer Kranfabrik auf dem ehemaligen Junkers-Gelände, erklärte später, sie hätte genug gehabt von den politischen Indoktrinationen der beiden Söhne. Die Jungen Pioniere und FDJ-Kinder der DDR benutzten anfangs noch die übriggebliebenen Landsknechtstrommeln der Hitlerjugend mit ihren Flammenbemalungen auf weißem Grund, und auch die blechern schmetternden Fanfarenzüge waren noch die alten. Ich glaube hingegen, dass ihr die beiden älteren, pubertierenden Jungen einfach zu viel geworden waren.
Ich selbst wurde mit acht oder neun Jahren Junger Pionier, denn die ganze Volksschulklasse trat gemeinsam in den kommunistischen Kinderverband ein. Schnell und stolz knotete ich das blaue Halstuch über den Hausschlüssel und gründete mit Freunden aus der Nachbarschaft die kindliche Feuerwehrgruppe »Ernst Thälmann«. Von dem kannte ich nicht mehr als seinen Namen. Die alten Feuerwehrmänner mit ihren roten Fahrzeugen müssen gewusst haben, wer er war. Ein Held und kommunistischer Märtyrer und ein Feind der Weimarer Demokratie, wie die meisten von ihnen es wohl auch gewesen waren, wenn auch aus anderen Gründen. Wer ahnte damals eigentlich, was in den Köpfen der Deutschen wirklich vorging? Alle schauten jedenfalls nach vorn und ich natürlich auch. Mir ging es gut, und vor allem wollte ich älter werden, wie jedes Kind, wenn es erst einmal gelernt hat, seine Geburtstage zu zählen.
Ob ich je einer kommunistischen Organisation angehört hätte, lautete die Frage eines US-Beamten im Hamburger Konsulat, als ich zum ersten Mal 1959 nach Amerika reiste. »No.« Auch am Holocaust – eine Frage, die sich auf amerikanischen Visumanträgen deutscher Bewerber bis vor kurzem wiederholte – hatte ich nicht teilgenommen. So wurde eine Lüge mit einer Wahrheit ausgeglichen.
Ein Dutzend Mal überquerte die Mutter zwischen 1949 und 1953 unter abenteuerlichen Umständen die streng bewachte Zonengrenze, um ihre Söhne im Westen zu besuchen. Von diesen Exkursionen, die mit Lebensgefahr verbunden waren, erzählte sie, als hätte es sich um eine Art Schnitzeljagd gehandelt, und meine Schwester und ich waren begeistert: Verräterisch knackendes Unterholz im Wald, aufsteigende Leuchtraketen, russische Kommandos aus der Ferne, Gänsemarsch entlang stillgelegter Eisenbahngleise in mondloser Nacht – das nächste Mal wollten wir mitkommen. Später las ich von erpresserischen Schleppern, Vergewaltigungen und Frauenmördern, die jene heimlichen Übergänge im Harz und am Hohen Meißner in den Westen (und umgekehrt) gefährdeten.
Im Rückblick schieben sich die vier Jahreszeiten der Kindheit zusammen in Winter und Sommer. Die harten Winter der Nachkriegszeit, in denen ungezählte Deutsche verhungerten und erfroren, verwandeln sich im Rückblick in glückliche Tage, aus denen Schlittenfahrten und Schneeballschlachten mit knisternden Schritten durch dichte Schneedecken auftauchen, als hätten die Erwachsenen keine anderen Sorgen gehabt. Im nahegelegenen, winzigen Zoo von Köthen gab es ein Wolfsgehege, und das nächtliche Heulen dieser Tiere klang wie eine Botschaft aus einem jener Hauff’schen Märchen, die unsere Mutter ihren Kindern vorlas und die uns gruseln ließen: Derlei Gefühlsregungen, so weiß ich heute, können gelernt werden. Dass sogar eine Sehnsucht nach den Ängsten, die in Märchen lauern, zur kindlichen Gewohnheit werden können, mögen Psychologen erklären. Vielleicht kommen sie auf die Idee, dass die Kinder sich den Schrecken grausamer Märchen öffnen, weil sie genau wissen, dass ihre Mütter sie trösten werden, wenn sie das Buch erst einmal beiseitegelegt haben. Das wäre gewiss die zwangloseste Erklärung – der Gewissheit einer freiwilligen Fahrt durch eine Geisterbahn gleich, die man ja am Ende der unheimlichen Reise ins Freie hinter sich lässt.
Ich wurde von mütterlicher Zärtlichkeit und Liebe überschüttet wie ein geliebtes Haustier. Es ging mir gut. Ich war ein zuversichtliches Kind, dem nichts fehlte. Die Tage, an denen es 1947 zum Abendessen geröstetes Schwarzbrot mit Salz bestreut gab, plusterten sich später zu wahren Hungersnöten auf, die es für uns nicht wirklich gab. Wohl aber konnten meine Schwester und ich unsere Mutter verletzen, indem wir abends in unseren Betten lagen und »Hunger, Hunger« riefen. Hungerten wir wirklich? Es muss doch manchmal so gewesen sein; denn die Hamsterfahrten in überfüllten Zügen bis tief nach Sachsen an der Hand meiner Mutter waren real, und in Oschatz warf ich den ersten und letzten Blick auf die dunkelbraunen Budapester Schuhe meines Vaters, die für einen Rucksack voller Kartoffeln in den Besitz eines Bauern übergingen. In den Schuhen eines Toten wird er sonntags in die Kirche gegangen sein, ehe sie für immer schloss. Er betete bestimmt im festen Glauben, ein gutes Geschäft gemacht zu haben. Später würde er seinen Hof der Idee der sozialistischen Landwirtschaft opfern müssen, ohne Rücksicht auf die Schönheit seiner Schuhe und die Größe seiner Grundflächen – falls er nicht schon auf festen Sohlen in den Westen geflohen war.
Im Gepäckwagen des Zugs war auf der Rückfahrt aus Oschatz noch Platz, und dort spielte ich mit einem kleinen Bleiflugzeug (es war das Modell einer Me-109) imaginäre Luftkämpfe mit entsprechenden Begleitgeräuschen, bis mir dieses kleine Erinnerungsstück von einem Erwachsenen weggenommen wurde, ohne dass die Mutter protestierte. Der Krieg war eben noch immer nicht vorbei.
Flucht in den Westen
Die DDR verließ ich mit meiner Mutter und meiner Schwester Ursula, »Ulli«, Anfang März 1953. Der Köthener Bildhauer Robert Propf hatte in einer Gaststätte das Gespräch zweier Stasi-Beamten mitgehört: »Morgen früh nehmen wir die Naumann hops. Sechs Uhr dreißig, Wolfgangstraße 28.« Meine Mutter, so fand sie viel später heraus, war in den Verdacht der Sabotage geraten, weil ein Drahtseil, das sie bestellt hatte, gerissen war. Sie korrespondierte regelmäßig mit ihren Verwandten in New York. Das schien der Stasi zu reichen. Die Wirtschaft der DDR war gerade kollabiert, irgendjemand musste schuld sein. Propf, ein Freund der Familie, trank sein Bier aus und klingelte an unserer Haustür. Meine Mutter weckte ihre Kinder, wir zogen uns an, ich mit doppelter Unterwäsche. Ich fütterte meine Zierfische, ließ die weißen Mäuse in der Wohnung laufen, knüpfte mein blaues Pioniertuch um, und eine befreundete Anwältin fuhr uns mitten in der Nacht in ihrem Vorkriegsauto zu Bekannten nach Dessau. Am nächsten Tag nahmen wir den überfüllten Zug nach Ostberlin.
Meine Kindheit war zu Ende. Doch das empfand ich nicht so; im Gegenteil, ich freute mich auf ein Abenteuer. Meine Schwester und meine Mutter schwiegen, an den Fenstern zogen die Telefonmasten vorbei, und ich las meine ersten italienischen Vokabeln auf einem Schild unter dem Fenster: »E pericoloso sporgersi«, »Vorsicht, nicht hinauslehnen«. In Ostberlin stiegen wir in eine S-Bahn um. Die fuhr in den Westen. Die kleine Familie lehnte sich aus der DDR hinaus.
Als wir kurz vor Mitternacht auf dem Westberliner Bahnhof Zoo aus dem fast menschenleeren Waggon stiegen, lasen wir die Schlagzeile eines Boulevardblatts: »Stalin tot«. Meine Mutter fragte: »Sollen wir zurückfahren?«, und besann sich eines Besseren.
Jahrzehnte später erfuhr ich, dass der mörderische Stalin in seiner Datscha bei Moskau viele Stunden lang tot neben einer Couch auf dem Boden lag, während seine potenziellen Nachfolger starr vor Angst neben dem leblosen Körper saßen, ohne zu wissen, was sie nun tun sollten. Sie konnten sich nicht gegenseitig umbringen oder absetzen, das kam später, also erhielten sie Stalin insofern am Leben, indem sie ihn nach dem Staatsbegräbnis einbalsamieren ließen, einer Tradition folgend, die sich seit Tausenden Jahren in aller Welt gegen die Vergänglichkeit wehrt oder der Vorbereitung dient, im Jenseits in halbwegs annehmbarer Verfassung aufzuerstehen, wenn nicht gar auf Erden. Im 19. Jahrhundert wurden ägyptische Mumien nach Europa exportiert, wo sie in Pulverform gegen allerlei Altersbeschwerden in Apotheken verkauft wurden. Das blieb Stalin erspart, immerhin.
Die Ankunft im freien Westberlin teilte die flüchtige Familie mit Tausenden anderer DDR-Bürger, die in langen Schlangen vor Schreibtischen alliierter Beamter offenbaren mussten, warum sie geflohen seien. Ja, warum wohl? An jenem Tag, dem 6. März, sollten mehr als 5000 Flüchtlinge ihre Seelenlage in wenigen Worten den Ordnungskräften der westlichen Geheimdienste Berlins darlegen. Meine Mutter wurde gefragt: »Waren Sie in der Akazienallee in Köthen?« Die Herrschaften waren gut informiert. Denn dort amtierte die Stasi in einem großbürgerlichen Anwesen.
Einige Meter hinter der Familie Naumann, die in der »Notaufnahmestelle« Kuno-Fischer-Straße anstand, brach eine alte Frau tot zusammen. Sie wurde weggetragen und versank in der Geschichte wie später die Millionen DDR-Bürger, die das sozialistische Massenexperiment aus dem Arbeiter-und-Bauern-Staat in jenen Jahren hinaustrieb. Zurück blieb eine Gesellschaft, die ihre neue politische Elite aus gutwilligen Antifaschisten, sitzengebliebenen KP-Kadern, SED-Genossen, Opportunisten und einer seltsamen Bande von Staatssicherheitsagenten bilden musste. Klassische Nationalökonomen wurden nicht gebraucht. Die erste historische Niederlage des Regimes im Aufstand vom 17. Juni 1953 hinterließ keine Zweifel im Sendungsbewusstsein der SED





























