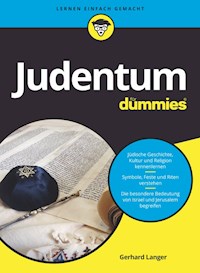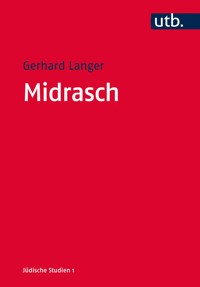9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Michael Winter ermittelt
- Sprache: Deutsch
Michael Winter ist Mitglied der Wiener Kriminalpolizei und zuständig für die besonders schweren Fälle. Doch auch der abgebrühte Ermittler kommt an seine Grenzen, als der ehemalige Wirtschaftsminister Klaus Windisch tot aufgefunden wird – ausgeblutet, lächelnd und in der Hand eine blutgefüllte Tasse mit einer rätselhaften Aufschrift. Der Mord an dem umstrittenen Politiker versetzt das gesamte Land in Aufruhr, und Michael Winter ermittelt unter Hochdruck im Umfeld des Toten. Durch die Journalistin Angelika Kretschmer stößt er auf ein undurchdringliches Netz aus Korruption und verborgenen Leidenschaften …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Michael Winter ist Mitglied der Wiener Kriminalpolizei und zuständig für die besonders schweren Fälle. Doch bisweilen stößt auch der abgebrühte Ermittler an seine Grenzen, wie im Fall einer eiskalten Mörderin, die ihre kleine Tochter qualvoll verdursten ließ. Noch gezeichnet von diesem schockierenden Familiendrama wird Michael Winter zum nächsten Tatort gerufen. In einem vornehmen Gebäude wurde die Leiche des ehemaligen Wirtschaftsministers Klaus Windisch entdeckt – ausgeblutet, lächelnd und in der Hand eine Tasse mit der Aufschrift »Wien ist anders«. Unter großem Druck ermittelt Michael Winter im Umfeld des Toten, denn die Presse stürzt sich auf den Mord an dem so beliebten wie umstrittenen Politiker und die Führung des Landes drängt auf schnelle Ergebnisse. Unterstützt wird er dabei von seiner jungen Kollegin Julia Gartner und der forschen Wirtschaftsjournalistin Angelika Kretschmer, die einem riesigen Politskandal auf der Spur ist. Doch Winters Intuition führt ihn in das Privatleben des Exministers und zu einem undurchdringlichen Netz aus Korruption und verborgenen Leidenschaften …
Autor
Gerhard Langer wurde 1960 in Salzburg geboren und ist Professor für Judaistik an der Universität Wien. Neben der Forschung und Lehre widmet er sich dem Schreiben von Kriminalromanen. »Gnädig ist der Tod« ist der erste Fall für den charismatischen Wiener Ermittler Michael Winter.
Gerhard Langer
Gnädig ist der Tod
Kriminalroman
Für Sepide
Prolog
»Jedes Kind hat ein Recht auf Leben«, sagt sie und fügt bestimmt hinzu: »Aber nur die wenigsten hätten je gezeugt werden dürfen!«
In Situationen wie diesen verfluche ich den Tag, an dem ich beschloss, Polizist zu werden.
Auf den Fotos, die ich in meinen Händen halte, liegt ein Mädchen auf seinem Bett. Es heißt Antonia. Vor drei Wochen hat Antonia ihren achten Geburtstag gefeiert. Ihr Kopf ruht auf einem weichen Kissen, und in eine flauschige Decke eingehüllt sieht sie aus, als würde sie schlafen. Ein friedliches Bild, wären da nicht diese Striemen an den Handgelenken, wo die Fesseln ins Fleisch geschnitten haben, diese aufgerissenen Lippen, diese aschfahle Haut. Ich kann den Tod riechen, auch wenn ich mich längst nicht mehr am Tatort befinde, sondern in einem Gruppenraum des Wiener Landeskriminalamtes sitze.
Ich lege die Fotos hin und sehe in die Augen ihrer Mutter, einer zweifachen Mörderin. Sie sind wie kalte nasse Steine, an denen man abrutscht und in die Tiefe fällt. Alles an dieser Frau ist streng und diszipliniert. Ihr langes blondgefärbtes Haar wird mit einigen Spangen militärisch in Zaum gehalten, ihre Augenbrauen und Fingernägel wurden vor Kurzem einer sorgfältigen Pflege unterzogen, ihr Lippenstift ist dezent und mit klarem sicherem Strich aufgetragen. Auch ihre weiße Bluse ist frisch gewaschen und verströmt einen zarten Geruch nach Weichspüler.
Ich weiß, dass ich die Fragen jetzt stellen muss, und sie beantwortet sie mit der Präzision einer geeichten Maschine. Ich bemühe mich, ihr nicht in die Augen zu sehen, und betrachte stattdessen ihre geraden weißen Zähne, ihre Grübchen, die links und rechts symmetrisch ihr Lächeln einfassen und ihre kleinen Ohren, die zwei grüne Perlen zieren, kalt wie der Meeresgrund. Ihr Atem geht ruhig und regelmäßig. Hinter ihr an der Wand tickt eine Uhr mit großen schwarzen Ziffern. Tick, tick, tick. Sie tickt verdammt richtig, denke ich.
»Und Sie«, beginne ich und schlage mein Notizbuch auf, »was hat Sie aus der Bahn geworfen?« Ich weiß nicht, warum ich das sage, es kommt, ohne zu überlegen. Ich fühle nichts außer diese Abneigung dagegen, hier zu sein, diesen Wunsch, mein Studium nicht abgebrochen zu haben, nicht in diese kalten Augen blicken zu müssen.
Zu meiner Überraschung antwortet sie: »Ihr Vater hat ihr wehgetan.« Dann schweigt sie wieder.
Behutsam hake ich nach: »Inwiefern wehgetan?«
Sie scheint zu überlegen, nach den passenden, ihrer Meinung nach der Situation angemessenen Worten zu suchen. Sie spricht nichts unbedacht, plaudert nicht, jedes ihrer Worte hat Gewicht.
»Er hat sie missbraucht.«
Ich höre den Satz, lasse ihn in mich eindringen. Dann reiße ich ein Blatt mit den Daten zu ihrer Person aus meinem Notizbuch, lege es vor mich hin und streife es glatt. Isabella Martin, 32 Jahre, Besitzerin einer kleinen Boutique im 8. Bezirk, wohnhaft in der Taborstraße im 2. Bezirk, keine Vorstrafen, verheiratet, ein Kind.
Sie sieht mich an, schweigt, erwartet, dass ich weitere Fragen stelle, klar und präzise. Auch wenn es mir widerstrebt, muss ich auf sie eingehen. Also fordere ich sie auf, mir im Detail zu schildern, was genau er getan hat.
Sie legt ihre linke Hand auf die rechte, atmet etwas stärker aus als zuvor.
»Er hat sie berührt«, presst sie hervor.
Ich warte eine gefühlte Minute, aber es werden wohl nur Sekunden gewesen sein. Dann fließt es aus ihr heraus.
»Am Anfang war es kaum zu merken. Er hat seine Hand auf ihre Schulter gelegt und dabei ihren Hals gestreichelt. Nichts Besonderes. Dann hat er sie manchmal von hinten umarmt und dabei ihre kleinen Brüste berührt. Sie war recht reif für eine Achtjährige. Ich weiß genau, dass es nicht einfach aus Versehen passiert ist. Ich habe es ihm sehr bald angesehen. Er wollte sie haben. Wenn wir miteinander geschlafen haben, hat er an sie gedacht. Sagen Sie nichts! Ich weiß es einfach. Eine Mutter spürt so was.«
Ich wage nicht zu widersprechen und nicke nur.
»Wenn sie auf dem Sofa saßen und fernsahen, hat er ihre Knie gestreichelt und die Oberschenkel. Sie hat nicht gewusst, was sie tun sollte. Er war einfach zu stark, nicht physisch, meine ich, aber psychisch. Manchmal hat sie mich angesehen, Hilfe suchend. Ich habe ihn zur Rede gestellt, aber er hat nur gelacht. Es sei ja wohl nichts dabei, seine Tochter zu liebkosen. Ja, genau so hat er es gesagt. ›Liebkosen‹. Ich habe mir noch gedacht, was für eine eigenartige Wortwahl: ›Liebkosen‹.«
Ich höre zu. Mache mir Notizen, während sie redet, zeichne ein Mädchen mit Kniestrümpfen, das auf einem Sofa sitzt, und neben ihm einen übergroßen Mann. Ich weiß, dass er gar nicht groß war. Vielleicht einen Meter siebzig. Aber muskulös, zumindest wirkt er auf den Fotos so, die wir in der Wohnung sichergestellt haben. An seinem Körper konnte man das nicht mehr sehen. Dazu war zu wenig von ihm am Stück vorhanden. Seine Frau hat ihn in praktisch abpackbare Portionen zerteilt und diese im Gefrierschrank eingefroren. Sie wurden längst abgeholt und befinden sich in der Gerichtsmedizin.
»Es war am 2. Februar«, sagt sie. »An dem Tag habe ich sie allein mit ihm gelassen. Das geschah nur sehr selten im letzten Jahr. Ich habe das vermieden. Und ich weiß auch, warum.«
Sie schweigt wieder, scheint nachzudenken. Ich lasse ihr Zeit.
»Sie waren allein. Ganze zwei Stunden. Das war einzig und allein mein Fehler.«
Zum ersten Mal während unseres Gesprächs wirkt sie nervös. Aber sie fängt sich rasch, atmet ruhig ein und aus und sieht mich an.
»Sie sind dagesessen, als wäre nichts gewesen, aber ich habe es in ihren Augen gesehen. Eine Mutter …«
»Ich weiß«, unterbreche ich sie, »eine Mutter spürt so was. Hat Ihre Tochter irgendwann darüber gesprochen?«
Sie nickt. »Am nächsten Tag, als er in der Arbeit war. Sie hat sich an mich geklammert wie ein Kleinkind und mir alles erzählt. Jede Einzelheit.«
Ich warte, aber sie macht eine quälend lange Pause. Ich spüre Unruhe in mir aufsteigen. Lass ihr Zeit, ermahne ich mich selbst, nur dann wirst du begreifen, was passiert ist. Warum eine Frau ihren Mann getötet und zerstückelt und danach ihre Tochter ans Bett gefesselt hat, ihr nichts mehr zu trinken und zu essen gab, eine unerträglich qualvolle Woche lang. Und warum die Nachbarn nichts gehört haben.
Sie streicht ihren Rock glatt und richtet dann den Oberkörper kerzengerade auf, bereit für die Offenbarung.
»Er hat sie gestreichelt. Und als sie ihm sagte, dass es ihr unangenehm sei, hat er nur gemeint, dass man das für seinen Vater tut, wenn man ihn liebt. Ob sie ihn denn überhaupt lieb hat. Sie hat ihm gesagt, dass sie ihn sehr lieb hat. Aber er hat nur den Kopf geschüttelt. Wie das denn sein kann, wenn sie ihm nicht erlaubt, sie zu streicheln.«
Langsam und ruhig erzählt sie weiter, und ich erfahre, wie es dazu kommen konnte, dass ein Vater seine achtjährige Tochter dazu brachte, ihre Kleider auszuziehen und ihre Brust streicheln zu lassen. Wie sie selbst dabei half, dem Vater Hose und Unterhose auszuziehen, und er sie dazu nötigte, seinen Penis anzufassen und ihm schließlich zu gestatten, mit dem Penis ihre Klitoris zu berühren. Das Schlimmste, so sagt sie, war wohl, dass das Mädchen etwas empfunden zu haben glaubte, von dem sie nicht wusste, wie sie es erklären sollte, ein prickelndes Gefühl, etwas unangenehm Angenehmes, etwas, wofür sie sich schämte. Sie erzählt wieder in der gewohnten Ordnung, ohne Umschweife.
»Ich habe ihn zur Rede gestellt, aber er hat nur gelacht. Welche Fantasie so ein Kind habe. Wie ich so etwas glauben könne. Ich wusste es. Wenn er den Mut gehabt hätte, es zuzugeben.«
Würde er dann noch leben? Ich zweifle daran, aber ich kann mich irren. Zwar liege ich selten falsch, aber es passiert. Ich vermute, an diesem Tag war sein Schicksal beschlossen. Seines. Aber das des Mädchens? Selbst nach fast dreißig Jahren Polizeidienst kann ich das nicht verstehen. Warum musste das Mädchen sterben? Noch ist es nicht so weit, ihr diese Frage zu stellen. Noch ist sie zu wütend auf ihn, noch möchte sie einfach nur über ihn sprechen, möchte den Mord mir gegenüber darstellen, aber nicht verteidigen, dazu sieht sie keinen Anlass. Sie gleicht vielmehr einer Schauspielerin, die ihre beste Rolle nicht ohne Publikum spielen kann und die wogende Masse braucht, unsichtbar im Scheinwerferlicht, aber trotzdem gegenwärtig, gebannt auf die Bühne starrend. Ich bin jetzt das Publikum und muss meinerseits meine Rolle gut spielen, sonst wird der Vorhang bei ihr fallen, ohne dass ich das Ende mitbekomme. Also ermuntere ich sie weiterzuerzählen, und sie geht darauf ein. Ich vermute, wir sind erst im ersten Akt, noch lange vor der ersehnten Pause. Wieder fühle ich dieses Ziehen im Nacken, die beginnenden Kopfschmerzen. Ich möchte meine Schläfen massieren, an etwas Schönes denken, das mich entspannt, aber ihre eisigen Augen nehmen mich gefangen. Ich lege den Stift beiseite, weil meine Hand zu zittern beginnt. Sie bemerkt es, und für einen Augenblick überlege ich, was sie von mir hält. Ich glaube, dass sie sich fragt, ob ich jemals Schuld auf mich geladen habe und wie sie mich einordnen soll. Sie denkt in Kategorien wie sauber gegen schmutzig, rein gegen unrein, für den Himmel bestimmt oder das Fegefeuer. Die Hölle ist schon für ihren Mann reserviert.
Ich nehme den Faden wieder auf. »Wie lange waren Sie mit ihm verheiratet?«
»Dreizehn Jahre, vier Monate und drei Tage, nein, ich muss nachdenken …«
Sie sieht mir auf den Mund. Soll ich es ihr vorrechnen?
»Wann soll ich aufhören zu zählen, meinen Sie bis heute oder …?«
»Bis zu ihrem Tod!«, sage ich lauter als beabsichtigt und füge schnell beschwichtigend hinzu: »Ich meinte, bis zu seinem Tod.«
»Ich erinnere mich nicht«, entgegnet sie plötzlich, und ich bedauere, sie so festgenagelt zu haben. Sie hat den Mord zwar nicht verdrängt, aber manches davon ausgeblendet. Teile der damit verbundenen Realität sind nicht in ihrem Bewusstsein angekommen, verharren noch irgendwo in der Kältestarre ihres Gehirns.
»Vergessen Sie, was ich gefragt habe. Erzählen Sie einfach weiter über diese – wie soll ich es nennen? – Sünde zwischen Ihrem Mann und …«
Sie lässt mich den Satz nicht vollenden.
»Nachdem ich ihn zur Rede gestellt hatte, damals, als er mir nur ins Gesicht gelacht hat, da wusste ich, dass mein Leben mit ihm einfach nur eine Lüge war. Er hat es nie ernst gemeint. Er hat mich geheiratet, aber er hat mich nie geliebt. Er hat mich nie so angesehen wie sie. Er hat mich nur selten geküsst. Er hat gesagt, dass er es nicht mag, wenn ihm jemand mit der Zunge im Mund herumfährt, das ekle ihn an. Aber sie hat mir erzählt, wie komisch sie sich gefühlt hat, wie unangenehm es war, als er ihr die Zunge in den Mund gesteckt hat.«
Sie wischt sich mit dem Handrücken über die Lippen wie nach einem fetten Essen. »War es das?«, fragt sie dann.
Erneut hat sie sich in ihren inneren Eisschrank zurückgezogen. Sie nickt ihrem Anwalt zu, der während des gesamten Gesprächs kein Wort gesagt hat, und macht Anstalten, sich vom Stuhl zu erheben, aber ich lasse sie nicht.
»Moment noch«, sage ich bestimmt.
Sie setzt sich wieder und senkt den Blick, begutachtet ihre Fingernägel.
»Warum haben sie ihre Tochter sterben lassen?«, frage ich, zögerlicher als ich will.
»Sie wollte es so«, erwidert sie und steht auf.
Einige Monate später
Dienstag, 2. Oktober
Tag 1
1
Ich komme gern früh in mein Büro im Landeskriminalamt, das sich in einem über hundert Jahre alten, Ehrfurcht gebietenden Gebäude an der Roßauerlände befindet, neben dem Verteidigungsministerium, nicht weit vom alten jüdischen Friedhof und wenige Minuten von Sigmund Freuds einstiger Wirkungsstätte entfernt. Ich setze mich an meinen alten Schreibtisch, der lange vor meinem Dienstantritt hier stand und auf meinen Wunsch hin nie ausgetauscht wurde. Er ist so groß, dass selbst der riesige Computerbildschirm unscheinbar wirkt. Auf einen Tisch für Besprechungen im kleinen Kreis habe ich verzichtet, aber nicht auf zwei bequeme Lehnstühle, in denen man – auch in Gedanken – versinken kann. An den weiß getünchten Wänden stehen weiße Regale mit Ordnern. Hier stapeln sich die schriftgewordenen Erinnerungen an vergangene Fälle, gelöste und ungelöste. Ich grüble über dem Fall Isabella Martin, den ich abgegeben habe. Noch immer quälen mich Träume, in denen mich Antonias tote Augen fixieren und fragen: »Warum?«
Ich forme einen Vogel aus weggeworfenem Papier. Sie muss schon länger im Türrahmen gestanden haben, aber ich bemerke sie erst jetzt. Sie heißt Julia Gartner und trägt die blaue Polizeiuniform und die Abzeichen einer Bezirksinspektorin. Seit zwei Wochen ist sie bei uns, frisch versetzt aus Niederösterreich, von wo sie unbedingt wegwollte, obwohl ihre Beurteilungen erstklassig waren und ihr der zuständige Ermittlungsleiter eine steile Karriere in Aussicht stellte. Ich frage nie, weshalb. Irgendwann erfahre ich es sowieso. Ich versenke den Papiervogel in der Schublade und blicke sie an.
»Oberstleutnant Winter! Chef!«, sagt sie mit einem gewissen Nachdruck in der Stimme. »Wir haben einen Termin.«
Ich lache laut, mehr aus Verlegenheit, weil ich sie vergessen habe und weil sie mir bei einer nicht gerade intellektuellen Tätigkeit zugesehen hat, aber es irritiert sie nicht. Ich sehe in ein warmes braunes Paar Augen. Julia, denke ich, war der beliebteste Vorname in den Achtzigern, als sie geboren wurde, und gleichzeitig wundere ich mich, warum mir gerade jetzt mein Hirn diese unnötige Information aufdrängt.
Julia tritt an meinen Schreibtisch. Ich weiß, dass ich ihr wie allen Neuzugängen ein längeres persönliches Gespräch angeboten habe, in dem ich alle erdenklichen Fragen zu beantworten versuche und so rücksichtsvoll wie möglich und so deutlich wie notwendig auf die Fettnäpfe hinweise, in die sie möglichst nicht treten soll, ihr Wege und Umwege zu erläutern versuche, auf denen wir uns bewegen müssen, und dabei auch nicht die Besonderheiten der Wiener Seele zu vergessen versuche, die man lieben, aber nie ganz verstehen kann.
Ich komme jedenfalls nicht einmal dazu, einen Satz zu vollenden, weil gleichzeitig mein Handy und das Festnetztelefon klingeln. Wenige Minuten später habe ich nacheinander mit dem diensthabenden Offizier, dem Leiter der im Dienst befindlichen Mordgruppe, der Staatsanwältin und dem Polizeipräsidenten telefoniert. Und auf meinem Handy landen im Sekundentakt Fotos, die mir absolut nicht gefallen. Als es endlich ruhig ist, bringt Julia es auf den Punkt.
»Verdammte Scheiße, Chef!«
Ich hätte es nicht treffender formulieren können. Ich finde sie schon jetzt sympathisch, und ich mag, wie sie »Chef« ausspricht, selbstbewusst, aber nicht frech oder übergriffig. Sie ist nervös, und ich glaube, ihren Schweiß zu riechen, aber es ist eindeutig mein eigener.
Die nächsten Minuten laufen in schweigendem Einvernehmen ab. Sie folgt mir wie selbstverständlich, und schließlich fahren wir die kurze Strecke ins Goldene Quartier, Wiens Nobelmeile. Wo früher einmal eine Arbeiterbank die Sparguthaben armer Sozialdemokraten verwaltete, befeuert heute eine Gruppe erlesener Immobilienspekulanten die nervösen Zuckungen des Kapitalismus, und einige wenige Luxusgeschäfte vertreiben die Langeweile der Reichen und Superreichen.
Vor und in dem prunkvollen Gebäude in der Tuchlauben, in dem die Leiche gefunden wurde, ist die Aufregung spürbar, auch wenn alle hier ihren gewohnten Job machen. Die Leute von der Tatortgruppe arbeiten noch konzentrierter als sonst, der Staatsanwältin ist an ihren Sorgenfalten anzumerken, dass sie alles andere als begeistert ist, heute Journaldienst zu haben. Alle wirken so angespannt, als würden sie von unsichtbaren Kameras gefilmt.
Der Tote liegt in einer fast leeren, frisch renovierten Wohnung über einem der teuersten Geschäfte der Stadt. Ich hatte gehofft, dass die Fotos lügen und die Nachricht, die alle in Aufregung versetzt hat, nicht stimmt, aber ich erkenne ihn sofort und will auf der Stelle umdrehen.
»Warum muss das mir passieren?«, frage ich Julia, doch diesmal sagt sie nichts von »Chef«, sondern zuckt nur mit den Schultern.
Ich rufe die Fotos auf, die mir in der letzten halben Stunde zugeschickt worden sind. Darauf sieht er aus, als lächele er in eine Kamera. Perfektes Styling. Ein maßgefertigter grauer Nadelstreifanzug, eine hellblaue Krawatte mit dezenten weißen und roten Punkten. Seine linke Hand umfasst eine Kaffeetasse, auf der »Wien ist anders« steht. Verdammte Scheiße, da hat jemand Humor. Die Tasse ist halb voll oder halb leer, wie man es nimmt, und mit einer dicken roten Flüssigkeit gefüllt. Ich weiß, dass es kein Glühwein ist.
Der Tote heißt Klaus Windisch, 49 Jahre, war vor einigen Jahren Österreichs Wirtschaftsminister, danach erfolgreicher Unternehmer und lange Zeit der große, hellblonde, blauäugige Lieblingsschwiegersohn des Landes, bis sich das Glücksblatt des Saubermanns wendete. Ich versuche, mich an die Medienberichte zu erinnern. Im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Wohnbaugesellschaft flossen Gelder an Busen- und Parteifreunde, es ging um Schein- und Verschleierungsfirmen in Steuerparadiesen, Zahlungen im Zusammenhang mit dem Börsengang einer Firma mit immensen Verlusten für die Kleinaktionäre, aber mit gigantischen Gewinnen für ihn, munkelte man, und Verdacht auf Steuerhinterziehung in vielfacher Millionenhöhe. Aus dem Politliebling wurde der Hauptverdächtige der Justiz. Ich wollte nie etwas mit ihm zu tun haben. Insgeheim sehne ich mich nach Isabella Martin zurück, nach ihren kalten Augen, möchte den Fall wiederhaben und diesen hier abgeben, an wen auch immer.
Dr. Hartmut Meyer, der Gerichtsmediziner, reißt mich aus meinen Gedanken.
»Schön, dich zu sehen. Hast mir gefehlt«, begrüßt er mich mit einem müden Lächeln und kratzt sich an der Stirn.
Der Duft seines aufdringlichen Rasierwassers oder Eau de Toilette schlägt mir entgegen. Ich rieche Iris, Sandelholz, Hagedorn und irgendwelche anderen Hölzer, unerträglich schwer und süßlich.
Offensichtlich hat er sich schon an Windisch zu schaffen gemacht, den Leichnam entkleidet und auf Wunden und Auffälligkeiten untersucht, um eine vorläufige Todesursache zu bestimmen. Nackt und bloß liegt der Körper vor uns.
»Er war schon ein gut aussehender Mann, der Herr Minister a. D.«, stelle ich fest, ohne viel zu überlegen, mehr um der Situation die Spannung zu nehmen.
Meyer mustert mich von der Seite, um zu prüfen, ob ich ihn provozieren will, aber mein Gesicht ist nur von Schlafentzug und dem kaputten Scherblatt meines Rasierapparates gezeichnet.
»Nicht mein Typ«, kontert er. »Ein aalglattes Arschloch.«
Ich bin solche Ausdrücke von Meyer nicht gewohnt. Er gehört zu den zivilisierten Menschen in meinem Umfeld. Ein Mann mit Stil, kunstbeflissen und belesen.
»Warum so derb?«, frage ich ihn.
Er hat sich wieder im Griff. »Ein kleiner Ausrutscher«, lächelt er, »aber ist doch wahr.«
Nicht alle Gerichtsmediziner sind sarkastische Selbstdarsteller, Hartmut Meyer definitiv nicht. Es ist diese Nervosität, die uns alle beschleicht, diese Angst, hier auch nur einen winzigen Fehler zu machen, die ihn anders agieren lässt. Aber er fängt sich schnell.
»Deine Kollegen haben seinen Anzug durchsucht. Sein Handy ist ausgeschaltet, Portemonnaie mit Geld und Karten trug er bei sich sowie diverse Schlüssel. Falls ihn jemand gewaltsam zu Tode gebracht hat, wovon ich leider ausgehen muss, war es definitiv kein Raubmord.«
»Todesursache, Todeszeitpunkt?«, frage ich mechanisch, obwohl ich weiß, dass diese Fragen jeden Gerichtsmediziner zur Weißglut treiben und in den allermeisten Fällen nicht beantwortet werden. Heute bekomme ich allerdings prompt eine Antwort.
»Gerne, Herr Oberstleutnant. Wenn Sie mich gleich in die Gerichtsmedizin begleiten wollen, dann schneiden wir Windisch gemeinsam auf. Dabei werden alle Fragen beantwortet. Einverstanden?«
Ich versuche ein gequältes Lächeln und verspreche ihm, später zum Kaffee vorbeizukommen. Wenn die Obduktion abgeschlossen ist. Und weil ich eine Weile stehen bleibe und schweige, lässt sich Meyer doch herab, ein paar Vermutungen zu äußern.
»Todeszeitpunkt: gestern, später Abend. Vor Mitternacht. Zur Todesursache habe ich eine ziemlich wahrscheinliche Vermutung.«
Er macht eine Pause, aber ich weiß, dass er nicht erwartet, dass ich sie mit irgendeiner unnötigen Bemerkung fülle. Also lasse ich mir Zeit, bis er weiterspricht.
»Er hat eine Beule am Hinterkopf. Daran ist er definitiv nicht gestorben. Aber siehst du den Einstich dort?« Meyer zeigt auf eine deutlich erkennbare Einstichstelle im linken Unterarm.
Ich nicke. Er drückt an verschiedenen Stellen der Leiche herum, wobei ich versuche, nicht genau hinzusehen, und fragt dann: »Was fällt dir auf?«
Natürlich ist die Frage rhetorisch, weil er weiß, dass ich nur mit den Schultern zucken kann.
»Keine Leichenflecken, Michael.«
Ich ahne langsam, worauf er hinauswill.
»Aderlass.«
»Sehr gut, Herr Oberstleutnant. Die fehlenden Leichenflecken und der Einstich deuten darauf hin, dass ihm jemand Blut abgenommen hat. Viel Blut, viel zu viel Blut. Wenn das stimmt, dann war es ein verdammt beschissener Tod, den nicht einmal er verdient hat.«
Ich antworte nicht. Was immer ich über Klaus Windisch zu seinen Lebzeiten gedacht habe, spielt keine Rolle mehr. Jetzt liegt da ein Toter, und ich behandle alle Toten gleich. Wenn ich mich mit ihnen beschäftige, haben sie kein irdisches Gericht mehr zu fürchten. Nackt und bloß stehen sie vor ihrem Schöpfer und warten, ob der himmlische Richter mit dem Daumen nach oben oder unten zeigt. Ich suche inzwischen ihre Mörder.
Meyer redet jetzt auf mich ein, aber ich nehme nur Bruchstücke auf, muss mich konzentrieren, spüre die beginnenden Kopfschmerzen. Ich höre ihn »definitiv nicht hier ermordet« sagen und »praktisch keine Blutspuren, außer, du hast es ja gesehen, das Blut in der Tasse. Michael, hörst du mir überhaupt zu?«
Ich nicke.
»Noch mal zum Mitschreiben«, fährt er fort. »Ihr müsst einen Tatort suchen, wo man ihm Blut abgenommen hat. Vielleicht hat man ihn vorher betäubt, sodass er es nicht mitgekriegt hat, das weiß ich noch nicht, wenn nein, dann hat er einen langsamen Tod erlebt, nicht extrem schmerzhaft, aber verdammt fies.«
Diesmal habe ich ihm sehr genau zugehört. Ich stelle mir den Minister vor, wie er um Gnade bettelt. Nein, wahrscheinlich hat er es mit der üblichen Tour versucht. Seinem Peiniger Geld in Hülle und Fülle angeboten, vielleicht ein Bankkonto irgendwo in der Schweiz. Er würde natürlich von nichts wissen, keiner Menschenseele etwas erzählen, wenn er nur diesen Tropf abstellt. Nur für einen Augenblick, um zu verhandeln. Später, als er merkt, dass dies nicht zieht, droht er mit Gewalt, mit dem Schrecken der Polizeimacht, mit seinen Verbindungen, Anwälten, Hintermännern, die dem feigen Kerl die Zähne einschlagen werden. Und erst danach, sozusagen in Phase drei, kommt die Tour mit den Kindern, aber er hat gar keine, und vielleicht verspricht er sogar, sich bei Gott und der Welt zu entschuldigen, Abbitte zu leisten, und gelobt Besserung gegenüber dem Mann, der doch hoffentlich nicht zum Mörder werden will und dem er nicht in die Augen sehen kann. Kennt er ihn? Wahrscheinlich. Sicher.
Julia hat sich im Hintergrund gehalten und einen jungen Mann befragt, der als Verkäufer unten im Luxusladen arbeitet. Er zittert, sitzt bleich auf dem einzigen im Raum vorhandenen Stuhl. Zweifelsohne ist er derjenige, der den Toten heute Morgen gefunden hat. Julia versteht es, ihn so gut es geht zu beruhigen, und entlockt ihm wahrscheinlich die nötigen Antworten, ohne ihn zu zermürben. Wieder ein Punkt für sie.
Ich will diesen Ort verlassen, zu meinem Auto gehen, als von hinten ein Hauch von einem Hugo-Boss-Parfüm heranweht und sich mit dem Geruch von Tod und frischer Farbe mischt.
»Ich habe mich schon gewundert, wo du bleibst«, sage ich, noch bevor ich mich umdrehe. »Kollege Rachinger.«
»Immer einen guten Riecher, der Herr Oberstleutnant«, kommt prompt die Antwort und mit ihr eine ausgestreckte Hand. Ich schüttle sie ohne Widerwillen. Der groß gewachsene, kahlköpfige Mann in der Lederjacke ist die Feuerwehr für Norbert Gingrich, den Chef des Verfassungsschutzes, genauer den Direktor des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Rachinger wird nicht selten von ihm im sprichwörtlichen Regen stehen gelassen, ohne Schirm. Das macht ihn mir erträglich. Er fängt die Kugeln ab, bevor sie Gingrich erreichen können. Egon Rachinger ist kein Einstein, aber seine Intelligenz und Kombinationsgabe verdienen eine unsichtbare Verbeugung. Gingrich hat ihn geschickt und nicht seinen Stellvertreter Hobbichler, die schleimige Kröte, die ihm normalerweise in den Arsch kriecht. Und Gingrich hat mir am Tatort eine halbe Stunde Vorsprung gegeben. Das ist mehr, als ich erwarten darf. Also grüße ich freundlich und beschließe, vorerst keine blöde Bemerkung zu machen.
»Wie es aussieht, werden wir zusammenarbeiten«, stelle ich fest.
Er lächelt und nickt. »Winter, der Chef sagt, du bist der Beste.«
Rachinger verzieht keine Miene. Erstaunlicherweise meint er, was er sagt. Auch wenn er lügt. Es ist nicht schwer, die Zusammenhänge zu erkennen. In einem Fall wie diesem ist es üblich, dass wir mit dem Verfassungsschutz zusammenarbeiten. Aber dass Rachinger mir an den Fersen klebt, hat auch noch andere Gründe. Gingrich kann mich nicht leiden. Rachinger soll darauf achten, dass diese Ermittlungen schnell und erfolgreich geführt werden und wir möglichst bald den Mörder finden. Wenn irgendetwas schiefläuft, werde ich dafür die Ohrfeigen kassieren, nicht Rachinger, und schon gar nicht Gingrich, und es wird etwas hängen bleiben an meinem Vorgesetzten und Freund, Oberst Ludwig Prantl, dem Leiter des Ermittlungsdienstes, dessen Stellvertreter ich bin.
Julia tritt zu uns und schaut mich mit einem Wer-ist-dieser-Typ-Blick an, also stelle ich die beiden einander vor.
»Egon Rachinger bekämpft eigentlich böse Terroristen, aber in der nächsten Zeit beehrt er uns mit seiner Gesellschaft.«
Sie schüttelt seine Hand und lächelt übertrieben brav. Mindestens fünf Sekunden zu lang sieht sie ihm in die Augen, und er genießt es. Vertraulichkeiten zwischen Kollegen mag ich nicht und bin schon drauf und dran, etwas zu sagen, verkneife es mir dann aber. Ich habe mühsam gelernt, mich im Zaum zu halten.
Julia wendet sich mir zu und grinst. Ich komme mir überflüssig vor, aber normalerweise dauert dieser Zustand nicht lange. Rachinger lässt keinen Zweifel aufkommen. Ich bin dazu ausersehen, die unausweichliche Sonderkommission zu leiten. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass dieser Fall in meiner Laufbahn irgendwo zwischen Himmelfahrtskommando und letzter Chance angesiedelt ist. Wenn ein ehemaliger Minister ausgeblutet wird, rückt die Kavallerie an. Da sind die Leute vom EBLKA 1, vom Ermittlungsbereich Leib und Leben des Landeskriminalamtes, zwar das wichtigste Rädchen am Wagen, aber natürlich wird in so einem Fall der Verfassungsschutz eingeschaltet, möglicherweise will sogar das Bundeskriminalamt ein Wörtchen mitreden. Wenn es Orden zu verteilen gibt, wird es genug geschwellte Brüste geben. Ich sehe die Ministerin Hand in Hand mit dem Polizeipräsidenten. Und genug Klugscheißer, die böse austeilen, wenn etwas schiefläuft. Ich bin ein heißer Kandidat dafür, etwas abzubekommen. Rachinger, mein gefräßiger Schatten, wird sofort zubeißen, wenn ich einen Fehler mache, und ich wette, dass sie bereits die Stunden bis dahin zählen.
Ich erinnere mich an die Diskussionen um meine Bestellung zum stellvertretenden Einsatzleiter. Gingrich war nie von mir überzeugt, und er lässt es seinen ehemaligen Schulfreund Prantl bei jeder Gelegenheit spüren. Wenn ich jetzt scheitere, wird er die Bluthunde loslassen oder, noch schlimmer, die Presse auf mich hetzen. Und damit auch auf Prantl. Ludwig Prantl ist noch vom alten Schlag, ein Polizist, der viele Jahre draußen Dienst tat, an der sprichwörtlichen Front. Einer, der sich damals keineswegs davor scheute, ein paar Gläser gespritzten Weißwein in einem verrauchten und verrufenen Vorstadtlokal zu trinken, um aus erster Hand Informationen zu erhalten. Einer, der mit den Rotlichtgrößen per Du war. Ganz anders als Gingrich, der sich über Jahre im Dienste der Terrorismusbekämpfung im Ausland aufhielt, sich gern mit Politikern gleich welcher Couleur umgibt und am liebsten jeden Österreicher mit den modernsten Überwachungsmethoden kontrollieren möchte. Zwischen Gingrich und Prantl liegen Welten. Klar, es vergeht kein Tag, an dem Prantl nicht darauf hinweist, dass heute ohnehin alles anders sei, um gleich im Anschluss von den vielleicht gar nicht immer guten, aber keineswegs schlechteren Zeiten zu erzählen.
Wenn Prantl einen Fehler macht, ist Gingrich die lästige Konkurrenz los, die zwischen ihm und einem Posten im Ministerium steht, auf den er schon lange spekuliert. Also schlage ich vor, keine Zeit zu verlieren, um ihm diesen Triumph nicht zu gönnen.
Vor dem Gebäude kämpfen wir uns durch die Menge der Journalisten, die sekündlich größer zu werden scheint, als würden sie wie Fliegen vom Leichengeruch angezogen. Rachinger steigt wie selbstverständlich mit ins Auto ein und lehnt sich auf dem Rücksitz zurück. Ich sehe ihn durch den Rückspiegel fragend an, aber er lässt sich nichts anmerken. Während ich die Nachrichten auf meinem Handy durchscrolle, wundere ich mich, dass Prantl nur zweimal angerufen hat. Ich fahre los und bitte Julia, die Nachrichten abzuhören, erfahre von ihr dann aber nichts, was ich nicht schon geahnt habe. Dass ich natürlich alle Unterstützung bekommen werde, die ich brauche, und auf Ressourcen zugreifen könne, die unter anderen Umständen nicht zur Verfügung stünden. Aber weil eben der Fall so speziell und von nationalem Interesse sei, habe die Innenministerin selbst jede operative und technische Hilfe zugesagt.
Aber schließlich gelingt es Julia doch, mich überrascht zu erleben. Denn ganz nebenbei habe die Innenministerin sich bei Prantl über mich beschwert, weil ich mich ihrem Neffen gegenüber schlecht benommen habe. Dies sei jetzt die Gelegenheit, es wiedergutzumachen.
Ich habe keine Ahnung, was sie meint.
»Der Neffe der Innenministern heißt Lukas Meierhofer«, erklärt Julia, »und arbeitet im Assistenzbereich 2. Analyse. Er hat mich mal auf dem Gang angesprochen und wollte ein wenig plaudern, hat aber eigentlich nur von sich erzählt. Dass er gern in die USA will und so, irgendeine Spezialausbildung machen. Klang sehr ehrgeizig.«
»O mein Gott«, sage ich und schlage aufs Lenkrad, »der Meierhofer.«
Jetzt fällt es mir wieder ein. Ein schmächtiges Bürscherl, gerade mal Mitte zwanzig, mit kurzen schwarzen Haaren, in zu engen Jeans, geschniegelt irgendwie. Er steht artig in der Tür und fragt mich höflich, ob ich ein paar Minuten Zeit für ihn hätte. Er fühle sich unterfordert, mit seinen Fähigkeiten nicht genug wertgeschätzt, und im Übrigen habe er sich für eine Ausbildung angemeldet, in Amerika. Um Ermittlungstechniken zu lernen. Er bräuchte dazu meine Unterstützung. Ich schaue ihn fragend an und schlürfe meinen Kaffee. Während ich mit ihm rede, ignoriere ich ihn geistig. Ich kann das. Die wenigsten Leute merken es, dass man ihnen gar nicht zuhört und im Kopf längst an etwas anderes denkt, aber er hat es gemerkt. Jetzt ist alles ganz deutlich. Meierhofer hat mich gefragt, warum ich ihn nicht beachte, obwohl er eindeutig der Beste in seinem Bereich sei. In welchem Bereich, habe ich gedacht, aber was anderes gefragt. Ich erinnere mich nicht mehr, was, habe es verdrängt. Ich weiß nicht einmal mehr, ob ich ihm überhaupt geantwortet habe. In meiner Erinnerung habe ich meinen Cappuccino ausgetrunken. Dann ist die Episode Meierhofer beendet.
»Dieser Meierhofer ist mit der Ministerin verwandt?« Ich trete stärker aufs Gas als gewollt und fahre beinahe eine Passantin an, die die Straße überquert. »Auf diese ehrgeizige kleine Kröte habe ich keine Lust«, knurre ich und füge, bevor Rachinger etwas einwenden kann, rasch hinzu: »Hast du in deinem Team auch ein paar Überraschungen? Tanten oder Nichten? Es lebe der Nepotismus.«
Julia schaut mich kurz an, verkneift sich aber die Frage.
Rachinger bleibt ruhig. »Wie alt bist du, Michael? Gehst auf die fünfzig zu, oder? Seit wann kennen wir uns? Ich schätze mal fünfzehn Jahre, wahrscheinlich sind es zwanzig. Vertrauen, mein Lieber, Vertrauen.«
Ich vertraue nicht mal mir selbst. Aber ich halte meinen Mund.
Julia nimmt inzwischen per Handy Infos von Prantl entgegen, der offenbar nur zähneknirschend zustimmt, ihr alles mitzuteilen, was er mir sagen will. Ich kann beim Fahren nicht telefonieren, auch nicht mit Freisprechanlage. Nicht einmal mit Prantl. Das Team trifft sich in zwei Stunden.
»Um 15 Uhr gibt der Polizeipräsident eine Erklärung ab«, wiederholt Julia die telefonische Auskunft. »Er hätte dich gerne dabei.«
Ich verdrehe die Augen. Sie sieht mich kurz an und schenkt mir ein verständnisvolles Lächeln. Ich fange an, sie wirklich zu mögen.
»Was hat der Verkäufer erzählt?«, frage ich, nachdem sie das Gespräch mit Prantl beendet hat. »War die Wohnung abgesperrt? Wie konnte der Täter überhaupt ins Haus gelangen? Wem gehört die Wohnung? Wie konnte man die Leiche unbemerkt dorthin transportieren?«
Meine Fragen prasseln auf sie nieder, aber sie bleibt gelassen. Ich vertreibe Frauen in meiner Umgebung schneller als das Weihwasser den Teufel, aber Julia ist anders. Sie strahlt eine Gelassenheit aus, die ich von mir selbst nicht kenne, eine Ruhe inmitten aller Hektik, die mir guttut. Meine Fragen beantwortet sie präzise und ohne Schnörkel. So erfahre ich, dass die Wohnung, in der wir den ehemaligen Minister gefunden haben, einem der Firmenbosse, denen das Geschäft darunter gehört, als Luxusherberge dient. Im ganzen Gebäude gibt es nur zwei Eigentümer, die Wohnungen vermieten – an eine Klientel, die inkognito bleiben will. Wir werden sie trotzdem behelligen müssen. Da die Wohnung gerade renoviert wird, wimmelt es von Fingerabdrücken, die wir mit den Bauarbeitern abgleichen müssen.
»Wie kam der Tote in die Wohnung?«
»Einfach. Sie war nicht abgesperrt. Während der Umbauarbeiten wurde darauf nicht geachtet. Wer stiehlt in dieser Gegend schon Farbkübel und Stehleitern?«, entgegnet Julia.
Ich zucke mit den Schultern. »Also müssen wir klären, wie der Mörder ins Haus kam.«
Ich würde mich gern weiter mit Julia austauschen, aber ich habe eine andere Aufgabe vor mir. Ich muss einen schweren Gang gehen, den Julia und Rachinger mir nicht abnehmen können. Rachinger nennt mir die Adresse, und eine Minute später parke ich vor der Börse. Ich drücke Julia wortlos die Autoschlüssel in die Hand und steige aus. Ich weiß, dass ich auf Prantl warten sollte, dass es klug wäre, ein Kriseninterventionsteam zu verständigen, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich keine Zeit verlieren darf, dass ich es sofort erledigen muss, allein.
2
Die kleinen Schilder an dem Gründerzeithaus tragen keine Namen, nur goldene Klingelknöpfe verraten, dass hinter den Mauern Menschen leben, nicht wie jedermann, aber wie Windisch. Ich drücke auf den obersten Knopf in der Hoffnung, dass oben auch Penthouse bedeutet. Es dauert einen Augenblick, ehe ich eine raue Frauenstimme durch die Sprechanlage vernehme.
»Ja, bitte? Was kann ich für Sie tun?«
Ich versuche, nicht allzu grimmig in die neben der Klingel angebrachte Kamera zu starren, und halte meinen Dienstausweis vors Gesicht.
»Hier ist Oberstleutnant Winter, Kriminalpolizei. Frau Windisch?«
»Ja, Windisch. Was wollen Sie von uns?«
Sie verwendet den Plural. Aber ich weiß nicht, ob sie damit sich selbst meint oder das Kollektiv ihrer Familie. Immerhin stammt sie aus einem alten Adelsgeschlecht.
»Kann ich kurz raufkommen und Sie sprechen? Es ist wichtig, gnädige Frau.«
Ich könnte mich für das »gnädige Frau« ohrfeigen, aber sie öffnet die Tür ohne Kommentar. Im großzügigen Eingangsbereich gehe ich zum Fahrstuhl, aber natürlich kenne ich den Code nicht, um ihn zum Fahren zu bringen. Also muss ich die Treppe nach oben nehmen. Auf dem Weg zum Penthouse überlege ich, wie ich es ihr sagen soll, aber meine Gedanken fügen sich nicht. Ich denke an die blutgefüllte Tasse. Was will der Mörder damit sagen? Warum dieser Nobelladen? Warum heute?
Constanza Windisch öffnet die Tür, und ich strecke ihr die Hand entgegen. Ich schwitze, aber nicht von der Anstrengung, die Treppen ins fünfte Stockwerk erklommen zu haben, sondern weil es nur wenige Dinge gibt, die ich so sehr hasse, wie einem Angehörigen die Todesnachricht zu überbringen.
Frau Windisch wirkt erstaunlich jung, aparter als auf den zahlreichen Fotos, die in der Regenbogenpresse kursieren. Ihr pechschwarzes Haar ist kurz geschnitten. Sie trägt ein enges helles Kleid, braune Stiefel, eine auffällige Kette mit passenden Ohrringen und ein geschmackloses Armband. Ihre Lippen wirken frisch geschminkt, das Haar ist ein wenig zerzaust, aber nicht zu viel, um nicht unordentlich zu wirken. Sie will souverän erscheinen, aber nicht abgehoben, sexy, aber nicht vulgär, obwohl ich finde, dass es haarscharf an der Grenze ist.
Ich halte ihr noch einmal meinen Dienstausweis hin, woraufhin sie mich wortlos hineinbittet. Wir gehen ein paar Schritte in einen großen Raum, in dem mir zuerst nur eine riesige weiße Sitzgruppe auffällt, die einen schwarzen Tisch umgibt. Dann registriere ich teure Ausstattung in gespielter Einfachheit, eine Bar, die in der Wand verschwindet. Daneben das Gemälde einer riesigen, nackten Maria Lassnig, durch eine Großstadt schreitend, mit festem Schritt wie King Kong und gleichzeitig schwebend, dem Boden entrückt. Rot, orange, blau. Es nimmt mich länger gefangen als der Panoramablick durch die riesige Glasfront. Warum habe ich mein Kunststudium beendet?, frage ich mich nur für eine halbe Sekunde, in der mein Verstand sich verführen und wie so oft ablenken lässt.
Ich warte nicht, bis Constanza Windisch etwas sagt, sondern komme ohne Umschweife zur Sache. Anders kann ich es nicht.
»Ihr Mann ist tot, Frau Windisch. Er wurde ermordet. Es tut mir sehr leid.«
Es gibt Tausende Reaktionen auf diese eine Aussage. Ich kenne sie alle. Wie eine Schauspielerin, die für ein paar Sekunden ihren Text vergessen hat, blickt mir Frau Windisch Hilfe suchend in die Augen, die keinen Trost spenden. Dann wendet sie sich ab und sieht aus dem Fenster, klammert sich an die Aussicht über Wien, fixiert die Universität und die Votivkirche, bevor sie sich wieder zu mir umdreht und meinen Arm ergreift. Ich bin bereit, sie zu stützen, falls sie fällt, und einen Arzt zu rufen. Aber sie fängt sich rasch, sieht mich an und fragt nur: »Wie?«
Ich suche nach einer halbwegs zumutbaren Version, in der das Wort »ausbluten« nicht vorkommt.
»Die genaue Todesursache kennen wir noch nicht. Ihr Mann wurde heute Morgen in einer leeren Wohnung in der Innenstadt tot aufgefunden. Aber unseren Informationen nach wurde er dort nicht ermordet. Der Mörder hat seinen Leichnam dort abgelegt. Mehr kann ich nicht sagen. Ich versichere Ihnen, dass …«
Sie unterbricht mich zu Recht, bevor ich mich in Worthülsen verliere.
»Kann ich zu ihm?«
Ich schüttle nur den Kopf. Sie hält immer noch meinen Arm fest und dreht den Kopf zur Seite, will mir nicht in die Augen sehen. Ich muss ihr Fragen stellen, aber dazu brauche ich Distanz, wenigstens einen Meter Platz zwischen uns. Ich will ihr Zeit lassen, aber sie redet von sich aus.
»Sie haben keine Ahnung, wer das getan hat, nicht wahr? Sagen Sie nicht, dass sie schon eine Spur haben.«
Ich suche nach einem Anschluss, nach Worten, die nicht nach hohlen Phrasen klingen, nach Antworten, die trösten können. Ich habe sie nicht. Also spule ich meine Routinefragen ab. Sie macht keine Anstalten, sich hinzusetzen, also bleibe auch ich stehen.
»Wann haben Sie Ihren Mann zuletzt gesehen, Frau Windisch?«
Sie denkt nach. »Gestern zu Mittag. Wir waren bei Meinl am Graben essen.«
»Und danach?«
»Danach? Danach ist mein Mann in sein Büro in der Singerstraße gegangen. Dorthin hat er sich manchmal zurückgezogen, wenn er in Ruhe arbeiten wollte oder, wie es in letzter Zeit leider oft der Fall war, sich mit seinem Anwalt traf.«
»Hat er dort Mitarbeiter beschäftigt, die ich befragen kann?«
»Eine Mitarbeiterin. Dr. Monika Weyringer.« Sie bittet mich um einen Stift und ein Blatt Papier. Ich reiche ihr mein Notizbuch und sie notiert geistesabwesend eine Nummer auf ein freies Blatt.
»Frau Windisch, wir müssen herausfinden, wo sich Ihr Mann gestern Nachmittag aufgehalten hat, mit wem er sich getroffen hat, Sie wissen …«
Erneut unterbricht sie mich.
»Er notierte all seine Termine in seinem Tablet. Das muss sich in seiner Aktentasche befinden, die er mitgenommen hat. Wie gesagt, wir waren essen. Danach wollte er ins Büro gehen. Es war kalt, und er hat sich einen Pullover angezogen. Dann hat er sich von mir verabschiedet, mit einem Kuss …«
Sie sagt es mit einem Trotz, als hätte ich ihre Ehe infrage gestellt, ihre Beziehung kritisiert. Es arbeitet in ihr.
Mit dem Zeigefinger wischt sie sich eine Träne aus dem Augenwinkel. Sie geht zur Bar, nimmt zwei Gläser und eine Flasche Wodka und schenkt ein. Sie reicht mir ein Glas und nimmt selbst einen tiefen Schluck. Ich widerstehe der Versuchung und stelle das volle Glas an der Bar ab.
»Er hatte keinen Pullover an, als wir ihn gefunden haben«, sage ich, ohne über die mögliche Konsequenz dieser Aussage nachzudenken.
Sie lässt das Glas fallen. Mit einem dumpfen Knall schlägt es auf dem Teppich auf, zerspringt aber nicht.
»Was soll das heißen? War er nackt? Was verschweigen Sie mir?«, schreit sie.
Ihre Unsicherheit, zuvor kaum merklich, ist jetzt zu einer Wand geworden.
»Mit wem hat sich mein Mann getroffen? Was ist an dem Abend geschehen?«
Ich muss sie schnell beruhigen, bevor sie gänzlich die Fassung verliert, rede irgendetwas von Routine und erzähle ihr, wie ihr Mann bekleidet war. Sie schüttelt den Kopf und führt mich ins Ankleidezimmer. Ich zähle zweiundzwanzig Anzüge, davon drei mit grauem Nadelstreif. Sie fährt mit der Hand über jedes einzelne Jackett, verweilt eine Zeit lang bei dem einen oder anderen, lässt, so vermute ich, ihren Erinnerungen freien Lauf, das Leben mit ihrem Mann im Eiltempo Revue passieren. Da ich darauf gefasst bin, dass sie jeden Moment zusammenbricht, überrascht mich ihre nüchterne Klarheit.
»Das sind seine Anzüge. Ich kenne jeden, und es fehlt keiner. Der Anzug, von dem Sie sprechen, ist mir nicht bekannt. Haben Sie ein Foto?«
Ich verspreche, ihr sobald wie möglich eines zu schicken. Dass sie sich irrt und sich einfach nicht an den Anzug erinnert, wäre angesichts der Situation nicht unwahrscheinlich. Die meisten Menschen haben nur eine grobe Ahnung von der Garderobe ihrer Partner, selbst wenn sie das eine oder andere Kleidungsstück vielleicht sogar gemeinsam gekauft haben. Constanza Windisch scheint die Ausnahme zu sein.
Wir gehen zurück ins Wohnzimmer. Noch einmal fällt mein Blick auf das Gemälde von Lassnig, die sich mit Riesenschritten durch die Stadt bewegt. Ich habe eine letzte Frage.
» Frau Windisch, wissen Sie, wo das Auto Ihres Mannes steht?«
»Nein. In die Singerstraße ist er immer zu Fuß gegangen. Wahrscheinlich steht es in der Tiefgarage. Sehen Sie nach. Es ist ein blauer BMW, ein Hybridmodell, das Kennzeichen ist WK1. Das ist auch der Code für den Lift, damit kommen Sie direkt in die Garage.« Ihre Angaben sind präzise, kommen ohne Zögern. Sie hat ihre Selbstkontrolle wieder.
Ich lege ihr meine Visitenkarte auf den Tisch. Als ich gehen will, hält sie mich am Arm fest.
»Sie haben nicht gefragt, ob er Feinde hatte.«
Ich wäre nicht auf die Idee gekommen. Ein Mann wie Windisch war von Feinden umgeben. Sie danach zu fragen wäre sinnlos und müsste ihr in der Situation wie eine Provokation erscheinen. Zu meinem Erstaunen kommt Frau Windisch selbst darauf zu sprechen.
»Sie haben mir diese Geschmacklosigkeit erspart«, sagt sie, bevor ich antworten kann. »Dafür bin ich Ihnen dankbar. Sie sollten aber fragen, ob wir noch Freunde hatten, damit sie auf Ihrer langen Liste von Verdächtigen jemanden ausradieren können. Ich schreibe Ihnen die Namen auf.«
Sie drückt meinen Arm fester und sieht mich mit einem Blick an, der ein wildes Tier das Fürchten lehren würde. Oft überdeckt die Wut die Trauer, bildet eine Schutzschicht, hinter der man ein paar Stunden überleben kann. Manchmal bröckelt sie aber schon nach wenigen Minuten dahin.
Manche würden denken, dass die Liste mit Freunden nur eine sarkastische Bemerkung war, aber ich täusche mich nicht, dass sie es vollkommen ernst gemeint hat. Man könnte meinen, dass ihr das Reden hilft, dass es sie irgendwie am Boden festhält, aber dieser klare und feste Ton in der Stimme lässt es zu mehr werden, zu einem Auftrag, von dem sie erwartet, dass ich ihn umgehend erfülle.
»Mein Mann hat viele sogenannte Freunde verloren, als gegen ihn ermittelt wurde. Politiker, Geschäftsfreunde. In Wirklichkeit wollten ihn alle nur fertigmachen. Eine Hasenjagd haben sie veranstaltet, und das Schlimmste daran war, dass sich Leute unter den Treibern befanden, denen er einmal geholfen hat, die ohne ihn in der Gosse gelandet wären.«
Sie lässt meinen Arm los, geht zur Bar, wo immer noch das Glas mit Wodka steht, das ich nicht getrunken habe. Sie leert es in einem Zug. Als sie sich wieder umdreht, hat sie zu ihrer Contenance zurückgefunden und ist wieder ganz die Frau von Welt.
»Stellen Sie mir eine Liste seiner letzten wirklich guten Freunde zusammen«, bitte ich.
Sie weiß, dass auch ich es ernst meine, und nickt nur stumm.
»Sie sollten Personenschutz beantragen«, sage ich im Gehen, weil ich weiß, dass sie es kategorisch ablehnen wird. Aber Prantl wird mich danach fragen, und dann muss ich nicht lügen. Ja, ich habe es ihr angeboten. Nein, sie hat abgelehnt. Ja, ich habe darauf bestanden, aber …
In der Garage sehe ich mir alle Autos genau an, überlege, wie viele Jahrzehnte ich arbeiten müsste, um mir einen dieser teuren Wagen zu leisten, und entdecke definitiv keinen blauen BMW Hybrid. Wir müssen das Auto finden. Ich rufe Chefinspektor Erwin Berger an, den Leiter einer der drei Mordgruppen. Er ist in meinem Alter und steht seit Jahren hinter mir, auch in schlechten Zeiten. Ich berichte ihm kurz den Stand der Dinge, bitte ihn, die Fahndung nach dem Fahrzeug einzuleiten, und verspreche ihm, bald im Büro zu sein. Eine Weile denke ich über Frau Windischs Reaktion auf den Tod ihres Mannes nach. Sie war beherrscht, und sie versteht es, ihre Gefühle zu kontrollieren. Fast genauso gut wie ihren Hang zu starken Getränken.
3
In ihrem hellen Hosenanzug, der teuren Bluse und den straff nach hinten frisierten brünetten Haaren wirkt die etwa dreißigjährige Dr. Monika Weyringer wie das Klischee einer Businessfrau aus dem Versandhauskatalog. Ich halte mich nicht lange mit Floskeln auf und erkläre ihr die Umstände, doch meine Rücksichtslosigkeit rächt sich. Sie fängt sofort an zu weinen. Ich habe keine Sekunde überlegt, in welcher Beziehung diese Frau zu Windisch gestanden haben mag. Die Begegnung mit Constanza Windisch hat mich durcheinandergebracht, und ich brauche ein paar Minuten, um wieder klar zu denken.
Ich lasse Frau Weyringer Zeit, schenke ihr ein Glas Wasser ein und setze mich zu ihr an einen großen runden Tisch, der aus Holzscheiten und einer Glasplatte besteht. Zweifellos ein sündhaft teures Unikat. Nichtsdestotrotz ist es hässlich.
»Ich kann nicht glauben, dass Dr. Windisch tot sein soll. Ermordet?«
Ich reiche ihr ein Taschentuch, und sie tupft sich die Tränen von den Wangen.
»Es tut mir sehr leid, Frau Dr. Weyringer, aber ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Sie wissen, nur so können wir …«
»… den Täter finden! Ich weiß. Wenn ich irgendwie helfen könnte.«
Ihre Stimme ist lauter geworden, und sie zerknüllt das Taschentuch. Neben der Trauer gibt es etwas wie Wut. Aber worauf?
»Frau Weyringer, erzählen Sie mir, was Ihre Aufgabe hier ist und an was Herr Windisch zuletzt gearbeitet hat.«
Während Monika Weyringer über die Arbeit berichtet, versuche ich, mir Notizen zu machen. Aber ich spüre, dass mir ihre Worte immer wieder entgleiten. Ich verstehe nichts von dieser Art von Geschäften, die sie vor mir ausbreitet wie alte Landkarten entlegener Regionen der Welt. Was ich verstehe ist »Wohnprojekt«, »soziale Integration«, »das Miteinander verschiedener Kulturen«. Das Reden beruhigt sie. Irgendwann unterbreche ich sie.
»Frau Weyringer, ich muss Sie fragen, wann Sie Herrn Windisch das letzte Mal gesehen haben. War das gestern Nachmittag?«
Sie schluchzt. »Gestern? Nein, Herr Dr. Windisch war gestern nicht im Büro.«
Jetzt verstehe ich die Unsicherheit, die ich bei Frau Windisch gespürt habe, als sie über die Pläne ihres Mannes für den Nachmittag sprach. Sie hatte geahnt, dass er nicht im Büro war, dass er etwas anderes vorhatte. Ich frage trotzdem nach.
»Sind Sie sicher? Waren Sie die ganze Zeit hier?«
»Ja, die ganze Zeit. Ich habe mich noch gewundert, dass er nicht erschienen ist. Er hatte sich morgens angekündigt. Und er war immer verlässlich. Ich hätte ahnen müssen, dass ihm etwas passiert ist.«
Sie wirkt verloren, wie eine Pflanze, die man von ihrem warmen Platz im Haus entfernt und draußen in den peitschenden Regen gestellt hat. Unbehaglich spule ich meine üblichen Fragen ab.
»War außer Ihnen noch jemand hier?«
Sie wischt sich erneut die Tränen aus dem Gesicht, bemüht sich, ruhig zu atmen. Dann schüttelt sie den Kopf. »Nur ich. Bis etwa 17 Uhr. Dann ist Herr Dr. Autischer gekommen.«
»Sein Anwalt.« Ich kenne den Mann zur Genüge aus dem Fernsehen.
»Ja. Er wollte mit Herrn Dr. Windisch ein paar Dinge besprechen, ich weiß nicht, ob … also ob ich darüber mit Ihnen reden darf.«
Nicht heute, nicht jetzt. »Das müssen Sie nicht, Frau Weyringer. Wenn es für den Fall relevant ist, werde ich darauf zurückkommen. Haben Sie eine Ahnung, wo Herr Windisch am Nachmittag gewesen sein könnte?«
»Nein, leider nicht. Haben Sie seine Frau gefragt? O Gott, die Arme. Ich habe überhaupt nicht …«
Ihr Mitleid ist gespielt. Selbst ihre Tränen kommen mir jetzt anders vor, eher wie kristallene Stacheln, die sie am liebsten in Constanza Windischs Körper bohren möchte. Die beiden Frauen waren keine Freundinnen.
»Ich war gerade bei ihr«, sage ich, bevor Frau Weyringer noch eine Lüge über ihr gutes Verhältnis zu der Frau ihres Chefs auftischen kann. »Sie hat ihren Mann gestern Mittag zum letzten Mal gesehen.«
»Das verstehe ich nicht.«
Ihr Erstaunen ist echt.
»Herr Dr. Windisch hat immer angerufen, wenn er einen Termin nicht wahrnehmen konnte. Er war ein ausgesprochen korrekter und feiner …«
Sie weint wieder. Ich krame ein weiteres Papiertaschentuch aus meiner Sakkotasche hervor und reiche es ihr, um Routine bemüht.
»Wissen Sie, ob Herr Windisch sein Tablet hiergelassen hat?«
»Nein«, entgegnet sie mit etwas sichererer Stimme. »Sein Tablet hatte er immer bei sich.«
»Wir haben keines gefunden«, sage ich wieder betont geschäftsmäßig. »Arbeitete er hier mit einem Computer?«
»Dr. Windisch arbeitete mit einem Laptop. Wollen Sie ihn mitnehmen?«
Sie führt mich in ein anderes Zimmer. Ich erwarte unzählige Ordner und Bücherwände, aber nur ein Schreibtisch und ein ergonomischer Stuhl in der Mitte des ansonsten leeren Raums zeugen von seiner Funktion. Ich versuche, mir Windisch hier vorzustellen, wie er irgendwelche Zahlen in seinen Laptop tippt, mit seinem Anwalt telefoniert, wie er Monika Weyringer zu sich ruft, ihr Aufträge erteilt und dabei in die Augen blickt, mit einer Mischung aus eitler Unnahbarkeit und extremer Liebesbedürftigkeit, aber ich spüre nur eine trostlose Leere und Einsamkeit. Bevor dieses Gefühl stärker werden kann, macht mich Frau Weyringer auf das Fehlen des Laptops aufmerksam.
»Er hat ihn wohl auch mitgenommen. Das hat er manchmal gemacht, wenn er einen Termin wahrnahm.«
Tablet und Laptop müssen in Händen des Mörders sein, denke ich. Im Unterschied zum Handy hat er sie mitgenommen. Er will uns unsere Arbeit nicht zu leicht machen.
4
Eine Stunde später sitze ich an meinem Schreibtisch, mit einem neuen Hemd, das nicht nach vergossenen Tränen und dem Schweiß meiner Anspannung riecht. Gott sei Dank habe ich immer ein Reservehemd in meinem Büro, für alle Fälle. Vor mir steht eine große Tasse mit dampfendem Kaffee. Sie trägt die Aufschrift »Meine Tasse«. Obwohl sie von meinem Kollegen Berger irgendwann einmal ins Büro mitgebracht wurde, finde ich, dass sie besser zu mir passt. Ich habe ihm eine neue zu Weihnachten geschenkt, mit »Peace on Earth« darauf. Er hat die Botschaft verstanden.
Ich gehe zu Prantl, der sich allerdings gerade angeregt mit der Staatsanwältin, einer Enddreißigerin namens Sandra Roiss, unterhält. Sie schenkt mir ein Lächeln zur Begrüßung, wirkt aber angespannt, wenn auch nicht wirklich nervös. Obwohl sie den Job erst vor Kurzem übernommen hat, hat sie sich einen Ruf als strenge, aber faire und entschlossene Verfahrensleiterin erworben. Nachdem sie sich noch einige Notizen gemacht hat, verabschiedet sie sich mit festem Händedruck von uns, wobei sie einen raschen Erfolg wünscht. Dann machen Prantl und ich uns in den Besprechungsraum auf.
Nach und nach trudeln die Kollegen der Sonderkommission ein. Unsere Mordgruppen sind fast vollständig versammelt, und ich sehe Rachinger, der mir freundlich zunickt. Wir kommunizieren wortlos.
Prantl bleibt stehen, bittet aber alle anderen, sich zu setzen. In solchen Momenten merke ich wieder, wie sehr er das Gegenteil jener nervenzerfressenen Idioten ist, die man aus Krimis kennt. Er hat ein sicheres Auftreten, besitzt Führungsqualitäten, kann Leute motivieren und schreckt sich nicht vor der Presse.
»Erwin«, sagt er und schaut zu Berger, der mit struppigem grauem Haar und Dreitagebart zwanzig Jahre älter und müder aussieht, als er ist, weshalb ihn schon so manche unterschätzt haben, die heute noch in der Justizanstalt Stein einsitzen. »Erwin, erinnerst du dich an den Fall Salzlechner?«
Berger nickt. Manche von den Anwesenden tun es ihm gleich, die meisten anderen erwecken mit zustimmenden Gesten den Anschein, als hätten sie selbst damals den Bericht geschrieben. Nur Julia verzieht keine Miene und lässt sich nicht anmerken, dass ihr der Fall nicht vertraut ist.
»Salzlechner war bereits drei Wochen tot, und wir haben jede nur erdenkliche Spur verfolgt.«
Prantl macht eine kurze Pause, schaut aber diesmal nicht von seinem Zettel auf, den er vorhin sorgfältig auseinandergefaltet und vor sich hingelegt hat. Ich weiß, dass nichts draufsteht, aber das Papier hilft ihm, sich zu konzentrieren. Ich frage mich, wann er sich überlegt hat, mit Salzlechner zu beginnen. Aber ich zwinge mich, nicht den Faden zu verlieren, ehe er überhaupt abgewickelt wird.
»Der Präsident der Industriellenvereinigung, Heinrich Salzlechner, wurde mit einem Fleischerhaken in seiner Garage aufgehängt. Das war im September 2004. Danach schlitzte ihm der Mörder mit einem Skalpell den Bauch auf und entfernte die Eingeweide. Trotz intensivster Bemühungen verliefen damals alle Spuren im Sand, und wir wurden von der Presse gegrillt. Uns als unfähige Truppe zu bezeichnen war dabei noch das Charmanteste. Nur du, Erwin, hast dich mir damals, als ich diesem Vollkoffer vom Kronenblatt eine reinhauen wollte, in den Weg gestellt und gesagt, dass wir die Sau ausweiden werden, noch heute oder morgen. Genau so hast du es auch dem Reporter gesagt. Und er hat dich gefragt, ob er dich zitieren darf. Und du hast ihn gefragt, ob du es ihm aufschreiben sollst. Ich weiß es so genau, weil ich mir damals eine Notiz in mein blaues Heft gemacht habe.«