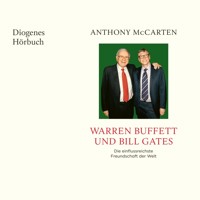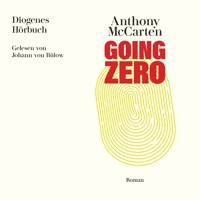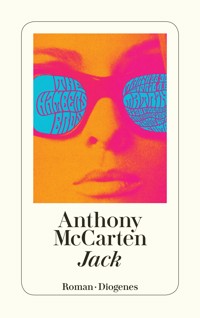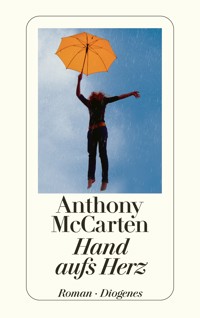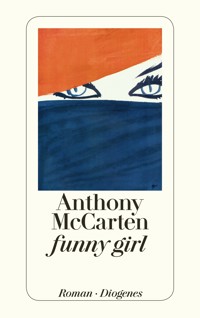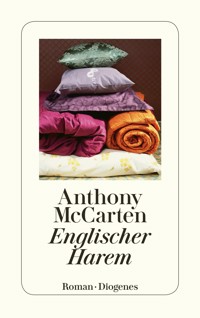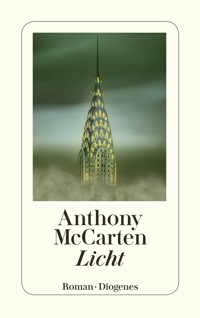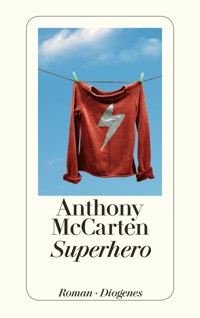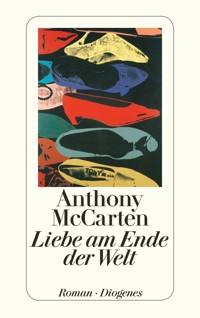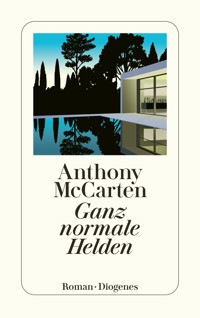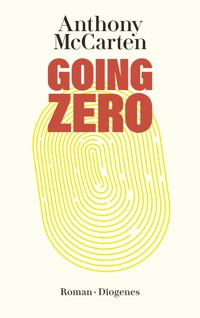
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Hat man als Einzelner überhaupt eine Chance gegen das System? Eine junge Bibliothekarin aus Boston ist entschlossen, es zu versuchen – ihr bleibt keine Wahl. Und so greift sie zu, als sich die Einladung zu einem ungewöhnlichen Kräftemessen bietet: dem Betatest von FUSION, einem Projekt der US-Geheimdienste und des Social-Media-Moguls Cy Baxter. Wem es gelingt, 30 Tage unauffindbar zu bleiben, dem winken 3 Millionen Dollar. Doch Kaitlyn geht es um etwas anderes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Anthony McCarten
Going Zero
Roman
Aus dem Englischen von Manfred Allié und Gabriele Kempf-Allié
Diogenes
Für Jennifer Joel, eine großartige Lektorin.
Und, wie immer, für Eva.
Phase eins
7 Tage vor »GO ZERO«
BOSTON, MASSACHUSETTS
Der bodenlange Spiegel soll den engen Eingangsbereich weiträumiger und heller wirken lassen. Er ist alt und von blinden Flecken überzogen wie von einem Ausschlag. Aber den Bewohnern der Sozialwohnungen – Lehrer, kleine Verwaltungsangestellte, ein Bäcker und ein halbes Dutzend Rentner, die schon dankbar sind, dass die meiste Zeit der Aufzug funktioniert – leistet er gute Dienste. Dank ihm können sie vor dem Verlassen des Gebäudes ein letztes Mal kurz prüfen, ob sich auch kein Rocksaum in den Strümpfen verheddert hat, der Hosenlatz zu ist, keine Zahnpasta am Kinn, das Haar nicht zu wild, kein Klopapier am Schuh, bevor sie auf die Straße stolpern und sich dem Urteil ihrer Mitmenschen stellen.
Auch am Ende des Tages ist er von Nutzen. Wenn die Hausbewohner die Kälte der winddurchfegten Straßen abschütteln, ihre Mäntel aufknöpfen, ihre Briefkästen leeren, dann ist der alte Spiegel der Erste, der ihnen zeigt, welchen Schaden sie im Laufe des Tages genommen haben.
Die Frau, die eben eingetreten ist, betrachtet nachdenklich ihr Bild darin: Mitte dreißig, schwarzes Haar, Pagenschnitt, eine dieser riesigen Brillen, die seit letztem Jahr wieder in Mode sind, eine lange, weit geschnittene Hose, Turnschuhe und unter dem Mantel – einem leichten Übergangsmodell vom Vorjahr – eine akkurat gebügelte schwarze Bluse mit Blumenmuster. Die Frau sieht sehr danach aus, was sie auch ist, nach Bibliothekarin – oder zumindest so, wie die meisten sich eine Bibliothekarin vorstellen. Ein zugeknöpfter Bücherwurm, aber mit einer gewissen Eigenwilligkeit, die sich an ein paar auffälligen Schmuckstücken zeigt: einem großen Anhänger an einer Kette, klimpernden Ohrringen, einem Siegelring am kleinen Finger. Könnte Kirchgängerin sein, Kuchen für den Basar backen, aber auch nach Feierabend bei Frauenprotesten mitmarschieren.
Sie schließt ihren Briefkasten auf, holt eine Handvoll Umschläge heraus, drückt die Briefkastentür zu, bis sie das Schloss einrasten hört, sieht, dass ihr Namensschild ein wenig verrutscht ist, und rückt es gerade.
K. Day. Apartment 10
Ganz bewusst steht dort K. Day. Nicht Kaitlyn. Nur der Anfangsbuchstabe, das muss reichen: Nennen wir es den Alleinlebende-Frauen-Trick Nummer 273. Kommt gleich nach dem, auf dem Heimweg den Schlüssel gezückt in der Hand zu halten. Wer »Miss Kaitlyn Day« auf den Briefkasten oder an die Türklingel schreibt, beschwört Ärger regelrecht herauf. Jeder zufällig vorbeikommende Widerling weiß dann, dass dort eine alleinstehende Frau wohnt, und könnte auf die Idee kommen, herumzulungern, um herauszufinden, ob sie vielleicht gerettet werden muss, belästigt, verfolgt, vergewaltigt, umgebracht.
Sie sortiert ihre Post am Papierkorb. Müll. Müll. Müll. Rechnung. Müll. Rechnung. Und dann: heilige Scheiße. Da ist er. Da ist tatsächlich der Brief.
Auf dem Umschlag steht Department of Homeland Security. Und sogar, ist das zu glauben, mit einem Siegel. Sie hatte gedacht, so etwas hätten zuletzt die Tudors verwendet. Doch drin statt Büttenpapier wie für eine Hochzeitseinladung: mieses Behördenpapier. Aber immerhin eine Einladung.
Fusion-Initiative, Betatest steht oben auf dem einzelnen Blatt. Fett und unterstrichen.
Sehr geehrte Ms. Day,
herzlichen Glückwunsch! Sie wurden als potenzielle Teilnehmerin am »Going Zero«-Betatest der Fusion-Initiative ausgewählt, eines Gemeinschaftsprojekts von WorldShare und der Bundesregierung.
Der »Going Zero«-Betatest beginnt offiziell am 1. Mai um 12 Uhr mittags. Dann erhalten Sie und die neun anderen per Losverfahren ermittelten Kandidat:innen unter der von Ihnen bei Ihrer Bewerbung hinterlegten Nummer eine Textnachricht mit der Anweisung »Go Zero!«.
Um 2 Uhr nachmittags desselben Tages werden Ihr Name, Ihr Foto und Ihre Adresse der Taskforce der Fusion-Initiative in der Fusion-Zentrale in Washington, D.C., übermittelt.
Während der gesamten Laufzeit des Versuches sind Sie berechtigt, im Rahmen der Gesetze der Vereinigten Staaten von Amerika jede Ihnen angemessen erscheinende Maßnahme zu ergreifen, um zu verhindern, dass das von der Fusion-Zentrale ausgeschickte Zugriffsteam Sie aufgreift. Alle Teilnehmer:innen des »Going Zero«-Projekts, die am 31. Mai um 12 Uhr mittags noch auf freiem Fuß sind, erhalten eine steuerfreie Prämie von drei Millionen US-Dollar.
Wir danken Ihnen für Ihr patriotisches Engagement und für Ihren wichtigen Beitrag zur Sicherheit unseres Landes.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Ihnen unter Androhung der Disqualifikation nicht gestattet ist, Ihre Teilnahme am »Going Zero«-Betatest vor dessen Abschluss und ohne unsere schriftliche Einwilligung publik zu machen. Beachten Sie in diesem Zusammenhang die Geheimhaltungsklausel in Ihren Bewerbungsunterlagen sowie die Ausführungen zu Ihrer juristischen Verantwortbarkeit sowie möglichen Strafen.
Kaitlyn sieht auf und betrachtet noch einmal ihr Spiegelbild. Eine ganz gewöhnliche Frau, eine wie Dutzende andere. Aber in den nächsten fünf Wochen muss sie außergewöhnlich sein.
Bist du bereit, perfekt zu sein, Kaitlyn Day?, fragt sie das Bild, das ihr entgegenblickt. Denn genau das muss sie jetzt sein.
Ihr Spiegelbild verrät nichts.
Geh nach oben, sagt sie sich. Geh alles noch einmal durch. Wenn die Anweisung »Go Zero« kommt, dann muss sie im nächsten Augenblick untergetaucht sein. Einfach verschwunden. Fort.
Wo gibt es denn so was? Na ja, es kommt vor. Verdammt, das weiß sie besser als die meisten anderen. Leute können einfach so weg sein, puff.
Sie muss sich ausruhen. Wer weiß, wann sie das nächste Mal ruhig und in ihrem eigenen Bett schlafen kann. Noch eine ganze Minute verharrt das Bild im Spiegel reglos, während sie sich ausmalt, was nun kommen mag. Dann setzt es sich in Bewegung.
7 Tage später: 20 Minuten vor »GO ZERO«
FUSION-ZENTRALE, WASHINGTON, D.C.
Am 1. Mai um zwanzig vor zwölf wird Justin Amari, Wuschelkopf, mit noch leerem Magen, vor der Fusion-Zentrale am McPherson Square von einem Begrüßungskomitee in Empfang genommen. Der Gebäudekomplex war im Vorjahr in Windeseile hochgezogen worden, nach einer kryptischen Pressemeldung: »Silicon-Valley-Milliardär Cy Baxter kauft Grundstück in der City, wo er mehr Zeit zu verbringen gedenkt. Was hat er vor?«
Unter den Anwesenden entdeckt Justin Erika Coogan, die rechte Hand des Chefs, beinahe ebenso berühmt wie er, Mitbegründerin der Fusion-Muttergesellschaft WorldShare und das subtilere Pendant zu Cy.
»Nervös?«, fragt Justin.
Erika ist so überrascht von der Frage, dass sie grinst.
»Ich glaube an Cy und an das, was wir hier tun«, sagt sie. Ihre Stimme ist tief, eine Spur Texas in den Vokalen. »Aber heute, klar … das ist eine große Sache. Riesig.«
Zusammen mit anderen VIPs führt sie ihn durch die Empfangshalle, ganz Glas und Stahl, durch zwei Hochsicherheitsschleusen, dann sind sie in der innersten Sicherheitszone, der Kein-noch-so-kleiner-Nanosensor-an-deinen-Schuhen-kein-Smartphone-kein-Laptop-kein-Fitnesstracker-kein-Aufnahmegerät-im-Kugelschreiber-Zone. Dem von einem Gewusel von Fusion-Teams bevölkerten Nervenzentrum. Dem Allerheiligsten.
Die Dimensionen versetzen ihm noch immer einen Schock. Da läuft es einem kalt den Rücken herunter. Ein riesiger Saal voller Bildschirme, dazwischen lange Schreibtischreihen, an denen die Cleversten der Cleveren sitzen, Ingenieure, Kybernetiker, Geheimdienstler, Programmierer, Hacker, dazu ganze Armeen von Datenanalytikern aus öffentlichem Dienst und Privatwirtschaft, das Fußvolk im Fusion-Heer. Und darüber, auf einer Art Kommandobrücke, die eines Captain Kirk würdig wäre, steht Cy Baxter, geradezu vibrierend vor Erregung und Stolz, und blickt herab auf sein gewaltiges Werk.
Eigentlich sollte ich aufgeregt sein, denkt sich Justin. Schließlich riskiert er hier seinen Arsch.
Sämtliche Bildschirme – auf jedem der Tische, die der Tablets und Smartphones, selbst die riesigen an der hinteren Wand – sind schwarz, sie schlafen. Sie warten … warten … warten darauf, dass man sie weckt.
Justin schaut auf die Uhr. Noch fünfzehn Minuten neunundfünfzig Sekunden bis zum Start … achtundfünfzig … siebenundfünfzig …
Auf ein Zeichen von oben geht er zur Empore, zu Cy, heute in Anzug und Krawatte statt der üblichen Uniform aus Sneakers, schlabbrigen Jeans und T-Shirt mit austauschbar coolem Spruch à la WHYTHEFUCKNOT?.
Neben Cy steht Justins Chef, Dr. Burt Walker, Leiter der Abteilung Wissenschaft und Technologie bei der CIA. Beide mit Gesichtern, als hätten sie gerade die Weltformel entdeckt. Ebenfalls dabei, aber nicht ganz so zufrieden, nicht so überzeugt, dass das alles so eine großartige Idee ist, ist Walkers Vorgängerin bei der CIA (und neuerdings Chefin eines Start-ups im Bereich Risikoanalyse), Dr. Sandra Cliffe.
Walker, findet Justin, sieht aus, als hielte er Ausschau nach dem Band, das er gleich durchschneiden soll. Aber da bist du wohl in die falsche Zeit geraten, Burt, denkt Justin. Hier gibt es keine Eröffnungszeremonie. Den Startschuss zu diesem so bedeutsamen Betatest wird, wenig spektakulär, nur ein kleiner Mausklick geben, der den zehn ausgewählten Kandidaten des geheimen Testlaufs die Nachricht »Go Zero« sendet, die Aufforderung, sich unsichtbar zu machen, vom Radar zu verschwinden. Von da an werden sie alles daransetzen, keinerlei Spuren zu hinterlassen. Aber leicht wird das nicht: Cy Baxter und seine Cyberdetektive hier in der Fusion-Zentrale haben Mittel, sie aufzuspüren, wie sie noch nie jemand vor ihnen hatte.
Jeder der zehn Teilnehmenden – oder »Zeros«, wie das Team sie nennt – bekommt zwei Stunden Zeit, und keine Sekunde mehr, um sich einen Vorsprung zu verschaffen, seinen Plan, wie auch immer der aussehen mag, in die Tat umzusetzen, dann beginnt die Jagd.
»Ich möchte noch schnell ein paar Worte sagen, bevor es losgeht«, ertönt Cys verstärkte, feierliche Stimme – trotz seiner 45 Jahre wirkt er jungenhaft, elastisch, als wolle er gleich lossprinten. »Vorab vielen Dank an unsere Freunde von der CIA für diese wirklich historische Zusammenarbeit: ein Meilenstein der öffentlich-privaten Partnerschaft.« Sein Blick wandert an Justin vorbei und heftet sich auf Dr. Walker und Dr. Cliffe, die er beide mit einem bedeutungsvollen Nicken bedenkt. »Dann danke ich natürlich unseren Investoren für das Vertrauen, das sie uns entgegenbringen, einige davon sind heute hier.« Ein Nicken in Richtung der Anzug- und Kostümträger in der vorderen Publikumsreihe. »Aber mein größter Dank am heutigen Tag gilt euch allen hier vom Fusion-Team, für euren Einfallsreichtum und eure unermüdliche harte Arbeit.«
Das Fusion-Personal applaudiert. Es sind allesamt Experten auf ihren Arbeitsgebieten, ausgestattet mit einem gewaltigen technischen Arsenal und umfassenden rechtlichen Befugnissen; hier im HQ sind es fast tausend Leute, und dazu kommen noch Tausende Polizeikräfte draußen sowie spezielle Zugriffsteams, die an strategischen Punkten übers ganze Land verteilt bereitstehen. Cy Baxter hat jedem einzelnen Mitarbeiter eingeschärft, dass die Schnelligkeit ihrer Erfolge ebenso zu bestaunen sein soll wie die Mittel, mit denen sie sie erringen.
»Das ist für uns hier eine große Sache. Die nächsten dreißig Tage entscheiden darüber, ob die CIA einen Zehnjahresvertrag mit uns abschließt und Mittel bereitstellt, um den Informationsreichtum der CIA mit der Findigkeit des freien Marktes zusammenzuführen.« Er hält inne, wägt seine nächsten Worte sorgfältig ab. »Ihr seid eine handverlesene Truppe. Alles, was ihr hier seht … das alles …« – mit einer Bewegung schließt er den ganzen Saal ein, die drei unterirdischen Stockwerke voller summender Server in ihren klimatisierten Schränken, die 932 Angestellten (der Hintergrund jedes einzelnen bis ins kleinste von der CIAüberprüft), die an den Computertischen sitzen, in den Virtual-Reality-Suites, an den Kommandoplätzen für die Drohnen, in Forschungslabor, Kantine und Verwaltung –, »das alles ist keinen Cent mehr wert, wenn wir scheitern. Für mich persönlich ist dieses Projekt das wichtigste in meinem Leben. Punkt.«
Das wird mit Applaus aufgenommen.
»Als man zuerst mit der Frage an mich herangetreten ist, ob ich mir eine Public-Private-Partnership vorstellen könnte, durch die das Sicherheitsniveau unseres Staates, die Möglichkeiten der Überwachung, auf eine vollkommen neue Ebene gehoben würde, eine, wie es sie bisher noch nicht gegeben hat, da habe ich den stellvertretenden Direktor hier angesehen … und Dr. Cliffe, die sich vielleicht noch an meine Reaktion erinnert … ich glaube, ich habe so etwas gesagt wie … ja, so was wie … ›Ihr wollt mich wohl verarschen!‹«
Gelächter aufs Stichwort.
»Aber andererseits – ich stelle mir vor, Orville Wright muss ja etwas ganz Ähnliches zu seinem Bruder gesagt haben, nicht wahr? Oder Oppenheimer, als er eine Bombe bauen sollte, oder Isaac Newton, als sie von ihm wissen wollten, wo oben und unten ist.«
Weiteres Gelächter.
Er grinst, ein überraschend gewinnendes Lächeln. »Aber man weiß erst, dass man’s kann, wenn man’s kann. Stimmt’s? Erst ›auf keinen Fall‹, dann ›ja natürlich‹. Aber auch mit noch so viel Selbstvertrauen und all der harten Arbeit, die alle hier im Raum schon in die Sache gesteckt haben, wissen wir immer noch nicht, nicht zu hundert Prozent, ob wir’s können. Deshalb dieser Betatest. Wir stecken jetzt die Lunte an, und dann schauen wir, was daraus wird.«
Ausgiebiger Applaus. Cy liebt diese Leute, und sie lieben ihn ebenso, und das mit gutem Grund.
Justins Blick bleibt auf Cy geheftet. Wie reich ist dieser Mann denn nun?, überlegt er. Genau weiß das keiner. Eigentlich weiß man so gut wie nichts über ihn. Keine Details. Von wo genau stammt er? Selbst das ist unklar. Cy sagt, er komme aus Chicago, aber eine Geburtsurkunde hat nie jemand gesehen, und so bleibt das Gerücht, dass seine slowakische Mutter ihn, ihr einziges Kind, mit sieben Jahren in die Vereinigten Staaten gebracht hat. Aber erst seit Kurzem, nachdem Ravensburger ein tausendteiliges Puzzle von ihm auf den Markt gebracht hat – Cy mit verschränkten Armen vor einer Rakete von Bezos, startklar, um WorldShare-Überwachungssatelliten ins All zu bringen –, haben die Leute endlich die Möglichkeit, mit flinkem Finger und forschendem Blick das zu schaffen, was bisher eine rein geistige Herausforderung war: sich ein klares Bild von dem Mann zu machen.
Justin hat ihn aus der Ferne studiert, die Fakten zusammengetragen. Porträts in den Illustrierten, eins schmeichelhafter als das andere, beschreiben einen Spätentwickler, einen, der lange gebraucht hat, den Umgang mit Messer und Gabel zu lernen, und der schon einmal ein Fremdwort falsch betont. Andererseits IQ 168. Ein einsames Kind, das typische Mobbingopfer, beinahe gut aussehend, auch wenn seine kleinen Augen ein bisschen schief stehen, Ellenbogen und Schienbeine voller Ausschlag. Hatte sich früh mit Computern beschäftigt, dann war er auf der Hightech-Welle geritten. Mit sechsundzwanzig war aus dem Start-up in der Garage eine Firma mit zwölf Milliarden Marktwert geworden, und da ging es erst richtig los. Angefangen hatte er mit neuartiger Technik, sozialen Netzwerken. Aus WorldShare, der netten kleinen Plattform für Informationsaustausch – »Machen wir was zusammen?« – »Klar, warum nicht?« –, hat er ein weltweites Ökosystem der Freundschaft gemacht, und von da an verzweigte sich die Firma in Windeseile weiter, in alle Richtungen, er steckte die Profite in immer riskantere Unternehmungen, wie andere auf schnelle Windhunde wetten.
Die Wall Street verliebte sich auf den ersten Blick in diesen Tausendsassa, der in die Zukunft schaute, sie pumpte Geld in alles, was er sich ausdachte: Cybersicherheit, Überwachungskameras, Alarmanlagen, Sicherheit im öffentlichen Raum, ja sogar Nachrichtensatelliten. Nach einem Jahrzehnt war er reich wie Midas, aber er prahlte nie damit (keine Pressefotos von der Paris Fashion Week, keine Freunde in Hollywood, keine Riesenjacht und kein Privatjet); in aller Stille, ohne unpassende Publicity, stieg er in großem Stil in alles ein, was grün, gesund und ökologisch war, am Ende auch in die interplanetare Zukunft. Heute gibt er Geld für die Erforschung von Solarantrieben, für langlebigere Batterien, transparente Kryptowährungen der US-Notenbank, und dann setzt er sich auch für eine neue Generation von Kernreaktoren ein, mit denen sich endlich das fossile Zeitalter beenden lässt. Das, was die Leute an Cy so mögen, das, weswegen sie ihn so sympathisch finden, über seine Intelligenz hinaus und trotz seines Reichtums, ist die Art, wie er allem Anschein nach tatsächlich das Beste aus dem machen will, was er ist und was er besitzt, wie er wirklich etwas Gutes tun will für die Welt, wo er doch ebenso gut surfen gehen könnte. Oder mit einer Rakete ins Weltall fliegen.
Und er ist auch nicht einfach nur ein Workaholic, sondern lässt sich Zeit für sein Privatleben: spielt Bassgitarre in einer vierköpfigen Indie-Combo, schwitzt zweimal die Woche auf dem städtischen Tennisplatz von Palo Alto, seinem Wohnsitz. Es gab nie eine andere Liebesgeschichte als die mit Erika Coogan. Men’s Health verriet er, dass er sein dringend benötigtes geistiges Gleichgewicht beim Meditieren findet. Stundenlang verharrt er in der Lotusstellung, und im Unterarmstütz bringt er es auf eine gute Viertelstunde. (Als das in den Medien angezweifelt wurde, antwortete er mit einem dreiundzwanzigminütigen Livestream.) Am Ende ist er zur Kultfigur avanciert: Herz und Hirn mit Schwung und Mumm.
Schon eine Leistung, gibt Justin zu, wenn ein Milliardär in einer Zeit von Missgunst und Gehässigkeit so viel erreichen und erschaffen kann und sich dafür so wenig Verachtung einhandelt. Nur ein weiterer Beweis – zu dem Schluss ist er gezwungen –, dass es sich auszahlt, und zwar reichlich, wenn jemand alles, was er tut, was auch immer es sein mag, tief, sehr tief, unter dem Radar hält.
18 Minuten vor »GO ZERO«
MARLBOROUGH STREET 89, WOHNUNG VON KAITLYN DAY, BOSTON, MASSACHUSETTS
Ist die Uhr stehen geblieben? Die Zeit kriecht dahin, dann kommt sie zum Erliegen, und gerade als Kaitlyn sicher ist, dass da etwas nicht stimmt, dass da eine Falte im Gewebe der Zeit ist, tickt der Sekundenzeiger doch wieder einen Schritt voran. Sie hat sich in der Bostoner Wohnung am Sofaende zusammengerollt, mit einer Decke über den Knien und einem Buch in der Hand. Dass sie zu dem Buch gegriffen hat, das lange unbeachtet auf dem überladenen Couchtisch gelegen hatte, auf dem sich Zeitschriften (Atlantic, New York Review of Books, New Yorker) stapeln wie Bodenschichten nach einem Erdbeben, hat sie gar nicht bemerkt.
Sie liest auch nicht darin – sie ist im Zwiegespräch mit sich selbst. Das ist eine dumme Idee, das ist eine tolle Idee, das ist verrückt. Ihre beste Chance, ihre letzte Chance. Alles geht hin und her wie Wellen, brandet an, zieht sich wieder zurück.
Vergiss dies. Denk an das. Die Gedanken überfluten sie, so viele, dass sie keinen einzelnen davon festhalten kann.
Rucksack
Schlafsack
Wanderstiefel
6 T-Shirts
1 Reservejeans
Anna Karenina
Atmen, Mädchen, sagt sie sich. Ruhig atmen. Nicht vergessen, wer du bist. Ich bin Kaitlyn Day, flüstert sie wie ein Mantra. Fast 33 Jahre alt, Geburtstag 21. September, Sozialversicherungsnummer 029-12-2325. Die vertrauten Fakten sind wie Balsam, eine Salbe, eine Gebetsmühle, eine Leine, an der sie sich festhalten kann, und sie spürt, wie die Luft wieder in ihre Lunge strömt, der Sauerstoff in ihr Blut.
Landkarten
kleines Zelt
Gaskocher
Kochtopf
Atemschutzmaske
Handy K
Handy J
Kompass
Konserven
Besteck
Studentenfutter
Dosenöffner
Tampons
Seife
Zahnpasta
Taschenlampe
Batterien
Wasserflasche
Kaitlyn Elizabeth Day. Geboren und aufgewachsen in Boston. Die Eltern leben nicht mehr. Zwei Brüder – aber mit beiden hat sie nicht viel Kontakt. Sie verstehen sie nicht. Sie mögen Sport, Kaitlyn mag Bücher. Die beiden arbeiten auf dem Bau, sie ist Bibliothekarin. Ihre Brüder schwenken die Fahne und brüllen den Fernseher an, sie schreibt an Senatoren. Die Brüder haben keine Fantasie, sie hat zu viel davon. Genau genommen ganz entschieden zu viel. Manchmal stopft sie ihr Gehirn dermaßen voll, dass es Amok läuft, und dann muss es mit kleinen weißen Pillen beschwichtigt werden. Aber heute hat sie einen Plan. Und der Plan muss klappen. Er muss klappen. Aber es wird auch ein Spaß, sagt sie sich. Und ganz schön gefährlich.
2 Minuten vor »GO ZERO«
FUSION-ZENTRALE, WASHINGTON, D.C.
»Lassen Sie mich zum Abschluss noch eines sagen. Ein letzter Gedanke noch.« Cy Baxter hält inne, lässt den Blick über sein Publikum schweifen. Wie gut er das macht, geht Justin durch den Kopf. So viel Selbstbeherrschung. Ein bisschen linkisch, aber gerade das macht es liebenswert, man spürt noch die Jugend ohne Freunde, die Nase, die er dauernd nur in Programmierbücher gesteckt hat, ohne auf das Gekreisch vom Spielplatz in der Ferne zu achten, und später, da hatte er schon hunderttausend auf dem Konto, aber kein Mädchen, das mit ihm auf den Abschlussball wollte.
»Es geht heute nicht nur darum, die Machbarkeit eines Konzepts zu beweisen, auch nicht darum« – ein Nicken zur Seite zu den zwei Vertretern der CIA, die das Podium mit ihm teilen –, »unseren Partnern bei der CIA zu zeigen, was wir erreichen können, wenn wir am selben Strang ziehen und unsere Ressourcen gemeinsam nutzen … auch wenn wir das zeigen können und es auch zeigen werden. Aber was wir heute vor allem feiern wollen, ist diese Partnerschaft, deren Aufbau Jahre gedauert hat. Zum ersten Mal bringen wir die gebündelten Ressourcen von Polizei-, Militär- und Sicherheitskräften – NSA, CIA, FBI und dem militärischen Geheimdienst – mit denen der Hacker und der sozialen Netzwerke zusammen. Koordiniert von den brillanten Köpfen meiner Leute von WorldShare.«
Leichter Applaus von der Industrieseite.
»Hier haben wir sie alle versammelt, die Leute, die hinter Fusion stehen! Gemeinsam werden wir mithilfe allerneuster Technologien eine 360-Grad-Datenbank aufbauen, wie die Welt sie noch nicht gesehen hat. Verdammt cool, was?« Wieder ein Blick in Richtung Geldgeber von der CIA, mit dem freundlich-kollegialen Grinsen, das noch einmal versichert, wie unglaublich glatt das alles bisher gegangen ist. »Unser Ziel ist also letzten Endes etwas geradezu lächerlich Einfaches: Wir machen das Leben für die bösen Buben ein gutes Stück schwerer und für die netten Jungs ein gutes Stück leichter, und wir tun das mit dem Besten, was wir an Technik zur Verfügung haben. Natürlich ist uns die Privatsphäre wichtig. Die Hälfte unserer Arbeit hier bei WorldShare besteht ja darin, die Privatsphäre unserer Kunden zu schützen. Aber wenn Sie nichts Unrechtes getan haben, und das trifft doch auf neunundneunzig Prozent von uns zu, dann werden Sie doch auch bereit sein, ein klein wenig von diesem hochheiligen Recht zu opfern, wenn Sie dafür mehr Sicherheit, mehr Frieden, mehr Recht und Ordnung bekommen. Ich will Ihnen sagen, wem der Schutz ihrer Privatsphäre am meisten am Herzen liegt: den Bösewichten. Die brauchen ihn, weil sie sich dahinter verstecken. Der 11. September hat uns gezwungen, noch einmal grundsätzlich über das empfindliche Gleichgewicht zwischen der Sicherheit des Einzelnen und der Sicherheit des Ganzen nachzudenken. Damals hatten wir alles an Daten, was wir gebraucht hätten, um diese Katastrophe zu verhindern, aber uns fehlten der Wille und die technischen Mittel, das Verbindende zwischen diesen Daten zu finden. Am heutigen Tag, hier in diesem Gebäude, da bringen wir Willen und Wissen zusammen wie niemals zuvor.« Und wie ein Wahlredner schließt er mit etwas ein klein wenig Unerwartetem: »Gott segne Amerika und unsere Truppen! Und jetzt … geht’s los.«
Damit weist er auf das digital erzeugte Bild einer großen analogen Uhr, das jetzt auf die Wand hinter ihm projiziert wird, gleich zwölf Uhr mittags, weist auf den Sekundenzeiger, wie er sich Stückchen für Stückchen aufwärts bewegt, und dann sind, klack, Sekunden-, Minuten- und Stundenzeiger vereint.
Um Punkt 12 ruft Cy laut und vernehmlich das Kommando für den Start: »Go Zero!« Im selben Augenblick wird aus den Tiefen des Gebäudes mit einem einzigen Mausklick an zehn Mobiltelefone in ganz Amerika eine Nachricht geschickt, eine Botschaft, deren zwei Wörter sich beinahe reimen. Die, die sich verstecken sollen, haben jetzt zwei Stunden, bevor die, die sie finden sollen, mit ihrer Suche beginnen.
Stunde null
MARLBOROUGH STREET89, WOHNUNG VON KAITLYN DAY,
BOSTON, MASSACHUSETTS
Brrrrrrrrrrrr, Brrrrrrr, Brrrrrrr.
Beim Hechtsprung nach ihrem Handy stößt sie es zu Boden, und es rutscht unter das Sofa, wo eine verstaubte, unausgelöste Mausefalle straff gespannt auf Besuch wartet. Fast hätte sie ihre tastenden Finger geschnappt, aber die stoßen das Ding weg und bekommen stattdessen das vibrierende Telefon zu fassen. Mit zitterndem Daumen öffnet sie die Meldung. Liest …
GO ZERO
Sofort dreht sie das Telefon um, nimmt den Akku heraus.
Showtime.
Sieben Minuten später ist sie auf der Straße, schwimmt im Strom der Menschenmassen. Jetzt muss sie schnell sein. Nur zwei Stunden, um sich unsichtbar zu machen. Ihre Gesichtszüge sind unter einer Baseballkappe der Boston Red Sox versteckt, einer großen Sonnenbrille und einem Mundschutz aus Viruszeiten. Sie hat ihre Hausaufgaben gemacht, sie weiß alles über Gesichtserkennungsprogramme und wie man sie überlistet. Sie trägt so viele Kleidungsstücke übereinander, dass sie aussieht, als sei sie kräftig gebaut. Damit kann sie alles und jeden täuschen, der Ausschau nach einer zierlichen Bibliothekarin hält.
Auch darüber, wie Leute an ihrem Gang erkannt werden, hat sie sich schlaugemacht. Sie weiß, dass es nicht genügt, einfach nur anders zu gehen, als sie sonst geht, es muss ein glaubwürdiger Gang sein, sonst reagieren die Computer sofort. Nicht einfach irgendwie gehen, sondern konsequent so gehen wie eine andere, eine neue Persönlichkeit schaffen mit einem eigenen Gang, einer unverwechselbaren Haltung, die sie einnehmen kann – das ist es, was sie jetzt versucht, und es erfordert all ihre Konzentration. In dieser ersten Stunde darf nicht irgendwo bei einem Computer ein Alarmglöckchen klingeln, das auf einer Bostoner Straße eine auffällige Frau meldet, die geht wie drei verschiedene Personen, kein System darf daraus schließen, dass sie nur betrunken sein kann – oder ihm etwas vorspielen will. Sie muss also konsequent beim Gang einer einzelnen erfundenen Person bleiben, Ms. X, ungefähr in ihrem Alter, aber mit mehr Selbstvertrauen, glücklicher, nicht so kraftlos, die Schritte ein wenig elastischer, mehr Schwung in den Hüften. Als Ms. X schreitet sie also nun die Straße hinunter, aber sie merkt bald, dass so etwas leichter gesagt ist, als getan, jetzt wo sie das Bein schlenkert, den freien Arm schwingt, das Kreuz durchdrückt, die Füße aufsetzt wie ein Model auf dem Laufsteg; jetzt spürt sie, wie anstrengend eine solche Verstellung ist.
Was macht sie überhaupt hier? Bei diesem großen Räuber-und-Gendarm-Spiel? Kaitlyn ist Bibliothekarin. Ja liebe Güte, eine Bibliothekarin, über die schon in zwei Stunden die anderen mehr wissen werden als sie selbst, viel mehr. Gewohnheiten, Verhaltensmuster, von denen sie nicht einmal etwas ahnt. Blutgruppe: Wer kennt schon seine eigene Blutgruppe. Sternzeichen: Ja, Jungfrau, okay. Beziehungen (da werden sie nicht viel finden). Kontonummer, Kontostand (nicht der Rede wert), Kinder (0, das haben sie schnell heraus). Geistige Gesundheit (labil, Daten verfügbar). Scheiße, denkt sie, als ihre Knie beim Gehen aneinanderstoßen. Geh weiter, Ms. X. Bleib in deiner Rolle. Und PS: Geh schneller.
Zeitfenster für Zugriff: noch 29 Tage 22 Stunden 21 Minuten
FUSION-ZENTRALE, WASHINGTON, D.C.
Eine Stunde 39 Minuten nach dem Startschuss sind die Fusion-Teams auf ihren Posten, warten vor ihren noch dunklen Bildschirmen, halten sich strikt an die Order, nicht einmal auf die Leertaste zu tippen, bevor die vorgeschriebenen zwei Stunden verstrichen sind. Nur noch einundzwanzig Minuten bis zur größten, wichtigsten Herausforderung ihres Berufslebens. Tick, tick, tick …
Zu den Wartenden gehört Dr. Sandra Cliffe. Mit ihren achtundsechzig Jahren ist sie eine sturmerprobte Steuerfrau. Hat viel erlebt und vielen Gegnern getrotzt. Damals in den Neunzigern war sie die Erste gewesen, die die CIA mit Erfolg zu Partnerschaften mit der Privatwirtschaft animiert hatte. Sie hatte damals vorgeschlagen, Technologien schon im Entwicklungsstadium von den großen Firmen zu beziehen. Reihenweise hatte sie Auszeichnungen dafür bekommen – CIA Director’s Award, Defense Intelligence Agency Director’s Award, CIA Distinguished Intelligence Medal, National Reconnaissance Officer’s Award for Distinguished Service, National Security Agency Distinguished Service Medal. Im Jahr 2005 hatte sie ihren Posten aufgegeben, zufrieden mit dem Erreichten. Danach verschmähte sie fast ein Jahrzehnt lang alle öffentlichen Ämter, bis der neue (aufgeschlossenere) Präsident sie 2014 zum Mitglied des Nationalen Wissenschaftsrats ernannte. Unter dem nächsten (feindseligeren) Präsidenten wurde ihre Arbeit erschwert, aber dessen (aufgeschlossenerer) Nachfolger berief sie erneut, und so ist sie heute kraft ihres Amtes herbeordert worden, um im Auftrag des Präsidenten ein Auge auf das Fusion-Projekt im Allgemeinen und ihren (von George W. Bush ernannten) Nachfolger bei der CIA, Dr. Bertram »Burt« Walker, im Besonderen zu haben.
Sandra Cliffe plagt eine große Sorge: Als sie seinerzeit die CIA zur Zusammenarbeit mit dem sich rasend schnell entwickelnden Privatsektor ermunterte, stand außer Frage, dass Eigentümer und Betreiber der dabei erworbenen Technologien die CIA sein würde, ein anderer Nachrichtendienst und/oder sonstige Regierungsbehörden. Es war ausdrücklich nicht vorgesehen, dass irgendein Unternehmer, der kein öffentliches Amt bekleidete und niemandem außer seinen Aktionären Treue geschworen hatte, Miteigentümer oder gar alleiniger Betreiber werden würde. Deswegen misstraut sie diesem Projekt und wird keine Träne vergießen, wenn es bei dem Betatest auf seine entschieden zu teure Nase fällt.
Sie blickt hinüber zu Burt Walker und sieht ihn lächeln; fasziniert von so vielen flackernden Leuchtanzeigen und Computerbildschirmen voller Daten wirkt er um vieles glücklicher als sie.
Fusion ist Burts Baby. Ein Mann von fünfundfünfzig. Hemd schief zugeknöpft, Zehndollarkrawatte. Rot im Gesicht, als hätte man ihm im Barbershop eben erst das heiße Tuch abgenommen. Fusion ist mit Abstand Burts größtes Projekt seit seiner Berufung zum CIA-Abteilungsleiter; sein Versuch, für die CIA in den 2020ern das zu schaffen, was Dr. Cliffe drei Jahrzehnte zuvor so elegant und erfolgreich gelungen war, nämlich die CIA zu modernisieren. Da der CIA Operationen auf US-amerikanischem Boden weitestgehend untersagt sind, es sei denn, sie richten sich gegen Bedrohungen aus dem Ausland, sieht Burt in Fusion, und in Cy Baxter, eine Möglichkeit, in aller Stille das inländische Aktionsfeld der Agency zu erweitern, ohne dass deswegen in Washington eine große Diskussion darüber in Gang kommt, ob sie damit ihre Befugnisse überschreitet – was Jahre und unzählige Komiteesitzungen kosten würde.
Mit anderen Worten, Fusion kann für die CIA ganz diskret das erledigen, was die CIA nicht offen tun kann.
Der klammheimliche Deal, auf den er sich mit Baxters Fusion-Projekt eingelassen hat, ist ebenso einfach wie riskant: Ist dieser Betaversuch erfolgreich, bindet sich Fusion in einem jährlich fortgeschriebenen Chartervertrag an die CIA, die das Projekt im Gegenzug von da an komplett finanziert, mit rund neun Milliarden Dollar jährlich, und das für die nächsten zehn Jahre. Im Rahmen dieser geheimen Vereinbarung bekommt Fusion Zugang zu sämtlichen relevanten Daten des zentralen US-Geheimdiensts, mit strengen Vorgaben hinsichtlich ihrer Verwendung. Im Gegenzug erhält die CIA unbegrenzten (verdeckten) Zugriff auf Fusions gewaltige Datenbank mit persönlichen Informationen über jeden, der jemals auf einem seiner Geräte WorldShare installiert hat: derzeit über zwei Milliarden Menschen. Zusätzlich stellt Fusion der CIA seine hervorragenden Techniker rund um den Globus zur Verfügung, dazu fortschrittlichste Überwachungstechnologie, sowohl boden- als auch – in Gestalt von WorldShares um die Erde kreisenden Satelliten – weltraumgestützt. Diesen Deal – dessen Details dem Kongress wohlweislich vorenthalten wurden – hat Burt seinen Vorgesetzten und dem Pentagon mit dem Argument verkauft, die Regierung stehe vor einer entscheidenden Wahl: entweder jetzt die Partnerschaft mit Baxters WorldShare, oder die USA würden gefährlich hinter China und Russland zurückfallen, zwei Länder, in denen die Cyberbewaffnung von Staats wegen gefördert werde.
In einer nicht öffentlichen Anhörung im Pentagon wurde er gefragt, wie es sein könne, dass eine so mächtige und erfahrene Organisation wie die CIA in Sachen Datenbeschaffung überhaupt erst so weit hinter ein soziales Netzwerk zurückgefallen sei.
Ganz einfach, antwortete Walker: Weil WorldShare, anders als die CIA, keine Beschränkung durch Verfassung, Justiz oder behördliche Anordnungen kennt. »Diese Tech-Giganten können tun und lassen, was sie wollen, konnten sich in den letzten zwanzig Jahren ungehindert Wissen über die Erfahrungen ihrer User und ihre persönliche Daten aneignen, im Prinzip stehlen, sie verwalten und manipulieren, und niemand aus der Regierung hat auch nur buh gesagt. Ist es da überraschend, dass sie heute die fast vollständige Kontrolle über die Produktion, Organisation und Präsentation von Informationen auf diesem Planeten haben?«
Und so blieb der geheimniskrämerischsten Abteilung der weltgrößten Supermacht nichts anderes übrig, als mit verlegen geröteten Gesichtern einem unwillkommenen Gast einen Platz an ihrem Tisch anzubieten, Cy Baxter, mit dem die Regierung sich eine Zusammenarbeit immerhin vorstellen konnte.
Kein Wunder also, dass Cy nun mit einem Lächeln von seinem Befehlsstand herabblickt, während der Countdown läuft, die letzten Sekunden bis zum Start des Projekts, aufgeregt wie eine Prinzessin mit Magnumflasche beim Stapellauf dieses neuen Staatsschiffs. Im Grunde verkünden er und seine Generation heute ihren Sieg: den Triumph dieser jungen Industrie, die so lange als unseriös galt und der jetzt etwas so Bedeutendes anvertraut wird. Hinzu kommt, dass es für Erika und ihn auch ein persönlicher Triumph ist, gezeichnet, wie sie beide sind von einer Tragödie, für die dieses Projekt, und das in nicht geringem Maße, auch eine Abrechnung sein soll.
Wenn dieser Test ein Erfolg wird, und daran zweifelt außer vielleicht Sandra Cliffe niemand, dann ist – egal, wie man dazu stehen mag – das Zeitalter der totalen Information gekommen, Information, die sich nutzen lässt, um aus dem Land (und der Welt) einen sichereren Ort zu machen.
Drei.
Cy ballt beide Hände zu Fäusten und reckt sie in die Höhe …
Zwei.
Das wird großartig, wenn es klappt. Für alle. Ehrlich.
Eins.
Für alle, außer für die Bösen.
»Showtime!«, ruft Cy.
Im selben Augenblick erwachen sämtliche Computer, die unzähligen Bildschirme, zu hochauflösendem Leben und eine riesige, rückwärts zählende Digitaluhr mit altmodisch anmutenden Ziffern erscheint auf einem der großen Bildschirme und verkündet in leuchtendem Rot:
ZEITFENSTER FÜR ZUGRIFF
noch 29 Tage 21 Stunden 59 Minuten
29 Tage 21 Stunden 59 Minuten
BOSTON, MASSACHUSETTS
Nur zwei Stunden hatten die Kandidaten Zeit, um unterzutauchen, so lautete die Spielregel. Die vergingen wie im Flug. Jetzt liegt der Startschuss zwei Stunden und eine Minute zurück, und Kaitlyn weiß, dass ihre supercleveren Verfolger inzwischen ihre Adresse kennen, ihre Bankdaten, Handynummer, große Teile ihrer Lebensgeschichte, ihre Steuererklärung, Krankenakten, E-Mails, Fotos. Sie spürt geradezu, wie sie auf ihr herumkrabbeln, sie inspizieren, sie durchleuchten, ihr so nahe kommen, als tastete tatsächlich jemand ihren Körper ab, nähme gerade jetzt in dieser Sekunde eine Probe vom Schmutz unter ihren Fingernägeln, zupfe ihr ein Haar für die DNA-Analyse aus. Sie schaudert beim Gedanken an diese digitalen Übergriffe. Aber das ist jetzt nicht der Augenblick, um die Nerven zu verlieren. Halt dich an deinen Plan, schärft sie sich ein. Pass ihn an, wenn es sein muss, aber alles in allem: Halte dich an den Plan. Sie weiß schon, was für ein Risiko sie eingeht – mit ihrer gewagten Strategie, sich anfangs nicht zu weit von ihrer Wohnung zu entfernen, einfach zur nächsten Bushaltestelle zu gehen, zumindest an Tag eins. Aber sie hat das genau durchdacht und betet, dass es funktioniert. Heilige Maria Muttergottes, bete für uns. Es muss funktionieren. In Gedanken lässt sie die Lieblingsheiligen ihrer Mutter Revue passieren. Sie ist zwar nicht religiös, aber jetzt gerade braucht sie alles, was sie an göttlicher Hilfe bekommen kann. Sie hätte noch ein paar Kerzen mehr anzünden sollen, überlegt sie. Noch ein, zwei Engel bitten, auf sie aufzupassen. Das hätte doch nicht geschadet, oder?
Boston. Ihr Zuhause. Doch plötzlich fühlt es sich an wie Feindesland. Überall Augen. Sie beobachtet die Kameras auf den ihr vertrauten Straßen schon seit einiger Zeit, aber jetzt hat sie das Gefühl, sämtliche Kameras beobachten sie. Irgendwie gibt es viel mehr davon als früher, an jeder Straßenkreuzung, fast jeder Fahrradkurier hat eine am Helm. Sie machen einem nichts aus, wenn man weiß, dass sie nicht nach einem Ausschau halten, aber wenn man erst einmal weiß, dass sie genau das tun, dann sind die heimtückischen Dinger überall. Jeder und alles könnte jetzt ein Informant sein, die ganze Welt um sie her, Feinde, wohin sie blickt.
Im Mittelpunkt ihrer Strategie, wenn man es denn so nennen will, steht die Idee, das Falsche zu tun, aber das mit Kalkül. Die Erwartungen der anderen unterlaufen. Sie rechnen damit, dass die Kandidaten mit List und Tücke arbeiten, Tricks und Täuschungen. Wie wäre es dann, wenn sie gar nicht so sehr versuchte davonzulaufen; mit zu viel Anstrengung spielt sie ihnen nur in die Hände, sagt sie sich.
Zum Beispiel verbieten die Regeln ja nicht, nach Honduras oder Patagonien zu fliegen, aber damit würde man sich dem ganzen Arsenal der staatlichen Überwachung aussetzen. Gerade der Versuch, außer Reichweite zu gelangen, würde einen verraten. Daher hatte sie beschlossen, dass es keine Flughäfen, keine Grenzkontrollen in ihrem Plan geben würde, und dann überlegte sie, was eine Frau wie Kaitlyn Day denn vollkommen Unerwartetes tun konnte. Was konnte sie machen, was eindeutig nicht den Erwartungen an sie entsprach, nicht zu ihrem Profil, ihrer Vorgeschichte passte und was die anderen deshalb bestimmt nicht vorhersehen würden?
Sie hat sich über die Bemühungen der modernen Überwachungsgesellschaft schlaugemacht, Verhaltensmodelle zu entwickeln, um Kriminellen immer einen Schritt voraus zu sein, schon vor der Tat zu wissen, was sie gleich tun werden, auf der Grundlage früheren Verhaltens und der simplen Tatsache, dass kein Mensch sich jemals ändert, nie wirklich ändert, nur mal ein kleiner Schlenker oder Ausrutscher in die eine oder andere Richtung. Qui non mutantur – wer sich nicht ändern will. Mit Sicherheit waren sie gerade in diesem Augenblick dabei, ein Profil von Kaitlyn zu erstellen, würden anhand der Daten, die sie hatten, jeden Moment mit großer Wahrscheinlichkeit richtig voraussagen können, was sie als Nächstes tun würde. Aber … könnte sie ihnen nicht gerade so einen dicken Strich durch ihre Rechnung machen? Ihnen einen Knüppel zwischen die Beine werfen? Was, wenn sie nicht nur wie eine andere ging, sondern auch wie eine andere dachte, wie eine andere handelte, wie eine andere reagierte, zu jemand anderem wurde?
Wie eine andere läuft sie in Richtung ihrer Bankfiliale und mustert die anderen Passanten, allesamt Selbstdarsteller. Wer davon ist ein Spion? Eine Fälschung? Ein Betrüger? Wer ist hinter ihr her? Der junge Mann da, mit Kopfhörern im Ohr, der auf sein Telefon tippt, ist das der Feind, ein Mann, der jetzt schon seit so vielen Jahren den Kopf gesenkt hält, dass er – wie viele seiner Generation – gebeugt geht wie ein Homo habilis vor zwei Millionen Jahren? Oder diese über ihr Telefon gebeugte Frau, die vielleicht gerade etwas auf Twitter postet oder sonst irgendwo, vielleicht ihren Schrittzähler checkt, sich die Kalorienzahl eines Muffins berechnen lässt oder eine Nachricht liest mit einem Rabattgutschein für ein Café, an dem sie gerade vorbeigekommen ist, und alles, alles wird aufgezeichnet, aufbereitet, ausgewertet von Datenkraken, Versicherungen, Wahlkampagnen. Warren hat ihr das einmal alles erklärt, und als er fertig war, löschte sie noch am selben Abend sämtliche Accounts. Peng. Jeder andere sah plötzlich wie ein Irrer aus. So wie die ihr Leben lebten, das war doch der reine Wahnsinn. Und dann zu behaupten, Kaitlyn sei verrückt!
Kaitlyn liest gern Detektivgeschichten, Klassiker, aber auch neue Sachen; die Bücherregale in ihrer Wohnung sind voll davon, allen voran die Erzählungen von Edgar Allan Poe. Vergesst Sherlock Holmes! Der alte Soziopath mag noch so oft neu verfilmt werden, letztlich ist er nur eine billige Kopie des einzig wahren C. Auguste Dupin, Held von Poes Der Doppelmord in der Rue de Morgue. Was für eine Geschichte! Es kommt ein Affe drin vor. Dupin verblüfft seine Freunde, indem er ihre Gedanken liest, ihnen auf Dinge antwortet, die sie noch gar nicht ausgesprochen haben. Er weiß, was andere tun werden, bevor sie selbst es wissen. Keine Einzelheit entgeht ihm, sein Blick ist scharf, er merkt sich alles, deutet alles, was er sieht. Dupin ist jemand, der Gedanken weiterspinnt. Schlüsse zieht, Folgerungen. Voraussagen trifft. Natürlich nur eine Geschichte. Coole Idee, aber niemand nimmt so viel wahr, merkt sich so viel, kann voraussagen, was als Nächstes geschieht. Zumindest bisher. Aber heute? Heute trägt jeder ständig einen kleinen, länglichen Auguste Dupin mit sich herum; der analysiert den Schlafrhythmus, die Herzfrequenz, kennt unseren Tagesplan, unser Bewegungsprofil, hört unsere Gespräche mit, und deshalb weiß dieser Taschendetektiv, wann uns eine Nachrichtenmeldung am besten erreicht und welcher Werbeslogan am besten trifft und uns genau im richtigen Augenblick durch die richtige Ladentür steuert.
Ja, schon gut. Wissen wir ja alles.
Sie ist bei der Bank angelangt. Warren, wünsch mir Glück! Stellt sich in die Schlange am Geldautomaten. Am helllichten Tag. Kappe. Sonnenbrille. Das Gesicht (interessiert niemanden) halb von der Atemschutzmaske verdeckt. Aber dann, merkwürdig, zieht sie sie herunter. Atmet tief durch. Sie ist an der Reihe. Gegrüßet seist du, Maria. Sie tritt vor. Tippt eine Geheimzahl ein, von der sie weiß, dass sie sie verrät, hebt sogar den Blick zu der Stelle, von der sie sicher ist, dass eine verborgene Kamera sie von dort beobachtet, registriert, erkennt. Sie bietet ihr unmaskiertes Gesicht diesem unsichtbaren Auge dar, hält dem Blick stand, schön ruhig, dann nimmt sie die Geldscheine, die der Apparat ausspuckt, zieht die Maske wieder hoch und ist fort.
29 Tage 21 Stunden 14 Minuten
FUSION-ZENTRALE, WASHINGTON, D.C.
So weit, so gut.
Cy ist in seinem von neuester Technik strotzenden Büro im Obergeschoss, als er das Signal bekommt. Auf seinem Glastisch leuchtet es auf. Die Bibliothekarin, Zero 10. Die Frau aus Boston. Großartig. In Boston haben sie ein Zugriffsteam. Kein Grund zur Eile, er schlendert aus seinem Büro. Unter den zehn Kandidaten, deren Profile er in den vergangenen sechzehn Minuten studiert hat, hat er sie sofort als schlichtes Gemüt ausgemacht, das Musterbeispiel eines einfältigen Menschen, der immer noch glaubt, alles, was er auf dieser Welt tut, sei seine Privatsache.
Aber er hatte doch gehofft, selbst eine Bibliothekarin würde ihm eine größere Herausforderung bieten als das hier. Offenbar ist sie an einem Geldautomaten gewesen und hat ihre eigene Kreditkarte benutzt. Also echt, so macht das keinen Spaß. Er will doch hoffen, dass seine Technik, groß und vielfältig, wie sie ist, ihre Vorzüge noch um vieles besser unter Beweis stellen kann, bevor das Spiel zu Ende ist. Um die CIA zu beeindrucken, und zwar so, dass sie die neunzig Milliarden Dollar lockermachen, zehn Jahresraten, muss er ihnen vorführen, dass seine Teams auch schwierige Aufgaben lösen, sich festbeißen können an Sachen, die nicht so lächerlich einfach sind; dass sie bis in die tiefsten Schichten der digitalen Spuren vordringen können, die ein gewöhnlicher Mensch hinterlässt. Und im Testlauf für diese Technik muss verdammt noch mal alles drin sein, denn die Zielscheiben der Zukunft werden keine Bibliothekarinnen sein, sondern staatlich gestützte Cyberfeinde Amerikas, russische und chinesische Hackerbanden, deren Strategien kaum auszumachen sind, nordkoreanische Kryptokriminelle; iranische Erpresser; anonyme Terroristen, die auf amerikanischen Straßen ihr Unwesen treiben.
Dass sie also Nummer 10 in noch nicht einmal einer Stunde aufspüren – keine besondere Leistung. Tatsächlich bereut er jetzt, dass er darauf bestanden hat, beim Auswahlprozess nicht dabei zu sein; es war vertragsgemäß in erster Linie Aufgabe der CIA gewesen, fünf typische Zivilisten und fünf Profis auszuwählen. Aber eine Bibliothekarin? So was sollte repräsentativ sein? Echt jetzt? Eine Person, die mit Büchern zu tun hatte? Der Rest der Welt war schon eine Generation zuvor auf Digital umgestiegen, und da sucht irgendein Blödmann einen Bücherwurm aus, eine, die mit Antiquitäten zu tun hat, als Herausforderung für Fusion? In Gedanken nimmt er sich vor, dass er sich über diese verlorene Gelegenheit zum Datensammeln beschweren will, dann geht ihm auf, dass analoge Menschen (über die er schon eine ganze Weile nicht mehr nachgedacht hat) der modernen Überwachungswelt in manchen Punkten tatsächlich überlegen sind. Es ist sehr viel unwahrscheinlicher, dass ihre kleinen Schnitzer einen digitalen Alarm auslösen, und man wird viel eher auf traditionelle Mittel zurückgreifen müssen, um sie zu schnappen. Trotzdem, und selbst er findet, dass es zu schnell ging, hat sich dieser analoge Schmetterling bereits in seinem blitzenden Netz verfangen.
Er tritt hinaus auf die Galerie über dem großen Kontrollraum, blickt auf die Videowand.
»Können wir die Aufnahmen mal sehen?«, ruft Cy.
Erika ist unten. Er winkt, sie winkt zurück.
Ohne Erika, geht ihm durch den Kopf, gäbe es all das nicht. Ich verdanke ihr so viel. Manche Beziehungen bringen nur Ärger. Manche helfen einem auf die Beine. Aber dann gibt es die seltenen Fälle, bei denen so etwas herauskommt. Jetzt, wo er auf all das blickt, was er mit ihrer Hilfe erschaffen hat, gestattet er sich auch ein bisschen Eigenlob: Gar nicht schlecht für den Sohn einer ledigen Mutter, die in den Armenvierteln von Portland, Oregon, leere Limonadenflaschen zusammengeklaubt hat, damit sie ein klein wenig Geld hatte – ein Sohn, der nun eine Schlüsselrolle bei der inneren Sicherheit Amerikas, ja noch darüber hinaus, spielt, verantwortlich für eine Einrichtung, die womöglich in der Lage sein wird, den nächsten Virenausbruch zu stoppen, schon im Augenblick, in dem er beginnt, mitzuhören, wenn der nächste Schallangriff auf eine US-Botschaft noch in der Planung ist, Cyberangriffe auf lebenswichtige Einrichtungen zurückzuschlagen, einem neuen Jeffrey Epstein das Handwerk zu legen, ganz zu schweigen von dem, was dem armen Michael zugestoßen war! Armer Michael. Wenn ich heute an dich denke, Mann, überlegt er, und unwillkürlich schweift sein Blick nach oben, ein weltliches Gebet in Richtung Decke und darüber hinaus in unendliche Weiten.
Das grobkörnige Bild von der Geldautomatenkamera erscheint drei Meter hoch auf der Videowand. Das Programm, eins, das er selbst entwickelt hat, sucht automatisch das geeignetste Standbild aus, markiert die Flächen des Gesichts der Frau mit grünen Linien, misst Augenabstand, Ohrform, den großen Mund, und vergleicht es mit einer der Aufnahmen aus dem Bewerbungsprozess. Hundert Prozent Übereinstimmung. Als Nächstes können sie unter verschiedenen Winkeln der Geldautomatenkamera wählen, genug Material, um ihr Gesicht überall wiederzuerkennen. Er sieht noch zu, wie Zero 10 ihnen den Rücken zukehrt und aus dem Bild verschwindet. Cy schaut auf den Zeitstempel: gerade mal dreiundfünfzig Sekunden her. Ein Lämpchen blinkt auf der Karte. Washington Street. Sie hat keine Chance. Wenn das so weitergeht, bekommen sie gar nicht erst die Gelegenheit, eins ihrer Spielzeuge zum Einsatz zu bringen.
»Können wir Medusa auf sie ansetzen?«, fragt Cy. Medusa ist die Superdrohne, die auf siebeneinhalbtausend Meter Höhe fliegt, ausgestattet mit einer Vielzahl von Kameras und den raffiniertesten optischen Techniken; damit könnten sie sich Zero 10 in Nahaufnahme ansehen, während der Apparat zugleich die umliegenden vierundzwanzig Quadratkilometer im Auge behielte.
Erika schüttelt bedauernd den Kopf. Negativ.
Er versteht sofort. Boston ist eine dieser Städte. Man sollte meinen, nach dem Anschlag beim Marathon hätten sie darum gebettelt, dass so eine Drohne über ihnen kreist, aber nein.
Erika schaut wieder zu ihm hoch. »Aber Kompaktdrohnen sind schon auf dem Weg zu der Stelle, und es gibt Überwachungskameras. Sie geht Richtung Chinatown.«
Erika wendet sich den Leuten zu, die die neueste Generation von Minidrohnen steuern, keine davon größer als ein Taschenbuch; Cy kommt die Wendeltreppe herunter. »Wo steckt unser Zugriffsteam?«, fragt er.
»In ihrer Wohnung. Hatten gerade angefangen, sich dort umzusehen. In vier Minuten da.«
Cy lässt die Schultern kreisen, das baut die Verspannungen ab, die er dort und im Nacken spürt. »Wenn sie sie haben, können sie sich den Bereitschaftsteams für Nummer 7 und 4 anschließen. Und habe ich heute Abend einen Yogatermin?«
»Drohnen im Anflug, und ja, wir haben Kuzo aus San Francisco kommen lassen.«
»Was würde ich ohne dich machen?« Als hätte man eine verlässliche Software zur Freundin.
Cy kehrt an seinen Platz auf der Kommandobrücke zurück, jetzt wieder ganz Captain Kirk, und die große Bildschirmwand spaltet sich in ein halbes Dutzend Kaitlyns auf, wie sie vom Geldautomaten davongeht, die Straße hinunter, drei Bilder von fest installierten Kameras, drei weitere aus der Ferne, die rasch näher kommen, eine fliegende Kamerastaffel.
»Wer steuert?«, fragt Cy. Drei Hände zu seiner Rechten heben sich kurz, und er gibt Anweisungen.
»Einer von euch setzt sich vor sie, nehmt ihre Beine auf und lasst den Gang analysieren, gegenprüfen mit den Festkameras.« Eigentlich überflüssig, die Frau ist schon so gut wie gefasst, aber das trainiert die Algorithmen, die Teams hier in der Leitstelle bleiben auf Zack, bis das Zugriffsteam in Aktion tritt.
Eines der Bilder schaukelt und schwankt, die Drohne beschleunigt, fliegt den anderen voraus, dann macht sie kehrt. Schon beim Zusehen fühlt man sich wie auf einem Kinderkarussell. Allerdings ohne jedes Geruckel – die Kardanaufhängung der Kamera sorgt für fließende Bewegungen, die Verarbeitungsgeschwindigkeit, die 5G-Verbindung, alles, bis in die kleinste Kleinigkeit, ist reibungslos. Cy beugt sich vor, klickt auf seinem eigenen Monitor ein paar Menüpunkte an, sodass er in Echtzeit die Analyse von Kaitlyns Bewegungen verfolgen kann, den Schwung der Hüften, das Strecken und Beugen der Beine, die Art, wie sie mit den Armen rudert, alles Teil des gewöhnlichen menschlichen Repertoires, aber hier Zeile um Zeile in kalten Zahlen angeführt, die etwas Intimes, Privates, Einzigartiges festhalten. Er sieht einer Maschine beim Denken zu. Es ist großartig, wie hier eins der Geheimnisse der menschlichen Natur zu Computercode wird, der Homo erectus in Bewegung. Und plötzlich hört diese Bewegung auf. Keine Kaitlyn mehr, auf keinem der sechs Schirme.
Er blickt auf.
»Wo ist sie?«
»Sie ist da reingegangen«, antwortet Erika. Eine der Drohnenkameras filmt das Schaufenster eines armseligen kleinen Ladens.
»Gibt’s da drin eine Überwachungskamera?«
»Nichts«, ruft einer aus dem Zero-10-Team. »Nicht bei uns angeschlossen. Warten wir?«
Cy atmet tief durch. Ihm geht auf, dass sie tatsächlich darauf warten, dass er ihnen sagt, wie es weitergeht. Er muss erst noch lernen, wie das ist, als General im aktiven Fronteinsatz; das ist doch etwas ganz anderes, als die Aufsichtsratssitzung zu leiten, die ihm den Jahresbericht präsentiert. »Hat dieser Laden womöglich eine Hintertür?«, geht ihm auf.
Sofort macht eine der Drohnen einen Hüpfer übers Hausdach und taucht in die Gasse dahinter, steht in der Luft wie ein Kolibri, wartet. Eine Brandschutztür kommt ins Bild, die eben zufällt. Auf der Gasse ist allerdings niemand.
Cy beschreibt einen Kreis mit dem Finger, und der Pilot dreht die Drohne, eine quälend langsame Bewegung … Müllcontainer … Feuerleiter … Garagentore … da! »Die Garage!«
Bei Cys Schrei ruckt die Drohne ein wenig, dann ist sie wieder stabil, rast die Gasse hinunter wie ein Jagdhund und sieht gerade noch, wie Kaitlyn Day … in ein Taxi steigt.
»Redet mit mir!«, brüllt Cy. Von Langeweile keine Spur mehr.
»Das Zugriffsteam ist in zwei Minuten da. Und wir haben das Taxi identifiziert.«
Auf dem Schirm erscheint eine Taxifahrerlizenz samt Nummer, kurz darauf so gut wie alles über den Moldawier mit dem abgelaufenen Visum, Vater von drei Kindern, dem dazugehörigen Fahrer.
Die Teams der anderen Zeros verfolgen jetzt auch alle, was auf der Videowand geschieht, lassen sich ablenken von der eigenen Arbeit, hier im Allerheiligsten und draußen bei ihren eigenen Zeros, weil es plötzlich spannend wird, eine Verfolgungsjagd.
Der Drohnenpilot, der gesehen hat, wie Kaitlyn in das Taxi stieg, ist drangeblieben, steuert mit dem Geschick der Gamer-Generation den Apparat von Hand, schlägt Haken um Dinge auf der Straße, macht Bögen um Bäume, taucht unter der Überführung an der Washington Street durch. Und in dem Augenblick, in dem die Brücke seine Sicht behindert, fädelt sich das Taxi in den dichten Verkehr ein, einen ganzen Pulk von Taxis, sodass jetzt die Verfolger kreuz und quer zwischen den Fahrspuren auf der Stuart Street hin und her flitzen, dann die Charles Street Richtung Norden, haarscharf um einen Bus herum, vom Bürgersteig wieder in die Mitte, und zugleich nimmt eine zweite Drohne eine Abkürzung unter den Bäumen, über den Köpfen der aufblickenden Touristen (»Warum werden diese Drohnen nicht endlich verboten?«), und sieht gerade noch, wie das Taxi vorn urplötzlich, unter wütendem Hupen der anderen, nach links ausschert. Die Drohne ruckelt. Ändert den Kurs. Nimmt erneut die Verfolgung auf.
»Da!«, ruft Cy, als das Taxi schließlich abrupt am U-Bahnhof Park Street zum Halten kommt, zwischen dichten Scharen von Schülern und Studenten, die zum Eingang strömen. Ganz kurz erhascht er einen Blick auf eine schlanke, dunkelhaarige Frau, die in die wogende Teenagermasse taucht.
Und dann ist sie fort. Die Drohnen schweben hilflos vor dem Bahnhofseingang, mit kreischenden Reifen fährt das Zugriffsteam in einem SUV mit abgedunkelten Scheiben vor, zwei bleiben am Wagen, die anderen stürmen los über die Straße, in nicht weiter auffälligen schwarzen Jacken. Die beiden Dagebliebenen zerren den Fahrer aus dem Taxi, halten ihm ihre Dienstmarken unter die Nase. Der Mann sieht ziemlich unglücklich darüber aus.
Hocherfreut über die unerwarteten Fähigkeiten der Bibliothekarin, die sich nun doch noch als Herausforderung entpuppt, haut Cy mit den Handflächen auf die Tischplatte. Wie cool ist das denn! Dank den Bodycams seiner Leute, die (natürlich unbewaffnet) die Verfolgung aufnehmen, ist es, als liefe er selbst dort; sie stürmen die Treppe hinunter, schubsen die jungen Leute beiseite.
»Gesichtserkennung im Bahnhof negativ«, meldet einer von den niederen Zero-10-Chargen. »Und an der Schranke hat sie nicht ihre CharlieCard benutzt.«
Ein wirres Durcheinander von Bildern auf dem großen Schirm, aus dem Inneren des U-Bahnhofs, jetzt, wo die Verbindung zu den dortigen Überwachungskameras hergestellt ist. Massenhaft Menschen aus Boston. Alle Größen, Formen und Farben. Alle in Bewegung, in sämtliche Richtungen, ständig neu durchmischt. Cy beißt sich auf die Lippe. Es sind einfach zu viele – zu viele Red-Sox-Kappen, warme Mützen und hochgeschlagene Kragen (selbst jetzt im Mai), das Gewimmel der Großstadt überfordert selbst seine Gesichtserkennungs-Software. Park Street. Zwei U-Bahn-Linien, vier mögliche Richtungen. Tote Winkel. Säulen. Während der ersten Minute hofft er noch, doch nach der zweiten muss er es einsehen. Sie ist ihnen entwischt.
»Schön«, sagt er lächelnd. Tja! »Mannschaft aufteilen. Eine Hälfte wieder zurück zu ihrer Wohnung, Erfassung dort abschließen, die andere Hälfte bleibt vor Ort und wertet sämtliche Kameras in der Innenstadt aus. Verdammt noch mal, in der ganzen Stadt.«
Er kehrt in sein Büro zurück und denkt dabei seltsamerweise, immer noch lächelnd: Halt dich ran, Kaitlyn!
29 Tage 20 Stunden 47 Minuten
BOSTON, MASSACHUSETTS
Jetzt kennen sie also mein Gesicht, überlegt sie. So gut wie sicher. Dass das die unverwechselbaren Züge der Frau mit Namen Kaitlyn Day, Zero 10, sind, ist in allen möglichen Datenbanken gespeichert.
Und genau deshalb muss sie dieses Gesicht ab jetzt sehr gut verbergen, wo auch immer sie damit hinzugehen beschließt.
Sie hatte sich seinerzeit beim Bewerbungsgespräch und nach Unterzeichnung der Geheimhaltungsvereinbarung gewundert, dass keine Fingerabdrücke von ihr genommen wurden, nicht einmal ihren Führerschein hatten sie kopiert. Das sei Teil der Aufgabe, die Fusion sich selbst gestellt hätte, wurde ihr erklärt; sie wollten über ihre Zielpersonen so wenig wie möglich wissen, nur dass sie für das Projekt geeignet seien und geistig gesund. Sie bräuchten einen guten Querschnitt von Persönlichkeitstypen und Fähigkeiten, um zu testen, wie gut ihre Techniken realen Herausforderungen gewachsen sein würden, aber sie wollten es sich möglichst schwer machen. Es werde eine bunte Mischung von Kandidaten sein, versprachen sie, unterschiedlich in ihren Einstellungen und Verhältnissen und Begabungen. Kaitlyn musste also annehmen, dass man sie ausgewählt hatte, um zu sehen, wie gut das Arsenal des Systems mit allein lebenden, kinderlosen, kurzsichtigen Bibliothekarinnen zurechtkam, die möglicherweise eine Bedrohung für das Land darstellten.
Sie hastet den Winter-Street-Fußgängertunnel zur Station Downtown entlang, dann hängt sie sich im Zug, auf der Fahrt nach Back Bay, an einen Haltegriff. Ein weiteres Dutzend Leute sieht sie, die auch noch ihre Coronaschutzmasken tragen – manche werden sie vielleicht nie wieder ablegen, besessen von der Vorstellung der Virenmengen, die ständig im Umlauf sind, von einer unterschwelligen Angst vor der Bedrohung, die von anderen Menschen ausgeht, sodass Selbstschutz zur Notwendigkeit wird, ein Schutzschild für das Persönlichste; und sie denkt, wie schnell doch aus der Welt eine feindselige Umgebung werden kann. Vielleicht kommt ihr das gerade nur so vor, weil ja tatsächlich die besttrainierten Menschenjäger der Welt es auf sie abgesehen haben. Aber sie hat außerdem das Gefühl, im freien Fall zu sein, sie stürzt durch das gesellschaftliche Gefüge, gehört nun zu den Gejagten und damit den Ungewollten, den Vertriebenen und Verachteten, der Unterwelt der Unerwünschten.