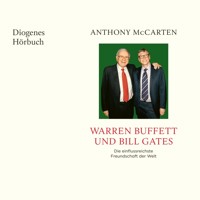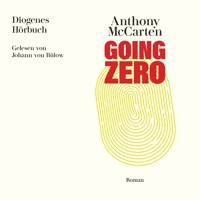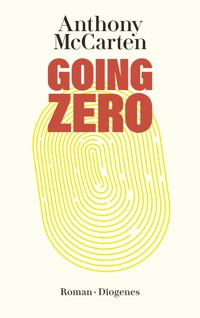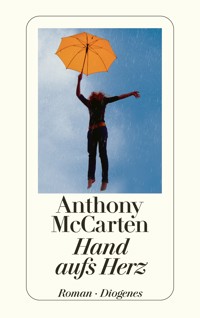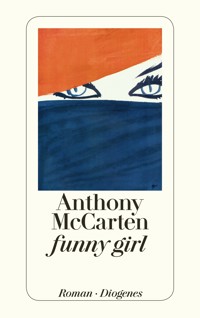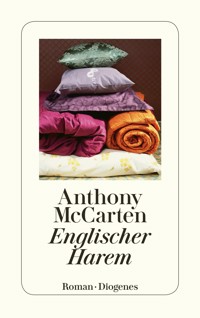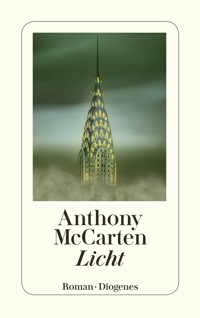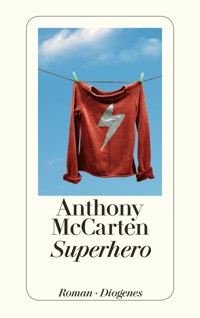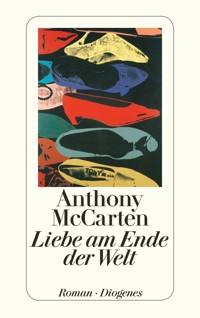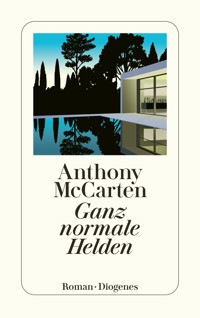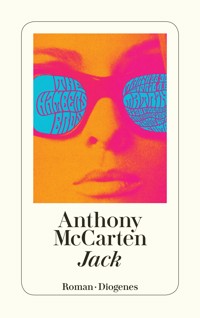
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er ist nur noch ein Abglanz seiner selbst und säuft sich in Florida zu Tode: Jack Kerouac, Idol der Beatniks, der einst das Leben seines Freundes Neal Cassady ausschlachtete, um es zu ›dem‹ Kultroman der Jugendbewegung zu verdichten, ›Unterwegs‹. Da steht aus heiterem Himmel eine Literaturstudentin vor seiner Tür. Ihr Traum: als seine erste Biographin sein Leben aufzuschreiben. Jack weigert sich und lässt sich doch von Jans Bewunderung zu einem Blick zurück verführen. Ein Trip, aus dem keiner der Beteiligten heil zurückkommt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Anthony McCarten
Jack
Roman
Aus dem Englischen von Manfred Allié und Gabriele Kempf-Allié
Diogenes
{5}Für Zoë
{7}Warum bist du unglücklich?
Weil 99,9 % von allem, was du denkst,
und allem, was du tust
deinem Ich gelten
und das existiert nicht.
Wei Wu Wei
{9}Teil 1
{11}Ja, ich war da. Ich war an seinem Grab, als sie den Sarg hinunterließen. Ich stand abseits von dem kleinen Grüppchen, weitgehend unsichtbar, mit Mütze und billiger Sonnenbrille im Schatten einer knorrigen Ulme, die der unablässige Wind zum Bonsai geformt hatte. Auf einem Dach in der Nähe zerschnitten Arbeiter die Luft mit ihren kreischenden Elektrowerkzeugen. Alles wirkte beschämend locker. Die Leute hatten sich nicht einmal besonders angezogen. Dichter eben! Man kann von ihnen einfach nicht erwarten, dass sie sich wie andere Menschen benehmen, nicht einmal auf einer Beerdigung. Einer von ihnen streckte sogar die Hand hinunter ins Grab und versuchte, den Sarg festzuhalten, was die anderen offenbar billigten, als ob sie mit ihrem Schweigen ausdrücken wollten: »Keats hätte es genauso gemacht, und Byron und Shelley auch.« Still, still! er ist nicht tot, er schläft auch nicht – er ist erwacht! Aber Schülerstreiche, Geschmacklosigkeiten, Skandale und Theatralik – {12}das waren schon immer ihre Markenzeichen gewesen. Ein einziger wilder Haufen, seit zwei Jahrzehnten schon. Aber ich wusste, wie man sich bei einer Beerdigung benimmt. Verhielt mich still. Blieb im Hintergrund. Ich gehörte schließlich nicht dazu. Denn ich hatte Jack Kerouac ja nicht gut gekannt, jedenfalls nicht den Menschen. Wir waren uns nur siebenmal begegnet, im Frühling des Vorjahrs, als ich mich bemühte, von ihm die Einwilligung für eine autorisierte Biographie zu bekommen. Und obwohl ich dem notorischen Einzelgänger in dieser Zeit erstaunlich nahegekommen war, fand ich nicht, dass ich näher am Grab oder unter den eigentlichen Trauergästen hätte stehen sollen. Wenn allerdings die Kenntnis seiner Bücher oder das Wissen um seine Seele der Maßstab von Vertrautheit gewesen wäre, dann hätte mir der Platz rechts neben der Witwe zugestanden, denn ich weiß alles über diesen Mann, diesen großen Schriftsteller, diese Seele, die uns nun verlassen hat.
Zahlenmäßig war es ein erbärmliches Aufgebot, gerade wenn man seinen internationalen Ruhm bedachte, und das machte mich traurig. So viel Anerkennung, all die Bücher, die er geschrieben hatte, all die Appelle, der Idealismus – was hatten sie ihm eingebracht? Und wenn man bedenkt, dass er schon da als »Vater einer Generation« angesehen wurde – {13}einer Generation, die man gemeinhin als Hippies bezeichnet und die an diesem Tag nur durch zwei Exemplare vertreten war, abgerissene Herumtreiber im Boheme-Chic; Navajo-Stirnbänder, Sandalen, Batikhemden, mit anderen Worten kostümiert wie für einen Kindergeburtstag, wer weiß, vielleicht sogar mit Drogen im Gepäck, Joints, die zwischen den Seiten seines berühmtesten Buches klemmten, ihrer Bibel, in Schultertaschen aus Segeltuch. Ich fand es störend, dass sie da waren, und doch irgendwie passend. Immerhin – waren nicht sie es gewesen, die seine Bücher millionenfach gekauft hatten? Hatte nicht ihre Liebe ihn zu dem gemacht, der er am Ende war: ein Sonderling, ein Reaktionär, ein undurchschaubarer Charakter, der sogar seinen besten Freunden nicht mehr traute, ein weltberühmtes Wrack, ein selbstzerstörerischer Alkoholiker und nun, mit 47, ein Leichnam?
Am Tag seines nicht unerwarteten Todes rätselten alle, wie sich ein Mann, dem nur zehn Jahre zuvor die Welt zu Füßen gelegen hatte, so hatte verändern können. Er war wirklich ein Star gewesen. Für manche eine Art Prophet. Zumindest eine einzigartige Stimme. Damals war nicht an ihn heranzukommen gewesen. Aber hier, bei seinem Begräbnis, sah man nichts als den sichtbaren Beweis für seinen unglaublichen Absturz.
{14}Kein Wunder, dass ich unbedingt seine Geschichte erzählen, seine offizielle Biographie schreiben wollte. Kein Wunder, dass ein Teil von mir es kaum erwarten konnte, alles offenzulegen, die Wahrheit über einen Mann zu enthüllen, den seine eigenen Fiktionen zugrunde gerichtet hatten, genau die Geschichten, die er über sich selbst und andere erzählt hatte. Ich brannte darauf, diesen so ungenügend betrauerten Leichnam zu neuem Leben zu erwecken und angemessen zu ehren. Er lebt, er wacht – der Tod ist tot, nicht er!
Der einzige Haken war, dass Jack mir nie ausdrücklich erlaubt hatte, seine Geschichte zu erzählen, dass er nie wirklich gesagt hatte: Jan, ich erlaube dir, als Erste meine Geschichte zu erzählen. Das heißt: Haken ist ein zu schwaches Wort. Es war ein Dilemma, das über mein ganzes weiteres Leben entschied. Deshalb stritten sich an diesem düsteren Tag zwei Seelen in meiner Brust, ja ich war innerlich regelrecht zerrissen, wenn Sie die Wahrheit wissen wollen. Hatte ich denn nun – oder hatte ich es nicht? – das moralische Recht, weiterzumachen und das zu tun, was ich mir mehr oder weniger vorgenommen hatte, fiel es mir einfach dadurch zu, dass er nicht mehr da war und mich nicht mehr daran hindern konnte?
{15}Im Frühjahr 1968 hatte ich beschlossen, zu ihm hinzufahren, ihn aufzuspüren, wo immer er sein mochte, ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten und ihm zu sagen, wer ich war.
Kleine Fußnote: Es ist ein weitverbreiteter Wunsch, den Abstand zwischen sich selbst (dem Fan) und dem Objekt der Verehrung (dem Künstler) auf ein paar wenige Zentimeter zu verringern. Aber kaum einer erreicht das Ziel. In den meisten Fällen bleibt es ein Wunschtraum, der nur in der Phantasie des Fans lebt. Man kann vielleicht darauf hoffen, sein Idol bei öffentlichen Auftritten von ferne zu sehen oder mit viel Glück ein unleserliches Autogramm zu ergattern, wenn der Held eilig aus irgendeiner Tür huscht, aber mehr als das – eine persönliche Beziehung? – ha! Solche Gedanken sind reines Wunschdenken.
Ich hingegen war Akademikerin; ich stand gewissermaßen im Dienst der Geschichtsschreibung, und jeder Künstler muss sich irgendwann der Nachwelt stellen, zumindest wenn er sein Vermächtnis regeln will. Das war meine Rechtfertigung vor mir selbst: Jack brauchte mich. Er wusste es nur noch nicht.
1968 war allgemein bekannt, dass Jack körperlich in sehr schlechter Verfassung war. Ich will es deutlicher sagen: Der Mann lag im Sterben. Das Gerücht, dass er drauf und dran war, sein Versprechen, sich zu Tode zu trinken, in die Tat umzusetzen, war {16}bis nach San Francisco gedrungen, wo ich Undergraduate an der Universität von Berkeley war. Ich musste mich also beeilen, wenn ich seine Geschichte so erzählen wollte, wie sie es verdiente: offen, ungeschminkt, im Klartext und ohne Umschweife, die reine Wahrheit, die er der Welt schuldete –
Hier ist die Kirche, und der Turm, der ist hier,
Und ihr seht die Gemeinde durch die offene Tür.
Das Projekt stand von Anfang an unter schwierigen Vorzeichen.
Zum einen war dieser Pionier der amerikanischen Literatur wie vom Erdboden verschwunden. Schon 1966 hatte sich dieser bedeutende Autor – Vater von zehn Romanen, davon einer weltweit als Klassiker anerkannt – vollkommen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Wo war er? Wo versteckte sich Jean-Louis Lebris de Kérouac? Seine alten Freunde hätten seine Adresse nicht einmal herausgerückt, wenn man ihnen die Adern mit Natriumpentothal vollgepumpt und sie an einen Lügendetektor angeschlossen hätte. Wie sollte da ich – ein Niemand, eine Null in der damaligen Situation – mein berühmtes Studienobjekt aufspüren?
Und es gab noch ein weiteres Problem. Es war jahrelange Schwerarbeit, eine gute umfassende {17}Biographie zu recherchieren und zu schreiben. Im Falle von Jack brauchte ich unbedingt Zugang zu seinen persönlichen Briefen; nur dann konnte ich die unglaublichen Anekdoten, die schon jetzt über ihn kursierten, einschätzen. Es war bekannt, dass er seine Korrespondenz sorgfältig archivierte, aber wenn ich diesen Schatz heben wollte, brauchte ich seine Zustimmung, sein Vertrauen, seinen Segen. Weshalb sollte er unter Millionen Verehrern ausgerechnet mir dieses Vorrecht einräumen?
Und dann war da noch eine dritte Hürde.
Allein schon die vorbereitende Beschäftigung mit seinen Werken hatte mich zwei Studienjahre gekostet, und ich war mit einer solchen Besessenheit ans Werk gegangen, dass ich jetzt ziemlich mit den Nerven fertig war. Wollte ich meine Fixierung wirklich noch weiter treiben, indem ich noch einmal zehn Jahre damit zubrachte, seine Romane, seine Manuskripte und Papiere zu durchforsten – von den berühmten Briefen ganz zu schweigen –, und das bei all meinen komplizierten, verschütteten Gefühlen für ihn? Und wieso sollte ich ausgerechnet seine Geschichte erzählen und nicht die von irgendjemand anderem? Empfand ich für diesen Mann wirklich das, was Goethe als »Wahlverwandtschaft« bezeichnet hatte, eine notwendige Voraussetzung für jeden Biographen?
{18}Ich beschloss, die ganze Angelegenheit mit Jonathon zu besprechen, meinem Professor für amerikanische Literatur in Berkeley, meinem Mentor und intellektuellen Gewissen, einem Mann, mit dem ich, nebenbei bemerkt, seit etwa sechs Monaten auch eine Art Liaison hatte.
Aber Jonathon konnte mir nicht helfen, konnte mir keine Anweisungen erteilen. Er sagte, die Entscheidung, ob ich weitermachen wolle, müsse ich ganz allein fällen. Er äußerte allerdings gewisse Zweifel an Kerouacs literarischem Rang und riet mir, sorgfältig zu überlegen, ob K es wirklich wert sei, dass man sich ernsthaft mit ihm befasste. (Sie müssen wissen, dass K in Js Augen zweitklassig ist, auf einer Stufe mit Ray Bradbury.)
Das alles setzte mir zu, und über Wochen war ich nicht gerade umgänglich. Ein paar Tage lang gab ich den Gedanken, überhaupt eine Biographie zu schreiben, egal von wem, gänzlich auf. Aber nur bis ich durch einen schicksalhaften Zufall in den Tiefen der Bibliothek von Berkeley auf ein dünnes Buch stieß, ein postum veröffentlichtes Werk von Neal Cassady, seinerzeit Kerouacs bestem Freund und Vorbild für seinen berühmtesten Romanhelden Dean Moriarty.
Wo wäre ich jetzt, wenn ich das schmale Bändchen unberührt auf dem verstaubten Regalbrett gelassen hätte?
{19}Aber das Leben ist nicht die Geschichte dessen, was man vermieden hat; es handelt hauptsächlich von den Dingen, die uns unaufgefordert in die Hände fallen, die uns über den Weg laufen, ohne dass wir nach ihnen suchen, die uns die unschuldige Nase blutig schlagen und uns das Unvermeidliche aufdrängen. So kam es, dass ich dieses Buch mit dem Titel The First Third aufschlug.
Neal Cassady. Dieser Nebendarsteller hat mich schon immer interessiert, fast so sehr wie Kerouac selbst. Die Geschichte seines wahren Lebens war in mancherlei Hinsicht viel wichtiger für mich, denn ich war selbst eine Nebenfigur. (Mehr dazu später.) Der überragende Erfolg von Unterwegs, Kerouacs Kultbuch über Cassady, hatte sich als Katastrophe für Neals Leben erwiesen. Als die jugendlichen Leser des Romans herausfanden, dass es für Dean ein reales Vorbild gab, einen Mann, der mit Frau und Kindern in Los Altos, Kalifornien, lebte und als Weichensteller Schichtarbeiter bei der Eisenbahn war, pilgerten die jungen Leute zu ihm hin. Sie erwarteten, die Verkörperung ewiger Jugend aus dem Buch zu finden, und trauten ihren Augen kaum, als sie einem Bahnarbeiter mit nikotingelben Fingern gegenüberstanden, der seine Familie mit zwei Jobs über Wasser hielt. Als Cassady ihre enttäuschten Blicke sah, war er tief in seinem Stolz verletzt. Also {20}versuchte er, die Scharte auszuwetzen. Er bemühte sich, dem Bild gerecht zu werden, das sein Schriftstellerkumpel ihm angehängt hatte. Cassady ließ sich zu Drinks und Drogen einladen und versuchte immer wieder, für sie in die Rolle des wiedererstandenen Achill aus dem Roman zu schlüpfen. Eine Zeitlang gelang ihm das auch, aber die Anstrengung war gewaltig, denn wer kann schon auf Dauer eine Rolle spielen? Vollgepumpt mit Drogen, ohne auch nur einen Gedanken an seine kleinen Kinder, ging er daran, der Welt zu beweisen, dass er seiner Rolle gewachsen war; mit Vollgas über die kalifornischen Straßen, einen Haufen Hipsters auf dem Rücksitz, er selbst schon halb weggetreten, brabbelte er für die Blödmänner falschen Spengler und Proust vor sich hin, trommelte zur voll aufgedrehten Jazzmusik den Rhythmus auf das mit Christophorusplaketten bepflasterte Armaturenbrett, steuerte dieses Auto voller hirnloser Fans auf den finalen Fluchtpunkt der eigenen Selbstzerstörung zu und lebte den Kerouac-Hype (an dem er schließlich auch starb).
Eine amerikanische Tragödie. Und ein Thema mit viel Potential für Biographen. Und was für ein tragisches Ende! Die Kids waren nämlich nicht die Einzigen, die sich auf die Suche nach Dean Moriarty machten. Polizisten lesen auch Bücher. Und hier kommt der Höhepunkt: Ein paar {21}Drogenfahnder stellten Cassady eine Falle; sie überredeten den per Anhalter reisenden Bahnarbeiter, ihnen als Gegenleistung für eine Fahrt in die Stadt ein paar Joints zu verkaufen. Erwischt. Und die Auflösung? Auch perfekt: Eine Gefängnisstrafe, eine, die ihm endgültig den Hals brach. Großartig. Was für eine Geschichte, dachte ich, was für eine Parabel darüber, wie gefährlich es für eine reale Person ist, ihrem literarischen Alter ego nachzueifern. Denn während Kerouac literarischen Ruhm und weltweite Anerkennung erntete, wurde Cassady, dieses Produkt seiner Prosa, mit achtundzwanzig Jahren zum ausgebrannten Wrack, zum Opfer fremder Erwartungen. Er verbüßte Gefängnisstrafen, eine nach der anderen, raste bis zu seinem elenden Ende mit Autos durch die Gegend und versuchte schließlich sogar, sich das Leben zu nehmen, indem er die Wagen absichtlich zu Schrott fuhr, getrieben von dem immer verzweifelteren Bedürfnis, dem fremden Drehbuch zu entkommen und wenigstens sein Ende selbst zu schreiben.
Wie passend, dachte ich. Denn wenn Jack für sein berühmtes Buch die wahre Identität von Cassady »gestohlen« und ihm eine falsche aufgedrückt hatte, eine Verzerrung, eine glatte Lüge, anders ausgedrückt, dann war das ein Thema, das mir sehr am Herzen lag; eine Geschichte, mit der ich, wenn auch {22}nur ganz am Rande, zugleich meine eigene erzählen konnte.
Ich sah mich plötzlich Jack gegenübersitzen und ihm verfängliche Fragen stellen:
WEINTRAUB
Sir, inwieweit waren Schuldgefühle wegen Cassadys Tod der Grund für Ihren plötzlichen Rückzug aus der Öffentlichkeit?
WEINTRAUB
Sir, sollte die Literatur die Verantwortung für ihre Opfer übernehmen?
WEINTRAUB
Kann Kunst eine Rechtfertigung für Totschlag sein?
»Wahlverwandtschaft«? Plötzlich war sie da: die eine Zutat, die noch gefehlt hatte. Ich spürte, wie sich die Zahnräder in meinem Inneren klickend in Bewegung setzten. Ich war unterwegs. Es gab jetzt keinen Zweifel, nicht den geringsten: die Kerouac-Biographie würde geschrieben werden. Und zwar von mir.
Also belud ich im Frühling jenes Jahres einen klapprigen 57er Plymouth und fuhr nach Osten, um ihn zu suchen.
Wie ich ihn gefunden habe? Wollen Sie die Wahrheit hören? Er stand im Telefonbuch.
Na jedenfalls fast.
{23}Es war folgendermaßen.
In seinem allerletzten Interview mit der New York Times hatte er erwähnt, dass er seiner Mutter ein Haus in Florida gekauft habe. Das war alles, was ich wusste. Also rief ich eine nach der anderen die Telefonvermittlungen in Florida an. In St. Petersburg fand ich schließlich einen Kerouac. Der Vorname hatte einen anderen Anfangsbuchstaben. Ob das ein Verwandter war? Oder war es Tarnung?
Also rief ich an. Der Hörer lag mir bleischwer in der Hand. Es meldete sich eine Frau – Jacks Mutter? Wenn ja, würde ich nichts aus ihr herausbekommen. Wer den Partisan Review aufmerksam gelesen hat, weiß, dass diese zähe alte Matrone die Grenzen von Jacks Reich wie ein Gurkha sicherte. Sie ließ keinen durch. Beklommen fragte ich: »Könnte ich bitte mit Jack sprechen?«
Am anderen Ende wurde aufgelegt.
Es war seine Mutter.
Als Nächstes beschaffte ich mir über die Stadtbibliothek das Telefonbuch von St. Petersburg. Und da stand sie. Die Adresse. Jetzt war ich sicher, dass ich wusste, wo Jacks Mutter wohnte, und machte mich eines smoggrauen Morgens auf den Weg in Richtung Südosten. Ich fuhr erst einmal fünf Stunden am Stück, dann tankte ich und machte von einem Münztelefon einen Wünsch-mir-Glück-Anruf {24}bei dem genialen, unvergleichlichen, hochgelehrten, irgendwie attraktiven, aber fürchterlich schüchternen Jonathon Meyer, einem der besten Kenner der zeitgenössischen amerikanischen Literatur an der gesamten Westküste und im richtigen Leben ein Feigling.
»Wo bist du?« Ich hörte Besorgnis in seiner Stimme.
Ich erzählte es ihm. »Ich will herausfinden, wo Jack Kerouac steckt; ich hole mir sein Einverständnis für eine Biographie.«
Nach einem langen Schweigen am anderen Ende der Leitung sagte er: »Jan, lass das, komm runter. Was redest du da?« Ich merkte, wie sich immer mehr Sorge in seine Worte schlich. »Wo bist du? Sag mir, wo du steckst. Und zwar genau.«
Ich antwortete ihm, dass ich schon auf mich aufpassen könne, brüllte es genau genommen durch das Tosen der Lastwagen. »Mach dir doch nicht immer solche Sorgen. Entspann dich.« Wir hatten beide gehört, dass Kerouac womöglich sogar gefährlich war, ein gewalttätiger Säufer, aber ich hatte nicht vor, bei dieser Sache so ängstlich zu sein, wie Jonathon sich das gewünscht hätte. Das sagte ich ihm auch. Dass man manchmal auch etwas riskieren musste. Doch Jonathon ließ sich nicht beschwichtigen. »Jetzt hör mir mal zu – lass das bleiben – wir {25}müssen darüber reden – sei nicht unvernünftig. Kerouac? Der lässt dich nicht rein. Unmöglich. Du weißt doch gar nicht, wo er ist. Komm zu mir ins Büro, jetzt sofort. Komm zurück. Wir reden darüber. Wir bringen das in Ordnung. Okay?«
Ich gab den Versuch auf, es ihm leichtzumachen. »Du bist nicht mein Vater«, erklärte ich ihm. »Du hast mir nichts zu befehlen. Außerdem ist es zu spät. Ich bin schon unterwegs zu ihm.« Ich hielt den Telefonhörer in die Höhe, damit er den Verkehr auf der Schnellstraße hören konnte, aber dumpf hörte ich doch noch, wie er meinen Namen rief. Ich hielt mir den Hörer wieder ans Ohr. »Jan … um Himmels willen … das ist verrückt! Hörst du mich? Jan? Sag mir, wo du bist, und ich komme und hole dich. Bist du noch da?«
Genau was ich von ihm erwartet hatte. Jonathon trottete im Cordanzug mit Argyle-Socken über den Campus. Er war kein Adonis, aber sein Verstand war jedem, der mir bisher begegnet war, überlegen – man konnte ihm stundenlang zuhören, nicht nur wenn er über Faulkner, Lardner, Pound, Melville redete, sondern auch über die Herstellung von Styropor, über Raketenantrieb, über das Steuern einer Cessna 290, für die er einen Pilotenschein hatte.
Ich brachte das Telefonat zu Ende. »Na, so weit erst mal. Ich ruf dich aus …« Beinahe hätte ich {26}mich verraten, hätte beinahe gesagt, wohin ich fuhr, und vergessen, dass das Städtchen St. Petersburg in Florida ein Geheimnis bleiben musste. »… ich ruf wieder an. Bye.« Ich legte den Telefonhörer zurück auf die Gabel.
Ich hatte beschlossen, dass ich auf die Fahrt meinen Hund mitnehmen würde, einen Sealyham Terrier. Ich stellte mir vor, dass Winston mich beschützen würde, aber vor allen Dingen war der alte Bursche der perfekte Gefährte für die fünftägige Marathonfahrt.
Nachts, allein im Motelzimmer, während ich durch die dünnen Wände dem Zischen der Druckluftbremsen und dem schmatzenden Geräusch der Reifen draußen auf dem nassen Asphalt lauschte und Winston (Probleme mit der Blase, der arme Junge) auf einem Stück Zeitungspapier in der Ecke kauerte, arbeitete ich an meinem Plan und legte mir meine Strategien zurecht. Um Kerouacs Erlaubnis zu bekommen, wollte ich ihn bei seiner Eitelkeit packen.
Bei Tage steuerte ich den Wagen quer durch die unendliche Weite Amerikas und begriff dabei eine der Hauptmetaphern und -beschäftigungen Kerouacs: die Fahrt über weite Strecken als Sinnbild der menschlichen Reise, weil nämlich all unsere Sorgen {27}und Nöte, die uralten Ängste, die wir vor der Welt verborgen halten müssen, die nur wir allein kennen und die uns in unserem Inneren so viel Verwirrung und Leid und Schmerz bescheren, uns nicht wichtiger sein sollten als eine Landschaft, die bei siebzigMeilen die Stunde vorüberfliegt, nicht weiter unserer Sorge wert als ein Kuhdorf, das umso schneller im Nichts des Rückspiegels verschwindet, je fester wir den Fuß aufs Gas drücken.
Was es hier zu lernen gibt und was Kerouac Ende der vierziger Jahre, als die Trümmer des Krieges noch rauchten, deutlich erkannte, das ist, dass man nach vorn blicken muss, nach vorn und immer nur nach vorn … unsere Augen auf die nächste Biegung der Straße geheftet, weil wir sicher sein können, dass dahinter eine hübsche Zerstreuung wartet, etwas Flüchtiges, Schönes, dessen einziger Zweck auf Erden darin besteht, dass es uns – uns Neurotiker! – alles Traurige vergessen macht, das hinter uns liegt.
Diese Form des Gedächtnisverlustes erfasste mich, während ich über die endlos geraden Straßen glitt, um Kurven manövrierte, zurückschaltete, wenn kleine Steigungen sich bemerkbar machten, während ein Bundesstaat nach dem anderen unter meinen Rädern dahinrollte und sich immer mehr das Gefühl einstellte, dass ich die Kontrolle über diesen Wagen und über mein Leben hatte, im Tempo, in {28}der Richtung und auch was ihr Ziel anging. Und als ich in solch tagträumerischer Seligkeit dahinfuhr, dachte ich an Jack und an sein elendes Leben (oder das, was ich davon wusste). Ich überlegte, wie ich die Biographie anlegen sollte, und kam auf das Jahr 1944 als den vermutlich besten Anfangspunkt.
Damals, ein ganzes Jahr bevor der Krieg seine verwundeten Veteranen wieder ans heimische Ufer spülte, hatte Jack einen Zyklus von zehn Romanen geplant, in denen alles stehen sollte, was es über das Jungsein in dieser Zeit zu sagen gab. Damals war er Student an der Columbia-Universität und hielt seine Notizen in zerfledderten Schulheften fest. Manche seiner Ideen waren schon da, die Geschichten selbst noch flüchtig. Wo sollte er seine Figuren hernehmen? Er selbst? Seine Familie? Seine alten Lehrer? Der Milchmann? Auf dieser Grundlage begann er einen düsteren Roman, aber er war zäh, schwerfällig, voller Antihelden. Und dann hatte er Glück. Auf dem Campus hörte er eines Tages Jazzmusik, die dort über den Flur eines Wohnheims geschwebt kam; er klopfte an eine Tür und stolperte mitten hinein in eine Gruppe angehender Schriftsteller, besessene, fiebernde junge Leute, viele davon homosexuell; die kannten wiederum Drogensüchtige und Kleinkriminelle, und binnen eines Monats hatte sich eine Clique gebildet. Hier fand er, fertig zum Gebrauch, {29}Romanfiguren für ein ganzes Leben. Drogen, Rausch, Herumtreiberei, Mord, Selbstmord, Psychose, die Zwänge des Weckers und der Hypothek, Unschuld, Musik, Jazz, poetische Verzückung, Nonkonformismus, Tod durch Missgeschick, Gefängnis, europäische Literatur, die Vorstellung, das Leben sei »ein Traum der Götter, der längst ausgeträumt ist« – von all dem wimmelte es nur so, und alles öffnete ihm die Augen. Er gab die Universität auf, denn da hätte er nur unter einer Glasglocke hocken und all die schrägen Vögel der Gesellschaft betrachten können, und schwang sich stattdessen selbst in die Lüfte. Ende der Vierziger wurde Kerouac selbst zum schrägen Vogel und riskierte eine Zeitlang viel am trüben Himmel über dem Times Square.
Als er wieder auf den Boden kam, hatte er fette Beute im Schnabel. Er brauchte zehn Jahre, bis ihm klar wurde, was für ein Glück er gehabt hatte. Von gewohnheitsmäßigen Dieben (und ganz besonders von Neal Cassady) stahl er eine neue Sprache. Aus ihrem Leben und Lieben ohne Punkt und Komma, ihren ganz eigenen Gewohnheiten, machte er eine romantische Geschichte; er nahm sie alle in seine Texte auf. In möblierten Zimmern an der Upper West Side strömte die Prosa nur so aus seiner Feder. Nichts Anstoßerregendes, aus der Perspektive von 1968 gesehen: ein wenig unehelicher Sex, ein wenig {30}Hasch, Nacktheit an unpassenden Orten, Platten werden gespielt, es wird so unbekümmert geflucht, dass jeder außer einem anerkannten Autor dafür im Gefängnis gelandet wäre.
Aber für die amerikanische Literatur war es ein großer Schritt vorwärts. Zu den Schrecken des Krieges boten seine Bücher eine alternative Realität. Junkies, denen er erste Entwürfe zu Unterwegs zeigte, lobten ihn in den Himmel; Schleimer unter hochwirksamen Barbituraten erklärten ihn zum Genie, besser als Wolfe, ganz da oben zusammen mit Melville. Er hatte selbst das Gefühl, dass er etwas Großem auf der Spur war. Er schluckte diese schillernden Pillen des Lobes und tauchte tiefer in das Experiment ein, jedes neue Werk extremer als das vorhergehende, und schließlich schleppte er einen Koffer voller erster Entwürfe mit sich herum.
Und dann wartete er. Zehn Jahre vergingen. Seine Manuskripte wurden von jedem Verlagslektor, dem er oder seine Freunde sie zur Lektüre andrehen konnten, zurückgeschickt. Der Koffer sah immer abgewetzter aus. Man konnte diese Prosa, die alles riskierte, nur entweder lieben oder hassen, und als sich herausstellte, dass die meisten sie hassten, fand er sich damit ab, dass er mit diesen Papieren begraben würde. Und dann plötzlich brach der Sturm los.
{31}Unterwegs fand einen Verleger. Offenbar war Kerouac seiner Zeit einfach nur um zehn Jahre voraus gewesen. Dieser literarische Herumtreiber, längst über alle Verzweiflung hinaus, der in der Zwischenzeit alle Schattierungen der Enttäuschung kennengelernt hatte und der sich mit Vollgas Richtung Selbstzerstörung bewegte, erfuhr eines Sommertags im Jahr 1957, dass er an der Spitze der Bestsellerlisten stand. Über Nacht war er da, der große Erfolg; plötzlich »liebten« ihn die Leute, bewunderten ihn, priesen (wie bizarr das alles war) seinen Verstand, waren begeistert. Seine Bücher verkauften sich weltweit. In einer einzigen Woche verkaufte er fast eine Million Exemplare und wurde von genau denen gelesen, die in seinem Buch am schlechtesten wegkamen: jungen Männern. Diese Jungs trugen ihn auf Schultern, machten eine internationale Berühmtheit aus ihm, sorgten dafür, dass er schon wenige Monate später auf dem Umschlag von Time landete. War es ein Traum oder ein Alptraum? Kerouac hatte keine Zeit, sich das zu überlegen. Das Buch brach alle Verkaufsrekorde. Bis es Weihnachten wurde, hatte die Welt ihn in ihr Bewusstsein aufgenommen. Man kannte ihn. Der Stein, den er ins Wasser geworfen hatte, setzte eine Flutwelle in Gang, die um die ganze Welt lief; sie spülte die Strohhütten seiner Zeitgenossen davon {32}und wurde an jedem Ufer von der Jugend, die auf den Landspitzen Ausschau hielt, begeistert begrüßt. Der Name Jack Kerouac und der seines Helden Dean Moriarty verschmolzen zu einem einzigen für alle jungen Leute, die gegen die Langeweile und die erdrückende Moral ihrer Nachkriegseltern ankämpften.
Und nun saß unser Schriftsteller dort in New York im Ozone Park und trank nach wie vor seinen Whisky aus einer Flasche in brauner Papiertüte, dachte über das Sterben und den Tod nach, seinen eigenen Tod, und wusste nicht, was er davon halten sollte. Plötzlich terrorisierte ihn sein Agent am Telefon, die hysterische Presse fiel über ihn her, der falsche Glamour von Interviews, Filmrechten, Fans und noch mehr Fans, von Geld und weiterem Geld; das Telefon klingelte, bis der Hörer von der Gabel fiel. Was sollte er davon halten, dieser zurückhaltende Mann, inwischen zum Säufer geworden, der immer noch bei seiner Mutter lebte, immer noch in dem schmalen Bett seiner Kindheit schlief, unter der Decke, die seine Großmutter gehäkelt hatte, unter den Footballwimpeln seiner Highschoolzeit, die in Reih und Glied dort hingen?
Und es kam noch schlimmer. Die besseren Kritiker warteten nicht lange, bis sie die Messer zückten. Immer neidisch auf jeden Erfolg, der nicht {33}ihrer persönlichen Fürsprache zu verdanken war, stürzten sie sich auf ihn und beschuldigten ihn bald jeder erdenklichen Missetat, erklärten ihn zur überschätzten Eintagsfliege, zum Unruhestifter, zum poète maudit. Es störte sie, dass die Stimme eines Einzelnen so rasch zur tonangebenden geworden war, und so strengten sie sich alle gemeinsam an, seinen Einfluss zu begrenzen. Ein paar wichtige Leute erhoben sich und verkündeten, Jack Kerouac habe unsere amerikanische Literatur verraten.
Bald wurde dem armen Mann für alles Übel, das man an der Jugend fand, die Schuld gegeben. Seine Figuren, die sich treiben ließen, harmlos, jazzberauscht, waren nun plötzlich »die Essenz des Asozialen«. Binnen eines Monats nach seinem Sensationserfolg war der »neue Rimbaud« zum Liebling der Halbstarken geworden. Auch die religiöse Rechte machte ihn zum Prügelknaben. Die Katholiken erwiesen Unterwegs sogar die dubiose Ehre, es als einziges amerikanisches Buch der Nachkriegszeit auf den Index verbotener Bücher des Vatikans zu setzen. Und als die Medien ihn aufsuchten, sich einen Kommentar erhofften, fanden sie einen Alkoholiker. Sie zerrten ihn vor die Kameras des landesweiten Fernsehens, und er versuchte sich zu verteidigen. Doch Kerouac, längst ein aufgeschwemmtes Wrack, meilenweit entfernt von dem Idol auf dem {34}