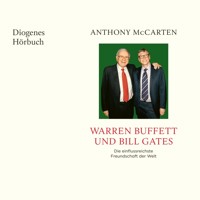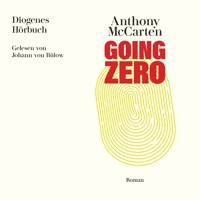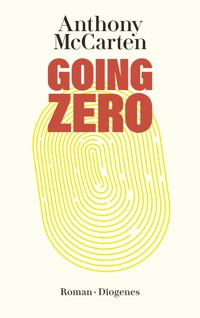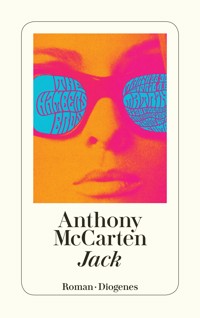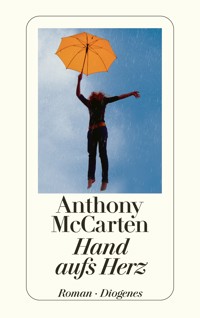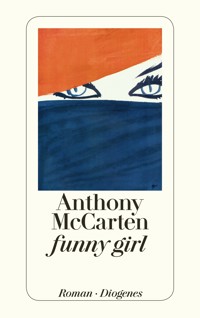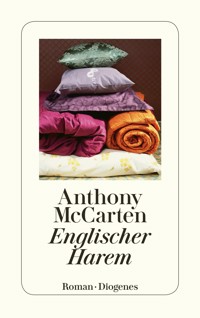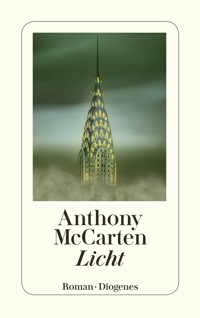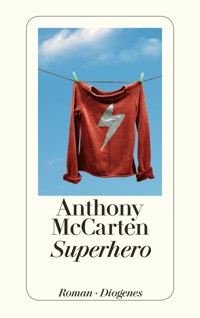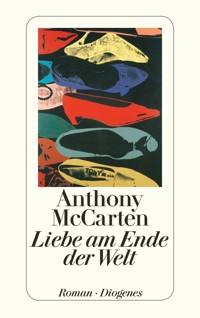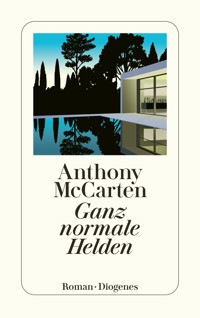10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Am 28. Februar 2013 macht Papst Benedikt XVI. eine sensationelle Ankündigung: Er tritt zurück. Sein Nachfolger wird der Armenprediger Jorge Bergoglio aus Argentinien. Heute wohnen sie im Vatikan fast Tür an Tür: Benedikt XVI. und Franziskus, so ähnlich und doch so verschieden. Beide fühlten sich moralisch für ein Amt ungeeignet; beide sind voller innerer Widersprüche. Und das zu einer Zeit, in der der Vatikan mit Skandalen zu kämpfen hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Anthony McCarten
Die zwei Päpste
Franziskus und Benedikt und die Entscheidung, die alles veränderte
Aus dem Englischen von Stefanie Schäfer
Diogenes
Für meine Eltern: meine Mutter, die sich immer gewünscht hat, auf einem Motorrad durch den Himmel zu brausen; meinen Vater, dessen letzter Auftrag an mich war, »am Glauben festzuhalten«; und für Eva, die mir die Aussicht von der Villa Borghese auf Rom gezeigt hat
Prolog
Am 11. Februar 2013 wurde eine sechshundertjährige Tradition durchbrochen: Papst Benedikt XVI., bisheriger Hüter der Lehre und getreuer Erbe des lange dahinsiechenden Johannes Paul des Großen, gab eine überraschende Erklärung ab. Er würde aufgrund seines fortgeschrittenen Alters zurücktreten und für den Rest seines Lebens den Titel »emeritierter Papst« oder »Papa emeritus« tragen.
Nur wenige Wochen später wurden die großen Türen der Sixtinischen Kapelle im Vatikan verschlossen und die Kardinäle, die zum zweiten Mal in weniger als einem Jahrzehnt ins Konklave berufen wurden, gebeten, ein neues geistliches Oberhaupt für die 1,28 Milliarden Mitglieder der römisch-katholischen Kirche zu wählen. Als sich die Türen einige Tage später wieder öffneten, war der charismatische Argentinier Jorge Bergoglio, der den Namen Franziskus tragen sollte, gewählt worden. Die Welt hatte zum ersten Mal seit dem Jahr 1415 zwei lebende Päpste.
Die Gründe für Benedikts ungewöhnlichen Schritt wurden zum Gegenstand zahlreicher Spekulationen. Ein Papst hatte im Amt zu sterben. War das nicht Bestandteil der Stellenbeschreibung? Nicht nur Tradition, geradezu ein Dogma. Wie die Washington Post unter Berufung auf einen theologischen Experten erklärte: »Die meisten Päpste der letzten Jahrzehnte waren der Ansicht, dass ein Rücktritt inakzeptabel sei, außer in Fällen einer unheilbaren oder schwächenden Krankheit – dass die Vaterschaft, nach den Worten von Paul VI., nicht abgelegt werden könne.«
Weder der Rücktritt von Papst Benedikt noch das Dilemma zweier zeitgleich lebender Päpste waren ganz ohne Beispiel. In der langen Geschichte der Kirche haben insgesamt drei Päpste abgedankt, 263 taten es nicht. Papst Gregor XII. war 1415 inmitten eines politischen Ringens zwischen Italien und Frankreich um die wahre Kontrolle über die katholische Kirche zurückgetreten. Aber wir müssen bis ins Jahr 1294 zurückblicken, zu Coelestin V., um einen Papst zu finden, der sich aus eigenem Willen – aus »Sehnsucht nach der Ruhe seines früheren Lebens« – zur Abdankung entschloss.
Seine spektakuläre Entscheidung stieß damals auf empörten Widerstand. In Dante Alighieris Göttlicher Komödie, die in dieser Zeit entstand, gibt es einen Abschnitt aus dem dritten Gesang des Inferno, in dem Virgil Dante durch die Tore der Hölle führt. Bevor sie das Inferno erreichen, betreten sie ein Vorzimmer, das von einer Kakophonie qualvoller Schreie jener elenden Seelen erfüllt ist, »die ohne Lob und ohne Schande lebten«; in der Tat Menschen, die schlimmer waren als Sünder, weil sie es versäumt hatten, zu handeln, zu glauben oder Versprechen zu halten. Dante starrt auf die Gesichter der unheilbar Nichtssagenden, die dem Untergang geweiht sind, bis er irgendwann einen Mann sieht und schreibt: »Da einen ich erkannt nun unter ihnen, schaut’ hin ich und erblickte jenes Schatten, der auf das Groß’ aus Feigheit einst Verzicht tat.« Dieser Mann war natürlich Papst Coelestin V., dessen Treuebruch den großen italienischen Dichter derart entsetzte, dass er ihn in seinem Meisterwerk verewigte.1
Warum also machte Benedikt, der der Tradition verpflichtet war wie kein anderer Papst der Neuzeit, den untraditionellsten Schritt, den man sich vorstellen kann, obwohl er genau wusste, welche Empörung eine päpstliche Abdankung auslösen musste? Ein schlechter Gesundheitszustand ist keine gültige Erklärung; im Gegenteil, dieser ist für einen Papst in der Regel von Vorteil, da er – für jeden erkennbar – das Leiden Christi am Kreuz nachvollzieht. Und ein weiteres Mysterium muss geklärt werden: Wie konnte dieser ultrakonservative Beschützer des Glaubens, Hüter der Lehre, einen solchen Schritt überhaupt in Erwägung ziehen, obwohl er ganz genau wusste, dass er den Stuhl des heiligen Petrus für den radikalen Jorge Bergoglio freigeben würde, einen Mann, der sich in Charakter und Ansichten grundlegend von ihm unterscheidet?
Dieses Buch erzählt die Geschichte zweier Päpste, die beide eine ungeheure und unveräußerliche Autorität besitzen: ein seltsames Paar, dessen Schicksale zusammentrafen und die sich gegenseitig zutiefst beeinflussten.
Betrachten wir zunächst Benedikt, den ehemaligen Kardinal Joseph Ratzinger: ein Deutscher, intellektuell, Humor ist ihm verdächtig; dem Luxus zugeneigt, introvertiert, elegant gekleidet (er ließ die päpstliche Tradition der roten Samtschuhe wiederaufleben und von einem Parfümeur einen besonderen Duft nur zu seiner Verwendung kreieren); der die Weigerung der Kirche, nachzugeben und sich zu verändern, als ihre größte Stärke und sogar als das Geheimnis ihrer zeitlosen Beständigkeit empfindet. Obwohl er seine heiligen Pflichten ernst nimmt, mangelt es ihm gänzlich an Volksnähe – ein zurückgezogen lebender Theologe, dem es an Praxiserfahrung fehlt. Sport ist ihm fremd. Hat, soweit wir wissen, noch nie ein gefühlvolles Wort zu einer anderen Seele gesprochen.
Franziskus dagegen – oder wie wir ihm zunächst begegnen werden, Kardinal Bergoglio – ist ein charismatischer, lebenslustiger Argentinier, äußerlich bescheiden, ein extrovertierter Mann, der schlichte Kleidung bevorzugt (er lief zwanzig Jahre lang mit demselben Paar schwarzer Schuhe herum, trägt bis heute eine Swatch) und ein wiederholter Verfechter der Befreiungstheologie, einer katholischen Bewegung, die den Armen und Unterdrückten durch unmittelbare Beteiligung an politischen und gesellschaftlichen Angelegenheiten helfen will. Er ist ein Mann mit dem gewissen Etwas. Ein Mann des Volkes. Hatte sogar mal eine Freundin. Hat als Türsteher in einem Tangoclub gearbeitet. Ein leidenschaftlicher Fußballfan.
Die »Sünde« ist ein wichtiges Thema im Leben dieser beiden Männer, genauer gesagt, die Gnade und besondere Weisheit, die sich daraus ergeben, dass ein Sünder seine Schwächen anerkennen und seine Sünden hinter sich lassen kann. Wie viel weiser, wie viel wertvoller als zukünftiger Lehrer, Heiler und Oberhaupt ist die Person, die ein umfassendes Verständnis für eine bestimmte menschliche Schwäche, ein Versagen oder ein Problem aus erster Hand mitbringt, sich aber dann aus dem Abgrund dieser dunklen Erkenntnis erhoben hat, um die wahren Dimensionen des Problems zu erkennen? Und andererseits: Wie viel weniger wertvoll und dafür umso gefährlicher ist derjenige, der in dieser Hinsicht versagt hat?
Jorge Bergoglio bezeichnet sich offen als Sünder und weist immer wieder darauf hin, dass es sich hierbei nicht um einen Euphemismus oder eine hohle Phrase handelt. Er hat gesündigt. Er geht sogar noch weiter, indem er erklärt, es reiche nicht aus, das Ritual der Beichte einem Priester gegenüber zu vollziehen. Nein, man müsse praktische Schritte unternehmen, um für diese Sünden im täglichen Leben zu büßen, und dazu echte und einschneidende Veränderungen vornehmen. Niemand könne sich durch einen kurzen Besuch in einem dunklen, von einem Priester besetzten Kabuff reinwaschen. Man müsse handeln. In seinen Worten: »Sünde ist mehr als ein Fleck, der durch einen Gang in die Reinigung entfernt werden kann. Es ist eine Wunde, die behandelt, geheilt werden muss.«
Diese Logik suggeriert eine wahrhaft reformerische Agenda, die – sofern erlaubt – natürlich auch in viele andere Bereiche des Glaubens und der Lehre hineinreichen würde. Wie sollte zum Beispiel ein zölibatärer Priester glaubhaft über sexuelle Themen referieren können? Gewiss sollte die Kirche mit ähnlicher Offenheit zugeben, dass sie nicht optimal dazu geeignet ist, ihre Ansichten auf diesem Gebiet durchzusetzen. Wie können zölibatäre, sex-verleugnende Männer ihre sexuell aktiven Gemeindemitglieder beurteilen, deren Lebenserfahrung wesentlich umfassender und vielfältiger ist als die ihre? Wie Frank Sinatra einmal scherzte: »Eure Heiligkeit, Sie spielen dieses Spiel nicht, Sie machen die Regeln nicht.« Oder woher sollte ein zölibatärer Novize, der gefragt wird, ob er bereit sei, für den Rest seines Lebens auf Sex zu verzichten, genau wissen, worauf er sich einlässt? Das kann er einfach nicht. Doch was soll dieser naive junge Mensch, der nie seine sexuellen Triebe erforscht hat, tun, wenn sich diese Triebe eines Tages bemerkbar machen? Wie so viele vor ihm wird er zu einem Doppelleben gezwungen sein, mit manchmal katastrophalen Folgen und unter Umständen zahlreichen Opfern. Und was berechtigt die Kirche dazu zu behaupten, nur zölibatäre Männer seien dazu geeignet, von der Kanzel Gottes Wort zu verkünden? Wenn zudem die Geschichte von Adam und Eva nach Franziskus’ Worten nur ein Gleichnis ist und keineswegs wörtlich aufgefasst werden sollte – womit er zugleich dem Mythos der siebentägigen Schöpfung den Boden entzieht –, welche Teile der Heiligen Schrift sollten dann außerdem noch als fiktional gelten? Ist auch die Geschichte von Jesus Christus, der von den Toten aufersteht und leibhaftig in den Himmel auffährt, von nun an nichts weiter als eine Parabel? Wenn sich Franziskus’ Geist der Offenheit in logischer Weise auf alle Bereiche des Glaubens und des Dogmas erstreckt, wo werden dann die Neujustierungen enden?
Die folgende Geschichte spielt sich hauptsächlich in einem Vatikan in der Krise ab, der von Skandalen überschwemmt wird, aber einfache Heilmittel bisher verweigert hat, der sich der Notwendigkeit der Veränderung bewusst ist, aber vor den Verlusten zurückschreckt, die eine solche Veränderung mit sich bringen könnte, mit einem Papst, der – aufgrund seiner Vergangenheit – nicht die moralische Autorität, die Fähigkeiten und die Stärke besitzt, mit diesen Skandalen umzugehen, und einem zweiten, neuen Papst, der – wegen seiner Vergangenheit – seine spirituelle Führerrolle über mehr als eine Milliarde Anhänger mit dem Geständnis prädiziert, dass er ein Sünder sei.
Dies ist eine entscheidende Zwischenstation auf der Reise einer Institution, die seit mittlerweile zweitausend Jahren existiert.
Ein interessantes Dilemma begleitet diese Situation der zwei lebenden Päpste, und es hat mit dem Konzept der »päpstlichen Unfehlbarkeit« zu tun.
Lassen Sie uns kurz darauf eingehen.
Seit zweitausend Jahren ist die Kirche bestrebt, die Existenz zweier Päpste zu vermeiden, und hat dieses Ziel fast vollständig erreicht. Einige Pontifizes wurden sogar vergiftet, um die Situation um jeden Preis zu verhindern. Doch aus welchem Grund? Warum dienen Päpste nicht nur für eine Amtszeit und treten dann zurück, um von einem jüngeren Mann ersetzt zu werden? Der Grund heißt Unfehlbarkeit. Die Gnade der Fehlerlosigkeit, das Geschenk der Vollkommenheit, Gottes Gabe für den, der auf dem Stuhl Petri sitzt, die Gnade, recht zu haben, unbestreitbar recht – in der Gegenwart und vor allem in der Zukunft, auf ewige Zeiten, in allen Fragen der Lehre. Wenn der Papst ex cathedra spricht, will heißen vom Stuhl Petri aus, also als Papst und nicht als Privatperson, sind seine Worte Teil des Magisteriums, der offiziellen Lehre der katholischen Kirche, hinter der die Macht und Autorität Christi stehen. Wie können Ratzinger und Bergoglio nebeneinander existieren … obwohl sie sich offenbar über so vieles nicht einig sind? In der Tat: Solange sie beide nebeneinander existieren, müssen sie als ewiger Beweis dafür gelten, dass Päpste fehlbar sind, denn bei jedem Zwist muss ein Papst zwangsläufig immer unrecht haben. Und ein Papst, der unrecht hat – und das beweist die bloße Existenz seines Zwillings, seiner Gegenstimme –, ist überhaupt kein Papst. Für jede päpstliche Äußerung existiert die lebende, atmende Widerlegung, das personifizierte Gegenargument – und macht sie ungültig. Wie können sie beide von Gott erfüllt und durch die Gabe der ultimativen Weisheit gesegnet sein und einander widersprechen?
Da zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Buches zwei päpstliche Positionen zur Verfügung stehen, können sich Katholiken – sogar einige hochrangige – aussuchen, welcher Papst und welche päpstliche Position am besten zu ihnen passt, die benediktische oder franziskussche, wodurch das faktische Dilemma zweier koexistierender Männer in Weiß sehr real wird. Wie der streng konservative amerikanische Kardinal Raymond Burke, ein lautstarker Kritiker Franziskus’, einer katholischen Zeitung im Jahr 2016 sagte: »Mein Papst ist Benedikt.« Ein konservativer ehemaliger Apostolischer Nuntius in den USA, Erzbischof Carlo Maria Viganó, hat Franziskus sogar aufgefordert zurückzutreten2. In einem Akt der Rache dafür, dass Franziskus ihn als päpstlichen Nuntius ersetzt hat (eine vermeintliche Strafe für Viganós geheimes Treffen mit US-Konservativen, die sich der Homo-Ehe widersetzen), behauptet Viganó, er habe Franziskus von dem vielfachen sexuellen Missbrauch durch den amerikanischen Kardinal Theodore McCarrick erzählt, doch dieser habe erst viel später geeignete Maßnahmen ergriffen. Ob an Viganós unbestätigter Behauptung etwas Wahres dran ist oder nicht: Es ist in der Neuzeit beispiellos, dass ein Papst von seinem eigenen Klerus so meuterisch angegriffen wird.
Benedikt tadelte jedoch in einem seiner seltenen Briefe, der im September 2018 vom Vatikan veröffentlicht wurde, diejenigen, die ihm wie Burke noch immer Treue gelobten, indem er stattdessen den Schulterschluss mit Franziskus probte und solche, die eine Diskontinuität der Theologie postulierten, scharf kritisierte und diese antifranziskanischen Vorwürfe als »dummes Vorurteil«3 zurück wies. Um sich für das Kompliment zu revanchieren, umarmte Franziskus seinen Vorgänger öffentlich und verkündete, ihn in der Nähe zu haben, sei »wie einen weisen Großvater zu Hause zu haben«4. Sind die Burkes und Viganós innerhalb der Kirche nun zufriedengestellt, zum Schweigen gebracht? Im Gegenteil.
Benedikts Versprechen, die Wogen durch ein tiefes Schweigen – silenzio incarnato – zu glätten, war am 11. April 2019 vergessen, als er sein sechsjähriges, selbst auferlegtes Embargo brach und sich zur tiefsten Krise der Kirche, dem Skandal um den sexuellen Missbrauch, zu äußern. O je. Welche Bestürzung muss diese Verlautbarung bei Franziskus und denjenigen in der Kirche ausgelöst haben, die verzweifelt nach einer einzigen päpstlichen Perspektive suchten! In einem mit 6000 Worten keineswegs nebensächlichen, unter anderem vom privaten katholischen Mediennetzwerk CNA/EWTN veröffentlichten Schreiben gab er die Schuld an den epidemischen Ausmaßen des Missbrauchs nicht etwa der Kirche, ihren »vom Teufel« beeinflussten Priestern oder ihren veralteten und unzureichenden Maßnahmen, wie Franziskus es erst knapp zwei Monate zuvor auf dem großen Anti-Missbrauchsgipfel getan hatte, sondern nennt als zentrale Ursache für Missbrauch Gottlosigkeit und eine Entfremdung vom Glauben, die sich seit den 1960-er Jahren auch in einer Abkehr von der katholischen Sexualmoral breitgemacht habe. Auch in der Theologie, in der Priesterausbildung und in der Auswahl von Bischöfen habe dies fatale Folgen gehabt5. Eine so andere, exemplarische und tadelverwässernde Erklärung – von einem pensionierten Papst, der seine Ansichten direkt über die des amtierenden Papstes stellt – veranschaulicht das Alptraumszenario, das Benedikts Rücktritt darstellt6. Viele Katholiken reagieren zu Recht verwirrt und wissen nicht mehr, welcher päpstlichen Position sie zuhören und gehorchen sollen. Keiner der beiden Päpste besitzt zur Zeit die Autorität, die der Titel »Papst« früher beinhaltete.
Joseph Ratzinger ist ein Mann mit festen Prinzipien. Dieses Buch untersucht seine Vergangenheit, um die Quellen seiner tiefen Überzeugung zu ergründen, dass Veränderung eher ein Zeichen von Schwäche als von Stärke sei. Seine Wahl zum Papst war unter den gegebenen Umständen gewiss eine sichere Option. Nach der Theatralik eines Johannes Paul II., seinem sozialen Engagement und seinen unermüdlichen Reisen (gibt es einen Flugplatz in der Welt, der von seinen Lippen nicht geküsst wurde?) musste sich Mutter Kirche erst einmal ausruhen und Ordnung in ihre häuslichen Angelegenheiten bringen. Benedikt, ein bedeutender Theologe, versprach, die alte Lehre zu beschützen und zu stärken, kurzum, er würde dafür sorgen, dass überfällige Reformen überfällig blieben. Das war seine Stärke, das machte ihn wertvoll. Schon als Kind hielt er sein Zimmer peinlich aufgeräumt. Alle Fakten weisen darauf hin, dass Benedikt, der Sohn eines Polizisten, von der Überzeugung erfüllt war, dass nur in der Autorität, im gesetzestreuen Gehorsam, im Unauflöslichen, die Gläubigen den wahren Frieden fänden. Zweifel, Unsicherheit, Schwankungen und Korrekturen konnten nur Unzufriedenheit und Verzweiflung, Zynismus und schließlich Verachtung erzeugen. Musste man ihm nicht darin zustimmen, dass sich die Seelen der Menschen schmerzlich nach Gewissheit sehnen? Wiederholt hat er über das gesprochen, was er als die größte Bedrohung für diese Gewissheit ansieht: den Geist des Relativismus. Er ist in den letzten Jahrzehnten an so vielen Windungen der Lehre, so vielen ideologischen Strömungen, so vielen neuen Denkweisen verzweifelt. Wie sollen wir in einer solchen Welt erkennen, wer die Wahrheit sagt? Was ist die Wahrheit? Die Welt erbebt vor rivalisierenden Stimmen – Marxisten, Liberalen, Konservativen, Atheisten, Agnostikern, Mystikern –, und aus jeder Brust ertönt der universelle Ruf: »Ich spreche die Wahrheit! Nur ich!«
Nein, sagt Ratzinger, es gibt nur eine Wahrheit. Sagte doch der Herr: »Ich bin die Wahrheit …« Im Zentrum von Ratzingers Lehre steht, dass es einen gemeinsamen Bezugspunkt, eine Axis mundi, geben muss, um Chaos, Katastrophen und Konflikte abzuwenden. Eine Wahrheit, von der aus wir alle navigieren können. Diese doktrinäre Position lässt sich mit einem Kompass vergleichen, der in alle Richtungen zeigt, aber als Ausgangspunkt rechtweisend Nord nehmen muss. Nur dann kann er Reisenden helfen, eine Reise zu planen, und sie auf den richtigen Weg bringen. Dasselbe gilt für die menschliche Moral, scheint er uns sagen zu wollen. Was ist ihr rechtweisender Norden? Gott. Ohne Gott besitzt die Menschheit keinen gültigen Bezugspunkt, keine Axis mundi. Jede Meinung gilt so viel wie jede andere auch. Die Wahrheit wird relativ. Töte Gott, und was du tatsächlich tötest, ist jede Hoffnung auf absolute Wahrheit. Deine Wahrheit ist deine, meine ist meine, und so wird jeder Mensch in ein Gefängnis seiner eigenen Interpretation von Gut und Böse gesperrt.
Das ist die große Krise der westlichen Welt, wie Ratzinger sie wahrgenommen hat: der Fluch des Relativismus. Welchen Schaden hat der angerichtet? Ratzinger sah deutlich, wie zumindest im englischsprachigen Raum immer weniger Menschen ihr Feuer von der Flamme eines zweitausend Jahre alten christlichen Glaubens bezogen. Zum Beispiel Amerika: Würden Exkatholiken als eigene religiöse Gruppe betrachtet, wären sie heute die zweitgrößte Religion in den USA. In Großbritannien sagt heute über die Hälfte der unter Vierzigjährigen von sich, keinen Glauben zu haben. Warum sind so viele Menschen still, aber stetig aus den Kirchen geschlichen?
Doch noch andere, drängendere Krisen erwarteten ihn, als er Papst wurde – so viele. Verbrechen wurden begangen, von Männern Gottes, von seinen Kollegen im Weinberg des Herrn, von seinesgleichen. Verbrechen, die mit Knöpfen zu tun hatten, oft Kinderknöpfen, Reißverschlüssen, Händen, Genitalien, Mündern, Öffnungen, Verletzungen, Verrat, Geheimnissen, Einschüchterungen, Lügen, Drohungen, Traumata, Verzweiflung, zerstörten Leben; so viel Schlimmes in einem Umfeld der Frömmigkeit und umduftet von uraltem Weihrauch. Jeder Skandal sollte Benedikt auf seine Weise erschüttern und seinen Glauben daran untergraben, dass er der richtige Mann sei, um diese Probleme zu lösen. Am Ende schockierte er die Welt. Er tat das Undenkbare. Er trat zurück. Und mit diesem Schritt raubte ironischerweise dieser überzeugte Traditionalist der Kirche eine entscheidende Gewissheit, auf die sich ihre verbleibenden Gläubigen immer verlassen hatten: dass ein Papst ein Papst auf Lebenszeit sei.
Am anderen Ende des Spektrums steht in vielerlei Hinsicht Jorge Bergoglio, der Reformer. Kaum war er Papst Nummer 266 geworden und hatte den Namen Franziskus angenommen, gab er ad libitum seine erstaunlichen Kommentare ab. Schnell war sein Name in aller Munde, ebenso wie der universelle Refrain: »WAS hat der Papst gerade gesagt?« Er brachte frischen Wind in die Kirche mit seiner Ausstrahlung eines Rockstars und einem Touch John Lennon dazu (beide Männer waren immerhin mal auf dem Cover des Rolling Stone-Magazins), sowie seinem Hang zu atemberaubenden Aussagen, die sogar seine glühendsten Fans nach Luft schnappen ließen. Passend zu Lennons Bemerkung, dass die Beatles inzwischen »populärer [seien] als Jesus«, was die Fundamentalisten im amerikanischen Heartland dazu brachte, zuhauf ihre Alben zu verbrennen, hörte man von Bergoglio die erstaunliche Ankündigung, dass sogar Heiden in den Himmel kommen könnten. Heiden? Im Ernst? Diese Götzenanbeter, diese Sonntagsschläfer, sollten genauso gen Himmel auffahren wie sie, die Gläubigen? Wozu dann, so fragten sich die Katholiken in aller Welt völlig zu Recht, die tausendfachen Stunden kniezermürbender Gebete, all die Predigten und Ermahnungen von der Kanzel herunter, die vielen Beichten und daraus resultierenden Bußen; wozu all die gemurmelten Rezitationen des Rosenkranzes, mit Daumen und Zeigefinger jede Perle an der Schnur abzählend, wozu das Fasten und die Sublimation der natürlichen Triebe, all die von Gott geforderte Liebe und schließlich all die Schuld, so viel Schuld? Wofür, wenn nicht, um einen Vorteil bei der Sicherung der ultimativen himmlischen Belohnung zu haben? Aber der neue Papst bestätigte es: Es könne nicht Schuld der Heiden sein, wenn sie in eine heidnische Kultur hineingeboren werden, und von daher sei es ziemlich ungerecht, wenn nur die durch den Zufall ihrer Geburt gottesfürchtig Erzogenen die besten und einzigen Zimmer im himmlischen Hotel erhielten. Mit solchen Äußerungen schien der neue Papst im Alleingang den Geist der 1960er Jahre wiederzubeleben.
Doch damit nicht genug der Überraschungen. Homosexuellen bot er die Entschuldigung der Kirche an, ex cathedra. Es sei nicht Aufgabe der Kirche, Homosexuelle zu verurteilen, verkündete er. Angeblich hat er sogar zu einem schwulen Mann, Juan Carlos Cruz (einem Opfer von sexuellem Missbrauch), gesagt, dass »Gott dich so gemacht hat und dich so liebt, und es ist mir egal. Der Papst liebt dich so«. (Stellen Sie dies einmal den Ansichten Ratzingers gegenüber, der Homosexualität als ›in sich unsittlich‹ bezeichnete.) Papst Franziskus hat auch verheiratete Priester nicht ausgeschlossen, denn es sei menschlich, »das Brot und den Kuchen, das Gut der Weihe und das Gut eines Lebens als Laie haben zu wollen«. Bereitwillig gibt er die Heuchelei der gegenwärtigen Position der Kirche zu, da es bereits verheiratete Priester in entlegenen Ecken des katholischen Reiches, in den griechischen und russischen Kirchen, gibt. Und er räumt gerne ein, dass der heilige Petrus selbst Kinder hatte. Clemens IV. und Adrian II. heirateten, bevor sie die Weihe empfingen. Pius II. hatte mindestens zwei uneheliche Kinder. Johannes XII. soll während des Aktes gestorben sein. Und sagen wir einfach, dass alle, die den Namen Papst Innozenz angenommen haben, dem Namen nicht gerade gerecht wurden.
Die wörtliche Auslegung der Bibel? Adam und Eva bezeichnete er als »eine Fabel«. Und was ist mit der unbefleckten Empfängnis, Sintfluten, Menschen, die angeblich achthundert Jahre alt wurden, oder der Teilung eines Meeres, so dass man trockenen Fußes hindurchgehen konnte – kurzum, alldem? Franziskus scheint zu dem Schluss gekommen zu sein, dass die Menschen – insbesondere im Westen – nicht mehr von Priestern verlangen, Dinge zu behaupten, von denen jeder weiß, dass sie nicht wahr sind und auch nicht wahr sein können. Mehr noch: Eher könnte die Kirche durch solche wörtlichen Auslegungen sogar geschwächt werden.
Die Kultur der katholischen Kirche? Mit der Autorität des Magisteriums hat er sie als »narzisstisch« bezeichnet, als zu sehr nach innen gerichtet, auf ihr eigenes Überleben und ihre Bereicherung anstatt auf die Bedürfnisse der Armen. Er hat Begriffe wie »spiritueller Alzheimer« verwendet, um eine Kirche zu beschreiben, die Christi beispielhafte Barmherzigkeit vergessen hat, und »die Machtgier von Klerikern auf der Karriereleiter« angeprangert. Er hat gesagt: »Wie jeder Körper, wie jeder menschliche Körper, leidet die Kirche unter Krankheiten, Fehlfunktionen und Gebrechen. Sie muss behandelt werden. Mit wirksamer Medizin.«
Sexueller Missbrauch? Als Oberhaupt einer Kirche, von der Bishopaccountability.org, eine Nonprofit-Anwaltsorganisation, die kirchliche Missbrauchsfälle verfolgt, sagt, sie habe inzwischen drei Milliarden Dollar Abfindungen an Opfer weltweit gezahlt, spricht er jetzt von »null Toleranz« gegenüber sexuellem Missbrauch und, noch entscheidender, gegenüber Vertuschung. Seine Bischöfe fordert er auf, jegliche Meldung sofort der Polizei anzuzeigen, wenn sie sich nicht mitschuldig machen wollen. Diese neuen Regeln der Transparenz, der Aufdeckung und der strafrechtlichen Folgen haben bereits zu einem außerordentlichen Rückgang der Anzahl gemeldeter Missbrauchsfälle geführt, was darauf hindeutet, dass sexuelle Straftaten von Priestern fast auf null reduziert werden konnten, indem man ihnen mit entsprechender Verhängung schneller Strafen (etwa Gefängnisstrafen) drohte und sexuell übergriffigen Klerikern das Deckmäntelchen kirchlichen Schutzes entzog. Wie erschreckend einfach sich die Lösung doch noch erweisen könnte, sofern die Polizei uneingeschränkten Zugang zu den Kirchenakten erhält und die Kirche selbst die verzweifelten Versuche der Opfer, Gerechtigkeit zu erlangen, erhört und entsprechend handelt. Schließlich hat die katholische Führung allen Grund, so zu reagieren, denn ihr Überleben steht auf dem Spiel.
Kapitalismus? Papst Franziskus wettert, die Herrschaft des Geldes sei für Massenarmut und ökonomische Rückständigkeit verantwortlich – woraufhin er beschuldigt wurde, die fütternde Hand zu beißen.
Die Umwelt? Er nimmt die Regierungen dieser Welt für ihren sündigen Schutz derer ins Visier, die Mutter Erde verletzen und unsere gemeinsame Heimat zerstören. In einer langen und sorgfältig recherchierten Enzyklika hat er die Ansichten von Klimawandelleugnern und eigennützigen, gewinnorientierten Industrien an den Pranger gestellt.
Kurzum, er scheut sich nicht, sich mächtige Feinde zu machen. Schon jetzt werden in der Kirche murrende Stimmen laut, die sich nach den einfacheren Gewissheiten sehnen, welche ein Papst Benedikt geboten hat. Franziskus scheint im Wesentlichen Wandel zu verkörpern, und es war schon immer schwieriger, Argumente für Veränderung zu finden als für Stillstand. Dennoch scheinen seine Argumente, vereinfacht und auf den Punkt gebracht – für mich zumindest –, zu lauten, dass die Kirche weniger insistieren, dafür mehr inkludieren müsse; dass sie die wertvollen Lektionen, die in den Kirchen, und die wertvollen Lektionen, die in den Schulen gelehrt werden, in Einklang bringen sollte.
Bergoglios Wahl des Namens Franziskus nach dem heiligen Franz von Assisi kann heute als das gesehen werden, was sie war: eine Erklärung revolutionärer Absichten. Wie weit wird er gehen? Wie weit darf er gehen? Es war einmal ein junger Mann namens Francesco Bernardone. Als er durch den Wald ging, stieß er auf eine verfallene Kapelle. Eine Wand war eingestürzt. Er trat ein. Das Kruzifix hing noch an der Wand, wo sich der Altar befunden hatte. Francesco erzählte später immer wieder, dass es »seine Sinne fesselte«. Es sprach zu ihm. Es sagte: »Francesco, baue meine Kirche wieder auf.« Francesco war ein praktischer Mann, der die Anweisung völlig missverstand. Er sagte okay, ging zum Steinbruch auf dem Berg Subasio, klopfte Steine, karrte sie den Berg hinunter und begann, die eingestürzte Wand zu reparieren. Er hatte nicht verstanden, was Gott wollte, nämlich etwas viel Größeres. Und die Moral von der Geschicht’? Selbst die wundervollste Reise kann … mit einem Fehler beginnen.
Lassen Sie mich diesen Prolog mit einigen persönlichen Bemerkungen abschließen. Ich bin Katholik. Zumindest wurde ich so erzogen, und wie ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann, ist man damit für sein ganzes Leben geprägt. Ich bin mit der Geschichte von Jesus Christus aufgewachsen, diesem jungen jüdischen Radikalen, der vor zwei Jahrtausenden aus Nazareth kam und behauptete, der »Menschensohn« oder, noch kühner, der »Messias« und »König der Juden« zu sein, der von seinem Vater auf eine göttliche Mission geschickt worden sei, um die Menschheit von der Erbsünde zu befreien, welche sie seit der Vertreibung aus dem Paradies heimsuche. Er wurde daraufhin gefangen genommen und gekreuzigt, erstand aber am dritten Tage von den Toten wieder auf und fuhr gen Himmel, wo er bis zu dem unbestimmten Tag bleibt, an dem er zurückkehren wird, um das Ende des gesamten menschlichen Experiments anzukündigen. Das war meine Religion. Eine gewagte Geschichte, zugegebenermaßen, aber mit der unverschämten Logik der Wahrheit. Tacitus nannte das Christentum einen »verderblichen Aberglauben«, und der Schriftsteller Jorge Luis Borges bezeichnete es als »einen Zweig phantastischer Literatur«: Dennoch ist dies der Glaube, in den ich hineingeboren wurde.
Ich wuchs als zweitjüngster Spross einer großen Familie auf, die so tiefkatholisch war, dass zwei meiner Schwestern – sehr glücklich – mit ehemaligen Priestern verheiratet sind. Bei uns saßen Priester mit am Tisch, hin und wieder ein Bischof, einmal sogar ein Kardinal. Nicht nur gingen wir regelmäßig zur Kirche, sondern erhielten auch einmal im Monat Besuch von einer großen Statue der Jungfrau Maria, die in feierlichem Wechsel durch die Pfarrei wanderte und meine Geschwister und mich dazu zwang, unter der Ägide meiner Mutter den Rosenkranz herunterzubeten – endlose (in meiner Erinnerung nervtötende) »Gegrüßet seist du, Maria«, mit denen wir wieder und wieder um göttliche Hilfe baten. Das Leben in unserer Arbeiterstadt war ganz sicher nicht leicht, und Geld und gute Jobs waren gleichermaßen rar, daher hielten wir es für eine sichere Option, uns mit der Muttergottes auf guten Fuß zu stellen. Gib keine Widerworte, fall einfach auf die Knie, und alles wird gut, solange wir Gott auf unserer Seite haben, so ging der Drill. Wir gehorchten, ließen uns pflichtbewusst nieder und vergruben unsere Gesichter in die Couch, während wir die alten Beschwörungen murmelten: »Bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes …«
Amen. Falls Sie sich für die Verhütungsmethoden meiner Eltern interessieren: Ich bin eines von acht Kindern (also mehr Coitus als interruptus). Ich besuchte katholische Schulen, zunächst bei Nonnen, dann bei Klosterbrüdern; in beiden war ich gut aufgehoben. Während meiner ganzen Kindheit war ich Messdiener; im peinlich fortgeschrittenen Alter von sechzehn Jahren trat ich ein letztes Mal in roter Kapuze und weißem Oberteil auf. Erste Bartstoppeln am Kinn und die Gewänder inzwischen zwei Größen zu klein für mich, brachte ich dem Priester die Messkännchen mit Wasser und Wein und jene weißen, unschuldigen Oblaten, die der Mann mit dem heißen Draht zum Himmel, dieser Nachbarschaftsmagier, in den wahrhaftigen Leib Christi verwandeln würde. Das tägliche Wunder, direkt vor unseren Augen. Der Leib Christi, Abrakadabra. Ob Sie’s glauben oder nicht.
Wir waren Katholiken, genauer, »irische Katholiken«, und obwohl wir schon vier Generationen zuvor mit einem Einwandererschiff nach Neuseeland gekommen waren, wurden unsere irischen Wurzeln sorgfältig gepflegt. Die weitverzweigte Familie, ihre Religion und Kultur bildeten einen geschlossenen Kreis, und nur innerhalb von diesem wurden Geschäfte gemacht und der Glaube gelebt. Das hat uns geprägt. Auch mein heutiges Leben als Schriftstellers verdankt seine Wurzeln der beseelenden Schönheit der Liturgie, die ich von Kind auf hörte; einer Kunst, die in der verschnörkelten Sprache liegt, welche dazu anregte, in mehreren Dimensionen und über Zeit und Raum hinweg zu denken und nie über das Leben nachzusinnen, ohne vorher über den Tod zu grübeln. Das Faktische wurde unwiderruflich an das Fiktive geknüpft, die Unterscheidung zwischen beidem wurde unterbunden. Egal, wurde uns beigebracht, wenn man nicht beweisen kann, dass etwas wahr ist: Welche Gefühle löst es aus? In unserer kleinen Kirche weinten die Menschen ganz offen. Die Hände waren im Gebet so fest verschränkt, dass man das Weiß der Knöchel sehen konnte. Der Glaube war für diese Menschen so notwendig wie ein Gehaltsscheck. Man musste glauben, um den Tag zu überstehen. Die Kirche in unserer Stadt, sechseckig und ohne Turm, war das geographische und psychologische Zentrum unseres Lebens. Wenn ich jemals daran gezweifelt hätte, hätte meine Mutter mir den Kopf zurechtgerückt, und wenn ich einen Aspekt des Glaubensbekenntnisses, irgendeine weit hergeholte Behauptung von der Kanzel oder aus der Bibel, in Frage stellte, tadelte sie mich: »Anthony, es ist gefährlich, nur wenig zu wissen!« Dass diese Frau, die mit vierzehn die Schule verlassen hatte, den Dichter Alexander Pope aus dem Stegreif zitieren konnte (wenn auch nicht ganz richtig, da es heißt »nur wenig zu lernen«), deute ich als Beweis, dass die Kirche in Ermangelung von Schulbildung unsere Universität war – der Priester, der den Professor ersetzte.
Die Idee zu diesem Buch und dem gleichnamigen Spielfilm (Netflix, 2019, in den Hauptrollen Sir Anthony Hopkins und Jonathan Pryce, Regie Fernando Meirelles) kam mir übrigens seltsamerweise bei dem plötzlichen Tod einer meiner Kusinen. Als Pauline starb, bat mich meine älteste Schwester, eine gläubige Katholikin, per SMS, eine Kerze für sie anzuzünden, wenn ich mich in der Nähe einer Kirche befände. Und das tat ich. Ich war schließlich in Rom. Ich ging also mit Eva, meiner Partnerin, in die Peterskirche im Vatikan, und wie der Zufall so will, drängten sich auf dem berühmten Platz Zehntausende von Menschen, um den neuen Papst Franziskus zu sehen, der eine Messe im Freien hielt. Das Gesicht des Mannes, projiziert auf eine Riesenleinwand, verlieh ihm diesen Superstar-Appeal. Und während ich dort stand und seinen sanften italienischen Worten lauschte, fragte ich Eva, ob sie wisse, wo der andere Papst sei, der abgedankt hatte? Eva wusste es. Ihr Vater hatte in München für Benedikt (damals noch Erzbischof Ratzinger von München) gearbeitet, während er Vizekanzler der Katholischen Universität war. Eva erzählte mir, dass dieser zweite Papst, der den Titel eines Papstes sowie möglicherweise viele seiner Befugnisse behalten hatte, zurückgezogen innerhalb der Mauern des Vatikans in einem Kloster lebte, nur wenige Hundert Meter hinter der Bühne, auf der jetzt Papst Franziskus stand. Zwei Päpste also, nur einen Steinwurf voneinander entfernt! Ich fragte Eva, ob sie wisse, wann es das letzte Mal vorgekommen war, dass die Welt zwei lebende Päpste hatte. Wir googelten es. Die Antwort, die daraufhin auf dem Display ihres Smartphones erschien, inspirierte sowohl das Buch als auch den Film.
1Konklave
»Lasst mich in das Haus des Vaters gehen.«
Diese Worte wurden am 2. April 2005 um 15.30 Uhr auf Polnisch geflüstert. Kaum mehr als sechs Stunden später wurde die katholische Kirche auf einen beispiellosen neuen Kurs gebracht.
Papst Johannes Paul II. war tot. Seit 1991 hatte der Vatikan seine Krankheit geheim gehalten und erst 2003 in einer Erklärung am Vorabend seines dreiundachtzigsten Geburtstags zugegeben, was längst offensichtlich geworden war. Das schleichende, schmerzhafte Siechtum des Papstes durch die Parkinson-Krankheit war für die 1,1 Milliarden Katholiken der Welt schon lange eine Qual.
Bereits seit dem 1. Februar pulsierte Rom vor Spekulationen und Gerüchten, nachdem der Papst mit Kehlkopfentzündung und Atemnot, verursacht durch eine kürzlich aufgetretene Grippe7, eilig in seinen privaten Flügel der Gemelli-Klinik eingeliefert worden war. Die Presse versammelte sich ordnungsgemäß zur Totenwache.
In den folgenden zwei Monaten bewies Johannes Paul II. jedoch einmal mehr jene Widerstandskraft, die bereits die vielen Jahre der Krankheit geprägt hatte. Man darf nicht vergessen, dass dieser Papst während seiner sechsundzwanzigjährigen Amtszeit nicht nur einen, sondern zwei Mordversuche überlebt hatte; er hatte sich 1981 von vier Schussverletzungen und ein Jahr später von einem Bajonettangriff erholt. Nun zeigte er sich trotz wiederholter Einweisungen ins Krankenhaus und einer Tracheotomie weiterhin an den Fenstern und auf den Balkonen des Vatikans, um die Menschenmassen auf dem Petersplatz zu segnen – mit kaum vernehmbarer Stimme. Zum ersten Mal in seiner Amtszeit als Papst war er nicht bei der Palmsonntagsmesse anwesend, wurde aber am Ostersonntag, dem 27. März, im Rollstuhl hinausgeschoben und versuchte, seine traditionelle Ansprache zu halten. Er wurde beschrieben als »[scheinbar] in großer Bedrängnis, den Mund öffnend und schließend, vor Frustration oder Schmerz grimassierend, wobei er mehrmals eine Hand oder beide Hände an den Kopf hob«8. Das war zu viel für die geschätzt achtzigtausend hingebungsvollen Katholiken, die von unten zusahen, und die Tränen flossen in Strömen. Dem Papst gelang ein kurzes Kreuzzeichen, bevor er hinter die Vorhänge seiner Wohnung zurückgerollt wurde.
In den folgenden sechs Tagen hielt der Vatikan die Welt regelmäßig über seinen sich verschlechternden Zustand auf dem Laufenden, und diejenigen, die auf eine vollständige Genesung gehofft hatten, begannen zu akzeptieren, dass das Eintreten seines Todes nur eine Frage der Zeit war. Am Morgen des 1. April wurde in einer öffentlichen Erklärung verkündet, dass »der Gesundheitszustand des Heiligen Vaters sehr ernst« sei und er am Vorabend um 19.17 Uhr »die Krankensalbung« oder »Letzte Ölung«9 erhalten habe. Johannes Pauls engster Vertrauter und Privatsekretär, Erzbischof Stanislaw Dziwisz, führte das uralte Ritual für Sterbende kurz vor ihrem »Aufbruch von dieser Welt«10 durch. Ihnen wird die Beichte abgenommen, und ihre Sünden werden ihnen vergeben, dann wird die Stirn mit heiligem Öl benetzt und die Hände werden damit gesalbt wie sonst nur bei Priestern. Der Vatikan-Experte und Biograph von Papst Benedikt XVI., John Allen jr., war Zeuge der Pressekonferenz und beschrieb, wie »… der aufschlussreichste Hinweis auf den wahren Ernst der Situation am Ende des Briefings kam, als [der Sprecher des Vatikans, Joaquin Navarro-Valls] mit den Tränen kämpfte, während er das Podium verließ, auf dem er mit den Reportern gesprochen hatte«.11
Umgeben von jenen, die ihn so viele Jahre lang geliebt und umsorgt hatten, erlangte Johannes Paul II. während seiner letzten 24 Stunden mehrmals das Bewusstsein wieder und wurde von seinem Leibarzt, Dr. Renato Buzzonetti, als »gelassen und klar«12 beschrieben. Nach polnischer Tradition erhellte »eine kleine Kerze die Dunkelheit des Raumes, in dem der Papst im Sterben lag«.13 Als er auf die Menge aufmerksam wurde, die unten Mahnwache hielt und seinen Namen rief, sprach er einige Worte aus, die die Vertreter des Vatikans folgendermaßen verstanden: »Ich habe dich gesucht. Jetzt bist du zu mir gekommen und ich danke dir.«14
Dr. Buzzonetti führte zwanzig Minuten lang ein Elektrokardiogramm durch, um den Tod von Papst Johannes Paul zu bestätigen. Sobald dies geschehen war, konnten die jahrhundertealten vatikanischen Rituale beginnen, von denen einige Elemente bis ins Jahr 1059 zurückreichen, als Papst Nikolaus II. das Verfahren zur Papstwahl radikal reformierte, um die weitere Ernennung von Marionettenpäpsten in den Händen von gegnerischen kaiserlichen und adeligen Kräften zu verhindern. Per Dekret verfügte er, dass ausschließlich Kardinäle für die Wahl eines Nachfolgers auf dem Stuhl Petri verantwortlich seien.
Kardinal Eduardo Martinez Somalo war vom verstorbenen Papst zum Camerlengo, wörtlich »Kämmerer«, ernannt worden, um die Kirche während des Interregnums zu führen. Nun trat er vor und nannte Johannes Paul II. dreimal bei seinem polnischen Taufnamen Karol. Als keine Antwort kam, schlug er mit einem kleinen silbernen Hammer auf die Stirn von Johannes Paul als sicheres Zeichen seines Todes. Er wurde dann aufgefordert, den Fischerring, »anulus piscatoris« – den päpstlichen Ring, der seit dem dreizehnten Jahrhundert für jeden Papst gegossen wird –, mit einem Hammer zu zerstören, um das Ende seiner Herrschaft zu symbolisieren.
Und so wurde der Tod von Johannes Paul der Welt verkündet. Die öffentliche Trauer war atemberaubend, und schon bald nannten ihn viele, wenn auch inoffiziell, »den Großen«, ein Namenszusatz, der vor ihm nur den heiligen Päpsten Leo I. (440–461), Gregor I. (590–604) und Nikolaus I. (858–867) verliehen worden war. Sein Leichnam wurde in blutrote Gewänder gekleidet und in den Apostolischen Palast gebracht, wo ihm die Mitglieder der päpstlichen Verwaltungsbüros und der Römischen Kurie ihren Respekt erweisen konnten, bevor er am nächsten Tag in die Peterskirche überführt wurde, womit die offiziellen neun Tage der Trauer begannen. Diese sind als Novemdiale bekannt, eine Sitte, die auf das novemdiale sacrum zurückgeht, einen alten römischen Reinigungsritus, der am letzten Tag einer neuntägigen Festivität durchgeführt wurde.15Schätzungsweise vier Millionen Pilger und drei Millionen Bürger Roms defilierten vorbei, um für diesen geliebten Menschen zu danken und zu beten. Erstaunliche Zahlen, wenn man sie mit dem vorherigen Rekord von 750000 Besuchern vergleicht, die dem Leichnam Papst Pauls VI. im August 1978 die letzte Ehre erwiesen hatten. Johannes Paul hatte Anweisungen hinterlassen, dass seine letzte Rede vom Stellvertreter des Staatssekretariats, Erzbischof Leonardo Sandri, verlesen werden sollte, falls er nicht mehr am Leben wäre, um dies persönlich zu tun. Während der Messe auf dem Petersplatz am Sonntag, dem 3. April, verlas Sandri die letzte Botschaft von Johannes Paul über Frieden, Vergebung und Liebe, in der er den Gläubigen verkündete: »Der Menschheit, die bisweilen verloren und von der Macht des Bösen, des Egoismus und der Angst beherrscht scheint, bietet der auferstandene Herr das Geschenk seiner Liebe an, die vergibt, versöhnt und den Geist der Hoffnung neu eröffnet. Es ist die Liebe, die die Herzen bekehrt und den Frieden schenkt.«16
Das war schwer zu überbieten.
Nun galt es, keine Zeit zu verlieren. Die Tradition des Interregnums verlangt, dass die Beisetzung eines Papstes zwischen dem vierten und sechsten Tag nach dessen Tod erfolgen muss. Daher wurde sie auf Freitag, den 8. April, angesetzt. Ebenso darf das Konklave zur Wahl seines Nachfolgers nicht früher als fünfzehn und nicht später als zwanzig Tage nach seinem Tod stattfinden, und so wurde angekündigt, dass es am 18. April beginnen würde.
Der Vatikan begann, die Bestattung mit militärischer Präzision zu planen. Als Dekan des Kardinalskollegiums, der zwar keine Autorität über seine Kardinalsbrüder besitzt, aber als primus inter pares gilt,17 fiel die Verantwortung für den Ablauf Joseph Ratzinger zu. Zudem war er vierundzwanzig Jahre lang die rechte Hand Johannes Pauls gewesen.
Johannes Paul II., der wegen seiner zahlreichen Besuche von insgesamt 129 Ländern auch den Spitznamen Pilgerpapst trug, war weiter gereist als sämtliche Päpste in der zweitausendjährigen Geschichte der Kirche vor ihm zusammengenommen, um sicherzustellen, dass Staatsoberhäupter, Könige und Würdenträger aus der ganzen Welt an der Seite der katholischen Gläubigen waren. Selten in der Geschichte hatte sich eine heterogenere Gruppe von Menschen versammelt, und viele gegnerische Nationen wurden durch ihren jeweiligen Respekt vor dem verstorbenen Papst geeint. Prinz Charles verschob seine Hochzeit mit Camilla Parker-Bowles, damit er neben dem britischen Premierminister Tony Blair und dem Erzbischof von Canterbury, Rowan Williams, an der Zeremonie teilnehmen konnte. US-Präsident George W. Bush wurde dabei beobachtet, wie er sich hinüberneigte, um die Hand des französischen Präsidenten und hartnäckigen Irak-Krieg-Kritikers Jacques Chirac zu schütteln, während im Publikum UN-Generalsekretär Kofi Anan neben den ehemaligen Präsidenten Bill Clinton und George H.W. Bush stand. Der israelische Präsident Moshe Katsav sprach mit dem syrischen Führer Bashar al-Assad und dem iranischen Präsidenten Mohammed Khatami und schüttelte ihnen die Hände (obwohl Khatami später diesen Austausch kategorisch leugnete).
Es sollte das größte Begräbnis für einen Papst in der Geschichte der katholischen Kirche werden, und schätzungsweise zwei Milliarden Menschen weltweit sahen sich die Live-Übertragung im Fernsehen an, eine Million von ihnen auf großen, eigens für die Stadt Rom errichteten Außenbildschirmen.
Die Zeremonie begann mit einer privaten Messe im Petersdom, an der Mitglieder des Kardinalskollegiums und die neun Patriarchen der orthodoxen Ostkirchen teilnahmen, die zwar verschiedene Liturgien feiern und über eigene Regierungsstrukturen verfügen, sich aber als Teil einer Kirchengemeinschaft dem Papst verbunden fühlen. Der Leichnam des Papstes wurde gemäß einer jahrhundertealten Tradition, die bezeugt, dass er ein Mensch unter Menschen ist, in einen Sarg aus Zypressenholz gelegt, den später zwei weitere Särge aus Blei und Ulmenholz als Zeichen seines Todes sowie seiner Würde umschließen sollten. In den Sarg wurde ein versiegeltes Dokument gelegt, das offiziell sein ganzes Lebenswerk als Papst abschloss, und drei Säckchen, die jeweils eine Gold-, Silber- oder Kupfermünze für jedes Jahr unter Papst Johannes Paul II. enthielten18, bevor ein weißer Seidenschleier über sein Gesicht und seine Hände gebreitet wurde. Nach Abschluss dieser Zeremonie wurde der nun geschlossene Sarg von zwölf Edelmännern Seiner Heiligkeit (Gentiluomini di Sua Santità) getragen – früher bekannt als Geheimkämmerer; Mitglieder adeliger römischer Familien, die den Päpsten seit Jahrhunderten als Laienbegleiter des päpstlichen Haushalts gedient haben – und von der langsamen Prozession der Kirchgänger begleitet, die auf den mittleren Petersplatz hinausschritten, um die öffentliche Beisetzung einzuleiten.
Viele glauben, dass Kardinal Ratzingers Verhalten während dieses dreistündigen Spektakels ihm das Papsttum sicherte. In seiner Predigt sprach er unter wiederholtem Beifall aus der Menge ausführlich in »menschlichen, nicht metaphysischen Begriffen« von Johannes Pauls Kindheit in Polen bis zum Ende seiner Tage in Rom.19 In seiner abschließenden Erinnerung an einen der letzten öffentlichen Auftritte des Papstes brach seine sonst meist emotionslose und äußerst förmliche Stimme, und er musste seine Tränen hinunterschlucken. Es war ein großartiger und bewegender Auftritt für alle, die ihn miterlebten.
Als das Begräbnis zu Ende ging und sich die Wagenkolonnen und Hubschrauber der Würdenträger entfernten, sangen die Menschenmengen Santo subito (»Heiligsprechung jetzt«). Als sich schließlich die Erschöpfung über die Stadt legte und die Menschen, die zu müde waren, um die Heimreise anzutreten, auf den Straßen schliefen, sprach man im Vatikan und in den Medien der Welt darüber, wer der Nachfolger jenes Papstes werden würde, der nun nach seinem Wunsch in der »nackten Erde« der Krypta unter der Peterskirche begraben lag.20
Eine heikle Aufgabe für die wahlberechtigten Kardinäle
Da nur zehn Tage Zeit blieben, ehe die 115 für das Begräbnis in Rom versammelten Kardinäle ins Konklave einberufen werden würden, war es nun angesagt, in diskreten Gesprächen – denn offener Wahlkampf ist streng verboten – zu eruieren, welche Kandidaten favorisiert werden sollten. Dies war ein heikler Balanceakt, und der Prozess musste sorgfältig gehandhabt werden, um das gefürchtete »Pignedoli-Prinzip« zu vermeiden. Diese anerkannte Theorie, aufgestellt von George Weigel vom Ethics and Public Policy Centre in Washington D.C. und benannt nach Kardinal Sergio Pignedoli – der bei den Medien als Spitzenkandidat des Konklaves von 1978 galt, bei dem Papst Johannes Paul II. gewählt wurde –, besagt, dass »die Chancen eines Mannes, Papst zu werden, in dem Maße sinken, wie häufig er in der Presse als papabile (inoffizieller Begriff für Kardinäle, die als potentielle zukünftige Päpste angesehen werden) bezeichnet wird«.21 Theoretisch waren alle Kardinäle, die am Konklave teilnahmen, wählbare Kandidaten, doch hinter dieser Fassade der Einfachheit verbarg sich eine Vielzahl unterschiedlicher theologischer und politischer Ansichten, die die Wahl eines Nachfolgers für den Stuhl Petri alles andere als einfach machten, so, wie es bereits in den letzten 729 Jahren seit dem ersten Konklave im Jahr 1276 der Fall gewesen war.
Nach einer Hängepartie, die zu einem Interregnum von fast drei Jahren geführt hatte, wurde 1271 Papst Gregor X. gewählt, der das Konklave als solches entwickelte, um den Prozess der Papstwahl zu erleichtern. Er bestimmte, dass die Kardinäle bis zu einer Entscheidung im Konklave bleiben mussten und, falls sie nach fünf Tagen oder mehr noch zu keiner Entscheidung gelangt waren, sogar nur noch Brot, Wasser und Wein bekamen. Trotz seiner Bemühungen, diese Veränderungen umzusetzen, wurden nach dem Tod Gregors am 10. Januar 1276 aufgrund von politischen Machtkämpfen vier Päpste in ebenso vielen Jahren gewählt, und es kam noch zu drei weiteren Sedisvakanzen von über zwei Jahren, zwischen 1292 und 1294, 1314 und 1316 sowie 1415 und 1417. Jahrhunderte vergingen, bis die Konklaven nicht mehr länger als eine Woche dauerten; erst 1831 mit der Wahl von Papst Pius VIII. nahm dies ein Ende. Alle Kardinalsversammlungen außer einer fanden in Rom statt – was möglicherweise die absolute Dominanz der Italiener auf dem Papstthron von 1523 bis zur Wahl des Polen Johannes Paul II. 1978 beeinflusste – und waren vor der Entscheidung für Papst Franziskus im Jahr 2013 eine rein europäische Angelegenheit.
Die Liebe und Zuneigung zu Johannes Paul, die Millionen von Trauernden bei seiner Beerdigung bewiesen hatten, hätten zu der Annahme verleiten können, die katholische Kirche sei in besserer Verfassung gewesen als je zuvor. Die harte Realität war jedoch, dass dies eine Kirche war, die zunehmend im Widerspruch zur modernen Gesellschaft stand und nicht in der Lage schien, einen Weg zu finden, um mit ihr Schritt zu halten, geschweige denn, im Leben ihrer Anhänger auf der ganzen Welt eine führende Rolle zu spielen. Johannes Paul hatte während seiner Amtszeit wie kein anderer die Gläubigen berührt, doch die schwindende Anzahl der Kirchenbesucher bewies, dass dies einfach nicht ausreichte, um die Position der Kirche aufrechtzuerhalten. Michael J. Lacey, Mitautor des Werks The Crisis of Authority in Catholic Modernity, schrieb dazu, die katholische Kirche leide unter einer »zugrundeliegenden Krise der Autorität. […] [D]ie Laien scheinen zu lernen, mit ihr [der Kirche] zu ihrer eigenen Zufriedenheit umzugehen, indem sie nicht zu viel von Rom oder von ihren Ortsbischöfen erwarten …«22. Was musste die Kirche tun, um diese Probleme zu bekämpfen?
Verschärft worden waren die Probleme durch die vielen Fälle sexuellen Missbrauchs, die die Kirche 2002erschütterten und bis heute belasten. Der Vatikan verteidigte hartnäckig Johannes Pauls Aufzeichnungen über den Umgang mit Missbrauchsfällen, die der Kirche gemeldet wurden, und behauptete 2014, dass er nicht erkannt habe, wie schlimm dieser »Krebs« war, weil wegen der »Reinheit« seines Geistes und seiner Gedanken diese ganze Situation für ihn schlicht »unglaublich« gewesen sei.23 Aber die Krise war in den Köpfen der versammelten Kardinäle nur allzu präsent, und wie der angesehene katholische Autor und Journalist David Gibson beschreibt, »ging die Wut über den Skandal viel tiefer als die über den sexuellen Missbrauch selbst … und richtete sich hauptsächlich gegen die Autoritäten, die solche Verbrechen jahrelang, ja, jahrzehntelang unkontrolliert hatten geschehen lassen. In diesem Sinne waren die Missbrauchsskandale symptomatisch für eine größere Krise der Kirche, die sich darauf konzentrierte, wie die Autorität – und die damit einhergehende Macht – in der Kirche von Johannes Paul II. ausgeübt wurde«24.
Neben diesen Schlüsselthemen brachten die Kardinäle ihre eigenen regionalen Probleme mit an den Tisch, darunter den »Säkularismus in Westeuropa, den Aufstieg des globalen Islam, die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich im Norden und Süden und das richtige Gleichgewicht in der Kirchenregierung zwischen Zentrum und Peripherie«.25
Dank der positiven medialen Aufmerksamkeit rund um das Begräbnis hätte man leicht zu der Annahme verleitet werden können, dass der Überschwang der öffentlichen Gefühle der Kirche nun eine Möglichkeit geboten hätte, die eigenen institutionellen Mängel anzugehen. Intern jedoch war man entgegengesetzter Meinung. Man hatte das Gefühl, dass die Probleme, mit denen die Kirche in Zukunft konfrontiert werden würde, so gewaltig waren, dass radikale Veränderungen an diesem entscheidenden Wendepunkt nicht die unterschiedlichen Probleme lösen konnten, denen die Kardinäle aus den westlichen Nationen und den Entwicklungsländern gegenüberstanden, und dabei gleichzeitig das Erbe Johannes Pauls, des inspirierenden und engagierten Mannes des Volkes, fortsetzten. Das war eine zu schwere Aufgabe, und die Kardinäle waren größtenteils der Überzeugung, dass sie eine zuverlässige Person und einen reibungslosen Übergang brauchten, um Probleme zu lösen, die die Kirche irreparabel zu erschüttern drohten. Die große Frage war: Wer konnte diese Person sein?
Die Kandidaten
Als der Druck zunahm, ergriff der Vatikan die bislang beispiellose Maßnahme, vom 8. April bis zur Eröffnung des Konklaves eine Nachrichtensperre zu verhängen. Abgesehen von der Ironie eines solchen Schrittes, da der Prozess selbst geheim war, wurde dies von vielen Medienvertretern als frustrierende Einmischung durch keinen anderen als den berüchtigten vatikanischen Wächter über Regeln und Doktrinen, den Präfekten der Kongregation der Glaubenslehre, Kardinal Ratzinger, angesehen. In Wahrheit bemühte man sich jedoch um ausgleichende Gerechtigkeit zugunsten der Kardinäle aus nicht-italienischen oder nicht-englischsprachigen Ländern, insbesondere aus Afrika, Südamerika und Asien, die sich gegenüber lokalen und anderen europäischen und amerikanischen Kardinälen benachteiligt fühlten. Denn diese erhielten in den Medien unverhältnismäßig viel Sendezeit und konnten ihre Meinung zu den Fragen, mit denen die Kirche konfrontiert war, wesentlich ausführlicher darlegen.
Westeuropa
26 (23 %)
Osteuropa
12 (10 %)
Italien
20 (17 %)
Afrika
11 (10 %)
Lateinamerika
20 (17 %)
Naher Osten & Asien
10 (9 %)
Nordamerika
14 (12 %)
Australien & Neuseeland
2 (2 %)
Die Nachrichtensperre konnte – wenig überraschend – nicht verhindern, dass Klatsch in die Zeitungen drang, aber viele der Kardinäle blieben diplomatisch und beharrten darauf, dass es im Vorfeld des Konklaves keinen klaren Favoriten gebe. In Wirklichkeit wurde über eine ganze Reihe von Kandidaten spekuliert, die sowohl konservative als auch liberal-progressive Ideologien vertraten. Nach dem sechsundzwanzigjährigen Papsttum von Johannes Paul galt es jedoch als relativ sicher, dass der neue Papst kein junger Mann sein würde, um eine wesentlich kürzere Amtszeit als die seines Vorgängers zu gewährleisten – obwohl nur wenige vermutet hätten, wie kurz sie tatsächlich sein würde. Wie der Autor Paul Collins bemerkt, »hätte ein geschwächter oder sogar seniler Papst, der nicht in der Lage oder nicht willens war zurückzutreten, die Kirche mit einem massiven konstitutionellen Dilemma konfrontieren können. Nach den derzeitigen Regeln kann niemand den Papst entlassen.«26 Das Papsttum, wie es Johannes Paul personalisiert hatte, führte zu einer Herrschaft, die eher einer zentralisierten Autokratie glich und in der den einzelnen Orden wenig Autonomie eingeräumt wurde. Folglich entstand ein direkter Zusammenhang zwischen der sich verschlechternden Gesundheit des Papstes und der eingeschränkten Handlungsfähigkeit der Kirche in dringenden Fragen. Die Kirche war in der Schwebe gelassen worden, unfähig, auf wichtige Entscheidungen zu reagieren, »gezwungen, auf der Stelle zu treten und wichtige Probleme unbehandelt zu lassen, während sie das Ende des Papstes erwartete«.27
Johannes Paul II. hatte mehr Kardinäle ernannt als jeder andere Pontifex zuvor – 231 – und im Februar 2001 den Rekord für die meisten gleichzeitig ernannten Kardinäle aufgestellt, nämlich vierundvierzig auf einmal: ein Ereignis, das viele als Schachzug betrachteten, um sein Erbe zu sichern. Er suchte nämlich gezielt Männer aus, die seine theologischen Ansichten über die Richtung teilten, die die Kirche nach seinem Tod einschlagen sollte. Rasch folgten weitere dreißig Ernennungen im Jahr 2003, wodurch die Gesamtzahl der Kardinäle, die noch jung genug waren, ins Konklave berufen zu werden – also unter achtzig, da ältere Kardinäle nicht mehr wählen dürfen –, 115 betrug. Zwar entsprachen nicht alle Johannes Pauls Vorstellungen von strenggläubigen Konservativen mit einer Leidenschaft für die entrechteten Armen, doch sein überragendes Vorbild sorgte dafür, dass sein Schatten zu Beginn der Wahl noch lange in den Köpfen vieler präsent war.
Die neun Vollversammlungen (bekannt als Konsistorien), bei denen Johannes Paul seine 231 neuen Kardinäle ernannte, fanden über einen Zeitraum von vierundzwanzig Jahren statt und hatten zur Entwicklung vieler unterschiedlicher Meinungen geführt. Vereinfacht ausgedrückt, gab es zwei gegensätzliche Lager innerhalb der modernen Kirche.
Die Konservativen
Diese Gruppe von Kardinälen war gerade wegen ihrer Loyalität zu Johannes Paul und seinen Lehren sowie des Glaubens an eine papstzentrierte Kirche ernannt worden, in der Hoffnung, dass sie seine Arbeit nach seinem Tod fortsetzen würden. Sie glaubten, der »Katholizismus müsse sich zunehmend gegen die vorherrschende postmoderne Kultur stellen« und [es bestehe] »eine reale Gefahr, dass viele Katholiken, einschließlich Priester und Theologen, durch Säkularismus und Relativismus stark gefährdet seien«28. Im Grunde waren die konservativen Kandidaten alle zutiefst davon überzeugt, dass die Doktrin nicht geändert werden durfte und die Kirche sich nicht einer sich verändernden Gesellschaft anpassen sollte.
KARDINAL JOSEPH RATZINGER, DEUTSCHLAND (78)
Als langjährige rechte Hand von Johannes Paul II. und daher von vielen als wahrscheinlicher Nachfolger betrachtet, galt Kardinal Joseph Ratzinger von Anfang an als Spitzenkandidat.
Von den 115 wahlberechtigten Kardinälen war Ratzinger einer von nur zwei, die Johannes Paul II. nicht selbst ernannt hatte. Die beiden Männer waren jedoch während ihrer Kardinalszeit eng verbunden gewesen. Ratzinger selbst beschrieb es so: »Gleich als er Papst wurde, hat er sich vorgenommen, mich als Präfekten der Kongregation für die Glaubenslehre [CDF] nach Rom zu berufen. Er hatte ein großes, ganz herzliches und tiefes Vertrauen in mich gesetzt. Sozusagen als die Gewähr dafür, dass wir den richtigen Kurs im Glauben fahren.«29 Ratzinger, der diese Rolle seit 1981 innehatte, war Johannes Pauls Wachhund in puncto Glaubensdoktrin – die Journalisten nannten ihn »Gottes Rottweiler«, seine Mitbrüder »Panzerkardinal« – und einer der mächtigsten Männer im Vatikan. Die beiden Männer teilten und vertraten radikal-konservative Überzeugungen, die von einem sozialen Gewissen gegenüber den Armen und Benachteiligten gemildert wurden.
Die offizielle Rolle der 1542 gegründeten CDF, wahrscheinlich besser bekannt unter ihrem ursprünglichen Namen Sacra Congregatio Romanae et universalis Inquisitionis, »Heilige Römische und Universale Inquisition«, bestand darin, »die Glaubenslehre und ihre Traditionen in der ganzen katholischen Welt zu fördern und zu verteidigen«.30 Die Welt hatte sich seit den Tagen der Ketzerei und Inquisition im 16. Jahrhundert jedoch ein wenig verändert. Dem letzten Vatikanischen Konzil von 1962–1965 (besser bekannt als Vaticanum II) war es gelungen, die katholische Kirche, »einen Teil davon um sich tretend und schreiend, aus dem frühen neunzehnten in die Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts zu ziehen … und die Kirche für die heutige Welt zu öffnen …, um mit ihr in einen ernsthaften, aber kritischen Dialog zu treten«.31 Viele erkannten schnell, dass die Ergebnisse des Konzils Raum für durchaus kontroverse Interpretationen öffneten. Als Johannes Paul II. Papst wurde, waren daher viele von denen, die ihn für einen liberalen und fortschrittlichen Kandidaten gehalten hatten, überrascht, wie schnell er das Zweite Vatikanische Konzil in einem viel konservativeren Licht neu auslegte.
Aus seiner Abteilung in der Kongregation für die Glaubenslehre heraus hatte Ratzinger das letzte Wort über die Durchsetzung von Johannes Pauls theologischer Auslegung des Zweiten Vatikanischen Konzils sowie über Disziplinarangelegenheiten innerhalb der Kirche – zuletzt auch über aufsehenerregende Fälle von sexuellem Missbrauch. Ratzinger brachte seine Sorge um die Zukunft der Kirche in einer Rede am Tag vor dem Tod Johannes Pauls zum Ausdruck, in der er beklagte, dass Nordamerika und Europa »eine Kultur entwickelt haben, die Gott vom öffentlichen Bewusstsein ausschließt, entweder, indem [die Menschen] ihn ganz leugnen, oder indem sie behaupten, seine Existenz könne nicht nachgewiesen werden, sei ungewiss und daher ein wenig irrelevant«.32
Neben seiner zentralen Rolle in der CDF bekleidete Ratzinger auch das Amt des Dekans des Kardinalskollegiums. Als es zum Konklave kam, hatte er wieder einmal den Vorsitz bei einem offiziellen Verfahren inne. Dafür war er bestens gerüstet, denn er kannte alle Kardinäle namentlich und sprach darüber hinaus nachweislich zehn Sprachen. Zuvor als stiller, aber umstrittener Theologe und Wissenschaftler mit schwacher öffentlicher Präsenz gehandelt, führte sein erfolgreicher Umgang mit den Ereignissen vor und nach dem Tod Johannes Pauls zu einem gewaltigen Meinungsumschwung zu seinen Gunsten.
Es war nicht nur seine souveräne Beerdigungspredigt für Johannes Paul, die viele Kardinäle begeistert hatte. Am Karfreitag, dem 25. März 2005