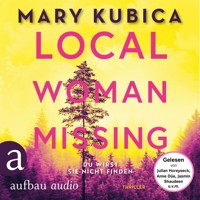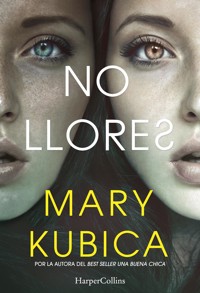2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Vertraust du deiner Familie?
Die junge Lehrerin Mia Dennett verschwindet spurlos, nachdem sie abends mit einem fremden Mann eine Bar verlassen hat. Monate später wird sie aus einer einsamen Blockhütte in den Wäldern Minnesotas befreit. Mia ist völlig wesensverändert, zutiefst verstört und kann sich nur bruchstückhaft erinnern. Und warum nennt sie sich auf einmal Chloe? Als Detective Gabe Hoffman den Fall übernimmt, stößt er auf ungeahnte Abgründe in Mias Familie – und der wahre Albtraum beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
MaryKubica
GOODGIRL
ENTFÜHRT
Roman
Aus dem Amerikanischen von Jens Plassmann
Zum Buch
Die junge Lehrerin Mia Dennett verschwindet spurlos, nachdem sie abends mit einem fremden Mann eine Bar verlassen hat. Monate später wird sie aus einer einsamen Blockhütte in den Wäldern Minnesotas befreit. Mia ist völlig wesensverändert, zutiefst verstört und kann sich nur bruchstückhaft erinnern. Und warum nennt sie sich auf einmal Chloe? Als Detective Gabe Hoffman den Fall übernimmt, stößt er auf ungeahnte Abgründe in Mias Familie – und der wahre Albtraum beginnt.
»Ein raffiniertes und hoch spannendes Debüt über die Lügen, die wir vor allem uns selbst erzählen.«Lisa Gardner
»Nichts ist, wie es scheint. Das erinnert an Gone Girl, doch Kubicas Heldin hat zudem noch ein Herz.« Publishers Weekly
»Ein starker Thriller und ein psychologisches Puzzle.« BookPage
»Ein großartiges Debüt voller überraschender Wendungen.«
Los Angeles Times
»Dieser Roman wird sie lange wach halten!«Chicago Book Review
»Bis zum Schluss hat der Leser keine Ahnung, was wirklich passiert.« Booklist
»Mary Kubica erzählt von einer Entführung, die völlig anders abläuft als erwartet. Ein außergewöhnlicher und hoch spannender Roman.« Huffington Post
Zur Autorin
Mary Kubica lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Chicago. Sie studierte amerikanische Geschichte und Literatur und widmet sich heute dem Schreiben. Good Girl. Entführt, ihr erster Roman, wurde in den USA von Lesern und Presse mit großer Begeisterung aufgenommen.
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel The Good Girl
bei Harlequin MIRA, Ontario, Kanada
Deutsche Erstausgabe 05/2015
Copyright © 2014 by Mary Kyrychenko
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2015 by Diana Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion | Johanna Cattus-Reif
Umschlaggestaltung | t.mutzenbach design, München
Umschlagmotive | © shutterstock/Nejron Photo
Satz | Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-641-15353-3
www.diana-verlag.de
Für A & A
Eve
VORHER
Ich sitze am Frühstückstisch und nippe an meinem Becher Kakao, als das Telefon klingelt. Abwesend blicke ich hinaus in den Garten, der nach dem frühen Herbsteinfall dicht mit Laub bedeckt ist. Nur noch wenige Blätter hängen leblos an den Bäumen.
Es ist Nachmittag. Der Himmel ist bewölkt, die Temperaturen sind bis in den einstelligen Bereich gestürzt. Das geht mir alles viel zu schnell, denke ich. Wo um alles in der Welt ist die Zeit geblieben? Hatten wir nicht gestern erst den Frühling begrüßt und wenig später den Sommer?
Das Klingeln schreckt mich zwar auf, aber da ich mir sicher bin, dass es nur irgendein Telefonverkäufer sein wird, mache ich mir nicht sofort die Mühe, von meinem Platz aufzustehen. Ich genieße diese letzten Stunden der Ruhe, die mir bleiben, bevor James durch die Haustür poltern und in meine Welt einbrechen wird, und habe nicht die geringste Lust, diese kostbaren Minuten an irgendeinen aufdringlichen Verkäufer zu verschwenden, dessen Angebot ich sowieso ablehnen werde.
Das nervige Läuten des Telefons hört auf und setzt wieder ein. Ich hebe ab, nur um es zum Schweigen zu bringen.
»Hallo?«, frage ich in gereiztem Ton und lehne mich mit der Hüfte gegen die Kochinsel.
»Mrs. Dennett?«, erkundigt sich eine Frau. Einen Augenblick lang spiele ich mit dem Gedanken, ihr zu sagen, dass sie sich verwählt hat, oder ihren Versuch sofort mit einem Danke, kein Interesse abzublocken.
»Am Apparat.«
»Mrs. Dennett, hier ist Ayanna Jackson.« Den Namen kenne ich. Begegnet bin ich ihr noch nie, aber sie ist seit über einem Jahr eine fixe Größe in Mias Leben. Wie oft habe ich Mia ihren Namen erwähnen hören. Ayanna und ich haben dies gemacht … Ayanna und ich haben das gemacht … Sie erklärt, woher sie Mia kennt, dass sie beide auf der alternativen Highschool in der Stadt unterrichten. »Ich hoffe, ich störe Sie nicht bei irgendetwas«, sagt sie.
Ich atme tief durch. »O nein, Ayanna, ich bin gerade nach Hause gekommen«, lüge ich.
Mia wird in einem knappen Monat fünfundzwanzig. Am 31. Oktober. Sie ist an Halloween geboren, und vermutlich ruft Ayanna deshalb an. Bestimmt möchte sie für meine Tochter eine Party veranstalten. Vielleicht eine Überraschungsparty?
»Mrs. Dennett, Mia ist heute nicht auf der Arbeit erschienen«, sagt sie.
Mit dieser Eröffnung habe ich nicht gerechnet. Ich brauche einen Moment, um mich zu sammeln. »Dann wird sie wohl krank sein«, erwidere ich. Instinktiv versuche ich sofort, meine Tochter in Schutz zu nehmen. Gewiss gibt es eine überzeugende Erklärung dafür, dass sie nicht zur Arbeit gekommen ist oder angerufen hat. Meine Tochter ist ein Freigeist, das stimmt, aber sie ist sehr zuverlässig.
»Haben Sie etwas von ihr gehört?«
»Nein«, sage ich, aber das ist nicht ungewöhnlich. Manchmal vergehen Tage oder Wochen, ohne dass wir voneinander hören. Seit der Erfindung der E-Mail ist das Weiterleiten irgendwelcher banaler Nachrichten unsere bevorzugte Form der Kommunikation geworden.
»Ich habe es bei ihr zu Hause versucht, aber da geht niemand ran.«
»Haben Sie eine Nachricht hinterlassen?«
»Mehrere.«
»Und sie hat nicht zurückgerufen?«
»Nein.«
Ich verfolge nur halbherzig, was die Frau am anderen Ende der Leitung sagt. Stattdessen beobachte ich die Nachbarskinder, die ein schwaches Bäumchen schütteln, damit die letzten verbliebenen Blätter auf sie herabregnen. Die Kinder sind meine Uhr. Tauchen sie im Garten auf, weiß ich, es ist Nachmittag, die Schule ist aus. Verschwinden sie wieder im Haus, wird es Zeit, das Abendessen zuzubereiten.
»Und ihr Handy?«
»Da meldet sich sofort die Mailbox.«
»Haben Sie …«
»Ich habe eine Nachricht hinterlassen.«
»Sind Sie sicher, dass sie sich den ganzen Tag nicht in der Schule gemeldet hat?«
»In der Verwaltung haben sie nichts von ihr gehört.«
Ich habe Angst, dass Mia Ärger bekommen wird. Ich habe Angst, dass sie rausgeworfen wird. Dass sie selbst in Schwierigkeiten stecken könnte, ist mir noch nicht in den Sinn gekommen.
»Hoffentlich hat das nicht für allzu viele Probleme gesorgt.«
Ayanna zufolge hat in Mias erster Stunde niemand aus der Klasse die Abwesenheit der Lehrerin gemeldet, sodass erst in der zweiten Stunde endlich nach außen drang: Ms. Dennett ist heute nicht gekommen und auch keine Vertretung. Daraufhin ist der Schulleiter in die Klasse gegangen, bis eine Vertretung organisiert werden konnte. Dort hat er dann entdeckt, dass mit den teuren Künstlerfarben, die Mia von ihrem eigenen Geld gekauft hat, nachdem die Schulverwaltung eine Anschaffung abgelehnt hatte, Gang-Graffiti auf die Wände geschmiert worden waren.
»Finden Sie das nicht auch merkwürdig, Mrs. Dennett?«, fragt sie. »Das passt gar nicht zu Mia.«
»Ach, Ayanna, dafür hat sie bestimmt triftige Gründe.«
»Und welche könnten das sein?«, fragt sie.
»Ich werde mal bei den Krankenhäusern anrufen. Es gibt da eine Nummer für ihre Gegend …«
»Hab ich schon gemacht.«
»Dann bei ihren Freunden«, sage ich, obwohl ich Mias Freunde überhaupt nicht kenne. Namen wie Ayanna und Lauren habe ich beiläufig aufgeschnappt, und ich weiß von jemandem aus Simbabwe, der nur ein Studentenvisum hat und zurückgeschickt werden soll, was Mia absolut unfair findet. Aber ich kenne diese Leute nicht, und Nachnamen oder Kontaktdaten wären schwer zu besorgen.
»Hab ich auch schon gemacht.«
»Sie wird schon wieder auftauchen, Ayanna. Das ist alles bestimmt nur ein Missverständnis. Dafür kann es Millionen von Gründen geben.«
»Mrs. Dennett«, sagt Ayanna, und auf einmal wird es mir klar: Etwas ist nicht in Ordnung. Es trifft mich wie ein Schlag in den Bauch, und sofort muss ich daran denken, wie ich mit Mia im achten oder neunten Monat schwanger war und ihre strammen Beinchen und Ärmchen mit solcher Wucht um sich getreten und geschlagen haben, dass sich in meiner Haut winzige Füße und Hände abzeichneten. Ich ziehe einen Barhocker heraus, setze mich an die Kücheninsel und erinnere mich plötzlich daran, dass Mia demnächst fünfundzwanzig wird und ich mir noch kein Geschenk überlegt habe. Weder habe ich ihr eine Feier angeboten noch vorgeschlagen, in einem schicken Restaurant in der Stadt einen Tisch für James, Grace, Mia und mich zu reservieren.
»Was sollen wir Ihrer Meinung nach denn tun?«, frage ich.
Am anderen Ende ist ein Seufzen zu hören. »Ich hatte gehofft, Sie würden mir sagen, Mia ist bei Ihnen«, sagt sie.
Gabe
VORHER
Es ist schon dunkel, als ich vor dem Haus eintreffe. Aus den Fenstern der stattlichen Villa im Tudorstil strömt Licht und erhellt die von Bäumen gesäumte Straße. Drinnen kann ich eine kleine Gruppe von Leuten erkennen, die bereits auf mich wartet. Da ist der Richter, der im Raum auf und ab geht, und Mrs. Dennett, die auf der Kante eines gepolsterten Stuhls hockt und aus einem Glas trinkt, das etwas Alkoholisches zu enthalten scheint. Dann sind ein paar uniformierte Beamte anwesend und eine weitere Frau, eine Brünette, die gerade aus dem Fenster sieht, als ich bedächtig am Straßenrand anhalte und meinen großen Auftritt damit noch ein wenig verzögere.
Die Dennetts sind genau wie all die anderen Familien an Chicagos North Shore, einer Ansammlung von Vororten, die sich nördlich der Stadt den Lake Michigan entlangzieht. Sie sind stinkreich. Kein Wunder also, dass ich noch auf dem Fahrersitz meines Wagens verharre, während ich eigentlich schon im vollen Bewusstsein der Macht, die ich angeblich besitze, auf den klotzigen Bau zumarschieren sollte.
Ich muss an die Worte des Sergeants denken, mit denen er mir den Fall übertragen hat: Verbocken Sie mir das bloß nicht.
Sicher und warm sitze ich in meinem schäbigen Auto und betrachte das imposante Gebäude. Es besitzt den für ein Tudorhaus typischen Charme der Alten Welt: Fachwerk, niedrige Fenster und steile Dreiecksgiebel. Mich erinnert es an eine mittelalterliche Burg. Obwohl ich sehr entschieden zur Vertraulichkeit ermahnt wurde, sollte ich mich im Grunde geschmeichelt fühlen, dass der Sergeant mich mit einem Fall von derart großem öffentlichen Interesse beauftragt hat. Aus irgendeinem Grund tue ich das aber nicht.
Ich laufe quer über den Rasen zum Gehweg, steige die beiden Stufen zur Eingangstür hoch und klopfe. Es ist kalt. Während ich warte, stopfe ich die Hände in die Jackentaschen. Meine billigen kakifarbenen Hosen und das Polohemd, das ich unter meiner Lederjacke zu verbergen suche, kommen mir lächerlich unpassend vor, als mir einer der einflussreichsten Richter des Landes die Tür öffnet.
»Richter Dennett«, sage ich und trete ein. Ich bewege mich mit mehr Autorität, als ich wohl habe, und zeige Anzeichen eines Selbstbewusstseins, das ich für Momente wie diese irgendwo unter Verschluss gehalten haben muss. Richter Dennett ist ein Mann von eindrucksvoller Statur und Macht. Wenn ich das Ding in den Sand setze, bin ich im besten Fall meinen Job los. Mrs. Dennett erhebt sich von ihrem Stuhl. In meinem kultiviertesten Ton sage ich zu ihr: »Behalten Sie doch bitte Platz.« Die andere Frau, die deutlich jünger ist, wahrscheinlich Ende zwanzig oder Anfang dreißig, und bei der es sich meinen ersten Nachforschungen zufolge um Grace Dennett handeln dürfte, kommt uns entgegen und stellt sich zu Richter Dennett und mir in den Übergang zwischen Eingangshalle und Wohnzimmer.
»Detective Gabe Hoffman«, sage ich ohne weitere Begrüßungsfloskeln. Ich lächle nicht, ich biete niemandem die Hand an. Tatsächlich stellt die junge Frau sich als Grace vor. Wie ich durch meinen Backgroundcheck weiß, ist sie in der Kanzlei Dalton & Meyers als Anwältin angestellt. Und rein intuitiv weiß ich, dass sie mir auf Anhieb unsympathisch ist. Sie strahlt schon so ein Gefühl von angeborener Überlegenheit aus, wie sie geringschätzig meine ordinäre Straßenkluft mustert, und spricht mit diesem zynischen Unterton, bei dem ich Zustände bekomme.
Mrs. Dennett ergreift das Wort. Sie hat noch immer einen starken britischen Akzent, obwohl sie meinen Recherchen nach bereits seit ihrem neunzehnten Lebensjahr in den Vereinigten Staaten lebt. Sie scheint mit den Nerven am Ende zu sein. Zumindest ist das mein erster Eindruck. Ihre Stimme klingt schrill, ihre Finger spielen an allem herum, was in Reichweite liegt. »Meine Tochter wird vermisst, Detective«, bricht es aus ihr heraus. »Keiner ihrer Freunde hat sie gesehen. Niemand hat etwas von ihr gehört. Ständig rufe ich auf ihrem Handy an und hinterlasse Nachrichten.« Sie kämpft verzweifelt gegen die Tränen an, beginnt zu stammeln. »Ich bin zu ihrer Wohnung gefahren, um zu sehen, ob sie dort ist. Den ganzen Weg zu ihr raus bin ich gefahren, und dann hat der Vermieter mich nicht hineingelassen.«
Mrs. Dennett ist eine atemberaubende Erscheinung. Der oberste Knopf ihrer Bluse steht offen, und ich kann meinen Blick nicht von dem langen blonden Haar lösen, das voll und schwer auf dem sich durch das Dekolleté abzeichnenden Ansatz ihrer Brüste liegt. Ich kenne bereits Fotos von Mrs. Dennett, wie sie neben ihrem Mann auf der Treppe zum Gericht steht. Aber Fotos sind kein Vergleich zum Anblick von Eve Dennett in natura.
»Wann haben Sie zuletzt mit ihr gesprochen?«, frage ich.
»Vergangene Woche«, sagt der Richter.
»Nicht vergangene Woche, James«, sagt Eve. Die Miene ihres über die Unterbrechung verärgerten Mannes lässt sie kurz stutzen, bevor sie fortfährt: »Es war die Woche davor. Vielleicht sogar zwei Wochen davor. So ist es nun einmal um unsere Beziehung zu Mia bestellt. Manchmal kommen wir wochenlang nicht dazu, miteinander zu reden.«
»Also ist daran noch nichts Außergewöhnliches?«, frage ich. »Ich meine, eine Weile gar nichts von ihr zu hören?«
»Nein«, gibt Mrs. Dennett zu.
»Und wie sieht es bei Ihnen aus, Grace?«
»Wir haben uns letzte Woche gesprochen. Nur ein kurzer Anruf. Mittwoch, glaube ich. Vielleicht auch Donnerstag. Ja, es war Donnerstag, weil sie anrief, als ich gerade das Gerichtsgebäude betrat und zu einer Verhandlung musste, bei der es um einen Ablehnungsantrag von Beweismitteln ging.« Die Nebenbemerkung sollte mir offenbar bedeuten, dass sie Anwältin ist. Als würden der Nadelstreifenblazer und die lederne Aktentasche zu ihren Füßen daran noch irgendeinen Zweifel lassen.
»Irgendetwas Ungewöhnliches?«
»Nur Mia, wie man sie so kennt.«
»Und das bedeutet?«
»Gabe«, mischt der Richter sich ein.
»Detective Hoffman«, korrigiere ich bestimmt. Wenn ich ihn Richter nenne, kann er mich wenigstens mit Detective anreden.
»Mia ist ein sehr unabhängiger Mensch. Sie folgt in allem, was sie tut, nur ihrem eigenen Kopf, könnte man sagen.«
»Ihre Tochter ist also vermutlich seit Donnerstag verschwunden, ja?«
»Eine Freundin hat gestern noch mit ihr gesprochen und sie auf der Arbeit gesehen.«
»Um wie viel Uhr?«
»Keine Ahnung … So um drei.«
Ich sehe auf meine Uhr. »Mit anderen Worten, sie wird seit siebenundzwanzig Stunden vermisst?«
»Stimmt es, dass sie erst als vermisst betrachtet wird, wenn sie achtundvierzig Stunden fort ist?«, erkundigt sich Mrs. Dennett.
»Natürlich nicht, Eve«, erwidert ihr Mann in abfälligem Ton.
»Nein, Ma’am«, sage ich und bemühe mich, besonders freundlich zu klingen. Die demütigende Art ihres Mannes gefällt mir nicht. »In Wahrheit sind bei Vermisstenanzeigen gerade die ersten achtundvierzig Stunden häufig die entscheidenden.«
Erneut mischt der Richter sich ein. »Meine Tochter ist keine vermisste Person. Sie ist bloß nicht an ihrem Platz. Sie tut irgendetwas Unüberlegtes, Fahrlässiges, irgendetwas Verantwortungsloses. Aber eine vermisste Person ist sie nicht.«
»Euer Ehren, wer hat denn nun Ihre Tochter zuletzt …« Da ich ein Klugscheißer bin, kann ich es mir einfach nicht verkneifen: » … an ihrem Platz gesehen?«
Die Antwort kommt von Mrs. Dennett. »Eine Frau namens Ayanna Jackson. Sie ist eine Kollegin von Mia.«
»Haben Sie eine Nummer, unter der ich sie erreichen kann?«
»Auf einem Zettel in der Küche.« Ich nicke einem der Beamten zu, der in die Küche geht.
»Hat Mia so etwas schon einmal gemacht?«
»Nein, noch nie.«
Die Körpersprache von Grace und Richter Dennett besagen etwas anderes.
»Das stimmt nicht, Mom«, wirft Grace ein. Ich sehe sie erwartungsvoll an. Anwälte hören sich einfach ungeheuer gern selbst reden. »Fünf- oder sechsmal ist Mia bei verschiedenen Gelegenheiten von zu Hause abgehauen. Hat die ganze Nacht weiß Gott was mit weiß Gott wem getrieben.«
Ja, denke ich bei mir, Grace Dennett ist wirklich ein Aas. Grace hat das dunkle Haar ihres Vaters. Sie ist so groß wie ihre Mutter, hat aber den Körperbau ihres Vaters. Keine günstige Mischung. Manche Menschen würden Sanduhrfigur dazu sagen. Ich wahrscheinlich auch, wenn ich sie leiden könnte. Aber so würde ich sie einfach drall nennen.
»Das war etwas völlig anderes. Damals war sie noch in der Highschool. Sie war ein wenig naiv und ungezogen, aber …«
»Miss dieser Sache hier bitte nicht mehr Bedeutung zu, als sie hat, Eve«, sagt Richter Dennett.
»Trinkt Mia?«, frage ich.
»Selten«, sagt Mrs. Dennett.
»Woher willst du wissen, was Mia tut, Eve? Ihr beide sprecht euch doch kaum.«
Sie hebt die Hand, um sie gegen die laufende Nase zu pressen, und einen Moment lang bringt mich der Anblick des gewaltigen Diamanten an ihrem Finger völlig aus dem Konzept. Ich höre James Dennett nur noch mit halbem Ohr darüber lamentieren, dass seine Frau, ohne seine Heimkehr abzuwarten, unbedingt schon Eddie habe einschalten müssen. Bei dieser Bemerkung erschüttert mich allerdings die Tatsache, dass der Richter nicht nur ein Duzfreund meines Chefs ist, sondern ihn sogar ganz vertraulich beim Spitznamen nennt. Richter Dennett jedenfalls ist davon überzeugt, dass seine Tochter sich nur ein wenig herumtreibt und kein Anlass für offizielle Nachforschungen besteht.
»Sie glauben also, die Polizei sollte sich da raushalten?«, frage ich.
»Ja, sicher. Hier handelt es sich um eine innerfamiliäre Angelegenheit.«
»Wie sieht es denn mit Mias Arbeitsdisziplin aus?«
»Wie bitte?«, erwidert der Richter scharf. Über seine Stirn graben sich Falten, die er rasch mit einer ärgerlichen Handbewegung wegmassiert.
»Ich meine ihre Verlässlichkeit. Irgendwelche Probleme am Arbeitsplatz? Hat sie früher schon einmal unentschuldigt gefehlt? Ruft sie häufiger an und meldet sich krank, auch wenn sie es gar nicht ist?«
»Keine Ahnung. Sie hat einen Job. Sie hat ein Einkommen. Sie bestreitet ihren Lebensunterhalt. Da stelle ich keine Fragen.«
»Mrs. Dennett?«
»Sie liebt ihre Arbeit. Sie liebt einfach, was sie tut. Sie wollte schon immer Lehrerin werden.«
Mia ist Kunstlehrerin. An der Highschool. Ich notiere mir das zur Sicherheit in mein Heft.
Der Richter möchte wissen, ob ich diesen Aspekt für bedeutsam halte. »Möglicherweise«, antworte ich.
»Und warum?«
»Ich versuche nur, Ihre Tochter besser zu verstehen, Euer Ehren. Was für ein Mensch sie ist. Das ist alles.«
Mrs. Dennett ist inzwischen den Tränen nahe. Ihre blauen Augen sind von den bedauernswerten Bemühungen, das Weinen zu unterdrücken, schon ganz geschwollen und gerötet. »Glauben Sie, Mia ist etwas zugestoßen?«
Haben Sie mich nicht genau deshalb gerufen?, denke ich bei mir. Sie glauben doch selbst, dass Mia etwas zugestoßen ist. Aber stattdessen sage ich: »Ich würde vorschlagen, wir handeln lieber sofort, dann können wir später immer noch Gott dafür danken, dass sich alles als großes Missverständnis entpuppt hat. Ich bin mir sicher, es geht ihr gut, keine Frage, aber ich möchte mir die ganze Sache doch lieber etwas genauer ansehen, bevor mir bei einer oberflächlichen Überprüfung etwas entgeht.« Ich würde mir in den Hintern beißen, wenn – wenn sich herausstellt, dass nicht alles in Ordnung gewesen ist.
»Wie lange lebt Mia schon in einer eigenen Wohnung?«, frage ich.
»In dreißig Tagen werden es sieben Jahre«, erklärt Mrs. Dennett, ohne nachzudenken.
Ich bin verblüfft. »Sie zählen so genau mit? Bis auf den Tag?«
»Es war ihr achtzehnter Geburtstag. Sie konnte es gar nicht erwarten, hier herauszukommen.«
»Ich werde da gar nicht weiterbohren«, verspreche ich. In Wahrheit brauche ich es gar nicht. Ich kann es selbst kaum erwarten, hier rauszukommen. »Wo genau wohnt sie jetzt?«
Der Richter antwortet: »Sie hat eine Wohnung in der Stadt. Ein paar Schritte von Clark Ecke Addison.«
Als passionierter Fan der Chicago Cubs steigt meine Begeisterung sofort. Wenn ich nur die Worte Clark oder Addison höre, stellen sich meine Ohren auf wie bei einem ausgehungerten Welpen. »Wrigleyville. Eine schöne Gegend. Und sicher.«
»Ich werde Ihnen die Adresse holen«, bietet Mrs. Dennett an.
»Ich würde dort gern einmal vorbeischauen, wenn Sie nichts dagegen haben. Nur um zu sehen, ob vielleicht ein Fenster eingeschlagen ist oder es sonst Anzeichen eines gewaltsamen Eindringens gibt.«
Mit zitternder Stimme fragt Mrs. Dennett: »Glauben Sie, jemand ist in Mias Wohnung eingebrochen?«
Ich versuche, beruhigend zu klingen. »Ich möchte es nur überprüfen, Mrs. Dennett. Gibt es einen Pförtner in dem Haus?«
»Nein.«
»Irgendein Sicherheitssystem? Kameras?«
»Woher sollen wir das wissen?«, knurrt der Richter.
»Besuchen Sie sie denn nicht?«, rutscht es mir heraus, bevor ich mich bremsen kann. Ich warte auf eine Antwort, aber es kommt keine.
Eve
NACHHER
Ich ziehe den Reißverschluss ihrer Jacke zu, stülpe ihr die Kapuze über den Kopf, und wir treten hinaus in den unerbittlichen Chicagoer Wind. »Wir müssen uns jetzt beeilen«, sage ich, und sie nickt, ohne nach dem Grund zu fragen. Der SUV von James steht nur wenige Schritte entfernt. Die Windböen werfen uns fast um, und als ich nach ihrem Ellbogen greife, weiß ich nur, dass wir nun beide hinfallen werden, sobald eine von uns ins Taumeln gerät. Vier Tage nach Weihnachten ist der Parkplatz eine einzige Eisbahn. Ich bemühe mich nach Kräften, sie vor dem nicht nachlassenden beißend kalten Wind zu schützen. Ich ziehe sie dicht an mich und lege einen Arm um ihre Taille, um sie warm zu halten, obwohl ich deutlich kleiner bin und an dieser Aufgabe zweifellos kläglich scheitere.
»Wir kommen nächste Woche wieder her«, sage ich beim Einsteigen zu Mia und muss dabei mit lauter Stimme über die zuschlagenden Türen und klickenden Sicherheitsgurte hinweg sprechen. Das Radio setzt dröhnend ein, und der Motor orgelt an diesem eisigen Tag mit letzter Kraft. Mia schreckt zusammen, und ich bitte James, das Radio auszuschalten. Auf der Rückbank starrt Mia stumm aus dem Fenster und beobachtet die Wagen, die uns heute den ganzen Tag zu dritt gierig wie eine Gruppe ausgehungerter Haie umkreisen. Einer der Fahrer hebt die Kamera ans Auge, und für einen Moment blendet uns das Blitzlicht.
»Wo zum Teufel steckt nur die Polizei, wenn man sie mal braucht?«, fragt James, ohne mit einer Antwort zu rechnen, und hupt dann so lange, bis Mia sich schützend die Ohren zuhält. Erneut blitzen Kameras auf. Die Wagen warten alle mit laufendem Motor auf dem Parkplatz und blasen aus ihren Auspuffrohren wild quellende Abgaswolken in den grauen Tag.
Mia sieht auf und bemerkt, dass ich sie betrachte. »Hast du mich verstanden, Mia?«, frage ich mit freundlicher Stimme. Sie schüttelt den Kopf, und ich kann den quälenden Gedanken fast hören, der sie beschäftigt: Chloe. Mein Name ist Chloe. Unverwandt blicken ihre blauen Augen in meine blauen, die jedoch gerötet und wässrig sind von den Tränen, die ich zurückzuhalten versuche. Seit Mias Rückkehr kommen mir ständig die Tränen, obwohl James dann immer sofort eingreift und mich zur Ruhe mahnt. Ich gebe mir alle Mühe, das Ganze zu begreifen, setze ein Lächeln auf, das gezwungen und doch vollkommen ehrlich ist, während mir pausenlos die unausgesprochenen Worte durch den Kopf gehen: Ich kann es einfach nicht fassen, dass du zu Hause bist. Sorgfältig achte ich darauf, Mia genügend Freiraum zu lassen. Mir ist zwar nicht genau klar, wie viel sie benötigt, aber ich möchte auf keinen Fall zu weit gehen. Ich sehe ihr Leiden in jeder Geste, in jedem Gesichtsausdruck, selbst in der Art, wie sie neuerdings steht. Ihre Haltung strotzt nicht länger vor Selbstbewusstsein, wie ich es von der alten Mia kannte. Mir ist klar, ihr muss etwas Furchtbares zugestoßen sein.
Ich frage mich allerdings, ob sie spürt, dass auch mit mir etwas geschehen ist.
Mia wendet den Blick ab. »Wir kommen nächste Woche wieder zu Dr. Rhodes«, sage ich, und sie antwortet mit einem Nicken. »Am Dienstag.«
»Wie viel Uhr?«, fragt James.
»Um eins.«
Er zieht mit einer Hand sein Smartphone zurate und erklärt mir dann, dass ich Mia zu diesem Termin alleine begleiten muss. Er sagt, um diese Uhrzeit sei eine Verhandlung, bei der seine Anwesenheit unbedingt erforderlich ist. Außerdem, fügt er hinzu, käme ich gewiss auch ohne ihn zurecht. Ich erwidere, dass ich selbstverständlich zurechtkommen werde, aber dann beuge ich mich zu ihm und flüstere in sein Ohr: »Sie braucht dich jetzt. Du bist ihr Vater.« Ich erinnere ihn daran, dass wir genau darüber gesprochen und uns geeinigt haben und dass er es versprochen hat. Er versichert, er werde sehen, was sich machen lässt, doch meine Zweifel bleiben groß. Ich weiß doch, dass er für derartige Familienkrisen in seinem ausgefüllten Terminkalender letztlich keinen Raum hat.
Auf der Rückbank starrt Mia aus dem Fenster auf die vorbeifliegende Welt, während wir über die Interstate 94 aus der Stadt hinausrauschen. Lange kommen wir jedoch nicht so rasch voran. Es ist kurz vor halb vier am Freitag vor dem Silvesterwochenende, und der Verkehr ist chaotisch. Wir müssen anhalten, warten und kriechen dann im Schneckentempo über die Autobahn. James besitzt keine Geduld für so etwas. Dauernd blickt er in den Rückspiegel und kontrolliert, ob die Paparazzi wieder auftauchen.
»Tja, Mia«, sagt James, um Zeit totzuschlagen. »Diese Psychotante meint also, du würdest an Amnesie leiden.«
»Ach, James«, sage ich, »nicht jetzt, bitte.«
Mein Mann ist jedoch nicht bereit zu warten. Er will der Sache auf den Grund gehen. Mia ist erst seit knapp einer Woche wieder zurück und wohnt bei uns. Solange sie noch nicht in der Lage ist, allein für sich zu sorgen, wird es so bleiben. Ich muss daran denken, wie am ersten Weihnachtstag der klapprige weinrote Wagen mit Mia an Bord bedächtig in die Einfahrt bog. Ich sehe James noch vor mir, der sonst stets so unbeteiligte, gleichgültige James, wie er zur Haustür hinausstürmt und sie als Erster begrüßt, wie er diese ausgemergelte Frau auf unserer schneebedeckten Einfahrt in die Arme schließt, als sei er und nicht ich es gewesen, der all die langen, bedrückenden Monate in verzweifelter Sorge verbracht hat.
Seitdem jedoch konnte ich beobachten, wie sich diese momentane Erleichterung bei James verflüchtigte, wie ihn Mia in ihrer Selbstversunkenheit zu ermüden begann, bis sie irgendwann nur noch ein Fall von vielen in seiner ständig wachsenden Arbeitslast war und nicht unsere Tochter.
»Wann denn?«
»Später, bitte. Und außerdem«, betone ich noch, »ist diese Frau eine ausgebildete Spezialistin. Eine Psychiaterin, James, keine Psychotante.«
»Na schön, Mia, also diese Psychiaterin meint, du hättest Amnesie«, wiederholt er, aber Mia reagiert nicht. Durch den Rückspiegel betrachtet er sie mit diesen dunklen Augen, die sie zu bannen suchen. Für einen flüchtigen Moment bemüht sie sich nach Kräften, seinen Blick zu erwidern, doch dann senkt sie den Kopf und richtet ihre ganze Aufmerksamkeit auf einen kleinen Kratzer an ihrer Hand. »Fällt dir denn gar nichts dazu ein?«, fragt er.
»Das hat sie mir auch gesagt«, antwortet sie, und ich erinnere mich an die Worte der Ärztin, als sie James und mir in ihrem tristen Behandlungsraum gegenübersaß, während Mia im Wartezimmer in irgendwelchen längst veralteten Modezeitschriften blättern sollte. Wortwörtlich trug sie uns die Lehrbuchdefinition von Akuter Belastungsreaktion vor, und ich musste immer nur an diese bedauernswerten Vietnamveteranen denken.
Er seufzt. Selbstverständlich wird James es für unglaubwürdig halten, dass sich ihre Erinnerungen einfach so in Luft aufgelöst haben sollen. »Also, wie muss man sich das vorstellen? Du weißt noch, dass ich dein Vater bin und dass das hier deine Mutter ist, aber du glaubst, dein Name sei Chloe. Du weißt, wie alt du bist, wo du wohnst und dass du eine Schwester hast, aber du hast keine Ahnung, wer Colin Thatcher ist? Du weißt wirklich nicht, mit wem du die letzten drei Monate zusammen warst?«
Ich springe Mia zur Seite und sage: »Es nennt sich selektive Amnesie, James.«
»Willst du mir erzählen, sie sucht sich einfach die Dinge aus, an die sie sich erinnern will?«
»Mia selbst nicht. Ihr Unterbewusstsein tut das oder ihre Unbewusstheit oder irgend so etwas. Es legt schmerzhafte Erinnerungen da ab, wo sie sie nicht finden kann. Das ist nichts, wofür sie sich frei entscheidet. Auf diese Weise unterstützt ihr Körper sie nur dabei, es zu bewältigen.«
»Was zu bewältigen?«
»Diese ganze Geschichte, James. Alles, was geschehen ist.«
Er möchte wissen, wie wir es in Ordnung bringen können. Das weiß ich auch nicht genau. »Zeit, würde ich sagen«, lautet mein Vorschlag. »Therapie, Medikamente, Hypnose.«
Er schnauft verächtlich. Hypnose ist für ihn so seriös wie Amnesie. »Was für Medikamente?«
»Antidepressiva, James«, antworte ich. Ich drehe mich um, tätschele Mias Hand und sage: »Vielleicht kommt ihre Erinnerung auch nie zurück, und das ist dann auch nicht schlimm.« Einen Moment lang betrachte ich sie liebevoll. Sie gleicht mir fast wie ein Spiegelbild, größer gewachsen allerdings und jünger natürlich und im Unterschied zu mir noch viele, viele Jahre entfernt von Falten und den grauen Strähnen, die sich in meiner dunkelblonden Mähne breitzumachen beginnen.
»Wie sollen Antidepressiva ihr helfen, sich zu erinnern?«
»Sie sorgen dafür, dass sie sich besser fühlt.«
James sagt stets offen seine Meinung. Das ist eine seiner Schwächen. »Ach, Eve, wenn sie sich an nichts erinnert, kann doch auch nichts dafür sorgen, dass sie sich schlecht fühlt, oder?«, fragt er. Die Unterhaltung ist damit beendet, und unsere Blicke wandern hinaus auf den vorbeiziehenden Gegenverkehr.
Gabe
VORHER
Die Highschool, in der Mia Dennett unterrichtet, liegt im Nordwesten von Chicago in einem Teil, der North Center genannt wird. Es ist eine verhältnismäßig gute Gegend, ganz in der Nähe ihrer Wohnung, mit einer überwiegend weißen Bevölkerung, die sich die durchschnittlichen Monatsmieten von über tausend Dollar leisten kann. Damit hat sie es also ganz gut getroffen. Würde sie etwa in Englewood arbeiten, hätte ich da schon Bedenken. Ihre Schule macht es sich zur Aufgabe, Highschool-Abbrechern die Chance auf eine Ausbildung zu geben. Es gibt Angebote zu beruflicher Bildung, Computertraining, grundlegenden Alltagsfähigkeiten und so weiter, alles in überschaubaren Kleingruppen. Hier kommt die Kunstlehrerin Mia Dennett ins Spiel, die eher die ungewöhnlichen Begabungen fördern soll, die keinen Platz mehr haben in gewöhnlichen Highschools, wo die Zeit für immer mehr Mathematik und Naturwissenschaften gebraucht wird und wo sich sechzehnjährige Außenseiter, denen alles egal ist, nur zu Tode langweilen.
Ayanna Jackson empfängt mich in ihrem Büro. Ich muss eine gute Viertelstunde auf sie warten, da sie noch unterrichtet, und so quetsche ich meinen Körper in eins dieser winzigen Folterstühlchen aus Plastik, wie sie in Klassenräumen stehen, und warte. Angenehm ist die Situation gewiss nicht. Auch wenn ich die Sixpackfigur von früher schon lange nicht mehr habe, bilde ich mir doch gerne ein, dass sich die zusätzlichen Pfunde durchaus ansehnlich verteilen.
Die Sekretärin behält mich die ganze Zeit über fest im Blick, als wäre ich ein Schüler, der zum Gespräch beim Schulleiter einbestellt wurde.
Da ich während meiner Highschooltage einige Male in dieser misslichen Lage gesteckt habe, kommt mir selbst die Szene nur allzu vertraut vor.
»Sie versuchen also, Mia zu finden«, sagt sie, nachdem ich mich als Detective Gabe Hoffman vorgestellt habe. Genau das versuche ich, bestätige ich. Es sind inzwischen fast vier Tage vergangen, seit jemand die Frau gesehen oder mit ihr gesprochen hat, weshalb sie, sehr zum Missfallen des Richters, offiziell zur vermissten Person erklärt wurde. Es stand in der Zeitung, kam in den Nachrichten, und jeden Morgen, wenn ich aus dem Bett klettere, sage ich mir, dass ich heute Mia Dennett finden und zum Helden erklärt werde.
»Wann haben Sie Mia das letzte Mal gesehen?«
»Dienstag.«
»Wo?«
»Hier.«
Wir gehen in einen der Klassenräume, und Ayanna, die mich bittet, sie mit ihrem Vornamen und nicht mit Miss Jackson anzureden, deutet einladend auf eins der Plastikstühlchen, die fest mit dem kaputten und vollgekritzelten Schreibtisch verbunden sind.
»Wie lange kennen Sie Mia schon?«
Sie nimmt hinter ihrem Schreibtisch auf einem bequemen Lederstuhl Platz, und ich fühle mich wie ein kleines Kind, obwohl ich sie in Wahrheit um einen Kopf überrage. Sie schlägt ihre langen Beine übereinander, sodass der Schlitz ihres schwarzen Rocks sich öffnet und nackte Haut zum Vorschein kommt. »Drei Jahre. So lange Mia hier unterrichtet.«
»Kommt Mia gut mit allen aus? Mit den Schülern? Den Kollegen?«
»Es gibt überhaupt niemanden, mit dem Mia nicht gut auskommen würde«, erklärt sie ein wenig feierlich.
Ayanna beginnt von Mia zu erzählen. Sie erzählt von der natürlichen Freundlichkeit, mit der Mia an der Alternativschule von ihrem ersten Tag an aufgetreten ist. Erzählt davon, wie gut sich Mia in die Schüler einfühlen kann und sich gibt, als sei sie selbst auf den Straßen Chicagos aufgewachsen. Sie erzählt, wie Mia für die Schule Benefizveranstaltungen organisiert hat, um bedürftigen Schülern die Materialkosten erstatten zu können. »Man hat ihr nie angemerkt, dass sie eine Dennett ist.«
Miss Jackson zufolge bleiben die meisten Junglehrer nicht lange an einer solchen Schule, in einem solchen Umfeld. Angesichts der aktuellen Lage auf dem Arbeitsmarkt ist eine Alternativschule bisweilen die einzige Option für eine Anstellung, und dann nehmen Collegeabsolventen diese Stellen eben, bis sie etwas Besseres finden. Aber nicht Mia. »Das war genau das, was sie machen wollte.«
Sie zieht einen Stapel Papiere von einer Ablage auf ihrem Schreibtisch, steht auf und sagt: »Ich will Ihnen mal etwas zeigen.« Sie kommt zu mir, setzt sich an einen Nachbartisch und legt den dicken Papierstoß vor mich. Zuerst fällt mir auf, dass die krakelige Handschrift auf den Blättern noch schlechter ist als meine eigene. »Heute Morgen haben die Schüler an ihrem Lerntagebuch gearbeitet«, erklärt sie, und schon beim Überfliegen begegnet mir unzählige Male der Name Miss Dennett.
»Wir lassen jede Woche Einträge in das Lerntagebuch erstellen«, führt sie weiter aus. »In dieser Woche lautete der Arbeitsauftrag, mir zu sagen, welche Pläne sie für ihr Leben nach der Highschool haben.« Ich grübele eine Minute darüber nach und entdecke die Worte Miss Dennett gleich mehrfach auf nahezu jedem Blatt. »Aber neunundneunzig Prozent aller Schüler denken im Augenblick ausschließlich an Mia«, fasst sie zusammen, und ich kann am niedergeschlagenen Klang ihrer Stimme hören, dass es ihr nicht viel anders geht.
»Hatte Mia mit irgendwelchen Schülern Probleme?«, frage ich, nur um sicherzugehen. Ihre Antwort ist mir bereits klar, bevor sie noch den Kopf schüttelt.
»Wie sieht es mit einem festen Freund aus?«, frage ich.
»Den gibt’s wohl«, sagt sie, »sofern man ihn so nennen kann. Jason irgendwas. Seinen Nachnamen kenne ich nicht. Nichts Ernstes. Sie treffen sich erst seit ein paar Wochen, einem Monat vielleicht, länger nicht.« Ich notiere mir das. Die Dennetts hatten nichts von einem Freund erwähnt. Wäre es möglich, dass sie nichts davon wissen? Natürlich wäre es möglich. Inzwischen beginne ich zu begreifen, dass bei den Dennetts so ziemlich alles möglich ist.
»Haben Sie eine Ahnung, wie ich ihn erreichen könnte?«
»Er ist Architekt«, sagt sie. »In irgendeinem Büro an der Wabash. Sie trifft sich dort freitagabends häufig mit ihm zur Happy Hour. Wabash Ecke … keine Ahnung, Wacker vielleicht? Irgendwo unten am Fluss.« Klingt nach Nadel im Heuhaufen, aber das mache ich doch gerne. Ich notiere mir die Informationen.
Die Tatsache, dass Mia Dennett einen schwer fassbaren Freund hat, gibt mir Hoffnung. In Fällen wie diesem ist es nämlich immer der Freund. Finde ich Jason, finde ich bestimmt auch Mia, oder das, was von ihr übrig ist. Da sie mittlerweile schon vier Tage verschwunden ist, beginne ich damit zu rechnen, dass diese Geschichte ein unglückliches Ende nehmen dürfte. Jason arbeitet in der Nähe des Chicago River. Ungünstige Nachricht. Aus diesem Fluss werden jährlich Gott weiß wie viele Leichen gezogen. Er ist Architekt, also ist er clever, geübt im Lösen von Problemen, etwa dem, eine fünfundfünfzig Kilo schwere Leiche unbemerkt zu entsorgen.
»Wenn Mia und Jason eng miteinander befreundet sind, ist es dann nicht seltsam, dass er gar nicht nach ihr sucht?«, frage ich.
»Meinen Sie, Jason könnte darin verwickelt sein?«
Ich zucke mit den Achseln. »Ich weiß nur, wenn ich eine Freundin hätte und vier Tage nichts von ihr gehört hätte, würde ich mir ein wenig Sorgen machen.«
»Vermutlich schon«, stimmt sie zu. Sie steht auf und beginnt, die Tafel abzuwischen. Kreidestaub legt sich in winzigen Körnern auf ihren schwarzen Rock. »Bei den Dennetts hat er nicht angerufen?«
»Mr. und Mrs. Dennett haben überhaupt keine Ahnung, dass ein Freund existiert. Ihrer Meinung nach ist Mia Single.«
»Mia und ihre Eltern stehen sich nicht sehr nahe. Sie haben gewisse … weltanschauliche Differenzen.«
»Ist mir schon aufgefallen.«
»Ich glaube nicht, dass sie mit ihnen über so ein Thema reden würde.«
Um Ayanna nicht noch weiter abschweifen zu lassen, versuche ich, das Gespräch wieder auf das Wesentliche zu lenken. »Mia und Sie stehen sich aber nahe, richtig?«
Sie nickt.
»Würden Sie sagen, dass Mia Ihnen alles erzählt?«
»Soweit ich das beurteilen kann.«
»Was hat sie Ihnen denn über Jason erzählt?«
Ayanna setzt sich wieder, diesmal auf die Ecke ihres Schreibtischs. Sie wirft einen Blick auf die Wanduhr, klopft sich den Staub von den Händen und denkt über meine Frage nach. »Es war nichts für länger«, sagt sie und sucht nach den richtigen Worten. »Mia geht nur selten Beziehungen ein, und wenn, ist es niemals etwas Ernstes. Sie möchte sich nicht gerne binden. Verpflichtet sein. Unabhängigkeit ist ihr ausgesprochen wichtig, manchmal vielleicht schon in übertriebenem Maße.«
»Und Jason ist … anhänglich? Braucht Hilfe?«
Sie schüttelt den Kopf. »Nein, so ist es nicht. Er ist nur irgendwie einfach nicht der Richtige. Wenn sie von ihm gesprochen hat, trat nicht das geringste Leuchten in ihre Augen. Sie erzählte von sich aus nichts über ihn, wie es junge Frauen doch machen würden, wenn sie den einen getroffen haben. Ich musste sie immer dazu drängen, mir von ihm zu erzählen, und dann klang es mehr wie ein Protokoll: Wir sind essen gegangen. Wir haben uns einen Film angesehen … Und ich weiß, dass er immer lange arbeiten muss, was Mia geärgert hat. Ständig verpasste er Verabredungen oder kam zu spät. Mia hasste es, von seinem Terminkalender abhängig zu sein. Wenn es schon im ersten Monat so viele Reibungen gibt, wird die Sache nie lange halten.«
»Es wäre also denkbar, dass Mia vorhatte, mit ihm Schluss zu machen?«
»Keine Ahnung.«
»Aber sie war nicht wirklich glücklich?«
»Nicht glücklich würde ich nicht sagen«, antwortet Ayanna. »Ich glaube nur, es war ihr letztlich ziemlich egal.«
»Empfand Jason in dieser Hinsicht ähnlich, soweit Sie das beurteilen können?« Sie sagt, dass sie das nicht wisse. Mia war offenbar recht zurückhaltend, wenn sie über Jason sprach. Die Auskünfte blieben eher nichtssagend: Listen der Dinge, die sie gemeinsam unternommen hatten, oder ein paar äußerliche Merkmale des Mannes – Größe, Gewicht, Haar- und Augenfarbe –, merkwürdigerweise aber kein Nachname. Nie hat Mia über ihren ersten Kuss gesprochen oder über dieses Kribbeln im Bauch, das man spürt, wenn man seinen Traummann gefunden hat – Ayannas Wortwahl, nicht meine. Einerseits wirkte Mia genervt, wenn Jason sie versetzte, was Ayanna zufolge häufig geschah, andererseits machte sie aber auch an den Abenden, wenn sie sich zu einem Rendezvous am Chicago River trafen, keinen vor Vorfreude besonders aufgeregten Eindruck.
»Und Sie würden das als Zeichen von Desinteresse deuten?«, frage ich. »Desinteresse an Jason? An der Beziehung? An der ganzen Sache?«
»Mia hat sich bloß die Zeit vertrieben, bis ihr etwas Besseres begegnet.«
»Haben die beiden sich gestritten?«
»Nicht dass ich wüsste.«
»Und bei echten Problemen hätte Mia Ihnen bestimmt davon erzählt«, behaupte ich.
»Das hoffe ich doch«, erwidert die Frau, und ihre dunklen Augen nehmen einen traurigen Ausdruck an.
Ein fernes Klingeln ist zu hören, gefolgt vom wilden Trappeln von Füßen auf dem Gang. Ayanna Jackson erhebt sich, was ich als Wink für mich verstehe. Ich verspreche, sie auf dem Laufenden zu halten, und gebe ihr meine Karte mit der Bitte, mich anzurufen, sollte ihr noch etwas einfallen.
Eve
NACHHER
Auf halbem Weg die Treppe hinunter sehe ich sie durchs Fenster. Ein Nachrichtenteam mit Kamera und Mikrofon steht bibbernd draußen auf dem Bürgersteig vor unserem Haus. Tammy Palmer von den Lokalnachrichten hat sich in hellbraunem Trenchcoat und kniehohen Stiefeln auf dem Rasen meines Vorgartens platziert. Sie hält mir den Rücken zugekehrt, während ein Mann mit den Fingern herunterzählt drei … zwei …, und als er dann auf Tammy zeigt, höre ich in meinem Innern, wie sie ihre Berichterstattung beginnt. Ich stehe hier vor dem Haus, in dem Mia Dennett lebt …
Es ist nicht das erste Mal, dass sie hier sind, aber ihre Zahl beginnt abzunehmen. Offenbar wenden sich die Reporter jetzt anderen aktuellen Themen wie den gesetzlichen Bestimmungen zur gleichgeschlechtlichen Ehe oder der trübseligen wirtschaftlichen Situation zu.
In den ersten Tagen nach Mias Rückkehr kampierten sie noch permanent draußen und versuchten verzweifelt, einen Blick auf die geschundene junge Frau zu erhaschen oder irgendeinen Schnipsel an Information aufzuschnappen, der sich zu einer Schlagzeile verwerten ließ. Hartnäckig verfolgten sie uns in ihren Autos auf all unseren Wegen in die Stadt, bis wir Mia quasi im Haus einschlossen.
Mysteriöse Wagen parkten draußen, durch deren Seitenfenstern Paparazzi lange Teleobjektive schoben, um sich bei ihren Klatschzeitschriften mit Fotos von Mia eine goldene Nase zu verdienen. Ich ziehe die Vorhänge zu.
Erst jetzt sehe ich Mia am Küchentisch sitzen. Wortlos steige ich die letzten Stufen hinab und studiere meine Tochter in ihrer eigenen Welt, bevor ich in diese eindringe. Sie trägt ein Paar zerschlissene Jeans und einen eng anliegenden Rollkragenpullover, dessen navyblaue Farbe ihre Augen gewiss bezaubernd zur Geltung bringt. Ihre Haare sind noch feucht vom Duschen und trocknen in langen Strähnen auf dem Rücken. Was mich verwirrt, sind die dicken Wollsocken an ihren Füßen und der Becher Kaffee, um den sich ihre Hände schließen.
Sie hört, wie ich mich nähere, und dreht sich um. Ja, denke ich bei mir, der Rollkragenpullover lässt ihre Augen tatsächlich bezaubernd aussehen.
»Du trinkst Kaffee«, sage ich, und ihr unsicherer Gesichtsausdruck macht mir sofort bewusst, dass ich das Falsche gesagt habe.
»Trinke ich denn keinen Kaffee?«
Ich gehe seit nunmehr über einer Woche mit größter Behutsamkeit vor, bemühe mich stets darum, nur das Richtige zu sagen, und unternehme – auf schon lächerlich übertriebene Weise – alle erdenklichen Anstrengungen, damit sie sich zu Hause fühlt. Ich bin hochgradig angespannt, um sowohl James’ Apathie als auch Mias Verwirrtheit zu kompensieren. Und dann, wenn ich am wenigsten damit rechne, unterläuft mir bei einer scheinbar harmlosen Unterhaltung dieser Schnitzer.
Mia trinkt keinen Kaffee. Sie trinkt generell kaum Koffeinhaltiges. Es macht sie nervös. Aber wenn ich sehe, wie sie in diesem trägen, phlegmatischen Zustand an ihrem Becher nippt, dann denke ich – hoffe ich –, ein wenig Koffein könnte vielleicht für den nötigen Schub sorgen. Wer ist diese schlaffe Frau hier?, frage ich mich, deren Gesicht ich zwar erkenne, deren Körperhaltung und deren Art zu sprechen mir aber ebenso fremd sind wie diese unheimliche Stille, die sie umschließt wie eine große Luftblase.
Es gibt eine Million Dinge, die ich sie fragen möchte. Aber ich tue es nicht. Ich habe geschworen, sie einfach in Frieden zu lassen. James hat so heftig nachgebohrt, das war schon mehr als genug für uns beide. Ich überlasse das Fragen den Profis, Dr. Rhodes und Detective Hoffman, und denen, die wie James nicht wissen, wann sie besser aufhören sollten. Sie ist meine Tochter, und sie ist nicht meine Tochter. Sie ist Mia, und sie ist nicht Mia. Sie sieht aus wie sie, aber sie trägt Socken, trinkt Kaffee und schreckt mitten in der Nacht schluchzend aus dem Schlaf auf. Sie reagiert schneller auf den Namen Chloe als auf ihren Geburtsnamen. Sie wirkt leer, scheint zu schlafen, wenn sie wach ist, und liegt wach, wenn sie schlafen sollte. Als ich gestern Abend den Abfallzerkleinerer unter dem Spülbecken eingeschaltet habe, ist sie vor Schreck fast an die Decke geschossen und danach sofort auf ihr Zimmer gegangen. Oft sehen wir sie stundenlang nicht, und wenn ich frage, wie sie die Zeit verbracht hat, antwortet sie nur: Ich weiß nicht. Die Mia, die ich kenne, ist nicht in der Lage, so lange ruhig zu sitzen.
»Scheint ein schöner Tag zu werden«, versuche ich es, aber sie antwortet nicht. Das Wetter ist wirklich schön draußen. Die Sonne scheint. Aber im Januar ist die Sonne noch trügerisch, und ich bin mir sicher, am Boden wird es sich bestenfalls auf minus fünf Grad erwärmen.
»Ich möchte dir gern etwas zeigen«, sage ich und führe sie von der Küche ins angrenzende Esszimmer, wo ich im November, als ich von ihrem Tod überzeugt war, einen kostbaren Kunstdruck gegen eins von Mias Kunstwerken ausgetauscht habe. Mia hat dieses pittoreske Dorf, das wir Jahre zuvor in der Toskana besucht hatten, von einem Foto abgezeichnet und dann mit Ölpastellen gemalt. Durch mehrere übereinanderliegende Farbschichten hat sie dem Dorf einen sehr plastischen Ausdruck verliehen. Es ist ein kurzer Augenblick, eingefangen hinter dieser Glasscheibe. Ich beobachte, wie Mia das Bild mustert, und denke bei mir: Wenn doch nur alles auf diese Weise konserviert werden könnte. »Du hast das gemacht«, sage ich.
Sie weiß es. Daran erinnert sie sich. Sie erinnert sich noch an den Tag, an dem sie sich mit dem Foto und den Ölpastellen an den Tisch im Esszimmer gesetzt hat. Sie hatte ihren Vater gebeten, ihr den großen Malkarton zu kaufen, und er war darauf eingegangen, obwohl er davon überzeugt war, dass es sich bei ihrer neu entdeckten Liebe zur Kunst nur um eine vorübergehende Phase handelte. Als sie fertig war, haben wir es alle pflichtgemäß bewundert, und dann wurde es irgendwo zusammen mit den alten Halloweenkostümen und Rollerskates weggeräumt. Gestolpert bin ich erst wieder darüber bei der Suche nach alten Fotos von Mia, um die uns der Detective gebeten hatte.
»Erinnerst du dich noch an unsere Reise in die Toskana?«, frage ich.
Sie tritt näher, um mit ihren schönen Fingern über das Kunstwerk zu fahren. Sie überragt mich zwar deutlich, aber hier im Esszimmer ist sie ein Kind – ein Küken, das noch nicht recht weiß, wie es auf seinen eigenen zwei Beinen zu stehen hat.
»Es hat geregnet«, antwortet Mia, ohne den Blick von dem Gemälde zu lösen.
Ich nicke. »Stimmt, es hat geregnet«, sage ich, froh darüber, dass sie sich erinnert. Aber geregnet hat es nur an einem einzigen Tag, die restliche Zeit über war das Wetter herrlich.
Ich würde ihr gern erzählen, dass ich das Gemälde aufgehängt habe, weil ich mir solche Sorgen um sie gemacht habe. Ich hatte schreckliche Angst. Monatelang lag ich jede Nacht wach und grübelte endlos. Was, wenn? Was, wenn ihr etwas passiert ist? Was, wenn ihr nichts passiert ist, wir sie aber niemals wiederfinden? Was, wenn sie tot ist und wir nie davon erfahren? Was, wenn sie tot ist, wir davon erfahren und der Detective uns bittet, die verwesenden Überreste zu identifizieren?
Ich würde Mia gern erzählen, dass ich vorsorglich ihren Weihnachtsstrumpf aufgehängt und Geschenke gekauft, eingepackt und unter den Baum gelegt habe. Sie soll wissen, dass ich jeden Abend das Licht auf der Veranda vor dem Haus angelassen und bestimmt tausendmal auf ihrem Handy angerufen habe, nur um sicherzugehen. Nur für den Fall, dass es irgendwann vielleicht doch nicht direkt zum Anrufbeantworter weiterschaltet. Immer und immer wieder habe ich mir den Ansagetext angehört, immer dieselben Worte, derselbe Tonfall – Hi, hier ist Mia. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. So konnte ich wenigstens für einen Moment den Klang ihrer Stimme hören. Und ich habe überlegt: Was, wenn dies die letzten Worte sind, die ich von meiner Tochter höre? Was, wenn?
Ihre Augen sind tiefe Höhlen, ihr Gesichtsausdruck ist leer. Ich habe in meinem Leben wohl nie jemanden mit einer so makellos samtenen Pfirsichhaut gesehen. Jetzt ist alles Pfirsichhafte verschwunden, und sie ist nur noch weiß, gespensterhaft fahl. Und wenn Mia mit mir spricht, sieht sie mich nicht an. Sie sieht an mir vorbei oder durch mich hindurch, aber niemals in mein Gesicht. Die meiste Zeit sieht sie zu Boden, auf ihre Füße, ihre Hände, auf irgendetwas, nur um dem Blick ihres Gegenübers auszuweichen.
Und dann steht sie hier im Esszimmer, und auch der letzte Rest von Farbe entweicht ihrem Gesicht. Es geschieht ganz plötzlich. Der Lichtstrahl, der durch die offenen Vorhänge fällt, unterstreicht noch, wie Mias Körper sich ruckartig strafft, bevor ihre Schultern absacken und ihre Hand vom Toskana-Bild auf ihren Unterleib schnellt. Das Kinn sinkt ihr an die Brust, ihre Atmung wird rau. Ich lege eine Hand auf ihren viel zu hageren, fast knochigen Rücken und warte. Aber ich warte nicht lange. Mir fehlt die Geduld. »Mia, Liebling«, sage ich, aber sie versichert mir bereits, dass alles in Ordnung ist. Ihr gehe es gut. Und ich denke mir, dass es gewiss nur am Kaffee liegt.
»Was ist los?«
Sie zuckt mit den Achseln. Ihre Hand presst weiter fest auf den Bauch. Ich kann sehen, dass es ihr nicht gut geht. Unwillkürlich macht sie sich daran, das Zimmer zu verlassen. »Ich bin müde, das ist alles«, erklärt sie. »Ich muss mich nur ein wenig hinlegen.« Ich nehme mir vor, während sie schläft, alles Koffeinhaltige im Haus zu beseitigen.
Gabe
VORHER
»Sie sind gar nicht so einfach zu finden«, sage ich, als ich seinen Arbeitsplatz erreiche. Sein Büro ähnelt mehr einer Box, hat aber höhere Wände als die üblichen Zellen in einem Großraumbüro und bietet damit ein Minimum an Ungestörtheit. Es gibt nur einen Stuhl – seinen –, weshalb ich am Eingang der Box stehen bleibe und mich an die bedenklich nachgebende Wand lehne.
»Ich wusste ja auch nicht, dass jemand nach mir sucht.«
Dem ersten Eindruck nach ist er ein aufgeblasenes Arschloch, so ähnlich wie ich noch vor ein paar Jahren, bevor ich lernte, nicht so sehr von mir selbst eingenommen zu sein. Er ist ein kräftiger, massiger Typ, wenn auch nicht sonderlich groß. Ich bin mir sicher, er macht Krafttraining und trinkt Proteinshakes. Vielleicht nimmt er sogar Steroide. Ich werde das später in meine Notizen aufnehmen, aber im Augenblick möchte ich nicht, dass er von solchen Einschätzungen etwas mitbekommt. Das könnte mir Ärger einbringen.
»Kennen Sie Mia Dennett?«, frage ich.
»Kommt darauf an.« Er wirbelt in seinem Drehstuhl zurück und tippt mit dem Rücken zu mir an einer E-Mail.
»Worauf?«
»Darauf, wer es wissen will.«
Ich habe keine große Lust, bei diesem Spielchen mitzuwirken. »Ich will das wissen«, sage ich und spare mir meine Trumpfkarte für später auf.
»Und Sie sind?«
»Auf der Suche nach Mia Dennett«, antworte ich.
Ich kann mich in dem jungen Kerl wiedererkennen, obwohl er höchstens vier- oder fünfundzwanzig Jahre alt sein dürfte, bestimmt frisch vom College kommt und noch immer glaubt, die ganze Welt würde sich nur um ihn drehen. »Wenn Sie das sagen.« Ich dagegen stehe an der Schwelle zur Fünfzig und habe heute Morgen die erste graue Strähne in meinen Haaren entdeckt, was ich zweifellos Richter Dennett zu verdanken habe.
Er schreibt weiter an der E-Mail. Das gibt’s doch gar nicht, denke ich. Es ist ihm wirklich völlig egal, dass ich hier stehe und mit ihm sprechen will. Ich schiele über seine Schulter auf den Bildschirm. Es geht um College Football, und der Adressat ist ein gewisser dago82. Meine Mutter ist Italienerin – von ihr habe ich die dunklen Haare und Augen, von denen ich denke, dass alle Frauen sie einfach toll finden müssen –, daher empfinde ich das Spaghettifresser-Schimpfwort Dago als Beleidigung gegenüber meinen Landsleuten, obwohl ich noch nie in Italien gewesen bin und kein Wort Italienisch spreche. Ich suche einfach nach einem weiteren Grund, diesen Typen nicht zu mögen. »Viel zu tun heute, was?«, bemerke ich, und er scheint sauer, dass ich seine E-Mail gelesen habe. Er minimiert den Bildschirm.
»Wer sind Sie, verdammt noch mal?«, fragt er erneut.
Ich greife in meine hintere Hosentasche und ziehe die glänzende Marke heraus, die mir so gut gefällt. »Detective Gabe Hoffman.« Er schaltet sichtbar ein, zwei Gänge zurück. Ich lächle. Gott, wie liebe ich diesen Job.
Er stellt sich dumm. »Ist irgendwas mit Mia?«
»Yeah, so könnte man es ausdrücken.«
Er wartet darauf, dass ich fortfahre. Aber das tue ich nicht, nur um ihn zu nerven. »Was hat sie getan?«
»Wann haben Sie sie das letzte Mal gesehen?«
»Schon eine Weile her. Eine Woche oder so.«
»Und wann das letzte Mal gesprochen?«
»Keine Ahnung. Letzte Woche. Dienstagabend, denke ich.«
»Denken Sie?«, frage ich. Er sieht auf seinem Terminkalender nach. Ja, es war Dienstagabend. »Aber getroffen haben Sie sie am Dienstag nicht?«
»Nein. Eigentlich sollte ich, aber ich musste absagen. Sie verstehen schon, Überstunden.«
»Sicher doch.«
»Was ist mit Mia?«
»Sie haben also seit Dienstag nichts mehr von ihr gehört?«
»Nein.«
»Ist das normal? Fast eine Woche lang nicht miteinander zu sprechen?«
»Ich habe sie angerufen«, gibt er zu. »Mittwoch, vielleicht auch Donnerstag. Sie hat nicht zurückgerufen. Ich habe einfach angenommen, sie wäre angepisst.«
»Und warum? Hatte sie irgendeinen Grund, angepisst zu sein.«
Er zuckt mit den Schultern, greift nach einer Flasche Wasser, die auf dem Schreibtisch steht, und trinkt einen Schluck. »Ich habe Dienstagabend unser Date platzen lassen. Ich musste arbeiten. Sie klang reichlich kurz angebunden am Telefon, verstehen Sie? Ich habe gemerkt, dass sie wütend war. Aber ich musste arbeiten. Also dachte ich, sie wäre eingeschnappt und würde deshalb nicht zurückrufen … Keine Ahnung.«
»Was hatten Sie denn geplant?«
»Am Dienstag?«
»Ja.«
»Wir wollten uns in einer Bar in Uptown treffen. Mia war schon dort, als ich sie anrief. Ich war spät dran. Ich hab ihr gesagt, dass ich es an diesem Abend nicht schaffe.«
»Und sie war verärgert?«
»Erfreut war sie nicht.«
»Und Sie haben also noch gearbeitet? Hier? Am Dienstagabend?«
»Bis etwa drei Uhr morgens.«
»Irgendjemand, der das bestätigen könnte?«
»Äh, ja. Meine Chefin. Wir haben für ein Kundentreffen am Donnerstag ein paar Entwürfe zusammengestellt. Ich habe mich die halbe Nacht immer mal wieder mit ihr zusammengesetzt. Stecke ich in Schwierigkeiten?«
»Dazu kommen wir noch«, antworte ich knapp und halte unser Gespräch in der Stenovariante fest, die nur ich entziffern kann. »Wohin sind Sie nach der Arbeit gegangen?«
»Nach Hause, Mann. Es war mitten in der Nacht.«
»Haben Sie ein Alibi?«
»Ein Alibi?« Jetzt wird ihm unbehaglich. Er windet sich in seinem Stuhl. »Keine Ahnung. Ich habe eine Taxe genommen.«
»Haben Sie eine Quittung?«
»Nein.«
»Gibt es in Ihrem Haus einen Pförtner? Jemand, der uns bestätigen kann, dass Sie unbeschadet nach Hause gekommen sind?«
»Kameras gibt’s«, sagt er, und dann kommt die Frage: »Wo zum Teufel steckt Mia?«
Nach meinem Treffen mit Ayanna Jackson habe ich mir Mias Anrufliste besorgt und festgestellt, dass sie fast täglich mit einem gewissen Jason Becker telefoniert hat. Wie weitere Recherchen ergaben, ist dieser Becker in einem Architekturbüro im Downtown-Bezirk Loop angestellt. Daraufhin habe ich seiner Arbeitsstelle einen Besuch abgestattet, um herauszufinden, was er über das Verschwinden der jungen Frau weiß. Schon bei der ersten Nennung ihres Namens habe ich es ihm an der Nase ablesen können: Eifersucht. Er war davon überzeugt, seinem Nebenbuhler gegenüberzustehen.
»Sie wird vermisst«, sage ich und versuche, seine Reaktion zu deuten.
»Vermisst?«
»Genau. Verschwunden. Seit Dienstag hat sie niemand gesehen.«
»Und Sie glauben, ich hätte etwas damit zu tun?«
Es ärgert mich, dass er stärker um seine weiße Weste besorgt ist als um Mias Leben. »Ganz genau«, lüge ich. »Ich glaube, Sie haben etwas damit zu tun.« In Wahrheit muss sich sein Alibi nur als so wasserdicht herausstellen, wie er es geschildert hat, und ich kann wieder ganz von vorn anfangen.
»Brauche ich einen Anwalt?«
»Glauben Sie, dass Sie einen brauchen?«
»Ich hab Ihnen doch gesagt, ich musste arbeiten. Ich habe Mia am Dienstagabend nicht getroffen. Fragen Sie meine Chefin.«
»Das werde ich«, versichere ich ihm, obwohl der Ausdruck, der über sein Gesicht huscht, mich anfleht, dies bitte nicht zu tun.
Jasons Kollegen verfolgen die Vernehmung derweil mit großem Interesse. Sie gehen langsamer, wenn sie an seinem Arbeitsplatz vorbeikommen, oder bleiben vor der Box stehen und tun, als würden sie sich unterhalten. Mich stört das nicht. Ihn schon. Es macht ihn verrückt. Er fürchtet um seinen guten Ruf. Mir gefällt der Anblick, wie er sich in seinem Stuhl windet und immer zappeliger wird. »Benötigen Sie sonst noch irgendwelche Auskünfte?«, fragt er, um die Sache zu beschleunigen. Er will mich endlich loswerden.
»Ich muss wissen, welche Pläne Sie am Dienstagabend hatten. Wo Mia war, als Sie anriefen. Um wie viel Uhr das war. Sehen Sie einfach auf der Gesprächsliste Ihres Telefons nach. Ich muss mit Ihrer Chefin sprechen und mich vergewissern, dass Sie hier waren, und mit dem Sicherheitsdienst, um zu sehen, um welche Uhrzeit genau Sie gegangen sind. Ich werde die Aufzeichnungen von den Kameras in Ihrem Gebäude brauchen, um zu klären, dass Sie wirklich nach Hause gekommen sind. Wenn Sie bereit sind, mich bei der Beschaffung dieser Informationen zu unterstützen, können wir sofort loslegen. Aber wenn es Ihnen lieber ist, besorge ich mir erst einen richterlichen Beschluss …«
»Wollen Sie mir etwa drohen?«
»Nein«, lüge ich. »Ich zeige Ihnen nur Ihre Optionen auf.«
Er erklärt sich einverstanden, mir die gewünschten Nachweise zu besorgen und mich gleich jetzt seiner Chefin vorzustellen, einer Frau mittleren Alters, deren Büro eine zum Chicago River hinausführende Glasfront besitzt und um ein Vielfaches größer ist als seines.
»Jason«, erkläre ich, nachdem mir die Firmenchefin bestätigt hat, dass er die ganze Nacht durchschuften musste, »wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um Mia wiederzufinden.« Eigentlich wollte ich nur noch mal diesen teilnahmslosen Gesichtsausdruck sehen, bevor ich gehe.
Colin
VORHER
Der Aufwand hält sich in Grenzen. Ich bezahl einen Typ dafür, ein paar Stunden länger zu arbeiten als gewollt, folge ihr in die Bar und setz mich so, dass ich sie sehen kann, ohne selbst gesehen zu werden. Dann warte ich auf den Anruf, und sobald sie erfährt, dass er sie versetzt, schalte ich mich ein.
Viel weiß ich nicht von ihr. Ich habe einen Schnappschuss gesehen. Auf dem verschwommenen Foto, das aus einem gut zehn Meter entfernt geparkten Auto gemacht wurde, kommt sie gerade von einem Hochbahnsteig der Chicagoer »L« herunter. Etwa zehn Menschen sind zwischen dem Fotografen und der jungen Frau zu sehen, weshalb sie ihr Gesicht mit Rotstift eingekreist haben. Auf der Rückseite der Aufnahme stehen die Worte Mia Dennett sowie eine Adresse. Vor ungefähr einer Woche habe ich dieses Foto erhalten. So einen Auftrag habe ich noch nie ausgeführt. Diebstahl, ja. Nötigung, ja. Aber keine Entführung. Doch ich brauch das Geld.
Ich bin ihr schon ein paar Tage gefolgt. Ich weiß, wo sie ihre Lebensmittel kauft, welche Reinigung sie benutzt und wo sie arbeitet. Gesprochen habe ich mit ihr noch nie. Den Klang ihrer Stimme würde ich nicht wiedererkennen. Ich kenne weder die Farbe ihrer Augen noch den Ausdruck, den sie annehmen, wenn sie Angst hat. Aber das wird sich ändern.
Ich halte ein Bier in der Hand, ohne davon zu trinken. Ich kann nicht riskieren, betrunken zu werden. Nicht heute Abend. Aber ich möchte auch keine Aufmerksamkeit erregen, daher habe ich mir ein Bier bestellt, um nicht mit leeren Händen dazusitzen. Sie ist restlos bedient, als sie der Anruf auf dem Handy erreicht. Sie geht nach draußen, um zu telefonieren, und kommt völlig frustriert wieder zurück. Kurz spielt sie mit dem Gedanken, sofort zu gehen, entschließt sich dann aber, erst in Ruhe auszutrinken. Sie kramt einen Stift aus ihrer Handtasche und beginnt, auf einer Papierserviette herumzukritzeln, während sie irgendeinem Idioten zuhört, der auf der Bühne Gedichte vorträgt.
Ich versuche, nicht darüber nachzudenken. Ich versuche, nicht über die Tatsache nachzudenken, dass sie hübsch ist. Ich rufe mir das Geld in Erinnerung. Ich brauche das Geld. So schwer kann diese Sache doch nicht sein. In ein paar Stunden ist alles erledigt.
»Das ist gut«, sage ich und nicke in Richtung Serviette. Etwas Besseres fällt mir einfach nicht ein. Von Kunst verstehe ich nicht das Geringste.
Bei meinem ersten Versuch zeigt sie mir noch die kalte Schulter. Sie will nichts mit mir zu tun haben. Das macht es einfacher. Sie hebt kaum den Blick von der Serviette, selbst als ich von der Kerze schwärme, die sie gezeichnet hat. Sie will, dass ich sie in Ruhe lasse.
»Danke.« Sie sieht mich nicht an.
»Ein wenig abstrakt.«
Das ist offensichtlich die falsche Bemerkung gewesen. »Meinen Sie damit, es sieht beschissen aus?«
Ein anderer würde jetzt lachen und behaupten, er habe nur Spaß gemacht, um sie anschließend mit Komplimenten herumzukriegen. Ich nicht. Nicht bei ihr.
Ich nehme ihr gegenüber Platz. Bei jeder anderen, an jedem anderen Tag, wäre ich einfach fortgegangen. An jedem anderen Tag hätte ich mich ihrem Tisch gar nicht erst genähert. Nicht dem Tisch einer so zickig und angefressen wirkenden Tusse. Small Talk, Flirten und all solchen Scheiß überlasse ich lieber den anderen. »Dass es beschissen aussieht, habe ich nicht gesagt.«
Sie legt eine Hand auf ihre Jacke und sagt: »Ich wollte gerade gehen.« Sie trinkt ihr Glas aus und stellt es ab. »Jetzt haben Sie den Tisch ganz für sich allein.«
»Wie Monet«, sage ich. »Monet macht doch diese abstrakten Sachen, oder?«
Ich sage es mit Absicht.