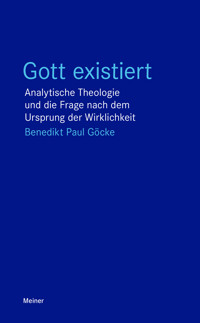
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Felix Meiner Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Blaue Reihe
- Sprache: Deutsch
In der gegenwärtigen philosophischen und theologischen Diskussion wird die Möglichkeit schlüssiger Argumente für die Existenz Gottes in der Regel mit Verweis auf Hume oder Kant zurückgewiesen. In seinem originellen Essay zeigt Benedikt Göcke jedoch, dass der Versuch, die Existenz Gottes argumentativ zu begründen, nach wie vor ein lohnenswertes Unterfangen wissenschaftlicher Wirklichkeitserschließung ist und sich keine prinzipiellen Gründe dafür finden lassen, warum Gottesbeweise nicht möglich sein sollten. Vielmehr ist das Unternehmen der Gottesbeweise immer noch eine der dringlichsten Aufgaben von Philosophie und Theologie. Göcke reflektiert zunächst einleitend über Wissenschaft und Wahrheit, den christlichen Wahrheitsanspruch sowie die Methodik der analytischen Theologie, bevor er – streng analytisch argumentierend – die metaphysische Frage nach der Existenz Gottes im Kern auf die Frage nach dem transzendenten Ursprung der Wirklichkeit zurückführt, die nur im Rahmen des metaphysischen Realismus eingefangen werden kann. Im Anschluss plausibilisiert er eine Variante desjenigen Gottesbeweises, der ursprünglich von Thomas von Aquin in »De Ente et Essentia« entwickelt wurde und sich auch heute noch als gelingender Gottesbeweis vertreten lässt: Wenn die Welt intelligibel ist, dann existiert Gott.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benedikt Paul Göcke
Gott existiert
Analytische Theologie und die Frage nach dem Ursprung der Wirklichkeit
Meiner
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie ; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über ‹https://portal.dnb.de› abrufbar.
eISBN (PDF) 978-3-7873-4908-1
eISBN (ePub) 978-3-7873-4909-8
© Felix Meiner Verlag Hamburg 2025. Alle Rechte vorbehalten. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings (§ 44 b UrhG) vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen. Konvertierung: Bookwire GmbH
Inhalt
Einleitung
1.
Wissenschaft und Wahrheit
2.
Christlicher Glaube und der Anspruch auf Wahrheit
3.
Analytische Theologie und die Frage nach dem Ursprung der Wirklichkeit
4.
Gott als Ursprung der Wirklichkeit
A.
Das Argument der ontologischen Unabhängigkeit Gottes
B.
Das Argument des objektiven Wahrheitswertes der Aussage »Gott existiert«
5.
Die prinzipielle Möglichkeit von Gottesbeweisen
A.
Begrifflicher Skeptizismus
B.
Argumentativer Skeptizismus
C.
Alethischer Skeptizismus
6.
Ein Gottesbeweis aus der Intelligibilität der Wirklichkeit
A.
Die Intelligibilität der Wirklichkeit
B.
Die Kontingenz der Wirklichkeit
C.
Der Ursprung der Wirklichkeit
D.
Gott existiert
E.
Der Preis der Zurückweisung des Argumentes
Schluss: Schöpfung aus dem Nichts
Appendix
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Einleitung
Obwohl in großen Teilen gegenwärtiger Philosophie und Theologie die Möglichkeit schlüssiger Argumente für die Existenz Gottes zurückgewiesen wird (größtenteils mit Verweis auf Hume oder Kant) und der Glaube an die Existenz Gottes als willkürliche Entscheidung des je Einzelnen aufgefasst wird, soll im Folgenden der Versuch unternommen werden, eben diese Existenz argumentativ zu begründen.
Damit dieser Versuch gelingen kann, sind in den folgenden Kapiteln einige vorbereitende Reflektionen nötig, die den Boden bereiten, aus dem das hier entwickelte Argument für die Existenz Gottes erwachsen wird: Das erste Kapitel – Wissenschaft und Wahrheit – wird in aller Kürze dafür argumentieren, dass das Ziel der Wissenschaft darin besteht, möglichst umfassende, kohärente, konsistente und mit dem Anspruch auf Wahrheit auftretende Theorien zu entwickeln, mit denen die in der Wirklichkeit bestehenden Sachverhalte in ihrem Sein und So-Sein erklärt werden können. Vor diesem Hintergrund wird das zweite Kapitel – Christlicher Glaube und der Anspruch auf Wahrheit – eine Minimalthese gehaltvollen christlichen Glaubens entwickeln, die besagt, dass christlicher Glaube nur dann eine gehaltvolle Weltanschauung ist, wenn zumindest einige seiner Elemente als metaphysische Aussagen über das Ganze der Wirklichkeit aufgefasst werden, die einen Anspruch auf objektive Wahrheit erheben und dementsprechend durch schlüssige Argumente gerechtfertigt werden müssen.
Das dritte Kapitel – Analytische Theologie und die Frage nach dem Ursprung der Wirklichkeit – wird in Anlehnung an die analytische Philosophie zunächst klären, was genau unter der Methodik der analytischen Theologie, die in diesem Bändchen federführend ist, verstanden wird, um mit ihrer Hilfe in einem ersten Schritt dafür zu argumentieren, dass die metaphysische Frage nach der Existenz Gottes im Kern die Frage nach dem transzendenten Ursprung der Wirklichkeit ist. Das vierte Kapitel – Gott als Ursprung der Wirklichkeit – wird diesen Begriff dann etwas genauer bestimmen und dafür plädieren, dass Gott, wenn er denn existiert, weder ein Postulat der praktischen Vernunft noch eine nützliche Fiktion oder gar ein Konstrukt unseres subjektiven Bewusstseins sein kann. Stattdessen ist der transzendente Ursprung der Wirklichkeit, wenn es einen solchen denn gibt, in seinem Sein und So-Sein vollständig unabhängig davon, wie wir über ihn denken.
Nachdem der Gottesbegriff auf diese Weise geklärt worden ist, wird das fünfte Kapitel – Die prinzipielle Möglichkeit von Gottesbeweisen – eine Lanze dafür brechen, dass der Versuch, die Existenz Gottes argumentativ zu begründen, nach wie vor ein lohnenswertes Unterfangen wissenschaftlicher Wirklichkeitserschließung ist und sich darüber hinaus keine prinzipiellen Gründe finden lassen, warum Gottesbeweise nicht möglich sein sollten. Vielmehr ist das Unternehmen der Gottesbeweise eine der dringlichsten Aufgaben der Theologie. Im Anschluss an die vorbereitenden Überlegungen der Kapitel eins bis fünfwird im sechsten Kapitel – Ein Gottesbeweis aus der Intelligibilität der Welt – eine Variante eines Gottesbeweises plausibilisiert, der ursprünglich im Werk De Ente et Essentia des Scholastikers Thomas von Aquin entwickelt worden ist und sich meiner Einschätzung nach auch heute noch als gelingender Gottesbeweis vertreten lässt.
1Wissenschaft und Wahrheit
Die menschliche Erkenntnis der Wirklichkeit ist nicht unmittelbar gewiss, sondern durch metaphysische Annahmen bestimmt, die der Erfahrung der Wirklichkeit vorgelagert sind. Diese Annahmen konstituieren die Perspektive, durch die uns die Wirklichkeit verständlich wird. Sie können als Erfahrungsrahmen bezeichnet werden und bilden den Kern einer Weltanschauung.1 Eine Weltanschauung ist somit ein theoretisches Gebilde, das implizit oder explizit unsere Urteile über die durch die Sinne des Menschen vermittelte Wirklichkeit bestimmt. Ohne Weltanschauung gibt es keine Erfahrungsurteile, was bedeutet, dass der jeweilige Erfahrungsrahmen mitbestimmt, welche Erfahrungsurteile wir aufgrund der Wahrnehmung der empirischen Welt fällen können.2
Ob sich eine Weltanschauung in der Vergangenheit bewährt hat, lässt sich daran erkennen, ob diese Weltanschauung auch heute noch vertreten wird. Wenn dies nicht der Fall ist, dann scheint es Faktoren zu geben, die dazu geführt haben, dass diese Weltanschauung aufgegeben worden ist und die Menschen ihre Perspektive auf die Wirklichkeit geändert haben. Ob sich eine Weltanschauung in der Gegenwart bewährt, lässt sich zum einen daran erkennen, ob es Menschen gibt, deren Interpretation der Wirklichkeit als Ganzer von dieser Weltanschauung sowohl im praktischen wie auch im theoretischen Bereich geleitet wird, und zum anderen daran, ob sie für Menschen so attraktiv ist, dass sie, analog zur religiösen Konversion, zu ihr übertreten. Wenn dies der Fall ist, dann scheint es auch hier Faktoren zu geben, die dafür verantwortlich sind, dass eine bestimmte Art der Erfahrung mit der Wirklichkeit sich als tragfähiger Orientierungsrahmen für das individuelle und gemeinschaftliche Leben erweist.3 Ob sich eine Weltanschauung auch in Zukunft bewähren wird, wird davon abhängen, inwieweit es ihr gelingen wird, auf Neues zu reagieren und dieses mit dem Kern ihrer metaphysischen Grundsätze so zu vermitteln, dass sie sich weiterhin für die Menschen bewährt.
Die Faktoren, die für die Bewährungsfähigkeit einer Weltanschauung relevant sind, so wird hier zumindest angenommen, sind jene Faktoren, die gemeinhin als die Merkmale eines wissenschaftlichen Zugangs zur Wirklichkeit klassifiziert werden. In anderen Worten: Die Bewährungsfähigkeit einer Weltanschauung ist bestimmt durch die Faktoren, die zu ihrer Wissenschaftlichkeit beitragen. Obwohl es wünschenswert wäre, die Frage danach, was denn die notwendigen und hinreichenden Bedingungen des wissenschaftlichen Zugangs zur Wirklichkeit sind, auf eindeutige und klare Weise durch die Angabe dieser Bedingungen beantworten zu können, hat die Diskussion in der Wissenschaftstheorie gezeigt, dass solche notwendigen und hinreichenden Bedingungen, die ausnahmslos jeder als wissenschaftlich zu qualifizierende Zugang zur Wirklichkeit erfüllen muss, kaum zu rechtfertigen sind: Historisch wurden zum einen ganz unterschiedliche Zugänge als wissenschaftliche Zugänge zur Wirklichkeit klassifiziert. Systematisch gibt es zum anderen eine enorme Bandbreite an Tätigkeiten, die wir als wissenschaftliche Tätigkeiten bezeichnen, die aber in ihrer Methodik und Ausrichtung nur unter sehr allgemein formulierte Kriterien zu subsumieren sind. Aus wissenschaftstheoretischer Perspektive gibt es daher keinen singulären, allgemeinverbindlichen und auf notwendigen und hinreichenden Bedingungen basierenden Begriff des wissenschaftlichen Zugangs zur Wirklichkeit, mit Hilfe dessen für jede menschliche Tätigkeit einwandfrei festgestellt werden könnte, ob es sich bei dieser Tätigkeit um eine wissenschaftliche Tätigkeit handelt oder nicht.4 Die Klärung des Charakters eines wissenschaftlichen Wirklichkeitszuganges kann daher auch nicht darin bestehen, hinreichende und notwendige Kriterien anzugeben, die ausnahmslos von jeder wissenschaftlichen Disziplin erfüllt werden müssen, sondern vielmehr darin, den Wissenschaftsbegriff als einen Begriff aufzufassen, der eine ganze Familie an Tätigkeiten und Disziplinen charakterisiert.5 Nur so scheint es möglich zu sein, die zahlreichen Variationen und unterschiedlichen Tätigkeiten, die gemeinhin als Wissenschaften verstanden werden, auch aus systematischer Sicht unter einen Hut zu bringen.
Zu den allgemeinen Voraussetzungen des wissenschaftlichen Zugangs zur Wirklichkeit gehört in diesem Sinne ganz grundlegend, dass der Mensch zur Reflexion seiner Weltanschauung fähig ist: Der Mensch kann sich der ihn in seiner Beobachtung der Wirklichkeit leitenden metaphysischen Prinzipien bewusstwerden und ihre Relationen untereinander und zu anderen Aussagen untersuchen, um sich auf diese Weise ihren Zusammenhang zu verdeutlichen. Darüber hinaus kann der Mensch die Beobachtungsaussagen, die in seiner jeweiligen Weltanschauung formuliert werden können, in verschiedene Gegenstandsbereiche unterteilen, die durch die Einheit ihres Gegenstandes konstituiert werden. So lassen sich beispielsweise biologische, physikalische, historische, metaphysische und religiöse Aussagensysteme spezifizieren, die primär auf den ihnen korrespondieren Gegenstandsbereich gerichtet sind. Dieser Gegenstandsbereich wird dabei so aufgefasst, dass er einen bestimmten Aspekt der Wirklichkeit repräsentiert.6 Trotz der unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, die sich jeweils mit einem bestimmten Gegenstandsbereich befassen, kann der Mensch aber auch erkennen, dass es eine letzte Einheit der Wissenschaften geben muss, weil es letzten Endes genau eine Wirklichkeit gibt, die sich den Menschen durch die Sinne anzeigt. Idealerweise konstituieren die einzelnen Wissenschaften daher ein System der Wissenschaft, in welchem sie nicht unvermittelt nebeneinanderstehen, sondern ein kohärentes Ganzes der verschiedenen Aspekte der einen Wirklichkeit konstituieren. Der allgemeine wissenschaftliche Zugang zur Wirklichkeit setzt also voraus, dass die Wirklichkeit sich nicht nur in Gegenstandsbereiche unterteilen lässt, sondern auch, dass die Wirklichkeit eine harmonische und einheitliche Wirklichkeit ist. Die oft in Anspruch genommene Unterscheidung zwischen Formal-, Natur- und Geisteswissenschaften ist also zurückzuweisen, falls damit gemeint ist, dass den Formal-, Natur- und Geisteswissenschaften jeweils unterschiedliche Wirklichkeiten – anstelle von unterschiedlichen Aspekten der einen Wirklichkeit – zugrunde liegen. Die Formal-, Natur- und die Geisteswissenschaften untersuchen jeweils unterschiedliche, aber aufgrund der Einheit der Wirklichkeit verbundene Aspekte der einen Wirklichkeit, die allen Wissenschaften zugrunde liegt.
Aus der Annahme der Einheit der einen Wirklichkeit und der Annahme der Möglichkeit, die Wirklichkeit in verschiedene Gegenstandsbereich zu unterteilen, folgen drei prinzipielle Hinsichten, die für den wissenschaftlichen Zugang zur Wirklichkeit bestimmend sind: Erstens können die einzelnen Gegenstandsbereiche von je einer Wissenschaft genauer untersucht werden. Dies geschieht in den Einzelwissenschaften, wie beispielsweise der Physik, der Mathematik, der Geschichtswissenschaft und der Germanistik. Zweitens können einzelne Wissenschaften und schließlich alle Wissenschaften auf ihre Unterschiede, Gemeinsamkeiten, Verbindungen und Wechselwirkungen hin untersucht werden. Dies geschieht beispielsweise in der Geochemie, in der synthetischen Biologie oder dem Forschungsgebiet der künstlichen Intelligenz. Drittens kann die Relation des Menschen zu den einzelnen Wissenschaften und zur Wissenschaft der Wirklichkeit als Ganzer untersucht werden, um so die transzendentalen Bedingungen der Möglichkeit wissenschaftlicher Erkenntnis zu untersuchen. Dies geschieht beispielsweise in der Transzendentalphilosophie, Metaphysik, Epistemologie und Ontologie.
Das allgemeine Ziel des wissenschaftlichen Zugangs zur Wirklichkeit besteht darin, möglichst gehaltvolle, konsistente und kohärente Theorien über die verschiedenen Gegenstandsbereiche der Wirklichkeit, ihren Zusammenhang miteinander und mit dem Ganzen der Wirklichkeit zu entwickeln, um mit ihrer Hilfe die vorgefundenen Aspekte der Wirklichkeit in ihrem Sein zu verstehen und ihr Bestehen zu erklären, damit eine gelingende Orientierung des Menschen in der Wirklichkeit ermöglicht wird.7
Obwohl nicht jede wahre Aussage eine wissenschaftliche Aussage ist und nicht jede wissenschaftliche Aussage eine wahre Aussage ist, ist der wissenschaftliche Wirklichkeitszugang darüber hinaus bemüht, nicht nur möglichst gehaltvolle Theorien zu entwickeln, sondern Theorien zu formulieren, die einen Anspruch auf Wahrheit erheben. Der wissenschaftliche Wirklichkeitszugang steht somit unter dem regulativen Ideal der Wahrheit. Obschon die einzig plausible Definition von Wahrheit die der korrespondenztheoretisch verstandenen Wahrheit ist, der zufolge ein Satz »p« genau dann wahr ist, wenn p der Fall ist, kann die Wahrheit einer wissenschaftlichen Aussage nicht zweifelsfrei überprüft werden.8 Diese Überprüfung würde voraussetzen, dass der Mensch einen Standpunkt einnehmen kann, von dem aus er neutral die Relation der Korrespondenz von Aussage und Wirklichkeit überprüfen kann. Da dies dem Menschen nicht möglich ist, muss sich der wissenschaftliche Zugang zur Wirklichkeit damit begnügen, Kriterien zu entwickeln, denen gemäß es vernünftig ist, anzunehmen, dass sie dazu beitragen, die Wirklichkeit verlässlich zu erkennen.
Das wohl entscheidendste methodologische Merkmal des wissenschaftlichen Zugangs zur Wirklichkeit besteht vor diesem Hintergrund darin, dass wissenschaftliche Theorien sich aufgrund des Ideals der Wahrheit an der Wirklichkeit orientieren und sich daher an der Wirklichkeit bewähren können müssen oder an ihr scheitern können müssen. Genauer formuliert: Zumindest einige der explizit formulierten Sätze einer wissenschaftlichen Disziplin müssen sich in einer ihrem Gehalt adäquaten Art und Weise dergestalt an der Wirklichkeit messen lassen können, dass sie sowohl an der Wirklichkeit scheitern als auch durch sie bestätigt werden können. Das Scheitern und Bewähren einer Theorie kann dabei je nach Disziplin und Gegenstandsbereich unterschiedlichen Bedingungen und Anforderungen genügen und kann in Bezug auf die Bewährung einer Theorie beispielsweise in Form von konstanter Bestätigung empirischer Vorhersagen, durch die erfolgreiche Vorhersage bislang unbekannter Sachverhalte, durch eine konsistente und kohärente metaphysische Erklärung eines Sachverhaltes unter Einbezug aller naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, durch eine konsistente Interpretation eines historischen Sachverhaltes oder durch technologischen Fortschritt geschehen.





























