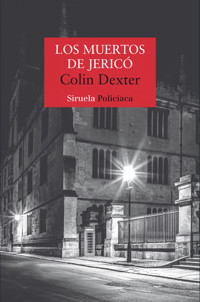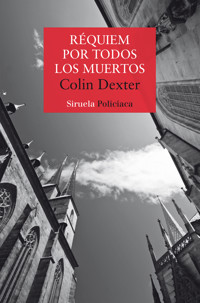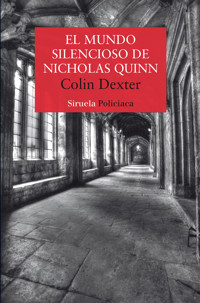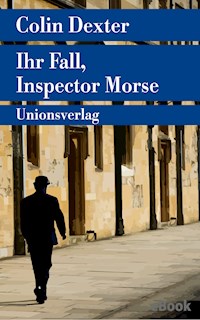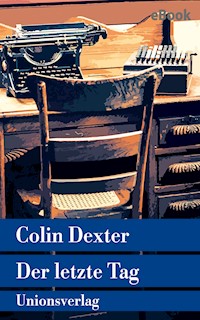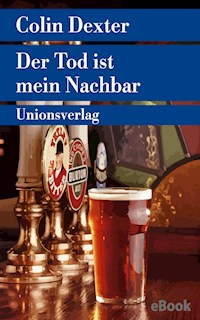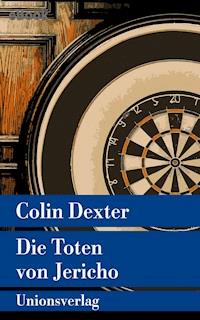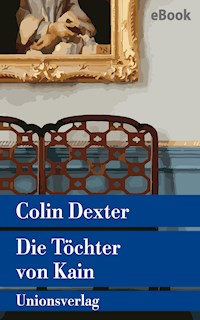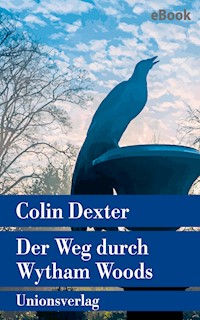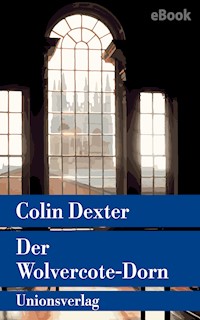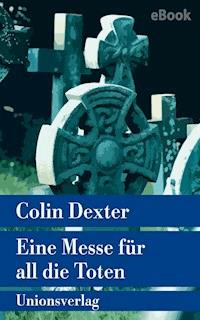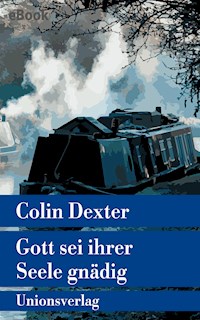
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Am besten denkt es sich doch immer noch bei einem Bierchen im rauchigen Pub. Inspector Morse denkt auch gerne bei einem Bierchen am Vormittag und dem gelegentlichen Whisky zwischendurch. Die Kombination mit etlichen Zigaretten und einer abgrundtiefen Abneigung gegen jegliche Form körperlicher Betätigung beschert Morse schließlich die Quittung – er wird mit einem Magengeschwür ins Krankenhaus eingeliefert. Nüchtern und gedemütigt von hartnäckigen Fragen zu seinem Trinkverhalten, liest Morse in dem Buch, das ihm sein Zimmernachbar hinterlassen hat: ein mysteriöser Mordfall aus dem Jahr 1859. Die junge Joanne Franks wurde tot aus dem Oxford-Kanal geborgen, zwei Männer dafür gehenkt. Morse findet etliche Details, die nicht zusammenpassen wollen, und beginnt, den Fall neu aufzurollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über dieses Buch
Inspector Morse ermittelt am liebsten bei Bier, Whisky und Zigaretten. Der exorbitante Mangel an körperlicher Betätigung beschert ihm schließlich die Quittung. Nüchtern und ans Bett gefesselt, liest er eine Abhandlung über einen Mordfall von 1859. Morse findet etliche Details, die nicht zusammenpassen wollen, und beginnt, den Fall neu aufzurollen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Colin Dexter (1930-2017) studierte Klassische Altertumswissenschaft. Er ist der Schöpfer der vierzehnteiligen Krimireihe um Inspector Morse. Für sein Lebenswerk wurde er mit dem CWA Diamond Dagger und dem Order of the British Empire für Verdienste um die Literatur ausgezeichnet.
Zur Webseite von Colin Dexter.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Colin Dexter
Gott sei ihrer Seele gnädig
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Christiane Friederike Bamberg
Ein Fall für Inspector Morse 8
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die englische Originalausgabe erschien 1989 bei Macmillan, London.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1990 unter dem Titel Mord am Oxford-Kanal im Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek.
Für die vorliegende Ausgabe hat Eva Berié die deutsche Übersetzung nach dem Original überarbeitet.
Originaltitel: The Wench is Dead
© by Macmillan, an imprint of Pan Macmillan, a division of Macmillan Publishers International 1989
Übernahme der Übersetzung mit freundlicher Genehmigung des Rowohlt Verlags, Reinbek
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Tim Gainey (Alamy Stock Foto)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape und Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-31031-5
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 07:18h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
GOTT SEI IHRER SEELE GNÄDIG
1 – Das Denken ist völlig abhängig vom Magen …2 – Weißt du, warum wir den Toten mehr Gerechtigkeit …3 – Blumen, Schreibmaterial und Bücher sind stets willkommene Geschenke …4 – Meine abendlichen Besucher sollten, falls sie die Uhr …5 – Diese Art Literatur besitzt zuweilen eine gleichsam lethische …6 – Ich genieße die Rekonvaleszenz. Es ist der Teil …7 – MORD AM OXFORD-KANAL8 – Stil ist das Zeichen eines Temperaments, das sich …9 – Wie erfreulich und angenehm ist doch die Welt …10 – TEIL ZWEI11 – »Mein Ehrenwort, Watson, Sie spielen wunderbar mit …12 – Das Wichtigste in einer Bibliothek sind die Regale …13 – Oh, füll den Becher: – was frommt die …14 – Unter den Lebenden zu sein war ein Privileg …15 – TEIL DREI16 – In einem Hotel in Brighton mit Blick auf …17 – Die Kriminalschriftsteller als Gattung sind auf Originalität und …18 – TEIL VIER19 – Wir bekommen beim Lesen eine Menge kluger Einsichten …20 – Diese hassenswerten Leute, die sich Quellenforscher nennen21 – Hure: Von der Wiege bis zur Bahre …22 – Halt! Tue nichts wegen deinem Namen! Ein Name …23 – Alles, was die Menschheit je getan, gedacht oder …24 – Magnus Alexander corpore parvus erat. (Nicht einmal Alexander …25 – Wer unfähig ist, große Verbrechen zu begehen …26 – Es gibt ein Gesetz, im dunkelsten der Bücher …27 – Einbildung, die du uns fortziehest28 – Wir leben in einem System von Lügen.Der eine …29 – Ich glaube, es grämt die Heiligen im Himmel …30 – Lente currite, noctis equi!(O trabt langsam, ihr Pferde …31 – Die zweite Seite (Englands) liegt nach Westen …32 – Oh, was für ein feines Netz wir webenWenn …33 – Stet Difficilior Lectio.(Die schwierigere Lesart soll gelten.)34 – Plündernde Rohlinge erschossen die klagende Eule;Es schweigt der …35 – Häuf keine Rosen auf ihr GrabSie liebte sie …36 – Das Wissen eines Mannes stirbt mit ihm …37 – Die heutigen Tänzer liefern uns eine bedrückende Spiegelung …38 – Die Prägung des Begriffs »Slum« reflektiert die Wirksamkeit …39 – Um dessentwillen du dich hergekommen wähntestIst Schale …40 – Die Welt ist rund, und der Ort …EpilogZitatnachweisAnmerkungen
Mehr über dieses Buch
Über Colin Dexter
Colin Dexter: »Ich liebe es, von einem Krimi an der Nase herumgeführt zu werden.«
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Colin Dexter
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Zum Thema England
Für Harry Judge, der Kanäle liebtund der mich bekannt machte mitdem Buch The Murder of Christina Collinsvon John Godwin, eine faszinierende Schilderungeines frühviktorianischen Mordfalls.Ich fühle mich tief in beider Schuld.
(Das Buch kann in der Stadtbüchereiin Stafford ausgeliehen werden.)
BERNARDINE So klage ich Sie an der …BARABAS Hurerei? Das war in einem andern Landund außerdem – die Schickse lebt nicht mehr.
Christopher Marlowe, Der Jude von Malta
1
Das Denken ist völlig abhängig vom Magen;dessen ungeachtet sind die mit den bestenMägen nicht auch die besten Denker.
Voltaire in einem Brief an d’Alembert
Am Dienstag war ihm immer wieder übel. Am Mittwoch musste er sich des Öfteren erbrechen. Am Donnerstag war ihm zwar fast die ganze Zeit über schlecht, doch der Brechreiz hatte nachgelassen. Am Freitagmorgen kostete es ihn, elend und teilnahmslos, wie er sich fühlte, und vor allem unendlich müde, eine große Kraftanstrengung, aufzustehen und sich ans Telefon zu schleppen, um seinem Vorgesetzten im Polizeipräsidium in Kidlington mitzuteilen, dass er heute vermutlich nicht zum Dienst erscheinen werde.
Als er am Samstagmorgen aufwachte, stellte er erfreut fest, dass er sich erheblich besser fühlte, und während er in seinem Schlafanzug – grell gestreift wie eine Sonnenliege – in der Küche seiner im Norden Oxfords gelegenen Junggesellenwohnung saß, überlegte er sogar, ob er seinem Magen unter diesen Umständen bereits wieder eine Schüssel Weetabix zumuten könne. Da klingelte das Telefon.
»Hier Morse«, meldete er sich.
»Guten Morgen, Sir.« (Welch angenehme Stimme!) »Würden Sie bitte einen Augenblick am Apparat bleiben? Der Superintendent möchte Sie sprechen.«
Morse blieb am Apparat – er hatte kaum eine andere Wahl – und überflog, während er wartete, die Schlagzeilen der Times, die ihm gerade durch den Briefschlitz gesteckt worden war. Wie immer samstags reichlich spät.
»Ich stelle Sie jetzt durch zum Superintendent«, sagte dieselbe angenehme Stimme. »Einen Moment noch.« Morse schwieg, aber er schickte ein Stoßgebet zum Himmel (für einen Atheisten schon eine Überwindung), dass Strange sich beeilen und ans Telefon kommen möge, um ihm endlich mitzuteilen, was immer es mitzuteilen gab … Auf Morse’ Stirn begannen sich Schweißperlen zu bilden, und er suchte mit der Linken in den Taschen seines Pyjama-Oberteils nach einem Taschentuch.
»Hallo, Morse? Sind Sie am Apparat? Ah, ja? Tut mir leid, dass Sie sich nicht wohlfühlen, alter Junge. Geht zur Zeit vielen so. Den Bruder meiner Frau hat es auch erwischt – wann war es doch gleich –, muss jetzt zwei Wochen her sein, glaube ich. Nein, stimmt gar nicht, eher drei Wochen. Aber das tut ja auch nichts zur Sache.«
Der Schweiß floss jetzt in Strömen, und Morse wischte sich immer wieder mit dem Taschentuch über die Stirn, während er pflichtschuldig ein zustimmendes Gemurmel von sich gab.
»Ich habe Sie hoffentlich nicht aus dem Bett geholt?«
»Nein, das nicht, Sir.«
»Gut. Ich dachte, ich ruf mal schnell bei Ihnen an. Äh … Ach, übrigens, Morse …«, (offenbar hatte Strange sich jetzt zu dem durchgerungen, was er sagen wollte) »es besteht keinerlei Notwendigkeit für Sie, heute ins Präsidium zu kommen, keinerlei Notwendigkeit. Es sei denn, Sie fühlen sich schon bedeutend besser. Ich denke, wir werden hier auch ohne Sie schon zurechtkommen. Auf den Friedhöfen liegen reihenweise Männer, die sich für unentbehrlich hielten, ist es nicht so?«
»Vielen Dank, Sir. Sehr freundlich von Ihnen, mich anzurufen. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Allerdings hätte ich dieses Wochenende ohnehin freigehabt …«
»Ach? Na, umso besser. Trifft sich gut, nicht wahr? Da können Sie ja in aller Ruhe im Bett bleiben.«
»Ja, vielleicht, Sir«, sagte Morse erschöpft.
»Aber Sie sagten, Sie seien auf, oder?«
»Ja, Sir.«
»Nun, dann machen Sie, dass Sie jetzt schnell wieder ins Bett kommen, Morse. So ein freies Wochenende ist doch die ideale Gelegenheit, sich mal so richtig zu erholen. Genau das, was Sie brauchen, wenn Sie sich nicht ganz wohlfühlen – ein bisschen Ruhe, Erholung … Das hat der Arzt auch dem Bruder meiner Frau gesagt, als der … wann war das noch gleich …«
Hinterher meinte Morse sich zu erinnern, dass er das Telefongespräch mit Strange trotz allem noch halbwegs anständig über die Bühne gebracht hatte, einschließlich einiger angemessen besorgter Äußerungen bezüglich dem Ergehen von Stranges Schwager, doch vor allem hatte sich ihm eingeprägt, dass sich seine Stirn, als er mit der Hand darübergefahren war, plötzlich nicht nur feucht, sondern sehr, sehr kalt angefühlt hatte und dass er dann zwei-, dreimal tief Luft geholt hatte und plötzlich aufgesprungen und ins Bad gelaufen war …
Mrs Green, seine Putzfrau, die jeden Dienstag- und Samstagvormittag bei ihm sauber machte, warf nur einen kurzen Blick auf Morse, der, an die Wand gelehnt, auf dem Boden des Eingangsflurs saß, dann stürzte sie zum Telefon, wählte den Notruf und bestellte einen Krankenwagen. Ihr Arbeitgeber war bei Bewusstsein, allem Anschein nach nüchtern und sah halbwegs manierlich aus bis auf die rötlich braunen Flecken auf der Vorderseite seiner Schlafanzugjacke, Flecken, die Mrs Green, sowohl was ihre Farbe als auch was ihre Konsistenz anging, lebhaft an den Bodensatz in ihrer Kaffeemaschine erinnerten. Sie wusste nur zu genau, was diese Flecken bedeuteten. Der Arzt damals hatte ihr ohne jede Schonung mit brutaler Offenheit gesagt – fünf Jahre war das nun her –, dass ihr Mann, wenn sie ihn nur rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht hätte, noch am Leben sein könnte …
»Ja, genau«, hörte sie sich überraschend bestimmt sagen, »gleich südlich vom Banbury-Road-Kreisverkehr. Ja, ich werde an der Tür auf Sie warten.«
Um Viertel nach zehn ließ sich Morse ohne allzu großes Widerstreben von einem Sanitäter die Treppe hinunterhelfen. In Hausschuhen und einem frischen Schlafanzug, eine kratzige graue Decke um die Schultern, saß er etwas verloren auf der Pritsche des Krankenwagens. Die Krankenschwester, eine Frau mittleren Alters, schien seine Weigerung, sich hinzulegen, als persönlichen Affront aufgefasst zu haben. Mürrisch, ohne ein Wort zu sagen, schob sie ihm, als er sich geräuschvoll übergeben musste, eine weiße, emaillierte Nierenschale auf den Schoß und schwieg auch noch, als der Krankenwagen auf das Gelände des John-Radcliffe-Krankenhauses einbog und schließlich vor der Notfall-Ambulanz anhielt.
Während Morse, ausgestreckt auf einer Krankenbahre liegend, auf einen Arzt wartete, dachte er in einem Anflug von Selbstmitleid, dass er hier auf diesem Flur sterben könnte, ohne dass dies irgendjemandem auffiele. Er war schon immer ungeduldig gewesen (vor allen Dingen in Hotels, wenn morgens das Frühstück nicht gleich kam), und vielleicht hatte es ja in Wirklichkeit nur einige wenige Minuten gedauert, bis ein weiß gekleideter Krankenhausangestellter neben ihm auftauchte und begann, in aller Ruhe mit ihm den Aufnahmebogen durchzugehen. Morse musste Auskunft geben über seine nächsten Angehörigen (in seinem Fall nicht vorhanden) sowie seine Konfession (ebenfalls nicht vorhanden). Nachdem solchermaßen die Initiationsriten vollzogen und er gleichsam in den Klub aufgenommen worden war, begann man sich um ihn zu kümmern. Von irgendwoher erschien eine junge Schwester, fühlte ihm den Puls, maß seinen Blutdruck (wobei sie, wie Morse fand, den schwarzen Gummiriemen um seinen Oberarm sehr viel fester als nötig anzog) und trug die Ergebnisse mit einem Gleichmut in sein Krankenblatt (»MORSE, E.«) ein, der den Gedanken nahelegte, dass nur ausgesprochen dramatische Abweichungen von der Norm Grund zur Besorgnis sein könnten. Zum Schluss wollte sie auch noch seine Temperatur messen, und Morse kam sich einigermaßen idiotisch vor, wie er so dalag und das Thermometer ihm aus dem Mund ragte. Die Schwester schien mit dem Ergebnis der Messung offenbar unzufrieden, sie schüttelte das Thermometer einige Male mit einer Bewegung, nicht unähnlich einem Rückhandschlag beim Pingpong, um es ihm schließlich, kaum weniger geschickt als beim ersten Mal, noch einmal unter die Zunge zu zwängen.
»Werde ich überleben?«, wagte Morse einen Vorstoß, während die Schwester die Ergebnisse der Messung auf sein Krankenblatt übertrug.
»Sie haben Temperatur«, antwortete der wenig auskunftsfreudige Teenager.
»Ich dachte, jeder Mensch hätte Temperatur«, murmelte Morse.
Doch da hatte die Schwester ihm schon den Rücken zugewandt, um den nächsten Neuzugang in Augenschein zu nehmen.
Der junge Mann, den man gerade hereingerollt hatte, trug noch sein schwarz-rot gestreiftes Rugby-Trikot. Seine nackten Beine waren dreckverkrustet, und quer über seine Stirn klaffte eine scheußlich aussehende, riesige Wunde. Morse kam er dennoch ganz entspannt vor, als er dem Krankenhausangestellten (derselbe, der auch Morse befragt hatte) bereitwillig Auskunft gab über Lebensgeschichte, Konfession und Verwandte. Genauso entspannt ließ er es über sich ergehen, als die Schwester ihm mit dem Stethoskop zu Leibe rückte, den Puls fühlte und seine Temperatur maß. Morse merkte plötzlich, wie er neidisch wurde auf die selbstverständliche Vertrautheit zwischen dem jungen Mann und der ebenso jungen Schwester. Und plötzlich – und diese Erkenntnis traf ihn wie ein Schlag – realisierte er, dass die Schwester ihn vermutlich genau als das sah, was er ja auch tatsächlich war: ein Mann, der recht und schlecht ins sechste Lebensjahrzehnt getreten war und sich nun den leicht entwürdigenden Krankheiten des beginnenden Alters gegenübersah – Leistenbruch, Hämorrhoiden, Prostatabeschwerden und, ja!, Zwölffingerdarmgeschwüren.
Morse beugte sich gerade, von einem heftigen Würgereiz gepackt, über die Nierenschale, die sie vorsichtshalber in Reichweite hatten stehen lassen, als ein junger Assistenzarzt, ungefähr halb so alt wie Morse, neben ihn trat und den Bericht über seine Einlieferung, den Fragebogen des Krankenhauses und sein Krankenblatt zu überfliegen begann.
»Eine ziemlich üble Geschichte, Ihre Bauchbeschwerden, ist Ihnen das klar?«
Morse zuckte ausweichend die Achseln. »Mir hat bisher niemand etwas gesagt.«
»Man muss ja nicht gerade ein Sherlock Holmes sein, um zu verstehen, dass da etwas nicht stimmt, ganz und gar nicht stimmt.«
Morse wollte gerade etwas entgegnen, als der Assistenzarzt fortfuhr: »Sie sind gerade erst eingeliefert worden, glaube ich? Wenn Sie uns, Mr, äh, Morse, nicht wahr … wenn Sie uns ein bisschen Zeit lassen, dann werden wir versuchen, Ihnen bald Genaueres zu sagen, okay?«
»Ich fühle mich aber eigentlich ganz in Ordnung. Wirklich«, sagte Morse mit leiser Stimme und einigermaßen eingeschüchtert, während er sich in die Kissen zurücksinken ließ und versuchte, seine verkrampften Schultermuskeln zu entspannen.
»Der Eindruck täuscht, fürchte ich. Bestenfalls haben Sie nur ein Magengeschwür, das spontan zu bluten angefangen hat« – Morse spürte einen Stich von Panik im Zwerchfell –, »aber es kann auch sein, dass es sich um ein durchgebrochenes Magengeschwür handelt, und wenn das der Fall sein sollte …«
»Dann …?«, fragte Morse mit schwacher Stimme.
Aber der junge Arzt schwieg und begann stattdessen, Morse’ Bauch abzutasten.
»Nun, haben Sie etwas gefunden?«, fragte Morse und bemühte sich um einen möglichst munteren Ton.
»Sie sollten versuchen, ein paar Kilo abzunehmen. Ihre Leber ist vergrößert.«
»Ich dachte, Sie hätten gesagt, es sei der Magen.«
»Ja, ist es auch. Sie haben Magenblutungen gehabt.«
»Und was … was hat dann meine Leber damit zu tun?«
»Trinken Sie viel, Mr Morse?«
»Nun, die meisten Leute trinken doch so zwei, drei Gläser pro Tag.«
»Ich habe gefragt, ob Sie viel trinken.« Der Ton war ein wenig schärfer geworden.
Morse versuchte, trotz der in ihm aufsteigenden Angst gleichmütig zu wirken, und so zuckte er mit den Achseln: »Ich trinke gern mal ein Bier, ja.«
»Wie viele Biere pro Woche?«
»Pro Woche?«, fragte Morse erschrocken, und sein Gesicht verzog sich in nachdenkliche Falten wie bei einem Kind, dem man eine komplizierte Multiplikationsaufgabe zu lösen gegeben hat.
»Na, dann eben pro Tag«, schlug der Assistenzarzt entgegenkommend vor.
Morse dividierte durch drei. »So zwei, drei, denke ich.«
»Trinken Sie auch schärfere Sachen?«
»Gelegentlich.«
»Und was?«
Morse bewegte unruhig seine angespannten Schultermuskeln. »Whisky – ab und zu trinke ich einen kleinen Whisky.«
»Wie lange hält denn eine Whiskyflasche in der Regel bei Ihnen?«
»Das kommt darauf an, wie groß die Flasche ist.«
Doch diese Art von Humor kam offenbar nicht gut an, und so multiplizierte er schnell mit drei. »Eine Woche … zehn Tage … so ungefähr.«
»Und wie viele Zigaretten rauchen Sie pro Tag?«
»So acht … bis zehn«, sagte Morse, die richtige Zahl gleich umstandslos durch drei teilend.
»Gibt es irgendeine Art von körperlicher Betätigung, die Sie regelmäßig ausüben – Wandern, Joggen, Radfahren, Squash …?«
Doch bevor Morse mit seinen Überlegungen, welches wohl die günstigste Antwort sei, zu Ende gekommen war, musste er schon wieder nach der Nierenschale greifen. Während er sich geräuschvoll erbrach, registrierte der Assistenzarzt besorgt die rötlich braune Farbe des Erbrochenen, das mit hellroten Spritzern von frischem Blut durchsetzt war, Blut, das durch eine tägliche Dosis Nikotin seines Sauerstoffs beraubt und überdies noch reichlich mit Alkohol versetzt wurde.
Kurz darauf verfiel Morse in eine Art Dämmerzustand. Irgendwann, daran konnte er sich erinnern, hatte sich eine Schwester über ihn gebeugt (dieselbe junge Schwester, die sich auch vorher schon um ihn gekümmert hatte), um ihm den Puls zu fühlen. Ihr Stirnrunzeln hatte Morse verraten, dass sie über das Ergebnis ihrer Messung beunruhigt war.
Und plötzlich hatte er gewusst, dass der Engel des Todes ihn gestreift hatte, und ein Schauer war ihm über den Rücken gelaufen, als er zum ersten Mal in seinem Leben an das Sterben dachte. Einen Augenblick lang hatte er sogar gemeint, seinen Nachruf vor sich zu sehen – einen lobenden Nachruf natürlich.
2
Weißt du, warum wir den Toten mehrGerechtigkeit widerfahren lassen?Wir sind ihnen gegenüber zu nichtsverpflichtet, wir können uns Zeit lassen.Wir können ihnen unsere Ehrerbietung erweisenzwischen einer Cocktailparty und einerzärtlichen Geliebten – in unserer freien Zeit.
Albert Camus, Der Fall
Als Morse am nächsten Morgen erwachte, begann es draußen gerade zu dämmern. Die Uhr im Krankensaal zeigte zehn vor fünf, und durch einen Türbogen erspähte Morse die schlanke Gestalt einer Schwester, die, in warmen Lichtschein gehüllt, an einem Schreibtisch saß und Eintragungen in ihren Unterlagen machte. Vielleicht betraf die Eintragung ja ihn, dachte Morse. Wenn dem so war, so konnte es sich nur um einen kurzen Text handeln, denn abgesehen von einer kurzen Phase des Erbrechens irgendwann nach Mitternacht ging es ihm inzwischen wirklich sehr viel besser, und er hatte keiner weiteren Fürsorge bedurft. Der Infusionsschlauch, der von seinem rechten Handgelenk zu dem über seinem Bett aufgehängten Tropf führte, zog zwar unangenehm an seiner Haut, so als ob die Nadel nicht ganz exakt säße, aber er hatte beschlossen, die Nachtschwester wegen dieser Kleinigkeit nicht zu behelligen. Der Tropf verdammte ihn leider zur Immobilität – jedenfalls so lange, bis er über die gleiche Fähigkeit verfügte wie sein Bettnachbar, ein junger Mann, der gestern den Abend über im Krankenhaus herumgewandert war, den Tropf dabei wie ein äthiopischer Athlet hoch über seinen Kopf emporhaltend, als handele es sich um die Fackel mit dem olympischen Feuer. Seiner eingeschränkten Bewegungsfreiheit war es auch zuzuschreiben gewesen, dass Morse, was ihm ausgesprochen peinlich gewesen war, um eine sogenannte »Ente« hatte bitten müssen. Immerhin, die Bettpfanne war ihm bisher erspart geblieben, und er hoffte, dass mangels fester Nahrung in den letzten Tagen sein Darm ihm diesbezüglich keinen Ärger machen würde.
Die Schwester draußen redete jetzt mit ernster Miene auf einen schmächtigen jungen Assistenzarzt ein, dessen weißer Kittel ihm fast zu den Knöcheln reichte. Aus seiner rechten Tasche ragte ein Stethoskop. Gleich darauf betraten die beiden mit ruhigen Schritten den Krankensaal und verschwanden hinter den Vorhängen, die man gestern Abend zugezogen hatte, um dem Patienten im Bett schräg gegenüber von Morse ein gewisses Maß an Privatheit zu geben.
Morse hatte den Mann gesehen, als er hereingerollt worden war, einen älteren, distinguiert aussehenden Herrn Ende siebzig, mit einem Schnurrbart, wie er früher von Angehörigen der indischen Armee getragen worden war, und einigen spärlichen schneeweißen Haaren. Einen Augenblick lang hatten sich ihre Blicke gekreuzt, und in den Augen des alten Soldaten hatte Morse so etwas wie Aufmunterung und ein Gefühl kameradschaftlicher Nähe aufblitzen sehen. Die in seinem Körper wütende Blutvergiftung, die seinen Wangen bereits einen verräterisch rosa Hauch verlieh, hatte es jedoch nicht mehr zugelassen, dass der sterbende Mann seine Gefühle in Worte kleidete.
Um zwanzig nach fünf schlug der Assistenzarzt die Vorhänge zur Seite, um halb sechs kamen die Pfleger und rollten den Toten hinaus. Und als genau eine halbe Stunde später, um sechs Uhr, das Licht im Krankensaal anging, waren die Vorhänge um das Bett, in dem Oberst Wilfrid Deniston, OBE, MC, in den frühen Morgenstunden gestorben war, beiseitegezogen, so als sei nichts geschehen, und es war nichts zu sehen als ein frisch geplättetes Laken und zwei fachmännisch gefaltete Decken am Fußende. Hätte Morse gewusst, dass der Verstorbene zeit seines Lebens ein Wagner-Hasser gewesen war, so hätte er wohl bei ihm an Sympathie eingebüßt, andererseits hätte die Tatsache, dass Deniston das gesamte poetische Werk von A. E. Housman auswendig konnte, Morse wohl für ihn eingenommen.
Um Viertel vor sieben bemerkte Morse in der Umgebung des Krankensaals eine rege Geschäftigkeit, ohne jedoch ausmachen zu können, was genau vor sich ging. Er hörte Stimmen, das Klappern von Geschirr und das Quietschen schlecht geölter Räder, bis sich schließlich das Rätsel löste, als Violet, eine schwergewichtige, gut gelaunte Frau aus Westindien, einen Teewagen vor sich herschiebend den Krankensaal betrat. Die Aussicht auf eine Tasse heißen Tee war Morse mehr als willkommen. Zum ersten Mal seit einigen Tagen verspürte er wieder Lust, etwas zu sich zu nehmen, und erst vor ein paar Minuten hatte er mit Neid die Wasserkrüge und Saftflaschen auf den Nachttischen seiner Mitpatienten registriert. Nur der Patient gegenüber, ein gewisser Walter Greenaway, hatte keinerlei Getränk auf seinem Nachttisch stehen. Über seinem Bett hing ein Zettel mit der Aufschrift: PATIENT MUSS NÜCHTERN BLEIBEN!
»Tee oder Kaffee, Mr Greenaway?«
»Oh, wenn es Ihnen recht ist, dann hätte ich gern einen Gin Tonic.«
»Mit Eis und Zitrone?«
»Ohne Eis bitte, das verdirbt den Gin.«
Violet grinste, ließ Mr Greenaway zurück – ohne Eis, ohne irgendetwas – und schob ihre massive Gestalt zum nächsten Bett. Doch den munteren Sechzigjährigen schien es nicht weiter zu kränken, dass er übergangen wurde. Verschmitzt zwinkerte er Morse zu. »Alles in Ordnung, Chef?«
»Auf dem Weg der Besserung«, sagte Morse vorsichtig.
»Ha! Das hat der alte Oberst auch gesagt. ›Auf dem Weg der Besserung.‹ Der arme Teufel.«
»So, hat er das?«, murmelte Morse unbehaglich.
Nachdem der Ausdruck pietätvoller Bekümmerung auf Greenaways Gesicht gewichen war, fuhr Morse fort: »Sie bekommen nicht einmal Tee?«
Greenaway schüttelte den Kopf. »Sie werden schon wissen, was das Beste für mich ist.«
»Meinen Sie?«
»Aber ja! Die Ärzte hier sind großartig! Und die Schwestern erst!«
Morse nickte. Er hoffte nur, dass Greenaway mit seiner Einschätzung recht hatte.
»Sie haben das Gleiche wie ich, nicht wahr?«, fragte Greenaway in vertraulichem Ton.
»Wie bitte?«
»Der Magen – oder?«
Morse nickte. »Es heißt, ich hätte ein Magengeschwür.«
»Meines war schon durchgebrochen.« Greenaway verkündete die Tatsache, als gebe sie Anlass zu Stolz. »Um zehn werde ich operiert, deshalb durfte ich auch eben nichts trinken.«
»Ach so.« Einen Moment lang verspürte Morse den irrationalen Wunsch, sich ebenfalls mit einer gefährlich klingenden Diagnose brüsten zu können – mit einem ganzen Dutzend durchgebrochener Magengeschwüre am besten –, doch dann wurde seine Aufmerksamkeit abgelenkt, denn Violet mit ihrem Teewagen stand neben seinem Bett.
Sie begrüßte ihren neuen Schützling mit einem vergnügten Lächeln. »Morgen, Mister … äh (sie warf einen Blick auf sein Namensschild über dem Bett) äh … Mister Morse!«
»Guten Morgen«, antwortete Morse freundlich. »Ich hätte gern einen Kaffee – mit zwei Löffeln Zucker.«
»So, so! Zwei Löffel Zucker!« Violet verdrehte in gespieltem Erstaunen die Augen, sodass nur noch das Weiße zu sehen war. Dann blickte sie zu Greenaway hinüber, und beide tauschten ein verschwörerisches Lächeln aus. »Ich muss Ihnen leider sagen«, sagte sie dann zu Morse gewandt, »dass Sie weder Kaffee noch Tee noch Zucker bekommen dürfen.« Sie wies mit dem Zeigefinger auf die Wand hinter seinem Bett, und Morse verrenkte sich beinahe den Hals, um zu entziffern, was auf dem kleinen Kärtchen geschrieben stand: PATIENT MUSS NÜCHTERN BLEIBEN!
3
Blumen, Schreibmaterial und Bücher sind stets willkommene Geschenke. Falls Sie jedoch dem Patienten etwas zu essenoder zu trinken mitbringen möchten, fragen Sie bitte vorhereine Schwester. Sie wird Ihnen sagen, was erlaubt ist.
Gesundheitsbehörde Oxford,Merkblatt für Patienten und Besucher
Abends, kurz nach sieben Uhr, betrat Detective Sergeant Lewis den Krankensaal. Er trug verstohlen eine Plastiktüte von Sainsbury unter dem Arm. Sein Gesichtsausdruck ähnelte dem eines Flugreisenden, der mit schlechtem Gewissen eine Stange Zigaretten durch den Zoll zu schmuggeln versucht.
Morse war über Lewis’ Auftauchen erfreut und gerührt. »Woher wussten Sie, dass ich hier bin?«
»Ich bin bei der Polizei!«
»Ich nehme an, man hat Sie angerufen?«
»Ja. Strange höchstpersönlich. Er sagte, Sie hätten gestern Morgen am Telefon ziemlich erbärmlich geklungen, deshalb hat er Dixon bei Ihnen vorbeigeschickt, aber der kam zu spät, man hatte Sie schon abtransportiert. Strange rief mich dann an und fragte, ob ich nicht Lust hätte, wieder einmal nachzuprüfen, wie unser Gesundheitssystem funktioniere – und mich zu erkundigen, ob Sie etwas brauchen.«
»Wie zum Beispiel eine Flasche Scotch?«
Lewis überhörte die Bemerkung. »Ich wäre schon gestern Abend gekommen, aber man sagte mir, Besuche seien nicht erlaubt – das heißt, außer von nahen Angehörigen.«
»Sie denken wohl, ich sei mutterseelenallein auf der Welt, was, Lewis? Dem ist aber nicht so. Ich habe eine Großtante oben in Alnwick.«
»Ein bisschen zu weit, um mal eben vorbeizukommen, Sir.«
»Besonders, wenn man schon siebenundneunzig ist …«
»Strange ist eigentlich ganz in Ordnung, nicht?«, bemerkte Lewis nach einer verlegenen kleinen Pause.
»Na ja, wenn man ihn ziemlich gut kennt«, entgegnete Morse.
»Würden Sie sagen, dass Sie ihn gut kennen?«, fragte Lewis.
Morse schüttelte den Kopf.
»Übrigens, Sir, wie geht es Ihnen eigentlich? Was ist denn das Problem?«
»Problem. Es gibt kein Problem. Ein klarer Fall von Verwechslung.«
Lewis grinste. »Also jetzt mal im Ernst!«
»Im Ernst? Nun, sie geben mir nur riesige, runde, weiße Tabletten, die pro Stück ein paar Pfund kosten – das behaupten jedenfalls die Schwestern. Wenn ich mir vorstelle, dass ich für den Preis einer Tablette schon eine kleine Flasche recht anständigen Rotwein bekommen könnte …«
»Wie ist denn das Essen hier? Einigermaßen schmackhaft?«
»Essen! Was für Essen? Das Einzige, was sie mir hier zu schlucken geben, sind die Tabletten.«
»Also auch keinen Alkohol?«
»Sie wollen doch nicht meinen Gesundungsprozess gefährden, Lewis, oder?«
Lewis starrte auf das kleine Schild am Kopfende von Morse’ Bett. »Das ist also damit gemeint«, sagte er nachdenklich.
»Reine Vorsichtsmaßnahme«, sagte Morse mit schlecht gespielter Gleichgültigkeit.
Lewis warf einen bedauernden Blick auf seine Plastiktüte.
»Nun, kommen Sie schon, Lewis. Was haben Sie da drin?«
Lewis griff in die Tüte und holte eine Flasche Limonade hervor. Zu seiner Überraschung schien Morse ehrlich erfreut.
»Es ist nämlich so … Meine bessere Hälfte meinte, dass Sie bestimmt nichts Alkoholisches trinken dürfen …«
»Eine sehr kluge Überlegung! Sagen Sie ihr, dass mir, so wie die Dinge liegen, eine Flasche Limonade tausendmal lieber ist als eine ganze Kiste Whisky.«
»Ist das Ihr Ernst, Sir?«
»Nein, aber richten Sie es ihr trotzdem aus.«
»Und dann habe ich hier noch ein Buch«, sagte Lewis und zog einen dicken Schinken heraus mit dem Titel: Die Waage der Injustitia. Eine vergleichende Studie über Verbrechen und ihre Bestrafung, durchgeführt anhand von Akten der Grafschaft Shropshire aus den Jahren 1842 bis 1852.
Morse nahm den Wälzer und überflog den ermüdend langen Titel ohne Zeichen der Begeisterung. »Hm«, sagte er schließlich. »Macht einen ganz interessanten Eindruck.«
»Ist das Ihr Ernst, Sir?«
»Nein.«
»Es ist eine Art Familienerbstück, und meine bessere Hälfte meinte …«
»Sagen Sie Ihrer wundervollen besseren Hälfte, dass ich mich sehr gefreut habe.«
»Sie täten mir einen großen Gefallen, wenn Sie es bei Ihrer Entlassung in der Krankenhausbibliothek abgeben könnten«, sagte Lewis und registrierte befriedigt, dass Morse’ Mund sich zu einem breiten Grinsen verzog.
In diesem Augenblick trat die hübsche Schwester mit den Sommersprossen und dem rotbraunen Haar an sein Bett, wies auf die Limonadenflasche, die er auf dem Nachttisch abgestellt hatte, und drohte ihm mit dem Zeigefinger. Morse nickte und formte ein stummes okay. »Wer ist das?«, flüsterte Lewis, als sie weiterging.
»Das, Lewis, ist die Fantastische Fiona. Attraktiv, finden Sie nicht auch? Ich frage mich manchmal, wie es die Ärzte schaffen, ihre schmutzigen Hände von ihr zu lassen!«
»Vielleicht schaffen sie es ja gar nicht.«
»Ich dachte, Sie seien gekommen, um mich aufzuheitern.«
Doch die Chancen für Aufheiterungen jeder Art standen schlecht. Die Oberschwester (die Lewis beim Hereinkommen nur flüchtig wahrgenommen hatte, da er, in der Annahme, dies sei hier so üblich, gleich durchmarschiert war) hatte die ganze Zeit über mit Argusaugen über den Krankensaal gewacht, ihre besondere Aufmerksamkeit hatte jedoch der Ecke gegolten, wo der Chief Inspector lag. Von ihrem Schreibtisch bis zu seinem Bett waren es nur ein paar Meter, und mit ein paar raschen, energischen Schritten stand sie plötzlich an seiner Seite. Während sie mit geübtem Griff die anstößige Flasche an sich nahm, sagte sie zu dem unglücklichen Detective Sergeant: »Wir haben unsere Vorschriften in diesem Krankenhaus – die Hausordnung hängt gleich rechts neben der Tür zum Saal. Ich fände es sehr begrüßenswert, wenn Sie sich danach richten würden und, falls Sie vorhaben, den Patienten noch einmal zu besuchen, sich vorher bei mir oder bei meiner Vertretung melden. Es ist absolut notwendig, dass hier alles seinen geregelten Gang geht, und ich muss Sie dringend bitten, dafür Verständnis zu haben. Ihrem Bekannten hier geht es gar nicht gut, und wir tun alles, was in unseren Kräften steht, damit er wieder gesund wird. Unsere Bemühungen können aber nur dann Erfolg haben, wenn Sie uns nicht dazwischenkommen und irgendetwas mitbringen, von dem Sie meinen, dass es ihm guttäte, was ihm aber in Wahrheit nur schadet. Okay? Das ist doch wohl einzusehen, oder?«
Sie hatte mit einem leichten schottischen Akzent und grimmiger Miene gesprochen. Lewis, der bei ihren Worten abwechselnd rot und blass geworden war, sah völlig geknickt aus, als sie verschwand, um endlich wieder ihren Platz hinter dem Schreibtisch einzunehmen. Sogar Morse war eingeschüchtert und blieb für einen Augenblick stumm.
»Und wer war das?«, fragte er nun zum zweiten Mal an diesem Abend.
»Sie durften eben einem Auftritt unserer verehrten Oberschwester beiwohnen, gleichermaßen humorlos wie effizient. Eine Art calvinistische Mrs Thatcher.«
»Und ihr Wort …«
Morse nickte. »… ist Befehl. Sie ist diejenige, die hier auf der Station das Sagen hat. Aber das werden Sie sich sicherlich schon gedacht haben.«
»Aber musste sie so streng sein?«
»Was weiß ich! Vielleicht ist sie frustriert über ihr nicht existentes Sexualleben. Mit dem Gesicht …«
»Wie heißt sie?«
»Sie nennen sie Nessie.«
»Weil sie aus der Umgebung von Loch Ness stammt?«
»Aus dem Loch selbst, Lewis.« Die beiden Männer lachten, doch der Zusammenstoß mit der Stationsschwester war unerfreulich gewesen, und besonders Lewis konnte sich nur schwer davon erholen. Etwa fünf Minuten lang fragte er Morse aus nach den anderen Patienten, der Chief Inspector erzählte ihm vom Tod des Obersten der Indischen Armee im Morgengrauen, und weitere fünf Minuten vergingen mit Small Talk über Ereignisse im Präsidium, Lewis’ Familie sowie die in dieser Saison nicht gerade rosigen Aussichten von Oxford United. Doch der Auftritt der, wie Morse sie nannte, »verdammten Schwester« hatte ihnen beiden die Laune verdorben. Die Stimmung blieb gedämpft. Morse war plötzlich unangenehm heiß, und er spürte, dass die Unterhaltung ihn zu ermüden begann.
»Ich glaube, es ist allmählich Zeit, dass ich gehe, Sir.«
»Was haben Sie noch in Ihrer Plastiktüte?«
»Nichts …«
»Lewis! Mein Magen ist vielleicht im Moment nicht ganz in Ordnung, aber mein Gehör ist ungetrübt!«