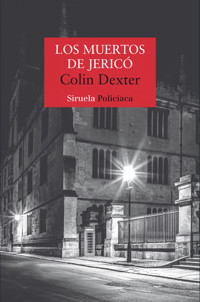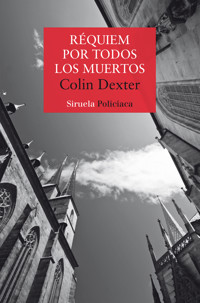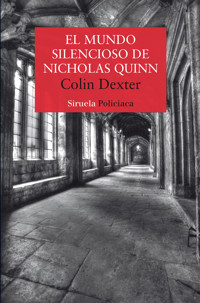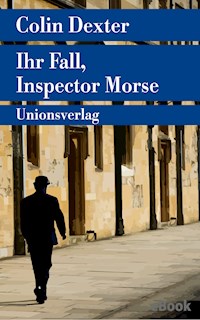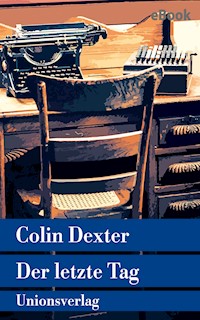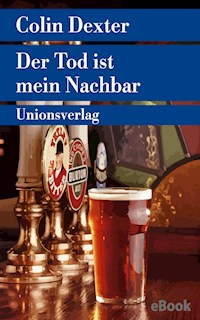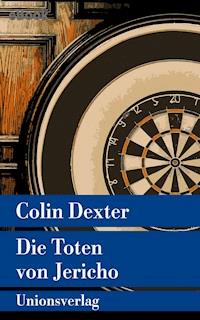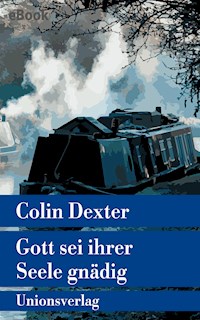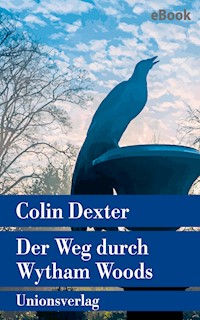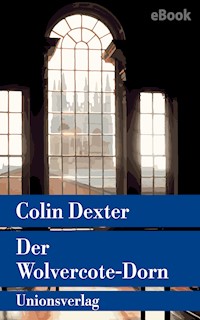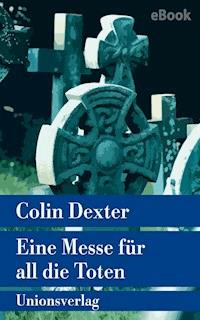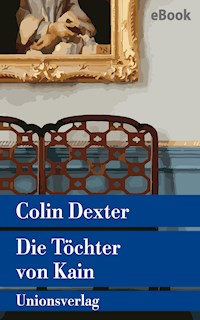
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Ermittlungen zum Mord an einem Geschichtsprofessor der Oxford-Universität haben noch kaum Fortschritte gemacht, als Inspector Morse und Sergeant Lewis der Fall übertragen wird. Morse braucht nicht lange, um einen Verdächtigen zu identifizieren. Nur leider wird ebendieser kurz darauf mit derselben Mordwaffe erstochen wie der Professor. Viel zu viele Verdächtige tauchen nun auf, und zum ersten Mal scheint Morse ratlos. Bis ihn Catulls Liebesgedichte und das Kreuzworträtsel der Times auf eine entscheidende Idee bringen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über dieses Buch
Die Ermittlungen zum Mord an einem Professor der Oxford-Universität haben kaum Fortschritte gemacht, als Inspector Morse der Fall übertragen wird. Kurz darauf wird der Hauptverdächtige mit derselben Waffe getötet. Zum ersten Mal scheint Morse ratlos. Bis ihn Catulls Liebesgedichte und das Times-Kreuzworträtsel auf die entscheidende Idee bringen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Colin Dexter (1930-2017) studierte Klassische Altertumswissenschaft. Er ist der Schöpfer der vierzehnteiligen Krimireihe um Inspector Morse. Für sein Lebenswerk wurde er mit dem CWA Diamond Dagger und dem Order of the British Empire für Verdienste um die Literatur ausgezeichnet.
Zur Webseite von Colin Dexter.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Colin Dexter
Die Töchter von Kain
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Ute Tanner
Ein Fall für Inspector Morse 11
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die englische Originalausgabe erschien 1994 bei Macmillan, London.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1996 unter dem Titel Die Leiche am Fluss im Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek.
Für die vorliegende Ausgabe hat Eva Berié die deutsche Übersetzung nach dem Original überarbeitet.
Originaltitel: The Daughters of Cain
© by Macmillan, an imprint of Pan Macmillan, a division of Macmillan Publishers International 1994
Übernahme der Übersetzung mit freundlicher Genehmigung des Rowohlt Verlags, Reinbek
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: The National Trust Photolibrary (Alamy Stock Foto)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape und Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-31034-6
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 06:39h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DIE TÖCHTER VON KAIN
PROLEGOMENA — Mittwoch, 25. Mai 1994I – Natales grate numerasII – Chaos herrscht’ in der KlasseIII – Als ich den Schritt von Schülern hörte …IV – Ein selbstgebackener Kuchen, wie ein geologisches ReliefV – Lumberjack Hafey, Lehrer in Mandan, tüftelte zwei Wochen …Teil eins1 – Pension: eine bestimmte Geldsumme, die gealterten Mietlingen nach …2 – Wie der Apfel sich rötet, der süße3 – Mit Eifer sucht’ ich auf als junger Mann4 – Krook malte den Buchstaben an die Wand …5 – O quid solutis est beatius curis6 – Wenn Neid und Faulheit sich vereinen, zeugen sie …7 – Denn wer die Weiber richten will8 – Caeli, Lesbia nostra, Lesbia ilia9 – Wenn Glockenblumen leuchtendes Azur10 – Wir beide schwiegen lange. Dann sagte ich etwas …11 – Gnädige Frau, Ihr färbt Euch das Haar doch …12 – Wenn man aber stirbt, um der Armut oder …13 – Wie drückend auch die Sorge sei14 – Jeder kann den Schmerz bemeistern, nur der nicht …15 – Für was sind Hopfengärten exzellent16 – Des Jünglings Aug‘ halb aufgeschlagen17 – Examen: Prüfung; Unterbeweisstellung von Wissen und hoffentlich auch …18 – Tote Fliegen verderben gute Salben. Schon ein wenig …19 – Der wahre Gradmesser für den Charakter eines Mannes …20 – Wer nah beim Friedhof wohnt, kann nicht um …21 – Hass ist die Folge der Angst; wir fürchten …22 – Wir wünschen uns alle, irgendwie wichtig zu sein23 – Eines Tages gelang es mir, mich nach Schließung …24 – Grausamkeit ist vielleicht die schlimmste Sünde. Intellektuelle Grausamkeit …25 – Je älter ich werde, desto mehr misstraue ich …26 – Drei können ein Geheimnis bewahren, wenn zwei von …27 – Viel Geld der Hure zahlt ein Mann28 – Doktor Fell, ich lieb Euch nicht29 – Das mir zugeteilte Los im Leben ist leider …30 – Randolph, das wird dir nicht schmecken, aber ich …31 – Keine andere Erfindung des Menschen hat so viel …32 – Dies sind, wie gesagt, beschwerliche Methoden, einen Mann …33 – Dieses Fest ist nicht totzukriegen; im September 1914 …34 – Der bunte, plauderhafte, scheue TagI – Am Mittwoch, dem 7. September 1994, saß Ms …II – »Danke, dass Sie gekommen sind«, sagte Phillotson ernstIII – »Was haben Sie denn nun eigentlich, Morse?«IV – Obwohl das Herbsttrimester erst am Vortag angefangen hatte …V – Das Interesse an der Aufführung von Was ihr …Teil zwei35 – Nichts Großes ist an mir, wofern es nicht36 – Ist das ein Dolch, was ich vor mir …37 – Ich genieße die Genesung. Es ist der Teil …38 – Das Museum hat viel von seinem viktorianischen Charakter …39 – Ja. Ihr habt das Fabelland gefunden, in das …40 – Donnerstag ist ein schlechter Tag. Mittwoch ist ein …41 – Seine nachlassenden Kräfte verunsicherten ihn, denn was sollte …42 – Man kann eine Hure mit Kultur vertraut machen …43 – Das Bühnenbild war wunderschön; nur die Schauspieler störten44 – Keine geringe Kunst ist schlafen: Es tut schon …45 – Wachet auch sorgsam über sittliche Entgleisungen Eurer Patienten …46 – Ich kannte mal jemand, der sprach Dialekt mit …47 – Wann können wir eine Zahl, die ein Quadrat …48 – Wird ihm guttun, eine Weile bewusstlos dazuliegen …49 – Manchmal überlege ich, was schöner wäre: Eine Oper …50 – Nichts in der Natur ist so wandelbar wie …51 – Lirum, larum, sei gescheit52 – Ich sagte, dies sei eine vortreffliche Bemerkung …53 – »Jo, mein armer Junge!«54 – Cambridge vermählt sich mit dem Fluss, nimmt ihn …55 – Nur ein starker Magen dreht sich nicht um56 – Er konnte kein Auslader oder Frachtführer sein …57 – Karl Popper lehrt, dass Wissen durch die Postulierung …58 – Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht …59 – Der heilige Antonius von Ägypten (ca. 251–356 n …60 – Trifft der Himalaya-Bauer einen Bären, groß und grimm61 – Die Gesamtsumme unverlangter geschlechtlicher Betätigung, welche die Frauen …62 – Daktyloskopie (f): Untersuchung von Fingerabdrücken (frühes 20. Jahrhundert)63 – In den meisten Fällen bleiben Fingerabdrücke am Tatort …64 – Gestalt (f): hauptsächl. i. d. Psychologie. Eine funktionell …65 – Siehe, ich sage euch ein Geheimnis66 – Der Geist ist selbst sein eigner Ort und …67 – Wir können beweisen, was immer wir wollen68 – Sie hat sich abgekehrt, doch mit der herbstnen …69 – Bei den Stämmen Zentral-Australiens hat jeder Mann …70 – Dann Leiden für und für; denn für und …EpilogZitatnachweisMehr über dieses Buch
Über Colin Dexter
Colin Dexter: »Ich liebe es, von einem Krimi an der Nase herumgeführt zu werden.«
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Colin Dexter
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Zum Thema England
Für die Mitarbeiter des Pitt Rivers Museum, Oxford,mit meinem Dank für ihre geduldige Hilfe.
Oxford ist das Quartier Latin von Cowley
(Anonym)
PROLEGOMENA
Mittwoch, 25. Mai 1994
I
Natales grate numeras?
Zählst du deine Geburtstage voll Dankbarkeit?
Horaz, Briefe II
Von montags bis freitags standen Julia Stevens’ Chancen, ihre Post zu bekommen, ehe sie zur Schule musste, fifty-fifty.
Deshalb zögerte sie am 25. Mai um 8.15 Uhr noch einen Augenblick vor der dunkelblauen Haustür ihres Reihenhäuschens in Ost-Oxford. Noch keine Spur von ihrem Briefträger. Aber heute würde er bestimmt etwas für sie dabeihaben.
Manchmal überlegte sie, ob sie ihren Ex-Ehemann, von dem sie sich vor acht Jahren wegen mehrfachen Ehebruchs hatte scheiden lassen, nicht doch noch ein kleines bisschen liebte. Besonders wenn sie an den Gruß dachte, den er ihr vor genau einem Jahr geschickt hatte – eine riesengroße geschmacklose Karte mit roten Rosen, über die sie sich doch mehr gefreut hatte, als sie zugeben mochte. Vor allem wegen der wenigen Worte, die er draufgeschrieben hatte: »Vergiss nicht, dass wir auch gute Zeiten miteinander hatten.«
Müsste sie es nicht – wenn überhaupt jemandem – wenigstens ihm sagen?
Aber da war ja noch Brenda. Ihre liebe, treue, unentbehrliche Brenda. Bestimmt würde ein Umschlag auf dem »Welcome«-Fußabtreter liegen, wenn sie nachmittags von der Schule kam.
Die (heute) sechsundvierzigjährige Julia Stevens mit dem tizianroten Haar wäre mit ihrem Leben (zumindest eine Spur) zufriedener gewesen, wenn sie sich hätte sagen können, dass sie nach fast dreiundzwanzig Jahren noch immer Freude an dem von ihr gewählten Beruf hatte. Doch das war nicht der Fall, und sie wusste, dass sie ohnehin bald das Handtuch geworfen hätte, auch ohne dass …
Auch ohne dass …
Aber diesen Gedanken verbannte sie rasch in einen der verborgensten Winkel ihres Bewusstseins.
Schuld an der Berufsmüdigkeit waren nicht so sehr ihre dreizehn- bis achtzehnjährigen Schüler, obschon einige wohl selbst die Geduld einer Mutter Teresa auf eine harte Probe gestellt hätten, sondern das System: Lehrplangestaltung, Ziele und Absichten (wo war da der Unterschied?), Bewertungskriterien, Einzelgespräche, Elternberatung, Anforderungsprofile, Prüfungen … Woher sollte man da noch die Zeit zum Unterrichten nehmen?
Bei einer Lehrerkonferenz Anfang des Jahres war sie aufgestanden und hatte mutig gesagt, was ihr nicht passte, aber der Schulleiter war auf ihre Kritik kaum eingegangen. Wozu auch? Schließlich hatte er seinen Posten ja gerade deshalb bekommen, weil er mit Begriffen wie Lehrplangestaltung, Bewertungskriterien und dergleichen so routiniert zu jonglieren verstand. Ein ideenreicher junger Mann, der aber, wie man munkelte, während seiner kurzen Phase als Lehrer nicht einmal bei den himmlischen Heerscharen Zucht und Ordnung hätte halten können.
Julia Stevens lächelte etwas melancholisch, als sie ihr Jobticket aus der Handtasche holte und in einen der roten Oxforder Doppeldeckerbusse stieg.
Nur gut, dass in der Schule niemand wusste, dass sie heute Geburtstag hatte. Zumindest keiner ihrer Schüler. Die Vorstellung, zu Beginn einer Stunde würde die versammelte Klasse plötzlich »Happy Birthday, Mrs Stevens!« anstimmen, trieb ihr einen Anflug von Röte in ihr blasses Gesicht mit den hohen Wangenknochen. Ihr Vertrauen zum Allmächtigen war nicht mehr sehr groß, aber in diesem Moment war ihr fast nach Beten zumute.
Und Ziel (oder Absicht?) ihres Gebetes müsste es dann wohl in erster Linie sein, sich einen kakofonischen Geburtstagschor ihrer 5C zu ersparen. Ansonsten war die 5C gar nicht so übel, und sie, Julia Stevens, mirabile dictu, gehörte zu den wenigen Kollegen, die mit dieser aufmüpfigen, bunt gemischten Schar fertigwurden. Nein, wenn schon gebetet werden musste, dann für etwas viel, viel Wichtigeres.
Wichtiger für sie selbst …
Sie hätte sich keine Sorgen zu machen brauchen. Weder im Kollegium noch in den sechs Klassen, in denen sie an diesem Tag unterrichtete, gratulierte ihr irgendjemand.
Dabei gab es in der 5C einen Schüler, der ganz genau wusste, wann Mrs Stevens Geburtstag hatte – am gleichen Tag wie er selbst nämlich. Am 25. Mai. War es dieser seltsame Zufall, der ihnen all diesen Ärger eingebrockt hatte?
Ärger? Allerdings.
Im Horoskop des letzten Sunday Mirror hatte Kevin Costyn interessiert seinen persönlichen »Schlüssel zum Schicksal« gelesen.
Zwillinge
Der einsame Planet steht ganz im Banne der liebreizenden Venus. Jetzt treten erregende Tatsachen an die Stelle falscher Hoffnungen. Ein Maximum an geistiger Energie ermöglicht es Ihnen, den Weg zu einem schwer zugänglichen Menschen zu finden, der Ihnen sehr am Herzen liegt. Nur ruhig Blut!
»Ein Maximum an geistiger Energie« war nun nicht gerade Kevins Stärke. Aber wenn sich der bewusste schwer zugängliche Mensch nur durch eine derartige Kraftanstrengung erobern ließ, war er bereit, sich ausnahmsweise mal ins Zeug zu legen. Vielleicht klappte das ja besser als die Brutalomasche, mit der er es beim ersten Anlauf probiert hatte. Damals hatte er sich bemüht, einer seiner Lehrerinnen näherzukommen.
Als er versucht hatte, Julia Stevens zu vergewaltigen.
II
Chaos herrscht’ in der Klasse,
Die mutig der Lehrer betrat.
Die Rüpel sich nicht um ihn scherten,
Sein Zustand ward desolat.
Roger McGough, The Lesson
Mit seinen (heute) siebzehn Jahren war Kevin Costyn unbestritten der Anführer der vierundzwanzig Schülerinnen und Schüler der Klasse 5C der Proctor Memorial School in Ost-Oxford. Er war vierzehn Monate älter als der Klassendurchschnitt, weil sein Intelligenzquotient – gemessen an den üblichen psychometrischen Kriterien – erheblich unter dem Durchschnitt seines eigenen Jahrgangs lag.
Früher war in Kevins Zeugnissen noch mit verhaltenem Optimismus davon die Rede gewesen, mit Fortschritten sei zu rechnen, falls er sich entschlösse, seine brachliegenden geistigen Fähigkeiten zu aktivieren. Doch schon vor vielen Trimestern hatten seine Lehrer jede Hoffnung aufgegeben, ihn zu nennenswerten schulischen Leistungen animieren zu können.
Trotz – oder vielleicht gerade wegen – dieser intellektuellen Defizite stellte Kevin einen erheblichen Machtfaktor und eine nicht zu unterschätzende Bedrohung dar, und wenn es einen Schüler gab, der es fertigbrachte, seine Lehrer in den Ruhestand, in die Kündigung, ja sogar in den Selbstmord zu treiben, so war dies Kevin Costyn, der sich in der Schule ebenso bösartig und gewalttätig aufführte wie auf der Straße. Im laufenden Sommertrimester hatte er sich nur für die alljährlich stattfindenden Wahlübungen in der Schule interessiert, die den Parlamentswahlen nachempfunden waren und bei denen er sich als Kandidat der British National Party profiliert hatte.
Die Lehrer zitterten, wenn er im Klassenzimmer saß, und priesen das Schicksal, wenn er (angeblich) krank war, schwänzte, als Zeuge zu einer Gerichtsverhandlung oder zwecks neuerlicher Verwarnung zur Polizei bestellt war oder einen Termin bei Bewährungshelfern, Sozialarbeitern oder Psychiatern hatte. Im Unterricht störte er nur dann nicht, wenn nächtliche Ausschweifungen seine subversiven Neigungen etwas gebremst hatten.
Sein Stammplatz war in der ersten Reihe, rechts vom Mittelgang. Das hatte drei gute Gründe. Erstens konnte er sich dort leicht umdrehen, um eventuelle Krawallaktionen zu dirigieren. Zweitens war er (was er nie zugegeben hätte) ein bisschen schwerhörig; der Unterricht selbst interessierte ihn zwar nicht, aber seine verbale Schlagfertigkeit gegenüber den Lehrkräften litt deutlich, sobald er seinen Kontrahenten akustisch nicht mehr folgen konnte. Drittens war die von der Natur recht großzügig ausgestattete Eloise Dring wegen ihrer Kurzsichtigkeit (und weil sie sich weigerte, eine Brille zu tragen) darauf angewiesen, der Tafel so nah wie möglich zu sein. Eloise – das attraktivste Mädchen in der Klasse – saß also in der vordersten Reihe. Und Kevin Costyn wollte ganz nah bei Eloise sitzen.
Da saß er also und wusste nicht, wo er in dem viel zu kleinen Pult die langen Beine lassen sollte. Seine Füße steckten in abgewetzten spitzen Schuhen, die er von einem verflossenen Freund seiner Mutter geerbt hatte. Diese, eine schlampig üppige Alleinerziehende, hatte ihren einzigen Sohn auf einem Rastplatz an der Cowley Ring Road empfangen (unter Begleitumständen, an die sie sich nur noch dunkel erinnerte) und wohnte in einer Sozialsiedlung, die bei den finanziell bessergestellten Bewohnern der angrenzenden Straßen Nuttenblock hieß.
Kevin war ein schlaksiger, grobknochiger junger Mann mit langen dunklen, ungewaschenen Haaren und ziemlich dürftigem Bartwuchs auf Oberlippe und Kinn. An diesem Tag trug er ein gebatiktes T-Shirt und zerschlissene Jeans. Sein mürrisches, lang gezogenes Gesicht sah aus wie von einem magenkranken El Greco gemalt, und auf dem linken Unterarm hatte er eine Tätowierung, die an diesem kühlen Tag vom Ärmel eines angeschmuddelten weißen Sweatshirts verdeckt wurde. In der Schule kannte praktisch jeder diese Tätowierung, einschließlich des Schulleiters, der im vergangenen Trimester in einem seltenen Anflug von Mut Costyn zu sich zitiert und nach dem tieferen Sinn des Epigramms gefragt hatte. Und Kevin war in der glücklichen Lage gewesen, ihm zu erklären, wie der eindeutige Spruch »Fuck ’em All!« im Allgemeinen von der Öffentlichkeit (mit und ohne Hochschulabschluss) interpretiert wurde.
So jedenfalls gab Kevin später das Gespräch wieder.
Sein Ansehen war in letzter Zeit in geradezu schwindelerregende Höhen gestiegen, was angesichts zweier Aufenthalte in einer Besserungsanstalt für jugendliche Straftäter nicht verwunderlich war. Hinzu kamen zwei weitere Aspekte, die seine Macht und seinen Einfluss mehrten. Erstens ging von ihm eine Aura primitiver, aber offenbar unwiderstehlicher Sexualität aus, die viele Mädchen magnetisch anzog. Zweitens besuchte er seit seinem zwölften Lebensjahr den Kampfsportkurs eines kleinen Chinesen, von dem die Fama ging, er habe ohne fremde Hilfe eine Street-Gang so lange bearbeitet, bis sie, auf dem Gehsteig liegend, um Gnade gefleht hätten. Kevin konnte dank der dort erworbenen Fähigkeiten Furcht und Schrecken verbreiten, was er auch häufig tat.
»KC« stand in roten Buchstaben auf dem Mädchenklo: Kevin Costyn; Karate-Champion; King of the Condoms … oder was einem sonst noch dazu einfiel.
In der Proctor Memorial School war es früher Sitte gewesen, dass die Schüler aufstanden, wenn ein Lehrer das Klassenzimmer betrat, und hin und wieder erinnerte sich die eine oder andere Klasse tatsächlich noch dieser Gepflogenheit. Als Mrs Stevens an ihrem Geburtstagnachmittag die 5C betrat, erhoben sich auf ein Zeichen von Kevin Costyn alle Schülerinnen und Schüler in schöner Einmütigkeit, und das Stimmengewirr verstummte so jäh, als habe ein Maestro mit dem Taktstock ans Pult geklopft.
Es war wie die Stille vor dem Sturm.
III
Als ich den Schritt von Schülern hörte, die meine alte knarrende Treppe hochstiegen, kam ich mir vor wie eine abgeschlaffte Hure, die auf ihre Freier wartet.
A. L. Rowse, On Life as an Oxford Don
Er stand vor der rostigen Gegensprechanlage. »Ich bins nur«, sagte er.
Ein kurzes fernes Surren, ein Klicken, dann ihre Stimme: »Es ist offen.«
Er ging die drei Treppen mit dem abgetretenen Läufer hoch und dachte an die junge Frau, die ganz oben wohnte. An das blasse, abgezehrt wirkende Gesicht, die Augen, die (so dachte McClure bei sich) vielleicht einmal gestrahlt hatten wie die der Athena Glaucopis, jetzt aber von einem stumpfen Schlammgrün waren wie das Wasser des Oxford-Kanals. Die Stupsnase, die in der Form ein wenig an einen Übungshang für junge Skihasen erinnerte, verunstalteten (seiner Ansicht nach) zwei billige silberne Ringe in den Nasenflügeln. Die eher zu schmalen Lippen (am aristotelischen Mittel gemessen) waren dick mit orangefarbenem Lippenstift nachgezogen – ein Farbton, den jede nur einigermaßen kompetente Make-up-Beraterin ihr sofort verboten hätte, weil er sich ganz und gar nicht mit den stümperhaft eingefärbten roten Strähnen im langen dunkelbraunen Haar vertrug.
Wozu aber diese Details von Gesicht und Haar? Der zweite Kunde, den die junge Frau an diesem Mittwoch, dem 25. Mai, empfing, hatte ganz anderes im Sinn, als er ein wenig atemlos die letzten Stufen der schmalen, engen Treppe erklomm.
Die junge Frau schlug die schmuddelige Tagesdecke zurück, beförderte mit einem gezielten Tritt einen Schlüpfer hinter die abgeschabte Couch, schenkte Rotwein (2,99 Pfund vom Discounter) in zwei Gläser, setzte sich auf das schmale Bett und aß, als es leise klopfte, rasch noch ihren Marsriegel auf.
Sie trug eine zerknitterte, hochgeschlossene lindgrüne Bluse, an weißen Strapsen schwarze Nylonstrümpfe, die den halben Oberschenkel unbedeckt ließen, und rote Stöckelschuhe. Mehr nicht. So wollte er sie haben; so war sie. Not macht erfinderisch. Und nachdem die Schuldenlast auf der Eigentumswohnung, die sie sich vor fünf Jahren auf der Höhe des Immobilienbooms zugelegt hatte, immer drückender geworden war, die Maschinenbaufirma ihr die Stellung im Verkaufsbüro gekündigt hatte und ihr Alkoholkonsum stetig stieg, musste sie sich etwas einfallen lassen. So hatte sie sich schließlich einen … neuen Job gesucht.
Dass die Arbeit sie befriedigte, hätte sie guten Gewissens nicht behaupten können. Andererseits war es die bei Weitem anspruchsloseste und bestbezahlte Tätigkeit, die sie je gehabt hatte, und sie wusste, dass sie ihre Sache gut machte. Sobald sie die ärgsten Schulden los war, würde sie Schluss machen, ganz klar. Je schneller, desto besser.
Sorgen machte ihr gelegentlich nur der Gedanke, ihre Mutter könne erfahren, dass sie sich ihren Lebensunterhalt als billige Nutte verdiente. Nein, so stimmte das nicht. Als teure Nutte, wie ihr derzeitiger Freier bestätigen konnte. Was sie nicht daran hinderte, sich mies und billig zu fühlen.
Als es zum zweiten Mal klopfte, stand sie auf, rückte die linke Strumpfnaht gerade, machte die Tür auf und wenig später auf dem schmalen Bett die Beine breit, die stark geschminkten Augen auf einen feuchten Fleck über ihrem (und ziemlich schnell auch über seinem) Kopf gerichtet.
Es war alles recht simpel. Sie ließ es über sich ergehen, im besten Fall waren ihr die Männer wenigstens körperlich nicht zuwider. Kurioserweise wünschte sie sich manchmal, dass da mehr wäre. Doch da war absolut nichts. Ganz selten einmal hatte sie für einen Freier so etwas wie Zärtlichkeit empfunden. Dieser hier war eine Ausnahme. Sie hatte sogar überlegt, ob sie, wenn er starb – immerhin war er schon fast siebenundsechzig –, wohl ein paar Tränen zerdrücken würde.
Dass man dieses irdische Jammertal auch anders als durch einen natürlichen Tod verlassen konnte, war ihr damals nicht in den Sinn gekommen, und nie hätte sie sich träumen lassen, dass ihr heutiger Kunde, Dr. Felix McClure, emeritierter Professor für Alte Geschichte am Wolsey College, Oxford, in Kürze einem Mord zum Opfer fallen würde.
IV
Ein selbstgebackener Kuchen, wie ein geologisches Relief.
Charles Dickens, Martin Chuzzlewit
Der Briefträger hatte Julia Stevens nur eine Sendung gebracht, einen braunen Umschlag mit der Gasrechnung, der in ihrer kleinen Diele an der Tischlampe lehnte.
Auf dem Tisch im Wohnzimmer aber lag ein zweiter Umschlag, dessen hintere Umschlagklappe nicht zugeklebt war, daneben eine üppig mit Zuckerguss verzierte Torte mit der Aufschrift »Happy Birthday, Mrs Stevens«, in Rot auf weißem Grund. Das Zuckerblumenarrangement war in Lila und Grün gehalten.
Brenda Brooks nannte ihre Arbeitgeberin, bei der sie nun seit immerhin fast vier Jahren für Sauberkeit sorgte, nie anders als Mrs Stevens. So auch jetzt – sowohl auf dem Kuchen als auch in dem Brief, der ihrer Geburtstagskarte beilag:
Liebe Mrs S.,
nur ganz kurz herzliche Glückwünsche zum Geburtstag, hoffentlich macht Ihnen die Überraschung ein bisschen Freude. Allzu genau dürfen Sie nicht hinschauen, es hat einen kleinen »Unfall« gegeben, und die Dekoration ist nicht besonders geworden. Die Blumen waren gerade fertig und sollten trocknen, und da ist mir eine Schüssel aus der Hand gefallen und hat alles kurz und klein geschlagen. Ich habe was Unfeines gesagt und noch mal von vorn angefangen, und schließlich hab ich es dann doch geschafft.
Also dieser kleine »Unfall« … Ich will Ihnen sagen, wie es wirklich war. Vor ein paar Wochen hat mein Mann mit mir Streit angefangen, und mein Arzt meint, dass er mir dabei vielleicht einen Handknochen gebrochen hat. Deshalb komme ich mit dem Spritzbeutel nicht so gut zurecht. Nächste Woche wollte ich den Fortgeschrittenenkurs anfangen. Die 38 Pfund hat er mir erspart!
Viel Spaß heute, wir sehen uns morgen früh, ich freu mich schon.
Alles Liebe,
Brenda (Brooks)
Julia las den Brief noch einmal, besah sich erneut liebevoll den Kuchen und war plötzlich sehr gerührt – und sehr zornig. Sie wusste, wie viel Freude Brenda der Dekorationskurs an der Abendschule gemacht hatte und wie stolz sie auf ihre Leistungen war. Gewiss, die Verletzung war sicher nicht weltbewegend, aber die Sache im Grunde doch furchtbar traurig. Das »Mrs« war wirklich ziemlich verwackelt, die beiden Ypsilons von Happy Birthday entschieden verunglückt, wie von zitternder Hand geschrieben. Ein Gefühl, das sie sich nicht recht erklären konnte, trieb sie zu sofortigem Handeln. Sie holte ihr breitestes, schärfstes Küchenmesser, schnitt ein großes Stück Torte mit dem verwackelten Mrs ab und aß es auf der Stelle.
Die Torte bestand aus vier Biskuitböden mit Sahne-, Erdbeerkonfitüre- und Zitronenbuttercremefüllung und schmeckte köstlich. Nur schade, dass niemand da war, dem sie etwas hätte abgeben können.
Zehn Minuten später läutete das Telefon.
»Ich hab in der Schule nichts gesagt, Miss, aber ich wollt Ihnen doch gratulieren.«
»Von wo rufst du an, Kevin?«
»Ich steh hier an der Ecke, an der Bushaltestelle.«
»Hättest du Lust, vorbeizukommen und ein Stück Geburtstagstorte mit mir zu essen? Du hast doch heute auch Geburtstag, nicht?«
»Lass ich mir nich’ zweimal sagen, Miss.«
Nachdenklich, mit einem leichten Lächeln auf den vollen Lippen, ging Julia zurück ins Wohnzimmer und schnitt mit demselben Messer – dem breitesten, schärfsten Messer, das sie in ihrer häuslichen Waffenkammer hatte – noch zwei Stück Torte ab. Der zweite Schnitt ging genau durch das missratenere der zwei Ypsilons.
V
Lumberjack Hafey, Lehrer in Mandan, tüftelte zwei Wochen an einem schwierigen Kreuzworträtsel und verlor darüber den Verstand, weil er das letzte Wort nicht herausbekam.
Man fand ihn in seinem Gartenhaus, wo er auf dem Boden hockte, sich die Haare raufte und unverständliche Worte murmelte.
Illinois Chronicle, 3. Oktober 1993
Detective Sergeant Lewis fand seinen Chef in dessen Büro, wo er, auf dem äußersten Rand seines schwarzen Ledersessels sitzend, kopfschüttelnd über dem Kreuzworträtsel der Times brütete.
»Noch nicht fertig, Sir?«
Morse sah kurz und mit kaum verhülltem Ärger auf. »Sie sehen doch, dass mir nur noch ein einziges Wort fehlt, Lewis! Alle anderen habe ich glatt in sechs Minuten geschafft, und ohne diese Störung …«
»Tut mir leid.«
»Nein. Seit zehn Minuten sitze ich jetzt hier und starre das verdammte Ding an.«
»Kann ich helfen?«
»Sollte mich sehr wundern.«
»Ich könnte es doch mal versuchen.«
Widerstrebend reichte Morse ihm das Blatt. »Freund und Gefährte«, las Lewis. Drei der neun Buchstaben hatten sich bereits ergeben: . L . . H . . . N
Wenig später warf Lewis das Handtuch. Er hatte sich redlich Mühe gegeben, einen brauchbaren Vorschlag zu machen und bei seinem Vorgesetzten Punkte zu sammeln, aber ihm war einfach nichts eingefallen. »Wenn es Ihnen recht ist, Sir, würde ich mich heute Vormittag gern mal ein bisschen in St. Aldate’s umsehen, vielleicht finden wir doch eine Verbindung zwischen diesen Einbrüchen in Nord-Oxford.«
»Viel Glück. Aber vergessen Sie nicht, dass ich auch dort wohne. Dass Sie den Typen bloß nicht meine Adresse geben …«
Sobald Lewis weg war, nahm sich Morse wieder sein Kreuzworträtsel vor. Dass er nicht alle Kästchen ausfüllen konnte, passierte selten, meist war er sogar ziemlich schnell fertig. Hätte er jetzt einen doppelten Scotch, würde ihm die Antwort sicher förmlich in die Augen springen. Aber es war erst 8.35 Uhr, und …
Moment mal … Freund und Gefährte? Scotch! Er zählte nach. Die Zahl der Buchstaben kam nicht hin, aber vom Ansatz her war die Idee nicht schlecht. Das musste er gelegentlich mal Lewis erzählen …
Doch Lewis sollte erst viele Monate später durch Zufall erfahren, welches Wort seinem Chef im Kreuzworträtsel der Times vom 25. Mai 1994 gefehlt hatte, einem Tag, an dem (wie sich im Nachhinein herausstellen sollte) sich so viele Dinge mit verhängnisvollen Folgen ereignet hatten.
Teil eins
1
Pension: eine bestimmte Geldsumme, die gealterten Mietlingen nach lebenslanger leidlicher Pflichterfüllung meist widerwillig zugebilligt wird.
Small’s Enlarged English Dictionary, 12th Edition
Am 31. August 1994 kurz nach zwölf Uhr saß Chief Inspector Morse an seinem Schreibtisch im Präsidium der Thames Valley Police in Kidlington, Oxfordshire, als das Telefon läutete.
»Morse? Sie sind ja noch da! Und ich dachte, Sie sitzen schon im Pub.«
Morse überhörte den Spott und bestätigte Chief Superintendent Strange, er sei in der Tat noch da.
»Zweierlei, Morse … aber ich komme am besten mal selber vorbei.«
»Soll ich nicht …?«
»Bewegung tut mir gut. Findet meine Frau.«
Nicht nur deine Frau, kommentierte Morse halblaut, nachdem er aufgelegt hatte, und machte zwischen den Aktenbergen ein Stück Schreibtischplatte frei.
Fünf Minuten später kam Strange schwerfällig hereingetappt und ließ sich in den Besuchersessel sinken.
»Jetzt werden Sie ja vielleicht Ihr Türschild ändern müssen.« Strange und Morse waren nicht befreundet, aber sie hatten auch nie gegeneinander gearbeitet, und Morse nahm deshalb die gutmütigen Frotzeleien des Superintendenten nicht übel, die an der Tagesordnung waren, nachdem der Sheehy-Bericht vor einem halben Jahr empfohlen hatte, den Rang des Chief Inspector abzuschaffen. Er frotzelte höchstens zurück, denn auch dem Chief Superintendent drohte durch diesen Bericht die Herunterstufung.
Schwer atmend und deutlich vergrätzt schüttelte Strange den Kopf. »Es ist wie eine Degradierung in der Army. Ausgesprochen … ausgesprochen …«
»Herabsetzend?«, schlug Morse vor.
Strange sah ihn scharf an. »Entwürdigend wollte ich sagen. Trifft es bedeutend besser. In meiner verdammten Muttersprache kenne ich mich nämlich aus.«
Nicht schlecht, dachte Morse und überlegte, wie schon so oft, dass er und seine Kollegen gut daran taten, den Chief Superintendent nicht zu unterschätzen. »Was kann ich für Sie tun, Sir? Zweierlei, haben Sie gesagt …«
Strange zögerte einen Augenblick. »Na ja … das ist die eine Sache. Das, wovon wir eben gesprochen haben. Sie haben sicher schon gehört, dass ich nächstes Jahr aufhöre.«
Morse nickte zurückhaltend.
»Und ebendarum geht es. Um die Pension.«
»Die Pension wird davon nicht berührt.«
»Glauben Sie?«
»Bestimmt nicht. Es muss eben alles seine Ordnung haben, deshalb bekommt man diesen Haufen Formulare …«
»Woher wissen Sie das?« Strange hob rasch den Kopf, und jetzt war es Morse, der ein wenig mit der Antwort zögerte.
»Ich – äh – denke auch daran, aufzuhören, Sir.«
»Das können Sie doch nicht machen! Wenn die Sie und mich gleichzeitig verlieren, können sie hier doch einpacken.«
»Für mich wären es ja sowieso nur noch zwei Jahre.«
»Sie haben also diesen Formularkram auch gekriegt?«
Morse nickte.
»Und etwa auch schon ausgefüllt?«, fragte Strange ganz fassungslos.
»Noch nicht, nein. Wenn ich Formulare sehe, krieg ich sofort Kopfschmerzen.«
Stranges Mondgesicht strahlte. »Genau dasselbe hab ich zu meiner Frau gesagt.«
»Könnte sie Ihnen nicht beim Ausfüllen ein bisschen unter die Arme greifen?«
»Angeblich kriegt sie dann auch sofort Kopfschmerzen.«
Die beiden Männer lachten.
»Na ja, wenn ich …«, sagte Morse vorsichtig. »Wir könnten ja mal zusammen …«
»Würden Sie das tun? Also, da fällt mir direkt ein Stein vom Herzen. Wir sollten gleich nächste Woche ein Bier trinken gehen, ich kaufe eine Schachtel Aspirin …«
»Zwei Bier wären besser.«
»Und zwei Schachteln Aspirin.«
»Abgemacht!«
»Na bestens! Jetzt also zum zweiten, sehr viel wichtigeren Punkt.«
Morse zog die Augenbrauen hoch. »Sehr viel wichtiger als die Pension?«
»Sagen wir: Etwas wichtiger.«
»Mord?«
»Mord.«
»Noch einer?«
»Derselbe. McClure.«
»Den bearbeitet Phillotson.«
»Nicht mehr.«
»Aber …«
»Seine Frau ist krank. Sehr krank. Sie übernehmen den Fall.«
»Aber …«
»Sie haben keine schwer kranke Frau. Sie haben nämlich gar keine Frau.«
Dagegen war nichts zu sagen. »Ist Lewis …«
»Ich hab ihn kurz in der Kantine gesprochen. Kommt her, sobald er seine Eier mit Chips verdrückt hat. Im Übrigen …« Strange wuchtete seinen schweren Körper mühsam aus dem Sessel hoch. »Im Übrigen hab ich das Gefühl, dass Phillotson mit dem Fall sowieso nicht sehr weit gekommen wäre.«
»Ich höre immer Gefühl …«
»Was dagegen?«, blaffte Strange. »Haben Sie so was nie?«
»Hin und wieder …«
»Wenn Sie zu viel getrunken haben.«
»Oder zu viel durcheinander. Ein paar Pints und eine Flasche Wein zum Beispiel …«
Strange nickte. »Dann gehen wir wohl demnächst gemeinsam auf den Gefühlstrip. Mit ein paar Pints und einer Packung Aspirin.«
Er machte die Tür auf und sah sich noch einmal das Namensschild an. »Vielleicht brauchen wir die Türschilder doch nicht zu ändern, Morse.«
2
Wie der Apfel sich rötet, der süße,
hoch oben am Baume,
hoch im höchsten Gezweig, ihn vergaßen
die Pflücker zu holen –
Ei doch, nein! Nicht vergaßen:
sie konnten ihn bloß nicht erreichen.
Sappho
Erst zum zweiten Mal übernahm Morse eine Mordermittlung, deren erste – und unvermeidlich dramatischste – Phase bereits abgeschlossen war: die Entdeckung der Tat, die Aufgeregtheiten der Medien, die Ermittlungen am Tatort, der Abtransport der Leiche.
Man käme sich vor wie jemand, der fünfundzwanzig Minuten zu spät zu einem Fußballspiel kommt und seinen Nebenmann fragen muss, wie es steht, hatte Lewis sehr treffend bemerkt. Leider konnte er mit diesem Bonmot bei Morse nicht recht landen, denn dessen Leben wäre nicht wesentlich ärmer gewesen, wenn der Ballsport nie erfunden worden wäre.
In gewisser Hinsicht war Morse sogar ganz froh, dass ihm die Untersuchung der Leiche am Tatort erspart geblieben war. Beim Anblick eines gewaltsam zu Tode gekommenen Menschen begann es unweigerlich in seinem Bauch zu rumoren. Und Felix McClure war, wie er wusste, sehr gewaltsam zu Tode gekommen, es war viel Blut geflossen, das – inzwischen angetrocknet und schmutzig braun – innerhalb der Kreidelinie auf dem beigefarbenen Teppich sicher noch deutlich zu sehen war. Einer Kreidelinie, die jene Stelle bezeichnete, an der man das Opfer mit einer schlimmen Messerwunde im Unterbauch gefunden hatte.
»Was haben die gegen Phillotson?«, fragte Lewis auf der Fahrt nach Nord-Oxford.
»Nichts. Nur dass er einigermaßen inkompetent ist. Nein, mal im Ernst: Es ist wegen seiner Frau, sie ist operiert worden, und irgendwas muss schiefgegangen sein.«
»Unterleib?«
»Ich weiß es nicht, Lewis. Ich habe nicht gefragt. Ich weiß ja nicht mal genau, was man als Unterleib definiert. Scheußliches Wort übrigens.«
»Ich meine ja nur.«
»Und ich antworte ja nur. Das mit seiner Frau wird schon wieder. Er war heilfroh, dass er aussteigen konnte.«
»Aber der Super meint, dass er den Fall sowieso nicht gepackt hätte?«
»Hätte er auch nicht. Er ist nicht gerade der Schlaueste im Revier.«
Lewis streifte den Mann auf dem Beifahrersitz, den Mann mit den arrogant blickenden, harten blauen Augen und dem selbstzufriedenen Lächeln, mit einem raschen Blick. Es war diese Überheblichkeit, die Lewis an seinem Chef gegen den Strich ging, mehr noch als dessen Geiz und permanenter Undank. Plötzlich erfasste ihn ein heftiger Widerwille gegen Chief Inspector Morse.
Aber das war gleich wieder vorbei. Denn Morse deutete, wieder ernst geworden, nach rechts zur Daventry Avenue und setzte hinzu, während der Wagen vor einem Wohnblock hielt: »Wir stehen ziemlich allein auf weiter Flur, Lewis, ich und Sie. Ist Ihnen das klar? Über uns ist nicht mehr viel.« Doch während er den Gurt löste, wurde sein Gesichtsausdruck nachdenklich. »Nous vieillissons, n’est-ce pas?«
»Wie bitte?«
»Wir werden alle nicht jünger. Und das ist das Einzige, was mir an diesem Fall Sorgen macht, alter Freund.«
Und dann lächelte er wieder, und Lewis sah es und lächelte mit, denn in diesem Moment war er mit seinem Leben überaus zufrieden.
Der Polizist vor dem Haus erbot sich, sie nach oben zu begleiten, aber Morse schüttelte den Kopf und sagte unnötig schroff: »Wenn Sie mir den Schlüssel geben, genügt das vollauf, mein Junge.«
Nur zweimal acht Stufen führten in den ersten Stock, trotzdem schnaufte Morse hörbar, als Lewis die Tür der Maisonettewohnung öffnete.
»Ja …« Morse war in Gedanken noch bei Phillotson. »Für diesen Fall wäre er so geeignet gewesen wie ein Legastheniker zum Korrekturlesen.«
»Das ist gut, Sir, sehr gut. Von Ihnen?«
Die Formulierung stammte von Strange, aber Morse hatte keine Hemmungen, sich anderer Leute Bonmots auszuleihen. Außerdem hatte Strange diesen Vergleich wahrscheinlich auch nur irgendwo gelesen.
Langsam öffnete sich die Tür zu einem neuen Fall.
Und Lewis, der durch die kleine Diele zum Tatort schritt, war gespannt, wie es hier wohl laufen würde.
Auf den ersten Blick schien der Mord an Dr. Felix McClure, emeritierter Professor am Wolsey College, Oxford, über den vor zwei Stunden Detective Chief Inspector Phillotson sechzig Minuten lang referiert hatte, kein außergewöhnlicher Fall zu sein.
Aber im Lauf der Ermittlungen hatten sich oft verwirrende, ja bizarre Aspekte ergeben, und das würde trotz Phillotsons bisheriger Untersuchung diesmal vermutlich nicht anders sein.
In dieser Hinsicht sollte Lewis recht behalten. Welche Seelenqualen aber Morse diesmal erwarteten, konnte Lewis in diesem Moment noch nicht ahnen, und würde sie wohl auch nie ganz ermessen können.
3
Mit Eifer sucht’ ich auf als junger Mann
Den Doktor und den Heiligen und hört’ mir an
Der weisen Reden viel; der Reden für und für,
Doch ob ich kam, ob ging – stets war’s dieselbe Tür.
Omar Khayyam, Rubaiyat
Mit dem Verkauf der acht Luxusapartments des 1989 in der Daventry Avenue erbauten Daventry Court (so hatte Phillotson seine Ausführungen begonnen) hatte man sich schwergetan. Die Immobilienpreise waren während der Rezession Anfang der Neunzigerjahre immer weiter in den Keller gerutscht, sodass McClure, als er im Frühjahr 1993 die Wohnung gekauft hatte, mit einem Preis von 99 500 Pfund ein echtes Schnäppchen gemacht hatte.
McClure, zur Zeit des Mordes fast siebenundsechzig, war (wie Morse sich in Kürze selbst würde überzeugen können) auf bestialische Art und Weise erstochen worden. Das Messer hatte nach den Feststellungen des Pathologen eine ungewöhnlich breite, mehr als 12 Zentimeter lange Klinge gehabt. Eine solche Waffe allerdings hatte sich nirgends gefunden. Blut? Ja, Blut war überall. Auch an der Person des Mörders? Ja, sicher.
Mit Sicherheit Blut an seinen Schuhen (Turnschuhen?), die Spuren – besonders des rechten Fußes – ließen sich mühelos vom Tatort zur Treppe und zum Ausgang verfolgen, von dort verloren sie sich auf dem gekiesten Vorplatz. Oder war der Mörder mit einem nah beim Ausgang geparkten Wagen weggefahren? Oder mit einem Fahrrad, das er an die nächstbeste Regenrinne gekettet hatte? (Vielleicht hat er ja auch die Schuhe ausgezogen, dachte Lewis.) Trotz intensiver Suche hatte man weder auf dem Vorplatz noch seitlich am oder hinter dem Wohnblock irgendwelche Hinweise gefunden. (Außer dem an sich schon aufschlussreichen Hinweis, dass es keine Spuren gibt, dachte Morse.)
Im Haus? Ja, auch davon würde Morse sich in Kürze selbst überzeugen können. Fremde Fingerabdrücke? Praktisch keine. Und nichts sprach dafür, dass der Täter durch ein Fenster im ersten Stock in die Wohnung eingedrungen war.
»Sehr ungewöhnliche Art des Zugangs, wie Sie wissen. Mit ziemlicher Sicherheit ist er durch dieselbe Tür hinausgegangen, durch die er hereingekommen ist.«
»Wie bei Omar Khayyam«, sagte Morse halblaut.
Phillotson guckte ratlos, der Name sagte ihm offenbar nichts.
Zugang von der Haustür aus, die eine Gegensprechanlage hat. McClure selbst muss den Besucher – oder die Besucherin – hereingelassen haben. Demnach jemand, den McClure kannte? Höchstwahrscheinlich.
Die Zeit? Auf jeden Fall am Sonntagmorgen nach halb neun, denn gegen acht hatte McClure in dem Zeitungsladen in Summertown, wo man ihn vom Sehen, wenn auch nicht dem Namen nach kannte, zwei Zeitungen gekauft, die News of the World und die Sunday Times, eine zur Befriedigung der niederen Instinkte, eine als Lektüre für den Kulturmenschen. Beide Blätter hatten – ohne Blutspuren – auf der Arbeitsfläche der »modernen Einbauküche« gelegen, wie es in den Immobilienanzeigen immer so schön heißt.
Später als halb neun also. Aber wann genau? Nach den vorläufigen oder vielmehr inzwischen gar nicht mehr so vorläufigen Feststellungen der Pathologin war McClure etwa zwanzig Stunden tot, als ihn am nächsten Morgen um 7.45 Uhr seine Putzfrau fand.
Demnach kam eine Tatzeit zwischen zehn und zwölf am Vortag infrage. Ungefähr. Im Ungefähren halten sich diese verflixten Pathologen ja bekanntlich am liebsten auf. (Morse dachte an Max und lächelte traurig, hier rannte Phillotson bei ihm offene Türen ein.)
Es gab noch einen Hinweis darauf, dass die Tat höchstwahrscheinlich vor zwölf Uhr mittags begangen worden war, nämlich die deutlich erkennbare – und klar erkannte – Tatsache, dass in Wohnung 6 keine Vorbereitungen für ein Mittagessen getroffen worden waren, weder Fleisch noch Gemüse herumlag. Allerdings war diese Folgerung nicht unbedingt schlüssig, denn entsprechende Erkundigungen hatten bereits ergeben, dass McClure sich nicht selten in dem bequem zu Fuß erreichbaren King’s Arms an der Banbury Road den Sonntagslunch zum Sonderpreis von 3,99 Pfund bestellte – ein Zweihundert-Gramm-Steak, Chips, Salat –, dazu zwei Pints Best Bitter. Keinen Nachtisch. Keinen Kaffee. Doch auch Spuren von Steak oder Chips oder grünem Salat hatte die Pathologin nicht gefunden, als sie den weißen Bauch von Dr. Felix McClure aufgeschlitzt hatte. Keinerlei Hinweise auf eine mittägliche Stärkung.
Die Leiche war in fötaler Stellung zusammengekrümmt, als man sie gefunden hatte, beide Hände in den Unterbauch gekrallt, die Augen fest geschlossen, als sei McClure unter qualvollen Schmerzen gestorben. Bekleidet war er mit einem kurzärmeligen Hemd (blaue und braune Längsstreifen), einer schwarzen Jaeger-Strickjacke und einer anthrazitfarbenen Flanellhose. Der untere Teil des Hemdes und die oberen Regionen der Hose waren steif von angetrocknetem Blut.
McClure war einer dieser »ewigen Studenten« gewesen (O-Ton Phillotson). 1946 hatte er ein Stipendium für Oxford bekommen, dort ein Einserexamen in Geschichte und Altphilologie gemacht und danach über vierzig Jahre seines Lebens als Tutor für Alte Geschichte am Wolsey College gearbeitet. 1956 hatte er eine seiner Studentinnen geheiratet, eine junge Frau vom Somerville College, die nach Abschluss ihres Studiums eine Dozentenstelle in Merton bekam und ihn 1966 (die entscheidenden Ereignisse in McClures Leben vollzogen sich offenbar im Zehnjahresrhythmus) wegen eines ihrer Studenten, einem bärtigen jungen Mann vom Trinity College, verließ. Kinder waren aus der Ehe nicht hervorgegangen, die Trennung hatte deshalb keine juristischen Probleme, vielleicht aber einiges an Kummer mit sich gebracht.
Veröffentlicht hatte er hauptsächlich Artikel in verschiedenen Fachzeitschriften für das Klassische Altertum, hatte aber noch das Erscheinen seines opus magnum erlebt: Die Pest in Athen: Ihre Auswirkungen auf Verlauf und Führung des Peloponnesischen Krieges. Ein langer Titel. Ein langes Werk.
Zeugen?
Von den acht Luxusapartments waren vier verkauft, zwei vermietet, zwei – die Nummer 5 unter McClure und die Nummer 2 – hatten noch keine Abnehmer gefunden. Eine Befragung der Hausbewohner hatte keine brauchbaren Informationen ergeben. Das frischgebackene Ehepaar in Nummer 1 hatte den Sonntagvormittag hauptsächlich im Bett verbracht – ohne Frühstück, ohne Zeitungen, nur mit sich selbst beschäftigt. Die extrem schwerhörige alte Dame mit dem blau getönten Haar in Nummer 3 hatte sich ausführlich darüber ausgelassen, dass sie an dem bewussten Vormittag nichts gehört hatte. Das Ehepaar aus Nummer 4 war auf einer »Rettet die Wale«-Demonstration in Wytham Woods gewesen, die Mieter in Nummer 7 waren auf Urlaub in Tunesien, und die Käufer von Nummer 8 hatten das Badezimmer renoviert und dabei pausenlos das Radio laufen lassen, wo die beliebte Familienserie The Archers wiederholt wurde (Morse ließ endlich wieder einmal etwas Interesse erkennen).
»Ziemlich dürftige Anhaltspunkte«, räumte Phillotson ein, wies aber nicht ohne Stolz auf zwei grüne Aktenkästen mit Berichten und Aussagen und Notizen und losen Blättern sowie einem genauen Plan von McClures Wohnung. Für Morse waren solche Pläne mit ihren Bogen und Strichen und Pfeilen und gepunkteten Linien und Maßangaben ein Buch mit sieben Siegeln. Er sah deshalb die von der Immobilienfirma Adkinson erstellte Dokumentation nur flüchtig durch. Als Phillotson zu Ende war, stand er auf. »Und wie gehts Ihrer Frau? Ich wollte vorhin schon fragen …«
»Leider gar nicht gut«, sagte Phillotson bedrückt.
»Ein richtiger Trauerkloß, Lewis.«
Sie waren wieder im Büro des Chief Inspector, und Lewis bemühte sich, die unhandlichen Aktenkästen irgendwo auf dem überfüllten Schreibtisch unterzubringen.
»Er sorgt sich offenbar sehr um seine Frau, wenn …«
»Quatsch. Er wusste einfach nicht, wo er weitermachen sollte.«
»Und wir wissen das?«
»Zunächst mal würde mich interessieren, welche Zeitung McClure zuerst gelesen hat.«
»Wenn überhaupt …«
Morse nickte. »Weiter möchte ich gern wissen, ob er an diesem Vormittag irgendwelche Telefongespräche geführt hat.«
»Können wir uns nicht von British Telecom eine Aufstellung geben lassen?«
»Warum nicht?«, gab Morse unbestimmt zurück.
»Sie wollen sicher die Leiche sehen.«
»Wie kommen Sie denn darauf?«
»Ich dachte nur …«
»Höchstens das Hemd. Längsstreifen in Braun und Blau, nicht?« Morse fuhr mit dem Zeigefinger der Linken an der Innenseite seines ziemlich engen und ziemlich abgestoßenen Hemdkragens entlang. »Ich denke daran, meine – äh – Garderobe aufzustocken.«
Sein kleiner Witz kam bei Lewis nicht an. Der Sergeant fand es nur verwunderlich, dass Morse sich scheinbar mehr für das Hemd eines Toten als für die Frau eines Kollegen interessierte. Scheinbar oder anscheinend – das war bei Morse immer die Frage, denn was in diesem erstaunlichen Hirn wirklich vorging, wusste im Grunde niemand.
»Haben wir irgendwas Brauchbares von Phillotson erfahren, Sir?«
»Sie vielleicht. Ich nicht. Als ich sein Büro betrat, wusste ich über den Fall genauso viel wie vorhin, als wir wieder gegangen sind.«
»Wie bei Omar Khayyam, nicht?«, sagte Lewis unschuldig.
4
Krook malte den Buchstaben an die Wand – auf eine sehr seltsame Weise, indem er mit dem untern Ende des Buchstabens anfing und ihn nach rückwärts schrieb. Es war ein Anfangsbuchstabe, nicht von der Form eines gedruckten, sondern von der Art, wie ihn ein Schreiber gemacht haben würde.
»Können Sie ihn lesen?«, fragte er mich mit einem stechenden Blick.
Charles Dickens, Bleakhaus
Das nach den (zweifelsohne zuverlässigen) Plänen der Firma Adkinson 4 mal 6,1 Meter große Wohn- und Esszimmer (der Tatort) war typisch für den Wohnbereich eines pensionierten Oxford-Professors: ein Eichentisch mit vier Stühlen, ein braunes Ledersofa, ein passender Sessel, Fernseher, CD-Player und Kassettenrekorder, in deckenhohen Regalen Bücher über Bücher. Büsten von Homer, Thukydides, Milton und Beethoven. Eigentlich nicht genug Platz für die vielen Bilder (unter anderem aus der Pittura-Pompeiana-Serie der Kopf des Theseus, der den Minotaurus erschlägt). Drei der Büsten erkannte Morse sofort, beim Bronzekopf des Thukydides musste er raten. Lewis hingegen hatte alle vier sofort identifiziert, er hatte bessere Augen als Morse, und die Namen der Unsterblichen standen in sehr kleinen Versallettern auf den Sockeln.
Morse blieb einen Augenblick neben dem Sessel stehen und sah sich um, ohne etwas zu sagen. Durch die offen stehende Tür der Küche (2,25 mal 3,15) sah er an einer Wand den Oxford Almanach hängen und ging näher heran, um »St. Hilda’s College« nach einem Aquarell von Sir Hugh Casson zu bewundern. Der Kalender war vom vorigen Jahr, wie Morse merkte, als er die Jahreszahl las: MDCCCCLXXXXIII