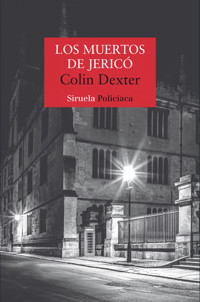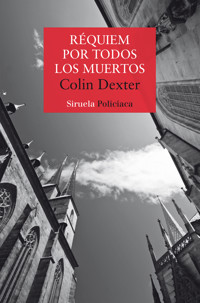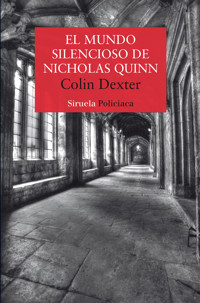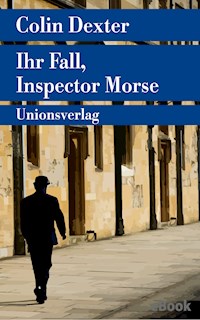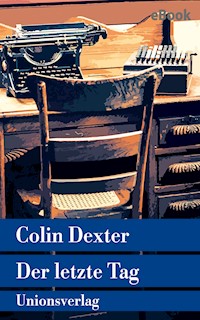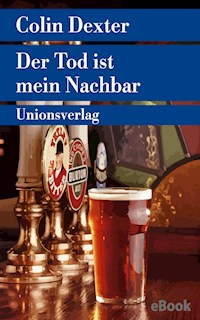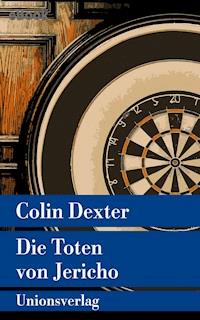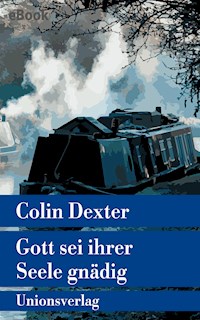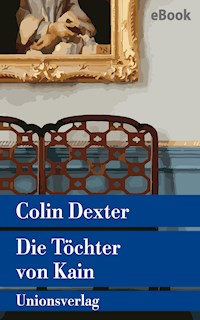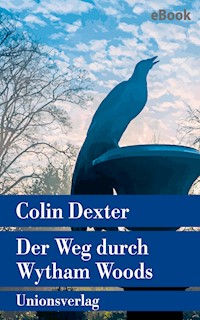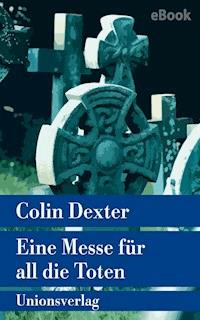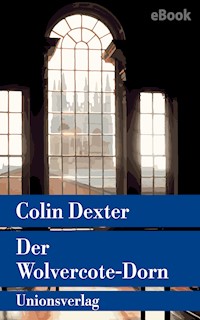
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Amerikanerin Laura Stratton ist im Besitz einer archäologischen Kostbarkeit: des Wolvercote-Dorns. Im Rahmen einer geführten historischen Städtetour durch England plant sie die feierliche Übergabe des Kleinods an das Ashmolean Museum, wo das Gegenstück ausgestellt ist. Doch dazu kommt es nicht. Nur wenige Stunden nach der Ankunft der Reisegruppe in Oxford liegt Stratton tot in ihrem Zimmer. Herzinfarkt. Was zunächst nach einem natürlichen Tod aussieht, wird schnell zu einem Fall für Inspector Morse und seinen Sergeant Lewis – denn der wertvolle Wolvercote-Dorn ist verschwunden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über dieses Buch
Die Amerikanerin Laura Stratton hütet eine archäologische Kostbarkeit: den Wolvercote-Dorn. Alles ist für die Übergabe an das Ashmolean Museum vorbereitet, doch kurz vorher wird Stratton tot aufgefunden. Was zunächst nach einem natürlichen Tod aussieht, wird zu einem Fall für Inspector Morse – denn der wertvolle Wolvercote-Dorn ist verschwunden.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Colin Dexter (1930-2017) studierte Klassische Altertumswissenschaft. Er ist der Schöpfer der vierzehnteiligen Krimireihe um Inspector Morse. Für sein Lebenswerk wurde er mit dem CWA Diamond Dagger und dem Order of the British Empire für Verdienste um die Literatur ausgezeichnet.
Zur Webseite von Colin Dexter.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Colin Dexter
Der Wolvercote-Dorn
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Ute Tanner
Ein Fall für Inspector Morse 9
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die englische Originalausgabe erschien 1991 bei Macmillan, London.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1992 unter dem Titel Tod für Don Juan im Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek.
Für die vorliegende Ausgabe hat Eva Berié die deutsche Übersetzung nach dem Original überarbeitet.
Originaltitel: The Jewel That Was Ours
© by Macmillan, an imprint of Pan Macmillan, a division of Macmillan Publishers International 1991
Übernahme der Übersetzung mit freundlicher Genehmigung des Rowohlt Verlags, Reinbek
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Oxford Picture Library (Alamy Stock Foto)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape und Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-31032-2
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 06:19h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DER WOLVERCOTE-DORN
Erster Teil1 – Es ist nicht unmöglich, in Gesellschaft einer Mätresse …2 – Um das Laster besser kurieren zu können …3 – »Jetzt komm schon, Maulwurf!«, drängte die Ratte und …4 – »Die Schabe Blattella Germanica«, hieß es 1926 in …5 – Jeder Heilige kann Wunder tun, ein Hotel führen …6 – Es gibt schlimmeren Zeitvertreib in der Welt …7 – Fast alle moderne Architektur ist Possenspiel8 – Der Gin and It, den Madame zu sich …9 – Oft habe ich mir gewünscht, ich wäre tot …10 – Eine törichte Starrheit ist der Kobold kleiner Geister11 – Geschichte (Subst.). Eine zumeist unzutreffende Darstellung zumeist unwichtiger …12 – Wasser, in Maßen genossen, kann keinem schaden13 – Solvitur ambulando14 – Nur die Hohlköpfe urteilen nicht nach dem Äußeren …15 – The best-laid schemes o’ mice and men16 – Im Lauf Ihres Besuchs begegnen Ihnen die großen …17 – Gescheite Leute haben offenbar keine Ahnung davon …18 – Man sah ein, dass ein gewisses Maß an …19 – In Oxford badete (und badet) man gern nackt …Zweiter Teil20 – Die Mondqualle wiegt sich unter den Wellen wie …21 – Du kamest nicht, und der Zeitmarsch zog dahin …22 – Pflicht ist das, was wir von anderen erwarten …23 – Allein der Bringer unwillkommner Zeitung hat ein nachteilig …24 – Es gibt mancherlei Schutzwehr gegen die Versuchung …25 – Eisenbahnfahren ist für mich nicht Reisen, sondern das …26 – Willst du diese Frau zum Weibe nehmen und …27 – Es ist höchst bedauerlich, dass sich viele niedrige …28 – Myself when young did eagerly frequent29 – Gibt verdammt viele Trinker heutzutage. Würde mich gar …30 – Genauigkeit in der Kommunikation ist wichtig, wichtiger denn …31 – Fenster haben einen hohen Wert. Für einen Menschen …32 – Der Mensch ist derart vernarrt in Systeme und …33 – Wer die Einsamkeit fürchtet, darf nicht heiraten34 – So klage ich Sie an der35 – Just a song at twilight36 – Da sie sich trafen, ward zum Juni der …37 – Sic, ne perdiderit, non cessat perdere lusor38 – Der West glimmt noch von schwachen Tagesstreifen …39 – I feel like I done when Slippery Sun40 – Ein Mensch, der sich tötet, um dem Leid …41 – Das Licht wird trübe; zum düstern Wald erhebt …42 – Und niemand auf den leeren Bahnsteig kam43 – Wie üblich brachte er Erklärungen für Dinge vor …44 – »Wenn mein erlauchter und gelehrter Bruder sein Urteil …45 – Mag sein, dass zu viel Fragen kränkend wirkt46 – Zu gern registriere und beobachte ich47 – Das Dunkel ist der Hervorbringung erhabener Ideen förderlicher …Dritter Teil48 – Manche Indizien sind schlagend – eine Forelle in …49 – Where water, warm or cool50 – Wenn er im Alter in Stinsford war …51 – Am Tagesende kamst du, und wie die Abendsonne …52 – Nur das Knochengerüst der Gewohnheit, das starre …53 – Und resümierte den Fall so gut, dass weit …54 – Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und …55 – In großen Dingen sollten wir uns weniger darum …56 – Und da nun näher kam das stolze Schiff57 – Was ist ein Name? Was uns Rose heißt58 – Nicht Ennas holdes Feld, wo Blumen pflückend59 – Je ne regrette rienEpilogZitatnachweisMehr über dieses Buch
Über Colin Dexter
Colin Dexter: »Ich liebe es, von einem Krimi an der Nase herumgeführt zu werden.«
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Colin Dexter
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Zum Thema England
Für Dorothy, meine Frau
Der Gott erspäht’ mit finstrem SinnIm Schatzkästchen den Hauptpreis dort,Mit stillem Schritt ging er dahinund nahm uns unser Kleinod fort.
Lilian Cooper, 1904–1981
Erster Teil
1
Es ist nicht unmöglich, in Gesellschaft einer Mätresse von Langeweile überwältigt zu werden.
Stendhal
Die leere Flasche Moët & Chandon Brut Impérial mit dem roten Etikett stand auf dem Nachttisch zu ihrer Linken, leer wie das Champagnerglas daneben und das Champagnerglas auf der anderen Seite des Bettes. Leere überall. Neben ihr lag ein schlanker, zierlich gebauter Mann Anfang vierzig, ein paar Jahre älter als sie, reglos auf dem Rücken. Die Hände hatte er hinter dem Kopf verschränkt, die Augen geschlossen. Er schlug sie auch dann nicht auf, als sie die geblümte Steppdecke zurückschlug, aufstand, in pelzgefütterte Hausschuhe schlüpfte und sich einen rosa Morgenrock überwarf, unter dem sich Brüste, Bauch und Schenkel deutlich abzeichneten. Sie trat ans Fenster und spähte durch einen Spalt zwischen den vorgezogenen Vorhängen.
Ihrem Taschenkalender, einem Oxford University Pocket Diary, hätte sie entnehmen können, dass an jenem Mittwoch Ende Oktober der Sonnenuntergang für 16.50 Uhr verzeichnet war. Die Sommerzeit war am letzten Wochenende zu Ende gegangen, und die Abende wurden, wie man so schön sagt, rasch länger. Sie hatte sich immer schwergetan mit dem Vor- und Zurückstellen der Uhr, bis ihr in Radio Oxford ein simpler kleiner Merksatz zu Ohren gekommen war, der ihr gefallen hatte: Im Winter stellt man die Uhr hinter. Heute aber war es draußen viel zu früh schon dunkel geworden, und noch immer schlug prasselnd der Regen gegen die Scheiben. Die Straßenlaterne von gegenüber warf einen orangefarbenen Schimmer über den schwarz glänzenden Asphalt.
In der Grundschule hatten sie eines Nachmittags eine Themseszene malen müssen, und alle Kinder hatten den Fluss blau gemalt. Nur sie nicht. Und da hatte die Lehrerin den Unterricht unterbrochen – mitten im Fluss gewissermaßen – und verkündet, Sheila Williams habe als Einzige den wahren Künstlerblick. Warum? Weil die Themse grau sein konnte oder weiß oder braun oder grün oder gelb – nur eben aus den Kästchen mit Oxfordblau und Cambridgeblau und Kobalt und Ultramarin, in denen die nassen Pinsel herumrührten, durfte die Farbe des Flusses auf gar keinen Fall kommen. Also fangt bitte noch mal von vorn an und versucht, die Farben zu malen, die ihr seht, und nicht die, die ihr von den Postkarten und den Atlanten her in Erinnerung habt. Bis auf Sheila natürlich. Denn Sheila hatte das Wasser schwarz gemalt.
So schwarz wie die spiegelnde Straße dort unten …
Ja.
Überall Schwärze.
Sheila zog den dünnen Morgenrock fester um sich. Sie wusste, dass er wach war, dass er sie beobachtete, wahrscheinlich an seine Frau dachte – oder an irgendeine Frau. Warum schickte sie ihn nicht weg? Warum vertrieb sie ihn nicht aus ihrem Bett, aus ihrem Leben? Vielleicht, weil sie ihn dringender brauchte als er sie? Das war nicht immer so gewesen.
Und dann stellte sie die Frage, so schwer es ihr auch fiel: »Bis vor Kurzem waren wir doch glücklich miteinander, nicht?«
»Was?« Das Schluss-s zischte.
Sie wandte sich um. Der Schnauzer und der sauber geschnittene Spitzbart umgaben dunkel seinen Mund, der ihr manchmal zu klein vorkam. Klein, kleinlich und – ja, verdammt arrogant.
»Ich muss gehen.« Unvermittelt setzte er sich auf und griff nach seinem Hemd.
»Sehen wir uns morgen?«, fragte sie leise.
»Wird sich kaum vermeiden lassen.« Er sprach mit lehrerhafter Präzision, sorgfältig betonten Konsonanten, der Andeutung eines Lispelns.
»Hinterher, meine ich.«
»Hinterher? Ausgeschlossen. Völlig ausgeschlossen. Morgen Abend müssen wir uns ganz auf unsere amerikanischen Gäste konzentrieren. Eine eminent wichtige Aufgabe, wie du weißt. Vor zehn kommen wir dort bestimmt nicht weg, und dann …«
»… musst du natürlich nach Hause.«
»Natürlich. Und du weißt auch, warum. Du bist vieles, aber nicht dumm.«
Sheila nickte bedrückt. »Du könntest vorher hier vorbeikommen.«
»Nein.«
»Auf einen Drink. Zur Stärkung vorher …«
»Nein.«
»Ja, dann …«
»Außerdem ist es der Leber und angrenzenden Organen sehr bekömmlich, zwischendurch mal Pause zu machen. Ein, zwei Tage in der Woche ohne Alkohol, Sheila … Ob du das durchhalten würdest?«
Er hatte sich rasch angezogen, jetzt knüpfte er mit schlanken Fingern die braune Fliege zu der gewohnten schlapp-dekadenten Schleife. Sheila fiel nichts Passendes mehr ein. Wieder wandte sie sich zum Fenster. Wenig später spürte sie seine Hand auf der Schulter, einen flüchtigen Kuss im Nacken. Dann schlug unten die Tür zu. Unglücklich sah sie dem schwarzen Regenschirm nach, der sich schnell entfernte. Dann knipste sie die Nachttischlampe aus, griff sich die Champagnerflasche und ging die Treppe hinunter.
Sie brauchte einen Drink.
Dr. Theodore Kemp eilte durch den strömenden Regen zu seinem nur wenige Gehminuten entfernten Heim. Es wurde höchste Zeit, die Beziehung zu dieser allzeit bereiten Geschiedenen, die er soeben verlassen hatte, zu lockern oder ganz abzubrechen. Sie wurde nachgerade zur Belastung. Dabei war ihm sehr wohl klar, dass es unter Umständen auch seine Schuld war, wenn Sheila jetzt schon morgens einen doppelten Gin brauchte, um ihren täglichen Pflichten nachgehen zu können. Es war einfach lästig, dass sie ihn so ernst nahm, dass sie immer mehr von seiner Zeit forderte, dass sie bei ihren Treffen immer leichtsinniger wurde. Umso vorsichtiger musste er sein. Gewiss, die sinnliche Frau würde ihm fehlen, aber seit einiger Zeit war sie ihm an den falschen Stellen etwas zu gut gepolstert.
Doppelgin … Doppelkinn …
Was er suchte, war eine Art von Liebe, die frei von lästigen Verpflichtungen war, und ein paar Monate hatte er gedacht, ebendies bei Sheila Williams gefunden zu haben. Es hatte nicht sollen sein … Dieses Urteil hatte er, Theodore Kemp, gefällt. Schließlich gab es noch andere Frauen auf der Welt – ganz besonders eine, die in ihrem Goldfischglas verführerisch hin- und herschwamm …
Er betrat die Wohnanlage in der Water Eaton Road, in die er vor zwei Jahren (nach dem Unfall) mit Marion gezogen war, schüttelte den triefenden Regenschirm aus und säuberte die durchnässten Schuhe sorgfältig auf der Fußmatte. Hoffentlich, dachte er, habe ich sie nicht ruiniert.
2
Um das Laster besser kurieren zu können, glauben sie, dass es nötig sei, es zu studieren, und ein wirksames Studium ist nur durch Praxis möglich.
Samuel Butler
Am gleichen Abend, nur viel später – die Bar hatte bereits das Gitter heruntergelassen –, saß John Ashenden allein im University Arms Hotel in Cambridge und beschäftigte sich in Gedanken mit dem morgigen Tag. Der Wetterbericht klang entschieden hoffnungsvoller, eine Wiederholung der ergiebigen Regenfälle, die heute ganz Süd- und Ostengland unter Wasser gesetzt hatten (einschließlich Oxford, wie wir gesehen haben), war nicht zu erwarten.
»Darf es noch etwas sein, ehe wir schließen, Sir?«
An sich war Ashenden ein Freund gepflegter Biere, andererseits wusste er aber auch, dass zu einer freundlicheren Weltsicht am schnellsten Whisky verhilft. Deshalb bestellte er jetzt noch einen großen Glenfiddich und ließ den Single Malt auf die Rechnung der Historischen Städtetour durch England setzen.
Eine Wetterbesserung wäre in jeder Beziehung zu begrüßen und würde die Stimmung seiner Amerikaner heben, die ständig über
zu wenig Sonne
zu reichliches Essen
zu viel Müll
zu frühes Wecken
zu lange Fußmärsche (ja, die besonders!)
lamentierten.
Dabei war es noch nicht mal eine besonders lästige Gruppe (bis auf diese eine Frau natürlich). Aus Ashendens Sicht waren sie sogar ein, zwei Punkte über dem Durchschnitt. Siebenundzwanzig Seelen, fast alle von der Westküste, hauptsächlich aus Kalifornien, die meisten zwischen fünfundsechzig und fünfundsiebzig, fast ausnahmslos reich, deren Leben sich um Alkohol, Bridge, Zigaretten und Krimis drehte. In den ersten Tagen hatte er noch gewisse Hoffnungen gehegt, dass sie sich statt für Zigaretten für Kultur interessierten, denn nachdem er zum Nichtraucher konvertiert war, nervte es ihn zunehmend, wenn manche sich schon während des Essens die nächste Zigarette anzündeten. Aber das hatte nicht sollen sein.
Wegen des Wolkenbruchs in Cambridge hatten sie die Ausflüge nach Grantchester und zum amerikanischen Soldatenfriedhof in Madingley streichen müssen. Die Programmänderung war – besonders von den Damen – höchst ungnädig aufgenommen worden, und auch ihm selbst war sie nicht gelegen gekommen. Wohl oder übel hatte er den Cicerone spielen, mit schmerzendem Nacken auf die Pracht der frühgotischen Spitzbogen des King’s College deuten und dann mit wehen Füßen durchs Fitzwilliam-Museum tappen müssen, um für seine Schar einige der stets beliebten präraffaelitischen Gemälde ausfindig zu machen.
»Ich habe gelesen, dass die Sammlung im Ashmolean sehr viel besser sein soll, Mr Ashenden. William Holman Hunt und … und Mill-ais.«
»Das werden Sie morgen ja selbst beurteilen können«, hatte Ashenden leichthin erwidert. Die Vornamen eines Malers, den sie so aussprach, als reime er sich auf Reis, hatte die vermaledeite Person offenbar vergessen – oder nie gewusst.
Es war ärgerlich, dass man wohl oder übel dem Busunternehmen in Cambridge das Geld für die ausgefallenen Ausflüge in den Rachen werfen musste. Noch ärgerlicher war, dass er für die Erbauung und Zerstreuung seiner Seniorenclique den ganzen Nachmittag hatte opfern müssen. Er hielt sich einiges auf seine Fähigkeiten als Reiseleiter zugute, aber in den letzten Jahren verspürte er immer dringender das Bedürfnis, bei seinen Pflichten, die ihn praktisch rund um die Uhr beanspruchten, hin und wieder eine Pause einzulegen. Die Nachmittage pflegte er sich deshalb nach Möglichkeit freizuhalten, hütete sich aber zu verraten, was er in dieser Zeit trieb.
Im November 1974 hatte er sich in Cambridge zur Aufnahmeprüfung für ein Studium der modernen Sprachen gemeldet. Seine in der Gesamtschule erzielten Abschlussnoten hatten nicht unberechtigten Optimismus geweckt, und er hatte noch ein Trimester drangehängt, um das Gesamtergebnis zu verbessern. Sein Vater wäre der stolzeste Mann in ganz England gewesen, hätte sein Sohn die Prüfer von seiner sprachlichen Kompetenz überzeugen können. Doch der Versuch schlug fehl, und am Weihnachtsabend war folgendes Schreiben durch den Briefschlitz gefallen:
Senior Tutor, Christ’s College, Cambridge
21.12.1974
Sehr geehrter Mr Ashenden,
nach gründlicher und wohlwollender Prüfung Ihrer Bewerbung müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir Ihnen keinen Studienplatz in unserem College anbieten können. Wir verstehen Ihre Enttäuschung, aber Sie wissen sicher, wie begehrt die wenigen Vakanzen …
Ganz ohne Folgen aber war sein kurzer Aufenthalt in Cambridge nicht geblieben. Er hatte zwei Nächte im Second Court von Christ’s übernachtet, zusammen mit einem Mitbewerber aus Trowbridge, einem schlaksigen, erstaunlich belesenen jungen Mann, der nicht nur ein Stipendium in Alten Sprachen anstrebte, sondern sich auch vorgenommen hatte, die Universität (oder das Universum?) zu den selbstverständlichen Wahrheiten seiner Spielart des Neomarxismus zu bekehren. So richtig hatte John das alles gar nicht verstanden, aber unvermittelt hatte sich vor ihm eine Welt der Gelehrsamkeit, des Intellekts, der fantasievollen Begeisterung und Sensibilität – ja, vor allem der Sensibilität – aufgetan, von der er in seiner Gesamtschule in Leicester nichts geahnt hatte.
An ihrem letzten gemeinsamen Nachmittag hatte Jimmy Bowden, der Trotzkist aus Trowbridge, ihn ins Kino mitgenommen – zu einer Doppelvorstellung aus dem goldenen Zeitalter des französischen Films –, und dort hatte er sich in eine sinnliche Hure mit rauchiger Stimme verliebt, die in einem schmierigen Bistro die seidenbestrumpften Beine übereinanderschlug und an ihrem Absinth nippte. Das alles habe etwas mit »der Synthese von Stil und Sexualität« zu tun, hatte Jimmy ihm zu erklären versucht. Bis in die frühen Morgenstunden hatten sie zusammengesessen und geredet, und am nächsten Morgen war Jimmy dann um sechs aufgestanden, um vor Marks & Spencer den Socialist Worker an den Mann – oder die Frau – zu bringen.
Wenige Tage nach der Ablehnung seiner Bewerbung hatte Ashenden eine Postkarte von Jimmy bekommen, eine Schwarz-Weiß-Aufnahme des Grabs von Karl Marx auf dem Friedhof von Highgate:
Die Idioten haben mir trotz meiner griechischen Prosa ein Vollstipendium spendiert! Nehme an, Du hast inzwischen auch Deinen positiven Bescheid. War schön, Dich kennenzulernen, freue mich auf unser erstes gemeinsames Trimester. Jimmy.
Er hatte Jimmy nie geantwortet. Und nur durch Zufall hatte er sieben Jahre danach, als er mit einer Gruppe nach Oxford kam, jemanden getroffen, der Jimmy Bowden gekannt hatte …
Jimmy hatte erwartungsgemäß seine Abschlussprüfung mit Glanz und Gloria bestanden und eine Doktorandenstelle zur Erforschung frühetruskischer Epigrafik bekommen. Drei Jahre später war er an Morbus Hodgkin gestorben. Er hatte, wie sich herausstellte, keine Angehörigen und war auf dem Holywell Cemetery in Oxford beigesetzt worden, an der Seite zahlreicher, sehr berühmter Professoren, nur acht, neun Meter von Walter Paters Grab entfernt. Auch nach Jimmys Tod schwand die Erinnerung an ihn nicht ganz aus John Ashendens Leben, denn über viele Jahre hatte er verschiedene Spezialzeitschriften abonniert, die in England und auf dem Kontinent für Filmfreaks wie ihn herausgegeben wurden. Wo und wann genau die Degeneration eingesetzt hatte (wenn man es denn so nennen wollte), hätte er nicht genau sagen können.
Er war Jahrgang 1952 und daher nicht mehr – wie die Generation seines Vaters – das Opfer sexueller Repression. Und nachdem er (gleich nach dem Schulabschluss) angefangen hatte zu arbeiten und zu reisen, hatte er kaum Hemmungen gehabt, seine sexuelle Neugier durch gelegentliche Besuche von Saunaclubs, Sexkinos oder freizügigen Shows zu befriedigen. Nach und nach aber fachten diese Erfahrungen seine Begierde, statt sie zu befriedigen, nur noch mehr an, und er wurde zum unverbesserlichen Voyeur. Von erfahreneren Kollegen aus der Reisebranche (die gegen korrumpierende Einflüsse aus dieser Richtung offenbar völlig immun waren) hatte er früher oft genug gehört, Pornos seien ja gut und schön, wenn sie nur nicht so entsetzlich langweilig wären …
Wie unappetitlich sein beginnendes Laster war, hatte er gleich zu Anfang begriffen, als er sich wie ein Blinder durch den dunklen Mittelgang eines schmierigen Kinos getastet hatte, die Cockneystimme des Anreißers noch im Ohr: »Hier haste was Richtiges, Kumpel, hier gehts echt zur Sache, kein Rumgefummel …« Es erschreckte ihn, dass ihn derart primitive Paarungsszenen so stark erregen konnten, andererseits war es ihm eine Beruhigung, dass fast alle Kinos, die er besuchte, ziemlich voll waren und dass die anderen Zuschauer vermutlich ebenso angepasst waren wie er selbst. Sehr bald begriff er auch etwas von jener »Synthese«, die Jimmy ihm zu erklären versucht hatte – der Synthese von Stil und Sexualität. Denn es gab da tatsächlich Leute, die sich auf solche Dinge verstanden, es gab Zusammenkünfte in Privatwohnungen, bei denen der Hohepriester den erhabenen Introitus anstimmte: »Sind alle miteinander bekannt?« Dass Ashenden genötigt gewesen war, heute Nachmittag auf eine solche Zusammenkunft der Eingeweihten zu verzichten, war enttäuschend. Wirklich sehr enttäuschend.
Doch die nächste Station war Oxford …
3
»Jetzt komm schon, Maulwurf!«, drängte die Ratte und trabte weiter. »Ach bitte, bleib stehen, Ratty«, bettelte der arme Maulwurf ganz verzweifelt. »Das verstehst du nicht. Es ist meine Heimat, mein altes Heim. Eben weht mir der Geruch in die Nase, es muss ganz in der Nähe sein, wirklich ganz in der Nähe. Da muss ich einfach hin!«
Kenneth Graham, Der Wind in den Weiden
Aaksfed? Das ist Aaksfed?«
John Ashenden warf von seinem Gangplatz in der ersten Reihe aus einen kurzen Blick auf die zierliche Siebzigerin aus Kalifornien. »Ja, Mrs Roscoe, das ist Oxford«, erwiderte er resigniert, doch ohne Groll. Die belesene, eifrige, humorlose (nervtötende!) Mrs Roscoe war zwar bisher noch mit keinem Programmpunkt der Historischen Städtetour durch England (London–Cambridge–Oxford–Stratford–Bath–Winchester) hundertprozentig einverstanden gewesen, doch als er jetzt auf seiner Seite aus dem Fenster sah, konnte Ashenden ihre Enttäuschung verstehen. Die alte Universitätsstadt zeigt sich, wenn man sich ihr vom östlichen Teil der A40 her nähert, nicht gerade von ihrer besten Seite, und der abfallbedeckte, ungepflegte Rasen vor einer grellbunten Tankstelle, an der sie sich auf ihrem Weg in Richtung Headington-Kreisverkehr vorbeiquälten, trug auch nicht gerade zur Verschönerung der Landschaft bei.
Die Reisenden – achtzehn Frauen, neun Männer (drei ausgewiesene Ehepaare) – lehnten sich zurück, während der Bus, dem Schild »Stadtmitte« folgend, wieder schneller wurde und über den gesichtslosen nördlichen Teil der Ringstraße zum Banbury-Kreisverkehr rollte.
Mrs Laura Stratton fühlte sich denkbar unbehaglich. Sie schlug zur Abwechslung das linke über das rechte Bein und massierte den linken Fuß mit der rechten Hand. Vereinbarungsgemäß würde Eddie die Formulare ausfüllen, sich um den Eintrag ins Gästebuch kümmern, dem Hoteldiener ihre Koffer zeigen und ihm ein angemessenes Trinkgeld geben, inzwischen konnte sie sich in ein heißes Kräuterbad legen und ihrem müden Körper, ihren müden Füßen Ruhe gönnen. »Mir ist so elend, Ed!«
»Ganz ruhig, Schätzchen, das wird schon alles wieder.« Er sprach so leise, dass selbst Laura ihn kaum verstand. Eddie Stratton, sechsundsechzig und damit vier Jahre jünger als seine Frau, legte die Hand kurz auf ihren nylonbestrumpften linken Fuß, dessen Zehen durch jahrelange schwere Arthritis deformiert waren. Wie zum Trotz leuchteten die Nägel in grellem Scharlachrot.
»Wenn ich bloß erst in meiner Wanne liege, gehts mir gut!« Laura schlug das rechte über das linke Bein und massierte den anderen Fuß. Beide hatten sich bis vor Kurzem noch der teuersten Fußpflege in ganz Pasadena erfreut.
»Jaa!« War außer seiner Frau sonst noch jemandem das leise Lächeln aufgefallen, das bei diesen Worten um Eddie Strattons Lippen lag?
Der Bus fuhr jetzt über die Banbury Road, wo Ashenden der Kommentar inzwischen fast von selbst über die Lippen ging: »… und beachten Sie rechts und links die hübschen Häuser aus orangerotem Backstein, sie entstanden in den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, als die Hochschullehrer … sehen Sie die Jahreszahl dort, 1887 …«
Unmittelbar hinter Ashenden saß ein Mann Anfang siebzig, pensionierter Bauingenieur aus Los Angeles, der jetzt durchs Fenster die Läden und Büros von Summertown betrachtete: Banken, Bausparkassen, Obstgeschäfte, Friseure, Makler, Zeitungsläden, Weinhandlungen … Fast wie zu Hause, dachte Howard Brown. Aber – im Grunde ist es ja zu Hause …
Die neben ihm sitzende Shirley war die zweite Ehefrau, die ein Lächeln auf den Lippen des Ehepartners erblickte, ein Lächeln wehmütiger Zufriedenheit, und plötzlich plagte sie ihr Gewissen.
»Howard?«, flüsterte sie. »Howard! Ich bin so froh, dass wir die Tour gebucht haben. Wirklich!« Sie legte ihren rechten Arm auf seinen langen Schenkel und drückte ihn leicht. »Und es tut mir«, pianissimo, »wahnsinnig leid, dass ich gestern Abend so gemein und undankbar war.«
»Schwamm drüber, Shirl, Schwamm drüber …«
Doch Howard Brown wäre es gar nicht unlieb gewesen, hätte seine Frau noch eine Weile in ihrer Schmollecke verharrt. In dieser (gar nicht so seltenen) Stimmung gewährte sie ihm den nötigen Spielraum für die (gar nicht so seltene) Untreue in Gedanken und Taten, die er sich nie hätte leisten können, hätte sie jetzt auch nur einen Bruchteil der Zuneigung erkennen lassen, die sie ihm entgegengebracht hatte, als sie sich entschlossen zu heiraten. Doch das war 1947 gewesen, vor dreiundvierzig Jahren, damals wäre es ihr nie im Traum eingefallen, seinen Tachostand zu kontrollieren, sich dafür zu interessieren, wo seine Privatpost abgestempelt war, oder ihn misstrauisch zu beschnüffeln, wenn er aus dem Büro kam.
»… und hier«, Ashenden war mittlerweile in Fahrt, »sehen wir Ruskins Einfluss auf die Architektur jener Zeit. Beachten Sie dort links die neugotischen, pseudovenezianischen Stilelemente … Und hier, wieder links, haben wir Norham Gardens, direkt dahinter die berühmten University Parks, dort das schmiedeeiserne Tor … Die Parks gehören zu den größten Grünanlagen der Stadt, aber sie können noch heute jederzeit ohne Begründung von der Universitätsverwaltung geschlossen werden. Da muss man herausfinden, wie man sich unbemerkt von den Aufsehern am Haupteingang hereinschleichen kann.«
»Und auch wieder herausschleichen, Mr Ashenden …«
Ausnahmsweise war dieser Einwurf der kleinen Mrs Roscoe nicht nur treffend, sondern auch harmlos, und die Mitreisenden belachten ihn vergnügt.
Howard Brown hatte von diesem Wortwechsel nichts mitbekommen. Er machte einen langen Hals, um einen Blick auf die Pförtnerloge zu erhaschen, und dabei spürte und witterte er wie der Maulwurf aus Wind in den Weiden vertrautes Gebiet, und etwas lange in ihm Verschüttetes erwachte plötzlich zu neuem Leben. Nostalgische Tränen stiegen ihm in die Augen. Er schnaubte heftig durch die Nase, warf seiner Frau einen raschen Seitenblick zu und sah erleichtert, dass um ihre Lippen wieder der gewohnte Zug säuerlicher Unzufriedenheit lag. Er war so gut wie sicher, dass sie nichts ahnte.
Als der Bus in die St. Giles’ einbog, war der Himmel klar, eine strahlende Sonne beschien den zimtfarbenen Stein der Häuser, die die breite, baumbestandene Straße säumten. »Wir befinden uns auf der St. Giles’«, Ashenden drückte jetzt aufs Tempo, »rechts und links in herrlich goldenen Herbstfarben leuchtende Platanen … links das St. John’s College, gleich dahinter Balliol … Vor uns das berühmte Märtyrerdenkmal, den Eleanoren-Kreuzen Eduard I. nachgebildet und geschaffen von Gilbert Scott zu Ehren der großen protestantischen Märtyrer Cranmer und Latimer und – äh …«
»Nicholas Ridley«, ergänzte Mrs Roscoe, während der Bus an der Ampel rechts abbog und dann auf der linken Seite der Beaumont Street vor der hohen neugotischen Fassade des Randolph Hotel hielt.
»Endlich!« Laura Strattons Ausruf klang wie der Stoßseufzer einer Gefangenen, die doch noch begnadigt worden ist.
Im Rückblick war es ein merkwürdiger (wenn auch belangloser) Zufall, dass der Mann mittleren Alters, der in einem unscheinbaren Wohnblock am oberen Ende der Banbury Road lebte, in ebenjenem Moment aus seinem Doppelglasfenster im zweiten Stock sah, als am späten Nachmittag der lang gestreckte Luxusbus mit Ashendens Reisegruppe vorbeifuhr. Eine kürzlich erneuerte Nadel entlockte der schon häufig abgespielten Platte die Götterdämmerung in einer von Furtwängler dirigierten Aufnahme, doch den Mann, der die Platte aufgelegt hatte, beschäftigte im Augenblick weniger die Musik als der ihn fast körperlich schmerzende Anblick der fettigen Hinterlassenschaft, die eine gestern Abend vom Chicken Barbecue in Summertown heimwärts ziehende Meute auf der Straße verstreut hatte.
4
»Die Schabe Blattella Germanica«, hieß es 1926 in einer etwas mysteriösen Bemerkung, »soll gelegentlich in der Küche des Randolph Hotel gesichtet worden sein.«
Jan Morris, Oxford
Roy, Chefportier im Fünfsternehotel Randolph, ein rüstiger Sechziger mit strahlendem Teint, hatte seit dem Mittag Dienst und war wie stets vom Empfang genau über die an diesem Tag zu erwartenden Anreisen informiert worden, besonders natürlich über die Busladung amerikanischer Touristen, die um halb fünf eintreffen sollte. Roy, der 1945, vor fünfundvierzig Jahren also, als Page im Haus angefangen hatte, fand Amerikaner gar nicht so übel. Nicht, dass er etwa urlaubshalber in die Staaten geflogen wäre – nein, so weit ging die Liebe nicht! –, aber meist waren die Yankees durchaus sympathische Zeitgenossen, freundlich, mitteilsam und großzügig. Trotz seines unverbesserlichen und durchaus kämpferischen Patriotismus war ihm das selbstverständliche Überlegenheitsgefühl seiner Landsleute neuerdings nicht mehr so ganz geheuer, besonders seit jenem Abend im vorigen Monat, als er nach einem enttäuschenden null zu null im Länderspiel England–Holland auf einer Euro-Ferry nach England zurückgekommen war.
Fünf Minuten vor der Zeit sah er in seinem Verschlag am Haupteingang, wie der Luxusbus unter den von zwei eleganten Laternenpfählen flankierten weißen Baldachin von Oxfords führendem Hotel rollte. Sekunden später stand Roy in seiner blauen Uniform mit den gelben Paspeln gütig strahlend oben an der Treppe – bereit, die neuen Gäste mit dem angemessenen Grad jener »Wärme« zu begrüßen, die dem Hotel auf mehreren Seiten seines bunten Prospekts attestiert wurde. Über ihm flatterten der Union Jack sowie die Fahnen der EWG und der Vereinigten Staaten sacht in der Nachmittagsbrise. Er hatte Freude an seiner Arbeit, die er im Übrigen nur selten als Arbeit bezeichnete. Ebenso selten ging in einem so gut und mit so glücklicher Hand geführten Haus wie dem Randolph etwas schief. Überaus selten.
Aber hin und wieder doch?
Ja, durchaus.
Phil Aldrich, ein kleiner, langköpfiger älterer Mitbürger mit melancholischen Zügen (ebenfalls aus Kalifornien), erhob sich von seinem einsamen Platz auf der Rückbank und setzte sich neben Mrs Roscoe; er hörte nicht mehr so gut wie früher und wollte wissen, was sich tat. Der Stellvertreter des Hoteldirektors war zur Begrüßung in den Bus gekommen und gab bekannt, dass in der St. John’s Suite im ersten Stock Tee – oder auf Wunsch auch Kaffee – bereitstand; dass die Zimmer bezugsfertig waren und fortan alle Einrichtungen des Hotels – vom Telefon bis zum Hosenbügler – den verehrten Gästen zur Verfügung standen; dass man schon angefangen hatte, die Koffer auszuladen, zu zählen, zu überprüfen und auf die einzelnen Zimmer zu schaffen. Es würde viel Zeit sparen, schloss er, wenn die Gästekarten gleich hier im Bus ausgefüllt werden könnten.
Unter beifälligem Nicken verteilte Ashenden die Formulare der Trusthouse-Forte-Kette, auf denen die Fragen nach der Firma, dem nächsten Reiseziel, der Zahlungsweise, Abreise und Nationalität bereits beantwortet waren. Die Reisenden selbst brauchten nur noch die Kästchen Heimatanschrift, Telefonnummer, Passnummer und Unterschrift auszufüllen.
»Donnerwetter«, sagte Phil anerkennend. »Verdammt gut organisiert, Janet.«
Ausnahmsweise fand diesmal auch Mrs Roscoe kein Haar in der Suppe, war aber in Gedanken bereits bei den Fährnissen der nicht absehbaren Zukunft. »Ich hoffe doch, dass die Leute sich hier über den großen Unterschied zwischen Vegetarismus und Veganismus klar sind …«
»Aber Janet! Das ist eins der führenden Hotels des Landes –«
Ashendens Stimme unterbrach sie. »So, wenn wir jetzt bitte alle … St. John’s Suite. St. John’s … im ersten Stock, die Haupttreppe hinauf … Tee oder Kaffee, bitte gleich … Sicher möchten Sie sich alle frisch machen und … Wenn Sie die Karten bitte an der Rezeption abgeben würden … geradeaus durch den Haupteingang … Dort unterschreiben Sie dann und nehmen Ihre Schlüssel in Empfang. Der Gästeaufzug ist rechts im Gang …«
»Los jetzt«, zischelte Laura.
»Ich frage später bei Ihnen nach, ob alles …«
Ashenden wusste aus Erfahrung, dass in der ersten Stunde in einem neuen Hotel die entscheidenden Weichen gestellt werden. Gelingt es, kleine Pannen gleich auszubügeln, hat man es statt mit einer Schar nervöser Nörgler mit glücklichen, zufriedenen Gästen zu tun. Zum Glück wurde Ashenden nur sehr selten mit so konkreten Beschwerden wie Küchenschaben, Mäusen oder unappetitlichen Hinterlassenschaften früherer Gäste konfrontiert. Kleinere Beanstandungen aber waren sogar in den bestgeführten Hotels an der Tagesordnung – fehlende Seife im Badezimmer, nur zwei Portionen Kaffeesahne am Heißwasserbereiter, fehlende Gebrauchsanweisung für den Fernseher, keine Spur, noch immer keine Spur vom Gepäck …
Eddie Stratton war es gelungen, sich als Zweiter in die Schlange an der Rezeption zu stellen. Kaum war er im Besitz des Schlüssels zu Zimmer 310, hatte Laura ihm, noch ehe der Papierkram erledigt war, das gute Stück entrissen.
»Ich geh gleich rauf, Ed, und leg mich in die Badewanne, ich halts nicht mehr aus …«
»Ist gut, Schätzchen, aber lass die Tür auf, wir haben nur den einen Schlüssel. Ich trink noch einen Tee in der St. John’s Suite.«
»Ja, schon recht.«
Und damit war sie verschwunden.
Während Laura zum Gästeaufzug hinkte, drehte Eddie sich um und sah die hinter ihm stehende Shirley Brown an. Sekundenlang reagierte sie nicht, dann aber, nach einem kurzen Blick auf ihren Mann, nickte sie fast unmerklich und lächelte mit den Augen.
5
Jeder Heilige kann Wunder tun,ein Hotel führen können nur ganz wenige.
Mark Twain
Endlich«, murmelte Laura Stratton zum dritten (und letzten) Mal, als sie den Schlüssel ins Schloss steckte und ihn korrekt – nämlich im Uhrzeigersinn – drehte.
Der Raum ging nicht direkt von dem Hauptgang im dritten Stock ab; ein Schildchen an der als Notausgang ausgewiesenen Pendeltür wies den Weg zu Zimmer 310. Als sie die Pendeltür durchschritten hatte, fand sich Laura in einem nur knapp zwei Meter breiten Gang, der parallel zum Hauptgang verlief und auf dem sie (nachdem sie sich nach links gewandt hatte) die fünf Meter bis zu der rechts gelegenen Tür ihres Zimmers ging. Dahinter knickte der Gang rechtwinklig ab und endete an einem weiteren Notausgang mit Pendeltür – der zweifellos, wie sich Laura (wiederum korrekt) sagte, über eine Hintertreppe ins Erdgeschoss führte. Auf den Gedanken, in diesem schmalen Raum könne ein Mensch stehen, eng an die Wand gedrückt und von dem schmalen Gang aus, der zu ihrem Zimmer führte, völlig unsichtbar – auf diesen Gedanken kam sie nicht.
Laura zog den Schlüssel ab und die Tür hinter sich zu, ohne sie ganz zu schließen. Die beiden großen schwarzen Lederkoffer waren schon angekommen, und als sie sich umschaute, stellte sie fest, dass das Zimmer sehr erfreulich anzusehen war. Rechts von ihr stand ein Doppelbett mit hellgrüner gesteppter Tagesdecke, dahinter ein Kleiderschrank. Geradeaus sah sie auf drei Spitzbogenfenster, deren Vorhänge bis zum Boden reichten, und vor diesen Fenstern standen von rechts nach links ein Wasserkocher, ein Fernseher, ein Ankleidetisch mit Spiegel und ein roter Plüschsessel. Ihrem raschen Rundblick entging nur die sehr ordentliche Reproduktion von Vermeers Ansicht von Delft über dem Bett. Laura und ihr erster Mann hatten das Original im Den Haager Mauritshuis gesehen. Der Museumsführer hatte darauf hingewiesen, dass es Marcel Prousts Lieblingsbild gewesen war. Sonderbarerweise hatte das Bild Laura enttäuscht, und in den wenigen Minuten, die sie noch zu leben hatte, blieb ihr keine Zeit mehr, das damalige Urteil zu revidieren.
Sie trat ans Fenster und sah auf den Portikus mit den ionischen Säulen und dem steinernen Apoll, der mit hochgerecktem rechtem Arm auf dem Scheitelpunkt des ziemlich flachen Giebels balancierte. Zwischen den beiden mittleren Säulen spannte sich ein großes blaues Transparent in Oxfordblau mit der Aufschrift: Museum Ashmoleanum apud Oxonienses. O ja, Laura war recht gut im Bilde über das Ashmolean Museum, und um ihre grell geschminkten Lippen lag ein leichtes Lächeln, als sie den Vorhang fallen ließ und sich der halb geöffneten Tür zu ihrer Linken zuwandte, die zu einem champagnerfarben gekachelten Badezimmer führte. Sie stieß die Tür ein Stück weiter auf, ohne jedoch vorerst einzutreten: WC rechts, Badewanne direkt vor ihr, der Duschvorhang halb vorgezogen. Links ein Waschbecken mit beheiztem Handtuchhalter, der großzügig mit flauschigen weißen Handtüchern bestückt war.
Laura schlief auf Doppelbetten seit jeher links – als junges Mädchen neben ihrer Schwester, später neben ihren beiden Ehemännern. Jetzt ließ sie sich schwerfällig auf die Bettseite direkt an der Tür fallen, stellte die weiße Lederhandtasche auf den Nachttisch, unter die Schalter für Licht, Radio und Fernseher, und zog die Schuhe aus.
Endlich war sie die Schuhe los.
Sie holte den Wasserkocher, füllte ihn am Waschbecken des Badezimmers und schaltete ihn ein. Dann ging sie erneut ins Badezimmer, steckte den Stöpsel in die Wanne und drehte den Warmwasserhahn auf. Danach hängte sie das BITTE-NICHT-STÖREN-Schild draußen an den Türknauf, ging zurück ins Badezimmer und goss eine rosa Schaumbadflüssigkeit in die sich allmählich füllende Wanne.
Beryl Reeves hatte bemerkt, dass in Zimmer 310 ein neuer Gast eingetroffen war. Um 16.40 Uhr war sie noch einmal mit dem Staubsauger und gespitzten Ohren über den Gang gezogen. Trotz ihrer noch sehr überschaubaren Berufserfahrung wusste sie, dass die Amerikaner, ehe sie um fünf Feierabend machte, diverse Fragen und Wünsche haben würden, vom Standort der »Eismaschine« (nicht vorhanden) bis zur Beschaffung weiterer Nescafé-Tütchen (schnell beschafft). Beryl kam aus Manchester, und wegen ihrer offenen, wenn auch etwas naiven Weltsicht – und vielleicht mehr noch wegen ihres Akzents – war sie bei ihren Gästen im dritten Stock im Allgemeinen sehr beliebt. Alles in allem war sie eine ausgezeichnete Mitarbeiterin – pünktlich, gewissenhaft, freundlich und (wie Morse später feststellen sollte) als Zeugin absolut zuverlässig.
An diesem Nachmittag hatte sie Punkt 16.45 Uhr (präziser geht es wohl kaum) vor Zimmer 310 haltgemacht, hatte das BITTE-NICHT-STÖREN-Schild draußen hängen sehen und sich gewundert, dass die Tür nur angelehnt war. Sie hatte einen kurzen Blick ins Zimmer geworfen, sich aber gleich wieder zurückgezogen, als sie sah, dass Dampf aus dem Badezimmer kam. Ja, eine weiße Lederhandtasche wäre ihr wahrscheinlich aufgefallen, wenn sie irgendwo im Zimmer herumgestanden hätte. Nein, weiter als bis zur Tür war sie nicht gekommen, in die Ecke vor dem Notausgang hatte sie nicht gesehen. Wenig später hatte ein amerikanischer Gast Zimmer 308 betreten, ein freundlicher Herr, der »Hi!« gesagt hatte. Ja, natürlich würde sie ihn wiedererkennen, sie wusste sogar, wie er hieß. Es war ein gewisser Howard Brown aus Kalifornien.
Kurz vor sechs läutete im Büro von Chief Superintendent Strange von der Polizeizentrale Thames Valley in Kidlington das Telefon. Der große Boss hörte sich ziemlich geduldig, wenn auch ohne große Begeisterung an, was sein Kollege, Superintendent Bell von St. Aldate’s in Oxford, ihm zu sagen hatte.
»Klingt eigentlich nicht danach, als ob das was für Morse wäre, Bell, aber wenn ihr wirklich so knapp seid … Nein, er wollte gerade ein paar Tage freinehmen, angeblich kommt er nie auf die Urlaubstage, die ihm zustehen. Es darf gelacht werden. Wenn man die Stunden abzieht, die er im Pub verbringt … was? Ja, wie gesagt, wenn ihr wirklich knapp seid … Ist gut. Seine Privatnummer haben Sie? … Bestens. Sagen Sie ihm, dass Sie mit mir gesprochen haben. Er hat es immer ganz gern, wenn Lewis mit von der Partie ist … Was? Lewis ist schon da? Gut, sehr gut. Und wie gesagt, sagen Sie ihm, dass Sie mit mir gesprochen haben, dann läuft das problemlos.«
6
Es gibt schlimmeren Zeitvertreib in der Welt, als einer Frau den Puls zu fühlen.
Laurence Sterne, Eine empfindsame Reise durch Frankreich und Italien. Von Mr. Yorick.
Schon da, Lewis?«
»Seit einer halben Stunde, Sir. Der Super hatte mich angerufen. In St. Aldate sind sie knapp dran …«
»Sieht ganz danach aus …«
»Ich war schon oben.«
»Keine Probleme?«
»Ich … weiß nicht recht, Sir.«
»Na gut. Auf gehts, Macduff!«
»Erhebe dich, Macduff, Sir. Unser Englischlehrer –«
»Danke, Lewis.«
»Zum Aufzug gehts hier lang.«
»Aufzug? Wir wollen doch nicht aufs Empire State Building.«
»Es sind immerhin etliche Stufen, Sir«, bemerkte Lewis vorsichtig – in der (begründeten) Vermutung, sein Chef habe sich mal wieder vorgenommen, etwas für seine Gesundheit zu tun.
»Auf mich brauchen Sie keine Rücksicht zu nehmen, Lewis. Sollte es wider Erwarten doch ein bisschen anstrengend werden, mache ich zwischendurch eine Verschnaufpause.«
Lewis nickte. Dass er wieder mal mit Morse, diesem Griesgram, zusammenarbeiten konnte, war ihm sehr recht.
Ein paar Sekunden blieb Morse schwer atmend vor Zimmer 310 stehen, wo er zunächst den Türknauf und dann mit hochgezogenen Brauen Lewis ansah.
»Nein, Sir, lohnt sich nicht. Da haben schon vier, fünf Leute dran rumgepfuscht.«
»Und wer ist jetzt drin?«, fragte Morse leise.
»Nur Dr. Swain. Seit einigen Jahren Hotelarzt hier.«
»Und vermutlich die Tote?«
»Die Tote auch, Sir.«
»Wer war vorher drin?«
»Mr Gascoigne, der Hoteldirektor, und Mr Stratton, der Ehemann. Er hat sie gefunden. Ist ziemlich am Boden zerstört. Ich hab Mr Gascoigne gesagt, er soll mit ihm in sein Büro gehen.« Lewis deutete unbestimmt nach unten.
»Sonst niemand?«
»Ich natürlich.«
Morse nickte und spendierte ein halbes Lächeln.
Laura Stratton lag lang ausgestreckt auf dem Doppelbett. Sie trug einen bodenlangen pfirsichfarbenen Morgenrock und darunter (soweit Morse sehen konnte) so gut wie nichts. Und sie war tot. Morse warf einen knappen Blick auf ihr Gesicht, schluckte kurz und wandte sich ab.
Dr. Swain, ein offenbar noch relativ junger Mann (Anfang dreißig?) von rosiger Gesichtsfarbe, saß am Ankleidetisch und schrieb. Er wandte den Kopf und lieferte umgehend die Antwort auf eine unausgesprochene Frage des Chief Inspector.
»Das Herz. Myokardinfarkt.«
»Danke, Doktor … Swain, ja?«
»Und Sie sind …«
»Morse. Chief Inspector Morse.«
Swain stand auf und überreichte Morse einen Briefbogen. Unter der Kopfzeile »Gesundheitsamt Oxfordshire« waren in der rechten oberen Ecke eine Reihe von Ärzten namentlich aufgeführt. Als vorletzten Namen las Morse: »M. C. Swain, MA, MB, BCh, MRCP, MRCGP«.
»Herzlichen Glückwunsch«, sagte Morse.
»Bitte?«
»Sechzehn, wenn ich recht gezählt habe. Sechzehn Buchstaben hinter Ihrem Namen, und ich habe keinen einzigen aufzuweisen.«
»Ja … äh … so geht das eben manchmal. Ich muss los. Meinen Bericht haben Sie. Wir müssen heute Abend zu einem Essen von der BMA.«