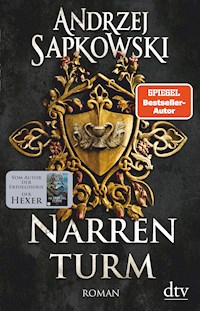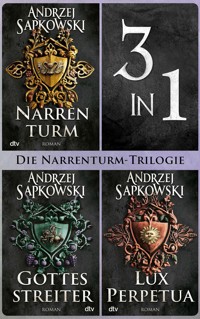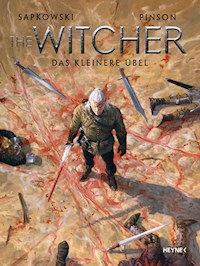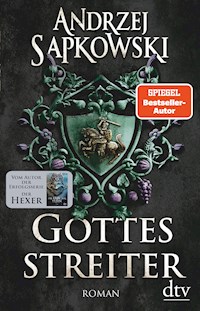
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Narrenturm-Trilogie
- Sprache: Deutsch
»Ein großer, bunter Bilderbogen mit allem, was dazugehört: Schlachtgetümmel, Liebschaften, Exorzismus, hohe Politik, schöne Frauen, Ritter zu Pferde, Intrigen, Skelette, die aus Gräbern steigen ...« Sächsische Zeitung Prag 1427: Die Stadt gleicht einem Hexenkessel. Fieberhaft sucht ein geheimer Magierzirkel nach dem Stein der Weisen. Das interessiert auch Reynevan von Bielau brennend – was dem Geheimdienst nicht entgeht, der ihn des Überfalls auf einen Steuereintreiber verdächtigt. Als der Papst zum erneuten Kreuzzug gegen die Hussiten aufruft, nutzt der junge, tollkühne Medicus daher die Wirren, um sich nach Schlesien davonzumachen. Er will sich für den Tod seines Bruders rächen und sucht nach einer Lösung für den Fluch, der über seinem Gefährten Samson liegt. Ehe er sichs versieht, gerät er jedoch zum Spielball der Mächtigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1027
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Über das Buch
Prag, im Jahr des Herrn 1427. Die Stadt gleicht einem Hexenkessel. Fieberhaft sucht ein geheimer Magierzirkel nach dem Stein der Weisen. Das interessiert auch Reinmar von Bielau, genannt Reynevan, brennend – was dem taboritischen Geheimdienst nicht entgeht, der ihn des Überfalls auf einen Steuereintreiber verdächtigt. Als der Papst zum erneuten Kreuzzug gegen die Hussiten aufruft, nutzt der junge Medicus daher die Wirren, um sich davonzumachen. Er will sich in Schlesien für den Tod seines Bruders rächen und sucht nach einer Lösung für den Fluch, der über seinem Gefährten Samson liegt. Ehe er sich's versieht, gerät er jedoch zum Spielball der Mächtigen …
Von Andrzej Sapkowski sind bei dtv erschienen:
Die Abenteuer des jungen Witchers
Der letzte Wunsch
Zeit des Sturms
Das Schwert der Vorsehung
Die Witcher-Saga
Das Erbe der Elfen
Zeit der Verachtung
Feuertaufe
Der Schwalbenturm
Die Dame vom See
Kreuzweg der Raben
Geschichten aus der Welt des Witchers
Etwas endet, etwas beginnt
Das Universum des Andrzej Sapkowski
Alain T. Puysségur: The Witcher. Der Codex
Die Narrenturm-Trilogie
Narrenturm
Gottesstreiter
Lux perpetua
Andrzej Sapkowski
Gottesstreiter
Roman
Aus dem Polnischen von Barbara Samborska
Prolog
Die Welt, werte Herren, hat begonnen, größer zu werden. Aber gleichzeitig ist sie auch kleiner geworden.
Ihr lacht? Weil ich, wie es scheint, Unsinn rede? Weil das eine das andere ausschließt? Gleich werde ich Euch beweisen, dass dies keineswegs der Fall ist.
Seht doch mal aus dem Fenster, edle Herren. Was seht Ihr da, worauf fällt Euer Blick? Auf die Scheune, antwortet Ihr, was der Wahrheit entspricht, und auf den Abtritt dahinter. Aber was ist da weiter, frage ich, dort hinter dem Abtritt? So merkt denn auf: Wenn ich die Maid frage, die eben mit den Bierkrügen herbeieilt, wird sie antworten, dass hinter dem Abtritt ein Stoppelfeld ist, hinter dem Stoppelfeld Jachyms Anwesen, dahinter die Teerbrennerei und noch ein Stück weiter wohl schon Klein-Kosolup. Wenn ich unseren Wirt frage, der mir etwas weltläufiger erscheint, dann wird er hinzusetzen, dass dies noch lange nicht das Ende ist, denn hinter Klein-Kosolup liegt Groß-Kosolup, nach den beiden kommt der Weiler Kozmirau, hinter Kozmirau das Dorf Lahse, hinter Lahse Goschütz, und hinter Goschütz liegt dann wohl schon Festenberg. Aber merkt auf, umso weltgewandter die Menschen sind, die ich befrage, wie zum Beispiel Euch, desto weiter entfernen wir uns von unserer Scheune, dem Abtritt und den beiden Geißenhügeln – denn einem weltgewandteren Verstand ist wohl bekannt, dass auch hinter Festenberg die Welt nicht zu Ende ist, denn dahinter liegen Oels, Brieg, Falkenberg, Neisse, Leobschütz, Troppau, Jitschin, Trentschin, Neutra, Esztergom, Buda, Belgrad, Ragusa, Janina, Korinth, Kreta, Alexandria, Kairo, Memphis, Ptolemais, Theben … Na, wie sieht’s aus? Wächst unsere Welt etwa nicht? Wird sie nicht immer größer?
Und auch dort ist sie beileibe noch nicht zu Ende. Folgt man hinter Theben dem Nil, der als Fluss Gihon einer Quelle im irdischen Paradies entspringt, flussaufwärts, so gelangt man zum Lande der Äthiopier, hinter dem bekanntermaßen das Wüstenland Nubien liegt, das heiße Land Kusch, das Goldland Ophir und die ganze unermessliche Africae Terra, ubi sunt leones. Und dahinter der Ozean, der die ganze Erde umfließt. Aber auch in diesem Ozean gibt es noch Inseln – Cathay, Taprobane, Bragine, Oxidrate, Gynosophe und Cipangu, wo das Klima wundersam fruchtbringend ist und Edelsteine zuhauf herumliegen, wie es der Gelehrte Hugo von St. Victor und Pierre d’Ailly beschreiben, und auch der edle Herr Jean de Mandeville, der jene Wunder mit eigenen Augen gesehen hat.
Somit ist also bewiesen, dass unsere Welt in den letzten paar Jahrhunderten wesentlich größer geworden ist. In gewissem Sinne, versteht sich. Hat auch die Welt nicht an Substanz gewonnen, um neue Namen ist sie gewiss reicher geworden.
Wie aber, fragt Ihr, soll man damit die Behauptung in Einklang bringen, die Welt sei kleiner geworden? Gleich werde ich Euch dies darlegen und beweisen. Zuvor aber bitte ich, Ihr möget weder spotten noch dreinreden, denn das, was ich sage, ist keineswegs eine Ausgeburt meiner Phantasie, sondern entspricht dem Wissen, das ich aus Büchern geschöpft habe. Und über Bücher soll man nicht spotten, denn schließlich hat sich ja jemand ganz fürchterlich abmühen müssen, damit sie entstehen konnten.
Wie man weiß, ist unsere Erde eine flache Scheibe von der Gestalt etwa eines runden Pfannkuchens, in deren Mitte Jerusalem liegt und die ringsum vom Ozean umgeben ist. Im Okzident bilden Calpe und Abyle, die Säulen des Herkules, mit der Meerenge von Gades dazwischen, das Ende der Welt.
Im Süden erstreckt sich der Ozean hinter Afrika, wie ich gerade ausführte. Im Südosten endet das Festland in India inferior, das dem Presbyter Johannes gehört, dort leben auch die Völker Gog und Magog. Im septentrionalen Teil der Welt ist Ultima Thule das letzte Stückchen Land, dort jedoch, ubi oriens iungitur aquiloni, liegt das Land Mogal, das Tartarenreich. Im Osten hingegen endet die Erde am Kaukasus, ein Stück hinter Kiew.
Und nun kommen wir zum Wesentlichen. Das heißt zu den Portugiesen. Genauer gesagt, zum Infanten Heinrich, dem Herzog von Viseu, einem Sohn König Johanns. Portugal, das lässt sich nicht leugnen, ist kein sehr großes Königreich, der Infant stand als Sohn des Königs erst an dritter Stelle in der Thronfolge, kein Wunder also, dass er von seiner Residenz in Sagres öfter und hoffnungsvoller hinaus aufs Meer blickte als nach Lissabon. Er berief Astronomen und Kartographen nach Sagres, jüdische Gelehrte, Seefahrer, Kapitäne und Schiffsbaumeister. Und dann ging es los.
Anno Domini 1418 gelangte Kapitän João Gonçalves Zarco zu den Inseln, die als Insulas Canarias, also Kanarische Inseln, bekannt wurden; der Name stammt daher, dass man dort eine außergewöhnliche Vielzahl an Hunden vorfand. Nur wenig später, nämlich 1420, segelte jener João Gonçalves Zarco gemeinsam mit Tristão Vaz Teixeira zu einer Insel, die Madeira genannt wurde. Im Jahre 1427 gelangten die Karavellen Diego de Silves zu den Inseln, die man Azoren benannte, Diego und Gott allein wissen, weshalb. Erst vor ein paar Jährchen, nämlich 1434, hat ein weiterer portugiesischer Seefahrer, Gil Eanes, das Kap Bojador umschifft. Und es geht das Gerücht, dass der tätige Infant Dom Henrique ein neuerliches Unternehmen vorbereitet, er, den einige bereits El Navegador – den »Seefahrer« nennen.
In der Tat, ich bewundere jene Meeresbezwinger und hege große Wertschätzung für sie. Welch unerschrockenen Leute sind das! Welch ein Graus ist es, sich unter Segeln auf den Ozean hinauszuwagen! Dort herrschen Böen und Stürme, da gibt es Felsen unter der Wasseroberfläche, Magnetberge, kochende oder zähflüssige See und in einem fort Wirbel und Turbulenzen, und wenn nicht Turbulenzen, dann Strömungen. Es wimmelt dort nur so von Ungeheuern, das Wasser ist voller Seedrachen, Seeschlangen, Delphine, Tritonen, Hippocampi, Sirenen und Plattfische. Im Meer tummeln sich sanguisugae, polypi, octopodes, locustae, cancri, verschiedenste pistrices et huic similia. Das Schrecklichste aber kommt am Ende – dort, wo der Ozean aufhört, an seinem äußersten Rand, beginnt die Hölle.
Warum wohl, meint Ihr, ist die untergehende Sonne so rot? Eben weil sie sich im Höllenfeuer spiegelt. Über den ganzen Ozean verstreut sind Löcher; segelt man mit einer Karavelle versehentlich über ein solches Loch, stürzt man geradewegs in die Hölle, Hals über Kopf, mitsamt dem Schiff und allem Drum und Dran. Ein solches Bild wurde erschaffen, damit sich kein Sterblicher auf die Meere hinauswagt. Die Hölle ist die Strafe für all jene, die dieses Verbot missachten.
Aber wie ich das Leben kenne, wird dies die Portugiesen nicht aufhalten.
Denn navigare necesse est, und jenseits des Horizonts liegen Inseln und Länder, die es zu entdecken gilt. Das ferne Taprobane muss in die Karten eingezeichnet, der Weg hin zu dem geheimnisvollen Cipangu in den Roteiros beschrieben und die Fortunatae Insulae, die Glücklichen Inseln, in den Portolanen markiert werden. Man muss weitersegeln auf der Fährte des heiligen Brendan, auf der Fährte der Träume, gen Hy Brasil, dem Unbekannten entgegen. Um das Unbekannte zu erforschen und bekannt zu machen.
Und dann – quod erat demonstrandum – wird die Welt für uns kleiner werden, schrumpfen; denn noch ein wenig Zeit, und alles findet sich auf den Landkarten, den Portolanen und den Roteiros. Und plötzlich ist alles ganz nah.
Die Welt schrumpft zusammen und wird um noch eines ärmer – um die Legenden. Je weiter die portugiesischen Karavellen segeln, je mehr Inseln entdeckt und benannt werden, umso weniger werden die Legenden. Wohin man auch blickt, schon löst sich wieder eine in Luft auf. Wir werden um immer mehr Träume ärmer. Und wenn die Träume sterben, nimmt das Dunkel ihren verwaisten Platz ein. Im Dunkeln aber, besonders wenn auch noch der Verstand einschläft, erwachen die Ungeheuer. Wie? Das hat schon jemand gesagt? Mein lieber Herr! Gibt es denn überhaupt etwas, was nicht schon einmal jemand gesagt hat?
Ach je, die Kehle ist mir ganz trocken geworden … Ob ich ein Bier verschmähen würde, fragt Ihr? Gewiss nicht.
Was sagt Ihr, frommer Bruder des heiligen Dominicus? Aha, dass es langsam Zeit wird, mit dem Geschwafel aufzuhören und mit meiner Erzählung fortzufahren? Zu Reynevan, Scharley, Samson und den anderen zurückzukehren? Ihr habt Recht, Bruder. Es wird Zeit. Ich komme also darauf zurück.
Das Jahr des Herrn 1427 war heraufgezogen. Erinnert Ihr Euch noch, was es gebracht hat?
Gewiss doch. Das kann man nicht vergessen. Aber ich will es Euch noch einmal ins Gedächtnis rufen.
Im Frühling jenes Jahres, wohl im März, aber sicher noch vor Ostern, erließ Papst Martin V. die Bulle Salvatoris omnium, in der er die Notwendigkeit des nächsten Kreuzzuges gegen die böhmischen Ketzer feierlich verkündete. Anstelle von Giordano Orsini, der schon betagt und entsetzlich unbeholfen war, ernannte Papst Martin Henry Beaufort zum Kardinal und Legaten a latere, den Bischof von Winchester und Halbbruder des englischen Königs. Beaufort nahm sich sehr eifrig der Sache an. Der Kreuzzug, der mit Feuer und Schwert die hussitischen Apostaten strafen sollte, war bald beschlossen. Der Feldzug wurde sorgfältig vorbereitet, das Geld, im Kriege eine Sache von allergrößter Wichtigkeit, wurde gewissenhaft eingetrieben. Wunder über Wunder, diesmal wurde auch nicht ein Groschen davon gestohlen. Einige Chronisten vermuten, die Kreuzfahrer seien ehrlicher geworden, andere meinten, man habe es einfach besser bewacht.
Zum Leiter des Kreuzzuges berief der Reichstag in Frankfurt am Main Otto von Ziegenhain, den Erzbischof von Trier. Alle Welt wurde zu den Waffen und unter das Zeichen des Kreuzes gerufen. Und schon standen die Heere bereit. Friedrich der Ältere von Hohenzollern, der Kurfürst von Brandenburg, erschien mit seinen Kriegern. Unter Waffen standen die Bayern unter Herzog Heinrich dem Reichen, der Pfalzgraf Johann von Pfalz-Neumarkt und sein Bruder Otto von Mosbach, Pfalzgraf bei Rhein. Am Treffpunkt erschien der noch nicht mündige Friedrich von Wettin, der Sohn des durch Krankheit verhinderten Friedrich des Streitbaren, des Kurfürsten von Sachsen. Es erschienen – jeder mit einer stattlichen Schar – Raban von Helmstätt, der Bischof von Speyer, Anselm von Nenningen, der Bischof von Augsburg, Friedrich von Aufseß, der Bischof von Bamberg. Johann von Brunn, der Bischof von Würzburg. Thiébaut de Rougemont, der Erzbischof von Bésançon. Es kamen Bewaffnete aus Schwaben, Hessen, Thüringen, aus den Hansestädten im Norden.
Der Kreuzzug begann Anfang Juli in der Woche nach Peter und Paul, man überschritt die Grenze und drang, den Weg mit Leichen und Brandschatzungen pflasternd, tief nach Böhmen ein. Am Mittwoch vor St. Jakobi standen die Kreuzfahrer, verstärkt durch die Kräfte des katholischen böhmischen Landfriedens, vor Mies, wo der hussitische Herr Prybik de Clenove saß, und belagerten die Burg, sie schwer aus Bombarden beschießend. Herr Prybik hielt sich jedoch tapfer und dachte nicht daran, sich zu ergeben. Die Belagerung dauerte an, die Zeit verrann. Der Brandenburger Kurfürst Friedrich verlor die Geduld. Was das denn für ein Kreuzzug sei, rief er, er rate, unverzüglich weiterzuziehen und Prag anzugreifen. Prag, so rief er, sei das caput regni, wer Prag habe, der habe Böhmen …
Heiß und glühend war der Sommer des Jahres 1427.
Aber was taten daraufhin die Gottesstreiter, fragt Ihr? Was geschah mit Prag, fragt Ihr?
Prag …
Prag stank nach Blut.
Erstes Kapitel
in dem Prag nach Blut stinkt und Reynevan verfolgt wird. Dann langweilt ihn der Alltagstrott, er hängt Erinnerungen nach, verspürt Sehnsucht, feiert, kämpft um sein Leben und versinkt in einem Federbett – in dieser Reihenfolge. Im Hintergrund schlägt Europa Purzelbäume, nimmt die Hacken zusammen und quietscht in den Kurven.
Prag stank nach Blut.
Reynevan roch an den Ärmeln seines Wamses. Er hatte gerade das Spital verlassen, und im Spital, wie das in Spitälern nun einmal so ist, wurden fast alle zur Ader gelassen, wurden laufend Geschwüre aufgeschnitten und Amputationen mit der Regelmäßigkeit von guten Werken durchgeführt. Die Kleidung konnte wohl diesen Geruch annehmen, das war nicht gerade außergewöhnlich. Aber sein Wams verströmte nur seinen eigenen Geruch, keinen anderen.
Er hob den Kopf und schnupperte. Von Norden her, vom linken Ufer der Moldau, drang der Geruch von Unkraut und Blattwerk, das man in den Gärten verbrannte. Vom Fluss wurde zudem der Geruch nach Schlamm und Aas hergetragen – es war heiß, der Wasserspiegel hatte sich stark gesenkt, und die freigelegten Ufer und austrocknenden Pfützen vermittelten der Stadt schon seit geraumer Weile unvergessliche olfaktorische Eindrücke. Aber diesmal war es nicht der Schlamm, der stank. Dessen war sich Reynevan sicher.
Ein leichter, sich aber ständig drehender Wind wehte zeitweise von Osten, vom Porzyczker Tor, her. Von Vítkov. Die Erde am Vítkover Hügel könnte gut und gerne Blut ausschwitzen. So viel war davon in den Boden gesickert.
Aber das war doch wohl nicht möglich. Reynevan schob den Riemen der Tasche auf seiner Schulter zurecht und ging mit raschen Schritten die Straße hinunter. Es war ganz einfach nicht möglich, dass es von Vítkov her nach Blut roch. Erstens war es ziemlich weit bis dorthin. Zweitens hatte die Schlacht im Sommer 1420 stattgefunden. Vor sieben Jahren. Sieben langen Jahren.
Energischen Schrittes eilte er an der Heilig-Kreuz-Kirche vorüber. Aber der Blutgeruch verging nicht. Ganz im Gegenteil. Er wurde stärker. Denn plötzlich wehte der Wind von Westen her.
Ha, dachte er, während er zum nahe gelegenen Ghetto hinüberblickte, Steine sind nicht wie der Erdboden, diese alten Ziegelsteine und der Putz hier haben schon viel gesehen, vieles hat sich in ihnen erhalten. Was dort eingedrungen ist, stinkt noch lange vor sich hin. Und dort, bei der Synagoge, in den Gässchen und Häusern ist noch viel mehr Blut geflossen als bei Vítkov. Zu Zeiten, die noch nicht ganz so lange zurückliegen. Im Jahre 1422, während des blutigen Pogroms, während der Unruhen, die in Prag nach der Hinrichtung von Jan Želivský ausgebrochen waren. Prag, erbost über den Tod seines beliebten Volkstribunen, der durch das Schwert umgekommen war, hatte sich erhoben, um sich zu rächen, zu brennen und zu morden. Wie üblich hatte dabei das jüdische Viertel am meisten abbekommen. Die Juden hatten mit der Hinrichtung Želivskýs absolut nichts zu tun und trugen in keiner Weise die Schuld an seinem Tod. Aber wen störte das?
Hinter dem Heilig-Kreuz-Friedhof bog Reynevan ab, ging am Spital vorbei, kam zum Alten Kohlenmarkt, lief über den kleinen Platz, tauchte in Torbögen und enge Durchgänge, die zur Langen Gasse führten. Der Blutgeruch verschwand, er löste sich in einem Meer von anderen Gerüchen auf. Die Torbögen und die Durchgänge stanken nämlich nach allem, was sich denken ließ.
Die Lange Gasse begrüßte ihn sogleich mit ihrem alles beherrschenden, ja geradezu überwältigenden Brotgeruch. An den Bäckerständen, auf den Laden und Bänken erglänzte, prahlte und duftete das berühmte Prager Backwerk, so weit das Auge reichte.
Obwohl er im Spital gefrühstückt hatte und keinen Hunger verspürte, konnte er sich nicht bezwingen – gleich an der ersten Bäckerbude erstand er zwei frische Brötchen. Die Brötchen, die hier calty genannt wurden, hatten eine derart aufdringliche erotische Form, dass Reynevan längere Zeit träumend durch die Lange Gasse wanderte, an Buden stieß, während seine Gedanken in einem wüstenheißen Wirbelsturm um Nicoletta kreisten. Um Katharina von Biberstein. Unter den Fußgängern, in die er in seiner Selbstvergessenheit hineinlief, waren einige überaus attraktive Pragerinnen unterschiedlichsten Alters. Er bemerkte sie nicht. Er entschuldigte sich zerstreut und ging weiter, biss von Zeit zu Zeit von seiner calta ab und betrachtete sie dann wieder gedankenverloren.
Der Altstädter Markt rief ihn mit seinem Blutgeruch in die Realität zurück.
Ha, dachte Reynevan, während er seine calta aufaß, hier ist das vielleicht nicht verwunderlich. Für diese Pflastersteine war Blut nichts Neues. Jan Želivský und neun seiner Gefährten war hier der Kopf abgeschlagen worden, im Alten Rathaus, nachdem man sie an einem Montag im März dorthin gelockt hatte. Als man nach dieser verräterischen Hinrichtung den Fußboden des Rathauses schrubbte, war der blutige Schaum in Strömen unter den Toren hervorgequollen und, wie man hörte, bis zum Pranger in der Mitte des Marktplatzes geronnen, wo er eine große Lache bildete. Kurz darauf, nachdem die Nachricht vom Tode des Tribunen in Prag einen Zornesausbruch und den Ruf nach Rache ausgelöst hatte, war Blut in alle umliegenden Rinnsteine geflossen.
Zur Kirche der Jungfrau Maria vor dem Teyn begaben sich viele Leute, in dem Gewölbe, das zur Kirchenpforte führte, herrschte großes Gedränge. Rokycana predigt, dachte Reynevan. Es wäre eigentlich recht gut zu hören, was Rokycana zu sagen hat. Jan Rokycanas Predigten zu hören, lohnte sich immer. Immer. Besonders jetzt, wo der so genannte Verlauf der Ereignisse in geradezu erschreckendem Tempo Stoff für Predigten lieferte. Es gab wohl genügend Dinge, über die man predigen konnte. Und die man sich unbedingt anhören musste.
Keine Zeit, ermahnte er sich. Es gibt wichtigere Dinge, dachte er. Und es gibt ein Problem.
Es ist darauf zurückzuführen, dass ich verfolgt werde.
Dass man ihn verfolgte, hatte Reynevan schon längst mitbekommen. Gleich nachdem er das Spital verlassen hatte, bei der Heilig-Kreuz-Kirche. Seine Verfolger waren sehr schlau, sie fielen nicht auf und verbargen sich geschickt. Aber Reynevan hatte sie dennoch bemerkt. Denn dies war nicht das erste Mal.
Er wusste im Grunde, wer seine Verfolger waren und in wessen Auftrag sie arbeiteten. Aber das war von geringer Bedeutung.
Er musste sie loswerden. Und er hatte auch schon einen Plan.
Er kam zum gut besuchten, lauten, stinkenden Viehmarkt, mischte sich unter die Menge, die sich zur Moldau und zur Steinernen Brücke hinbewegte. Er wollte verschwinden, und auf der Brücke, jenem schmalen Durchlass, der die Altstadt mit der Kleinseite und dem Hradschin verband, im Gewirr und Getöse, war die Gelegenheit zu verschwinden günstig. Reynevan drängte sich durch die Menschenmenge, rempelte die an ihm Vorbeigehenden an und erntete Flüche.
»Reinmar!« Einer der Angerempelten grüßte ihn mit seinem Taufnamen, statt ihn wie die anderen einen Hurensohn zu nennen. »Bei Gott! Du hier?«
»Ja, ich hier. Hör zu, Radim … Jesses, was stinkt denn hier so entsetzlich?«
»Das …« Radim Tvrdik, ein untersetzter und nicht mehr ganz junger Mann, wies auf den Eimer, den er schleppte. »Das ist Ton und Schlamm. Vom Flussufer. Den brauche ich … Du weißt schon, wozu.«
»Ja, ich weiß.« Reynevan blickte sich nervös um. »Gewiss doch.«
Radim Tvrdik war, wie alle Eingeweihten wussten, ein Magier. Radim Tvrdik war auch, wie einige wenige der Eingeweihten wussten, von der Idee besessen, einen künstlichen Menschen, einen Golem, zu schaffen. Alle, sogar die so gut wie nicht Eingeweihten, wussten, dass es bis dahin nur einmal in fernen Zeiten einem Prager Rabbiner, dessen gewiss verunstalteter Name in den erhalten gebliebenen Dokumenten mit Bar Halevi angegeben wurde, gelungen war, einen Golem zu erschaffen. Jenem Juden, wie man wissen wollte, habe seinerzeit Ton, Schlamm und Schlick vom Grunde der Moldau als Rohstoff zur Erschaffung des Golem gedient. Tvrdik jedoch vertrat als Einziger die Ansicht, nicht die immerhin bekannten Zeremonien und Beschwörungen hätten hierbei die entscheidende Rolle gespielt, sondern eine ganz bestimmte astrologische Konjunktion habe Einfluss auf Schlamm und Ton und deren magischen Eigenschaften. Freilich ohne dabei die geringste Ahnung davon zu haben, um welche konkrete Planetenkonstellation es sich handeln könnte. Tvrdik arbeitete nach dem Ausschlussverfahren – er holte sich Schlamm, sooft es ging, in der Hoffnung, einmal den geeigneten zu finden. Er holte ihn auch von verschiedenen Orten. Heute aber hatte er eindeutig übertrieben – dem Gestank nach zu urteilen, hatte er diesen Schlamm direkt unter einem Scheißhaus hervorgeholt.
»Du bist nicht bei der Arbeit, Reinmar?«, fragte er, sich die Stirn mit dem Handrücken abwischend. »Nicht im Spital?«
»Ich habe mir freigenommen. Es gab nichts zu tun. Ein ruhiger Tag.«
»Geb’s Gott«, der Magier stellte seinen Eimer ab, »dass dies nicht der letzte ruhige ist. Denn die Zeiten sind danach …«
Jeder in Prag wusste, was gemeint war, um was für Zeiten es sich handelte. Aber jeder zog es vor, nicht darüber zu reden. Man brach den Satz einfach ab. Sätze abzubrechen hatte sich in letzter Zeit überraschend schnell verbreitet und war Mode geworden. Die Konvention gebot, als Antwort auf solch einen abgebrochenen Satz eine schlaue Miene aufzusetzen, zu seufzen und bedeutungsvoll zu nicken. Aber dazu hatte Reynevan keine Zeit.
»Geh deines Weges, Radim«, sagte er und blickte sich um. »Ich kann hier nicht stehen bleiben. Und es wäre besser, wenn auch du nicht stehen bliebest.«
»Häää?«
»Ich werde verfolgt. Deshalb kann ich auch nicht zu den Tuchlauben gehen.«
»Du wirst verfolgt?«, wiederholte Radim Tvrdik. »Die Üblichen?«
»Sicher. Mach’s gut.«
»Warte.«
»Worauf denn?«
»Es ist nicht sinnvoll, wenn man versucht, seine Verfolger abzuhängen.«
»Warum denn?«
»Für die Verfolger«, erklärte der Böhme mit bemerkenswertem Scharfsinn, »ist der Versuch, sie abzuschütteln, ein sicheres Zeichen dafür, dass der Verfolgte kein reines Gewissen und etwas zu verbergen hat. Einem Dieb brennt die Kappe. Dass du nicht zu den Tuchlauben gehst, ist vernünftig. Aber schlag keine Haken, verschwinde nicht, versteck dich nicht. Tu das, was du immer tust. Geh deinen Alltagsgeschäften nach. Schläfere die Verfolger durch öde Alltagsroutine ein.«
»Zum Beispiel?«
»Ich habe von der ganzen Schlammschürferei einen trockenen Hals bekommen. Komm mit in den ›Krebs‹. Wir trinken ein Bier.«
»Ich werde verfolgt«, erinnerte Reynevan ihn. »Hast du denn keine Angst, dass …«
»Wovor sollte ich Angst haben?« Der Magier hob seinen Eimer wieder auf.
Reynevan seufzte. Es war nicht das erste Mal, dass ihn die Prager Magier überraschten. Er wusste nicht, ob dies an ihrer außerordentlichen Kaltblütigkeit oder einfach an ihrem mangelnden Vorstellungsvermögen lag, aber einige ortsansässige Magier schien es überhaupt nicht zu kümmern, dass für diejenigen, die sich mit schwarzer Magie befassten, die Hussiten gefährlicher waren als die Inquisition. Maleficium, Zauberei, fiel unter die Todsünden, auf die gemäß dem Vierten Prager Artikel die Todesstrafe stand. Und was die Prager Artikel anbelangte, so waren die Hussiten da keineswegs zu Scherzen aufgelegt. Die Calixtiner von Prag, die sich für die Gemäßigten hielten, standen darin den taboritischen Radikalen und den Fanatikern der Waisen in nichts nach. Ein Magier, den man gefasst hatte, wurde in ein Fass gesteckt und in diesem Fass auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
Sie kehrten zum Markt zurück, schritten durch die Scherenschleifergasse, dann durch die Goldschmiedgasse und die St.-Ägidius-Gasse. Sie gingen langsam. An einigen Ständen blieb Tvrdik stehen und tauschte mit den Krämern, die er kannte, ein paar Neuigkeiten aus. Den Gepflogenheiten entsprechend, wurde nach »heutzutage, in solchen Zeiten …« der Satz abgebrochen und das Abbrechen mehrfach von einer schlauen Miene, Seufzen und Kopfnicken begleitet. Reynevan blickte sich um, aber er konnte seine Verfolger nicht entdecken. Sie verbargen sich zu gut. Er wusste nicht, was sie dachten, aber ihn selbst begann die monotone Routine schon sehr zu langweilen.
Zum Glück gelangten sie kurz darauf, nachdem sie von der St.-Ägidius-Gasse in einen Hof und ein Torgewölbe abgebogen waren, direkt vor das Haus »Zum roten Krebs«. Und zur Schenke, die der Schankwirt, dem jeglicher Erfindungsreichtum fehlte, genauso genannt hatte.
»He! Guckt doch mal! Das ist doch Reynevan!«
Am Tisch, auf einer niedrigen Bank hinter den Pfeilern, saßen vier Männer. Alle trugen Schnurrbärte, hatten breite Schultern und waren nach Ritterart mit Lendnern bekleidet. Zwei von ihnen kannte Reynevan, er wusste, dass es Polen waren. Selbst wenn er es nicht gewusst hätte, hätte er es erraten. Wie alle Polen im Ausland verhielten sich auch jene in der Fremde lärmend, arrogant und demonstrativ rüpelhaft, was ihrer Auffassung nach ihren Stand und ihren hohen gesellschaftlichen Rang hervorheben sollte. Lustig war dabei nur, dass seit Ostern das Ansehen der Polen in Prag sehr niedrig und ihre gesellschaftliche Position noch niedriger war.
»Gelobt sei … Sei uns gegrüßt, ehrenwerter Äskulap!«, begrüßte sie einer von den Polen, den Reynevan unter dem Namen Adam Wejdnar vom Wappen Rawicz kannte. »Setzt euch doch, setzt euch beide! Wir laden euch ein und bewirten euch!«
»Was lädst du denn den so bereitwillig ein?« Der zweite Landsmann, ebenfalls Großpole und Reynevan als Mikołaj Żyrowski vom Wappen Czewoja bekannt, rümpfte mit gespielter Verachtung die Nase. »Hast du zu viele Groschen übrig, oder was? Außerdem versieht dieser Kräuterkundler doch bei den Aussätzigen seinen Dienst! Der steckt uns noch mit der Lepra an! Oder mit etwas noch Scheußlicherem!«
»Ich arbeite nicht mehr im Leprosorium«, erklärte Reynevan geduldig und nicht zum ersten Mal. »Ich praktiziere jetzt im Spital der Bohuslav-Mönche. Hier in der Altstadt. Bei der kleinen Kirche St. Simon und Judas.«
»Ist ja gut, ist ja gut!« Żyrowski, der dies wusste, winkte ab. »Was wollt ihr trinken? Ach verdammt, entschuldigt. Macht euch miteinander bekannt. Die Ritter Jan Kuropatwa von Łańcuchowo vom Wappen Streniawa und Jerzy Skirmunt vom Wappen Odrowąż. Entschuldigt, aber was zum Teufel stinkt denn hier so?«
»Schlamm. Aus der Moldau.«
Reynevan und Radim Tvrdik tranken Bier. Die Polen tranken österreichischen Wein und aßen gedünstetes Lammfleisch und dazu Brot. Sie schwadronierten absichtlich laut und vernehmlich auf Polnisch und erzählten einander mehrere Schnurren, die sie, jede einzelne, mit lautem Gelächter quittierten. Leute, die vorübergingen, wandten sich ab und fluchten leise. Manche spuckten aus.
Seit Ostern, genauer gesagt, seit Gründonnerstag, hatten die Böhmen von den Polen nicht die beste Meinung, und sie standen in Prag in keinem sehr hohen Ansehen. Mit fallender Tendenz.
Mit Zygmunt Korybut, der Einfachheit halber kurz Korybut genannt, Jagiełłos Schwiegersohn und Anwärter auf den böhmischen Königsthron, waren beim ersten Mal etwa fünftausend, beim zweiten Mal etwa fünfhundert polnische Ritter nach Prag gekommen. Auf Korybut hatten viele ihre Hoffnung gesetzt und in ihm die Rettung für die böhmischen Hussiten gesehen, und die Polen hatten tapfer für die Sache des Kelches und das Gesetz Gottes gekämpft und bei Karlstein, Iglau, Rötz und Aussig ihr Blut vergossen. Trotzdem waren sie nicht einmal bei ihren böhmischen Waffenbrüdern sonderlich beliebt. Wie konnte man denn auch Kerle mögen, die laut lachten, wenn sie hörten, dass ihre böhmischen Verbündeten Namen wie Picek von Psikous oder Sadlo von Stare Kobzi trugen? Die mit hemmungslosem Gelächter auf Namen wie Cvok von Chalupy oder Doupa von Zasada reagierten?
Korybuts Verrat hatte der Sache der Polen erheblich geschadet, so viel war klar. Die Hoffnungen der Böhmen waren auf der ganzen Linie dadurch enttäuscht worden, dass dieser Hussitenkönig in spe mit den katholischen Herren paktierte, die Kommunion sub utraque specie verriet und den Schwur auf die Vier Prager Artikel brach. Die Verschwörung war entdeckt und zerschlagen worden, statt auf dem böhmischen Thron landete Jagiełłos Schwiegersohn im Gefängnis, und man begann die Polen als Feinde zu betrachten. Ein Teil von ihnen hatte Böhmen auf der Stelle verlassen. Ein anderer Teil war aber geblieben. Wohl, um der Verachtung für Korybuts Verrat Ausdruck zu verleihen, sich für die Sache des Kelches auszusprechen und zu zeigen, dass man weiterhin für die calixtinische Sache kämpfen wollte. Und was hatte all dies gebracht? Man mochte sie auch weiterhin nicht. Es wurde – nicht ohne Grund – vermutet, dass die calixtinische Lehre den Polen schlichtweg am Arsch vorbeiging. Man behauptete, sie seien geblieben, weil sie – primo – nichts besäßen, zu dem sie hätten zurückkehren können. Nach Böhmen seien sie nur gezogen, weil sie von den Gerichten als Prasser und Verschwender gesucht würden, und nun lasteten auch noch auf allen, Korybut eingeschlossen, Flüche und Verleumdungen. Dass sie – secundo – nur in Böhmen gekämpft hätten, weil sie ausschließlich auf Bereicherung, auf Beute und Besitz ausgewesen seien. Dass sie – tertio – nicht kämpften, sondern lediglich die Abwesenheit der kämpfenden Böhmen ausnutzten, um deren Frauen zu vögeln.
All diese Behauptungen stimmten.
Ein Prager Bürger, der eben vorüberging, spuckte auf den Boden.
»Oho, irgendwie mögen die uns nicht, nein, sie mögen uns nicht«, bemerkte Jerzy Skirmunt vom Wappen Odrowąż mit komischer lang gezogener Artikulation. »Warum wohl? Das ist doch seltsam.«
»Sollen sie sich doch sonst wohin scheren!« Żyrowski warf sich Richtung Straße in die mit den silbernen Hufeisen des Czewoja-Wappens geschmückte Brust. Wie jeder Pole vertrat er die widersinnige Ansicht, dass er als Träger eines Familienwappens, wenn auch völlig pleite, in Böhmen mindestens den Rožmberks, den Kolowrats, den Sternbergs und allen anderen mächtigen Familien zusammen ebenbürtig sei.
»Vielleicht tun sie’s ja auch«, pflichtete ihm Skirmunt bei. »Ja, das ist schon seltsam, ihr Lieben.«
»Die Leute wundert es«, Radim Tvrdik sprach mit ruhiger Stimme, aber Reynevan kannte ihn nur zu gut, »die Leute verwundert der Anblick der ritterlichen und kämpferischen Herren, die sich so sorglos an einem Wirtshaustisch verlustieren. In diesen Tagen! Heutzutage, in solchen Zeiten …«
Er unterbrach sich, wie dies jetzt Sitte war. Aber die Polen waren es nicht gewohnt, derlei Bräuche zu pflegen.
»Solche Zeiten, dass die Kreuzfahrer gegen euch losziehen, um zu kämpfen, was«, lachte Żyrowski, »dass sie mit großer Macht nahen, Feuer und Schwert mit sich führend und Erde und Wasser hinter sich lassend? Bald werden sie …«
»Schweig!«, unterbrach ihn Adam Wejdnar. »Euch aber, Herr aus Böhmen, entgegne ich: Eure Zurechtweisung trifft hier nicht zu. In der Neustadt träfe sie wohl zu, da ist es leer geworden, da sind die Leute weg. Denn, wie Ihr zu sagen beliebtet, heutzutage, in solchen Zeiten, sind die Neustädter Kaufleute mit Prokop dem Kahlen zur Verteidigung des Landes ausgerückt. Hätte mir ein Neustädter so etwas gesagt, hätte ich geschwiegen. Aber hier aus der Altstadt ist doch kaum einer mitgezogen. Ein Esel schilt den anderen ein Langohr, das ist es doch.«
»Eine Streitmacht zieht von Westen heran«, wiederholte Żyrowski, »das ganze Europa! Diesmal werdet ihr nicht standhalten können. Das wird euer Ende sein, dann ist es aus mit euch.«
»Mit uns«, versetzte Reynevan spöttisch, »und mit euch etwa nicht?«
»Mit uns auch«, erwiderte Wejdnar düster und brachte Żyrowski mit einer Handbewegung zum Schweigen. »Mit uns auch. Leider. Es scheint, wir haben uns in diesem Konflikt nicht für die richtige Seite entschieden. Wir hätten darauf hören sollen, was Bischof Łaskarz gepredigt hat.«
»Wohl, wohl«, seufzte Jan Kuropatwa, »ich hätte auf Zbyszek Oleśnicki hören sollen. Jetzt hocken wir hier wie der Ochse im Schlachthaus, und gleich kommt der Metzger. Ein Kreuzzug zieht gegen uns heran, ihr Herren, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Ein Heer von achthunderttausend Mann. Kurfürsten, Herzöge, Pfalzgrafen, Bayern, Sachsen, Bewaffnete aus Schwaben, aus Thüringen, aus den Hansestädten, dazu der gesamte Pilsener Landfrieden, ja sogar noch ein paar Wunderlinge aus Übersee. Anfang Juli haben sie die Grenze überschritten und Mies belagert, das jeden Augenblick fallen kann oder gar schon gefallen ist. Wie weit ist es von Mies bis hierher zu uns? Rund zwanzig Meilen. Nun rechnet es euch selbst aus. In fünf Tagen sind sie hier. Heute ist Montag. Am Freitag sehen wir ihre Kreuze in Prag, denkt an meine Worte.«
»Prokop wird sie nicht aufhalten, sie schlagen ihn im Feld. Er kann ihnen keinen Widerstand leisten. Ihrer sind zu viele.«
»Als die Midianiter und Amalekiter gegen Gilead zogen«, sagte Radim Tvrdik, »waren sie so zahlreich wie die Heuschrecken, und ihre Kamele waren wie Sand am Meer. An der Spitze von nur dreihundert Kriegern hat Gideon sie geschlagen und vertrieben. Weil er im Namen des Herrn Zebaoth gekämpft hat und mit seinem Namen auf den Lippen.«
»Ja, ja, gewiss doch. Und der Schusterjunge Skuba hat den Drachen am Wawelschloss besiegt. Liebwerte Herrn, verwechselt doch nicht Märchen mit der Realität.«
»Die Erfahrung lehrt«, fügte Wejdnar mit einem säuerlichen Lächeln hinzu, »dass der Herr, so er überhaupt Partei ergreift, sich meist auf die Seite des Stärkeren schlägt.«
»Prokop wird die Kreuzfahrer nicht aufhalten«, wiederholte Żyrowski nachdenklich. »Ha, diesmal, mein Herr aus Böhmen, würde euch nicht einmal Žižka persönlich retten können.«
»Prokop hat keine Chance!«, lachte Kuropatwa. »Da gehe ich jede Wette ein. Zu groß ist die Streitmacht, die heranzieht. Am Kreuzzug beteiligt sind Ritter vom Jörgenschild, aus dem Orden vom Schilde St. Georgs, der Blüte der europäischen Ritterschaft. Und der päpstliche Legat führt mehr als hundert englische Bogenschützen an. Hast du schon mal von den englischen Bogenschützen gehört, Böhme? Sie haben Bogen von Mannesgröße, schießen damit auf fünfhundert Schritte, aus dieser Entfernung durchschlagen ihre Pfeile Blech, durchlöchern sie Brustpanzer, als wären es Leinenhemden. Hoho! So ein Bogenschütze schafft es …«
»Schafft es so ein Bogenschütze«, fiel ihm Tvrdik gelassen ins Wort, »auf seinen Beinen zu bleiben, wenn er mit dem Dreschflegel eins über den Schädel gezogen bekommt? Zu uns sind schon viele tüchtige Leute gekommen, Blüten der Ritterschaft jeglicher Art, aber bisher ist uns noch keiner untergekommen, dessen Schädel einem böhmischen Dreschflegel widerstanden hätte. Wollt Ihr eine solche Wette bieten, Herr Pole? Ich behaupte, merkt auf, wenn so ein überseeischer Engländer eins mit dem Flegel über den Schädel gezogen bekommt, dann spannt dieser überseeische Engländer die Sehne kein zweites Mal, weil aus dem überseeischen Engländer ein überseeischer Leichnam geworden ist. Ist dem nicht so, habt Ihr gewonnen. Worum wetten wir?«
»Die ziehen euch das Fell über die Ohren.«
»Das haben sie schon versucht«, bemerkte Reynevan. »Vor einem Jahr. Am Sonntag nach St. Veit. Bei Aussig. Du warst doch bei Aussig dabei, Herr Adam.«
»Das ist wahr«, gab der Großpole zu. »Ich war dabei. Wir alle waren dabei. Und du warst auch dabei, Reynevan. Das hast du doch nicht etwa vergessen?«
»Nein. Das habe ich nicht vergessen.«
Die Sonne brannte fürchterlich, glühende Hitze ergoss sich vom Himmel herab. Die Sicht war ihnen vollständig genommen. Die Staubwolken, welche die Pferdehufe der angreifenden Ritter hatten aufsteigen lassen, mischten sich mit dem dichten Pulverdampf, der nach jeder Salve das ganze Karree der Wagenburg überzog. Über dem Geschrei der Kämpfenden und dem Gewieher der Pferde erhoben sich plötzlich das Geräusch von brechendem Holz und Triumphgeheul. Reynevan sah, wie die Fliehenden aus dem Dunst hervorbrachen.
»Sie sind durchgedrungen«, seufzte Diviš Bořek von Miletínek laut. »Sie haben die Wagenkette gesprengt …«
Hynek von Kolštejn fluchte. Roháč z Dubé versuchte, sein heftig schnaubendes Pferd zu zügeln. Das Antlitz Prokops des Kahlen war wie versteinert. Zygmunt Korybut war leichenblass.
Aus dem Dunst brachen mit lautem Geheul die Panzerreiter, die eisenbewehrten Herren drangen auf die fliehenden Hussiten ein, ritten sie um und metzelten all jene nieder, denen es nicht gelungen war, sich in das Innere der Wagenburg zu retten. Schon gelangten weitere Schwerbewaffnete in großer Anzahl durch die Bresche.
In diese dicht gedrängte Menge hinein, direkt in die Pferdemäuler und in die Gesichter der Reiter, blitzten plötzlich die Haubitzen und Tarrasbüchsen mit Feuer und Blei, krachten die Hakenbüchsen und donnerten die Faustrohre, prasselte ein dichter Hagel von Bolzen aus den Armbrüsten. Reiter stürzten aus den Sätteln, Pferde stürzten, Menschen stürzten zusammen mit ihren Tieren, die Reiterei verkeilte sich ineinander und ballte sich zu einem Knäuel zusammen; in dieses Gewirr hinein schlug die zweite Salve mit noch mörderischerer Wirkung. Nur wenige von den Panzerreitern waren bis ins innere Geviert der Wagen eingedrungen, sie wurden sogleich mit Hellebarden und Dreschflegeln niedergemacht. Gleich darauf brachen die Böhmen mit wildem Geschrei hinter den Wagen hervor, überraschten die Deutschen mit einem gewaltigen Gegenangriff und hatten sie im Handumdrehen aus der Bresche verdrängt. Unverzüglich wurde die Bresche wieder mit Wagen geschlossen, Armbrustschützen und Krieger mit Dreschflegeln besetzten sie. Wieder grollten die Haubitzen, rauchten die Läufe der Hakenbüchsen. Über den Wagenschanzen erglänzte mit blendend goldenem Schein die Monstranz, blitzte das Weiß der Standarte mit dem Kelch auf.
Ktož jsú Boží bojovníci
a zákona jeho,
prostež od Boha pomoci
a úfajte v něho,
že konečnĕ vždycky s ním svítĕzítĕ.
Gesang erklang, schwoll an und erhob sich triumphierend über der Wagenburg. Hinter den auf dem Rückzug befindlichen Panzerreitern legte sich allmählich der Dunst.
Roháč z Dubé wusste schon Bescheid, er wandte sich zu den in Formation wartenden berittenen Hussiten um und hob seinen Streitkolben. Dobko Puchała tat es ihm auf Seiten der polnischen Reiterei kurz darauf gleich. Die mährischen Reiter versetzte eine Geste Jan Tovačovskýs in Kampfbereitschaft. Hynek von Kolštejn senkte das Visier seines Helmes.
Vom Felde her hörte man die Rufe der sächsischen Anführer, die die Panzerreiter zu einem neuerlichen Angriff auf die Wagen aufriefen. Aber die Panzerreiter zogen sich zurück und wendeten die Pferde.
»Fliiieeehhht, fliieehht, ihr Deutschen!«
»Auf siiieee!«
Prokop der Kahle atmete tief durch und hob den Kopf.
»Jetzt …«, keuchte er laut, »jetzt gehören ihre Ärsche uns.«
Reynevan verließ die Polen und Radim Tvrdik ziemlich unverhofft – er stand ganz einfach plötzlich auf, verabschiedete sich und ging. Mit einem kurzen, bedeutsamen Blick signalisierte er Tvrdik den Grund für sein Verhalten. Der Magier blinzelte. Er hatte verstanden.
Die Gegend stank wieder nach Blut. Das kommt gewiss von den nahen Schlachthöfen, von den Hühnerschlachtereien oder vom Fleischmarkt. Aber vielleicht auch nicht? Vielleicht ist das ein ganz anderes Blut?
Vielleicht jenes, das im September 1422 die umliegenden Rinnsteine gefüllt hatte, als die Eisengasse und die daran angrenzenden Gässchen zum Schauplatz brudermörderischer Kämpfe geworden waren, als der Gegensatz zwischen der Altstadt und Tábor erneut in einem bewaffneten Konflikt gipfelte? Viel böhmisches Blut war damals die Eisengasse entlanggeflossen. Genug, um immer noch zu stinken.
Eben dieser Blutgeruch hatte seine Wachsamkeit verstärkt. Seine Verfolger konnte er nicht ausmachen, er bemerkte nichts Auffälliges, keiner der durch die Gässchen schlendernden Böhmen sah wie ein Spitzel aus. Dennoch spürte Reynevan beständig jemandes Blicke in seinem Nacken. Es sah ganz so aus, als wäre sein Verfolger trotz der ermüdenden Routine noch nicht genügend gelangweilt. Na schön, ihr Schurken, dachte er, na schön, dann werde ich euch noch etwas mehr Routine liefern. So viel, dass ihr kotzen werdet.
Er ging die Geißengasse entlang, in der die Buden und Werkstätten der Weißgerber eng nebeneinanderstanden. Ein paar Mal blieb er stehen und tat so, als interessierte er sich für die Waren, während er sich verstohlen umblickte. Er bemerkte niemanden, der aussah, als wäre er ein Spitzel. Aber er wusste, sie waren da.
Noch vor der St.-Gallus-Kirche bog er in ein weiteres Gässchen ein. Er strebte dem Carolinum zu, der Karls-Universität, seiner Alma mater. Der Routine folgend, wandte er sich dorthin, mit der Absicht, einem Disput zu lauschen. Er ging gerne in die Universität zu Disputen und quodlibets. Nachdem er am Sonntag Quasimodogeniti, dem ersten Sonntag nach Ostern, 1426 die Kommunion in beiderlei Gestalt empfangen hatte, besuchte er regelmäßig das lectorium ordinarium. Als wahrer Neophyt wollte er so tief wie möglich in die Geheimnisse und komplizierten Fragen seiner neuen Religion eindringen, und am leichtesten gelang ihm dies durch die dogmatischen Streitgespräche, welche die Vertreter des gemäßigten und des konservativen Flügels, die sich um Meister Jan Přybrama scharten, mit jenen des radikalen Flügels, also Leuten aus den Kreisen von Jan Rokycana und Peter Payne, einem Engländer, Lollarden und Wyclifiten, austrugen. Ein wahrhaftes Feuer entfachten die Dispute aber dann, wenn echte Radikale aus der Neustadt hinzukamen. Dann wurde es erst richtig lustig. Reynevan war Zeuge gewesen, als man den irgendein wyclifitisches Dogma verteidigenden Payne einen »beschissenen Englishman« genannt und mit Rüben beworfen hatte. Als man dem alten Christian von Prachatitz, dem ehrwürdigen Rektor der Universität, damit gedroht hatte, ihn in der Moldau zu ertränken. Als man dem grauköpfigen Peter von Mladoňovice eine tote Katze entgegengeschleudert hatte. Das Publikum lieferte sich regelmäßig Schlägereien, blutige Nasen und ausgeschlagene Zähne gab es auch draußen vor dem Carolinum, auf dem Fleischmarkt.
Seit jenen Zeiten hatte sich aber so manches verändert. Jan Přybrama und die Leute aus seiner Umgebung waren in Korybuts Verschwörung verwickelt gewesen, entlarvt und mit der Vertreibung aus Prag bestraft worden. Da die Natur keine Leere verträgt, hatte man die Dispute fortgesetzt; nach Ostern aber waren Rokycana und Payne plötzlich zu den Gemäßigten und Konservativen übergelaufen. Die Neustädter gaben wie üblich die Radikalen. Und zwar verdammt hartgesottene Radikale. Auf den Disputen wurde nach wie vor geschlägert, mit Schimpfwörtern und mit Katzen um sich geworfen.
»Herr.«
Er wandte sich um. Vor ihm stand ein kleiner Mann, von Kopf bis Fuß grau. Er hatte ein graues Gesicht, ein graues Wams, eine graue Kappe und graue Hosen. Den einzigen lebhafteren Akzent an seiner Person setzte ein funkelnagelneuer Schlagstock aus hellem Holz.
Er drehte sich erneut um, weil er hinter seinem Rücken ein Geräusch vernommen hatte. Der zweite Ganove, der ihm den Weg aus der Gasse abschnitt und ebenfalls einen Schlagstock trug, war ein bisschen größer und etwas bunter gekleidet. Dafür hatte er aber auch die verbotenere Visage.
»Gehen wir, Herr«, sagte der Graue, ohne die Augen zu heben.
»Wohin denn? Und wozu?«
»Leistet keinen Widerstand, Herr.«
»Wer schickt euch?«
»Der gnädige Herr Neplach. Gehen wir.«
Wie sich herausstellte, hatten sie nicht weit zu gehen. Bis zu einem der Häuser an der Südseite des Altstädter Marktes. Reynevan gelang es nicht, sich genau zu merken, in welches sie gingen; die Spitzel führten ihn durch den Hintereingang, dann durch finstere, nach verfaulter Gerste stinkende Erdgeschosse, Höfe, Durchgänge und über Stiegen. Das Innere der Wohnung war recht ansehnlich – wie die Mehrzahl der Häuser in dieser Gegend war auch dieses von reichen Deutschen erbaut worden, die nach 1420 aus Prag geflohen waren.
Bohuchval Neplach, genannt Filou, erwartete ihn in der Stube. Unter der Sturzdecke aus hellen Balken. An einem Balken war ein Strick befestigt. An diesem Strick baumelte ein Mann. Die Spitzen der eleganten Schnabelschuhe berührten den Boden. Fast. Es fehlten etwa zwei Zoll.
Ohne sich mit einer Begrüßung oder anderen kleinbürgerlichen Sitten aufzuhalten, ja beinahe ohne Reynevan auch nur eines Blickes zu würdigen, wies Filou mit dem Finger auf den Gehenkten. Reynevan wusste, worum es ging.
»Nein …«, er schluckte, »das ist er nicht. Eher nicht …«
»Sieh ihn dir genau an.«
Reynevan hatte ihn sich bereits so genau angesehen, dass er diese Schnur, die in den aufgequollenen Hals schnitt, das zur Fratze verzogene Gesicht, die hervorquellenden Augen und die heraushängende schwarze Zunge während seiner nächsten Mahlzeiten bestimmt vor Augen haben würde.
»Nein. Nicht der … Außerdem, was weiß ich … Ich habe ihn ja nur von hinten gesehen …«
Neplach schnippte mit den Fingern. Die aufmerksamen Knechte in der Stube drehten den Gehenkten mit dem Rücken zu Reynevan.
»Er saß, und er trug einen Mantel.«
Neplach schnippte wieder mit den Fingern. Kurz darauf saß der vom Strick geschnittene und mit einem Mantel versehene Leichnam zusammengesunken auf einem Stuhl, eine recht makabere Pose im Hinblick auf den rigor mortis.
»Nein.« Reynevan schüttelte den Kopf. »Wohl nicht. Den … Hmmm … An der Stimme hätte ich den bestimmt erkannt …«
»Tut mir leid.« Filous Stimme war so eisig wie der Wind im Februar. »Aber da kann man nichts machen. Wenn er ein Wort herausbringen könnte, hätte ich dich überhaupt nicht gebraucht. Vorwärts, bringt das Rabenaas da weg.«
Der Befehl wurde blitzschnell ausgeführt. Filous Befehle wurden stets blitzschnell ausgeführt. Bohuchval Neplach, genannt Filou, war das Haupt von Spionage und Gegenspionage der Taboriten und unterstand Prokop dem Kahlen direkt. Zu Lebzeiten Žižkas war er diesem unmittelbar untergeordnet gewesen.
»Setz dich, Reynevan.«
»Ich hab keine Zei…«
»Setz dich, Reynevan.«
»Wer war der …«
»Der Gehenkte? Das ist doch im Augenblick überhaupt nicht von Bedeutung.«
»War er ein Verräter? Ein katholischer Spion? Er war schuldig, wenn ich das recht verstehe?«
»Hä?«
»Ich frage, ob er schuldig war.«
»Geht es dir um die Eschatologie? Um die Lehre von den letzten Dingen? Wenn ja, kann ich mich lediglich auf das nicäische Credo berufen: Jesus starb, gekreuziget unter Pontius Pilatus, aber er ist auferstanden, und von dannen wird er kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ein jeglicher wird gerichtet werden, für seine Gedanken und für seine Taten. Und dann wird entschieden, wer schuldig ist und wer nicht. Das wird, wenn ich es so ausdrücken darf, am Ende entschieden.«
Reynevan seufzte und schüttelte den Kopf. Er war selbst schuld. Er kannte Filou. Er hätte nicht fragen dürfen.
»Es ist also unwichtig«, Filou machte eine Kopfbewegung hin zu dem Balken und dem abgeschnittenen Strick, »wer er war. Wichtig ist, dass es ihm noch gelungen ist, sich aufzuhängen, bevor wir seine Tür aufbrechen konnten. Dass ich es nicht geschafft habe, ihn zum Reden zu bringen. Und dass du ihn nicht identifizieren konntest. Du behauptest, er ist es nicht. Er ist nicht der, den du belauscht hast, der in Schlesien an der Verschwörung mit dem Breslauer Bischof beteiligt war. Richtig?«
»Richtig.«
Filou maß ihn mit tückischem Blick. Filous Augen, schwarz wie die eines Marders, die neben der Nase wie die Lauföffnungen zweier Hakenbüchsen zu zielen schienen, waren zu äußerst tückischen Blicken fähig. Es kam vor, dass in Filous schwarzen Augen zwei kleine goldfarbene Teufelchen aufleuchteten, die plötzlich wie auf Befehl gleichzeitig Kobolz schossen. Reynevan hatte dies schon gesehen. Stets kündigten sich dadurch sehr unangenehme Dinge an.
»Ich denke«, sagte Filou, »dass dies nicht stimmt. Ich denke, dass du lügst. Dass du von Anbeginn an lügst, Reynevan.«
Wie Filou zu Žižka gekommen war, wusste niemand. Selbstverständlich kursierten Gerüchte darüber. Eines von ihnen besagte, Bohuchval Neplach heiße mit richtigem Namen Jehoram ben Jizhak und sei Jude, ein Schüler der Rabbinerschule, den die Hussiten während des Blutbads im Ghetto von Komotau im März 1421 zum Zeitvertreib verschont hätten. Einem anderen Gerücht zufolge hieß er in Wirklichkeit Gottlob und war Deutscher, ein Kaufmann aus Pilsen. Man hörte aber auch, er sei Mönch gewesen, ein Dominikaner, den Žižka persönlich aus unerfindlichen Gründen vor dem Massaker an Priestern und Mönchen in Beraun gerettet habe. Es wurde auch behauptet, Filou sei Propst in Tschaslau gewesen, habe beizeiten den Konjunkturumschwung gewittert, sei zu den Hussiten übergelaufen und Žižka so gründlich in den Arsch gekrochen, dass er schließlich einen Posten bekommen habe. Reynevan war geneigt, dieser letzten Version noch am ehesten Glauben zu schenken. Filou musste Priester gewesen sein, dafür sprachen seine schurkische Verlogenheit, seine Janusköpfigkeit, sein entsetzlicher Egoismus und seine schier unvorstellbare Gier.
Jener Gier verdankte Bohuchval Neplach auch seinen Spitznamen. Als nämlich im Jahre 1419 die katholischen Herren Kuttenberg, das Silberbergwerkszentrum in Böhmen, besetzt hatten, begann das von den Kuttenberger Bergwerken und der dortigen Münzstätte abgeschnittene hussitische Prag, eigenes Geld zu prägen, Kupfergeld mit geringem Silberanteil. Das waren erbärmliche Münzen, praktisch wertlos und von einer Parität, die gen null tendierte. Daher verachtete man die Prager Münzen und nannte sie verächtlich Filous. Kaum hatte Bohuchval Neplach unter Žižka den Posten des Chefs der Geheimpolizei erhalten, wurde ihm der Spitzname Filou sofort und wie selbstverständlich angehängt. Denn es zeigte sich bald, dass Bohuchval Neplach für den kleinsten Filou zu allem bereit war. Genauer gesagt, Bohuchval Neplach war immer bereit, sich nach jedem noch so kleinen Filou zu bücken, und wenn er ihn aus einem Scheißhaufen aufklauben musste. Und dass Bohuchval Neplach keinen Filou verachtete – niemals – und dass er keine Gelegenheit verstreichen ließ, auch nur einen Filou zu stehlen oder abzuzweigen.
Wie es Filou gelungen war, seine Stellung bei Žižka, der in seinem Neuen Tábor Betrüger streng bestrafte und Diebstahl mit eiserner Hand unterband, zu sichern, blieb ein Rätsel. Auch insofern, da später der nicht minder prinzipientreue Prokop der Kahle Filou duldete. Es gab hierfür nur eine Erklärung – in dem, was Bohuchval Neplach für Tábor tat, war er ein Fachmann. Und Fachleuten sieht man vieles nach. Muss man vieles nachsehen. Denn Fachleute sind dünn gesät.
»Wenn du es genau wissen willst«, Filou ergriff wieder das Wort, »so habe ich deinem Bericht wie letztendlich auch deiner Person von Anfang an nur ein ganz geringes Maß an Vertrauen entgegengebracht. Geheime Zusammenkünfte, Beratungen im Verborgenen, weltumfassende Verschwörungen, das sind Dinge, die sich in der Literatur recht gut machen, die, sagen wir mal, einem Wolfram von Eschenbach gut anstehen; gewiss, bei Wolfram liest man mit Vergnügen von Geheimnissen und Verschwörungen … Vom Gralsmysterium, von der Terre de Salvaesche, von diversen Klingsors, Flagetanis, Feirefizen und Titurels. Deine Berichte enthielten ein bisschen viel von Literatur dieser Art. Mit anderen Worten, ich denke, dass du ganz einfach gelogen hast.«
Reynevan erwiderte nichts. Er zuckte nur mit den Achseln. Ziemlich vielsagend.
»Gründe für deine zusammenphantasierten Geschichten mag es viele geben«, fuhr Neplach fort. »Aus Schlesien bist du geflohen, wie du behauptest, weil man dich verfolgt hat und dir der Tod drohte. Wenn das wahr ist, dann hattest du gar keine andere Möglichkeit, als dich in Ambros’ Gunst einzuschmeicheln. Und wie hättest du das besser bewerkstelligen können, als ihn vor einem Anschlag zu warnen, der ihm angeblich bevorstand? Daraufhin hat man dich zu Prokop gebracht. Prokop vermutet hinter Flüchtlingen aus Schlesien für gewöhnlich Spione, er hängt daher einfach alle auf und kommt so per saldo auf seine Kosten. Wie hast du da wohl deine Haut retten können? Zum Beispiel, indem du deine sensationelle Nachricht über ein geheimes Treffen und eine Verschwörung verkündetest. Was meinst du, Reynevan? Wie klingt das?«
»Wolfram von Eschenbach wäre vor Neid erblasst. Und das Turnier auf der Wartburg hättest du in null Komma nichts gewonnen.«
»Gründe, dir etwas auszudenken«, fuhr Filou ungerührt fort, »hattest du mehr als genug. Aber ich denke, in Wirklichkeit gab es nur einen.«
»Klar.« Reynevan wusste nur zu gut, worum es ging. »Einen.«
»Mir leuchtet am meisten die Annahme ein«, in Filous Augen erschienen zwei kleine goldene Teufelchen, »dass deine Schwindeleien nur dazu da sind, von der Hauptsache abzulenken. Von den fünfhundert Gulden, die dem Steuereinnehmer geraubt worden sind. Was sagst du dazu, Medicus?«
»Das, was ich immer sage.« Reynevan gähnte. »Das haben wir doch längst durchgekaut. Deine üblichen, langweiligen Fragen beantworte ich wie üblich und genauso langweilig. Nein, Bruder Neplach, ich werde das Geld, das dem Steuereinnehmer geraubt worden ist, nicht mit dir teilen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens habe ich dieses Geld nicht, weil ich es nicht geraubt habe. Zweitens …«
»Und wer hat es geraubt?«
»Meine stinklangweilige Antwort ist: Ich weiß es nicht.«
Die beiden Teufelchen begannen zu hüpfen und kräftig Kobolz zu schießen.
»Du lügst!«
»Na klar. Kann ich gehen?«
»Ich habe Beweise dafür, dass du lügst.«
»Oho!«
»Du gibst an«, Filou durchbohrte ihn mit seinem Blick, »deine mysteriöse Zusammenkunft habe am dreizehnten September stattgefunden, und Kaspar Schlick habe daran teilgenommen. Aus erster Quelle weiß ich aber, dass Kaspar Schlick am dreizehnten September 1425 in Buda war. Er kann daher nicht in Schlesien gewesen sein.«
»Deine Quellen sind einen Dreck wert, Neplach. Aber was soll’s, das ist eine Provokation. Du versuchst, mich zu überlisten, mich festzunageln. Nicht zum ersten Mal. Stimmt’s?«
»Stimmt.« Filou zuckte nicht mit der Wimper. »Setz dich, Reynevan. Ich bin noch nicht fertig mit dir.«
»Ich habe das Geld des Steuereinnehmers nicht, und ich weiß auch nicht …«
»Halt die Klappe!«
Eine Zeit lang schwiegen sie. Die Teufelchen in Filous Augen beruhigten sich, ja, sie waren fast ganz verschwunden. Aber Reynevan ließ sich nicht täuschen. Filou kratzte sich an der Nase.
»Wenn Prokop nicht wäre …«, sagte er leise. »Wenn Prokop mir nicht verboten hätte, euch auch nur mit dem kleinen Finger anzurühren, dich und deinen Scharley, dann würde ich schon aus dir herauspressen, was notwendig ist. Bei mir haben noch alle gesungen; es hat nicht einen gegeben, der geschwiegen hätte. Du kannst gewiss sein, auch du würdest sagen, wo das Geld ist.«
Reynevan hatte schon so einiges gelernt, er ließ sich nicht erschrecken. Er zuckte mit den Achseln.
»Jaaa«, sagte Neplach nach einer weiteren Pause und blickte auf den Strick, der vom Balken herabhing. »Auch der hätte geredet, auch aus dem hätte ich ein Geständnis herausgepresst. Schade, wirklich schade, dass er es geschafft hat, sich aufzuhängen. Weißt du, eine Zeit lang habe ich wirklich gedacht, dass er in dieser Scheune gewesen ist … Ich bin sehr enttäuscht, dass du ihn nicht erkannt hast …«
»Dauernd muss ich dich enttäuschen. Das tut mir wirklich leid.«
Die Teufelchen begannen, sachte zu hüpfen.
»Wirklich?«
»Wirklich. Du verdächtigst mich, lässt mich verfolgen, liegst auf der Lauer, provozierst. Du stellst meine Motive in Frage, und dabei vergisst du ständig das eine und Wichtigste: Jener Böhme, der bei der Verschwörung in der Scheune dabei war, hat meinen Bruder verraten, hat seinen Tod durch die Häscher des Bischofs von Breslau verursacht. Und hat sich dessen auch noch vor dem Bischof gerühmt. Wenn der an diesem Balken gehangen hätte, hätte ich mit keinem Groschen für eine Dankesmesse gegeizt. Glaub mir, mir tut es auch leid, dass er es nicht war. Und auch keiner von denen, die du mir bei anderer Gelegenheit gezeigt und die zu identifizieren du mir nahegelegt hast.«
»Stimmt«, gab Filou nach einigem gewiss nur vorgetäuschten Nachdenken zu. »Früher hatte ich auf Diviš Bořek von Miletínek gesetzt. Mein zweiter Kandidat war Hynek von Kolštejn … Aber von denen ist es keiner …«
»Fragst du, oder stellst du Behauptungen auf? Denn ich habe dir bereits hundertmal erklärt, dass es keiner von denen ist.«
»Ja, du hast sie dir ja beide gut angesehen … Damals. Als ich dich mitgenommen habe …«
»Nach Aussig. Ich hab’s nicht vergessen.«
Der gesamte sanft geschwungene Hang war mit Leichen übersät, aber ein wahrhaft makaberer Anblick bot sich ihnen erst, als sie auf das Flüsschen Zdiřnica hinabblickten, das unten im Tal dahinfloss. Hier türmten sich, teilweise in den vom Blut geröteten Schlamm eingegraben, Berge von Toten, Menschenleiber und Pferdekadaver wüst durcheinander. Was hier geschehen war, war klar zu erkennen. Die sumpfigen Ufer hatten die vom Schlachtfeld fliehenden Sachsen und Meißner aufgehalten, lange genug, um von der taboritischen Reiterei und gleich dahinter einer brüllenden Horde von Reisigen eingeholt werden zu können. Die berittenen Böhmen, Polen und Mähren hatten nicht lange gefackelt, sie erschlugen, was ihnen unter die Schwerter kam, und nahmen dann sofort die Verfolgung der in Richtung Aussig Fliehenden wieder auf. Die Reisigen der Hussiten, Taboriten und Waisen hingegen machten am Fluss Halt. Sie erschlugen oder erstachen alle Deutschen. Systematisch, die Ordnung wahrend, kreisten sie sie ein, trieben sie zusammen, und dann verrichteten die Dreschflegel, Morgensterne, Hellebarden, Wurfspieße, sudlice genannt, Breitbeile, Speere und Forken ihr Werk.
Verschont wurde niemand. Die nach dem Gemetzel von Kopf bis Fuß mit Blut besudelten und singend und grölend zurückkehrenden Gottesstreiter hatten keine Gefangenen gemacht.
Am anderen Ufer der Zdiřnica, an der Straße nach Aussig, hatten Reiterei und Fußvolk noch zu tun. Aus den Staubwolken erscholl das Klirren von Eisen, das Geräusch von Hieben und Geschrei. Schwarzer Rauch kroch am Boden dahin, die Dörfer Předlice und Habrovice am anderen Ufer des Flüsschens brannten, auch dort dauerte, dem Lärm nach zu urteilen, das Gemetzel an.
Pferde schnaubten, schüttelten unruhig die Köpfe, legten die Ohren an, drängten seitwärts und stampften. Die sengende Hitze setzte ihnen zu.
Waffenklirrend und Staub aufwirbelnd kamen ihnen Reiter entgegen, unter ihnen Roháč z Dubé, Wyszek Raczyňski, Jan Bleh z Těšnice und Puchała.
»Schon fast alles vorüber!« Roháč räusperte sich, spuckte aus und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. »Es waren an die dreizehntausend. Nach ersten Berechnungen haben wir etwa dreieinhalbtausend von ihnen erledigt. Bisher zumindest. Denn dort drüben sind sie ja noch bei der Arbeit. Die Pferde der Sachsen sind müde. Die entkommen uns nicht. Da können wir die Rechnung noch ein bisschen nachbessern. Ich schätze, wir werden wohl so an die viertausend erschlagen haben.«
»Das ist vielleicht nicht gerade Grunwald«, Dobko Puchała lachte und zeigte dabei die Zähne, das Wieniawa-Wappen war unter der Schicht aus blutigem Schlamm fast nicht mehr zu erkennen, »das ist vielleicht nicht gerade Grunwald, aber toll ist es schon. Nicht wahr, Herr Fürst?«
»Herr Prokop!« Korybut tat so, als hätte er dies nicht gehört. »Ist es nicht an der Zeit, christliche Nächstenliebe zu üben?«
Prokop der Kahle gab keine Antwort. Er lenkte sein Pferd den Hang hinab, der Zdiřnica zu. Mitten durch die Leichen hindurch.
»Nächstenliebe hin, Nächstenliebe her«, brummte der etwas weiter hinten reitende Jakoubek von Vřesovice, der Hetman von Bilin. »Aber Geld ist Geld! Das ist doch nun wirklich schade! Guckt doch mal, der hier, der ohne Kopf, hat gekreuzte güldene Gabeln auf seinem Wappenschild. Das heißt, der ist ein Kalckreuth. Das wäre ein Lösegeld von wenigstens hundert Schock alte Groschen. Der hier, dem die Därme rausgequollen sind, mit dem Winzermesser im diagonalen Feld, ist ein Dietrichstein. Ein namhaftes Geschlecht, wenigstens dreihundert …«
»Ein versilberter Balken auf schwarzem Feld«, bemerkte Jakoubek von Vřesovice gleichmütig, ein Kenner von Heraldik und Ökonomie gleichermaßen, wie sich erwies. »Das heißt, das ist ein Nesselrode. Von der gräflichen Linie. Fünfhundert hätten wir für diesen Strolch gekriegt. Wir verschwenden hier Geld, Bruder Prokop.«
Prokop der Kahle wandte ihm sein Bauerngesicht zu.
»Gott ist der Richter«, erwiderte er heiser. »Die, die hier liegen, haben nicht sein Zeichen auf ihrer Stirn getragen. Ihre Namen standen nicht im Buch der Lebenden.«
»Außerdem«, versetzte er nach einer Weile bedeutungsvollen Schweigens, »haben wir sie nicht hierhergebeten.«
»Neplach?«
»Was willst du?«
»Du lässt mich immer noch bespitzeln. Deine Häscher sind mir stets auf den Fersen. Wirst du mich auch weiterhin verfolgen lassen?«
»Warum fragst du?«
»Weil mir scheint, dass es keinen Grund dafür gibt …«
»Reynevan, versuche ich etwa, dir beizubringen, wie man Schröpfköpfe setzt?«
Sie schwiegen eine Zeit lang. Filou ließ seinen Blick wieder zu dem abgeschnittenen Strick hinwandern, der vom Deckenbalken herabhing.
»Die Ratten verlassen das sinkende Schiff«, sagte er nach einigem Nachdenken. »Nicht nur in Schlesien verschwören sich die Ratten in Scheunen und Schlössern, sehen sich nach ausländischer Protektion um und kriechen den Bischöfen und Herzögen in die Ärsche. Denn ihr Schiff sinkt, ihnen geht der Arsch auf Grundeis, denn jetzt sind sie mit ihren trügerischen Hoffnungen am Ende. Denn wir steigen empor, und sie sinken herab, in die Kloake! Korybut ist umgefallen, vor Aussig hat es ein Pogrom und Massaker gegeben, die Österreicher haben bei Zwettl eins aufs Haupt gekriegt und sind erledigt. In der Lausitz brennt es bis nach Görlitz hinein. Ungarisch-Brod und Pressburg schlottern vor Angst, Olmütz und Tyrnau zittern hinter ihren Mauern. Prokop triumphiert.«
»Vorläufig.«
»Was heißt vorläufig?«
»Na, dort, bei Mies … In der Stadt sagen sie …«
»Ich weiß, was sie in der Stadt sagen.«
»Gegen uns zieht ein Kreuzzug heran.«
»Das ist normal.«
»Es heißt, ganz Europa …«
»Nicht ganz.«
»Achtzigtausend Bewaffnete …«
»Das stimmt einen Dreck. Dreißigtausend, höchstens.«
»Aber sie sagen doch …«
»Reynevan«, unterbrach ihn Filou in aller Gemütsruhe, »überleg doch mal. Wenn es wirklich bedrohlich wäre, wäre ich dann noch hier?«
Wieder schwiegen sie ein Weilchen.
»Außerdem wird sich die Angelegenheit jeden Moment aufklären«, sagte der Chef der taboritischen Geheimpolizei. »Jeden Moment. Hörst du?«
»Was? Wie? Woher?«
Neplach brachte ihn mit einer Geste zum Schweigen. Er wies zum Fenster hin. Er bedeutete ihm, zu lauschen.
Die Glocken von Prag ergriffen das Wort.
Die Neustadt begann. Als erste Kirche läutete Maria auf dem Rasen, gleich darauf die Kirche des Emmaus-Klosters, kurz danach ertönten die Glocken von St. Wenzel am Zderaz, St. Stephan stimmte in den Chor ein, nach ihm St. Adalbert und St. Michael, dann singend und klingend Maria Schnee. Kurz darauf erklang das Glockengeläut aus der Altstadt. Als Erstes ertönte das von St. Ägidius, darauf das von St. Gallus und schließlich laut und triumphierend das der Jungfrau Maria vor dem Teyn. Dann stimmten die Glocken auf dem Hradschin ein, St. Benedikt, St. Georg und die Allerheiligenkirche.
Im Goldenen Prag hatten die Glocken zu singen begonnen.
Auf dem Altstädter Markt herrschte ein schreckliches Gedränge und Gerangel. Vor dem Rathaus wogte eine Volksmasse, die Menge ballte sich vor den Türen zusammen. Die Glocken läuteten immer noch. Es war ein unglaublicher Lärm. Die Leute drängten, schrien sich gegenseitig nieder, gestikulierten, überall sah man nur noch verschwitzte Gesichter, rot vor Anstrengung und Erregung, und offene Münder. Fiebrig glänzende Augen.
»Was ist denn los?« Reynevan fasste einen nach Säure stinkenden Gerber am Ärmel. »Nachrichten? Gibt es Nachrichten?«
»Bruder Prokop hat die Kreuzfahrer geschlagen! Bei Tachau! Er hat ihnen aufs Haupt geschlagen, hat sie bezwungen!«
»Hat es eine offene Feldschlacht gegeben?«
»Was denn für eine Feldschlacht!«, schrie neben ihm ein Kerl, der, wie man sah, geradewegs aus der Barbierstube herausgesprungen war, das Gesicht noch halb mit Barbierschaum bedeckt. »Was denn für eine Schlacht! Ausgerissen sind sie! Hals über Kopf! In wilder Flucht!«
»Sie haben alles zurückgelassen!«, plärrte ein Handwerksbursche erregt. »Ihre Waffen, ihre Büchsen, ihre Habe, ihre Spieße! Geflohen sind die Papisten bei Tachau! Bruder Prokop ist der Sieger! Der Kelch ist der Sieger!«
»Was schwatzt ihr denn da! Sie sind geflohen? Ohne jede Schlacht?«
»Geflohen sind sie, geflohen! Und auf der Flucht von den Unseren ganz furchtbar verhauen worden! Tachau wird belagert, die Herren vom Landfrieden werden auf der Burg belagert! Bruder Prokop beschießt die Mauern mit seinen Bombarden, heute oder morgen kriegt er die Stadt! Bruder Jakoubek von Vřesovice verfolgt und bezwingt Herrn Heinrich von Plauen!«
»Still! Seid alle still! Bruder Jan kommt.«
»Bruder Jan! Bruder Jan! Und die Ratsherren!«
Die Türen des Rathauses öffneten sich, und eine Gruppe von Leuten trat auf die Stufen.