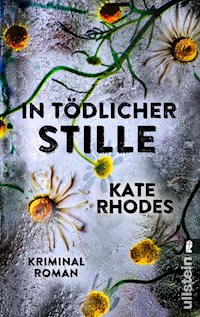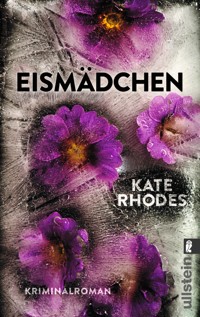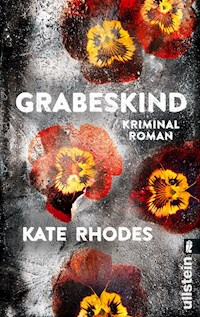
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Jude Shelley, die Tochter eines hochrangigen Politikers, hatte ihr ganzes Leben vor sich. Bis zu der Nacht, in der ein brutaler Serienmörder sie angreift. Schwer verletzt lässt er sie in der Themse zurück. Wie durch ein Wunder überlebt sie - ist jedoch schwer entstellt. Ihre Familie bittet Psychologin Alice Quentin, den Fall zu übernehmen. Wenig später wird am Westminster Pier die Leiche eines Priesters angespült. Der Fluss hat schon immer Opfer gefordert, aber nun scheint ein Mörder nachzuhelfen. Alice ist sich sicher, dass Jude und ihre Familie mehr wissen, als sie sagen. Aber wenn sie ihnen ihr Geheimnis nicht entlocken kann, wird es weitere Tote geben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Jude Shelley, die Tochter eines hochrangigen Politikers, hatte ihr ganzes Leben vor sich. Bis zu der Nacht, in der ein brutaler Serienmörder sie angreift. Schwer verletzt lässt er sie in der Themse zurück. Wie durch ein Wunder überlebt sie – ist jedoch entstellt. Ihre Familie bittet Psychologin Alice Quentin, den Fall zu übernehmen.
Der Fall laugt Alice aus, nicht zuletzt weil sie mit Detective Burns ermitteln muss. Die gemeinsame Geschichte der beiden ist nicht ganz unkompliziert.
Als wenig später am Westminster Pier die Leiche eines Priesters angespült wird, wird es gefährlich für das Ermittlerduo. Der Fluss hat schon immer Opfer gefordert, aber nun scheint ein Serienmörder nachzuhelfen. Alice ist sich sicher, dass Jude und ihre Familie mehr wissen, als sie sagen. Wenn sie ihnen ihr Geheimnis nicht entlocken kann, wird es weitere Tote geben …
Die Autorin
Kate Rhodes wurde in London geboren. Sie ist promovierte Literaturwissenschaftlerin und lehrte jahrelang an amerikanischen und britischen Universitäten. Für ihre Lyrik wird sie von der Presse hoch gelobt und erhält regelmäßig Preise. Sie lebt in Cambridge, am Ufer des Flusses, für dessen Erkundung sie sich extra ein Kanu zugelegt hat. Ihre Serie um die Kriminalpsychologin Alice Quentin ist eine der größten Entdeckungen im englischen Kriminalroman.
Von Kate Rhodes sind in unserem Hause bereits erschienen:
In der Serie »Ein Alice-Quentin-Thriller«:Im TotengartenBlutiger EngelEismädchenGrabeskind
Kate Rhodes
Grabeskind
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Uta Hege
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
ISBN 978-3-8437-1396-2
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016© 2015 by Kate RhodesTitel der englischen Originalausgabe: River of Souls (Mulholland Books at Hodder & Stoughton, London)Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®, München
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Für meine Schwester Honor Rhodes, die nicht nur Trägerin des Order of the British Empire, sondern auch meine Lieblingsgeschichtsexpertin ist.
»Der Fluss hatte etwas Grauenhaftes, die Gebäude an seinen Ufern waren in schwarze Leichentücher gehüllt, und die widergespiegelten Lichter sahen aus, als stiegen sie aus der Tiefe des Wassers empor und würden von den Geistern der Selbstmörder gehalten, die zeigen wollten, wo sie untergegangen waren. Mond und Wolken waren in ihrem Ungestüm so ruhelos wie ein schlechtes Gewissen in einem zerwühlten Bett, und es war, als lastete der Schatten Londons in seiner riesenhaften Ausdehnung bedrückend auf dem Fluss.«
Charles DickensReisender ohne Gewerbe – Nachtstücke
1
Die Strömungen der Themse sind gewaltig, und bald schon wird der Fluss zurückrasen in Richtung Meer. Der nicht enden wollende Regen hat die glatte Oberfläche aufgewühlt, und die Lichter, die sich darauf spiegeln, sehen aus wie verschwommene Silberflecken. Der Mann am Ufer blickt über das mondbeschienene Wasser und lauscht den Stimmen der Ertrunkenen. Sie flehen ihn bei Nacht mit leisen Flüsterstimmen an, sich ihrer zu erinnern. Er hat Stunden für den Weg zu Fuß hierher gebraucht und dabei eine Litanei von Brücken aufgesagt: Lambeth, Vauxhall, Chelsea, Albert, Battersea. Der Marsch hat ihn erschöpft, aber die erste Seele ist zum Greifen nah. Das spürt er daran, dass sein Atem schneller geht und sein Herz vor Aufregung in seiner Brust pulsiert.
Es ist schon spät, als er das Friedhofstor passiert. Das Rauschen des Verkehrs in der Battersea Church Road in den Ohren, geht er an den Grabsteinen, die aufrecht wie Soldaten stehen oder wie gefallene Krieger auf dem Schlachtfeld links und rechts des Wegs liegen, vorbei, bis er das Gotteshaus erreicht. Es stinkt nach Weihrauch und nach schalem Messwein, und die hellen Lichter in der Kirche blenden ihn. Er setzt sich in die letzte Bank und legt den Kopf in seine Hände, bis er eine Männerstimme vernimmt.
Ein ältlicher, weißhaariger Priester sieht auf ihn herab. Nur die Augen in dem hageren Gesicht des Mannes sind bemerkenswert. Sie sind kornblumenblau und strahlen eine unglaubliche Ruhe aus. »Ich habe Sie schon mal gesehen, nicht wahr? Sie sind ja vollkommen durchnässt. Kommen Sie mit in die Sakristei, mein Freund. Dort liegen ein paar Handtücher.«
Staubpartikel hängen in der Luft. Nach einem Augenblick vollkommener Stille saust dem Gottesmann der Hammer auf den Kopf. Er trifft ihn an der Schläfe und lässt ihn vornüberfallen. Der Mann folgt den Befehlen, die der Fluss ihm gibt, und zerrt sein Opfer quer über den Friedhof, bis es ohnmächtig am Rand des Wassers liegt. Obwohl er sich für diesen Augenblick gewappnet hat, ruft der Gedanke an die Aufgaben, die er erledigen muss, eisiges Entsetzen in ihm wach. Wenn er könnte, würde er den Priester einfach liegenlassen, damit er sich von dem Schlag erholen könnte, aber die Entscheidung liegt nun einmal nicht bei ihm.
Der nächste Schritt erfordert höchste Präzision. Er hört ein splitterndes Geräusch, gefolgt von einem lauten Schrei, als er dem alten Mann den Meißel in den Schädel rammt. Jetzt muss er sich beeilen, damit die Sache abgeschlossen ist, bevor der Geist entweichen kann. Der Priester ist bewusstlos, als der Mann das Teppichmesser über seine Braue und die Wange bis zu seinem Kiefer führt und Schnitt um Schnitt die Haut von seinen Knochen löst. Übelkeit droht ihn zu überwältigen, doch ihm bleibt nur ein kurzer Augenblick, um den Befehl des Flusses auszuführen. Mit zitternden Fingern bindet er das Symbol am Handgelenk des Opfers fest und vergewissert sich, dass die antike Glasscheibe nicht mehr verrutschen kann.
Er watet in den Fluss, bis er hüfttief im Wasser steht und die mächtige Strömung ihm den alten Mann entreißt. Wie ein Fächer breitet sich der schwarze Priesterrock auf der Wasseroberfläche aus, und als die leblose Gestalt gen Osten treibt, verschmilzt ihre Seele mit dem kalten Nass.
Der Mann hat seine Pflicht erfüllt. Jetzt bringt der Fluss den Leichnam an sein Ziel und wäscht währenddessen sein Geheimnis von ihm ab. Dankbar lässt der Mann sich auf die Knie sinken, bis die schwarzen Fluten über ihm zusammenschlagen, watet vorsichtig zurück ans Ufer, stellt sich auf den Friedhof und starrt auf die Themse, deren Lebenssaft von seinen Händen tropft.
2
Es hatte immer noch nicht aufgehört zu regnen, als ich Montagmorgen zum St. James’s Park lief. Die Tore des Themse-Sperrwerks waren bereits zum dritten Mal in dieser Woche angehoben worden, und die alten Abwasserkanäle waren so überlastet, dass das Brackwasser inzwischen blubbernd durch die Gitter in die Rinnsteine am Rand der Straßen stieg. Am liebsten hätte ich den ersten Bus genommen, der in Richtung meiner Wohnung führte, doch ich hatte eine Einladung zu einem Treffen mit der Leiterin der Rechtspsychologie der Met und war gespannt zu hören, was der Grund für den Termin bei dieser Koryphäe war. Also setzte ich den Weg im Schutze meines Schirms entschlossen fort.
Als Adresse hatte man mir ein unauffälliges, viergeschossiges Gebäude in der Dacre Street, einen Steinwurf von Scotland Yard entfernt, genannt. Ich fand es klug, dass es kein Hinweisschild am Eingang gab, denn das hätte das Institut zur Zielscheibe der Rache all der Psychopathen, die die Spezialisten im Verlauf der Jahre aufgespürt hatten, gemacht. Auch das Innere des Gebäudes kam mir mit den kahlen, weißen Wänden, dem bescheidenen Empfangstisch und den beiden kümmerlichen Kokospalmen links und rechts des Eingangs anonymer als das Wartezimmer einer Zahnarztpraxis vor. Und tatsächlich sah mich die Empfangsdame mit einem mitfühlenden Lächeln an, als zöge man mir gleich ohne Betäubung einen Weisheitszahn.
»Professor Jenkins’ Büro liegt in der obersten Etage.«
Ich kannte Christine Jenkins bisher nur durch ihre Fachbücher, die Pflichtlektüre während meines Studiums gewesen waren, aber der eindringliche Ton, mit dem mich ihre Assistentin um diese Zusammenkunft gebeten hatte, hatte meine Neugierde geweckt. An den Wänden waren Fotos von berühmten Psychologinnen und Psychologen aufgereiht, und Jean Piaget, Elizabeth Loftus und Carl Rogers folgten mir mit ernsten Blicken auf dem Weg durchs Treppenhaus.
Oben sah ich Christine Jenkins durch die offene Bürotür vor dem großen Fenster hinter ihrem Schreibtisch stehen. Ihre Haltung war angespannt, als sammele sie Kraft für eine Auseinandersetzung, aber als ich klopfte, drehte sie sich eilig zu mir um. Sie war groß und schlank, hatte kurzes graues Haar, und ihr Kostüm war wahrscheinlich maßgeschneidert. Sie begrüßte mich mit einem etwas distanzierten Lächeln.
»Danke, Dr. Quentin, dass Sie trotz des schlechten Wetters hergekommen sind.«
»Kein Problem. Ein bisschen Nässe hat noch niemandem geschadet.«
»Dies ist der regnerischste Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen – was bedeutet, dass Sie eine Optimistin sind.«
Ich erwiderte ihr Lächeln. »Nur so lange, bis die Umstände beweisen, dass das unberechtigt ist.«
Sie bedeutete mir, Platz zu nehmen. »Sie erinnern sich doch sicher noch an einen Überfall auf eine junge Frau namens Jude Shelley letztes Jahr?«
»Die Tochter eines Kabinettsmitglieds. Den Berichten nach lag sie mehrere Wochen auf der Intensivstation.«
Jenkins’ Miene wurde ernst. »Jemand hat sie in einen Wagen gezerrt, als sie von einer Party in der Lower Thames Street kam. Er hat ihr einen spitzen Gegenstand, einen Schraubenzieher oder einen Meißel, in den Skalp gerammt, ihr Gesicht zerfetzt und sie anschließend in den Fluss geworfen, wo man sie dann unterhalb der Southwark Bridge gefunden hat. Sie war so gut wie tot und liegt seither im Krankenhaus.«
Ich zuckte zusammen. »Und der Täter wurde bisher nicht ermittelt?«
»Die Akte wurde nach sechs Monaten geschlossen, weil es keine glaubhaften Verdächtigen in dem Fall gab. Aber die Ermittlungen waren fehlerhaft.«
»In welcher Hinsicht?«
»Sagen wir, dass die Kollegen nicht besonders gründlich waren.«
»Und deshalb bin ich hier?«
»Dem Mädchen fallen langsam Einzelheiten ein, und ihre Mutter hat darauf bestanden, den Fall noch mal aufzurollen.«
Ich sah sie reglos an. »Ich stelle es mir alles andere als leicht vor, einen Fall zu lösen, der bereits ein halbes Jahr lang bei den Akten lag.«
»Trotzdem können wir es uns nicht leisten, Whitehall zu verprellen, und vor allem hat uns der Commissioner persönlich den Befehl erteilt, der Sache noch mal nachzugehen.«
»Weil er Angst hat, dass die Shelleys sich sonst an die Presse wenden?«
Die Professorin sah mich unbehaglich an. »Es geht dabei vor allem um den Ruf der Polizei. Ich hätte gern, dass Sie sich mit dem Fall befassen. Erst mal für sechs Wochen, ab sofort. Sie sollen die Familie unterstützen und nach neuen Spuren suchen, und wenn Ihre Suche nichts ergibt, schließen wir den Fall endgültig ab.«
»Das ist unmöglich, fürchte ich. Ich fange nächste Woche wieder in der Klinik an.«
»Ihr Boss hat mir schon seine Zustimmung erteilt und ist bereit, Sie freizustellen.«
Ich lehnte mich auf meinem Stuhl zurück. »Warum wollen Sie ausgerechnet mich? Schließlich haben Sie hier ein ganzes Haus voller Leute, die für solche Aufgaben ausgebildet sind.«
»Die Mutter des Mädchens hat Ihr Buch Gewalt verstehen gelesenund darum gebeten, Sie für die Ermittlungen zu engagieren. Sie haben einen exzellenten Ruf, und ich denke genau wie Mrs Shelley, dass Sie wahrscheinlich die Beste für diesen Job sind.«
Trotz ihrer schmeichelhaften Worte störte mich, dass diese Sache bereits über meinen Kopf hinweg entschieden worden war. Aber auch wenn ich eigentlich in Urlaub fahren wollte, hatte mich die Professorin schon am Haken, denn es interessierte mich wirklich, warum die Mordermittler einen so großen Fall anscheinend an die Wand gefahren hatten.
Ich nickte knapp. »Und wann genau fange ich an?«
Die Direktorin atmete erleichtert auf. »Wenn’s geht, schon heute Nachmittag. Sie kriegen einen Arbeitsplatz im ersten Stock, wobei sich Mrs Shelley schnellstmöglich mit Ihnen treffen will.«
»Erst mal brauche ich die Akte.«
»Meine Assistentin wird Sie Ihnen runterbringen. Vielen Dank, dass Sie bereit sind, so kurzfristig einzuspringen. Lassen Sie mich wissen, falls ich Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen kann.« Als ich mich zum Gehen wandte, fügte sie in ernstem Ton hinzu: »Das Problem mit Ihrer zunehmenden Bekanntheit ist, dass Ihre Hilfe eingefordert wird, Dr. Quentin. Dadurch werden Sie zum Opfer Ihres eigenen Erfolgs.«
Die Feststellung verblüffte mich. Es klang, als spräche Jenkins eher über ihre eigene Position als über meine. Als Chefin einer nationalen Einrichtung stand sie wahrscheinlich oft im Rampenlicht, und der Druck der öffentlichen Meinung lastete anscheinend schwer auf ihr. Noch ehe ich den Raum verlassen hatte, sah sie bereits auf ihr Handy, denn offenbar wartete bereits der nächste wichtige Termin.
Der mir zugewiesene Schreibtisch stand in einem riesigen Büro am Ende eines dunklen Flurs. Obwohl es außer meinem mindestens noch fünfzehn andere Arbeitsplätze gab, waren außer mir nur eine Handvoll Bartträger im Raum, die offensichtlich taub und blind für alles außer ihrer Arbeit waren. Mir wurde klar, dass ich in einen Hinterhalt geraten war. Viele Psychologen warteten ihr Leben lang auf eine Einladung in dieses Institut, doch dieser Fall war schwierig, und wenn ich nicht irgendwelche neuen Spuren fand, brachte ich die nächsten Wochen damit zu, einem bekannten Kabinettsmitglied und seiner unglücklichen Gattin beizustehen. Und obwohl mir Jenkins ihre Unterstützung angeboten hatte, war ich anscheinend ganz auf mich allein gestellt. Ich hatte keine Assistentin, die mir bei der Aktendurchsicht half, und meine Kollegen hier waren sogar zu beschäftigt für ein freundliches Hallo. Ich stellte mich kurz vor, doch der ältere Mann, der sich über den Schreibtisch gegenüber beugte, sah mich mit einem leeren Lächeln an und konzentrierte sich sofort wieder auf seinen Job, als brächte der Gedanke, kurz mit mir zu plaudern, ihn entsetzlich in Verlegenheit.
Um halb elf erschien die Assistentin mit der Akte und legte den kiloschweren Stapel aufatmend auf meinem Schreibtisch ab. Die vertraulichen Berichte machten deutlich, dass bei den Ermittlungen tatsächlich alles andere als gründlich vorgegangen worden war. Und zwar von Anfang an. In den meisten Fällen werden Akte der Gewalt von Menschen aus der eigenen Familie oder anderen nahestehenden Personen ausgeübt, aber statt die Aussagen der Eltern und des Bruders eingehend zu überprüfen, hatten die vernehmenden Beamten die Familie des Ministers offenbar mit Samthandschuhen angefasst und nicht einmal ihre Alibis wirklich überprüft. Timothy Shelley hatte ausgesagt, er hätte sich in Brighton mit einem Kollegen auf einen Parteitag vorbereitet, und die Mutter und der Bruder hatten angeblich den Tatabend gemeinsam im Londoner Stadthaus der Familie verbracht. Also hatten die Ermittler sich vor allem auf den Freund des Opfers, Jamal Khan, und auf Shane Weldon konzentriert, einen Frauenmörder, der sein Opfer in den Fluss geworfen hatte und nach der Verbüßung seiner Strafe ein paar Tage vor dem Überfall auf Jude entlassen worden war. Die Ermittler hatten beide Männer gründlich überprüft, doch nicht einmal den kleinsten Hinweis auf eine Verbindung zwischen ihnen und dem Fall entdeckt. Dennoch und obwohl ich erst einmal mit der Familie sprechen wollte, um mir einen Eindruck vom sozialen Umfeld meines Opfers zu verschaffen, schrieb ich mir die beiden Namen auf.
Als ich die Berichte wieder in die Mappe schieben wollte, rutschte ein Umschlag voller Fotos aus dem Stapel, und ich zog ein paar Aufnahmen hervor. Auf dem ersten Bild sah ich ein fleckiges Metalldreieck aus Kupfer oder Bronze, was unter der Schicht aus grüner Patina nicht deutlich zu erkennen war. Dann folgte ein Porträt von Jude, auf dem sie vielleicht zwanzig war. Sie lächelte entspannt, ihre großen braunen Augen spiegelten das Licht, und sie sah hübsch und sorglos aus, als hätte es das Leben stets nur gut mit ihr gemeint. Die dritte Aufnahme war schwerer zu verstehen. Ein grünliches Oval hing um denselben schlanken Hals, der Rest jedoch sah vollkommen verändert aus. Der Großteil des Gesichts war nicht mehr da. Die Lippen und die Nase fehlten, und das junge Mädchen starrte mich aus einem braunen Auge an, das sich infolge der Entfernung eines Lides nicht mehr schließen ließ. Ich hatte schon des Öfteren mit missgestalteten Patienten und Patientinnen zu tun gehabt, so grässliche Verstümmelungen aber hatte ich noch nie gesehen. Ich atmete tief durch und schob das Foto wieder in den Umschlag, während mir das Ausmaß des Verbrechens, das jemand an dieser jungen Frau begangen hatte, bewusst wurde.
3
Ich hielt meine Aktentasche mit den Unterlagen auf dem Schoß, und mein Taxi bahnte sich mühsam einen Weg durch den Verkehr in Pimlico. Die Stadt schien langsam, aber sicher durchzudrehen. Ich hatte das vergangene halbe Jahr in dem verschlafenen Städtchen Northwood im ländlichen Berkshire zugebracht, und wie es aussah, hatte London während dieser Zeit tatsächlich noch an Tempo zugelegt. Die Fußgänger bewegten sich so schnell und zielstrebig durch die Grosvenor Row, als hinge ihre Existenz davon ab, auf die Sekunde pünktlich zu sein. Südlich von Embankment ragte eine Reihe halbfertiger Wolkenkratzer in den Himmel, und während das alte Battersea’sche Kraftwerk immer noch auf die Verwandlung in De-luxe-Apartments wartete, dehnte sich entlang des Flussufers nach Westen bereits eine durchgehende Glasfront aus. Reihen transparenter Türme hatten die Fabriken und die alten Lagerhallen dort ersetzt, das Haus der Shelleys aber lag im Herzen von Chelsea in einer Umgebung, die seit mindestens 300 Jahren völlig unverändert und immun gegen den Wandel war. Häuser aus der Zeit King Georges drängten sich dort um den Gemeinschaftsgarten, der mit seinen Rosenbeeten und den alten Kirschbäumen so ruhig und idyllisch wie in alten Zeiten war.
Ich flüchtete mich vor dem Regen unter Heather Shelleys Vordach und betrachtete die Nachbarhäuser, in die wahrscheinlich in den letzten Jahren alternde Rockstars oder reiche Russen eingezogen waren. Zu meiner Überraschung öffnete keine Angestellte, sondern Mrs Shelley höchstpersönlich die Tür. Sie war Mitte vierzig, doch obwohl sie wie die blonde Ausgabe ihrer noch unversehrten Tochter wirkte, waren die dunklen Ringe unter ihren Augen selbst unter der Schminke nicht zu übersehen. Eilig reichte sie mir die Hand.
»Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.«
Sie sprach mit einem warmen, nördlichen Akzent, und während sie mich durch den Flur führte, unterzog ich sie einer erneuten Musterung. Ich hatte sie nach Mr Shelleys Wiederwahl im Fernsehen gesehen, wo sie mir mit ihrem kühlen, distanzierten Lächeln wie der Inbegriff der Gattin des erfolgreichen Politikers erschienen war. Heute aber kam sie mir ganz menschlich vor. Sie trug ausgeblichene Jeans, einen marineblauen Pulli, eine Kette mit silbernem Kruzifix, und ihre Wildlederstiefel sahen mindestens so abgewetzt und ausgelatscht wie meine aus.
Sie setzte Kaffee für uns auf, und ich sah mich in ihrer Küche um. Der Raum war groß genug für alle nur erdenklichen Geräte, und an einer Wand hing ein gerahmtes Familienfoto aus der Zeit, bevor das Unglück über sie hereingebrochen war. In einem sonnigen Garten saßen Heather und ihr Mann mit Jude und einem schwarzhaarigen jungen Mann, der sicherlich ihr Bruder war. Er war genauso attraktiv wie sie, auch wenn sein Teint ein wenig dunkler und sein Lächeln zurückhaltender war. Eine rundum glückliche Familie.
Heather nahm mir gegenüber Platz und zupfte die Haut um ihre Fingernägel herum ab. »Wo soll ich anfangen?«
Ich sah sie mit einem aufmunternden Lächeln an. »Wo Sie wollen. Ich muss sowieso mit Ihnen allen sprechen, aber vielleicht fangen Sie mit der Familiengeschichte an. Woher kennen Sie zum Beispiel Ihren Mann?«
»Tim und ich haben uns in Oxford kennengelernt.« Sie atmete tief durch. »Anscheinend ziehen sich Gegensätze an. Ich stamme aus Leeds, wo meine Eltern einen kleinen Lebensmittelhandel hatten, und konnte nur dank eines Stipendiums Medizin studieren, während er direkt aus dem Internat in Eton kam.«
»Haben Sie je als Ärztin praktiziert?«
»Ich habe niemals meine Zulassung erlangt. Tim ist nach dem Studium karrieremäßig durchgestartet, deshalb wollte ich zu Hause bei den Kindern sein«, erklärte sie mir nüchtern, aber vielleicht hatte sie ja trotzdem den Verzicht auf ihre eigene Karriere irgendwann bereut.
»Ihre Tochter hat Jura studiert, nicht wahr?«
Plötzlich füllten ihre Augen sich mit Tränen, und sie stieß mit rauer Stimme aus: »Nach der Schule hat sie ein Soziales Jahr in Indien absolviert und danach beschlossen, Menschenrechtsanwältin zu werden. Sie hat das, was ihr passiert ist, einfach nicht verdient. Sie wollte die Welt verbessern, und sie hatte jede Menge Freunde.« Sie verstummte, und sie tat mir leid. Noch eine schlechte Nachricht, und es wäre endgültig um sie geschehen.
»Können Sie mir sagen, warum Sie darauf gedrängt haben, dass eine Psychologin sich des Falls annimmt?«
»Wir brauchen jemanden, der diese Art Gewalt versteht. Die Polizei war heillos überfordert. Obwohl Tim darauf bestanden hat, dass sie ihre besten Leute auf den Fall ansetzen, haben sie sich bei den Ermittlungen die ganze Zeit im Kreis gedreht. Sie haben sich vor allem auf den Freund meiner Tochter konzentriert, doch ich konnte mir nie vorstellen, dass er es war. Ich bin Jamal nur zweimal kurz begegnet, aber er war vollkommen verrückt nach ihr.«
»Hatte Jude auch noch Kontakt zu irgendwelchen Exfreunden?«
»Ich glaube nicht, aber falls ja, hätte sie mir wahrscheinlich nichts davon erzählt. Meine Tochter hat schon immer großen Wert auf ihre Eigenständigkeit gelegt. Es war ein fürchterlicher Schlag für sie, als sie urplötzlich ihre Unabhängigkeit verloren hat. Sie war nach dem Überfall nicht einmal wieder hier.«
»Was hält Ihr Mann davon, dass die Ermittlungen noch einmal aufgenommen werden?«
Heathers Miene wurde kalt. »Fragen Sie ihn selbst, falls Sie es schaffen, ihn irgendwo aufzuspüren.«
»Seine Tätigkeit verlangt ihm sicher sehr viel ab.«
»Vor allem bietet sie ihm die Gelegenheit, sich den Problemen, die er hat, erfolgreich zu entziehen.«
Ihre Offenheit schockierte mich. Nach gerade einmal fünf Minuten gab sie einer völlig Fremden gegenüber unumwunden zu, dass es mit ihrer Ehe nicht zum Besten stand. »Ist Jude gesundheitlich inzwischen auf dem Weg der Besserung?«
Heather sah mich reglos an. »Sie stand auf der Warteliste für eine Gesichtstransplantation, aber im Augenblick ist sie für einen solchen Eingriff viel zu schwach. Sie lag letzte Woche vierundzwanzig Stunden auf der Intensivstation. Das Einzige, was sie am Leben hält, ist der Traum, dass man den Kerl, der sie überfallen hat, erwischt. Sie hat fürchterliche Angst, dass sonst vielleicht noch jemand anderes so von ihm zugerichtet wird.«
»Sie müssen als Familie doch furchtbar unter dieser Sache leiden.«
Heather nickte zustimmend. »Am schlimmsten hat es unseren Sohn getroffen. Guy hatte danach einen Zusammenbruch. Er ist noch immer sehr verletzlich und geht erst seit Ostern wieder auf die Kunstakademie.«
Ich überflog meine Notizen. »Am Abend des Überfalls waren Sie und Guy zusammen, richtig? Können Sie mir sagen, wie der Abend verlaufen ist, bevor die Polizei erschien?«
Sie spannte sich unmerklich an. »Es war alles ganz normal. Ich habe gegen sieben was für ihn gekocht, aber da ich Heuschnupfen und entsetzliche Kopfschmerzen hatte, habe ich ein Bad genommen und lag gegen neun im Bett. Guy beschloss, bei uns zu übernachten, denn am nächsten Morgen wollte Jude zum Frühstück kommen, und die beiden hatten sich schon eine ganze Weile nicht gesehen.«
»Und wie hat Ihr Sohn den Abend zugebracht, nachdem Sie ins Bett gegangen waren?«
»Er hat an einem Kunstprojekt gearbeitet.«
»Wäre es möglich, ihn zu sprechen?«
»Heute nicht.« Heathers Gesicht umwölkte sich. »Es wird nicht einfach für ihn sein, darüber zu sprechen, deshalb muss ich ihn erst darauf vorbereiten.«
»Ich werde mich so kurz wie möglich fassen«, sagte ich ihr zu. »Hat Jude zum Zeitpunkt des Überfalls zu Hause oder im Studentenwohnheim gelebt?«
»In einer WG mit ihrer Freundin Natalie, aber an den Feiertagen kam sie immer nach Hause.« Wieder wurden Heathers Augen feucht. »Wir machen uns alle unglaubliche Sorgen. Sie hat eine Infektion, die sie einfach nicht loswird.«
»Vielleicht baut es sie ja auf, wenn der Fall wiederaufgenommen wird.«
»Ich bete zu Gott, dass es so ist«, stimmte mir Heather leise zu.
»Dürfte ich vielleicht Judes Zimmer sehen, wenn ich schon einmal hier bin?«
Ihre Mutter zögerte, aber nach sanftem Überreden führte sie mich in den zweiten Stock und wartete im Flur, als dränge sie nur ungern in das Territorium ihrer Tochter ein. Die Wände des Zimmers waren in einem zarten Rosaton gestrichen, an der Pinnwand hingen eine Reihe Schnappschüsse von gutgelaunten jungen Menschen, und die Regale waren mit Stephenie Meyer und mit J. K. Rowling angefüllt. Ich hatte juristische Fachzeitschriften sowie anderes Studienmaterial erwartet, doch das Zimmer kam mir nicht wie das einer Studentin, sondern eher wie das eines Kindes vor. Sicher hatte die Familie ihre Wohnung ausgeräumt, die Hinweise auf Judes Erwachsenenleben aber wurden offenbar an irgendeinem anderen Ort verwahrt. In ihrem Schrank hing eine Reihe Glitzerkleider, als verkehre sich mit einem Mal die Zeit und brächte das einst lebensfrohe, hübsche Mädchen wieder zurück.
Bis zum Ende unseres Treffens sah ich Heather die Erschöpfung überdeutlich an. Sie schien sich so sehr auf das Wohlergehen ihrer Kinder zu konzentrieren, dass sie ihr eigenes vergaß. Ich versprach, sie nach der Durchsicht der Beweise anzurufen, aber als ich mich zum Gehen wandte, wirkte ihr Gesicht noch eingefallener als vorher.
»Wäre es in Ordnung, wenn ich Jude morgen besuchen würde?«, fragte ich.
»Dann komme ich am besten mit. Es regt sie immer furchtbar auf, wenn sie neue Menschen trifft.«
»Trotzdem wäre es wahrscheinlich besser, wenn ich erst einmal alleine zu ihr gehen würde.«
Heathers Lächeln schwand. »Meine Tochter ist zu krank für irgendwelchen Stress.«
»Das ist mir klar.« Ich legte meine Hand auf ihren Arm. »Früher oder später wird sie mir begegnen müssen, Heather. Und ich werde ganz bestimmt nicht lange bleiben«, sagte ich ihr zu.
Ihre Lippen bebten, als sie mir auf Wiedersehen sagte, und dann drückte sie abrupt die Tür hinter mir zu.
Ich lief nach Norden in die Cromwell Road und setzte mich in ein Café. Ich war beunruhigt, denn obwohl ich erst seit ein paar Stunden mit dem Fall befasst war, fühlte ich mich bereits involviert. Heathers Leiden war mit bloßem Auge zu erkennen, denn sie konnte sich nur noch mit Mühe konzentrieren, und sie reagierte immer leicht verzögert, wenn man ihr eine Frage stellte. Offensichtlich litt sie unter einer situationsbedingten Depression. Sie bemühte sich verzweifelt, wenigstens ein Minimum an Stärke zu bewahren, obwohl für sie der schlimmste Alptraum aller Eltern wahr geworden war, aber sich Tag für Tag ins Krankenhaus zu schleppen und in Judes verstümmeltes Gesicht zu blicken ging allmählich über ihre Kraft.
Nachdem ich wieder in meiner Wohnung am Providence Square war, kochte ich mir Nudeln, spähte aus dem Küchenfenster und musste erkennen, dass an mein geplantes Läufchen nicht zu denken war. Noch immer war der Himmel hinter einer dichten, grauen Wolkenwand versteckt, aus der sich der Regen wie aus Eimern über mein Stadtviertel ergoss. Ein leichter Schauer hätte mich nicht abgehalten, aber selbst mein Masochismus hatte seine Grenzen, und so schlug ich abermals die Akte auf und fuhr mit meiner Arbeit fort.
Laut medizinischem Bericht hatte Jude Shelley eine Risswunde am Hals, infolge derer ein Luftröhrenschnitt erforderlich gewesen war, einen gebrochenen Kiefer, schwere Verletzungen am Schädel und einen gravierenden Verlust an Gesichtshaut und -gewebe aufgewiesen, als sie in die Klinik eingeliefert worden war. Und als wäre das nicht bereits schlimm genug gewesen, musste man von Glück sprechen, dass sie nicht ertrunken war.
Ich starrte auf die Liste und versuchte, mir emotionale Auslöser für ein derartiges Gemetzel vorzustellen, doch bevor ein psychologisches Motiv erkennbar würde, galt es, sämtliche Beweise durchzugehen.
Da mir von der detaillierten Darstellung der körperlichen Schäden, die die junge Frau davongetragen hatte, übel wurde, las ich erst mal den Bericht der Spurensicherung. Am 20. Juni letzten Jahres, praktisch auf den Tag vor einem Jahr, hatte man Jude um vier Uhr nachts am Themseufer unterhalb der Southwark Bridge entdeckt. Fünf Minuten nach dem Notruf war die Polizei vor Ort gewesen, und ich riss die Augen auf, als ich die ausholende Unterschrift am Rand des Polizeiberichtes entdeckte. Sie stammte eindeutig von Burns, von DCI Don Burns.
Ich versuchte, ihn mir vorzustellen, wie er im kalten Schlamm am Themseufer kniete und das Mädchen bis zum Eintreffen des Krankenwagens in stabiler Seitenlage hielt. Egal, wie grässlich die Verletzungen gewesen waren, hatte er sie sicher nicht im Stich gelassen, sondern ihre Hand gehalten, bis sie von den Sanitätern übernommen worden war.
Die Erinnerung an ihn rief ein gewisses Unbehagen in mir wach. Ich hatte Burns nur ein einziges Mal gesehen, seit wir im letzten Winter auf der Suche nach dem Eismädchen gewesen waren. Wir hatten in einem Landgasthof bei Charnwood vor dem prasselnden Kaminfeuer gesessen. Es war ein schöner Abend gewesen, denn er hatte mich geküsst, bevor er wieder losgefahren war, und mir versprochen, dass wir uns bald wiedersähen. Doch ich hatte nie wieder etwas von ihm gehört. Er hatte auf keine meiner Nachrichten auf seiner Mailbox reagiert, und als mir klargeworden war, dass er anscheinend nicht die Absicht hatte, mich zu kontaktieren, hatte meine Verletztheit heißem Ärger Platz gemacht.
Als ich daran dachte, dass ich ihn jetzt anrufen müsste, zog mein Magen sich zusammen, doch ich hatte keine andere Wahl. Widerstrebend schaltete ich meinen Laptop ein und meldete mich, fest entschlossen, möglichst kurz mit ihm zu sprechen, über Skype.
Nach dem dritten Klingeln ging er dran. Sein Gesicht war unscharf, und der Raum, in dem er saß, sah irgendwie verändert aus. Anscheinend war er umgezogen, denn statt der vertrauen Buchregale nahm ich fremde Bilder an der Wand in seinem Rücken wahr. Doch dann gewann das Bild an Schärfe, und ich erkannte, dass er äußerlich noch ganz der Alte war. Seine breiten Schultern füllten fast den ganzen Bildschirm aus, das dunkle Haar war eine Spur zu lang, und der Blick aus seinen braunen Augen war so durchdringend wie eh und je. Nur sein schiefes Lächeln fehlte, als er zur Begrüßung sagte: »Hallo, Alice. Ich hätte mich längst schon bei dir melden wollen.«
Ehe er noch etwas sagen konnte, tauchte kurz ein anderes Gesicht am Rand des Bildschirms auf. Von einer attraktiven Frau mit braunem Haar, die mich mit einem bösen Blick bedachte und dann wieder ging. Es tröstete mich nicht, dass Burns so unbehaglich guckte, wie ich mich fühlte, deshalb platzte ich sofort mit meinem Anliegen heraus. »Der Fall Jude Shelley wurde wieder aufgerollt. Ich brauche ein paar Infos, Don.«
»Willst du jetzt darüber reden?«
»Falls das möglich ist.«
»Können wir uns vielleicht lieber morgen treffen? Sagen wir, um acht im Brown’s?«
Nickend drückte ich auf die Escape-Taste und starrte auf den schwarzen Monitor. Ich wusste nicht, wer seine neue Freundin war, aber der Gedanke, dass Don Burns das Bett mit einer anderen teilte, schnürte mir die Kehle zu. Ein klassischer Fall von Somatisierung, wusste ich. Ich reagierte häufiger mit physischen Symptomen, wenn ich psychisch angegriffen war. Meistens konnte ich dann nicht mehr schlafen oder bekam heftige Migräne, doch das ließ ich in diesem Fall nicht zu.
Ich nahm ein ausgedehntes Bad, und gerade, als ich schlafen gehen wollte, zeigte mir das Klingeln meines Handys eine neue Nachricht an. Lola hatte mir ein Bild von sich auf ihrer Chaiselongue geschickt. Ich musste einfach lächeln, als ich ihre dicke Wampe sah. Was machte es schon aus, wenn ein bereits von Beginn an schlechter Tag katastrophal geendet hatte? Erst mal würde ich mich darauf konzentrieren, dass ich in zwei Wochen Patentante würde. Alles andere war egal.
4
Am nächsten Vormittag saß Burns bereits an einem Fenstertisch, als ich das Brown’s betrat. Er trug einen schwarzen Regenmantel, ließ die Schultern hängen, und seine bleiche Gesichtshaut spannte sich über seinen hohen Wangenkochen, während er über den Fluss in Richtung Whitechapel sah. Früher hatten wir uns regelmäßig in diesem Café getroffen, denn es öffnete schon früh und war trotz des hervorragenden Kaffees, den sie dort servierten, meistens leer. Zögernd trat ich auf ihn zu. Ich war immer noch wütend, weil er mich nach wie vor magisch anzog. Wenn er mich eingeladen hätte, mit ihm ins Hotel zu gehen, wäre ich sofort mitgegangen.
Als er mich entdeckte, erhob er sich halb von seinem Platz und verzog verlegen das Gesicht.
»Schön, dich zu sehen, Alice.«
»Ach ja?« Ich setzte mich und sah ihn reglos an. »Hör zu, es wird nicht lange dauern. Ich will einfach von dir wissen …«
»Kann ich dir nicht erst einmal erklären, warum ich dich nicht angerufen habe?«
»Nicht nötig. Schließlich bin ich nur der Arbeit wegen hier«, gab ich in kühlem Ton zurück, doch er fuhr einfach fort.
»Die Jungen kamen nicht damit zurecht, dass ich zu Hause ausgezogen war. Liam wollte nicht mehr in die Schule gehen, und Moray hat wieder ins Bett gemacht und jeden Abend stundenlang geheult.«
»Du hättest mir doch einfach sagen können, dass du dich mit deiner Frau versöhnt hast. Eine kurze SMS oder eine E-Mail hätten völlig ausgereicht.«
Er starrte auf den Tisch. »Ich hatte keine Ahnung, was ich sagen sollte. Ich hatte ein richtig schlechtes Gewissen, denn ich wollte dir nie weh tun.« Er sah mich prüfend an, als suche er nach Spuren des Leids, das er mir zugefügt hatte.
»Deshalb habe ich nicht bei dir angerufen. Ich bin hier, weil ich über Jude Shelley sprechen will. Deinem Bericht zufolge warst du vor dem Krankenwagen dort.«
Erst dachte ich, dass er mir keine Antwort geben würde, denn er sah wieder aus dem Fenster der Barkasse nach, die sich flussaufwärts schleppte. »Ich war mit einem Polizeianwärter dort. Es war der erste Einsatz dieses armen Kerls, und danach war er eine Woche krank.«
»War sie bei Bewusstsein?«
»Das war das Allerschlimmste. Sie kam immer wieder zu sich, obwohl ihre Schmerzen sicher unerträglich waren.«
»Ist dir abgesehen von den Verletzungen noch irgendetwas aufgefallen?«
»An ihrem Hals hing ein Metallstück. Scharfkantig, fünf Zentimeter lang, an einem Lederband.«
Ich erinnerte mich an das Foto aus der Akte. »Und was war das deiner Meinung nach?«
»Bevor ich es mir näher ansehen konnte, waren die Sanitäter da.«
»Hat sie etwas über ihren Angreifer gesagt?«
»Nichts, was einen Sinn ergeben hätte. Sie hat irgendwas von Seelen vor sich hin gebrabbelt, was nicht wirklich zu verstehen war.«
»Vielleicht dachte sie, sie würde sterben«, schlug ich vor, aber er schüttelte den Kopf.
»Es ging um die Seele des Flusses.«
Durch das Fenster sah ich auf die Themse, die total verschlammt, verdreckt und schwärzer als der Himmel war. Sicher konnte niemand glauben, dass unter der dunklen Oberfläche auch nur eine Spur von Leben war. Ich wandte mich erneut an Burns, und er zog seine Schultern hoch genug, um einen Angriff abzuwehren, und bedachte mich mit einem vorsichtigen Blick.
»Hast du heute schon die Zeitungen gesehen?«
Ich schüttelte den Kopf, und kurzerhand drehte er seine Ausgabe des Independent so, dass ich die Titelseite sah.
PRIESTER ERTRINKT BEI BRUTALEM ÜBERFALL.
In dem Artikel hieß es, dass am Vortag in den frühen Morgenstunden die vor allem im Gesicht entstellte Leiche eines Priesters namens Kelvin Owen am Westminster Pier im Wasser treibend aufgefunden worden war.
»Wie bei Jude«, stellte ich leise fest.
»Du denkst, es ist vielleicht noch mal passiert?«
»Weshalb hätte er ein ganzes Jahr lang warten sollen? Wobei mich die Verletzungen bedenklich stimmen. Es geschieht so selten, dass ein Täter seinem Opfer das Gesicht verstümmelt, dass ich gern genauer wüsste, was mit diesem Mann geschehen ist. Es kommt mir wie ein allzu großer Zufall vor, dass jemand an dem Tag, an dem man die Ermittlungen in Judes Fall neu aufgerollt hat, auf genau dieselbe Weise angegriffen worden ist. Wobei abgesehen von den Behörden und ihrer Familie bisher niemand was von meiner Arbeit weiß.«
»Ich kann mich gern nach Einzelheiten für dich erkundigen.«
»Das kannst du dir sparen, weil Professor Jenkins mir das Passwort für den landesweiten Polizeicomputer überlassen hat.« Ich schob meine noch volle Kaffeetasse fort. »Hast du weiter in dem Fall ermittelt, nachdem du die junge Frau damals gefunden hast?«
Er runzelte die Stirn. »Das Morddezernat hat sofort übernommen. Aber ihren Vater, den höchst ehrenwerten Timothy Shelley, habe ich kennengelernt. Er hat sich damals offiziell über das späte Eintreffen der Polizei am Fundort beschwert. Der Typ ist genau so, wie man es von den Mitgliedern der Oberschicht erwartet: schmierig, bösartig und arrogant.« Burns schottischer Akzent verstärkte sich, je mehr sein Ärger wuchs.
Zu meinem Ärger hätte ich den ganzen Tag dort sitzen können, um mir seine Schimpftiraden anzuhören. Deshalb stand ich so schnell wie möglich auf und band den Gürtel meiner Jacke zu.
»Danke, dass du mir deine Zeit gewidmet hast.«
»Ruf einfach an, falls ich dir helfen kann.« Er sah mich reglos an, aber bevor er mich noch einmal um Verzeihung bitten konnte, wandte ich mich schnellstmöglich zum Gehen.
Mit einem Brennen in der Kehle und wild klopfendem Herzen machte ich mich auf den Weg in Richtung Spice Quay, doch in Höhe der Tower Bridge legte ich eine kurze Pause ein und setzte mich auf eine Bank. Um mich zu beruhigen, sah ich den Segelschiffen durch den wieder einsetzenden Nieselregen auf ihrem Weg nach Bermondsey hinterher. Ich hatte in den letzten Monaten fast pausenlos an Burns gedacht. Unerwiderte Liebe mochte junge Menschen in ihrem emotionalen Reifungsprozess unterstützen, aus dem sie dann gestärkt hervorgingen, doch für eine smarte Psychologin von inzwischen dreiunddreißig Jahren taugte sie nicht. Am liebsten hätte ich vor lauter Frust gegen den nächsten Laternenmast getreten, und vor allem hätte ich Burns eben in dem Café liebend gerne angeschrien. Doch das hätte nichts geändert, denn er hatte nur versucht, das Richtige zu tun, und war aus diesem Grund zu seiner Frau zurückgekehrt. Das konnte ich ihm kaum verdenken, deshalb wäre es das Beste, nicht länger an ihn zu denken, und nach einem letzten Aufflackern von Selbstmitleid setzte ich meinen Weg entschlossen fort.
Jude Shelley lag in Londons teuerster Privatklinik, dem Royal London, das an Luxus kaum zu überbieten war. Die Getränkeautomaten in der großen, auf Hochglanz polierten Eingangshalle stellten kostenloses Mineralwasser und Cappuccino bereit, und durch die Fenster Richtung Norden erstreckte sich ein phänomenaler Blick über die Themse auf das alte Zollhaus und Old Billingsgate. Vielleicht war es eine Ironie des Schicksals, dass man aus dem Zimmer des Mädchens direkt auf die Lower Thames Street schaute, wo sie überfallen worden war. Ich an ihrer Stelle hätte umgehend um ein anderes Zimmer gebeten.
Eine Pflegerin mittleren Alters führte mich zu der Patientin in den ersten Stock und sah mich fragend von der Seite an. »Haben Sie Jude schon mal besucht?«
»Dies ist das erste Mal.«
»Darf ich Ihnen einen Rat geben?«
»Auf jeden Fall.«
»Versuchen Sie, die arme Jude nicht anzustarren. Den Leuten ist nicht klar, dass sie das tun, aber trotz der grässlichen Verletzungen ist sie noch immer eine ganz normale, junge Frau von dreiundzwanzig Jahren.«
Inzwischen standen wir vor Zimmer Nummer neun, und bevor sie sich zum Gehen wandte, sah die Schwester mich mit einem aufmunternden Lächeln an. Ich atmete tief durch und klopfte leise an die Tür. Im Vorzimmer roch es nach frischen Blumen, Jod und abgestandener Luft, am auffallendsten aber war die Dunkelheit. Obwohl inzwischen heller Morgen war, waren die Vorhänge geschlossen, deshalb nahm ich nur die Silhouette der Patientin wahr. Sie lag auf dem Bett und wegen der tief ins Gesicht gezogenen Krempe ihres Hutes war nicht zu erkennen, ob sie wach war oder schlief, doch plötzlich nahm sie mich mit heller, atemloser Stimme, die vom Zischen des Beatmers unterbrochen wurde, in Empfang.
»Sie sind bestimmt die Seelenklempnerin, von der mir Mum erzählt hat.«
»Richtig, ich bin Alice Quentin, aber keine Angst, ich bin nicht hier, weil ich Ihre Psyche auseinandernehmen will. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich mich setze?«
»Bitte. Sie bewahren mich davor, den Mist zu sehen, der tagsüber im Fernsehen kommt.«
Ich lachte auf. »Ich weiß, wovon Sie reden. Ich lag selber letztes Jahr im Krankenhaus und war praktisch hirntot, bis man mich wieder entlassen hat.«
»Dann haben Sie sich also ebenfalls mit Bares für Rares und mit Schnäppchenjagd vergnügt?«
»Ganz zu schweigen von den ganzen Talk- und Spielshows.« Ich hatte das Gefühl, dass sie versuchte, mir die Angst vor dem Zusammensein mit ihr zu nehmen, und obwohl ich keine Ahnung hatte, ob sie mein Gesicht sah, setzte ich ein Lächeln auf. »Wissen Sie, weshalb ich hier bin, Jude?«
»Meine Mutter möchte, dass Sie ein Profil des Angreifers erstellen. Sie ist sich total sicher, dass Sie den Kerl finden.«
»Sie ist Ihre Mum, und es ist ihre Aufgabe, sich ihren Optimismus zu bewahren.«
Das Sauerstoffgerät machte ein blubberndes Geräusch. »Nach neun OPs in einem Jahr hat für mich der Optimismus erst mal ausgedient.«
»Das kann ich mir vorstellen«, meinte ich, sah aber weiterhin auf meinen Block. »Heather sagt, Sie könnten sich inzwischen an Details des Überfalls erinnern. Hat sich die Erinnerung ganz plötzlich wieder eingestellt?«
»Nicht wirklich. Eher Stück für Stück, über die Monate hinweg.«
Ich hatte schon vermutet, dass sich ihr Gedächtnis nur ganz langsam von den Erlebnissen erholte, denn mitunter tauchte bei den Opfern die Erinnerung an die erlittene Gewalt erst mehrere Jahrzehnte später wieder auf. »Glauben Sie, Sie sind in der Lage, darüber zu reden?«
»Sicher, nur, was soll das bringen? Wenn die Polizei ihn nicht erwischt hat, finden Sie ihn doch bestimmt nicht ganz allein.« In ihren Worten lag ein Hauch von Bitterkeit. Anscheinend war sie fest entschlossen, keine falschen Hoffnungen zu hegen, weil sie Angst vor der Enttäuschung hatte.
»Ich will bestimmt nicht angeben, aber ich bin echt gut in meinem Job, und wenn Sie mir helfen, mache ich die Arbeit nicht allein. Straftäter werden häufig erst nach Jahren gefasst. Das wissen Sie doch sicher noch von Ihrem Studium, oder nicht?«
»Wir beide wissen, dass die Chance, ihn zu erwischen und verurteilen zu lassen, winzig ist.«
»Aber das wollen Sie doch, oder nicht?«
»Mehr als alles andere.«
»Dann sind wir uns also einig. Und da wir nichts zu verlieren haben, wenn Sie mir erzählen, woran Sie sich erinnern, schießen Sie am besten los.«
Sie atmete tief durch, doch schließlich meinte sie: »Ich sehe alles nur verschwommen, aber er hat mich aus seinem Wagen runter an den Fluss geschleppt.« Sie nahm eine Sprayflasche von ihrem Nachttisch, hob die Krempe ihres Huts ein wenig an und sprühte sich kurz irgendetwas ins Gesicht. »Meine Augen waren verbunden, bis er mit dem Schneiden angefangen hat. Daran kann ich mich Gott sei Dank nicht mehr erinnern, aber ich habe gehört, dass er dabei geweint und vor sich hin gemurmelt hat, dass der Fluss auf meine Seele wartet, bevor er mich reingeworfen hat.«
»Können Sie sich noch an irgendetwas anderes erinnern?«
»Seine Stimme war gedämpft, aber es kam mir vor, als hätte ich sie vorher schon mal irgendwo gehört.«
»Dann war es also jemand, den Sie kennen?«
»Vielleicht war mir auch nur der Akzent vertraut. Es klang, als ob er aus West London käme, so wie ich.«
»Haben Sie ihn irgendwann gesehen?«
»Nur ganz kurz. Wenn ich versuche, ihn mir vorzustellen, ist da nichts.« Ihre müde Stimme machte deutlich, wie erschöpft sie war.
»Vielleicht machen wir für heute erst mal Schluss. Ich habe Ihrer Mum versprochen, Sie nicht übermäßig zu strapazieren, aber trotzdem würde ich mich gerne noch einmal mit Ihnen unterhalten. Wäre das okay?«
»Ich weiß nicht«, antwortete sie und wandte sich mir zu. »Sie haben Angst, mich anzusehen, nicht wahr?«
»Ganz und gar nicht, nur hat mir die Pflegerin erklärt, Sie würden nicht gern angestarrt.«
»Und wie wollen Sie ihn finden, wenn Sie nicht einmal ertragen, das, was er getan hat, anzusehen?«, fuhr sie mich, plötzlich wütend, an.
»Ich würde Sie mir gern ansehen.« Mit wild klopfendem Herzen sah ich von meinem Notizbuch auf. »Es wird die Zusammenarbeit deutlich leichter machen, wenn wir völlig ehrlich zueinander sind.«
Sie schaltete die Nachttischlampe an, riss sich den Hut vom Kopf, und ich versuchte mir nicht anmerken zu lassen, wie schockiert ich von ihrem Anblick war. Schimmerndes kastanienbraunes Haar ergoss sich über ihre Schultern, aber alles andere war zerstört. Die Fotos hatten mich nicht vorbereitet auf das Ausmaß der Verletzungen, die sie davongetragen hatte. Weder auf die breite Narbe quer über dem Hals noch auf den Schlauch, durch den sie Sauerstoff bekam. Weder auf das Flickwerk der in ihr Gesicht verpflanzten Haut noch auf die dunklen Schatten dort, wo einst der rechte Augapfel gewesen war. Weder auf das leuchtend rote Loch, wo andere Lippen hatten, noch auf das, was von dem zweiten Auge übrig war. Jetzt wusste ich, wofür das Spray in ihrer Flasche war. Ihr Lid war abgerissen, und nachdem sie nicht mehr blinzeln konnte, brauchte ihre Netzhaut alle paar Minuten Feuchtigkeit. Doch das Auge war das Einzige, was sie noch kontrollieren konnte, und in dem Bemühen, meine Reaktion auf ihren Anblick zu erforschen, starrte sie mich reglos an.
Ich hielt dem durchdringenden Blick so gut wie möglich stand, und schließlich sagte ich ihr zu: »Ich werde alles tun, um rauszufinden, wer Ihnen das angetan hat, Jude, auch wenn das sicher alles andere als einfach wird. Ich würde gern versuchen, die Erinnerungen, die Sie an den Täter haben, durch so etwas wie Hypnose wieder aufzufrischen, wenn Sie damit einverstanden wären.«
»Fragen Sie mich alles, was Sie wollen.« Das Licht ging wieder aus. »Aber ich glaube nicht, dass sich dadurch was ändern wird.«
Als ich wieder aufsah, bröckelte die tapfere Fassade, und während der Ventilator über unseren Köpfen surrte, starrte sie mich weiter reglos mit dem Auge an, das sie nicht mehr schließen konnte.
5
Ich stand am Flurfenster und atmete tief durch. Das andere Themseufer wurde von dem alten Zollhaus dominiert, dem der durch das Eintreiben von Steuern über acht Jahrhunderte hinweg erlangte Wohlstand deutlich anzusehen war. Regen prasselte gegen das Glas, aber inzwischen war mir vollkommen egal, dass der diesjährige Sommer eine Pleite und dass ich Don Burns anscheinend völlig schnuppe war. Verglichen mit der armen Jude, war ich die glücklichste Frau der Welt.
Ich wollte gerade gehen, als ich jemanden im Flur sah, der mir bekannt vorkam. Timothy Shelley trug die Standarduniform eines Politikers aus dunklem Anzug, weißem Hemd und betont dezentem blauem Seidenschlips und hielt einen Strauß erst halb erblühter gelber Rosen in der Hand. Er kam mir jünger als bei seinen unzähligen Auftritten im Fernsehen vor, wenn er als Arbeitsminister erklären musste, weshalb die beharrlich ansteigenden Arbeitslosenzahlen immer noch nicht in den Griff zu kriegen waren. Mit dem permanenten Anflug eines Lächelns, der ansonsten völlig ausdruckslosen Miene und dem mittelbraunen, aus der Stirn gekämmten Haar war er für die Übermittlung schlechter Nachrichten bereits von seinem Aussehen her hervorragend geeignet, denn er wirkte kompetent und seriös. Seine Entourage bestand aus einem Mann, der etwas größer war als er, aber ungefähr im selben Alter und dieselbe Art dezenter, aber teurere Kleidung trug. Auf den ersten Blick erschien er mir wie ein Kollege von Tim Shelley, aber sein Gesichtsausdruck war etwas unsicher, als wäre er es gewohnt, Anweisungen zu befolgen. Oben an der Treppe lungerten zwei Bodyguards, von denen einer in sein Walkie-Talkie sprach.
Als der Minister sich dem Zimmer seiner Tochter näherte, trat ich ihm in den Weg.
»Mr Shelley, mein Name ist Alice Quentin. Ich war gerade bei Jude und würde gerne kurz mit Ihnen reden, falls das möglich ist.«
Sein Lächeln wurde etwas breiter. »Meine Frau hat mir bereits erzählt, dass Sie vielleicht bei unserer Tochter in der Klinik wären. Macht es Ihnen etwas aus, zu warten, bis ich bei ihr war?«
»Natürlich nicht.«
Er wandte sich seinem Begleiter zu. »Giles, könnten Sie wohl das Innenministerium bitten, die Besprechung zu verschieben?«
»Ich rufe dort umgehend an, Herr Minister.«
Der Mann bedachte seinen Boss mit einem ernsten Lächeln, zog sich umgehend zurück und sagte etwas zu den Leibwächtern, bevor er leise in sein Handy sprach.
Offenbar zog Shelley ein gemäßigteres Tempo vor und ließ sich vor allem nicht gerne drängen, denn es dauerte über eine Viertelstunde, bis er wieder aus dem Zimmer seiner Tochter kam. Er war ein wenig blasser als zuvor, offensichtlich hatte er sich auch nach all den Monaten noch nicht an Judes Anblick gewöhnt.
»Warum holen wir uns nicht erst mal einen Kaffee, Dr. Quentin?«, schlug er vor.
Er schien seine Gefolgschaft gar nicht zu bemerken, während wir nach unten gingen, so, als wäre es für ihn Routine, nie völlig alleine zu sein. Trotzdem sprach er deutlich freier, während aus dem Getränkeautomaten der Cappuccino in zwei weiße Tassen lief, und bis wir einen Tisch gefunden hatten, hatte er mir ausführlich beschrieben, wie hervorragend man seine Tochter hier versorgte und dass er infolge seiner eigenen bitteren Erfahrung tiefes Mitgefühl mit sämtlichen Familien empfand, über die eine Tragödie hereingebrochen war. Seine Sätze waren so präzise formuliert, als läse er von einem Teleprompter ab. Vielleicht war ich zu streng mit ihm, aber in meinen Augen klangen seine Worte hohl, als würde er sich allzu sehr darum bemühen, dass er ehrlich und vor allem überzeugend klang. Sein Stil war das genaue Gegenteil der fast naiven Offenheit, mit der mir seine Frau begegnet war.
»Haben Sie darauf gedrängt, dass die Ermittlungen noch einmal aufgenommen werden?«, fragte ich.
»Ganz im Gegenteil. Ich hatte Angst davor, wie meine Tochter darauf reagiert. Vielleicht versuche ich zu sehr, sie zu beschützen, aber wir standen uns immer schon sehr nah. Ich hasse den Gedanken, dass sich ihre Hoffnungen noch mal zerschlagen, und vor allem fürchte ich, dass Guy dadurch noch einmal aus dem Gleichgewicht gerät. Seien wir doch ehrlich, Dr. Quentin, uns ist beiden klar, dass die Chance, den Angreifer nach all der Zeit noch zu finden, sehr gering ist. Aber meine Frau sieht manchmal eben nur schwarz oder weiß.«
Zum ersten Mal nahm ich den Ausdruck ehrlichen Gefühls in seinen Zügen wahr. Sein Missfallen war ihm deutlich anzusehen, denn offensichtlich hatte er mit aller Macht dagegen angekämpft, die schmutzige Wäsche der Familie noch einmal ans Licht zu zerren. Er traute es mir offenbar nicht im Geringsten zu, dieses Verbrechen aufzuklären, und er wollte seine Tochter unbedingt vor einer Enttäuschung bewahren. Womöglich sorgte er sich auch um die Privatsphäre der übrigen Familie, denn wenn erst allgemein bekannt würde, dass die Ermittlungen noch einmal aufgenommen worden waren, griffen die Medien die Geschichte sicher wieder auf.
»Sie haben eine exponierte Stellung, Mr Shelley«, sagte ich. »Fällt Ihnen irgendjemand ein, der vielleicht einen Groll gegen Sie persönlich oder gegen Ihre Familie hegt?«
»Anders, als die meisten denken, ist Westminster ein in höchstem Maße entspannter Arbeitsplatz. Ich habe keine echten Feinde.« Seine Antwort kam etwas zu spät und zeigte mir, wie raffiniert er war. Genau wie Tony Blair oder Bill Clinton könnte er die ganze Welt belügen, ohne rot zu werden. Was in seinem Job wahrscheinlich unerlässlich war.
»Aber Sie hatten doch bestimmt einen Verdacht, wer Ihre Tochter überfallen haben könnte?«
»Ich fürchte, nein. Ich war nicht allzu wild auf ihren damaligen Freund. Ich hatte das Gefühl, dass er auf ihre anderen Freunde eifersüchtig war, aber der Polizei zufolge hat er ein wasserdichtes Alibi. Wobei der junge Mann sich nach dem Überfall nur zwei-, dreimal hier hat blicken lassen.« Sein Lächeln büßte einen Großteil seiner Strahlkraft ein. »Was meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Zeichen wahrer Liebe ist.«
»Können Sie sich an die Nacht des Überfalls erinnern?«
Er stieß einen leisen Seufzer aus. »Ich erinnere mich nur verschwommen, doch ich weiß noch, dass ich zusammen mit einem Mitglied meines Wahlkampfteams auf dem Weg nach Brighton war. Der Verkehr war höllisch, deshalb haben wir unterwegs noch eine Pause eingelegt und etwas gegessen. Ich weiß nicht mehr, um wie viel Uhr wir im Hotel waren, aber ich habe bis nach Mitternacht mit einem Kollegen an meiner Rede gefeilt.«
Plötzlich tauchte Shelleys Assistent an seiner Seite auf. »Wir müssten langsam gehen, Sir.«
»Moment noch, Giles.«
Mit angespannter Miene blieb der Mann in unserer Nähe stehen, und obwohl die Zukunft unseres Landes sicher nicht von Shelleys pünktlichen Erscheinen wo auch immer abhing, erhob der Minister sich von seinem Platz und verzog den Mund zu einem so strahlenden Lächeln, dass ich die zwei Reihen kerzengerader, sorgfältig gebleichter Zähne deutlich sah. »Meine Frau und ich wissen Ihre Hilfe sehr zu schätzen, Dr. Quentin.«
»Eins noch, Mr Shelley. Haben Sie von der Leiche, die man gestern Morgen am Westminster Pier gefunden hat, gehört?«
Er zuckte zusammen. »Pater Kelvin war ein Freund unserer Familie. Er hat Jude damals getauft, und meine Frau und ich gehen in St. Mary’s heute noch zum Gottesdienst. Die Polizei hat bereits angerufen, weil sie heute Abend mit uns reden will.«
Shelley wandte sich zum Gehen, und sein Assistent und seine beiden Leibwächter liefen ihm eilig hinterher.
Obwohl sein geschliffenes öffentliches Image es ihm nicht erlaubte, sich persönliche Gefühle anmerken zu lassen, konnte er die Parallelen zwischen beiden Fällen unmöglich ignorieren. An dem Tag, an dem man die Ermittlungen zum Überfall auf seine Tochter wiederaufgenommen hatte, war der Priester der Familie auf dieselbe Weise angegriffen worden. Doch im Gegensatz zu Jude hatte Pater Owen das Martyrium nicht überlebt.
Ich machte mir eine gedankliche Notiz, den Ermittlungsleiter im Fall Owen zu kontaktieren, um schnellstmöglich ein Treffen zu vereinbaren.
Mir schwirrte immer noch der Kopf, als ich durch die Borough High Street Richtung Park Street lief. Doch Lola wartete bereits in ihrem heißgeliebten türkischen Café, und als ich sie entdeckte, fiel der größte Teil des Stresses von mir ab.
Mit ihrem umwerfenden Charme hatte sie wieder mal den besten Tisch ergattert und sah mich mit einem kilometerbreiten Grinsen an. Ich schob ihre Mähne kastanienbrauner Ringellöckchen, die auf ihre Schulter fielen, zur Seite und schlang ihr zur Begrüßung meine Arme um den Hals.
»Hallo, Lo, du siehst phantastisch aus.«
»Haha. Mit meinem dicken Bauch mache ich augenblicklich jedem Walross Konkurrenz.«
»Glaub mir, du siehst wirklich toll aus!«
Lola blickte mich besorgt aus ihren grünen Augen an. »Bist du okay? Du siehst aus, als ob du etwas von der Rolle wärst.«
»Das bildest du dir ein. Was hast du in letzter Zeit getrieben?«
»Ich habe das Kinderzimmer gelb gestrichen. Damit liege ich auf jeden Fall nicht falsch.«
Lola hatte sich entschieden, ihre Schwangerschaft möglichst gelassen anzugehen. Sie plante eine Hausgeburt und wollte das Geschlecht des Babys noch nicht wissen, womit sie den armen Kindesvater in den Wahnsinn trieb. Neal hatte im Leben immer gern alles unter Kontrolle, obwohl er fast vierzehn Jahre jünger war als sie.
Plötzlich umklammerte sie mein Handgelenk.
»Du bist doch immer noch bei der Geburt dabei?«
»Auf jeden Fall. Obwohl Neal es sich ja vielleicht doch noch überlegt, wenn es erst mal so weit ist.«
»Machst du Witze? Er braucht nur den allerkleinsten Tropfen Blut zu sehen, damit er in Ohnmacht fällt. Und jetzt erzähl mir, was dir auf der Seele liegt.«
Ich erwog zu lügen, aber Lola hatte einen siebten Sinn für Schummeleien jeder Art. »Eine Kleinigkeit und ein echt großes Ding.«
»Dann erzähl mir erst mal von der Kleinigkeit.«
»Ich bin in einen verheirateten Mann verliebt.«
»Da gibt’s ein gutes Gegenmittel«, klärte sie mich augenrollend auf. »Nämlich jede Menge One-Night-Stands, bis du vor lauter anderen Kerlen nicht mehr an ihn denkst.«
Ich musste einfach lachen, als sie lüstern das Gesicht verzog.
»Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es so einfach ist.«
»Das funktioniert auf jeden Fall. Und was hast du noch für ein Problem?«
»Man hat mich gebeten, das Profil eines Täters zu erstellen, der das Gesicht einer jungen Frau verstümmelt hat. So grässliche Verletzungen habe ich nie zuvor gesehen.«
»Du solltest lernen, auch mal nein zu sagen, Schätzchen. Vielleicht würde dir das helfen.«
»Danke, Lo. Dein Mitgefühl ist wirklich grenzenlos.«
Lola pflügte sich durch einen Berg Falafel, Pitabrot und Hummus, und ich freute mich, dass sie endlich einmal eine ordentliche Mahlzeit zu sich nahm. Während ihrer Zeit als Tänzerin hatte sie ausschließlich von Rohkost, Wodka und Marlboro Lights gelebt, und ich war immer noch total beeindruckt davon, dass sie nicht mehr rauchte und auch keinen Tropfen Alkohol mehr trank, seit sie erfahren hatte, dass sie schwanger war.
»Hast du etwas von Will gehört?«, erkundigte ich mich.
»Letzte Woche. Er kommt zurück nach London, stimmt’s?«
»Da weißt du wieder einmal mehr als ich.« Ich war noch immer leicht verärgert, weil mein Bruder immer Lola und nicht mich anrief, sobald es irgendwelche Neuigkeiten gab. In seinen Jahren auf der Straße hatte ich mich stets an meine Freundin wenden müssen, wenn ich wissen wollte, wie es ihm ging, und obwohl er seine bipolare Störung halbwegs in den Griff bekommen hatte, meldete er sich auch weiter hauptsächlich bei ihr.
»Erzähl mir mehr von dem verheirateten Mann.«
»Da gibt’s nichts zu erzählen. Seine Frau hatte ihn rausgeschmissen, weil sie fand, dass er ein Workaholic war. Wir hatten einen Flirt, aber dann hat er beschlossen, zu seiner Familie zurückzukehren, weil er seinen Söhnen furchtbar fehlt.«
»Und was willst du dagegen unternehmen?«
»Nichts.«
Sie bedachte mich mit einem mitleidigen Blick. »Versprich mir, dass du nicht zu Hause bleibst und dich in Selbstmitleid ergehst.«
»Als hätte ich das je getan.«
Ich küsste sie auf die Wange, und sie stand auf und wandte sich zum Gehen. Selbst im neunten Monat war sie noch ein echter Hingucker, und eine Reihe männlicher Cafébesucher sahen ihr bewundernd hinterher, als sie von dannen flitzte, um ein letztes Mal vor der Geburt zum Frauenarzt zu gehen.
6
Der Mann versteckt sich zwischen zwei Gebäuden. Er trägt eine der Verkleidungen, die er im Wagen liegen hat – eine Lederjacke, falsches blondes Haar und eine graue Wollmütze, die er sich tief über die Augen zieht – , denn es ist wichtig, dass niemand sein wahres Aussehen beschreiben kann.
Obwohl der Tod des Priesters ihn noch immer quält, muss er die Anweisungen weiterhin befolgen, weil die Themse ihn dazu berufen hat. Der Fluss hat ihn für seine letzte Tat gesegnet, hat die Priesterseele akzeptiert und über Stunden seinen Namen intoniert.
Auf dem St. Pancras Way hasten diverse Fußgänger, verborgen unter ihren Regenschirmen, dicht an ihm vorbei. Es wäre ein Leichtes, mit gezücktem Messer auf sie zuzustürzen, doch der Fluss ist wählerisch und hat bereits sein nächstes Opfer ausgesucht.
Er beobachtet die Leute auf der Treppe vor der Polizeiwache, bis endlich eine wunderschöne schwarze Frau erscheint. Eilig zieht er sich noch etwas weiter in die Dunkelheit zurück, denn falls sie ihn entdeckt, besteht die Möglichkeit, dass sie sein Vorhaben durchschaut. Selbst auf die Entfernung kann der Mann die Reinheit ihrer Seele deutlich spüren. Er nimmt sich Zeit, um zu beobachten, wie sie vor dem Eingang des Reviers mit einer Freundin spricht, und prägt sich ihre Züge so gut ein, dass er sie sogar mit geschlossenen Augen sehen kann. Die Uniform hängt wie ein Sack an ihrem schlanken Körper, und als sie hineingeht, wogt ein Gefühl der Trauer in ihm auf.
Als er auf seine Uhr schaut, ist es schon nach zwei. Er muss so schnell es geht zurück, bevor ihn jemand vermisst, aber ihre Schönheit hat ihm neue Kraft verliehen. Er ist bis auf die Haut durchnässt, trotzdem in Hochstimmung, als er den Ort wieder verlässt.
7
Mein nächstes Treffen fand um drei an der Kunstakademie St. Martin am Granary Square statt. Heather hatte eine rätselhafte SMS geschickt und mir in knappen Worten mitgeteilt, ihr Sohn wäre bereit, mich dort zu sehen. Ich fragte mich, ob er so aalglatt wie sein Vater war und wie er davor zurückschreckte, mir die Geheimnisse seiner Familie zu enthüllen.
Von außen war das College ein langweiliges Industriegebäude, doch das Innere schmückten Spiegelwände, Zwischengeschosse mit gläsernen Böden sowie ein lichtdurchflutetes, mit zahlreichen, abstrakten Plastiken geschmücktes Atrium. Auch die Studierenden waren deutlich glamouröser als die Freaks in meinem Studiengang und brachten offensichtlich einen Großteil ihrer Zeit in Camden Lock mit der Suche nach Vintageklamotten zu. Ich wünschte mir, ich hätte auch eine künstlerische Ader, aber außer einem recht guten Gedächtnis und der Leidenschaft, die Tiefen der menschlichen Seele zu erforschen, hatte ich kein wirkliches Talent.
Ich erkannte Guy dank des Familienfotos, das mir in der Küche seiner Eltern aufgefallen war. Er war Mitte zwanzig, groß, mit einer sportlichen Figur und schwarzer Igelfrisur. Er war so blass, als hätte er die letzten Wochen unter Tage verbracht, und wirkte fest entschlossen, seinen wohlhabenden Hintergrund so gut wie möglich zu verbergen, denn zu abgerissenen Jeans trug er ein schwarzes, mit weißen Puderflecken übersätes Hemd. Auch seine Hand fühlte sich staubig an, als hätte er sie kurz zuvor in Mehl getaucht. Er erwiderte mein Lächeln nicht, und während ich mich fragte, ob man ihn vielleicht gezwungen hatte, sich mit mir zu treffen, sagte ich: »Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mich zu sehen.«
Er nickte knapp. »Schon gut. Jude hat es verdient, dass ich mir alle Zeit nehme, die nötig ist.«
Ich beobachtete seine Körpersprache auf dem Weg zu einer freien Bank, die etwas abseits stand. Seine Hände waren ständig in Bewegung, fuhren durch sein Haar oder strichen über seine Oberschenkel. Zur Natur seines Zusammenbruchs hatte sich seine Mutter nicht geäußert, doch er musste schwer gewesen sein, wenn er beinah ein Jahr lang nicht mehr an der Universität gewesen war.
»Ich versuche, mir ein Bild davon zu machen, wie Judes Leben vor dem Angriff war. Erinnern Sie sich an die Wochen vor dem Überfall?«