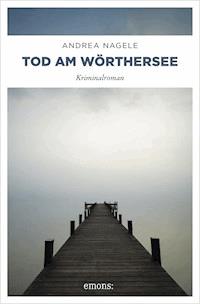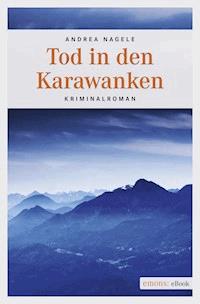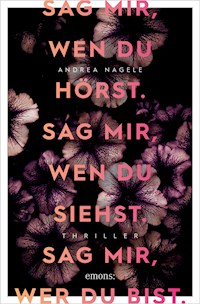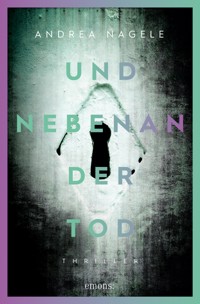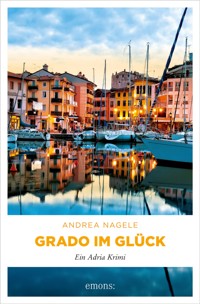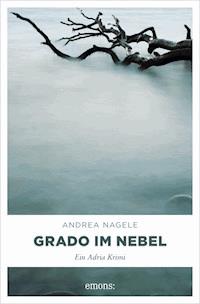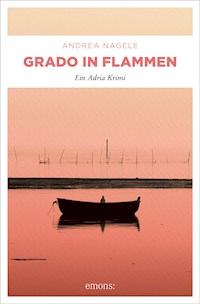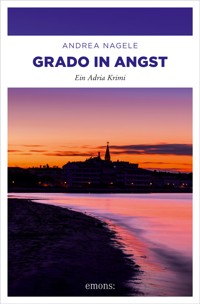Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissaria Degrassi
- Sprache: Deutsch
Wie alles begann: der erste Fall für Maddalena Degrassi. Ganz Grado genießt das herrliche Sommerwetter, da erschüttert ein mysteriöser Fall die Lagunenstadt: Am Strand verschwindet vor den Augen der badenden Gäste ein junges Mädchen. Für Maddalena Degrassi, frischgebackene Commissaria und als einzige Frau im Team von ihren männlichen Kollegen misstrauisch beäugt, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, der sie auf eine harte Probe stellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Andrea Nagele, die mit Krimi-Literatur aufgewachsen ist, leitete über ein Jahrzehnt ein psychotherapeutisches Ambulatorium. Heute arbeitet sie als Autorin und betreibt in Klagenfurt eine psychotherapeutische Praxis. Sie pendelt zwischen Klagenfurt am Wörthersee, Grado und Berlin.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2022 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Roberto Pastrovicchio/Arcangel.com
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Marit Obsen
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-890-0
Ein Adria Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für Maria, Nevio und Giuseppe
Prolog
Flirrt über Grado heute ein besonderes Licht?
Weit vorne liegt die Insel im matten Schein der Nachmittagssonne. Am Himmel tanzen federleichte Wolken in unterschiedlichen Grautönen. Ich kann mich kaum von ihrem Anblick lösen und auf die Fahrbahn konzentrieren.
Zum Glück gibt es nur wenig Verkehr auf der Straße. Die Badegäste aus der Region machen es sich noch in ihren Liegestühlen bequem, bevor sie sich mit einem guten Abendessen oder einem feinen Glas Wein vom heutigen Tagesaufenthalt verabschieden. Und die Urlauber bleiben ohnehin noch ein paar Tage. Die unzähligen An- und Abreisen erfolgen hier üblicherweise am Samstag. Dann ist »Schichtwechsel« in den Appartements und Hotels.
Meine große Wende hat bereits eingesetzt.
Vergnügt beginne ich zu pfeifen.
Ein wunderbares neues Leben liegt vor mir. Die Freude darauf ist unbeschreiblich.
Ich kurble das Fenster meines alten Fiat Panda nach unten und sauge die mit Salz und Jod getränkte Luft des nahen Meeres ein. Das Lenkrad dreht sich wie von selbst nach links und rechts, ohne den Wagen schlingern zu lassen. Das Gefühl, das mich erfasst, ist riesig. So tief wie das Meer, so grell wie das Schreien der Möwen. Säße ich nicht am Steuer, ich würde zu tanzen beginnen.
Endlich ist ein für alle Mal Schluss mit Traurigkeit, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Schon vor einer Weile habe ich meine Antidepressiva abgesetzt. Jahrelang musste ich das Zeug schlucken. An meiner Stimmung konnten die Tabletten jedoch nichts ändern. Außer schmerzhaften Magenkrämpfen jeweils eine halbe Stunde nach der Einnahme gab es kein nennenswertes Ergebnis. Mein dahingefristetes Dasein blieb von der Medikamenteneinnahme unberührt. Ebenso von der Gruppentherapie und den Einzelsitzungen. Ich hatte daran ohnehin nicht teilnehmen wollen und wäre ferngeblieben, hätte man nicht so beharrlich darauf bestanden. Die Fachleute glauben ja, alles hundertmal besser zu wissen als die Personen, denen so Schlimmes widerfahren ist wie mir. Mir auch noch den Kummer anderer anzuhören hat meine Lage nicht verbessert. Im Gegenteil, es zog mich noch ein Stück tiefer hinunter. Und die weisen Ratschläge meines Psychotherapeuten hatte ich selbstverständlich allesamt mühelos bei Dr. Google gefunden.
Schnee von gestern.
Ohne Belang.
Meine Welt ist jetzt schön wie keine andere.
Abrupt höre ich zu pfeifen auf, denn leise Musik aus dem Radio erreicht mich. Die spielen doch glatt meinen Lieblingssong.
»Perfect Day« von Lou Reed.
Schnell drehe ich den Regler auf volle Lautstärke und schmettere den Text mit.
Just a perfect day
Drink sangria in the park
And then later, when it gets dark
We go home
Die Glückshormone in mir wirbeln nur so durcheinander, rauschen wild durch meine Adern. Ich stelle sie mir als glitzernde Sternchen bildlich vor.
Just a perfect day
Feed animals in the zoo
Then later a movie, too
And then home
Oh, it’s such a perfect day
I’m glad I spent it with you
Oh, such a perfect day
You just keep me hanging on
You just keep me hanging on
Meine kehlige Stimme erfüllt den Innenraum des Autos. Die Straße, auf der ich mich befinde, heißt lapidar »352« und erstreckt sich ab der Autobahnabfahrt Palmanova als tolle Allee circa achtzehn Kilometer weit Richtung Grado. Da ich nur einen Teil der Strecke zurücklege, muss ich nicht lange fahren. Trotzdem bin ich auf dem kurzen Stück an so vielen schönen Wiesen, Feldern und Gebäuden, Weinlagen und einstigen, längst verfallenen Arbeiterunterkünften vorbeigedüst. Um das Notwendigste zu besorgen, musste ich ein paarmal anhalten. Ich war in einem Einkaufszentrum in der Nähe von Cervignano, im Supermarkt und in einem der Baumärkte. Überall habe ich ordentlich zugeschlagen. Über die notwendigen Nahrungsmittel hinaus besorgte ich auch eine beträchtliche Portion an Luxus.
In Gedanken an das Erworbene muss ich unwillkürlich schmunzeln.
Just a perfect day
Problems all left alone
Weekenders on our own
It’s such fun
Just a perfect day
You made me forget myself
I thought I was someone else
Someone good
Es stimmt, denke ich. Alles, was Lou Reed geschrieben hat, der gesamte Text, jedes einzelne Wort, stimmt haargenau. Ich bin durch dich, mein Schatz, ein besserer Mensch geworden. Jemand Gutes.
Gleich erreiche ich die Abzweigung nach Belvedere, dem bezaubernden Mini-Ort, aber dahin will ich nicht. Bei Gelegenheit werden wir beide dort ein Picknick veranstalten, und du hörst dir dann meine Erzählungen über Grado und die Lagune an.
Du weißt sicher nicht, dass der fünf Kilometer lange Damm, der die Insel mit dem Festland verbindet, erst im Jahr 1936, einer dunklen Zeit, erbaut wurde. Davor setzte man mit Booten über, um den Badeort zu erreichen.
Ich kann schon das Staunen auf deinem Gesicht sehen.
In meinem Bauch kribbelt die Freude, sie sprudelt wie die Bläschen eines frisch geköpften Proseccos aus dem Karst.
Oh, it’s such a perfect day
I’m glad I spent it with you
Oh, such a perfect day
Gerade als ich »You just keep me hanging on« schmettere, nähert sich von links oben ein Schatten.
Ein Kranich im Sturzflug, denke ich.
Dann kracht es sehr laut und wird auf einmal dunkel.
Sehr dunkel.
Erster Teil
1
Maddalena Degrassi strich die dunklen Locken aus ihrem Gesicht. Wangen und Stirn waren vor Aufregung feucht geworden. Ihr Herz pochte in einem stürmischen Rhythmus, so als wollte es ihr davonlaufen. In ihren Ohren rauschte das Blut, so nervös war sie.
Wie lange hatte sie diesen Tag herbeigesehnt. Sich so sehr darauf gefreut, dass sie es kaum mehr erwarten konnte, bis es Juni und endlich auch noch Montag wurde. Sehnsüchtig hatte sie die Tage, dann die Stunden gezählt. Und jetzt, da es so weit war, gab es nur noch dieses bange Gefühl.
Verdammt, worauf hatte sie sich da bloß eingelassen?
Seit dem Klingeln des Weckers heute Morgen drehten sich ihre Gedanken im Kreis.
»Franjo«, hatte sie geflüstert und ihren Freund zuerst sanft, dann heftig wach gerüttelt. »Amore, ich glaube, es war die falsche Entscheidung.«
»Was? Welche Entscheidung, Maddalena? Wovon redest du?« Verwirrt hatte er sich aufgesetzt, seine Arme um sie geschlungen und sie verschlafen angesehen. »Tesoro? Du zitterst ja. Was war die falsche Entscheidung?«
»Na, dass ich die Stelle bei der Kriminalpolizei in Grado angenommen habe.« Mit einem tiefen Aufseufzen hatte sie sich an ihn gekuschelt und den Kopf auf sein Schlüsselbein gebettet.
»Maddalena.« Er war mit ernstem Gesicht ein Stück von ihr weggerückt. »Das war ein Angebot, das du nicht ausschlagen konntest, die Möglichkeit, nach so langer Wartezeit endlich als Kommissarin Fuß zu fassen. Da ging es nie um eine Entscheidung. Es war doch von Anfang an klar, dass du die Stelle annimmst. Jetzt hast du Lampenfieber. Das ist ganz normal, hätte ich doch auch, Tesoro.«
Es stimmte.
Selbstverständlich hatte Franjo recht. Nur war es eben nicht er, sondern sie, die sich in Kürze in einem zu hundert Prozent mit männlichen Kollegen bestückten Polizeidezernat behaupten musste. Sogar die Schreibhilfe war ein Mann.
Was, wenn sie versagte?
Wenn niemand sie als Vorgesetzte ernst nahm?
Wenn sie sich nicht durchsetzen konnte?
Was, wenn sie für diesen Beruf überhaupt nicht taugte? Sich das bloß eingebildet hatte?
Unter der Dusche verteilte Maddalena Rosmarinshampoo auf ihrem Haar, schäumte es kräftig auf und spülte mit kaltem Wasser so lange nach, bis ihre Locken quietschten. Nachdem sie sich in ein Badetuch gewickelt hatte, setzte sie sich mit einer Tasse Espresso auf den Messingstuhl in der Ecke ihres kleinen Balkons. Mit gierigen Zügen rauchte sie eine halbe Zigarette und drückte sie dann im Aschenbecher auf dem Boden aus. Franjo streckte im selben Moment seinen Kopf durch die Tür und runzelte die Stirn.
»Du rauchst entschieden zu viel.« Er trat nach draußen, und Maddalena bemerkte, dass er etwas in der Hand hielt. »Für dich, kleiner Angsthase, zur Beruhigung. Ein voller Magen stärkt die Nerven.«
Das ist der Vorteil, wenn man einen Koch zum Freund hat, dachte Maddalena und sog den sich ausbreitenden Moschusgeruch ein. Fürsorglich, wie er eben war, hatte Franjo ihr ein weiches Ei im Glas zubereitet und Sommertrüffel darübergerieben.
Lächelnd setzte er sich neben sie. Er legte kurz seine Hand auf ihren Oberschenkel und streckte sie ihr dann auffordernd entgegen. »Das wird schon, meine Schöne. Du schaffst das mit links. Heute Abend lachen wir beide bei einem köstlichen Dinner über deine Aufregung, in Ordnung?«
Sie war sich da zwar nicht so sicher, schlug aber ein.
So begann der Tag schon besser.
Nach dem Frühstück zog sie murrend und stirnrunzelnd ihre neue Uniform an. Eine hellblaue Bluse zum blauen Blazer und einer Stoffhose, dazu schwarze, feste Schuhe.
»Du schaust aus wie ein Kind, das als Polizist auf einem Faschingsfest Furore machen möchte«, sagte Franjo schmunzelnd und bestärkte so ihren Unmut über die Verkleidung.
»Herzlichen Dank für den Vergleich. Die Schirmmütze setze ich eh nicht auf«, brummte sie und verzog sich abermals auf den Balkon.
Draußen über dem Meer baute sich eine dicke Wolkenwand auf. Obwohl es noch früh war, hing eine Dunstglocke über der Insel. Es würde heute schwül werden. Maddalena schob ihre Hand unter den steifen Kragen der Bluse und wischte den feinen Schweißfilm auf ihrer Haut mit den Fingern weg. Gedankenverloren schnippte sie Piniennadeln von der Brüstung und antwortete einsilbig auf Franjos Fragen. Wie sonst auch war er ihr nachgekommen; wohl um zu überprüfen, ob sie sich eine weitere Zigarette gönnte.
»Ja, ja.«
»Hast du überhaupt zugehört?«
»Mhm.«
Er schmunzelte zwar noch, aber Maddalena wusste, dass sie reagieren sollte, bevor seine Stimmung wegen ihrer offensichtlichen Nichtbeachtung seiner Person in Verärgerung umschlug. »Natürlich, Amore. Wir treffen uns am Abend in Dol pri Vogljah. Ich übernachte bei dir«, sagte sie deshalb schnell und ging ans Handy, das gerade zu läuten begann. »Papa!«, rief sie erfreut und spürte, wie eine warme Welle sie erfasste.
»Ich wollte dir Glück für deinen ersten Arbeitstag wünschen. Es geht dir doch gut?«
Es war nicht ungewohnt für Maddalena, dass ihr Vater ihre Gedanken lesen konnte und über ihre geheimen, oft widersprüchlichen Gefühle Bescheid zu wissen schien.
»Na ja … Ehrlich gesagt war ich kurz davor, zu dir in den Karst zu fahren. Aber Franjo hat mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.«
»Sag Maddy, sie soll unter keinen Umständen das Handtuch werfen«, tönte die kühle Stimme ihrer Mutter im Hintergrund. »Kneifen gilt nicht. Es wäre ihr zuzutrauen, das hatten wir doch alles schon.«
»Sibilla, also wirklich! Halte dich bitte etwas zurück«, entgegnete ihr Vater verärgert, und Maddalena lachte sich ins Fäustchen. »Unsere Tochter ist keine Drückebergerin und war es noch nie. Sie stand immer zu ihrem Wort.«
Mama konnte manchmal unmöglich sein und die falschen Worte zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt herausschieben. Doch ihr Vater verteidigte sie stets. Nicht dass sie es gebraucht hätte, aber es tat ihr gut und gab ihr eine Portion Sicherheit.
»Nach der Arbeit fahre ich zu Franjo, mache aber einen kurzen Zwischenstopp bei euch in Santa Croce.«
Franjo tippte auf seine Armbanduhr, und Maddalena beendete hastig das Gespräch. Wenn sie sich nicht ranhielt, würde sie an ihrem ersten Arbeitstag zu spät kommen.
2
Hannah wirbelte ihre kleine Tochter im Kreis herum.
»Juhu!«, schrie Pauline begeistert, und die blonden Haare flogen um ihr erhitztes Gesicht. »Noch einmal. Mama, bitte! Es ist so lustig.«
Beide hatten sie gerötete Wangen, und Paulines Augen funkelten vor Übermut.
»Okay. Ein allerletztes Mal.« Hannah musste über ihre unersättliche Neunjährige schmunzeln. Wie ein Kreisel ließ sie ihr Töchterchen über die Terrasse fliegen, schneller und immer schneller. Sie selbst hatte es als Kind sehr genossen, von ihrem Vater so durch die Luft gewirbelt zu werden.
Die Sonne warf schräge Strahlen vom Himmel. Fedrige Wolken durchzogen das helle Blau des Juninachmittags.
»So.« Hannah setzte Pauline ab und klemmte sich das feuchte Haar hinter die Ohren. »Jetzt ist es genug. Mir geht die Luft aus.«
Sie erwiderte das Lachen ihrer Tochter. Als sie ihre eigene Freude spürte und das Strahlen auf Paulines Gesicht sah, verkrampfte sie innerlich, und eine Welle von Erinnerungen überschwemmte sie.
»Was ist denn, Mama?«
Statt einer Antwort hielt Hannah den Finger vor die Lippen und stieß ihre Tochter unsanft von sich. Sie war machtlos, sich gegen die Bilder zu wehren, die auf sie einströmten, und nahm nur noch am Rande wahr, dass Pauline sich auf einen der Liegestühle setzte und den Daumen in den Mund steckte.
Es war der erste schöne Tag seit Langem. Der Februar hatte eine zarte Ahnung des herannahenden Frühlings aufkommen lassen, und Hannah fühlte sich wohl und geborgen in ihrer Welt. Vor ihr glitzerte der Schnee auf den Blumentöpfen, die sie vor Martins Geburt in den Keller zu tragen vergessen hatte. Sie lächelte verträumt in sich hinein.
Da war ein Geräusch, das sie nicht zuordnen konnte.
Hatte Martin zu weinen begonnen?
»Psst, Pauline! Ist das Martin?«
Die Kleine zog atemlos die Augenbrauen in die Höhe und lauschte.
»Ach nein.« Hannah schüttelte den Kopf. »Die neue CD von Max plärrt so. Nicht das Baby.«
»Mama.« Pauline zupfte an ihren Jeans und sah sie von unten herauf schelmisch an. »Einmal noch? Bitte.«
Und wieder ließ Hannah ihr kleines Püppchen durch die Luft fliegen, bis sie aus dem Wohnzimmer Friedrichs Stimme hörte.
»Na, meine beiden Süßen? Wohl schon vergessen, dass heute Abend ein rauschendes Fest steigt?«
Ihr Bruder Florian feierte heute seinen Geburtstag im Haus von Hannahs Familie. Nicht mehr lange, und die ersten Gäste würden eintreffen.
»Keineswegs. Alles ist vorbereitet, der Tisch gedeckt und unser Kleiner gebadet und gewickelt. Soll ich ihn dir bringen?«
»Nein. Lass mich, ich will ihn holen«, rief Pauline und hüpfte aufgeregt auf und ab.
Nur ungern überließ Hannah ihr diese Aufgabe. Sie konnte nicht genug von ihrem jüngsten Sohn bekommen, nie aufhören, seinen Duft einzuatmen und über seine zarte Haut zu streichen.
»Na los. Hol ihn, aber bitte pass auf. Fass ihn nicht zu fest an.«
Pauline nickte folgsam und brachte ihr den schlafenden Säugling. Vorsichtig streckte sie ihr den Kleinen entgegen. Ein Zipfel seiner Kuscheldecke hing herab.
Hannah strich ihrer Tochter über das verschwitzte Haar. »Gut gemacht«, raunte sie ihr zu.
In diesem Moment läutete es an der Tür.
»Ja, wen haben wir denn da?«, sagte Florian zur Begrüßung und drückte seine Schwester und das Baby fest an sich. Martin gab ein behagliches Seufzen von sich, öffnete seine Augen und begann zu nörgeln, kaum dass er richtig wach war. »Oh, da ist wohl jemand hungrig.«
Hannah ging mit Martin zurück ins Schlafzimmer. Dort gab sie ihm die Brust und konnte sich kaum von seinem zarten Gesichtchen losreißen. Zufrieden lächelnd legte sie ihr gesättigtes Baby in die Wiege. Sie verharrte noch einige Minuten bei ihm, beobachtete das regelmäßige Auf und Ab der kleinen Brust im hellblauen Strampler und wartete, bis ihr Jüngster friedlich eingeschlafen war.
Liebevoll streichelte sie seine samtig weiche Wange.
Die Zeit, die eben noch stillgestanden hatte, begann weiterzulaufen. Gut gelaunt ging sie ins Esszimmer. Auf einmal war sie bärenmäßig hungrig. Das Büfett war inzwischen geliefert worden und die Gäste eingetroffen. Es roch nach Frühlingszwiebeln, Erdbeeren, Zitronen und ein wenig nach Vanille. Ein später Sonnenstrahl tauchte das Wohnzimmer in ein rosa Licht, im Hintergrund lief Musik von David Gray.
Hannah betrachtete ihren Bruder. Er sah glücklich aus. So wie sie selbst.
Als ihre Gäste gegangen waren, räumte Hannah auf und sah nach ihren beiden älteren Kindern. Max schnarchte mit den Kopfhörern auf den Ohren. Pauline, die wie immer in ihrer Decke verkeilt dalag, hielt eine kleine Puppe im Arm. Hannah drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. Dann öffnete sie die Tür zu Friedrichs Arbeitszimmer.
Ihr Mann sah geistesabwesend hoch, lächelte sie an, holte tief Luft und vertiefte sich abermals in das dicke Gesetzbuch, das vor ihm auf dem Schreibtisch lag. Er arbeitete entschieden zu viel. Hannah beschloss, ihn demnächst mit einer Auszeit zu überraschen. Nur sie beide. Wie ganz zu Beginn ihrer Beziehung.
Mit diesem Vorsatz ging sie ins Schlafzimmer, knipste die Nachttischlampe an und beugte sich über Martins Wiege. Ihr Jüngster lag ganz ruhig da, sein zartes Gesicht erinnerte sie an das von Meissner Porzellanpüppchen. Sie starrte eine Weile auf seine Brust. Anders als vorhin senkte und hob sie sich nicht regelmäßig. Da stimmte etwas nicht.
Martin hatte zu atmen aufgehört.
»Friedrich«, schrie Hannah in Panik, »komm schnell. Das Baby!«
Ihr Mann stürzte ins Zimmer, nahm Hannah das Kind aus dem Arm und begann, Martins kleine Brust zu massieren.
»Ruf den Notarzt! Rasch!«
Nachdem sie wie in Trance den Notruf abgesetzt hatte, stand Hannah an der geöffneten Haustür, bleich, Augen und Mund weit aufgerissen, die Finger ineinander verknotet. Sie musste an sich halten, um nicht loszuschreien. Ohne Vorwarnung hatte jemand ihre kleine Welt auf ein Tablett gehoben, es durch die Luft geschleudert und auf dem Boden in Tausende Scherben zersplittern lassen.
Endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, tauchte ein Krankenwagen die Wohnsiedlung in wild flackerndes Blaulicht.
Ein Mann mit einem Ärztekoffer und zwei Sanitäter schoben Hannah beiseite. Sie taumelte. Dann, mit einem Mal, drangen Friedrichs Worte wie durch Watte zu ihr durch.
»Martin ist tot.«
»Mama?« Paulines Stimme holte sie zurück in die Gegenwart. »Bitte hör auf zu weinen. Spielen wir weiter. Dreh mich herum. Das ist schön.«
Und Hannah tat, was ihrer kleinen Tochter Freude machte. Sie drehte sich mit ihr im Kreis und lachte. Aber sie empfand nichts dabei. Der zuvor für einen kurzen Moment verspürte schwache Funken Lebensfreude war verpufft. Die Gefühle drangen nicht zu ihr durch. Das Einzige, was beharrlich durch ihren Kopf geisterte, war: Letztes Jahr im Februar ist es genauso gewesen. Wir haben gespielt und gelacht. Ich habe Pauline durch die Luft gewirbelt, und dann ist Martin gestorben.
3
»Hey, du.« Michaelas Stimme drang aus dem Telefonhörer.
»Ja?«, brummte er kurz angebunden.
»Keine Angst, Florian, das ist keine Anmache.«
»Aha«, murmelte er unangenehm berührt. Die Freundin seiner Schwester stand seit der Schulzeit auf ihn. Er mochte sie sehr, aber war sich nicht sicher, ob es gut wäre, wenn mehr daraus wurde.
»Pass auf, ich komme gleich zur Sache. Wir müssen über Hannah reden.«
Eigentlich wollte er sich weder Gedanken über seine Schwester machen noch sie mit Michaela analysieren müssen. Er hasste diese »Psychogespräche«, wie er sie nannte, aus tiefstem Herzen. Und dass es letztendlich darauf hinauslaufen würde, war ihm völlig klar.
»Vergiss es.«
»Nein. Es ist notwendig, und du weißt das ganz genau.«
Florian gab nach. »Okay, reden wir.«
»Wann?« Michaela ließ nicht locker.
»Vielleicht«, er zögerte, »jetzt?«
»Also dann im Arkaden-Café in der Innenstadt, in einer halben Stunde.«
Sie hatte aufgelegt, bevor er noch etwas erwidern konnte.
Eigentlich hatte er den Sonntagnachmittag faul verbummeln wollen. Trotz der Sonne am strahlend blauen Himmel vor dem Fenster fröstelte er und zog seinen grauen Hoodie enger um die Schultern.
Es war ja nicht so, dass er sich seit dem verhängnisvollen Abend seiner Geburtstagsfeier im vergangenen Jahr keine Sorgen um seine Schwester machte. Und nicht nur um sie, auch um Max und Pauline.
Er schlüpfte in seine Basketballschuhe und wickelte den blauen Seidenschal, den ihm seine Schwester vor Jahren geschenkt hatte, um den Hals.
Im Treppenhaus fiel ihm noch etwas ein, und er grinste. Schnell ging er zurück in die Wohnung und besprühte sich mit Aftershave. »Man kann ja nie wissen«, murmelte er feixend und schloss die Haustür mit einem energischen Ruck.
Die Hände tief in den Taschen seiner Kapuzenjacke vergraben, eilte er am Lendkanal entlang in die Innenstadt. Im schattigen Hof, in dem das Kaffeehaus lag, spürte er ein seltsames Gefühl in sich aufsteigen, das er nicht so recht einordnen konnte. Eine bunte Lichterkette baumelte vom Ast eines Baumes und bewegte sich im Wind.
»Hier! Hier bin ich.« Michaela winkte ihm zu, kaum dass er das Café betreten hatte.
Süß sah sie aus, wie sie da in ihrem rosafarbenen Shirt auf dem Sofa lümmelte.
»Zweimal vom trockenen Weißen mit viel Eis«, bestellte sie mit ihrer heiseren Stimme, ohne ihn zu fragen, klopfte auf das Kissen neben sich, und Florian ließ sich auf die geblümte Couch fallen.
»Also?« Fragend hob er eine Augenbraue.
»Hannah hat sich wieder völlig zurückgezogen. Es war doch schon besser. Sie geht nicht mehr ans Telefon, ruft auch von sich aus nicht mehr bei mir an, ich erreiche sie nicht. Zuerst dachte ich, es läge an mir, dass ich irgendetwas falsch gemacht hätte.« Michaela warf ihm einen sorgenvollen Blick zu.
»Sie durchleben eben eine schwierige Zeit. Das mit dem Baby hat sie und Friedrich völlig umgehauen.« Florian nahm einen großen Schluck Weißwein, während Michaela gedankenverloren an ihrem Strohhalm kaute. »Ich hatte gedacht, dass es ihr vielleicht guttun würde, zurück in die Kanzlei zu kommen, doch davon will sie nichts wissen. Meine Schwester war schon immer stur, aber das weißt du ja.«
»Außerdem ist da noch diese Sache mit –«
Bevor Michaela es aussprechen konnte, legte ihr Florian die Hand auf die Schulter. »Psst.«
Michaela zuckte zurück. »Auch wenn du es nicht hören willst, werde ich es jetzt sagen«, begehrte sie auf. »Hannah trinkt entschieden zu viel. Und ich kenne mich aus. Du erinnerst dich sicher noch an meinen Vater?«
Es war eine rhetorische Frage. Betroffen sah Florian an Michaela vorbei zum Fenster hinaus. Sein Blick verlor sich in den vom sanften Wind bewegten Ästen des Lindenblütenbaums. »Ich hatte gehofft, dass sich ihr Zustand durch den Sanatoriumsaufenthalt verbessern würde. Dass die Therapie ihr helfen würde, mit Martins Tod klarzukommen. Aber sie ist immer noch völlig fertig und will oder kann mit niemandem über das Baby reden«, sagte er.
»Kurz hatte ich den Eindruck, es wäre danach leichter für sie geworden. Aber vielleicht ist es ja immer noch zu früh.« Michaela fuhr sich mit der Hand über ihre Augen. »Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn mir so etwas passiert wäre.«
Vielleicht sollte er Michaela doch einmal zum Abendessen einladen? Dass er es bis jetzt nicht getan hatte, lag an seinen ambivalenten Gefühlen.
Wer ließ sich schon gern mit der besten Freundin der eigenen Schwester ein? Wenn das schiefging, brachte das nur Ärger. Er sah ihr lausbubenhaft grinsend in die schönen Augen unter den langen, geschwungenen Wimpern und fragte: »Na, was meinst du, wollen wir uns mal eine Pizza gönnen?«
Michaela blickte ihn ernst an. »Das hätten wir schon lange mal machen sollen. Jetzt will ich nicht mehr.«
Gekränkt zog sich Florian in sich zurück.
Michaela begann, nervös mit ihrem linken Bein auf und ab zu wippen. Sie trug Schnürsandalen, die ihren Fuß und den halben Unterschenkel mit einem Rautenmuster überzogen. »Wenn ich wegen Hannah irgendetwas tun kann, lässt du es mich wissen, Florian, ja?«
»Versprochen«, murmelte er, schon wieder versöhnt.
Dann schlürften beide einige Zeit schweigend ihren Wein.
Draußen hatte inzwischen die Dämmerung eingesetzt, und die Lichterkette warf ihren matten Schein in den Innenhof des Cafés. Die Anspannung zwischen ihnen verflüchtigte sich.
4
Maddalena saß Franjo in seinem Gasthaus gegenüber.
Selten hatte ihr etwas von ihm Zubereitetes so gut geschmeckt. Daran konnte nicht mal die grimmige Miene seines Kellners Miroslav oder die barsche Art seiner Mutter Mateja etwas ändern. Beide begegneten ihr vom ersten Tag ihres Kennenlernens an mit Argwohn.
Natürlich störte Maddalena dieses Misstrauen, diese unverhohlene Ablehnung. Doch Franjos Liebe wog alles auf. Wenn er ihre Verunsicherung bemerkte, nahm er sie in die Arme und flüsterte in ihr Ohr: »Sie verhalten sich wie die Kapaune draußen im Hof. Sind viel zu lange von mir gemästet worden. Eifersüchtiges Federvieh.«
Maddalena musste jedes Mal lachen, wenn sie sich die Szene bildhaft vorstellte: Franjo, der seiner Mutter und seinem Kellner Futter gab, und wie die beiden kreischend versuchten, dem anderen die besten Körnchen wegzuschnappen.
»Du«, begann sie, »mein Chef Comandante Achille Scaramuzza ist unausstehlich. Ich weiß, wie oft ich dir seit meinem ersten Arbeitstag schon von ihm vorgejammert habe, aber unser Verhältnis ist einfach schrecklich, und er ist ein wahrhaft grauenvoller Vorgesetzter, ohne jegliche Führungskompetenz. Du hättest nur mal sehen sollen, wie er mich und meine vorgeschriebene Dienstkluft aus seinen Schweinsäuglein von oben bis unten gemustert hat, um dann lapidar zu bemerken: ›Junge Frau, Sie können sich Ihre Garderobe selbst auswählen. Hat Ihnen das niemand gesagt?‹ Ich stand wie belämmert vor ihm, und in meinen Ohren sang das Blut seine Worte nach.«
»Woraufhin du, Tesoro, ihm auf deine höchst spezielle Art Paroli geboten hast, indem du am darauffolgenden Tag in deinen ältesten Jeans und der verschlissenen Lederjacke bei ihm aufgetaucht bist.« Franjo grinste und strahlte sie an. »Das wird dem alten Kerl sicher zugesetzt haben. Er dachte, du würdest dich ihm unterordnen.«
»Amore. Was hat das mit meiner Kleidung zu tun?«, fragte sie leichthin und trank einen Schluck von ihrem Prosecco.
»Nun, Scaramuzza hoffte vermutlich, du würdest ihn um Rat fragen bezüglich des nicht vorhandenen Dresscodes. Maddalena, du weißt selbst am besten, auf wie vielen unterschiedlichen Ebenen sich Widerstand zeigen kann. Und klar, Klamotten gehören dazu. Erinnere dich nur mal an die Hippies aus den Sechzigern des vorigen Jahrhunderts. Die haben damit doch auch ihr Statement gegen das Establishment gesetzt.«
Jetzt musste sie kichern. Scaramuzza war für sie wirklich der Inbegriff jener übrig gebliebenen Spezies, mit der sie nur schwer zurechtkam: von sich eingenommene, bornierte Frauenhasser, die sich für die herrschende Gesellschaftsklasse und die wiederum für einen reinen Männerclub hielten. »Die Augen sind ihm und seiner beziehungsweise eigentlich nun auch meiner Mannschaft aus dem Kopf gefallen.«
»Siehst du? Du beginnst bereits, dich durchzusetzen.«
Maddalena stand auf und umarmte Franjo innig. Sein verwegener Geruch nach Küchenkräutern, Schweiß und einem Hauch Aftershave warf sie regelmäßig um.
»Du raubst mir meinen Verstand«, murmelte sie und küsste seine erhitzte Wange.
»Dein Hirn solltest du definitiv behalten.« Er erhob sich ebenfalls und zog sie leise lachend die Treppe zu seinem Schlafzimmer hinauf. Gemeinsam stolperten sie über die Unmenge an Kochbüchern, die auf dem Boden verstreut lagen. Durch das geöffnete Fenster trug ein frisches Lüftchen den Duft von Piniennadeln herein und kündigte einen verheißungsvollen Sommer an. Dass unten die Hühner oder Kapaune oder wie die Viecher hießen um die Wette schrien, tat Maddalenas Stimmung keinen Abbruch. Mit dem Zirpen der Grillen und dem Sirren der dieses Jahr zu früh aktiv gewordenen Moskitos vermischte es sich für sie zu einer lieblichen Melodie.
Genau wie Franjo hatte auch der Karst seit jeher diese besondere Wirkung auf sie. Selbst ein Kind dieser magischen Landschaft, fühlte sie sich hier aufgehoben und geborgen. Die Unterschiede zwischen der italienischen und der slowenischen Seite trugen mit dazu bei, ihre Sinne anzuregen.
»Ach, wenn ich nur den Text zu diesem Lied kennen würde«, wisperte sie in Franjos Ohr.
Er hielt sie ein Stück von sich weg. »Commissaria, Sie sprechen in Rätseln.«
Dann lachten beide, und Franjo zog sie auf sein Bett. »Deine Lederjacke ist so etwas von bockig. Wie konntest du dein Essen so überhaupt genießen? Zieh dich aus. Augenblicklich.«
Das war ein Befehl, dem Maddalena gern nachkam.
5
Pauline konnte wieder einmal nicht einschlafen. Die Neunjährige drehte sich von einer Seite auf die andere, versuchte, Schäfchen zu zählen, die über die Himmelswiese stolperten. Selten kam sie über das neunzehnte Lämmchen hinaus. Nicht dass sie vorher eingeschlafen wäre, nein, viel eher wurde sie durch das Zählen erneut hellwach.
Sie setzte sich aufrecht hin und spitzte die Ohren. Ihre Eltern stritten schon wieder. Das taten sie ständig in letzter Zeit. Sie glaubten, dass ihre Tochter sie nicht hören konnte, doch Pauline verstand durch die Mauern hindurch fast jedes Wort.
Ihr Kinderzimmer lag Wand an Wand mit dem Schlafzimmer ihrer Eltern. Dort hatte früher auch Baby Martin gewohnt. Sie hörte ihren Vater wütend auf und ab gehen und mit lauter Stimme auf ihre Mutter einreden. Üblicherweise schimpfte ihr Vater nur mit ihrem Bruder so. Max war seit einiger Zeit schrecklich ungehorsam, und Papa bezeichnete ihn als »Punk«.
Als sie das Wort zum ersten Mal gehört hatte, dachte sie, er sei mit seinen dreizehn Jahren ein Bankdirektor geworden. Sie war mächtig stolz auf ihn gewesen und hatte nicht verstanden, worüber ihre Eltern sich die ganze Zeit ärgerten, denn es war doch wirklich egal, dass Max dieses Jahr in der Schule durchfallen würde, wenn er ohnehin schon in einer Bank arbeitete.
Als sie ihre Eltern am darauffolgenden Sonntag beim gemeinsamen Mittagessen gefragt hatte, ob sie selbst vielleicht auch bei der Bank arbeiten könnte, hatten diese sie zuerst nur verständnislos angesehen. Max hatte es gleich kapiert und die Augen verdreht, bis Pauline nur noch das Weiße sehen konnte, sich aber nicht dazu geäußert.
Sie bewunderte ihren Bruder. Oft sagte er, wenn es niemand anderer hören konnte, dass er sie nicht lieb hätte, sie eine Nervensäge sei und ihm unendlich auf den Geist ginge. Neulich hatte er sie beiseitegenommen und ihr ins Ohr gezischt: »Du weißt doch, dass ich lieber einen Bruder statt einer doofen Schwester gehabt hätte?«
Da hatte sie an Martin denken müssen und sich bemüht, die aufsteigenden Tränen hinunterzuschlucken. Aber ein paar waren ihr doch über die Wangen gelaufen. Ihr Bruder hatte sie böse angesehen und »Heulsuse« gemurmelt.
Das machte ihr aber alles nichts aus, weil sie wusste, dass Max sie eines Tages mögen würde. Sie musste nur geduldig warten und ihm nicht allzu sehr auf die Nerven gehen.
Ihr großer Bruder war nämlich der klügste Mensch, den sie kannte, er wusste einfach alles. Das war ein Geheimnis, denn Max wollte nicht damit angeben, aber egal, was sie ihn fragte, er wusste auf alles eine Antwort. In seinem Zimmer stand ein Computer, vor dem er die meiste Zeit hockte. Oft schimpften die Eltern deshalb mit ihm. Mama wurde manchmal in seine Schule gerufen, weil Max wieder irgendetwas angestellt hatte. Wenn sie dann nach Hause kam, schloss sie sich immer mit Papa in dessen Arbeitszimmer ein, aber wenn Pauline ihr Ohr ganz fest an die Tür presste, konnte sie hören, wie sie sich gegenseitig die Schuld daran gaben, dass Max so war, wie er war.
In der Schule hatte er sich unlängst während der großen Pause auf der Toilette die Haare abrasiert und nur einen schmalen Streifen mitten auf dem Kopf stehen lassen. Den hatte er dann grün angemalt.
Zu Hause hatte er ihr erklärt, dass diese Frisur Irokesenschnitt genannt wurde. Sie käme von den Indianern und sei das Coolste überhaupt. Pauline fand das toll und war stolz auf ihren Bruder. Den Eltern gefiel die neue Frisur allerdings nicht.
Erwachsene konnten manchmal sehr dumm sein und Eltern erst recht.
Jetzt stritten sie so laut, dass Pauline alles hören konnte.
»Du glaubst wohl, ich durchschaue dich nicht? Du säufst!«, schrie ihr Vater.
Ihre Mutter keifte zurück: »Das ist eine Lüge. Niemand trinkt und ich schon gar nicht. Sei sofort leise, reiß dich zusammen, die Kinder können dich hören!«
Da hielt Pauline sich die Ohren zu, schüttelte ihre blonden, langen Locken und lauschte auf ihr Herz, das wild gegen ihre Rippen trommelte. Sie hatte Angst, dass ihr Vater ihre Mutter schlagen würde. In der Schule hatten sie einmal einen Film darüber gesehen, darin hatte ein Mann eine Frau geohrfeigt, und die Lehrerin hatte danach mit ihnen über Gewalt gesprochen.
Das Sorgenpüppchen fiel ihr ein. Ihr Freund Niki hatte es ihr zur Geburtstagsparty mitgebracht. Sie glaubte zuerst, dass er ihr gar nichts schenken wolle, da er ohne Geschenk gekommen war. Erst später, als die anderen Kinder aus ihrer Klasse nach Hause gegangen waren, hatte Niki sein Päckchen geholt. Eigentlich war es ein großes Paket gewesen, mit ganz viel Papier drum herum.
Niki hatte ihr ernst erklärt, dass sie das Püppchen unter ihr Kopfkissen legen müsse, wenn sie Sorgen hätte. Dann seien die Sorgen am nächsten Morgen verschwunden, und alles käme wieder in Ordnung. Sie hatte an ihren kleinen Bruder denken müssen, der dadurch nicht wieder lebendig werden würde, und dass überhaupt nichts mehr in Ordnung war. Aber das hatte Pauline Niki nicht gesagt.
Jetzt nahm Pauline ihr Sorgenpüppchen aus dem Kasten, in dem sie es aufbewahrte, und streichelte ihm über den winzigen Kopf. »Bitte, Püppchen, mach, dass die Eltern sich wieder lieb haben.«
Dann legte sie das Figürchen unter ihr Kissen und presste ihr heißes Gesicht in den frisch gewaschenen Stoff mit den rosafarbenen Mäusen.
Kurze Zeit später schlief sie ein.
6
Maddalena vergrub sich in Arbeit.
Nur das half ihr über den Schmerz hinweg. Sie stand eindeutig unter Schock. Dennoch hatte sie weitergemacht und nur einen Tag Auszeit für das Begräbnis und einen weiteren Nachmittag für den Besuch beim Notar genommen.
Ihr heiß geliebter Vater war Ende Juni, wenige Wochen nach ihrem ersten Arbeitstag als Kommissarin, bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen.
Allein der Gedanke an das Sterben ihres Vaters nahm Maddalena die Luft zum Atmen.
War sie mit schuld an seinem Tod?
Sah ihre Mutter das womöglich auch so?
Ein Thema war das bisher nicht zwischen ihnen gewesen. Vermutlich hatten sie es beide bewusst ausgespart. Denn sonst hätten sie auch ihren Streit ansprechen müssen. Beide hatten sie sich Sorgen um Papas Gesundheitszustand gemacht, denn sein Blutdruck schlug wieder mal Kapriolen, und ihn daher vereint gezwungen, den Arzt aufzusuchen. Doch nach ihrem Nachtdienst war Maddalena erschöpft gewesen – und erleichtert, als ihr Vater darauf bestand, die Moto Guzzi zu nehmen, statt sich von seiner Tochter im Dienstwagen fahren zu lassen. Ihrer Mutter war das nicht recht gewesen, und sie waren an jenem Tag nach heftigen Worten unversöhnt auseinandergegangen. Maddalena wäre fast nicht ans Telefon gegangen, als der Anruf ihrer Mutter sie erreichte. Weinend hatte sie ihr vom Unfall ihres Vaters berichtet. Beim Abbiegen auf die belebte Küstenstraße Strada Costiera war er mit seiner Moto Guzzi gestürzt und sofort seinen Verletzungen erlegen.
Maddalena öffnete einen Ordner mit alten Fällen und vertiefte sich in die Unterlagen. Doch sie konnte sich beim besten Willen nicht auf ihre Arbeit konzentrieren.
Ihr geliebter Vater lag begraben auf dem Friedhof in ihrem Heimatdorf, das gut zweihundert Meter über dem Meer auf dem kluftigen Felsen thronte. Einen Grabstein gab es noch nicht. Nur die aufgeworfene Erde, in der das schlichte Holzkreuz steckte, bedeckt mit Kränzen und Gestecken.
Maddalena stand auf und öffnete das Fenster. Schwüle Hitze schlug ihr entgegen, und sie schnappte nach Luft. Schnell schloss sie es wieder und holte den Tischventilator vom Schrank. Die wirbelnde Kühle beruhigte sie. Von ihrem Schreibtisch aus starrte sie hinaus aufs Meer. Weit draußen zog gemächlich ein Frachter oder ein Tankschiff vorbei. Die Möwen keppelten und schrien einander an. Sie konnte ihrem Gezänk durch die geschlossenen Scheiben folgen. Am liebsten hätte Maddalena mit ihnen um die Wette gebrüllt und so ihrem Kummer Ausdruck verliehen. Traurig strich sie eine widerspenstige Locke aus ihrem Gesicht und schluckte tapfer die Tränen hinunter.
Sie musste sich zusammenreißen, erwachsen handeln, durfte sich ihrem Kummer nicht uneingeschränkt hingeben. Vor allem aber musste sie Haltung bewahren. Sie wurde so oder so schon nicht für voll genommen, und ein Zusammenbruch würde ihrem Image, an dem sie hart arbeitete, bloß schaden.
Aber sie vermisste Papa so sehr, diesen großartigen, gütigen Menschen, der ihr so viel beigebracht hatte. Wie gern hätte sie sich jetzt in seine Arme geschmiegt und ihn gefragt, warum er sie so früh hatte verlassen müssen.
»Commissaria, Chefin?«
Von Maddalena unbemerkt, war einer ihrer Mitarbeiter, Piero Zoli, in ihr Büro gekommen.
»Zoli, was gibt es?«
Der Kollege zuckte zusammen und wurde rot. Auf seiner Stirn schwoll eine Ader an. Ihr Ton war eine Spur zu barsch gewesen, aber daran ließ sich nun nichts mehr ändern.
»Ich habe ge… geklopft, aber …«, stotterte er verlegen.
Sie zwang sich zu einem Lächeln. »Ist schon gut, Zoli.«
Jetzt erst bemerkte sie, dass sich seine Hand um eine längliche Thermoskanne krampfte. Kamillentee für ihre aufgewühlten Nerven? Selbstverständlich wussten alle über ihren tragischen Verlust Bescheid, und die Gerüchteküche gab noch einiges an Gewürzen dazu. So viel stand fest.
»Danke, nach Kräutertee steht mir jetzt nicht der Sinn. War sicher nett von Ihnen gemeint.«
»Ich habe doch keinen Tee mitgebracht. Wo denken Sie hin? Espresso, Commissaria?«
Sie musterte ihn überrascht. »Den lehne ich nicht ab.«
In Maddalena regte sich Dankbarkeit. Zoli war ein schüchterner Zeitgenosse, von der Natur mit seiner Hakennase und einem schmächtigen Körper nicht eben gesegnet. Sie hatte ihn bisher als sowohl den Kollegen wie auch ihr gegenüber zurückhaltend erlebt.
Ein Lächeln überzog Zolis Gesicht. Eifrig goss er das dunkle Gebräu in eine kleine Espressotasse. Maddalena nahm sie über ihren Schreibtisch hinweg entgegen.
»Das riecht ja köstlich, fast so, als hätten Sie die Kaffeebohnen eben erst frisch geröstet.«
Zoli errötete. »Mama. Meine Mutter. Sie macht den besten Kaffee auf der Welt. Ich meine … also –«, stammelte er und brach dann befangen ab.
Nach dem ersten Schluck setzte Maddalena die Tasse ab. »Kompliment. Ich gebe Ihnen unumwunden recht. Es ist entschieden der beste Espresso, den ich seit langer Zeit getrunken habe.«
»Ich werde Ihnen, wenn es Sie nicht stört, immer mal wieder eine Dosis davon zukommen lassen.« Er lächelte sie an, und Maddalena lächelte zurück.
»Darüber würde ich mich freuen.«
Das Eis zwischen ihnen beiden war durch diese Geste eine Spur brüchiger geworden. Es ist ein Anfang, dachte Maddalena. Ein Schritt nach dem anderen, nur nichts überstürzen. Immer noch rivalisierten die Kollegen mit ihr, wollten nicht akzeptieren, dass sie als Frau und Neuzugang einem Männerteam vorstand, während Maddalena hartnäckig um ihre Anerkennung kämpfte.
Ihr Arbeitsplatz lag in einer schönen Gegend nahe dem Meer. Obwohl das Gebäude sie äußerlich an ein abweisend streng gehaltenes Militärgefängnis erinnerte, mochte sie es, denn im Inneren angelangt, fand man sich in längst vergangenen Zeiten wieder. An diesen Räumlichkeiten war die Moderne beinahe spurlos vorübergegangen. Alles hier war staubig und alt. Sogar der Geruch erinnerte an unbewohnte Dachkammern, die nie gelüftet wurden. Die Holzwürmer arbeiteten sich durch das Gebälk und die Bretterböden. Die Computer, obwohl ebenfalls nicht die neuesten Modelle, muteten in dieser Umgebung wie futuristische Objekte an.
Dennoch lag für Maddalena durchaus etwas Reizvolles in diesem offensichtlichen Widerspruch zwischen Altem und Neuem.
Gleich am zweiten Tag hatte sie sich zum Erstaunen ihrer Mannschaft einen ergonomischen Stuhl bestellt, um eventuell auftretenden Rückenproblemen vorzugreifen. Hinter dem schweren Holzschreibtisch wirkte er auf interessante Weise deplatziert.
Der Nachmittag zog sich endlos hin, und sie überlegte, ob sie hier nur als Platzhalterin für die Frauenquote angestellt worden war, denn es geschah kaum etwas auf der Insel der Sonne außer ein paar Diebstählen, einem Einbruch in eines der Ferienhäuser und zwei Autounfällen mit Blechschäden.
Es klopfte, und diesmal hörte Maddalena es.
»Herein!«, rief sie wohlwollend, weil sie mit Piero Zoli rechnete.
Doch nicht er, sondern Franjo stand vor ihr. Seine Augen unter dem hellen Haar funkelten, und Maddalenas Herz schlug schneller.
»Tesoro.«
»Amore.«
Sie sprang auf und eilte auf ihn zu. Erleichtert lehnte sie sich an ihn und ließ sich von seinen Armen umfangen. Wie gut er roch. Endlich kam so etwas wie Vorfreude in ihr auf. Sie hatte ganz vergessen, dass sie zum Abendessen bei Gianni verabredet waren.
Sie runzelte die Stirn. Obwohl sie sich eine gefühlte Ewigkeit durch alte Akten gewühlt hatte, war die Zeit nicht stehen geblieben.
»Bist du so weit?« Franjo hielt sie ein Stück von sich weg und musterte sie eingehend. »Du brauchst ein ordentliches Steak und mindestens eine Ofenkartoffel. Du bist so mager«, stellte er besorgt fest.
»Du weißt, wie schwer es mir seit Papas Tod fällt, ein Essen zu genießen.«
»Trotzdem, Tesoro, du musst bei Kräften bleiben. Ausreichend Nahrung und guter Schlaf sind nun mal die Grundvoraussetzungen dafür. Sonst klappst du irgendwann zusammen. Und das willst du doch nicht.«
Arm in Arm verließen sie das Gebäude und scherten sich nicht um die neugierigen Blicke, die ihnen folgten.
7
Niemand war schuld daran.
Plötzlicher Kindstod, SIDS, hieß ihr Alptraum in der Fachsprache. Die Babys starben im Schlaf. Sie hörten ganz einfach zu atmen auf.
Die Tragödie konnte nicht verhindert werden, doch alle quälten sich mit Schuldgefühlen, glaubten, es hätte an ihnen gelegen, sie hätten etwas übersehen und im entscheidenden Moment versagt. Es gab in Hannahs Familie keine Risikofaktoren. Niemand rauchte, Martin schlief in Rückenlage im eigenen Bettchen, wurde voll gestillt, und trotzdem war es geschehen.
Gerade hatte sie voll bepackt mit Einkaufstaschen die Wohnungstür aufgestemmt, da hörte sie auch schon das Telefon schnarren.
»Warum geht denn niemand dran?«, rief sie verärgert, bis ihr einfiel, dass Friedrich noch im Gericht war und Max und Pauline in der Schule.
Sie stellte die schweren Tüten auf dem Boden ab, schob die Tür mit dem Fuß ins Schloss und betrat das Vorzimmer. Das Läuten hatte inzwischen aufgehört.
»Typisch«, sagte sie.
Max hatte wieder einmal die Einstellungen am Anrufbeantworter verändert, wodurch es ihr jetzt nicht möglich war, zu erkennen, wer angerufen hatte. Sie vermutete, dass es Michaela oder Florian gewesen war.
Da Hannah ohnehin mit keinem der beiden reden wollte, konnte es ihr eigentlich nur recht sein, dass Max alles verstellt hatte. Dadurch war sie aus dem Schneider und musste nun niemanden zurückrufen.
Sie liebte ihren Großen sehr, nur wurde sie in letzter Zeit nicht schlau aus ihm. Genau genommen seit … Sie hielt erschrocken inne und verbot sich jeden weiteren quälenden Gedanken.
Kurz entschlossen ließ sie sich auf einen der kühlen Stühle am Esstisch fallen und zog ihr Handy aus der Tasche ihrer Jacke. Sie wählte Friedrichs Nummer. Es läutete, doch wie so oft in den letzten Monaten hob er nicht ab. Ungeduldig trommelte sie mit dem Mittelfinger auf die Stuhllehne. Tok, tok, tok machte es, tok, tok, tok.
Geh ran, beschwor sie ihn lautlos, rette mich, ich brauche dich.
Nach einer Weile hängte Hannah enttäuscht auf, goss sich ohne Umschweife und völlig automatisch ein großes Glas Cognac ein und setzte zum Trinken an. Mit wohligem Schauer spürte sie, wie sich die Hitze des Alkohols in ihrem Körper verteilte und sie sich langsam entspannte und gleichgültig wurde.
Ist doch einerlei, ob Friedrich mir beisteht, dachte sie. Verloren bin ich so oder so. Nichts wird mir mein Baby zurückbringen. Nichts. Verzweifelt schlug sie mit dem Fuß gegen das Tischbein.
»Au!«, rief sie und war froh darüber, den Schmerz zu spüren. Wenigstens taten jetzt ihre großen Zehen weh und nicht das dumme Herz.
Schnell schenkte sie sich ein weiteres Glas ein. Irgendwo mussten noch die Beruhigungstabletten aus dem Sanatorium liegen, fiel ihr ein, und sie wankte, schon leicht benommen, ins Schlafzimmer.
»Da seid ihr ja, ihr frechen Dinger«, nuschelte sie, als sie die blauen Pillen gefunden hatte, und torkelte zurück ins Esszimmer.
Dort nahm sie vier auf einmal und spülte sie mit dem Cognac hinunter.
Pauline kommt heute erst spät aus der Schule, überlegte sie noch, bis dahin bin ich wieder fit, und Max, hmm … Max …
Dann kippte ihr Kopf nach vorn, und Hannah vergaß für einige Zeit das Grübeln. Ihr Hirn wurde von glitzernden Babybildern überschwemmt.
Leise fing sie zu weinen an.
Ihre Tränen vermischten sich mit ihrer Wimperntusche und rannen in schmalen schwarzen Bächen ihre Wangen hinab.
Zwischendurch schluchzte sie immer wieder hart auf und biss sich auf die trockenen Lippen.
So lange, bis sie Blut schmeckte.
8
Max biss in sein Pausenbrot. Er hockte gemütlich auf einer Parkbank, hatte sein schwarzes T-Shirt mit dem roten Stern ausgezogen und spürte, wie die Sonne seinen Bauch wärmte. Bald war der Unterricht zu Ende.
Schnell rechnete er nach, wie lange er alles in allem brauchen würde und wann er losmusste, um so zu Hause anzukommen, dass es niemandem auffiel, dass er gar nicht in der Schule gewesen war. Mit dem Bus würde es knapp werden, aber er wollte auf alle Fälle noch auf Joey warten.
Er holte den Joint, den er schon vorbereitet hatte, aus der Blechschachtel in seinem zerschlissenen Schulrucksack, zündete ihn an und sog den Rauch tief ein. Joey besaß ein paar Marihuanapflanzen, die sie letzten Sommer heimlich gemeinsam angebaut und deren Blätter sie selbst geerntet und getrocknet hatten.
»Hey, Alter«, lispelte Joey, als sie kurz darauf neben ihm stand, und ließ sich auf seine angewinkelten Knie plumpsen.
»Autsch, du tust mir weh.« Verärgert zog er sie an ihrem Nietengürtel von sich herunter.
»Gib mir auch einen Zug, alles scheiße heute. Hab die Italienisch-Schularbeit verhauen.« Joey wartete nicht ab, sondern nahm ihm den Joint aus der Hand und zog daran.
Max’ Handy begann schrill zu klingeln.
»Shit«, sagte er mit Blick auf das Display, »der hat mir gerade noch gefehlt.«
»Wer?« Joey bog das Telefon zu sich und las lachend vor, was dort stand: »Erzeuger.« Dabei stieß ihre Zunge gegen ihre Zahnspange und verwandelte den s-Laut in ein Zischen.
Max hob ab.
Aus Erfahrung wusste er, dass er sich der elterlichen Aufsicht so besser entziehen konnte.
»Hat Mama dich angerufen?«, fragte sein Vater, ohne ihn zu begrüßen.
»Wieso sollte sie?«, blaffte Max ungehalten. »Während des Unterrichts stört sie mich nicht.«
»Mama hat mir in der letzten Stunde viermal auf die Mailbox gesprochen. Sie war aggressiv und ihre Stimme undeutlich und verwaschen.«
»Warum nervst du mich mit dem Schrott, Alter? Kümmere dich selbst darum. Sie ist deine Frau.«
Seine Mutter hatte also mal wieder zu tief ins Glas geschaut, und das schon am Vormittag. Das war ja nichts Neues.
Er war so wütend auf sie. Alles drehte sich nur noch um ihren Kummer. Ja, dass Martin zu atmen aufgehört hatte, war schlimm und schrecklich traurig. Für sie alle. Auch er litt unter dem Verlust des kleinen Zwerges. Und Pauline erst recht.
»Bist du schon auf dem Heimweg, Max?« Die Stimme seines Vaters war eindringlich. »Ich komme hier nicht weg. Habe noch eine Verhandlung. Ich möchte nicht, dass Pauline Mama in diesem Zustand sieht.«
»Verstanden«, entgegnete Max trocken. »Dann schwänze ich hiermit offiziell und mit der Genehmigung eines Richters den Nachmittagsunterricht.« Er beendete das Gespräch und warf sein Handy ins Gras. »Die blöden Alten. Die bringen nichts auf die Reihe.«
Er nahm Joey den Joint ab, warf ihn nach zwei tiefen Zügen auf den Boden und zertrat den Stummel mit der Schuhspitze.
Warum muss Mama bloß alles kaputt machen, fragte er sich still.
»Ich muss los.«