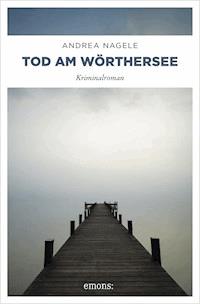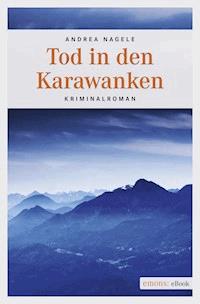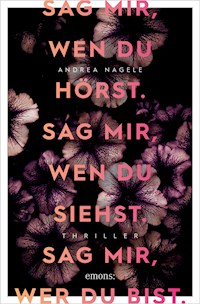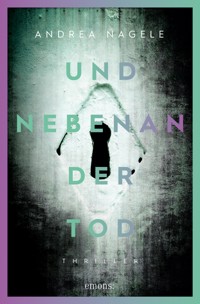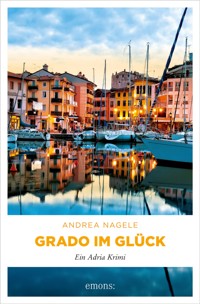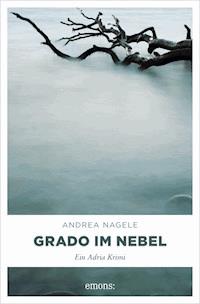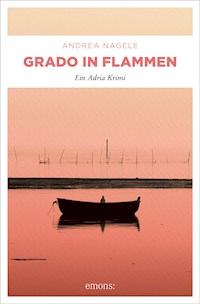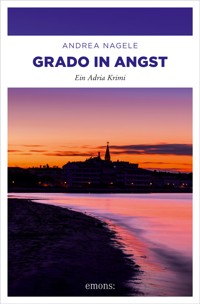Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissaria Degresse
- Sprache: Deutsch
An einem regnerischen Junitag muss Angelina Maria mit ansehen, wie eine junge Frau im Meer ertrinkt. Aber niemand schenkt ihr Glauben. Als jedoch eine weitere Frau verschwindet, muss Kommissarin Degrassi erkennen, dass ein Mord stattgefunden hat - und die beschauliche Ruhe in Grado weicht einer bedrohlichen Atmosphäre der Angst. Dunkle Wolken an der Adriaküste: ein intensiver Psychothriller.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andrea Nagele leitete über ein Jahrzehnt ein psychotherapeutisches Ambulatorium und ist mit Krimi-Literatur aufgewachsen. Neben dem Schreiben betreibt sie heute eine psychotherapeutische Praxis. Sie lebt mit ihrem Mann in Klagenfurt am Wörthersee und in Grado.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: ©mauritius images/Alamy Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Marit Obsen eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-962-2 Ein Adria Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Diesen Krimi widme ich meiner Freundin Ursula
und Franco, il mio amico Gradese.
Prolog
»Alle auf den Boden. Niederlegen, auf den Bauch. Hände über den Kopf!« Er hielt die Waffe fest in seinen Händen. Seine Gesichtszüge waren unbeweglich, die Stimme glasklar. »Los, Daisy!« Donald Duck warf seinen Entenkopf zurück. »Die Frauen hinter dem Schalter sollen das Geld rausrücken.«
Wäre die Situation nicht so ernst, sie hätte laut losgeprustet. Aufgeregt unterdrückte sie ein hysterisches Kichern und hustete in sich hinein.
»Reiß dich zusammen«, zischte er ihr zu.
Es war still im kleinen Postamt. Jedes noch so leise Geräusch war zu hören. Sogar das Summen der Fliege vorne am Fenster. Die beiden alten Frauen hinter den Schaltern zitterten vor Angst. Der Postbote auf dem Boden hielt seine Hände über dem Kopf verschränkt. Ebenso der Arbeiter in seiner blauen Kluft.
Sie hatten das Postamt gut ausgewählt. Lange Zeit waren sie durch die Gegend gefahren, hatten alles ausspioniert. Als sie ihre kleine Idylle endlich gefunden hatten, waren sie in eine Art Glückstaumel gefallen. Sie hatten gejohlt und das Autoradio auf volle Lautstärke gedreht. Das Postamt lag nur wenige Kilometer von der grünen Grenze entfernt. Donalds Worte klangen immer noch in ihren Ohren: »Danach können wir uns in Österreich in den Bergen erholen.«
Bei ihm wusste sie nie, ob er nur Spaß machte oder es ernst meinte. Aber das musste sie auch nicht, denn er hatte alles im Griff. In jeder Situation. Bewundernswert. Solange er nur bei ihr blieb. Ohne ihn konnte sie sich ein Leben nicht vorstellen. Hätte er ihr die rosa Pillen nicht gegeben, sie könnte das hier niemals durchstehen. Ihr Entenmann wusste, was gut für sie war. Auf ihn war Verlass.
Über dem Eingang hing eine Überwachungskamera, doch das war ihnen egal. Die Aufnahmen würden nur Donald und Daisy Duck zeigen, die für Onkel Dagobert die Kröten holten. Falls jemand auf den Alarmknopf drückte, bliebe ihnen immer noch genug Zeit zu flüchten. Der nächste Polizeiposten war über zehn Kilometer entfernt. Oft genug waren sie den Plan durchgegangen.
Sie waren nur zu zweit, ohne lästigen Anhang. Später einmal würden sie ein Kind haben, vielleicht auch mehrere. Doch vorher musste sie mit dem Methadon aufhören. Sobald sie am Morgen den Saft trank, wurde es wirr in ihrem Kopf, und die Gedanken gingen durcheinander. Für Donald war es leichter. Ihn machte das Koks stärker, schneller und klüger.
»Mach schon«, schrie Donald, und Daisy hastete zum Schalter.
Die ältere der beiden Frauen streckte ihr mit bebender Hand ein Geldbündel entgegen. Auf ihrer Stirn standen Schweißtropfen, das Gesicht war aschfahl.
Daisy spürte Mitleid in sich hochsteigen. Dann kam die Angst.
Donald durfte keine dieser Regungen bemerken.
»Die Kassette mit den Münzen und alle Scheine aus der Lade. Und zwar dalli.«
Nie hätte sie gedacht, dass ihre Stimme so streng klingen konnte. Sie wurde zornig auf die dumme Alte. Kapierte die denn nicht, dass die Zeit viel zu schnell verging?
Jede Sekunde zählte.
Während sie noch das Geld entgegennahm, spürte sie auf einmal eine Hand auf ihrem Daisy-Kopf und sprang zurück. Ein Arm schlang sich wie eine Klammer um ihren Körper, und sie bekam keine Luft mehr.
»Loslassen, sofort!«
Doch er ließ nicht los. Zwei blaue Arme drückten immer fester gegen ihren Brustkorb. Vor ihren Augen tanzten Punkte.
Der Postbeamte auf dem Boden hatte die Hände vom Kopf genommen und sich umgedreht. »Liese, drück den Alarm.«
Donald verpasste ihm einen Tritt ins Gesicht, und seine runde Brille segelte durch die Luft. Es gab ein Gerangel, ein Geschiebe und Gezerre.
Dann krachte es.
Die Arme lösten sich von ihrer Brust. Sie bekam wieder Luft. Etwas Rotes explodierte vor ihren Augen. Der Raum war jetzt voller Stimmen und Farben, und der Arbeiter im blauen Drillich lag wieder auf dem Boden. Dort, wo er hingehörte.
Eine ihrer hellen Haarsträhnen hatte sich gelöst und baumelte wie eine vergessene Girlande neben ihrer Daisy-Maske.
Dann war da Donalds quietschgelber Schnabel und versperrte ihr den Blick auf das rot-blaue Farbenmeer.
»Nichts wie weg! Nimm den Rucksack mit den Münzen, ich habe die Scheine. Los, beeil dich, sonst bleibst du da!«
Montag
1
Franziska beugte sich über die Brüstung. Das tiefgraue Meer unter ihr schäumte gegen die spitzen Steine, die Gischt warf schmutzig weiße Flocken auf den Fels. Das Toben des Sturmes vermischte sich mit dem monotonen Summen in ihren Ohren.
Kurz nach der Trennung von Tomaso hatte sie dieses Rauschen in ihrem Kopf zum ersten Mal wahrgenommen.
»Tinnitus. Eine Tinnitus-Attacke, ausgelöst durch Stress«, hatte Dottor Beltrame gemeint, als sie ihn gestern in seiner Praxis aufgesucht hatte, und sie unter seinen buschigen Augenbrauen prüfend angesehen.
»Aber ich leide doch nicht unter Stress«, hatte sie unsicher entgegnet.
»Signora Francesca, Trennungen können durchaus der Grund für Stress sein, für emotionalen Stress in diesem Fall. Außerdem«, hatte er hinzugefügt, »sollten wir Blut abnehmen. Sie sehen ein wenig blass und spitz um die Nase aus.«
Nun gut, dann litt sie eben unter Stress.
Warum wusste der Arzt von ihrem Zerwürfnis mit Tomaso?
Der überbesorgte Doktor hatte für Franziska einen Termin im Krankenhaus von Monfalcone ausgemacht.
Ein kühler Wind war aufgekommen und blies ihr die glatten, langen Haare ins Gesicht. Sie fröstelte und zog den rosa Pashmina enger um ihre schmalen Schultern. Der Wind peitschte Regentropfen gegen ihre Wangen.
Rasch ging sie zurück in die Wohnung und schloss die Terrassentür.
Im großen Raum war es stickig. Die Wohnung war von ihren Schwiegereltern vor vierzig Jahren im Stil der Siebzigerjahre eingerichtet worden, und Tomaso hatte seither nichts verändert. Das dunkle Holz und die hellbraunen Fasertapeten an den Wänden ließen das Zimmer düster aussehen.
Mit einem Streichholz ging sie von Kerze zu Kerze, bog die Dochte gerade und zündete sie an. Die warmen, flackernden Lichter malten Kreise an die Decke und tauchten das Zimmer in ein behagliches Licht.
Es war Zeit für einen Aperitif.
Franziska ging zum amerikanischen Kühlschrank und holte die Flasche Friulano und den Aperol heraus. Tomaso und sie hatten vor dem Abendessen gern einen Drink genommen.
Sie vermischte die zitronengelbe und die ziegelrote Flüssigkeit in einem bauchigen Weinglas mit sprudelndem Mineralwasser und lächelte wehmütig, als sie an den Kauf des Kühlschranks dachte. Zwei Jahre lang hatte sie sich so einen gewünscht, aber niemandem davon erzählt. Nach einem heftigen Streit war Tomaso mit ihr zu einem eleganten Möbelhaus in der Nähe von Udine gefahren. Zielstrebig hatte er einen der Edelstahlriesen angesteuert. »Den hier nehmen wir. Wie schnell kann er geliefert werden?«
»Woher wusstest du?«
»Bella mia, weil ich schon immer deine Gedanken lesen konnte.« Er hatte sie fest in seine Arme genommen. »Bitte verzeih mir noch ein letztes Mal. Ich werde mich ändern. Das verspreche ich dir.«
Sie konnte sich noch an ihr Erstaunen und die Freude erinnern, als wäre es gestern gewesen. Sie hatte ihm geglaubt, ihm verziehen und war, wie schon so oft davor, doch nur wieder von ihm enttäuscht worden.
Franziska strich eine Haarsträhne aus ihrem Gesicht und klemmte sie sich hinters Ohr. Sie wischte über ihre Augen, schnitt eine Scheibe von der Zitrone ab und steckte sie auf den Rand des Glases.
Ihr Magen begann heftig zu knurren, als sie an das in Burgunder geschmorte Kaninchen mit schwarzen Oliven und karamellisierten Schalotten dachte, das sie vor ein paar Wochen mit ihren Freunden Bibiana und Fabrizio in einer kleinen Trattoria im Karst gegessen hatte. Sie mochte die beiden, obwohl sie so taten, als wüssten sie nicht, was passiert war. Jeder in Grado hatte es mitbekommen.
Seufzend schmiegte sie sich in die weichen Kissen des Sofas. Der Regen prasselte gegen die Scheiben und lief in glitzernden, dünnen Streifen das Glas entlang. Weit draußen am Horizont konnte sie die Lichter der vorbeifahrenden Kreuzfahrtschiffe sehen.
Franziska nahm einen großen Schluck, als just in diesem Moment das Telefon zu klingeln begann. Sie zuckte zusammen.
»Francesca, cara, ciao.« Tomasos tiefe Stimme war ganz nahe an ihrem Ohr. »Darf ich dich Donnerstagabend zum Essen einladen?«
»Nun, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist keine allzu gute Idee.«
»Ich möchte dich sehen, du fehlst mir.« Tomasos Stimme hatte diesen warmen Klang angenommen, dem sie sich so schwer entziehen konnte.
»Daran hättest du früher denken sollen. Ich brauche Zeit für mich und muss mir über vieles klar werden.«
»Heißt das, wir haben noch eine Chance? Bitte lass uns beim Abendessen bei Gianni darüber reden. Der Tisch ist für einundzwanzig Uhr bestellt.«
Anscheinend war er sich sehr sicher gewesen, dass sie zusagen würde. Franziska runzelte unwillig ihre hohe Stirn. »Gut, treffen wir uns dort«, gab sie schließlich nach.
Sie beendete das Telefonat und nahm einen Schluck von ihrem Getränk. Trotz der Klimaanlage war es schwül im Raum. Sie holte einen kleinen schwarzen Schirm aus der Kommode im Vorzimmer, schlüpfte in ihre grünen Gummistiefel mit den gelben Blumen und ging hinaus auf die Terrasse in den Regen. Ihre Wohnung lag im dritten Stock eines weithin sichtbaren schiefergrauen Hochhauses direkt an der Seepromenade. Es hatte seinen unvergleichlichen Charakter durch die nach beiden Seiten hin konkav geschwungene Form.
Der Regen hatte die Luft erfrischt. Es roch würzig, und Franziska schmeckte das Salz des Meeres auf ihren Lippen. Weit unter sich meinte sie wieder einmal, einen Kopf mit wallenden hellen Haaren in den Wellen zu erkennen. Er hüpfte auf und ab, tauchte unter, kam wieder hoch und kämpfte sich in Richtung der schmiedeeisernen Delphinskulptur vor.
Dieses Schauspiel wiederholte sich Abend für Abend. Eine Meerjungfrau trieb im Wasser und kämpfte gegen die Wellen an, mit silbernen Haaren, die wie Schlangen um den zarten Kopf züngelten. Franziska hatte jedoch an noch keinem der Abende jemanden von den Felsen unter ihrer Terrasse ins Wasser steigen sehen. Es war wohl doch nur eine der gelben Bojen, die da auf den Wellen trieb.
Ihr gefiel die Vorstellung, eine Meerjungfrau würde Abend für Abend ans Ufer schwimmen und erfolglos versuchen, die Felsen zu erklimmen, um dann wieder zurück ins offene Meer hinauszutreiben.
Franziska lächelte, schob den Schirm nach hinten und hielt ihr Gesicht in den Regen. Wieder drängte sich Tomasos Bild vor ihre geschlossenen Augen. Tomaso, wie er ihr die Tränen von den Wimpern küsste. Fast meinte sie, seine Lippen auf ihren Lidern spüren zu können, so intensiv war die Erinnerung. Rasch öffnete sie die Augen, strich über ihre feuchten Wangen und warf einen letzten Blick auf das aufgewühlte Meer.
Von der Meerjungfrau war nichts mehr zu sehen.
Zurück in der Wohnung, schüttelte sie den Regen aus ihrem Haar, zog die Gummistiefel von ihren Füßen und stellte sie neben die Terrassentür. Dann tappte sie auf nackten Füßen ins Bad und rubbelte ihr Haar mit einem großen, flauschigen Handtuch trocken. Sie starrte in den Badezimmerspiegel und zog fragend die Augenbrauen hoch.
Wie sie so dastand mit ihrem zerzausten Haar, der gerunzelten Stirn, blass, kam sie sich unwirklich vor. Als wäre sie im falschen Film.
»Das bin ich ja wohl auch«, murmelte sie. »Bin irgendwo gelandet, wo ich nicht hingehöre. In einem fremden Land, einer fremden Wohnung, einem falschen Leben.«
Sie beschloss, nicht länger herumzusitzen, sondern sprang kurz unter die Dusche, schlüpfte in saubere Jeans und einen leichten Strickpullover und verließ die Wohnung. Ein Spaziergang würde ihr guttun.
Kaum im Treppenhaus, schwang wie von Geisterhand die Tür des Lifts auf, und Franziska trat in die Kabine. Eine junge Frau stand an die Rückwand gelehnt und blickte nicht auf. Sie erwiderte auch nicht Franziskas Gruß, sondern starrte weiter auf den Boden.
Hübsch war die Unfreundliche. Das lange silberblonde Haar, in dem eine bunt schillernde Schmetterlingsspange steckte, fiel offen über ihre Schultern, sodass es gleich einem glänzenden Tuch ihren zarten Körper umhüllte. Im Unterschied zu Franziska war sie klein. Sie hatte einen bunten Pareo um ihren zierlichen Körper geschlungen.
Der Lift blieb stehen, und die Unbekannte eilte hinaus. Sie hinterließ einen schweren Blumenduft. Franziska warf noch schnell einen Blick in den Spiegel und war unzufrieden mit dem, was sie sah. Während sie das Haus verließ, überlegte sie, dass die unerzogene Schönheit wahrscheinlich in einem der Ferienapartments wohnte.
Draußen empfing sie ein Schwall dampfender Luft. Es roch nach den Piniennadeln, die überall auf dem Boden verstreut lagen. Auf der Straße begegneten ihr fremde Menschen, die sich an ihr vorbeidrängten. Franziska liebte diese abendlichen Wanderungen durch das alte Grado mit seinen verwinkelten Gassen. Das Rauschen des nahen Meeres übertönte in angenehmer Weise das Pfeifen in ihren Ohren.
»Ciao, bella, ciao«, riss sie eine vertraute Stimme aus ihren Gedanken. Stefano drückte ihr einen trockenen Kuss auf die Wange und zog sie in seine Bar. »Cynar calda?«
Ihr schmeckte dieses Getränk, es wärmte wunderbar den Magen. Tomasos Mutter hatte es ihr einmal bei Regen und Sturm gemacht. Seither nannte Franziska den erhitzten Artischockenlikör mit Zitrone ihren »Sturm-Drink«.
»Nein, besser nicht. Ich nehme Kamillentee.«
»Kamillentee?« Stefano verzog das Gesicht. »Du bist doch nicht krank?«
»Ich weiß nicht.«
Er sah ihr direkt in die Augen. »Was jetzt?«
Franziska hob etwas hilflos die Schultern, und ohne es zu wollen, erzählte sie Stefano, was sie belastete. »Dottor Beltrame, du weißt ja, wie er ist, also muss es nichts bedeuten…«
»Was meinst du? Was soll nichts bedeuten? Jetzt mach es nicht so spannend, Francesca.«
»Er hat für mich einen Termin im Krankenhaus ausgemacht. Er schickt mich zu den Vampiren von Monfalcone, damit sie mir Blut abnehmen.«
Stefano war um die Theke herumgegangen und stand jetzt direkt vor ihr. »Mädchen, sag, was fehlt dir?« Er hatte seine schwarze Brille abgenommen.
»Mir ist in letzter Zeit manchmal übel. Ich habe Ohrensausen, Nasenbluten und bekomme ständig wegen nichts blaue Flecke.«
Stefano fuhr sich mit beiden Händen durch sein volles Haar. »Das klingt nicht gut«, sagte er ernst und sah Franziska dabei aufmerksam an.
»Na. Jetzt übertreib nicht.« Sie lachte nervös. »So dramatisch wird es schon nicht sein. Ich werde nicht gleich daran sterben.«
»Sterben? Das ist kein Spaß. Darüber gibt es nichts zu lachen. Was sagt Tomaso dazu?« Franziska kam sich einen Moment lang vor wie ein gescholtenes Kind.
Schroffer, als sie eigentlich wollte, fuhr sie ihn an: »Was hat er damit zu tun? Ihn geht das überhaupt nichts an.«
»Beruhige dich. Es scheint dir wirklich nicht so schlecht zu gehen, wenn du noch Feuer spucken kannst.«
Franziska schwang sich auf den Barhocker und beobachtete erstaunt, wie Stefano den Kamillentee in den Ausguss kippte und eine bauchige Flasche vom Regal holte.
»Das ist ein wirklich guter Tropfen.«
Franziska schüttelte ablehnend den Kopf.
»Keine Widerrede.« Stefano goss zwei Cognacschwenker halbvoll. »Salute.«
»Cin cin.« Sie nahm einen großen Schluck der bernsteinfarbenen Flüssigkeit und hustete. »Was ist das denn?« Sie sah ihn aus tränenden Augen fragend an.
»Bester alter Brandy.«
Langsam breitete sich eine wohlige Wärme in ihr aus, und sie begann, sich zu entspannen. Den ganzen Tag über hatte sie sich merkwürdig gefühlt. Erst jetzt, da sie mit Stefano darüber gesprochen hatte, war ihr klar geworden, dass es der morgige Termin war, der sie verunsicherte.
»Stefano«, fing sie an, doch als er aufblickte, sagte sie schnell: »Ach, nichts.«
Er fragte nicht nach und begann, die Gläser in die Geschirrspülmaschine einzuräumen. Franziska stieg der Cognac langsam zu Kopf. Stefano sah verdammt gut aus, fand sie, als sie ihm beim Einräumen zusah. Er hatte, obwohl er erst vierzig war, silbergraues Haar, das in unzähligen Wirbeln vom Kopf wegstand. Die strenge Brille betonte seine markanten Züge. Er trug ausschließlich schwarze Jeans mit grauen, weißen oder blau-weiß gestreiften Oberteilen. Sein Bruder Daniele betrieb den Designer-Laden neben der Bar. Tomaso hatte ihr einmal erklärt, dass Stefano zu faul sei, seine Kleidung selbst auszusuchen, und daher sein Bruder diese Aufgabe für ihn übernommen hatte. Zu Stefanos Vorteil.
»Was siehst du mich so an?«, fragte er.
»Ich habe dich gerade mit Tomaso verglichen.«
»Ach.« Stefano fuhr mit dem Zeigefinger über die glänzende Edelstahlarmatur des Spülbeckens. »Und, wie schneide ich ab?«
»So habe ich das nicht gemeint«, murmelte Franziska, die fand, dass das Gespräch in die falsche Richtung ging.
»Wie hast du uns denn dann verglichen?« Er schmunzelte.
Franziska sprang vom Hocker und wäre fast gestürzt. Stefano, der schon bei der Tür stand, machte einen Satz auf sie zu und fing sie gerade noch auf.
»War wohl ein wenig stark, dein guter Tropfen.«
Er begleitete sie zur Tür. Als sie sich voneinander verabschiedeten, sagte Stefano: »Du kommst doch morgen bei mir in der Bar vorbei, wenn du im Krankenhaus fertig bist, und sagst mir, was los ist?«
»Ja, ja, ja, vielleicht«, gab Franziska unbestimmt zurück und zog die Tür hinter sich ins Schloss.
2
Angelina Maria Cecon war längst nicht so schön wie ihre Tochter. Auch sie hieß Angelina, sah ihr aber nicht ähnlich. Angelina Maria maß eins sechzig und war untersetzt. Ihre Tochter Angelina mit ihren schlanken ein Meter achtzig war von ergreifender Schönheit und eine berühmte Schauspielerin.
Obwohl sie seit Jahren in Rom lebte, besuchte sie ihre Mutter jede Nacht. Einerlei, wie interessant die Männer waren, die sie zum Abendessen einluden, gleichgültig, wie fern die Drehorte, nichts konnte Angelina daran hindern, in der Nacht zu ihrer Mutter zu kommen.
Die alte Frau stützte ihren schweren Kopf auf die runzelige Hand und seufzte wehmütig. Hoffentlich musste sie nicht wieder ins Krankenhaus nach Triest. Ihr Atem ging rasselnd, und das furchtbare Durcheinander in ihrem Kopf nahm täglich zu. Vielleicht sollte sie ihre Tabletten doch regelmäßiger einnehmen?
Nur wurde dann alles um sie herum so kalt und grau. Die Ärzte hatten ihr erklärt, die Pillen könnten sie heilen. Früher hatte sie daran geglaubt. Doch ohne die Tabletten waren ihre Träume farbenfroher. Sie liebte es, eins zu werden mit diesen bunten, warmen Bildern. Dann hatte sie nichts zu befürchten. Ließ sie sich jedoch zu lange treiben, wurde sie von den Träumen verschlungen. Was froh und lebhaft gewesen war, präsentierte sich dann bedrohlich und tiefschwarz. Manchmal, so wie jetzt, kannte sie sich selbst nicht mehr aus. Alles verschwamm zu einer undurchdringlichen Masse, und sie musste aufpassen, in dem Sumpf nicht zu versinken.
Unzählige Male schon war sie in der Klinik gewesen.
Schwerfällig stand Angelina Maria auf und schlurfte zum Gasherd. Ein süßer, heißer Tee wäre jetzt genau richtig. Der würde sie ein wenig ablenken.
Draußen schüttete es. Die Regentropfen trommelten gegen die Fensterscheiben. Wie in jener schrecklichen Nacht.
Ein Schauer ging durch ihren Körper, als sie sich erinnerte, sofort wurde sie unruhig. Ihre Hand zitterte, als sie den schweren Topf auf die Flamme stellte. Während sie darauf wartete, dass das Wasser kochte, öffnete sie die Tür zur Terrasse und atmete tief die salzige Meerluft ein.
»Wäre es doch nur das Meer, in dem ich zu versinken drohe«, flüsterte sie und starrte hinaus auf die wilden Wellen.
Es war schon zu spät und auch zu stürmisch für Nixen. Seit einiger Zeit schwamm des Abends ein junges Nixlein unter ihr im Meer herum. Immer dann, wenn die Zeit nicht früh und nicht spät war, wenn das Licht zwischen hell und dunkel pendelte, spielte die Meerjungfrau wie ein junger Delphin mit den Wellen, ritt auf ihren schäumenden Kämmen, tauchte tief hinab in die brausenden Fluten.
Heute hatte sie dieses Schauspiel verpasst. Sie sah verschwommen, wie sich das Dunkel des Meeres mit dem Grau des Regens vermischte. Weit draußen tanzten grelle Lichter auf und ab.
»Verlorene Seelen«, flüsterte Angelina Maria und schlurfte beklommen zurück zum Herd.
Hoffentlich würde die Furcht sie nicht umklammern. Der stete Kampf gegen die Dämonen und Bestien machte sie müde.
Sie goss das kochende Wasser in die Tasse und beobachtete, wie sich der Beutel Kräutertee mit der Flüssigkeit vollsog und immer schwerer wurde. Dann setzte sie sich an den Tisch und umklammerte die heiße Teetasse mit beiden Händen. Tief in Gedanken versunken, spürte sie erst nach geraumer Zeit die Hitze in ihren Handflächen. Erschrocken ließ sie die Tasse los.
Ein heißer Strom schoss durch ihren Körper. Sie drohte zu verbrennen. Angstvoll hielt sie den Atem an, damit das Feuer die schlafenden Dämonen nicht aus ihren Träumen riss.
Als der Schmerz langsam verebbte und keines der Ungeheuer erwacht war, zog sie den Tee vorsichtig zu sich heran. Ihr Blick versank in der trüben Flüssigkeit. Bild um Bild stieg aus dem Dampf auf und schickte sie immer tiefer in ihre Erinnerung hinab.
Tränen brannten in ihren Augen. Sie durfte ihr Geheimnis nicht preisgeben. Vor langer Zeit hatte sie einer jungen Ärztin auf der Station davon erzählt. Aber sie hatte sie nicht verstanden. Seither blieb ihr Mund verschlossen.
Angelina Maria schluchzte auf und nahm einen großen Schluck vom immer noch heißen Tee. Die Wärme brannte in ihren rissigen Lippen.
3
Stefano konnte nicht einschlafen. Aufgebracht schleuderte er das Kissen zu Boden und setzte sich mit einem Ruck im Bett auf. Aus Erfahrung wusste er, dass hier nur sehr guter Sex oder eine ausgiebig lange und siedend heiße Dusche helfen konnten. Da Sex für ihn derzeit kein Thema war, blieb nur der Weg ins Badezimmer.
Als er den wohltuenden Strahl in seinem Nacken spürte, begann er, sich zu entspannen. Unter dem Prasseln des Wassers lösten und lockerten sich die Verkrampfungen. Stefano atmete erleichtert durch. Er dachte an Francesca. Eigentlich hatte er sie vor Tomaso kennengelernt. Sein Gesicht verzog sich zu einem schiefen Grinsen, als er daran dachte. Nacht für Nacht war sie mit einer Freundin in seiner Bar aufgetaucht. Stefano war es so vorgekommen, als würde sie das Gradeser Leben studieren. Damals hatte sie noch kein Wort Italienisch verstanden. Als Stefano sie zum Abendessen einladen wollte, hatte sich Tomaso dazwischengedrängt.
Stefano öffnete das andere Ventil und schüttelte sich wie ein junger Hund, als eiskaltes Wasser auf seine Schultern traf und ihm über Brust und Rücken lief. Mit einem Ruck drehte er den Hahn zu und sprang aus der Duschkabine. Der Regen hämmerte mit unverminderter Heftigkeit gegen die Scheibe des Badezimmerfensters. In ein Handtuch gehüllt, starrte er hinaus in die Nacht. Seine Wohnung lag über der Bar im zweiten Stock, mit einem weiten Blick bis hin zum dunklen Kanal. Er liebte die Geräusche des Hafens: das Knarren des Holzes, das Bimmeln der Glöckchen und das Rauschen des Windes in den Segeln der Schiffe.
Während er gedankenverloren dastand und der Regen Schlieren auf die Scheibe malte, fragte er sich, was bloß mit Francesca los war.
Sie war heute seltsam gewesen. Schon vor geraumer Zeit waren ihm ihr trauriger Ausdruck und die ungewöhnliche Blässe aufgefallen. Als sie vorhin so matt auf dem Barhocker saß, schien sie ihm zerbrechlicher denn je zu sein.
Da Tomaso offenbar nicht bemerken wollte, wie schlecht es Francesca ging, würde eben er sich um sie kümmern.
Auf seinem besorgten Gesicht machte sich ein zuversichtliches Lächeln breit. Er ging zum Kühlschrank und schenkte sich ein kühles Bier ein.
Dienstag
1
Laura hob den Gurt ihres Schulrucksacks an. Er war eindeutig zu voll, die Träger schnitten ihr in die Schultern. Ungeduldig wischte sie eine ihrer schwarzen, widerspenstigen Locken aus der feuchten Stirn. Es war aber auch heiß heute, obwohl die Sonne nirgends zu sehen war. Sie beschleunigte ihren Schritt, bog rasch um die nächste Ecke. Fast wäre sie in eine Gruppe Vorsaison-Touristen hineingelaufen, die lärmend aus der Trafik kam.
Mit gesenktem Kopf murmelte sie: »Entschuldigung«, und hastete weiter. Sie überquerte die breite Hauptstraße und blieb oben auf der Brücke über dem Kanal stehen, der die Isola della Schiusa vom Zentrum Grados trennte. Mit den Ellbogen stützte sie sich auf dem Geländer ab und legte ihr Kinn in die Handflächen. So stand sie eine Zeit lang und betrachtete das bunt schillernde Leben auf dem Wasser unter sich. Seit sie lesen gelernt hatte, entzifferte sie die Schriftzüge auf den Booten: »Mona Lisa«, »Arielle«, »Möwe«, »Carissima«, »Venezia«, »Sternchen«, »Fortuna«, »Meeresbrise«, »Claudia«, »Antonella«, und stellte sich Geschichten zu den Namen vor.
Nach einigen Minuten waren dunkle Wolken aufgezogen, und die Luft fühlte sich schwer an. Laura löste sich aus ihrer Versunkenheit, warf einen prüfenden Blick auf die Pinien, die den Kanal säumten, und ging rasch weiter. Wahrscheinlich würde es regnen, denn die Nadeln der Pinien schillerten metallisch. Schon oft hatte sie beobachtet, wie sich die Farbe der Laub- und Nadelbäume dem Wetter anpasste, den Wolken und dem Himmel. Manchmal drehten sich die grünen Blätter um, zeigten ihre graue Rückseite, und der Baum bekam einen eigenartigen Glanz. Ein untrügliches Zeichen, dass Regen bevorstand.
Laura schlenderte ein Stück am Hafen entlang, bevor sie in Richtung des Ambulatoriums abbog. Sie hätte auch über die Promenade am Meer gehen können, aber da wäre sie sicher Nicola, der Tochter der Gemüsefrau, über den Weg gelaufen.
Am liebsten war Laura allein und bastelte Pappmaschee-Puppen aus alten Zeitungen oder las aufregende kleine Geschichten über berühmte Leute in den Hochglanzmagazinen, die ihre Mutter manchmal aus dem Hotel mitbrachte.
Das Haus, in dem sie wohnten, war von zwei Seiten zugänglich. Ihr gefiel der Wohnblock mit der abblätternden rostroten Farbe und den schmalen Balkons. Sie fand die bunte Wäsche auf den Leinen lustig, die wie Fahnen im Wind flatterte und knatternde Geräusche von sich gab.
Gegenüber ihrer Schule auf der Isola della Schiusa war das Altersheim. Manchmal verirrte sich ein Bewohner und lief ziellos in der Gegend umher. Manche wussten nicht, in welcher Zeit sie lebten, und vergaßen sofort wieder, was man ihnen sagte. Ein paar der alten Frauen mit den struppigen weißen Haaren erinnerten sie an Angelina Maria aus der Villa am Meer. Laura gruselte sich ein wenig vor der alten Frau mit dem wirren Haar.
Als sie die ersten Regentropfen spürte, ging sie rasch ins Haus. Sie mochte es, am Fenster zu sitzen und den Tropfen zuzusehen, wie sie gegen die Scheibe klopften. Außerdem freute sie sich, dass sie mit ihrer Einschätzung des Wetters recht gehabt hatte.
Das Treppenhaus roch muffig nach ungelüfteter Wäsche und ranzigem Öl. Sie sprang die letzten Stufen zu ihrer Wohnung hoch. Als sie vor der Tür stand und nach dem Schlüssel kramte, breitete sich ein unangenehmes Gefühl in ihrem Bauch aus. Ihre Mama sollte zur Sprechstunde in die Schule kommen. Was wollte die Klassenlehrerin bloß von ihr?
Um sich abzulenken, dachte sie schnell an die süßen Croissants aus der Bäckerei. Mit dem imaginären Geschmack von Hagelzucker auf ihren Lippen schloss sie die Wohnungstür auf.
2
Die Busfahrt nach Monfalcone war anstrengend gewesen. Das Gesicht gegen das Fenster gelehnt, hatte Franziska versucht, ihr Unwohlsein zu kontrollieren, doch die winzigen Streichholzbäume, die an ihr vorbeiflitzten, hatten ihren Schwindel gesteigert. Das surrende Geräusch in ihren Ohren war auch vom Brummen des Motors nicht übertönt worden.
Trotz der Kopfschmerzen musste sie lächeln, als ihr Stefano einfiel. In letzter Zeit war es ihr zur Gewohnheit geworden, auf ein paar Worte bei ihm vorbeizuschauen. Sie mochte ihn, weil er sie zum Lachen brachte. Seit dem Tag, an dem sie sich kennengelernt hatten, herrschte zwischen ihnen eine besondere Art von Vertrautheit, auf die Tomaso fürchterlich eifersüchtig gewesen war. Immer wieder hatte sie ihm erklärt, dass zwischen ihr und Stefano nichts war. Trotzdem hatte er den Kontakt zwischen ihnen nicht gefördert. Nur wenn es sich nicht umgehen ließ, hatten sie bei Stefano einen Stopp eingelegt.
Die Hitze brütete über der staubigen Stadt. Wenn es im Juni schon so drückend schwül war, wie würde dann erst der August werden?
Franziska blieb kurz stehen und wunderte sich über ihre Kurzatmigkeit. Ihre Brust hob und senkte sich rasch. Es kam ihr vor, als flatterte in ihrem Innern ein aufgeregter Vogel auf und ab. Sie schnappte gierig nach Luft, um dieses beklemmende Gefühl loszuwerden. Über ihr segelten düstere Wolken, und dann spürte sie auch schon die ersten Regentropfen. Innerhalb kürzester Zeit entleerte sich der Himmel über der Stadt, und die Nässe spritzte bei jedem ihrer Schritte hoch zu ihren Waden. Bis sie endlich den Eingang zur Poliklinik gefunden hatte, waren Hosenbeine und Sandalen durchnässt.
Als sie im kahlen Gang vor dem Untersuchungszimmer ungeduldig darauf wartete, aufgerufen zu werden, stellte sich ein Gefühl der Verlassenheit ein. Drei ältere Frauen saßen in ihrer Nähe auf einer Holzbank. Sie kannten einander wohl, denn sie waren in ein lebhaftes Gespräch vertieft. Keine von ihnen schien Franziska auf ihrem weißen Plastikstuhl zu bemerken.
Als Franziska zehn Minuten später ihren Namen im Lautsprecher hörte, öffnete sie bang die Tür. Der Raum war groß und roch nach Chemikalien. Durch das beschlagene Fenster sah man auf einen langen Durchgang, der zwei Gebäude miteinander verband.
Sie wurde gebeten, Platz zu nehmen. Ein junger Arzt mit einem sternförmigen Leberfleck auf der Wange setzte sich ihr gegenüber. Über den Brillenrand hinweg musterten seine hellen Augen sie aufmerksam. Er sprach freundlich und zeigte Interesse an ihren Symptomen. Seine Stimme übte eine beruhigende Wirkung auf sie aus.
Gründlich beantwortete Franziska jede Frage. Das Blut, das anschließend aus ihren Venen in die schmalen Fläschchen floss, kam ihr hellrot und durchscheinend vor. Der Doktor hatte an der Farbe aber wohl nichts auszusetzen, denn er lächelte sie unbeirrt freundlich an. Nachdem ihr Röhrchen um Röhrchen abgezapft worden war, musste sie sich auf Geheiß eines energischen Pflegers, der von ihr unbemerkt das Behandlungszimmer betreten hatte, etwa dreißig Minuten auf einer Liege ausruhen.
Sie war dabei, einzudösen, als seine Stimme sie unsanft aus einem beginnenden Traum riss: »Sie können jetzt aufstehen, Signora. In zwei Stunden erwarten wir Sie zurück. Dann sind die ersten Befunde da.«
Kaum stand sie auf ihren Füßen, drehte sich auch schon das Zimmer in wilden Kreisen um sie. Sie klammerte sich ans kühle Plastik der Liege, atmete tief und gleichmäßig ein und aus und ging dann langsam, bewusst auf jeden ihrer Schritte achtend, aus der Tür auf den Gang.
Draußen auf der Piazzale Aldo Moro schlug ihr ein Schwall feuchter Luft entgegen. Es hatte aufgehört zu regnen. Über dem Gehsteig dampften milchig weiße Schwaden. Franziskas Haare waren inzwischen getrocknet und standen in wirren wollenen Löckchen um ihr blasses Gesicht.
Helle Wolkenfetzen, wild und watteweich, jagten über den düstergrauen Himmel. Franziska kam es wie ein Stummfilm vor. Das Ausbleiben der hohen, schrillen Schreie der Möwen und des jähen Geflatters weißer Flügel irritierte sie. Beides war für sie längst Teil ihrer Stadt am Meer geworden.
Sie suchte in den unbekannten Straßen einige Zeit nach einer Bar. Als sie schließlich fündig wurde, ließ sie sich erschöpft auf einem der kleinen Messingstühle in der Nähe des Tresens nieder. Gierig verschlang sie ein tramezzino mit Thunfisch und trank dazu eiskalte Orangina.
Versteckt hinter den raschelnden rosafarbenen Blättern der Tageszeitung breitete sich allmählich ein behagliches Gefühl der Wärme in ihr aus und verdrängte die Unruhe. Es würde schon alles gut gehen. Sicher waren ihre Erschöpfungszustände nur eine Folge der Anspannung der letzten Monate.
Sie blätterte noch eine Weile in einem der herumliegenden Journale, ohne das Geschriebene wirklich wahrzunehmen, und machte sich dann auf den Weg zurück zum Krankenhaus.
Die schwüle Hitze draußen vor der Tür ließ sie benommen zurückprallen. Innerhalb von Sekunden war das Gefühl angenehmer Frische, das sie eben noch in der Bar gehabt hatte, verflogen.
Die Unruhe kehrte zurück.
Entweder lief sie in Panik vor dem Befund davon, sprang in den nächsten Bus zurück nach Grado, oder sie stellte sich der Situation. Der Schweiß stand ihr auf der Stirn, die Knie fühlten sich weich an, der Magen flau. Angespannt stolperte sie die glühend heißen Gehsteige entlang, bis schließlich das graue Gebäude des ospedale im feuchtheißen Dunst vor ihr auftauchte. Unheimlich sah es aus, wie eine Betonburg mitten in der Wüste.
»Jetzt mach dich nicht verrückt und steigere dich nicht so hinein«, murmelte sie, als sie auf dem weißen Plastikstuhl erneut darauf wartete, aufgerufen zu werden.
Diesmal war sie in Gesellschaft eines jüngeren Mannes im Rollstuhl, der ihr neugierige Blicke zuwarf. Von den drei älteren Frauen war nichts mehr zu sehen. Hin und wieder durchquerte eine Krankenschwester den Flur.
Nervös trommelte Franziska mit ihren Fingerspitzen einen schnellen Rhythmus auf die Lehne des Stuhls. Erst als sie den strafenden Blick ihres Gegenübers wahrnahm, hörte sie damit auf.
Ob sie die Patienten hier noch mit Äther betäubten wie in früheren Zeiten? Ihr fiel der Cartoon im Wartezimmer ihres Zahnarztes ein, auf dem ein verängstigter Mann zu sehen war, dem die Assistentin ein Ätherfläschchen unter die Nase hielt, während der Arzt sich mit einer Riesenzange in der Hand über den eiternden Backenzahn des erbärmlichen Opfers hermachte.
Sie hatte gerade beschlossen, sich einen Eistee aus dem Automaten zu ziehen, da öffnete sich die Tür des Untersuchungszimmers, und ein älterer Arzt rief ihren Namen.
Zögernd erhob sie sich von ihrem Sitz.
3
Als Maddalena Degrassi vor dem Grab ihres Vaters stand und auf den grauen Stein mit seinem Namen starrte, spürte sie den übermächtigen Wunsch, ihren Schmerz über diesen Verlust laut hinauszuschreien.
Was, überlegte sie, würden wohl die alten Weiber hier auf dem Friedhof denken, wenn ich diesem Verlangen nachgäbe? Wahrscheinlich, dass Maddalena keine von ihnen war. Die über die Gräber gebückten Betschwestern mit ihren kohlrabenschwarzen Kleiderschürzen waren die übergroßen Krähen ihrer Kindheit.
Obwohl Maddalena sich eng verbunden fühlte mit dem Karst und ihrem alten Fischerdorf, Santa Croce, das gut zweihundert Meter über dem Meer am Fels kauerte, hatte sie immer schon jene tiefe Kluft in sich gespürt, die sie von den anderen hier trennte.
Ihr Vater hatte ihrem Drängen schließlich nachgegeben und sie in das Europagymnasium in Udine eingeschrieben. Die Jahre dort hatten all ihre romantischen Vorstellungen vom freien, selbstbestimmten Internatsleben über den Haufen geworfen. Anders als die Internatsschulen, die Maddalena aus ihren Mädchenromanen kannte, wurde dieses Institut von einer ehrgeizigen Direktorin mit strenger Hand geführt. Für die wilden Streiche und Abenteuer, die in Maddalenas Phantasie eine große Rolle spielten, blieb neben den vielen Hausaufgaben und der begrenzten Freizeit weder Energie noch Raum.
Von Udine war es nach dem Abitur nur ein kurzer Weg nach Rom gewesen, wo sie die nächsten Jahre damit verbracht hatte, sich als Polizistin ausbilden zu lassen. Nach Hause war sie nur noch in den Ferien gekommen.
»Ach, Papa, lieber Papa«, sagte sie traurig und strich mit der Handfläche liebevoll über den heißen Grabstein.
Sie vermisste ihn so sehr, diesen außergewöhnlichen Mann mit dem wilden grauen Haar, den feingliedrigen Händen und den strahlend blauen Augen, die sie an das Meer unter Santa Croce erinnerten. Mit ihrer Mutter, einer strengen Frau, hatte sie nie viel verbunden. Mit ihm dafür umso mehr. Und nun lag er hier, auf dem schönsten Friedhof der Welt, hoch über dem Funkeln der Wellen. Sah sie hinunter ins gleißende Azurblau, war ihr jedes Mal so, als würde sein intensiver Blick sie mitten ins Herz treffen. Wie gern hätte sie sich jetzt an ihn gelehnt, ihm von den Verwirrungen der letzten Monate erzählt und ihn um Rat gefragt.
Nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters vor einem Jahr hatte Maddalena erfahren, dass ihre Eltern nicht ihre leiblichen Eltern waren. In einer stürmischen Winternacht war sie den beiden vor die Tür gelegt worden, im Alter von ein paar Wochen, halb erfroren und nur eingehüllt in ein graues Wolltuch. Maddalena hatte vor Kummer beim Notar laut aufgeschrien, war vom Stuhl gesprungen und zu ihrer Mutter gelaufen, die die ganze Zeit über bleich und schweigend, ohne eine Miene zu verziehen, dagesessen hatte.
»Warum, zur Hölle, habt ihr mich die ganze Zeit über angelogen, warum hat mir niemand etwas davon erzählt?«
»Kind, dein Vater wollte es so.«
»Vater?«
»Maddalena.« Die Frau, die sich ihre Mutter nannte, hatte sie in einer seltenen Gefühlsanwandlung fest in die Arme genommen. »Du warst immer unser Kind, und wir haben dich vom ersten Moment an geliebt. Glaube mir, die Entscheidung, dir das zu verheimlichen, ist uns nicht leichtgefallen.«
Der Notar hatte sich zurückgezogen und Maddalena in den Armen ihrer Mutter weinen lassen. Nach und nach erfuhr sie die ganze Wahrheit.
Dieses Gefühl der Fremdheit lag also doch nicht nur in ihrer schwierigen Pubertät begründet. Wer war sie bloß, und woher kam sie, wo waren ihre Wurzeln?
Als der Notar zurückkam, hatte er ihr eröffnet, dass sie neben einer nicht unbeträchtlichen Summe Bargeld das geliebte Motorrad ihres Vaters, eine wunderschöne Moto Guzzi, geerbt hatte. Schon zu seinen Lebzeiten war Maddalena häufig mit dem Motorrad gefahren. Ihre Mutter, die bei Vaters täglichen Motorradfahrten von Santa Croce nach Triest vor Angst fast vergangen war, hatte sorgenvoll den Kopf geschüttelt.
»Nicht auch noch du«, hatte sie gemurmelt. »Ich will dich nicht verlieren, Maddy.«
Maddalena seufzte tief, wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel und warf einen letzten Blick auf die purpurfarbene Rose, die sie ihrem Vater gebracht hatte. Ohne sich noch einmal umzudrehen, schlenderte sie an den Gräbern vorbei zum Ausgang. Der Boden war aufgeweicht vom Regen der letzten Tage, und der würzige Duft der Zypressen vermischte sich mit dem modrigen Geruch nach verwelkten Blumen und feuchter Erde.
Als sie durch das schmiedeeiserne Tor zur Kirche ging, begannen die Gedanken an das bevorstehende Treffen mit Franjo in ihrem Kopf zu kreisen. Sie würde sich duschen und umziehen müssen, da sie direkt aus dem Nachtdienst von Grado hierhergekommen war. Vorher wollte sie sich noch einen Caffé macchiato und eine Zigarette in der einzigen Bar im Ort genehmigen.
Angesichts der behaglichen Stille, die dort herrschte, rückte sie sich auf der Steinveranda zur Straße einen kleinen Metallsessel zurecht. Fröstelnd zog sie ihre Lederjacke enger um die Schultern. Im Karst blies ein kühler Wind.
Ein Sonnenstrahl durchbrach die graue Wolkenbank und ließ das Glas Wasser vor ihr auf dem Tisch kristallklar funkeln. Maddalena schloss die Augen und hob ihr Gesicht dem Licht entgegen, bis die Zigarette aufgeraucht und die Sonne wieder hinter den Wolken verschwunden war.
Als sie kurze Zeit später, frisch geduscht und umgezogen, die chromblitzende Moto Guzzi aus der Garage schob, fiel ihr wieder ein, was Max über sie gesagt hatte. Sie hatte den pubertierenden Schüler vor gut zehn Monaten bei Ermittlungen kennengelernt. Es war Maddalenas Debüt als Kommissarin in Grado gewesen. Damals hatte der Junge ihr ernst erklärt, dass sie ihn eher an eine Rockerbraut als an eine Polizistin erinnerte, weshalb er nicht allzu viel Vertrauen in ihre Fähigkeiten setzte, seine Schwester zu finden. Ganz unrecht hatte er damit nicht gehabt.
Maddalena verspürte ein Gefühl der Unbeschwertheit, als sie jetzt mit ihrem Motorrad durch die engen Gassen brauste. Erst auf der Hauptstraße stülpte sie den Helm über ihre dunkelbraunen Locken. Sie liebte den Wind in ihrem langen Haar und verbot es sich, an die drohenden Gefahren und die vielen Unfälle, zu denen sie gerufen wurde, zu denken.
Immer wieder war sie fasziniert von der kargen Landschaft des Karstes. Schon im Juni war hier alles ausgedörrt und das frische Grün des Frühlings durch das charakteristische Graubraun des Sommers abgelöst. Sie raste vorbei an abgeblühten Fliederbüschen, Hecken und Kastanienbäumen, an niedrigen Steinmäuerchen und hölzernen Gattern, über sich die Endlosigkeit des grauen Himmels. Es hatte zu nieseln begonnen, und an einer Weggabelung vor Opicina schob Maddalena das Visier des Helms vor ihr Gesicht. Auf der Weiterfahrt erschien die Landschaft verwaschen. Wie in einem Aquarell ließ der Regen die Farben weich zerfließen.
Trotz der schlechten Straßenverhältnisse beschleunigte Maddalena. Der österreichisch-ungarische Militärfriedhof, die Abzweigung zum Leuchtturm Vittoria, Bäume und Sträucher flogen nur so vorüber. Jetzt wurden die Mauern höher und die Straße breiter. Verlassene Kasernen, spärlich besuchte Campingplätze rechts und links, dann war da auch schon Opicina. Bei schönem Wetter und klarer Sicht konnte man hier einen wunderbaren Panoramablick über die Bucht genießen.
Nicht so heute.
Ihre Gedanken waren so sehr beim Treffen mit Franjo, dass sie die richtige Abzweigung nach Slowenien beinahe verpasst hätte.
Wie immer, wenn sie durch diese karge Gegend fuhr, fühlte sie sich in die Vergangenheit zurückversetzt. War das der Grund, weshalb sie hier ihren Helden gefunden hatte, zwischen Steinmauern, hinter denen sich endlose buckelige Wiesen dehnten? Der Karst erinnerte Maddalena an die Weite englischer Landschaften. Ja, genau so war das: Franjo war ihr Mr.Darcy. Und jetzt hatte sie ihn verloren, was wohl daran lag, dass sie ihrerseits meilenweit davon entfernt war, eine Elizabeth Bennet zu sein. Leider.
Maddalena spürte den Kloß in ihrem Hals und bemühte sich, die aufsteigenden Tränen zurückzudrängen. »Fehlt ja noch«, schrie sie grimmig gegen den Fahrtwind an, »dass ich in meinem verdammten Helm ersaufe. Der verfluchte Regen draußen reicht schon.«
Die Straße hinunter nach Rupingrande, vor ihr die sanften Hügel des ehemals streng bewachten Grenzgebietes, und wieder hinauf nach Col mit seinen schroffen, abweisenden Felsen, dann überquerte sie erwartungsvoll den aufgelassenen Grenzübergang.