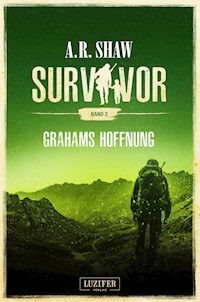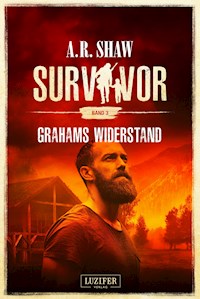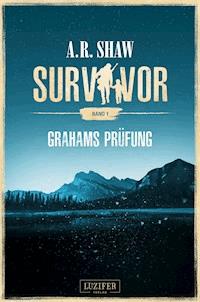
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Survivor
- Sprache: Deutsch
Es geschieht, was die Welt am meisten fürchtet. Ein mutiertes Vogelgrippe-Virus (H5N1) löst eine weltweite Pandemie aus, die den Planeten verwüstet und die Menschheit fast ausrottet. Nur zwei Prozent der Weltbevölkerung überleben. Eine sterbende Mutter weiß, dass ihr kleines Kind zu den wenigen gehört, die immun gegen das Virus sind. Was kann sie tun, um das Überleben ihres Kindes zu sichern, bevor ihr nahender, tragischer Tod eintritt? Währenddessen trägt Graham das letzte Familienmitglied zu Grabe. Dem Rat seines Vaters folgend begibt er sich in die Wildnis, zur Blockhütte der Familie, und durchlebt dabei Triumphe und Tragödien. Wieder und wieder muss er sich anpassen, um zu überleben. Gerade als er das Gefühl hat, diese neue Welt endlich in den Griff zu bekommen, überrascht ihn die Nachricht, dass er nicht allein ist. Eine versteckte, aber verwundbare Gemeinschaft von Preppern (1) lebt in der Nähe. Wird er die Kraft haben, den Gefahren zu begegnen und zu überleben? Und noch wichtiger: Wird er in der Lage sein, die ihm Anvertrauten zu beschützen? (1) "Prepper" bezeichnet Personen, die sich mittels individueller Maßnahmen auf jedwede Art von Katastrophe vorbereiten: durch Einlagerung von Lebensmittelvorräten, die Errichtung von Schutzbauten oder Schutzvorrichtungen an bestehenden Gebäuden, das Vorhalten von Schutzkleidung, Werkzeug, Waffen und anderem. Dabei ist es unwichtig, durch welches Ereignis oder wann eine Katastrophe ausgelöst wird. Viele Themen der Prepper überschneiden sich mit denen der Survival-Szene. [Quelle: Wikipedia]
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SURVIVORS
Band 1: Grahams Prüfung
A.R. Shaw
Aus dem Amerikanischen übersetzt von
Copyright © 2015 by A.R. Shaw All rights reserved. No part of this book may be used, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the written permission of the publisher, except where permitted by law, or in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews.
Impressum
überarbeitete Ausgabe Originaltitel: Graham’s Resolution: The China Pandemic Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER-Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Raimund Gerstäcker
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-169-1
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Für weitere spannende Bücher besuchen Sie bitte
unsere Verlagsseite unter luzifer-verlag.de
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen und senden Ihnen kostenlos einen korrigierten Titel.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhalt
Einführung
Einige meinen, China habe bei der Entwicklung des H5N1-Virus lediglich beabsichtigt, einen Impfstoff zu kultivieren, wenngleich in dem Wissen um die katastrophale Gefahr für die eigene Bevölkerung, sollte das Virus außer Kontrolle geraten. Andere sagen, China habe das Virus nur aus finsteren Motiven entwickeln können, da sie es in einer waffenfähigen Form erschaffen hatten. Am Ende war es gleichgültig, was ihre Absichten gewesen sein mochten. Sie hatten ohne ausreichende Sicherheitsvorkehrungen mit Pandoras Box gespielt und das Virus entfesselt. Es traf nicht nur die Menschen in China. Angefacht wie ein Buschfeuer von einem starken Wind verbreitete es sich als Flächenbrand über die ganze Welt. Mehr als sechs Milliarden Menschen fielen dem Virus zum Opfer. Die zwei Prozent der Menschen, die überlebten und aus irgendeinem Grund immun waren, wurden zu Trägern des Erregers. Zum Virus selbst lässt sich lediglich feststellen, dass es als die China-Pandemie bekannt wurde.
1| Schlimmer als der Tod
Zitternd stand Hyun-Ok im prasselnden Regen des pazifischen Nordwestens. Sie musste einfach mit eigenen Augen sehen, welche Bedrohung von dem grauenhaften Mann in der Ferne ausging. Einmal hatte sie sein Gebrüll gehört, gefolgt von einem Gewehrschuss und einem schrecklichen, menschlichen Schrei. Sie hatte ihn bereits von der Kandidatenliste gestrichen. Er konnte ihr nicht helfen. Jetzt musste sie sichergehen, dass er keine unmittelbare Gefahr für sie und ihren Sohn darstellte.
Mit todesstarrem Griff klammerten sich ihre Hände an die Seitenwände der Ladefläche des verlassenen schwarzen Pick-ups, hinter dem sie Zuflucht gesucht hatte. Entsetzt schnappte sie nach Luft, als der Wahnsinnige einen kleinen, völlig zerschrammten Radlader startete und sein Opfer mit der Schaufel aufhob. Noch lebendig und schreiend schüttete er es in das immense Feuer, das er den ganzen Tag in einem großen, stählernen Müllcontainer gefüttert hatte. Hyun-Ok trauerte still um den Unglücklichen, dessen Seele gerade als Funken himmelwärts stob.
Sie schlich sich davon. Ihr gebrochenes Schluchzen ging in einen Hustenanfall über, der tief aus ihrer infizierten Lunge kam. Endlich erstarben die gequälten Schreie. Sie mussten unbedingt aus diesem Teil der Stadt verschwinden! Der Verrückte namens Campos hatte Schilder aufgestellt: ›Unbefugten ist der Zutritt verboten‹. Was er getan hatte, sagte ihr, dass er seine Warnung ernst meinte.
Sie war die einzige Hoffnung ihres Sohnes. Sie hatte wenig Zeit, sein Überleben zu sichern. Mit jedem Tag schwächte die Krankheit Hyun-Ok mehr. Sie wusste, dass sie bald sterben würde. Aber sie durfte ihren fünfjährigen Sohn nicht sich selbst überlassen, schon gar nicht mit jemandem wie Campos in der Nähe. Nach tagelanger Suche war nur eine Person übrig geblieben, die infrage kam. Schon viel zu viel wertvolle Zeit und Energie hatte sie das gekostet. Schon bald musste Bang in Händen sein, die ihn beschützten.
Der, an den sie dachte, hatte ohnehin noch ein Mitglied seiner Familie zu begraben. Die wenige Zeit, die ihr noch blieb, konnte sie genauso gut mit ihrem Sohn verbringen. Es hatte keine Eile mehr.
So gut sie konnte, erholte sich Hyun-Ok von ihrem Hustenanfall und setzte ihren Heimweg fort. In der Stille der Nacht würde sie den Wald durchqueren, verborgen vor den wenigen verbliebenen Menschen. Seit sie erkannt hatte, dass ihr Sohn Bang keine Anzeichen der Viruserkrankung zeigte, war sie in jeder Nacht unterwegs gewesen.
Ein geliebter Mensch nach dem anderen war unter ihren Händen gestorben. Bang war ihr nicht von der Seite gewichen. Zuerst hatte ihre alte Mutter gehen müssen, dicht gefolgt von ihrem Vater. Kurz darauf ihr Mann, obwohl er sich verzweifelt an das Leben geklammert hatte und nicht gewillt gewesen war, seine Frau und seinen Sohn aufzugeben.
Bedeckt vom Schweiß des Fiebers und mit heiserer Stimme hatte ihm Hyun-Ok versichert, dass es seinem Sohn gut gehen würde. Sie hatte ihn gedrängt, sich fallen zu lassen ins friedliche Jenseits. »Ich werde bald bei dir sein, Liebster«, hatte sie gesagt, das Gesicht voller Tränen. So schwach, wie sie zu diesem Zeitpunkt schon gewesen war, hatten sie die Tränen überrascht.
Die Zärtlichkeit und die Wahrhaftigkeit ihrer Worte hatten ihn aufgeschreckt. Sein Blick war von ihr zu seinem Sohn an der Seite des Bettes gesprungen. Unter großen Schmerzen hatte er sich aufgerichtet, um Bang ins Gesicht zu sehen. »Er darf auf keinen Fall allein und wehrlos sein in dieser verrückt gewordenen Welt!«
Hyun-Ok hatte versucht, ihren Liebsten mit Worten zu trösten, während sie ihn sanft zurück auf das Kissen gedrückt hatte. Dann hatte sie ihm ihren Plan offenbart, wie sie ihren Sohn zu schützen gedachte. Er hatte sie beide fest an sich gedrückt und laut zu einem Gott mit tauben Ohren gebetet. Wie gerne hätte er seine Frau und seinen Sohn gleich mitgenommen. Dann hatte er sie leise für immer verlassen.
Seitdem war gerade einmal eine Woche vergangen. Noch in jener Nacht, nachdem Bang eingeschlafen war, hatte sich Hyun-Ok auf den Weg gemacht und begonnen, die wenigen Überlebenden in ihrer Nachbarschaft auszukundschaften. In schwarze Kleidung gehüllt und den zahlreichen Gefahren trotzend hatte sie die anderen ausgespäht und sich allein auf ihren Instinkt verlassen, wenn es darum ging, sie einzuschätzen. Sechshundert Menschen hatten ursprünglich in ihrer unmittelbaren Umgebung in Issaquah, einem Vorort von Seattle, gelebt. Bei einer Überlebensrate von nur zwei Prozent musste es ungefähr zwölf Überlebende geben. Überlebende, die man jetzt nur noch als Träger bezeichnete. Sieben hatte sie gefunden.
Die erste Person, auf die sie zwei Straßen weiter gestoßen war, hatte sie sofort ausgeschlossen. Sie war zu alt gewesen, um Beschützer eines Kindes von fünf Jahren zu sein. Die ältere Dame hatte ausgesehen, als habe sie höchstens noch ein Jahr vor sich, wenn überhaupt. Hyun-Oks Junge brauchte jemanden, der jünger war und ihn durch das Leben begleitete, zumindest bis er erwachsen war.
Beim Anblick des Mannes, den sie als Nächstes fand, hatte sie ebenfalls kein gutes Gefühl gehabt. Sie hatte beobachtete, wie entgrenzt er um seine verlorene Familie trauerte. Im Dunkeln hatte er draußen auf der Veranda in einem Liegestuhl gesessen und Obszönitäten in die Nacht hinausgeschrien. Als ob er geradezu auf die hungernden Hunde, die inzwischen verwildert waren, wartete. Er hatte zwar auf sie geschossen, aber nur, um einen Angriff zu provozieren. Hyun-Ok hatte seinen abgrundtiefen Schmerz spüren können. Sie hatte die Ahnung beschlichen, dass er es darauf anlegte, zu Tode zerfleischt zu werden. Wenn ihm das nicht gelänge, würde er sich wahrscheinlich bald selbst das Leben nehmen. Wahrscheinlich ging es vielen Überlebenden ähnlich. Also suchte sie weiter.
Als Nächstes hatte Hyun-Ok unbemerkt den Highway überquert und eine leicht bekleidete junge Frau gefunden, die auf einem verwaisten Grundstück Äpfel von einem Baum pflückte. Doch diese Frau würde die falsche Art Aufmerksamkeit erregen und wäre keine gute Wahl gewesen.
Der Mann, den sie letztendlich ausgewählt hatte, war der Einzige, der ihr fähig schien, der Beschützer ihres Sohnes zu sein. Außerdem hatte er etwas an sich – entweder war es die Art, wie er seine große Gestalt bewegte oder die bedächtige Würde, mit der er seine Lieben begrub – das Hyun-Ok das Gefühl gab, dass sich der Nachbar namens Graham als beste Wahl erweisen würde. Sie spürte, dass sie ihm ihren Jungen anvertrauen konnte. Nach dem bevorstehenden Tod von Grahams Vater würde er niemanden mehr zu begraben haben. Dann würde sie ihren Jungen zu ihm bringen und sich auf ihre eigene Reise in den Tod begeben. Noch einen Tag durchhalten, dachte sie. Aber bis es soweit ist, muss ich ihm alles über Bang aufschreiben.
Mit einem traurigen Lächeln durchstreifte sie das Labyrinth der geparkten Fahrzeuge. Aufmerksam lauschte sie allen Geräuschen, immer auf der Hut vor Gefahren. Ein letztes Mal warf sie einen Blick auf das glutrote Leuchten in der Ferne, bevor sie sich auf den Weg nach Hause machte. Ihre letzte große Aufgabe bestand darin, Graham davon zu überzeugen, dass er den Jungen ebenso brauchte wie dieser ihn. Sie wusste, dass dies die größte Herausforderung sein würde. Sie musste ihn davon überzeugen, oder ihr Sohn war verloren.
2| Gräber ausheben
Der gebrechliche alte Mann streckte die Hand nach seinem Sohn aus. Voller Tränen ergriff Graham sanft die zitternden, faltigen Hände seines Vaters, der vor ihm im Sterben lag. Er spürte, dass sie sich jetzt so nah waren wie nie zuvor.
Graham versicherte ihm, dass er es so machen würde, wie sie es besprochen hatten. Er würde das Gewehr zu allen Zeiten bei sich tragen. Mit ersticktem, rasselnden Husten erinnerte ihn sein Vater daran, dass Gott für ihn nicht vorgesehen hatte, sich das Leben zu nehmen. Das würde nur seelenloses Umherirren im Jenseits bedeuten. Zudem würde er nie wieder eins mit seiner verstorbenen Familie werden können.
Er hatte die Zeichen in jüngster Zeit zu oft gesehen und wusste, dass das Ende seines Vaters nah war. Verzweiflung breitete sich in ihm aus, denn diesmal würde er allein zurückbleiben, ohne auch nur eine einzige vertraute Seele auf der Welt. Der keuchende, pfeifende Atem seines Vaters wurde kürzer, der Blick starr, und das Gesicht sank in sich zusammen. Grahams Verzweiflung über den bevorstehenden Verlust des Vaters wich dem Gebet um Gnade und ein schnelles Ende. Er konnte es nicht mehr ertragen, wie sein Vater sich quälte. So wie sich auch diejenigen gequält hatten, die nun unter der Erde lagen. Einer nach dem anderen waren sie voller Schmerz und Trauer gestorben.
Graham konnte einfach nicht begreifen, weshalb ausgerechnet er noch lebte. Hilflos hatte er mitansehen müssen, wie seine Frau Nelly starb und ihr ungeborenes Kind mit sich nahm. Dann hatte ihn seine geliebte Mutter verlassen, gefolgt von seiner Schwester und seiner vier Jahre alten Nichte. Und nun sein Vater.
»Was soll ich ohne dich tun?«, fragte Graham.
Sein Vater antwortete langsam: »Mache das, was ich dir beigebracht habe. Triff gute Entscheidungen auf deinem Weg und bereue nichts. Du wirst es schaffen. Und du sollst immer wissen: Ich bin stolz auf dich.«
Graham wischte den Speichel von den Lippen seines Vaters und hielt seine Hand.
Als der Tod endlich kam, wurde sein Vater ganz ruhig und sagte ein letztes Mal: »Ich liebe dich, mein Sohn.«
Abgrundtief erschöpft von seiner schier endlosen Wacht rieb sich Graham das Gesicht. Vor Frust, Angst und Trauer liefen ihm die Tränen über seinen hellbraunen Backenbart. Er hatte sich nicht mehr rasiert, seit die Welt zusammengebrochen war, und es war ihm egal, ob er sich jemals wieder rasieren würde. Nahrung und sogar die Luft, die er zum Atmen brauchte, hatten jegliche Bedeutung für ihn verloren. Er hatte keine Ahnung, wie er weitermachen sollte ohne die Kraft und Orientierung, die ihm sein Vater gegeben hatte. Er weinte um ihn, wie er um die anderen vor ihm geweint hatte.
Nach dem allerletzten, rasselnden Schluchzen seines Vaters holte Graham tief Luft. »Reiß dich zusammen«, hätte sein Vater streng gesagt. Er beschloss, sich daran zu halten. Jetzt war er das Oberhaupt des Clans, und er würde weitermachen, als ob noch eine Familie existierte, die es zu beschützen galt.
Auch wenn es diesmal so schwer werden würde wie nie zuvor – er musste nur noch ein letztes Grab auszuheben. Es war ein schwacher Trost, aber für den Moment musste er genügen. Alle, die er jemals gekannt hatte, lebten nicht mehr: seine komplette Familie, alle Freunde, alle Bekannten. Vom einfachen Bettler bis zum reichsten Konzernlenker war keine soziale Schicht verschont worden. Sogar der Präsident war gestorben. Diese Pandemie praktizierte wahrhaft Chancengleichheit. Rassismus oder die Benachteiligung bestimmter gesellschaftlicher Schichten ließ sich ihr jedenfalls nicht vorwerfen.
Nur das schattige Morgenlicht leuchtete über ihnen, als sich Graham über die blau geäderten Augen des Mannes beugte, den er liebte und bewunderte. Dann schloss er diese Augen für immer.
»Auf Wiedersehen, Dad«, flüsterte er und küsste ihn auf die Stirn. Mit geübten Bewegungen wickelte er die Ränder des weißen Bettlakens langsam um den Körper seines Vaters. Dann verließ er leise das Zimmer.
***
Sein Vater hatte Graham um einen Platz zwischen den anderen vier Gräbern im preisgekrönten Rhododendrongarten seiner Mutter gebeten. Auf der einen Seite lagen seine Mutter und Nelly, auf der anderen seine Schwester und seine Nichte. So hatte es sein Vater gewollt, »zum Schutze der Ladys«, wie er gesagt hatte. Graham war von Anfang an klar gewesen, dass sein Vater, der immer ein Gentleman gewesen war, bis zum Ende durchhalten und sich erst nach den Damen des Hauses verabschieden würde.
Jetzt im Oktober ließ es sich im weichen Lehmboden noch leicht graben, aber bald würde es kalt werden. Der herbstliche Regen war oft dicht und lang anhaltend, doch an diesem Morgen regnete es in Strömen. Er würde warten müssen.
Graham fürchtete diese letzte Aufgabe fast so sehr, wie er sich davor gefürchtet hatte, seine geliebte Nelly zu beerdigen. Er ließ sich in den Sessel seines Vaters fallen und schluchzte unkontrolliert. »Was soll ich jetzt machen?«, schrie er, nahm sein Wasserglas und schleuderte es quer durch den Raum. Es zerschellte an der Wand.
Aber die Antwort hatte er bereits. Sein Vater hatte ihn darauf verpflichtet, ihre Pläne in die Tat umzusetzen. Graham erinnerte sich daran, aber fragte laut: »Wozu?« Er schluchzte weiter, frustriert von den unbeantwortet bleibenden Fragen.
Er verließ das Schlafzimmer, ging ans Fenster im Esszimmer und spähte hinaus in den Garten seiner Mutter. Er sah die verblichenen Blätter der Rhododendronbüsche. Die Erinnerung an ihre Frühlingsblüten ließ den Wunsch in ihm aufkommen, er könne seine Trauer irgendwie mit Nelly teilen. Nachdem die Pandemie ausgebrochen war, hatte er sich mit seiner Frau in das abgeschiedene Haus seiner Eltern geflüchtet. Hauptsache weg von dem Chaos, das in Seattle ausgebrochen war. Vergeblich hatte man versucht, das Virus mit Quarantänemaßnahmen unter Kontrolle zu bekommen. Nelly konnte nicht länger als Lehrerin arbeiten, und Grahams Job als Mathematikprofessor existierte nicht mehr. Das einzig Sinnvolle war gewesen, so schnell wie möglich ihre Wohnung in der Stadt zu verlassen. Die Entscheidung war endgültig gefallen, als eines Nachts Schüsse knallten, die ihn aufschrecken und seine schwangere Frau schützend an sich ziehen ließen. Am nächsten Morgen hatten sie erfahren, dass die Nachbarn wegen ihrer Lebensmittelvorräte ermordet worden waren. Aus Furcht, Nelly und er könnten die nächsten sein, hatten sie das Auto vollgepackt und die Stadt verlassen.
Während die Weltbevölkerung ausstarb, gingen die Menschen aufeinander los. Frische Lebensmittel wurden unendlich wertvoll. Selbst die Vorräte an Konserven gingen zur Neige. Diejenigen, die immun waren, beraubten die Lebenden. Alle suchten verzweifelt nach den schwindenden Nahrungsmittelreserven. Die Supermärkte wurden schon lange nicht mehr beliefert. Die vergeblichen Versuche der lokalen Behörden machten alles nur noch schlimmer. Mit Straßensperren sollten die Infizierten aus ihrem Gebiet herausgehalten werden, wodurch die Bewohner zu Gefangenen in ihren eigenen Gemeinden wurden.
Graham war von einem Vater großgezogen worden, der im Marine Corps gedient hatte. Dennoch war er davon überzeugt, dass der Besitz von Waffen streng reglementiert werden musste. Er fand, dass der allzu einfache Zugang zu Schusswaffen maßgeblichen Anteil an den zahlreichen Amokläufen an Schulen hatte. Graham war auch gegen die Kriege, die Amerika in aller Welt führte. Diese Ansicht verstärkte sich noch an den liberal gesinnten Schulen und Universitäten, die er besucht und an denen er schließlich gelehrt hatte.
Graham liebte und lebte die Kultur und die Ideale des pazifischen Nordwestens, in dem er aufgewachsen war. Ganz im Gegensatz zu seinem Vater und seiner Mutter, die ihre Sicht auf die Dinge stets für sich behalten hatten. Sie hatten weder öffentlich für eine Seite Partei ergriffen noch darauf gedrängt, dass die Kinder ihre Ansichten übernahmen. Sie wollten, dass Graham unabhängig und stark wurde in dieser unruhigen Welt.
Obwohl Grahams Vater darauf bestanden hatte, ihm schon in sehr jungen Jahren das Jagen beizubringen, hatte er nie eine eigene Waffe besessen. Sein Vater hatte oft versucht, ihn zu überzeugen, zum Schutz eine Pistole bei sich zu führen, zumal Graham verheiratet war und in einer zumindest nach Meinung seines Vaters gefährlichen Gegend lebte. Doch Graham hatte sich immer geweigert und im Gegenzug sogar versucht, seinen Vater davon zu überzeugen, dass diese Denkweise überholt war und jede Situation friedlich bereinigt werden konnte.
Sein Vater hatte das immer bezweifelt. Seine Erfahrungen besagten das Gegenteil. Während ihm die Haltung seines Sohnes weiter Sorgen machte, brachte er ihm im Laufe der Jahre wie selbstverständlich die Fähigkeiten bei, die es zum Überleben brauchte. Er wollte den Jungen vorbereitet wissen, unabhängig von persönlichen Idealen und politischer Zugehörigkeit. So verbrachten sie viel Zeit in der Wildnis. Sogar wenn sie in der Blockhütte der Familie Urlaub machten, brachte er seinen Sohn listig dazu, zu lernen. Vordergründig hatte er ihm alles beigebracht, was er über die Jagd und das Campen im Freien wusste, aber im Hintergrund waren es tatsächlich zahlreiche Überlebenstechniken gewesen, die er seinen Sohn gelehrt hatte.
Merkwürdigerweise hatten sie manchmal die alte Hütte erreicht, die im Laufe der Jahre mit fließendem Wasser und Strom nachgerüstet worden war, nur um festzustellen, dass beides nicht verfügbar war. Dann hatte ihm sein Vater gezeigt, wie man die Solaranlage aufbaute, um Strom zu gewinnen, und wie sich das Wasser aus dem nahe gelegenen See sterilisieren ließ. Er hatte ihm das Jagen beigebracht und ihm gezeigt, wie man die Beute zerlegte und das Fleisch über dem offenen Feuer zubereitete. Jetzt erst begriff Graham, wie klug und entschlossen der alte Mann dabei vorgegangen war.
Bevor alles zusammenbrach, waren Nelly und Graham glücklich gewesen. Sie hatten ein gutes Leben geführt. Erst kurz vor dem Weltuntergang hatten sie ihren zweiten Hochzeitstag gefeiert. Sie liebte es, zu planen und Listen aufzustellen. Wenig überraschend hatte sie ihrer beider Zukunft ganz genau vorgezeichnet.
Meist war Graham als Erster zu Hause und bereitete das Abendessen zu. Einmal hatte eine heftige Erkältung Nelly geplagt, sodass er sich entschlossen hatte, ihr so gut er konnte ihre Lieblingssuppe mit Wurst und Kohl nachzukochen, die sie beide so gern in dem italienischen Restaurant um die Ecke aßen. Er war erschrocken, als er sie an jenem Abend zu Hause vorgefunden hatte, früher zurück von der Arbeit als sonst. Zusammengekauert hatte sie weinend auf ihrem Bett gehockt. Sie neigte sonst nicht zu Weinkrämpfen, also musste etwas Schreckliches passiert sein. Er hatte sich zu ihr hinuntergebeugt, um sie zu trösten. Sie hatte ihn abgewehrt, sich aufgesetzt und ihn angestarrt. »Ich bin schwanger!«, hatte sie herausgeplatzt, das Gesicht tränenüberströmt.
»Du bist was?«, hatte er verblüfft erwidert.
»Ich bin schwanger. Wir bekommen ein Baby, und es ist viel zu früh! Es ist nicht Teil des Plans. Jetzt wird es nichts mehr mit meinem Master.«
Er hatte sie an sich gezogen, obwohl sie dagegen ankämpfte, und sie auf ihre nassen Lippen geküsst. »Du machst dich verrückt, Nelly. Wir bekommen ein Baby! Alles wird gut werden. Ich liebe dich!«
Aber nichts war gut gegangen. Kurz darauf war die Pandemie ausgebrochen und hatte Nelly und ihr ungeborenes Kind mitgenommen.
Jetzt, wo er ganz allein war, fragte er sich, wie viele in der Nachbarschaft noch am Leben waren und wie viele von ihnen, wie es sein Vater warnend genannt hatte, »böse Absichten« hatten.
Der prasselnde Regen war zu einem dichten Dauernieseln geworden. Er holte Regenmantel und Schaufel aus der Garage und griff nach dem Gewehr neben der Tür. Das Gewehr bei sich zu tragen fühlte sich für Graham inzwischen so selbstverständlich an, wie wenn man einen Schlüsselbund bei sich trug. Jedes Mal, wenn er nach draußen ging, hängte er es sich über die Schulter, und im Haus behielt er es stets in unmittelbarer Nähe. »Immer und überall«, so wie es sein Vater verlangt hatte.
Graham wusste, dass die Zeit gekommen war. Seine Kehle schnürte sich zusammen, während er versuchte, die Tränen zu unterdrücken. Draußen zwischen den Rhododendronbüschen lehnte er das Gewehr in Griffreichweite an die Gartenhütte. Der Wind frischte auf. Er stand da und lauschte. Sein Vater und er hatten sich das früh zur Gewohnheit gemacht. Der Akt des Zuhörens war zu einem Überlebensritual geworden. Die Umgebung sollte mit vertrauten Geräuschen gefüllt sein, und wenn diese völlig fehlten, konnte das nur Ärger bedeuten. Doch nur sehr wenige vertraute Geräusche waren übrig geblieben.
Kein Zug war in der Ferne zu hören, kein Flugzeug am Himmel. Keine Rasenmäher, keine quietschenden Keilriemen von Autos, kein permanentes Rauschen der Interstate 90, die sich durch die Stadt zog. Das Plaudern der Nachbarn und spielender Kinder waren nur noch Erinnerungen. Aber es waren genau diese Geräusche, die Graham vermisste.
Oft löste das, was er hörte, instinktiv seine Kampfbereitschaft oder seinen Fluchtreflex aus. Das Heulen eines Wolfes, das Knurren und Bellen der verwilderten Hunde, die sich um erlegte Beute stritten. Entferntes Gewehrfeuer. Gelegentliche Schreie, die allerdings in den vergangenen Tagen seltener geworden waren. Mit diesen Gedanken lenkte sich Graham ab, während er sich über den eingeweichten Lehmboden neben dem frisch aufgeschütteten Grab seiner Mutter beugte. In ihm hallten die Echos einer Welt, die still geworden war.
Schweiß tropfte von seiner Nase, während er mit aller Macht schaufelweise Erde hinter sich warf. Die Arbeit bot ein willkommenes Ventil für seine Wut und seinen Schmerz. Immer wieder rammte er die Schaufel in den Erdboden. Den Schmerz in Rücken und Schultern ignorierte er.
Dann vermochte er es nicht länger auszublenden. Als die Erinnerung in ihm hochkam, wie sich sein Vater und er an genau dieser Stelle den Baseball zugeworfen hatten, brach er zusammen. Er ließ die Schaufel fallen und ging er auf dem nassen Gras in die Knie. »Nein, das kann nicht wahr sein!«, schrie er und richtete sein Gesicht in den Himmel.
In diesem Moment nahm er aus dem Augenwinkel eine graue Gestalt wahr, gleich neben dem Berberitzenstrauch. Sie war so unscheinbar, dass er sie beinahe übersehen hätte. In einer fließenden, schnellen Bewegung griff er sein Gewehr und verfluchte sich dafür, sie nicht früher gesehen zu haben.
Graham legte an und zielte. Die Trauer schürte seinen Zorn. »Komm zurück! Ich schieße!« Die Gestalt versuchte, leise um die Ecke des Hauses herum in den Hintergrund zu entschlüpfen. Aber er wusste, dass sie dort war. Er konnte ihre Anwesenheit spüren, hatte aber keine Ahnung, wer oder was es sein könnte.
»Hier gibt es nichts zu holen, also verschwinde bitte«, ergänzte er, nun etwas ruhiger.
Dann signalisierte ein unterdrücktes Husten, dass tatsächlich jemand hinter der Ecke war. Graham war sich sicher, dass das Geräusch nicht seiner Fantasie entsprang. Er bewegte sich einige Schritte seitwärts, um den verdeckten Raum einsehen zu können. Dabei zielte er unablässig in Richtung der Person, die es wagte, ihn in seinem privaten Schmerz zu stören.
Eine dünne, weibliche Silhouette wurde sichtbar. Die Kapuze ins Gesicht gezogen stand sie gegen das Haus gelehnt da. Sie beugte sich nach vorne in dem vergeblichen Versuch, den Hustenanfall zu unterdrücken. Als der Husten nachließ, hob sie den Kopf und sah Graham mit starrem Blick an. Ihre Augen flehten, während sie die Hände hob, um zu zeigen, dass sie nichts Böses im Schilde führte.
Die zerbrechlich wirkende Frau humpelte nach vorne, stoppte und hob erneut die Hände. Graham konnte die Zeichen der Krankheit sehen, die sie schon deutlich geschwächt hatte. Nachdem sie noch ein paar Schritte näher gekommen war, erkannte er, dass kaum noch eine Stunde Leben in ihr war. Ihr Gesicht zeigte all die Zeichen, die er schon kannte. Allein die Tatsache, dass sie es schaffte, vor ihm zu stehen, kam einem Wunder gleich. Der nicht enden wollende Husten schüttelte ihren ganzen Körper. Graham näherte sich ihr bis auf fünfzehn Fuß und senkte den Lauf seiner Waffe. Sein Blick begegnete ihren bittenden Augen, wohl wissend, dass jeder Atemzug ihr letzter sein konnte.
Sie muss eine der Letzten sein, die am Virus erkrankt sind, aber noch leben. Jedoch nicht mehr lange.
»Ich bin Hyun-Ok«, flüsterte die Frau mit kaum hörbarer, rasselnder Stimme. Sie deutete vage hinter sich. »Das ist mein Sohn Bang.«
Graham stolperte einige Schritte zurück und hob die Hand. Er wusste sofort, was sie von ihm wollte. Er schüttelte den Kopf. »Nein, ich kann mich um niemanden kümmern.«
Sie schleppte sich einige Schritte vorwärts und flehte ihn an: »Ich habe Sie beobachtet. Sie sind ein guter Mann. Bitte, Sie sind der Einzige, der in Frage kommt. Er ist immun, wie Sie.«
Bevor Hyun-Ok mehr sagen konnte, stolperte sie auf der geschotterten Einfahrt, fiel auf die Knie und begann wieder zu husten. Der Junge rannte an ihre Seite.
Überrascht, ein so kleines Kind zu sehen, hängte sich Graham das Gewehr über die Schulter und kam einige Schritte näher. Er hatte sich noch nie von der Gefahr abschrecken lassen, dass das Virus ihm gefährlich werden könnte. Verdammt, er hatte sogar versucht, sich anzustecken, nachdem Nelly gestorben war.
Graham hob den kleinen, schmalen Körper der sterbenden Frau auf und trug sie in seinen Armen. Der Junge beobachtete jede seiner Bewegungen und blieb dicht hinter ihm, als er zum Haus zurückging.
Nur wenige Optionen blieben. Er konnte nicht dabei zusehen, wie die Frau in seiner Einfahrt starb, schon gar nicht mit ihrem Kind in der Nähe. Sein Vater hätte das vermutlich ebenso wenig zugelassen. Mit einer freien Hand öffnete er die Glasschiebetür, während die Frau weiter in seinen Armen huste. Den Jungen konnte er nicht sehen, aber er wusste, dass er hinter ihm stand. Er legte sie auf das Sofa im Wohnzimmer und hörte, wie der Junge die Tür zuschob. Graham nahm die rote Blumensteppdecke seiner Mutter von der Rückenlehne und legte sie über die kleine Frau.
Er sah zu, wie der Kleine zu seiner Mutter stürmte. Sie griff nach ihm, und sobald sie sich wieder etwas unter Kontrolle hatte, ergriff sie auch Grahams Hand. Mit verzweifeltem Blick sah sie ihn an.
»Bitte, Graham, Sie müssen ihn zu sich nehmen, es gibt sonst niemanden«, sagte sie.
Er fragte sich, woher sie seinen Namen kannte. »Ich hole Ihnen etwas Wasser«, sagte er und versuchte, dem Gespräch auszuweichen. Ihm war bewusst, wie grausam und hilflos sie sich in ihrer Lage fühlen musste, wohl wissend, dass sie ein kleines Kind in dieser neuen Welt allein zurücklassen würde.
»Nein, es bleibt nur noch sehr wenig Zeit«, murmelte sie. »Bitte keine Umstände.«
In diesem Moment tat sich Graham nicht mehr so leid wie noch gerade eben. Er wusste, dass der Junge in einer viel übleren Lage war. Und trotzdem. Er fühlte sich nicht bereit, für ihn die Verantwortung zu übernehmen.
Bevor Hyun-Ok weitersprach, legte sie die kleine Hand ihres Sohnes in die von Graham. »Sie brauchen ihn ebenso sehr, wie er Sie braucht. Bitte nehmen Sie ihn auf«, fuhr sie weinend fort.
Graham ertappte sich dabei, wie er nickte, während ihm ihre Verzweiflung immer bewusster wurde. Jede Sekunde würde sie genau dort auf dem Sofa vor den Augen ihres Sohnes sterben. Er konnte kein neues Leid ertragen. Er gab nach.
»Ich werde ihn zu mir nehmen. Ich werde mich um ihn kümmern.«
Damit sie in Frieden gehen konnte, hob er das Kind auf das Sofa neben seine Mutter. Als der Junge laut zu weinen begann, brach Grahams Stimme. »Alles ist gut. Ich verspreche, gut auf ihn aufzupassen.«
Graham wollte ihr unbedingt dieses Geschenk machen. Er hatte nichts tun können, als er seine geliebte Familie verloren hatte, aber er konnte zumindest dieser Fremden Frieden geben. In ihrem letzten Moment wollte er ihr zeigen, dass es noch Menschlichkeit gab. Er vermisste die Güte der Lebenden.
Hyun-Ok sah zu ihm auf. Auf ihrem Gesicht lag die gleiche Ruhe, die Graham am frühen Morgen auf dem Gesicht seines Vaters gesehen hatte. Ihr Gesicht wurde weich. Sie rang sich ein schwaches Lächeln ab, während sich ihre Augen von Graham auf ihren Sohn richteten. Sie blinzelte die Tränen weg, ihr Lächeln verschwand, und ihr Mund klappte auf. Der Funke des Lebens war verloschen, einfach so. Sie hatte den Übergang von dieser Welt in die nächste mit geborgter Zeit vollendet.
Graham ließ seinen Blick ein paar stille Momente auf ihr ruhen. Er hörte, wie ein leiser, erstickter Schrei tief aus dem Jungen kam. Zusammengekauert blieb er neben seiner Mutter liegen. Graham verstand seine Trauer. Auch der Junge hatte zu viel Tod gesehen, und das viel zu früh in seinem Leben. Er strich dem Jungen über den Kopf, der sich an seine Mutter klammerte und weinte.
Sanft schloss er Hyun-Oks Augen und legte seine Hand auf die Schulter des Jungen. »Alles wird gut«, sagte er. Der Junge stieß ihn weg und hielt sich an seiner Mutter fest.
Graham ging einen Schritt nach hinten. Er schüttelte den Kopf und verfluchte sich für das Versprechen, das er gerade gegeben hatte. Er ging aus dem Zimmer und ließ den kleinen Jungen zurück. Nun gab es ein weiteres Grab, das er vor Sonnenuntergang auszuheben hatte.
3| Im Dunkel vor dem Morgengrauen
Graham hob das Grab der toten Frau unmittelbar neben dem seiner geliebten Nelly aus. Er mochte den Gedanken, dass die beiden in der Welt der Lebenden gut miteinander ausgekommen wären. Beide hatten sie Kinder geliebt, und er wollte nicht, dass diese tapfere kleine Frau allein war. Es fühlte sich einfach richtig an.
Erschöpft lief Graham zum Haus zurück. An der Tür stampfte er den Schlamm von den Stiefeln. Der Junge lag noch immer an der Seite seiner Mutter. Graham wusste, dass das kein gutes Zeichen war. Was ist, wenn ich ihn nicht dazu bringen kann, sich von seiner Mutter zu lösen?
Er ging zu dem Jungen und schüttelte ihn wach. Augen wie die seiner Mutter, aber rot umrandet, sahen zu ihm auf.
»Na, mein Junge, wie heißt du noch mal?«, fragte Graham. Der Junge zögerte.
»Also, ich bin Graham. Und wie heißt du?«
»Bang.«
Graham war sich nicht sicher, ob er richtig gehört hatte. »Wie bitte?«
»Bang!«, rief der Junge und warf sich weinend auf den Bauch.
»Komm schon, Bang, ich brauche deine Hilfe«, sagte Graham.
Der Junge schloss die Augen und vergrub sein Gesicht an der Seite seiner Mutter.
»Nun komm schon. Wir haben viel zu tun«, beharrte Graham. Er zog ihn von seiner Mutter weg und vom Sofa herunter. Bang schrie, trat um sich und landete dabei einen Glückstreffer gegen Grahams Schienbein.
»Verdammt noch mal, Kind!« Er hielt Bang am Arm fest und zog den tretenden und schreienden Jungen in das Zimmer seines Vaters.
»Sieh dort hin!«, rief Graham über das Schreien hinweg und deutete auf seinen toten Vater. Der Junge wurde ruhiger und blickte Graham entsetzt an. Seine Augen waren nass, seine Nase lief. Bang versuchte, mit dem Schniefen aufzuhören.
»Wir müssen ihn begraben, und danach werden wir deine Mutter beerdigen«, sagte Graham mit strenger Stimme. »Aber dazu brauche ich deine Hilfe.«
Er ließ den Arm des Jungen los, und Bang griff nach dem Laken, in das der Tote gewickelt war. Graham nahm einen tiefen Atemzug.
»In Ordnung, Dad, los gehts«, sagte er und brachte seine Arme unter den leblosen Körper, der bereits zu erstarren begann. Er ließ sich leichter heben, als erwartet. Graham hielt seinen Vater fest an seine Brust gedrückt.
»Komm«, sagte er zu dem Jungen. Vielleicht half es, ihm etwas zu tun geben, damit er beschäftigt war. Bang folgte ihm nach draußen. Im Garten hielt Graham für einen Moment inne und vergrub sein Gesicht an der Schulter seines Vaters. »Es tut mir so leid, Dad«, sagte er und wünschte, er könnte seinem Vater ein würdevolleres letztes Geleit geben.
Der spätnachmittägliche Himmel war grau und deutete darauf hin, dass noch mehr Regen zu erwarten war. Graham legte seinen Vater am Rand des Grabes ab, sprang in die Grube und sah nach oben zu Bang. Der Junge hatte sich tatsächlich beruhigt. Vielleicht, weil er etwas zu tun hatte, vielleicht, weil er benommen war von den vielen Toten. Was auch immer der Grund sein mochte, Graham war dankbar dafür.
»Okay, hilf mir, ihn hier hinein zu bekommen«, sagte Graham, während er darum rang, seine eigenen Gefühle zurückzuhalten. »Versuche, ihn ein wenig mit zu schieben.«
Graham zog seinen verstorbenen Vater zu sich heran. Der Junge half, so gut er konnte, auch wenn er wenig auszurichten vermochte. Zu schnell kam der Körper herunter, sodass es eher in einem kontrollierten Fall endete. Graham überwältigten die Tränen. Er richtete seinen Vater ordentlich im Grab aus und kletterte wieder heraus. Sobald er oben war, bemerkte er, dass der Junge weg war. Er sah sich im ganzen Garten um, aber das Kind war spurlos verschwunden.
»Scheiße!«, rief Graham, gefolgt von: »He, Bang!«
Graham rannte zur Hintertür des Hauses, mit dem Gedanken, dass Bang vielleicht zu seiner toten Mutter zurückgelaufen war. Er schaute durch die Glastür, aber es war kein Junge zu sehen. Dann hörte er einen Schrei und Hundegebell. Beides kam von der Vorderseite des Hauses.
Graham griff nach seinem Gewehr und rannte um das Haus herum, wo er Bang die Straße hinunterstürzen sah, einen Pitbull auf den Fersen. Er brüllte und rannte geradewegs auf den Hund zu, was genug war, um ihn abzulenken und die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Graham zielte und feuerte. Der Hund war sofort tot.
Graham zögerte keine Sekunde, denn der Tumult würde andere Raubtiere anlocken. Er schnappte sich Bang unter den Arm, rannte mit dem schreiend um sich tretenden Jungen zurück auf das Grundstück und schlug das Tor hinter sich zu. Dann setzte er Bang auf dem Gras ab und kniete sich vor ihn.
»Schon gut, schon gut, sei leise! Es ist vorbei. Der Hund ist tot«, sagte Graham. Er fühlte sich schuldig, dass er das Kind zwingen musste, ruhig zu sein. Graham ging zum Tor, um nach weiteren Hunden Ausschau zu halten. Für den Moment war alles ruhig.
»Du musst still sein, oder die anderen bösartigen Hunde finden uns«, sagte er und streichelte dem Jungen über den Kopf, der versuchte, sein Weinen zu unterdrücken. »Alles in Ordnung mit dir? Hat er dich gebissen?«
Bang schüttelte den Kopf. Graham nahm ein Taschentuch und trocknete ihm das Gesicht. Die Brust des kleinen Jungen bebte vor Erregung, während er versuchte, sein Schluchzen zurückzuhalten.
»Ich weiß, das alles ist furchtbar, aber du darfst nicht weglaufen. Deine Mama wollte, dass du bei mir bleibst, dass ich für dich sorge. Ich habe es ihr versprochen. Bitte, tu das nie wieder. Na komm, lass uns das zu Ende bringen.« Graham stand auf und ging zurück zu den Gräbern, das Gewehr in der Hand und den Blick auf die Straße gerichtet. Wenn sie Glück hatten, würden die Raubtiere den Hundekadaver interessanter finden als ihn oder den Jungen.
»Wir müssen leise sein hier draußen, okay?«
Langsam, mit etwas Abstand, folgte ihm der Junge.
Graham kniete sich an den Rand des Grabes, das für seinen Vater bestimmt war. Nach einem kurzen Moment der Andacht stand er auf und nahm die Schaufel in die Hand. Als Bang zu ihm lief, gab Graham ihm eine kleinere Schaufel.
»Hier, die ist für dich«, sagte er, aber der Junge fing an zu zittern und weinte wieder. »Gut«, murmelte Graham frustriert. »Dann setz dich einfach da hin.«
Widerwillig nahm er eine Schaufel voll Erde und hob sie langsam über das offene Grab. Er begann bei den Füßen seines Vaters und ließ die Erde vorsichtig hineinrieseln. Er schüttete eine weitere Schaufel Erde hinein, dann noch eine und noch eine. Aber als es an der Zeit war, das Gesicht seines Vaters zu bedecken, zögerte er. Er weinte nicht, aber tiefe Trauer durchdrang ihn.
Das Nächste, was er wahrnahm, war ein erneuter Aufschrei des Jungen und das Knurren eines Hundes dicht hinter ihnen. Graham blickte auf und sah noch zwei weitere Hunde auf sie zukommen. Er griff nach Bang und riss ihn zur Seite, während der Hund in die Jacke des Jungen biss. Er schleuderte den Jungen hinter sich an den Rand des Grabes. Bang schrie laut und versuchte, auf allen vieren vom Grab wegzukriechen. Graham schwang die Schaufel wie eine Kriegsaxt und erwischte den Kampfhund mit voller Wucht am Schädel. Dann nahm er sein Gewehr und jagte dem betäubten Tier eine Kugel in den Schädel.
»Haut ab!«, schrie er die beiden anderen an.
Mit gefletschten Zähnen und nach unten geneigtem Kopf kam der nächste Hund auf ihn zu. Der dritte versuchte, ihn zu umgehen, um sich den Jungen zu schnappen. Graham schoss dem Hund, der auf ihn zukam, direkt in die Stirn. Er war so nahe, dass Graham den feinen Nebel aus Blutspritzern auf seinem Gesicht spürte.
Der letzte Hund versuchte, Graham mit einem überraschenden Satz zuvorzukommen. Aber es war zu spät für ihn. Mit dem Gewehrkolben schlug der Mann den Hund zur Seite, was ihm gerade genug Zeit verschaffte, einen Schuss abzufeuern. Er traf den Hund an der Hüfte. Ein letztes Mal legte er das Gewehr an und zog den Abzug.
Nichts passierte. Er hatte keine Munition mehr, genau in dem Moment, in dem ein rasendes, verwundetes Biest auf ihn zukam. Er warf das Gewehr beiseite und nahm wieder die Schaufel, rutschte dabei im Schlamm aus und schlug der Länge nach hin. Der verletzte Hund verbiss sich wütend in seinem Hosenbein.
Graham schwang die Schaufel mit aller Macht. Dann war eine Art metallener Gong und ein kurzes Aufjaulen zu hören. Aber er spürte noch immer, wie der Hund an seiner Hose riss. Wieder und wieder schlug er mit der Schaufel zu, bis endlich nichts mehr zu hören war. Graham rappelte sich auf.
Bang starrte auf das tote Tier. Das Knurren hatte aufgehört, aber der Junge schrie weiter aus Leibeskräften. Er war völlig außer sich. Graham ließ die Schaufel fallen und packte ihn an den Schultern. »Du musst leise sein, oder es kommen noch mehr«, zischte er ihm ins Ohr. Er ließ den Jungen stehen und füllte das Grab seines Vaters auf, so schnell er konnte. Die ganze Zeit sah er sich hektisch um.
Die Kadaver der Hunde warf er in eine Schubkarre. Dann kniete er sich wieder neben das Grab seines Vaters. Obwohl Graham nie ein religiöser Mensch gewesen war, hoffte er, dass alle seine Lieben an einem besseren Ort waren. Es zerriss schier sein Herz, als er die aufgehäufte Erde mit seinen rauen Händen ebnete.
»Es ist so schwer, sich zu verabschieden, Dad. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich weitermachen soll.« Dann erinnerte er sich daran, was sein Vater von ihm erwartete. Er stand auf, griff nach seinem Gewehr und brachte den schluchzenden Jungen ins Haus.
Sie mussten noch die Mutter des Jungen beerdigen, und die Abenddämmerung kam schnell. Graham wusste, dass er sich beeilen musste. Bang rannte sofort zu ihr. Das würde nicht leicht werden, soviel stand fest.
Mit einem Lappen säuberte er das Gewehr rasch vom Schlamm und lud nach. »Wir müssen sie jetzt begraben«, sagte Graham, als er fertig war.
»Nein!«, heulte der Junge.
»Wir können sie nicht hier liegenlassen. Es wird dunkel, wir müssen es jetzt tun«, sagte Graham schroff und ging zum Sofa. Bang legte seine Arme um seine Mutter, als wollte er sie beschützen. Graham zog ihn an den Schultern zurück und sagte: »Schau, Junge, wir müssen sie genau jetzt begraben. Du kannst entweder helfen oder zur Seite gehen. Zwing mich nicht, dich in einem der Zimmer einzusperren. Das Mindeste, was du jetzt für deine Mutter tun kannst, ist stark zu sein und mir zu helfen.«
Graham wickelte die rote Blumensteppdecke um Hyun-Ok, so wie er es mit den anderen getan hatte. Zuerst stand Bang nur schluchzend daneben. Dann fing er an, über ihre eingewickelten Beine zu streichen. Als Graham begann, den Rest von Hyun-Ok zu umwickeln, bemerkte er eine Halskette, an der ein Medaillon hing. Er nahm die Kette ab, während der Junge zusah. Dann streckte er seine Hand nach Bang aus, der zurückzuckte und ihm offenbar misstraute, bis er erkannte, was Graham vorhatte. Er ließ zu, dass Graham ihm die Kette umlegte. Mit einem leisen, dumpfen Geräusch schlug das Medaillon gegen seine schmale, knochige Brust.
»Sie hat ein Buch in der Tasche«, sagte der Junge und zeigte auf ihren grauen Mantel. Es waren seine ersten Worte, abgesehen von seinem Namen und »Nein«.
Graham durchsuchte ihren Mantel und fand ein kleines, ledergebundenes Tagebuch.
»Ist das für dich?«, fragte er. Bang zuckte nur mit den Schultern.
»Nun, du nimmst es erst einmal«, entschied Graham. Er fuhr fort, Hyun-Ok zu umwickeln, und stoppte, als er ihr Gesicht erreichte.
»Du kannst herkommen und dich verabschieden«, sagte er zu Bang.
Der Junge zögerte, schniefte und küsste sie dann auf die Wange. Er umarmte sie noch ein letztes Mal und streichelte ihre langen, seidigen Haare.
Graham sah nach draußen. Es wurde schnell dunkel. Er zog den Jungen sanft von seiner Mutter weg. »Okay, es ist an der Zeit. Wir müssen sie jetzt beerdigen.«
Der Junge beobachtete, wie Graham ihr Gesicht mit der Decke umhüllte. »Nein, nein, nein!«, jammerte er wieder. Bang versuchte, die Decke herunterzuziehen. Um ihn daran zu hindern, musste Graham ihn festhalten. Er wusste, dass es dem Jungen das Herz zerriss, aber er hatte keine Wahl.
»Pass auf«, sagte er, »wir müssen sie jetzt begraben, oder wir bekommen mehr Probleme mit den Hunden. Willst du das? Deine Mutter möchte, dass du in Sicherheit bist, dass du am Leben bleibst. Das schaffen wir nicht, wenn uns noch mehr Hunde aufspüren.«
Bang sah elend und verwirrt aus und schüttelte nur den Kopf.
»Also gut, lass uns das zu Ende bringen, bevor es komplett dunkel ist«, sagte Graham und warf sich das Gewehr über die Schulter.
Er hob Hyun-Oks leichten Körper auf und führte die kleine Prozession hinaus zu ihrer letzten Ruhestätte. Der Junge weinte. Je näher Graham dem Grab kam, desto mehr kämpfte Bang, um die Decke wegzuziehen. »Hör auf damit!«, befahl Graham.
Als sie das Grab erreicht hatten, legte Graham Hyun-Ok an den Rand ins Gras. Bang zog weiter an der Decke und legte die Füße frei. Graham stieß ihn weg. Unsanft landete Bang auf seinem Hinterteil.
Nachdem er sich nach verwilderten Hunden und weiteren Raubtieren umgesehen hatte und keine zu entdecken waren, sprang Graham in das ausgehobene Grab. »Los Junge, hilf mir«, flüsterte er, aber Bang ignorierte ihn.
Graham hob Hyun-Oks Körper in das Grab und setzte sie vorsichtig am Boden ab. Auf allen vieren beugte sich Bang über den Rand des Grabes und schrie wieder: »Nein, nein!«
Graham ignorierte den Jungen und schaufelte Erde in das Grab, so schnell er konnte. Bang weinte und tobte. Graham fühlte sich schrecklich, es auf diese Weise tun zu müssen, aber die Umstände ließen ihm keine andere Wahl.
Die Dunkelheit würde die Raubtiere mit sich bringen.
Es war fast dunkel, als er fertig war. Bangs Schluchzen war in ein leises Wimmern übergegangen. Obwohl Graham emotional und körperlich erschöpft war, begann er, die über dem Grab aufgehäufte Erde zu glätten. Zu seiner Überraschung schob Bang seine Hände beiseite und begann, die Erde selbst glatt zu streichen. Graham ließ ihn gewähren.
Ein entferntes Heulen durchbohrte das Schweigen des nächtlichen Gartens. Graham lief ein Schauer über den Rücken. »Okay, Bang, beeil dich und sage auf Wiedersehen.«
Der Junge murmelte etwas, dass Graham für Koreanisch hielt. Er kniete sich neben Bang und senkte den Kopf. Er hoffte, seinen Teil getan zu haben, damit Hyun-Ok friedlich gehen konnte. Laut, sodass der Junge es hören konnte, sagte er: »Ich werde auf deinen Sohn achtgeben, genau wie ich es versprochen habe.« Graham hörte erneutes Weinen. Er streckte die Hand aus und half Bang hoch, der sich nun gegen seine Schulter lehnte.
4| Die Glücklichen
Sie waren die Glücklichen. Sie konnten ihre Toten begraben. Die meisten Familien, in denen niemand zu den zwei Prozent Überlebenden gehörte, wurden nicht beerdigt. Sie lagen in Krankenhausbetten, ihren eigenen Betten und manchmal in Fahrzeugen, gestorben bei dem Versuch, ein Ziel zu erreichen oder zu fliehen vor dem Zerrbild des Lebens, das sie einst gekannt hatten.
Schon kurz nach Beginn der Pandemie hatten siechende und sterbende Menschen die Krankenhäuser überfüllt. Anfangs hatte man noch versucht, jeden Toten in einen schwarzen Leichensack aus Plastik zu packen. Bald waren die Vorräte verbraucht. Als sich die Krankheit weiter ausbreitete, war man dazu übergegangen, die Leichen auf Parkplätzen zu verbrennen. Zahllose Körper hatte man einfach liegen gelassen, damit sie verrotteten. Abhängig von der Umgebung beschleunigte oder verlangsamte die Natur den Verwesungsprozess.
Der Geruch lockte Scharen von wilden Tieren aus den Wäldern in die Städte und Siedlungen. Sie erschienen unmittelbar an den Häusern und auf den mit schwarzem Asphalt bedeckten Straßen. Zahlreich säumten sie das Labyrinth der befestigten Wege, das über ihre Grenzen hinausführte. Angelockt vom Duft des verwesenden Fleisches füllten jetzt sie die Leere, die die fehlenden Geräusche der Menschen hinterlassen hatte. Aus alleingelassenen Haustieren wurden bald entweder Jäger oder Gejagte, die verwilderten und zu ihrer ursprünglichen Natur zurückkehrten. Häufig bildeten sie große Rudel und oft mischten sie sich mit Wildtieren.
Kojoten, Wölfe, Bären und Luchse jagten ihre natürliche Beute, das Rotwild, das früher nur kurz in der Dämmerung zu sehen gewesen war. Jetzt war immer häufiger der Klang der Hufe von Wiederkäuern auf dem harten Asphalt und auf den Bürgersteigen zu hören. Aber es gab nur noch wenige menschliche Ohren, die das wahrnehmen konnten. Diejenigen, die es hörten, vernahmen ebenso oft die Geräusche der Wildnis, wenn die Beute durch Fänge und Klauen zu Tode kam. Die Überlebenden mussten stets selbst fürchten, einem wilden Raubtier zum Opfer zu fallen. Also blieben sie in ihren Unterständen und Schutzhütten, wo ihnen langsam aber stetig die Vorräte ausgingen.
***
Graham setzte den Jungen ab und schloss die Tür. Der Wind frischte auf. Es begann wieder zu regnen. Bang stand nur da, reglos und benommen. Graham sah hinaus zu den Gräbern, jetzt sechs an der Zahl. Er lehnte seinen Kopf an das kalte Glas und kämpfte gegen die Verzweiflung, die ihn zu überwältigen drohte. Er dachte über die Antwort nach, die ihm sein Vater gegeben hatte auf die Frage: »Warum soll ich weitermachen?«
»Du wirst einen Grund finden, oder der Grund wird dich finden.« Graham sah den Jungen an. Großartig! Mein Grund ist ein todtrauriges Kind?
Graham seufzte und blickte auf seine mit Schlamm verkrusteten Stiefel. Er fing an, sie an der Fußmatte abzustreifen, merkte aber bald, wie sinnlos das war. Er zog sie aus und sah die Tennisschuhe des Jungen, die ebenfalls von Schlamm überzogen und zu schmutzig waren, um damit im Haus seiner Eltern herumzulaufen.
»He, Bang, zieh die Schuhe aus«, sagte er.
»Ich will nach Hause«, jammerte der Junge.
Graham fasste ihn an den Schultern und drehte ihn zu sich herum, damit der Junge ihn ansehen musste. »Hör zu, deine Mutter hat die letzten Momente ihres Lebens damit verbracht, dein Leben zu retten. Sie hat dich zu mir gebracht. Ich habe versprochen, mich um dich zu kümmern. Das werde ich tun, bis du es fertiggebracht hast, getötet zu werden. Bis dahin wirst du tun, was ich sage und wann ich es sage. Und wenn du wieder fortläufst, wirst du keine zwei Straßenkreuzungen weit kommen, bevor sich große, hungrige Hunde über dich hermachen. Nur dass ich dich dieses Mal nicht retten werde, weil du nicht auf mich gehört hast. Verstanden?«
Bang weinte, aber sein angstvoller Blick richtete sich auch nach draußen in die zunehmende Dunkelheit. Graham hoffte, dass die Warnung ausreichte, um ihn vom Weglaufen abzuhalten. Es hatte nicht viel gefehlt, und der Junge wäre schon vorhin zerfleischt worden.
»Jetzt zieh die Schuhe aus«, befahl er noch einmal.
Bang setzte sich auf den Teppich und schnürte seine Schuhe auf. Er schniefte weiter, tat aber immerhin, was ihm gesagt wurde.
»Hast du Hunger?«, fragte Graham in freundlicherem Ton.
Der Junge reagierte nicht.
Auch Graham verspürte kein Bedürfnis, etwas zu essen. Er sah auf seine schmutzigen Hände. Graham machte sich Sorgen, Bang könnte wieder versuchen davonzulaufen, sobald er ihm den Rücken zukehrte, also sagte er: »Okay, hör zu. Ich muss duschen gehen. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder kannst du mir versprechen, dass du hierbleibst und dich benimmst. Oder du kannst dich von den Hunden draußen fressen lassen. Entscheide dich, was willst du? Ich habe nämlich keine Zeit für Spielchen.«
Schluchzend sagte der Junge: »Bleiben.«
»In Ordnung«, sagte Graham. »Es wird dunkel hier im Flur. Lass uns nach hinten gehen.« Bang hob seinen Rucksack auf, der neben der Tür lag. Graham bemerkte erst jetzt, dass der Junge überhaupt einen Rucksack dabei hatte. Bang folgte ihm.
Seit die Krankheit ausgebrochen war, hatte Grahams Familie das Haus in der Nacht meist dunkel gehalten. Er nahm eine Taschenlampe, um den Weg zur anderen Seite des Hauses auszuleuchten. Dort öffnete er die Schlafzimmertür und richtete das Licht der Taschenlampe auf zwei Betten.
»Das dort am Fenster ist meins. Du kannst hier schlafen«, sagte Graham und zeigte auf das Bett neben der Tür. Dann zeigte er in die andere Richtung. »Da ist das Bad, gleich über den Flur. Ich möchte, dass du aufs Klo gehst und dir die Hände wäschst.«
Der Junge sah zu ihm auf. Graham begann sich schuldig zu fühlen, weil er ihn so hart anpackte, aber es ging nicht anders. Der Junge lief ins Badezimmer, in dem ein kleines Nachtlicht sanft leuchtete, und machte die Tür hinter sich zu.
Graham gehört das Wasser laufen und wartete im Flur, bis der Junge fertig war. In der Zwischenzeit lehnte er seinen Kopf gegen eine Schranktür. Er hatte heute noch nichts gegessen. Aber selbst wenn er es versuchte, es würde nicht drin bleiben, soviel wusste er.
Seine Gedanken wanderten zurück zum Beginn des Tages und zum Tod seines Vaters im Morgengrauen. Als er nach unten sah, stand dort Bang, der ihn stumm anblickte.
»Bist du fertig?«
Der Junge nickte.
Graham ging mit ihm ins Schlafzimmer und zog die Bettdecke für ihn zurück. »Okay, rein mit dir«, sagte er.
Der Junge kletterte ins Bett und ließ sich von Graham zudecken. »Ich gehe duschen. Du wirst hierbleiben, oder?« Bang nickte, aber seine Unterlippe zitterte. Graham versuchte, ihm über den Kopf zu streichen, aber der Junge schreckte vor seiner Berührung zurück.
Graham schloss die Schlafzimmertür, ließ aber die Tür zum Bad offen, damit er alles mitbekam. Er betrachtete sich im Spiegel, das Gewehr noch immer über der Schulter. Er erblickte einen Mann, den er nicht kannte. Er sah verdreckt und völlig ausgebrannt aus, bar jeder Energie und Emotion. Graham schälte sich aus der schmutzigen Kleidung, drehte die Dusche auf und lehnte das Gewehr gleich daneben an die Wand. Den Duschvorhang ließ er halb offen, sodass er hinausblicken konnte. Er ließ das heiße, dampfende Wasser über seinen geschundenen Körper laufen und beobachtete, wie sich das Wasser braun verfärbte. Nachdem er den Schmutz der Gräber abgeduscht hatte, sah er im Schlafzimmer nach. Der Junge war eingeschlafen.
Graham blieb an der Tür stehen und beobachtete das schlafende Kind. Dann bemerkte er das Buch mit Ledereinband, das oben auf dem Kinderrucksack lag. Er nahm es in die Hand und setzte sich auf sein Bett. Unter dem hellgelben Schein der Taschenlampe holte er das Buch aus dem Einband. Die ersten beiden Seiten zeigten einen Stammbaum. Ein Foto von Bang war an einem Ast ganz oben eingeklebt. An den Ästen darunter waren die Bilder und Namen seiner Vorfahren zu sehen. Unter dem, was er für koreanische Namen hielt, war sorgfältig die Übersetzung ins Englische eingetragen. Die tapfere Frau, der Bang so ähnlich sah, war eine Schönheit gewesen. Grahams Magen verknotete sich bei dem Gedanken, dass der Junge seine Mutter verloren hatte. Langsam blätterte er die Seiten um, bis ein lose gefalteter Brief zum Vorschein kam. Der Brief war an ihn gerichtet.
Lieber Mr. Graham, ich schreibe Ihnen diesen Brief mit glücklichem Herzen. Ich weiß, dass Sie ein guter Mann sind und sich um meinen Sohn Bang kümmern werden. Bitte beschützen Sie ihn, und erinnern Sie ihn an seinen Vater und mich. Wenn er traurig ist, bitten Sie ihn, Ihnen über seine Familie zu erzählen und darüber, wer wir waren. Im Geiste werden wir mit Ihnen beiden sein. Ich will Ihnen ein wenig über Bang erzählen, damit Sie sich gut um ihn kümmern können. Wir sind koreanische Amerikaner. Mein tapferer Vater entkam den Todeslagern in Nordkorea. Bang kennt die Geschichte. Er ist fünf Jahre alt, sein Geburtstag ist der 15. Juli. Er ist in Seattle geboren. Er mag Autos und Tiere, hat Angst vor der Dunkelheit, und manchmal hat er böse Träume. Ich habe ihm beigebracht, dass er bei Ihnen tapfer sein muss. Er ist ein guter Jäger, was Kleinwild angeht.
Als er das las, hob Graham den Kopf und sah zu dem Jungen hinüber. Dann wandte er sich wieder dem Schriftstück zu.
Sein Vater und ich haben ihn gut trainiert. Er fängt Fische, jagt Enten, Hasen und Eichhörnchen. Er weiß, wie man kleine Fallen baut. In seinem Rucksack ist eine Steinschleuder, und er kann gut mit Pfeil und Bogen umgehen. Bang ist meist ein ruhiger Junge, aber er kann für sein Alter gut lesen und schreiben. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass Sie ihn so sehr brauchen wie er Sie. Sie beide sind jetzt allein. Deshalb habe ich mich für Sie entschieden.
Da war es, als wäre es die Antwort auf die Vorahnung seines Vaters: Du wirst einen Grund finden, oder der Grund wird dich finden. Offensichtlich hatte Hyun-Ok den nächsten Abschnitt zu einem späteren Zeitpunkt geschrieben, denn die Handschrift lief nun nicht mehr so weich und ruhig.
Bitte hören Sie auf meine Warnung! Wenn Sie Bang mit sich nehmen und diesen Ort verlassen, muss ich Sie vor einem sehr bösen Mann namens Campos warnen. Ich habe alle, die hier noch leben, nächtelang beobachtet, um meine Entscheidung zu treffen. Campos hat zwei der wenigen Überlebenden, die die Stadt betreten haben, getötet. Wenn Sie fortgehen, dann gehen Sie bitte bei Nacht. Halten Sie sich von der Highway-Auffahrt fern. Campos lebt in dem kleinen, blaubemalten Haus neben der Tankstelle. Ich denke, er hat den Verstand verloren. Er spricht laut in verschiedenen Stimmen zu sich selbst. Er ist sehr gefährlich, und Sie sollten ihn meiden. Er hat Schusswaffen und trägt stets ein Beil am Gürtel. Er ist es, der das Feuer in dem großen Müllcontainer am Brennen hält. Er hat sogar einen der Überlebenden lebendig hineingeworfen. Wenn Sie diesen Ort verlassen, dann nehmen Sie kein Auto. Das wäre viel zu laut, Campos würde Sie finden. Er darf Sie nicht entdecken. Verzweifeln Sie nicht wegen derjenigen, die gestorben sind, Mr. Graham. Sie haben nun jemanden, für den Sie leben müssen. Ich danke Ihnen als Mutter aus tiefstem Herzen, Hyun-Ok
Graham faltete den Brief zusammen und steckte ihn in das Buch zurück. Dann packte er das Buch wieder in den Ledereinband. Er war sich nicht sicher, was er von dem Jungen halten sollte. Von der Warnung war er nicht überrascht. Oft hatte er das ferne Hallen von Schüssen gehört und den schwarzen Rauch gesehen, der beinahe jeden Abend herüberwehte. Bisher hatte er keinen Grund gehabt, sich in diese Richtung vorzuwagen. Außerdem hatte sein Vater die Regel aufgestellt, dass jeder Kontakt mit der Außenwelt strikt zu meiden war. Die Familie war immer in der Nähe des Hauses geblieben, bis sie einer nach dem anderen gestorben waren. Graham hatte bis jetzt nicht einmal darüber nachgedacht, hier wegzugehen. Aber da gab es die Blockhütte der Familie, die sein Vater und er als Rückzugsort geplant hatten. Weit weg, so hoffte Graham, von all dem Irrsinn, Siechtum und Tod. Nun, da er von Campos wusste, würde er einen guten Plan brauchen, damit er und Bang diesen Ort sicher verlassen konnten.
Leider verlief der Weg zur Blockhütte geradewegs durch das problematische Gebiet. Sie waren von allen Seiten von Mensch und Natur eingeschlossen. Um auf die andere Seite des Highways zu gelangen, der als Überführung wie ein Damm über die Siedlung hinwegführte und auf beiden Seiten mit Betonwänden versehen war, mussten sie unter der Brücke hindurch. Genau dort hauste Campos. Was er über den Kerl gelesen hatte, klang ziemlich übel. Leider war die Immunität gegen das Virus nicht auf gute Menschen beschränkt, wie Grahams Vater immer zu sagen pflegte.
Bevor er schlafen ging, reinigte Graham sein Gewehr, so wie er es in den meisten Nächten zu tun pflegte. Er mochte die vertraute, immer gleiche Aufgabe. In der letzten Zeit hatte diese Routine sein ursprüngliches Einschlafritual, ein oder zwei Kapitel eines dystopischen Romans zu lesen, abgelöst. Neuerdings ähnelte die Welt da draußen der Welt in den Romanen zu sehr, um das Lesen wie früher genießen zu können.
5| Der Aufbruch
Kurz bevor Graham erwachte, starb sein Vater in seinen Träumen erneut. Die verzweifelten Appelle und die Versuche, Graham noch in den letzten Minuten die zum Überleben notwendigen Ratschläge mitzugeben, hallten in ihm nach. Er rieb sich den Schlaf aus den Augen und gähnte. Plötzlich sah er, noch benommen, den kleinen Jungen auf dem anderen Bett sitzen. Er saß mit dem Rücken gegen das Kopfende gelehnt. Für einen Moment ergab das Bild keinen Sinn. Dann kam alles wieder, was Graham am gestrigen Tag widerfahren war: Zwei Menschen verlieren, einen gewinnen. Der neue Tag brachte ein neues Ziel mit sich, eines, auf das Graham hinarbeiten konnte. Denn jetzt hatte er ein Kind, für das er verantwortlich war. Und das bedeutete, dass er es vor jeder Gefahr beschützen musste. Er spürte die Last seines Versprechens, aber empfand keinen Groll, auch wenn das alles unvermittelt über ihn hereingebrochen war.
Zeit, so schnell wie möglich von hier zu verschwinden. Denk an Hyun-Oks Warnung.
»Guten Morgen, Bang. Hast du gut geschlafen?«
Der Junge nickte. Graham konnte an Bangs traurigem Gesicht erkennen, dass sich auch für ihn die gestrigen Ereignisse zu einer neuen Realität formten. Bang ließ sich auf sein Kissen zurückfallen.
»Ich werde heute Morgen noch einmal duschen, weil wir uns nachher auf den Weg machen und wahrscheinlich eine Weile lang kein Wasser zum Waschen haben werden. Zumindest, bis wir an unserem Ziel angekommen sind. Wenn ich fertig bin, kannst du auch eine Dusche oder ein Bad nehmen. Was immer du möchtest. Du kommst in der Dusche klar, ja?«
Bang nickte und fragte dann: »Wo gehen wir hin?«
»Weg von hier. An einen sicheren Ort. Du wirst bald sehen.«