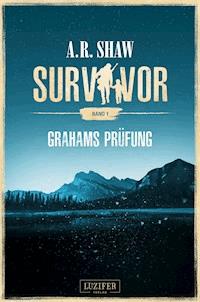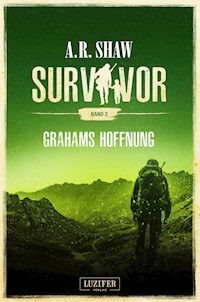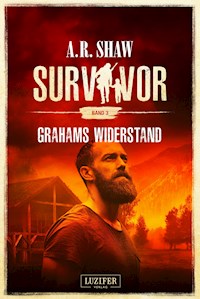
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Survivor
- Sprache: Deutsch
Der dritte Band der post-apokalyptischen Thriller-Reihe über eine weltweite Pandemie – aktueller denn je, beklemmend und erstaunlich realistisch. Der Frühling ist gekommen und verspricht nach den entbehrungsreichen Wintermonaten einen ersten neuen Hoffnungsschimmer für Graham und die Bewohner seines Camps. Doch der wahre Grund, der hinter dem Untergang der Menschheit steckt, wird immer offensichtlicher. Die wenigen Überlebenden sehen sich nun einem altbekannten Feind gegenüber, der sich als heimtückischer entpuppt, als man es sich vorstellen könnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Grahams Widerstand
Survivor – Band 3
A.R. Shaw
Übersetzt von Raimund Gerstäcker
Copyright © 2015 A.R. Shaw
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf vervielfältigt, verbreitet oder in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder mittels anderer elektronischer oder mechanischer Methoden übertragen werden, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers einzuholen. Dies gilt nicht für kurze Zitate in Rezensionen und weitere nicht kommerzielle Nutzung gemäß dem Urheberrecht.
Dieser Roman ist fiktiv. Namen, Figuren, Orte und Ereignisse sind ein Produkt der Fantasie des Autors. Zum Teil werden originale Schauplätze und öffentliche Namen für atmosphärische Zwecke eingesetzt. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlich existierenden Personen, lebendig oder tot, oder mit Unternehmen, Veranstaltungen, Institutionen oder Schauplätzen ist rein zufällig.
Gewidmet meiner wunderbaren Tochter Sarah Melanie. Dich bei mir zu haben, macht mein Leben erst komplett.
Impressum
überarbeitete Ausgabe Originaltitel: THE LAST INFIDELS Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER-Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Matthias Vorhauer Lektorat: Astrid Pfister
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-520-0
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche dir keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Willkommen in Grahams Welt. Als Schriftstellerin versuche ich stets die Rückblicke in Grenzen zu halten, die von den Lesern ohnehin meist übersprungen werden. Deshalb berichte ich in diesem Band nicht oft über das, was Sie bereits gelesen haben. In den folgenden Zeilen werde ich jedoch versuchen, Sie darüber zu informieren, was bereits geschehen ist – falls meine Leser es zwischen den Veröffentlichungen vergessen haben sollten.
Zu Beginn dieser Buchreihe sterben achtzig Prozent der Weltbevölkerung an einer Infektion mit dem H5N1-Virus. Die Krankheit wird allgemein als China-Pandemie bezeichnet. Graham ist gerade dabei, seinen Vater zu begraben, das letzte Familienmitglied, das noch gelebt hat, als Hyun-Ok, Bangs Mutter, ihn aufsucht. Sie stirbt, nachdem er sich bereit erklärt hat, sich ihres Sohnes anzunehmen. Zuvor warnt sie ihn aber noch vor den kommenden Gefahren.
Gemeinsam machen sich Graham und Bang auf den Weg zur Blockhütte der Familie, die sich nördlich des Skagit Rivers nahe der fiktionalen Stadt Cascade befindet (inspiriert von der Stadt Rockport, Washington). Auf dem Weg dorthin treffen sie auf einen gewalttätigen Wahnsinnigen namens Campos. Graham muss Campos schließlich töten, um den Mann davon abzuhalten, die Zwillinge Macy und Marcy umzubringen, die auf dem Weg zur Wohnung ihres Vaters sind. Sheriff, ein streunender Polizeihund, taucht zusammen mit den Zwillingen auf, er ist einer der wenigen Hunde, die noch nicht vor Hunger verwildert sind, und wird schnell zu einem treuen Begleiter der Mädchen (Sheriff ist zu einer geliebten Figur geworden; fast jede Woche erhalte ich Fanpost, in der ich gebeten werde, ihn am Leben zu erhalten).
Graham, Bang, die Zwillinge und Sheriff erreichen schließlich die Blockhütte bei Cascade, in der Graham Ennis vorfindet, einen griesgrämigen alten Mann und Tala, die von den amerikanischen Ureinwohnern abstammt und sehr krank ist. Die Gruppe lernt miteinander auszukommen und ihr Überleben zu organisieren, bis sie eines Tages auf Menschen in Schutzanzügen treffen, die ihnen einen Jungen namens Mark übergeben.
Die Mitglieder von Grahams Gruppe sind allesamt Träger des Virus, und die Menschen in den Schutzanzügen gehören einer Organisation von Preppern an, die die Katastrophe vorausgesehen hat. Die Prepper sind jedoch anfällig für das Virus, das Grahams Gruppe in sich trägt.
Allmählich lernen die beiden Gruppen, zu koexistieren, wobei sie sich aber an sehr genaue Quarantäneregeln halten. Dies geht so lange gut, bis eines Tages eine marodierende Bande Tala entführt. Die Prepper helfen Graham dabei, sie zu retten, aber ein Prepper namens Sam, wird bei der Rettungsaktion dem Virus ausgesetzt. Er überlebt allerdings und ist auf diese Weise fortan ebenfalls Überträger der Krankheit. Für seine siebenjährige Tochter bedeutet dies, dass sie nun als Waise aufwachsen muss. Sie bleibt bei den Preppern, während sich Sam Grahams Gruppe anschließt. Damit endet Buch 1, Grahams Prüfung. Sam darf seine kleine Tochter nur aus sicherer Entfernung begegnen – sie auf der einen Seite des Skagit Rivers, er auf der anderen.
Zu Beginn von Buch 2, Grahams Hoffnung bricht der Winter herein. Wir erfahren zunächst, dass Sam Teil der Gruppe geworden ist und Graham und Tala befinden sich mittlerweile in einer Beziehung. Alles, was schiefgehen kann, geht auch schief in Buch 2. Sam nimmt Mark und Marcy mit auf einen Jagdausflug, auf dem sie einem Schneesturm und einer Katastrophe ausgesetzt werden. Ennis erkrankt schwer, Graham sucht die Stadt auf und wird von einem wilden Hund schwer verletzt, aber von einem Neuankömmling namens McCann gerettet, der zu Pferd nach Cascade gekommen ist. Im Lager der Prepper wütet außerdem ein verheerendes Feuer, woraufhin Sam alle Quarantäneregeln bricht, um seine Tochter Addy in Sicherheit bringen zu können – ein Unterfangen, das ihn selbst fast umbringt. Daltons Frau Kim und zahlreiche weitere Prepper sterben in dem Feuer.
Am Ende von Buch 2 haben sich die verletzten Mitglieder von Grahams Camp nahezu wieder erholt, aber Ennis stirbt. Die Wissenschaftlerin Clarisse, das wertvollste Mitglied der Prepper, schafft es einen Impfstoff zu entwickeln, um diejenigen schützen zu können, die noch für das Virus anfällig sind. Diese Ereignisse und die Neuigkeit, dass Tala schwanger ist, beenden Grahams Hoffnung sowohl mit dem Licht der Zuversicht als auch mit dem Schatten der Unsicherheit.
Damit ist der Weg frei und ich darf Ihnen nun Band 3, Grahams Widerstand, präsentieren.
Dutchs Karawane
Dutch spürte ihre Blicke und konnte die Angst der Stuten beinahe riechen. Die wilden Hunde hatten sie die ganze Nacht über verfolgt. Nach dem langen Marsch, den sie durch den Staat Washington hatten unternehmen müssen, um den Invasoren entkommen zu können, erschien es ihm wie eine grausame Fügung des Schicksals, jetzt von Hunden aufgestöbert und gejagt zu werden.
Langsam hob er die Hand, um der Fahrerin des Trucks hinter ihm zu signalisieren, dass sie anhalten sollte. Dann ballte er die Hand zur Faust. Sie verstand das Zeichen und schaltete den Motor aus. Während er die Zügel der Stuten, die vor den Wagen gespannt waren, straff hielt, zog Dutch langsam und kaum merklich seine Remington 870 auf den Schoß. In Hinblick auf die unvermeidliche Konfrontation mit den wilden Bestien hatte er die Schrotflinte zuvor bereits mit einer Kombiladung aus zwei Schrotpatronen Number-One-Buckshot, gefolgt von zwei Ladungen Double-Ought-Buckshot und ergänzt von zwei Flintenlaufpatronen, geladen. Insgesamt verfügte er somit über sechs Schuss. Die Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass es eine gute zusätzliche Absicherung war, seine Waffe auf diese Weise zu laden. Sollte das Ganze wider Erwarten nicht funktionieren, hatte er noch weitere Möglichkeiten zur Verfügung.
Damit ihm auch nicht das geringste Anzeichen von Gefahr entging, lehnte er sich jetzt auf der Sitzbank des Wagens nach vorn und neigte seinen Kopf, um in die Dunkelheit zu lauschen. Er schloss die Augen, denn das half ihm dabei, sich zu konzentrieren. Er hatte sie ohne Rücksicht auf Verluste vorwärtsgetrieben, bis die Dunkelheit über sie hereingebrochen war. Das Heulen der Wildhunde hatte ihn schon beim Anbruch der Dämmerung vor ihren fleischfressenden Absichten gewarnt. In regelmäßigen Abständen waren ihre glühenden Augen im immer dunkler werdenden Wald zu sehen gewesen.
Die Zeit, ein Feuer zu machen und das Lager aufzuschlagen, war leider vorbei. Der gleichmäßige Rhythmus des fünf Tonnen schweren US-Army-Trucks mit Anhänger, vollgepackt mit Vorräten, dröhnte laut, während sich der kleine Konvoi dem Rand der Cascade Mountains näherte. Die Vorräte und die Ausrüstung waren für eine Heimat bestimmt, die sie neu gründen wollten. Sie zu finden, hatte sich Dutch zur Mission gemacht. Er führte den Konvoi in einem offenen Wagen an, der ähnlich schwer beladen war der Army-Truck. Zwei Lineback-Pferde, die sich der gegenwärtigen Gefahr anscheinend äußerst bewusst waren, zogen den Wagen.
Die junge Frau am Steuer des Trucks hinter ihm hatte sich durchaus als nützlich erwiesen. Aber wenn es nicht erforderlich gewesen wäre, beide Fahrzeuge mitzunehmen, hätte Dutch sie in der Nähe des Grand-Coulee-Staudamms an der State Route 20 rausgeschmissen. Er fürchtete nicht nur, von den Invasoren verfolgt zu werden, noch mehr Sorgen bereitete es ihm, dass er sich allmählich für die Sicherheit der Frau verantwortlich fühlte, die im Vergleich zu ihm noch ein halbes Kind war. Die Verantwortung, die ihm ihre bloße Anwesenheit in seiner Nähe auferlegte, könnte ihrer beider Tod bedeuten, und er hatte sich geschworen, nie wieder für andere Menschen Verantwortung zu übernehmen … weder jetzt noch irgendwann in der Zukunft.
Sein Plan war es deshalb, sie so bald wie möglich loszuwerden. Sie muss lernen, auf sich selbst aufzupassen, sagte Dutch seinem schlechten Gewissen immer wieder, das tief in ihm regelmäßig seine Stimme erhob. Er war jetzt beinahe fünfzig Jahre alt, und sie schien Anfang zwanzig zu sein. Sie brauchte keinen Beschützer, schon gar nicht so einen alten Knacker wie ihn, und eine weinerliche Zwanzigjährige zu babysitten, noch dazu in ihrer aktuellen Lage, wo es vor allem ums Überleben ging, löste in ihm ganz und gar keine Jubelstürme aus.
Nicht, dass sie tatsächlich weinerlich war, ganz im Gegenteil. Am meisten irritierte es ihn an ihr, dass sie überhaupt nicht sprach. Von dem Moment an, als er ihr vor vier Tagen in der Gegend von Saint Maries, südlich von Coeur d'Alene, Idaho, begegnet war, hatte sie ihn mit ihrem Schweigen fast in den Wahnsinn getrieben. Leider hatte er keine andere Wahl gehabt, als sie mitzunehmen, da er auf dem ganzen Weg hierher keiner anderen lebenden Seele begegnet war. Sie war fleißig, das musste er ihr zugestehen. Ein paar Tage lang würde er sie noch tolerieren, bis sie wieder ganz zu sich gefunden hatte. Er hoffte, dass die derzeitigen Bewohner von Cascade sie aufnehmen würden, sobald er sie vor der kommenden Gefahr gewarnt hatte. Er würde ihr sogar einen vollgepackten Rucksack und eine der Stuten, die hinten am Wagen angebunden waren, als Bezahlung mitgeben und sie fortschicken.
Der wahre Grund, warum er es gewagt hatte, sie überhaupt mitzunehmen, war, dass er wusste, was mit ihr geschehen wäre, wenn er sie dort zurückgelassen hätte: Sie wäre den Invasoren zum Opfer gefallen. Da diese mittlerweile längst ins Landesinnere eingedrungen waren, vermutete er, dass sie inzwischen entlang der Interstate 90 Jagd auf Überlebende der Seuche machten und dabei ihr neu erobertes Territorium in Augenschein nahmen.
Die Regeln der Invasoren waren wahrhaftig simpel: Entweder man schloss sich ihnen an, oder man wurde umgebracht. Sie waren dafür bekannt, keine Munition zu verschwenden. Sie erledigten den Job mit brutaler Ernsthaftigkeit, zur Not mit bloßen Händen oder mit einem Beil, einem Messer oder dem Schwert. Sie liebten es, auf diese animalische Weise zu töten. Auf die gleiche Art handhabten sie auch die Dinge in ihren eigenen Ländern. Schusswaffen sparten sie für die Jagd auf, Ungläubige schlachteten sie lieber mit der Klinge ab. Sie waren schließlich die Bodentruppen Gottes … nur, dass es dieses Mal amerikanischer Boden war, auf dem sie sich bewegten.
China war lediglich der Anbieter der Waffe gewesen, und die Chinesen übers Ohr zu hauen war eine leichte Übung für sie gewesen. In den Kühlkammern ihrer Labors hatten die Chinesen bereits die waffenfähige Version ihres Virus gelagert, also war es nur eine Frage des Geldes gewesen, um die notwendigen Informationen zu beschaffen und das Geschäft abzuwickeln. Was China allerdings nicht auf dem Schirm gehabt hatte, war die Notwendigkeit, die Schuld auf sie zu lenken und dafür zu sorgen, dass die Chinesen als Erschaffer des Virus bloßgestellt wurden, war dabei nur passend gewesen. So waren sie es letzten Endes, die die gesamte Welt als der einzig mögliche Schuldige am Tod von Hunderttausenden sah.
Die laufende Invasion war Phase 3 eines äußerst ausgeklügelten Fünf-Punkte-Plans, um den Dschihad über die Welt zu bringen und auf allen Kontinenten die Herrschaft zu übernehmen. In Phase 1 hatten sie zuerst das H5N1-Virus verbreitet, indem sie mehrere Attentäter damit infizierten. Sobald sich das tödliche Virus in ihnen vermehrt hatte, hatten sie die Flugzeuge bestiegen. Dank der Umluftsysteme in den Kabinen waren innerhalb kürzester Zeit alle anderen Passagiere ebenfalls infiziert worden und somit zu ahnungslosen Kurieren geworden, die in ihre Heimat zurückkehrten und dort zahlreiche weitere Menschen ansteckten, bevor sie schließlich starben. Auf diese Weise verbreitete sich das Virus exponentiell und der Völkermord war perfekt.
In Phase 2 brauchten sie dann nur zu warten, bis der Tod seine Arbeit erledigte. Gleichzeitig manipulierten sie ihre Statistiken, die nun eine höhere Sterblichkeitsrate bei ihnen angab, als es tatsächlich der Fall war – eine einfache, aber effektive Täuschung. Dass Tausende der ihren dem Virus zum Opfer fielen, war notwendig im Sinne des Dschihad. Essenziell für die Auslöschung des größten Teils der Weltbevölkerung war außerdem, den Hass in allen Formen zu schüren. Keine Beleidigung war zu schändlich, auf kein Tabu wurde Rücksicht genommen, nichts wurde mehr als heilig angesehen.
Da die Kontamination früh erfolgt war, war Europa, von innen zerstört, wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Nun würde bald auch das, was von den Vereinigten Staaten noch übrig war, unter ihre Herrschaft fallen. Der Dschihad war ein langfristiger Plan, doch die ersten beiden Phasen waren höchst erfreulich verlaufen … Amerika, wie es einst gewesen war, gab es nicht mehr.
Dutch war auf seiner zweiten Tour im Irak gewesen, als ihm ein improvisierter Sprengsatz seinen linken Unterschenkel direkt unterhalb des Knies genommen hatte. Das war es dann für ihn gewesen. Während seiner Genesung hatte er sich allerdings bemerkenswert schnell an die Prothese gewöhnt. Immer wieder hatte er versucht, seine Vorgesetzten davon zu überzeugen, dass er in noch besserer Form war als zuvor, aber Regeln waren nun mal Regeln und blieben es. Laut Abschnitt 313 der Armeevorschriften gehörte sein Name angeblich eindeutig in die Spalte, die die Überschrift Entlassungen trug. Nach einer längeren Genesungsphase hatte er schließlich seine Siebensachen gepackt und war in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt.
Die verlassene Ranch seines Vaters südlich von Coeur d‘Alene, Idaho, war letzten Endes zu seinem Rückzugsort geworden. Dort hatte er sich mit der gleichen Intensität in die Landwirtschaft und die Viehzucht gestürzt, die ihm im Krieg zu eigen gewesen war, denn andere Optionen waren zu dieser Zeit Mangelware. Dutch hatte niemals geheiratet, und seine Eltern waren ein Jahr vor seiner Verwundung verstorben. Auf gewisse Art und Weise war er sogar froh darüber, dass es so gekommen war, denn er war sich nicht sicher, ob seine Mutter seine Verletzung hätte ertragen können. Sein Vater hingegen hätte zweifellos von ihm erwartet, dass er bis zum bitteren Ende seinen Mann stand.
Sein Bruder Clive hatte zu dieser Zeit in Kalifornien gelebt. Zweimal hatte er Dutch angerufen, als die Pandemie über das Land hereingebrochen war. Beim ersten Anruf hatte er ihm erzählt, dass seine Frau an der Virusinfektion erkrankt war, und beim nächste Anruf hatte er verzweifelt berichtet, dass seine Tochter direkt nach der Mutter gestorben war. Dutch war deshalb nicht überrascht gewesen, seinen Bruder sagen zu hören, dass dieser sich gleich nach dem Gespräch das Leben nehmen würde. Er hatte gar nicht erst versucht, Clive aufzuhalten, denn er konnte es ihm ehrlich gesagt, nicht verübeln. Wofür sollte er denn noch leben? Deshalb hatte er ihm nur geantwortet: »Ich liebe dich, Bruder«, bevor er den Anruf beendet hatte.
Noch oft hörte Dutch in der folgenden Zeit dieselbe traurige Geschichte. Sie wiederholte sich wieder und wieder im ganzen Land. Er wartete geradezu darauf, dass er sich selbst ebenfalls das unvermeidliche Virus einfing. Er hätte es durchaus begrüßt und war sogar in ein paar lokale Bars gegangen, nachdem er sich mit der Arbeit auf der Ranch fast umgebracht hatte, in der Erwartung, das verdammte Ding mit nach Hause zu nehmen. Aber das Virus hatte sich einfach nicht in ihm festgesetzt. Eines Tages war er mit Schnupfen aufgewacht und hatte gedacht: Okay, jetzt geht es los. Aber ein paar Tage später war er so fit wie zuvor. Mit der Zeit stellte er fest, dass er … nun ja, irgendwie enttäuscht war.
Dutch half seinen Nachbarn und kümmerte sich um ihr Vieh, so gut er konnte. Doch dann starben sie einer nach dem anderen, und eines Tages fiel ihm auf, dass er der Einzige war, der sich noch durch die Stadt bewegte. Er klapperte daraufhin die Viehställe und Weiden der verstorbenen Bauern ab und ließ das gesamte Vieh frei … alle Rinder, Pferde, Esel, Schweine, Schafe, Ziegen und Hühner. Er öffnete einfach die Tore und Gatter und sah zu, wie sie davonliefen. Zunächst zögerten die Tiere, aber dann zerstreuten sie sich schnell. Jetzt waren sie endlich frei und konnten zusammen mit den Maultierhirschen und umherstreunenden Elchherden auf Futtersuche gehen. Schließlich würde sich niemand mehr um sie kümmern, also sah er es als seine Pflicht an, sie gehen zu lassen, bevor sie elendig in ihren Ställen verhungerten. Zumindest hatten sie so anstelle des sicheren Hungertodes die Chance, sich an die wilde Seite des Lebens anzupassen.
Irgendwann hatte er dann begonnen, den Funk abzuhören. Lange Zeit hatte sich nichts getan, bis es vor ein paar Monaten schließlich losgegangen war. Das Funksignal, das ihm als Erstes aufgefallen war, war über das Hochfrequenzband gesendet worden. Es war eine Übertragung in Morsezeichen gewesen. Das Signal kam noch immer regelmäßig aus dem Nordosten des Bundesstaates Washington herein. Zuerst hatte er es für ein automatisches Signal gehalten, eine Art Funk-Leuchtfeuer, denn die Nachricht wiederholte sich immer wieder, und es war deshalb gut möglich, dass einfach nur niemand mehr übrig war, um es auszuschalten. Dutch war ein bisschen aus der Übung, doch nach einer Weile hatte er es geschafft, die Nachricht zu entziffern. Es war ein Schock für ihn gewesen, als er begriffen hatte, dass es dort draußen noch mehr Überlebende wie ihn gab.
Er wollte sofort Kontakt aufnehmen, doch dann zögerte er. Jemandem da draußen einfach so zu vertrauen war für ihn keine Option. Also wartete er und ließ sich diese Möglichkeit für einen späteren Zeitpunkt offen. Doch dann begann Dutch plötzlich, Übertragungen ganz anderer Art aufzufangen. Die damit einhergehende allmählich einsickernde Erkenntnis zog ihm den Boden unter den Füßen weg. Er war alles andere als begeistert über die neue Entdeckung. Die Nachricht wurde nämlich in einer Sprache gesendet, die er bislang nur in fernen, vom Krieg zerrissenen Ländern gehört hatte. Ländern, in denen versteckte Bomben lauerten und sogar Frauen und Kinder verdächtig waren, weil auch sie dazu benutzt wurden, dich zu töten.
Nach ein paar Tagen erhöhter Aktivität hatten die losen Punkte schließlich mehr und mehr Sinn ergeben. War das Ganze etwa ein geplanter Angriff gewesen? Es gab keine andere Schlussfolgerung, die sich noch anbot. Die Verschwörungstheoretiker hatten also tatsächlich die ganze Zeit über recht gehabt. Anfangs war es nur ein Verdacht gewesen, dass es sich hierbei um ein waffenfähiges Virus handelte, doch jetzt war er sich sicher, dass dieser Verdacht auf der Wahrheit beruhte.
Dutch sprach selten laut auf seiner einsamen Ranch, es sei denn, er sagte etwas zu seinen beiden Hunden, doch als ihm allmählich bewusst wurde, was die Übertragungen bedeuteten, die er die ganze Zeit mitgehört hatte, sagte er in den leeren Raum hinein: »Ihr habt euch wohl nicht getraut, Mann gegen Mann gegen uns zu kämpfen … ihr gottverdammten Feiglinge.«
Einige Wochen lang verfolgte er die Funksprüche und erkannte dadurch, dass sich die schlimmste seiner Befürchtungen bestätigt hatte: Hier lief gerade eine Invasion der Vereinigten Staaten. Sie hatten bereits mehrere Teams losgeschickt, um die Großstädte zu sichern. Verdammt, sie mussten also schon im Land gewesen sein, bevor die Viruserkrankung überhaupt ausgebrochen war. Schläfer, die sich im Schatten versteckt hatten. Dutch wurde klar, dass sie eine Art Impfstoff haben mussten, denn sonst wären sie dieses Risiko nicht eingegangen.
Ein paar Wochen später bewegte sich der Feind dann in der Dunkelheit der Nacht nördlich an ihm vorbei. Sie benutzten die Interstate Highways und fuhren in langen, lärmenden Konvois. Alle Gemeinschaften von Überlebenden wurden auf ihrem Weg unbarmherzig abgeschlachtet. Mit einem seiner Pferde unternahm er etliche Aufklärungsausritte und beobachtete sie aus sicherer Entfernung, bevor er den Plan entwarf, sie zu umgehen und die Gruppe im Norden vor ihnen zu warnen. Er durfte es auf keinen Fall riskieren, dass sie einen seiner Funksprüche abfingen, der automatisch seinen Standort verraten würde. Zu Pferd unterwegs zu sein, war die sicherste Alternative. Er musste es nur von Saint Maries nach Coeur d'Alene schaffen.
Auf einem seiner Aufklärungstrips hatte Dutch in einer dunklen, kalten Frühlingsnacht immer lauter werdende feindliche Stimmen gehört und war kurz darauf Zeuge eines brutalen Mordes geworden. Ein anderer amerikanischer Überlebender, der ebenfalls nicht willens gewesen war, sich den Invasoren zu unterwerfen, hatte letzten Endes um sein Leben gefleht. Der Mann hatte schließlich seine Waffe niedergelegt und seinen Tod akzeptiert. Sie hatten ihn so bestialisch zu Tode geprügelt, wie sie es zu Hause wahrscheinlich nicht einmal mit ihren schlimmsten Kriminellen taten.
In derselben Nacht war Dutch dann dem rothaarigen Mädchen begegnet. Sie war in eine schwarze Burka gehüllt gewesen. Wie ein aufgeschrecktes Reh war sie in dem dunklen Wald direkt in seine Richtung geflohen, womit sie beinahe seine Position verraten hätte. Als er sie abfing, hatte sie sich erbittert gewehrt. Er hatte ihr Entsetzen und all ihre Blutergüsse gesehen und einen Augenblick lang überlegt, ihr sofort das Genick zu brechen, um sie von ihrem Elend zu erlösen. Es wäre eine barmherzige Tat gewesen, doch stattdessen war sie in seinen Armen zusammengebrochen und hatte ihre angsterfüllten hellgrünen Augen weit aufgerissen, als versuche sie, aus einem Albtraum zu erwachen. Er hatte sie hastig zurück in den Schatten gezogen und im Schutz der Nacht alles darangesetzt, sie davon abzuhalten, auch nur das kleinste Geräusch von sich zu geben, bis die Feinde meilenweit entfernt waren.
Als er seine Hand von ihrem Mund genommen hatte, hatte sie nicht ein Sterbenswort gesagt – nicht einmal, als er sie nach ihrem Namen gefragt hatte. Sie hatte sich nur fest an seinen Oberkörper geklammert und die Hände zu Fäusten geballt, bis ihr Körper allmählich erschlaffte, während er sie im Schutz der Dunkelheit wegführte.
Dutch hatte kein Auge zugemacht in dieser Nacht, stattdessen war er damit beschäftigt gewesen, sein Lager zusammenzupacken. Er hatte zuerst seine Habseligkeiten und dann das Mädchen verladen, als gehöre sie mit zu seinen Besitztümern. Danach waren sie zu seiner Ranch in Saint Maries zurückgeritten. Als sie kurz vor Tagesanbruch an seiner Hütte angekommen waren, hatte sie tief und fest geschlafen.
Er hatte ihren schlaffen, zerbrechlich wirkenden Körper von Gus, dem Lineback-Pferd, das sich jetzt an der Spitze des Gespanns befand, das den Wagen zog, heruntergezogen. Nachdem er sie in seiner Hütte hingelegt hatte, begannen sich die Hunde Elsa und Frank für die Fremde zu interessieren. Sie stupsten mit ihren nassen Nasen in die flammendroten Haare, die über ihr schlafendes Gesicht fielen, bis Dutch schließlich das Handzeichen gab, das die gut ausgebildeten, belgischen Schäferhunde, die wie er beim Militär gedient hatten, zurückpfiff. Sie ließen widerwillig von ihren Nachforschungen ab und bewachten sie danach aufmerksam, während Dutch sich draußen um die anliegenden Aufgaben kümmerte.
Kurz nach Sonnenaufgang hatte das Mädchen die Augen geöffnet und sich sofort in eine Ecke zurückgezogen, bis sie mit dem Rücken an der Wand saß. Die glänzenden Augenpaare der Hunde versetzten sie offenbar in Angst und Schrecken, obwohl die beiden Hunde ihre Zungen heraushängen ließen, was für angeblich furchterregende Kreaturen ein niedlich-schräges Lächeln ergab.
Dutch konnte nicht an sich halten und musste kichern, als er die beiden Hunde so sah, die neugierig das merkwürdige Mädchen beobachteten. Als sie sich in seine Richtung drehte, fing er ihren wütenden Blick ein. Einen Blick, der Mord bedeutete, und zwar möglichst kaltblütig.
»Jetzt mach mal halblang«, sagte Dutch daraufhin mit einem leichten Vorwurf in der Stimme, während er die Hunde mit einer Handbewegung dazu brachte, zur Seite zu gehen und sich hinzulegen. Je weiter sie sich entfernten, desto mehr verließ auch der tödliche Blick das Gesicht des Mädchens, und Dutch sah ihr an, dass sie abzuschätzen versuchte, welche Lebewesen im Raum wohl gerade die größere Bedrohung darstellten.
»Niemand wird dir hier etwas tun.« Er machte eine kurze Pause und fügte dann hinzu: »Es sei denn, du versuchst, mich umzubringen. In dem Fall kann ich für nichts garantieren.«
Sie konzentrierte ihren Blick jetzt auf ihn, blieb aber weiterhin stumm. Er sah zu, wie das Unvermeidliche geschah. Ihre Augen folgten der Linie seines großgewachsenen Körpers vom Kopf aus nach unten, bis sie sein rechtes Bein erreichten, wo sie anstelle eines Stiefels die Metallprothese sahen. Es hatte ihn nie sonderlich gestört und an die gelegentlichen Blicke hatte er sich schon längst gewöhnt. Auf die Sympathie der anderen legte er sowieso keinen Wert, also kommentierte er ihre Reaktion gar nicht erst. Er hegte auch keine Wutgefühle oder Hass, wie es ihm die Therapeuten mehrfach einzureden versucht hatten. Mit dem ganzen Bullshit, der angeblich mit so einer schweren Verletzung einherging, wollte er nichts zu tun haben. Dutch war der Meinung, dass sie schon gewonnen hatten, wenn er ihnen diese Genugtuung verschaffte, also hatte er die Schlussfolgerung einfach ignoriert, zu der auch ihr Verstand irgendwann kommen würde.
»Trag deinen Teil zum Ganzen bei und lass die Finger von meinen Sachen, dann werden wir uns blendend verstehen. Ich werde diesen Ort in Kürze verlassen und kann deine Hilfe dabei gut gebrauchen. Wenn du allerdings nicht mitkommen möchtest, kannst du auch gern hierbleiben. Aber ich muss dich warnen, die Hütte wird nicht mehr lange sicher sein, denn die Invasoren nähern sich mehr und mehr. Es ist aber deine Entscheidung. Du brauchst wahrscheinlich ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken, aber diesen Luxus haben wir leider nicht. Ich gehe nach Nordwesten, da gibt es ein Lager mit anderen Überlebenden und ich würde dich mitnehmen. Zusammen haben wir eine bessere Chance gegen diese Verbrecher als allein. Du kannst gern mitkommen, wenn du bereit bist, unterwegs mit anzupacken. Ich brauche jetzt eine Antwort. Bei Einbruch der Dunkelheit breche ich nämlich auf.«
Die Hunde namens Elsa und Frank hatten das Gespräch mitverfolgt und drehten zeitgleich ihren Kopf in Richtung des Mädchens, als warteten sie auf ihre Antwort. Nach einem kurzen, regungslosen Moment nickte sie einfach.
Dutch erinnerte sich noch gut an ihr mürrisches Gesicht an diesem Tag. Das Ganze war jetzt Wochen her und sie hatten es endlich in die Cascade Mountains geschafft, wo sie die Morsezeichen-Nachricht hingeführt hatte. Er hatte sie beide aus der unmittelbaren Gefahrenzone herausgebracht und versorgt. Er fand, dass sie ihm inzwischen zumindest ein wenig Vertrauen schuldete, aber dafür gab es immer noch kein Anzeichen. Nicht einmal ihren Namen hatte sie ihm bis jetzt verraten, und jetzt, dachte er, würde er ihn niemals erfahren, weil sie in Kürze von gefräßigen Wildhunden gefressen werden würden.
Natürlich hatte er nicht vor, es ihnen leicht zu machen. Ganz im Gegenteil, er würde dafür sorgen, dass sie sich an jedem Bissen von ihm verschluckten.
Pflichtlektüre
Macy zog ihre Füße aus den Wanderstiefeln und lehnte sich im Bürostuhl zurück. Mit einem absichtlich lauten Geräusch legte sie ihre Füße, an denen sie selbst gestrickte Socken trug, auf den Metalltisch. Durch die festgesteckte Zelttür war der herabprasselnde Frühlingsregen zu hören. Mit einem lauten Seufzen wandte sie sich dem nächsten Kapitel des Funkhandbuchs zu, das Rick ihr zum Lesen gegeben hatte. Mit Mühe versuchte sie, sich in die mäandernden Texte von jemandem zu vertiefen, den sie für einen absolut verrückten Nerd hielt.
Als Macy las, hörte sie auf einmal ein sehr merkwürdiges Knarren im Funkgerät, das vielleicht ein besonders eigentümliches statisches Rauschen war. Sie hörte eine Weile zu, entschied dann, dass es nichts weiter als eine Störung war, und griff nach dem Lautstärkeknopf, damit sie sich wieder auf dieses nervige Handbuch konzentrieren konnte. Das ganze Ding war voll mit einer für sie nicht verständlichen Fremdsprache. Dreimal las sie den letzten Absatz des aktuellen Kapitels, und dennoch gelang es ihrem Verstand nicht, das Ohmsche Gesetz und seine Formel Strom gleich Spannung geteilt durch Widerstand zu verstehen. Genauso wenig konnte sie nachvollziehen, warum Volt wichtiger als Watt sein sollte, geschweige denn, warum das jetzt überhaupt noch jemanden interessieren sollte. Aber Rick war unerbittlich. Sie wusste, dass er die Standards der alten Welt unbedingt beibehalten wollte, aber das hier, das war einfach lächerlich. »Ach leck mich doch!« Macy warf das Funkhandbuch für ARRL-Techniker genervt zu Boden, was Sheriff aufschreckte, der gerade sein Mittagsschläfchen begonnen hatte.
»Warum sollen wir uns denn noch an diese alten Regeln halten?«, fragte sie Sheriff, der ein wenig grummelig wirkte. Der Hund stellte die Ohren auf und neigte seinen Kopf zur Seite, als wolle er sagen: Verdammt, woher soll ich das denn wissen? Stell mir gefälligst nicht solche bescheuerten Fragen, Mädchen.
Macys Stuhl quietschte leise, als sie sich bückte und ihre Finger in seinem Fell versenkte, um ihn hinter den Ohren zu kraulen. »Du hast dich auf dieses neue Leben viel besser eingestellt als wir, nicht wahr, Junge?«
Sie glaubte nicht, dass Sheriff sich besonders für ihre Frage interessierte, viel wichtig schien ihm zu sein, dass sie die richtige Stelle hinter seinem linken Ohr fand. Sie sah zu, wie seine Augenlider langsam über den tiefbraunen, seelenvollen Augen nach unten gingen, als sein ganzer Körper entspannt in seine Komfortzone eintauchte.
Als sie das Kraulen gerade unterbrechen und das weggeworfene Handbuch wieder aufheben wollte, kam Rick ins Kommunikationszelt geschlendert. Er sah das Handbuch auf dem Boden, hob es auf und gab es ihr. »Wie läuft es denn so? Irgendwelche neuen Kontakte?«
Als ob!
»Nein, alles wie immer. Da draußen ist niemand, Rick. Es gibt nur uns. Ich weiß gar nicht, warum wir immer noch nach Signalen von anderen suchen«, beschwerte sich Macy.
Er schlug ihr spielerisch auf die Schulter. »Eines Tages könnten wir Glück haben. Auf der anderen Seite könnte genauso gut eines Tages jemand unser Signal auffangen und feststellen, dass es noch mehr Überlebende gibt. Man weiß nie, und ein wenig Glaube und Hoffnung kann doch nicht schaden. Glaube und Hoffnung, Macy. Was ist heute bloß los mit dir? Normalerweise bist du doch eher der optimistische Typ, aber du wirkst etwas niedergeschlagen. Was ist passiert, Mace?«
Sie starrte ihn an. Verdammt, er hat mich. Rick mochte es, Macy zu necken, aber er behandelte sie auch wie eine jüngere Schwester. Es gefiel ihr überhaupt nicht, dass er sehen konnte, wie sie sich fühlte. Sie hatte ganz vergessen, bei wem sie sich da gerade beschwerte, und nun war sie gezwungen, ihre Gefühle mit ihm zu teilen. Gab es etwas Schlimmeres?
»Nichts, mir geht es gut«, log sie und hoffte, Rick würde endlich von ihr und ihrer leicht melancholischen Stimmung ablassen. Als sie das Handbuch zuklappte und ihre Wanderschuhe anzog, um sich auf den Weg zurück zu Grahams Camp zu machen, vermied sie bewusst seinen Blick.
Rick kratzte sich an seinem bärtigen Kinn, während er sie aufmerksam musterte. Macy konnte geradezu körperlich spüren, wie seine Augen noch immer auf ihr ruhten. »Okay, wenn du jetzt nicht darüber reden willst, ist das deine Sache, aber ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Okay?«
Sie schaute zu ihm hoch und nickte. Es gab eine Menge, was gerade in ihr vorging und was sie auf keinen Fall herauslassen durfte. Sie konnte einfach nicht anders. Sie wollte weder Graham noch Rick mit ihren Problemen belasten, und im Moment war auch ihre Schwester weit davon entfernt, diejenige zu sein, mit der sie sprechen konnte.
Macy fühlte sich in letzter Zeit oft den Tränen nahe. Der lange Winter war vorbei, der Frühling brachte Blumen und Hoffnung, aber es regnete eindeutig zu viel, um sie für längere Zeit glücklich zu machen. Tala würde sie verstehen, aber die hatte gerade genug damit zu tun, ihre Angst um ihr ungeborenes Kind zu bekämpfen. Macy konnte sich ihr jetzt unmöglich anvertrauen. So, wie die Dinge momentan lagen, versuchten sie, Tala so weit wie möglich aus allem herauszuhalten, weil sie alle Hände voll damit zu tun hatte, sich um ihr eigenes Leben zu kümmern. Tala sollte sich lieber soweit wie möglich auf die anstehende, hoffentlich problemlose Geburt konzentrieren, von der ihrer aller Zukunft abhing.
Macy band ihre Stiefel zu Ende und zog dann ihren grünen Regenmantel an. »Danke, Rick«, sagte sie. Von hinten kam jetzt Sheriff angestürmt und stieß gegen ihre Wade, als er an ihr vorbeirannte, um sie nach draußen zu begleiten.
Im Nieselregen vor dem Zelt winkte sie Daltons Jungen, Hunter und Kade, zum Abschied zu. Pflichtbewusst trugen diese gerade Brennholz von einem Ort zum anderen. Der kleine Bruder stapelte dabei die Scheite auf die ausgestreckten Arme seines größeren Bruders. Hunter schaffte es, trotz der Ladung Holz in seinen Armen ansatzweise zu winken und Kade rief ihr hinterher: »Bye, Macy!«
Sie lächelte in sich hinein, während sie sich auf den Weg zur Brücke über den Skagit River machte. In Moment wie diesem gelang es ihr manchmal, die Lücke zwischen dieser und ihrer Welt wieder zu schließen. Zweimal pro Woche ging sie in das Lager der Prepper und übernahm dort ihre Schicht im Kommunikationszelt, um so viel von Rick zu lernen, wie sie nur konnte … und um nebenbei ab und zu aus Grahams Camp herauszukommen. Sie brauchte das, um wieder ein wenig Normalität zu erleben und um vor etwas fliehen zu können, das sie gar nicht benennen konnte.
Als sie sich dem rauschenden Fluss näherte, fiel ihr auf, dass ein Gespräch mit einem menschlichen Begleiter, den es gar nicht gab, weil nur Sheriff neben ihr lief, gar nicht möglich gewesen wäre, denn das Wasser war ohrenbetäubend laut. Seit der Frühling begonnen hatte und die Schneedecke zu schmelzen begann, war nicht nur der Fluss von einem Rinnsal zu einem mächtigen Strom angewachsen, auch die Erde selbst vermischte sich mehr und mehr mit Schmelzwasser und wurde dick und schlammig. Die einstigen Bewohner dieser Gegend hatten diese Jahreszeit unter dem Namen Schlammsaison gekannt.
Der Regen nahm jetzt immer mehr zu, und Macy blieb eine Minute stehen, um ihre Jacke zu schließen, damit ihre Pistole, die in einem Holster an ihrer Seite steckte, nicht nass wurde. Als Sheriff stehen blieb, bemerkte Macy, dass die dicke braune Masse seine Pfoten komplett bedeckte.
Als sie die Brücke erreichten, zögerte Sheriff, ihr zu folgen. Als Macy schon halb auf der anderen Seite war, drehte sie sich um, klopfte sich auf den Oberschenkel und rief ihn zu sich.
»Du bist wirklich ein ganz schöner Angsthase, was?«, fragte sie ihn, als er langsam die Brücke betrat, bevor er so schnell er konnte, an ihr vorbei auf die andere Seite des Flusses rannte. Sobald sie die Holzbohlen der Brücke verlassen hatte, versanken ihre Stiefel sofort wieder in der feuchten Erde, und es bereitete ihr einige Mühe, in dem rutschigen Matsch nicht hinzufallen, bis sie festeren Boden erreichte.
Sie gingen nun weiter in den Wald hinein, wo es den Regentropfen schwerer fiel, durch den immergrünen Baldachin aus Blättern zu dringen. Hier versanken ihre Füße nicht mehr im Schlamm, sondern traten auf ein Bett aus weichen Nadeln, die bei jedem Schritt ein frisches Kiefernaroma aussandten. Dieser Abschnitt des Weges gefiel Macy immer am besten. Hier, tief im Wald, fühlte sie sich im Einklang mit sich und der Welt. Es war fast so, als durchwanderte sie still ihre eigenen Gedanken. Hier konnte sie sich in Ruhe mit ihren Sorgen auseinandersetzen. Wie so oft ließ sie sich auch dieses Mal Zeit auf ihrem Heimweg unter dem grünen Dach des Waldes und siebte und sortierte all die verwirrenden Ereignisse der Vergangenheit und Gegenwart aus. Nachdem Ennis gestorben war, hatte sie die meiste Zeit im Wald verbracht, weil sie sich ihm an diesem Ort am nächsten gefühlt hatte. Graham hatte sie in den Tagen danach mehr als einmal im Wald gefunden. Er hatte gewusst, dass sie Abstand brauchte, und hatte sie lediglich darum gebeten, ihm Bescheid zu geben, bevor sie das Camp verließ.
Macy hatte Grahams Bitte akzeptiert und war nie zu lange draußen geblieben, weil sie nicht wollte, dass er sich Sorgen um sie machte. Obwohl sie immer langsamer ging, näherte sie sich viel zu früh der Helligkeit des Tages, die am Ende ihres Weges durch das immer lichter werdende Blätterdach brach. Macy und Sheriff tauchten in dem Moment aus dem Wald auf, als der Regen nachließ und der Schlag eines Hammers einen Nagel in sein Ziel trieb.
Der Wunsch, sie zu heilen
Sheriff rannte voraus, um Bang zu begrüßen, als sie die Lichtung von Grahams Camp betraten. Bang stand in der Nähe der Leiter und wartete geduldig darauf, Graham die nächste Schindel aus Zedernholz hochzureichen, die anschließend ihren Platz neben den anderen auf dem Dach des neuen Anbaus fand. Graham hatte einen Nagel zwischen seine Lippen geklemmt und murmelte ein Hallo, als er Macy sah.
Er bemerkte, dass sie ihm im Gegenzug zwar anlächelte, ihre Körperhaltung aber etwas ganz anderes ausdrückte. Um sie und um Bang machte sich Graham besonders Sorgen. Beide hatten sich nach dem Tod von Ennis komplett aus der Gruppe zurückgezogen. Er vermutete, dass Bang um Ennis trauerte, sich aber zugleich auch schuldig fühlte wegen der Rolle, die er bei Addys Behinderung gespielt hatte – schließlich war er derjenige gewesen, der sie dem Virus ausgesetzt hatte, wegen dem sie jetzt für alle Zeiten taub war. Was Macy anbetraf, nahm er an, dass Ennis Tod ihre Trauer über den Verlust ihrer eigenen Eltern und die Unsicherheit, wie das Leben weitergehen sollte, noch mehr verschlimmert hatte.
Es gab aber leider nichts, was Graham daran ändern konnte, denn Optimismus war Mangelware in dieser Zeit. Er trieb den Nagel mit einem weiteren Schlag ins Holz und zog dann den nächsten aus seinem Mundwinkel, damit er ungehindert sprechen konnte. Als sie sich der Tür der Blockhütte näherte, rief er ihr hinterher: »Hey, Macy?«
Sie blieb stehen und drehte sich zu ihm um. »Ja?«
Die Worte, die er jetzt hätte sagen sollen, fielen ihm einfach nicht ein. Er wollte sie wieder ins rechte Lot bringen, sie heilen, sie wieder ganz machen. Er wollte ihr sagen: Alles wird gut werden, es wird dir bald wieder besser gehen, doch stattdessen starrte er sie nur an, als sie so dastand mit ihren schlammbedeckten Stiefeln, der gerunzelten Stirn und Sheriff an ihrer Seite.
»Was ist los, Graham?«
»Äh, könntest du für Tala die Wäsche von der Leine nehmen? Sie wird in diesem Regen einfach nicht trocknen. Wir besuchen gleich Clarisse.« Ja, das war gut. Etwas zu tun zu haben, wird sie ablenken und ihr helfen, sich besser zu fühlen. War es nicht auch genau das, was seine Mutter immer zu sagen gepflegt hatte? Es war darum gegangen, dass Müßigkeit eine schlechte Sache war und zu viel Zeit zum Nachdenken ließ.
»Na klar, ich kümmere mich gleich darum«, antwortete Macy, die ihren trübsinnig wirkenden Weg die Veranda hinauf fortsetzte, um sich den Wäschekorb zu holen.
Graham warf einen Blick auf Bang und stellte fest, dass dieser den ganzen Morgen mit ihm draußen gewesen war, die ganze Zeit neben ihm gearbeitet hatte, und trotzdem war der Junge immer noch ein Häufchen Elend. Jeder Versuch, Bang aufzuheitern, hatte diesen scheinbar nur noch verschlossener und in sich gekehrter gemacht. Alles, was er versucht hatte, war scheinbar falsch gewesen und nichts schien zu funktionieren.
Das ist doch alles Bullshit, dachte Graham.
Plötzlich kam ihm das Gegenteil von dem in den Sinn, was seine Mutter ihm beigebracht hatte. Er erinnerte sich, wie seine Mutter ihnen immer gesagt hatte: »Reißt euch zusammen«, wenn er und seine Schwester es in der Öffentlichkeit übertrieben hatten – das Ergebnis war natürlich nur weiteres Kichern und Herumkaspern gewesen. Je älter er wurde, desto mehr war er mittlerweile davon überzeugt, dass seine Mutter eine Meisterin in umgekehrter Psychologie gewesen war.
Was zum Teufel sollte das bedeuten?
Dalton hatte das gleiche Problem drüben im Lager der Prepper. Er hatte nicht nur mit dem Verlust seiner eigenen Frau zu kämpfen, sondern musste sich zugleich auch noch um seine zwei trauernden jungen Söhne kümmern. Eigentlich war es das ganze Lager, das den Verlust der vier Mitglieder noch immer nicht verarbeitet hatte. Die Last all dessen machte Dalton, der über die Zeit zu einem echten Freund geworden war, manchmal distanziert und wütend. Er selbst verstand das nur all zu gut.
Graham schlug den nächsten Nagel mit mehr Kraft als nötig ein und griff dann nach unten, um die Holzschindel aus Bangs Hand entgegenzunehmen. Er versuchte ein Lächeln, erwartete aber nicht, dass es funktionierte. »Möchtest du später mit Tala und mir Clarisse besuchen gehen? Vielleicht ist Addy ja auch da. Dann kannst du dich selbst davon überzeugen, wie gut es ihr geht.«
Bang schüttelte den Kopf und wirkte sogar verletzt wegen dieses Vorschlags.
Verdammt, dachte Graham. Jetzt reicht es mir! Ich werde es nicht einmal mehr versuchen. Sie brauchen einfach Zeit, dann kommen sie schon von selbst zu mir.
»Okay. Alles geschafft«, sagte Graham und hämmerte den letzten Nagel ein. Er stieg von der Leiter und zog sie vom Dach. »Geh schon mal vor und sag Tala Bescheid, dass wir gleich zum Lager der Prepper aufbrechen, sobald ich hier aufgeräumt habe.«
Ohne ein Wort eilte Bang davon, während Graham sich in seine Frustration zurückzog. Er klappte die Leiter zusammen und ging zu seiner neuen Werkstatt hinüber, um sie dort hineinzustellen. Zumindest hatten sie es geschafft, beide Gebäude instand zu setzen, bevor der heiße Sommer kam. Mit McCann und Mark, die beide tatkräftig mitarbeiteten, ging alles viel schneller. Obwohl sie größtenteils ohne Strom lebten, hatten sie sich dafür entschieden, für die Elektrowerkzeuge ab und zu den Generator anzuwerfen, was die Arbeit natürlich deutlich beschleunigte.
Es belastete Graham, dass all diese Kinder mit schwindenden Benzinvorräten aufwachsen würden und vollkommen ungewiss war, auf welche Art und Weise sie in Zukunft leben würden. Dalton und er sprachen oft über die jüngere Generation und was die Erwachsenen jetzt tun mussten, um ihnen das Überleben zu ermöglichen. Entweder gelang es ihnen, den Jüngeren beizubringen, ohne die bisherigen Annehmlichkeiten des Lebens wie Elektrizität, moderne Medizin und verarbeitete Lebensmittel auszukommen, oder die nachfolgende Generation würde die Letzte sein. Es war eine schwere Aufgabe, und wenn sie versagten, würde dies enorme Konsequenzen nach sich ziehen. Graham konnte das Gefühl, dass die Menschheit bereits einmal fast alles verloren hatte, weil sie zu abhängig davon gewesen war, die Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu tun, einfach nicht abschütteln. Dies war die einmalige Chance, wieder ganz von vorn zu beginnen. Trotzdem, dachte er, ist es zu früh, sich darüber Gedanken zu machen. Sie hatten sich nämlich immer noch nicht von der letzten Katastrophe der Menschheit erholt.
Graham zog sein verschwitztes Hemd aus, und obwohl die Frühlingsluft noch recht kühl war, bückte er sich und benutzte den Wasserschlauch, um seinen Oberkörper, das Gesicht und den Hals abzuduschen. Als er aufblickte, sah er Tala auf sich zukommen. Ihre Schönheit faszinierte ihn zutiefst und er schreckte unwillkürlich zusammen, als er sie sah. Sie war jetzt im sechsten Monat schwanger, und ihre bevorstehende Mutterschaft ließ sie nicht nur strahlen, sondern machte sie für ihn schöner als jede Frau, die er jemals gekannt hatte. Ihr Lächeln verriet Graham, wie sehr sie seine Beobachtungen zu schätzen wusste.
»Findest du denn nie ein Ende?«, fragte sie. »Nun komm schon, sonst müssen wir nachher noch im Dunkeln zurücklaufen!«
»Wir könnten auch fahren.«
»Das Laufen tut mir gut. Außerdem ist es doch nicht allzu weit.«
Er nahm ein noch klammes Hemd von der Wäscheleine, zog es an und begann es zuzuknöpfen. »Ist das nicht irgendwie komisch? So als würden wir für eine vorgeburtliche Untersuchung zum Arzt gehen.«
»Das geht mir auch so. Ich war zwar immer für eine natürliche Geburt, aber ich hätte nie gedacht, dass ich es ohne die Option, im Notfall in ein Krankenhaus gehen zu können, machen müsste.«