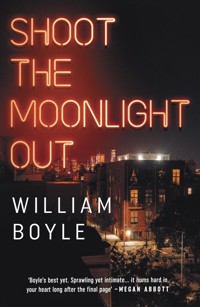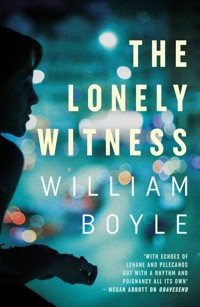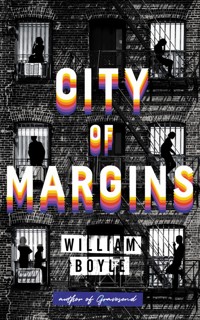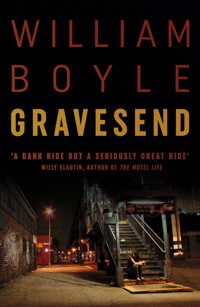14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Polar Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ray Boy Calabrese wird aus dem Gefängnis entlassen. Während seiner Schulzeit hat er einen Jungen wegen seines Schwulseins gequält, ihn zusammen mit Freunden geschlagen, getreten, sodass Duncan nur die Flucht blieb und er überfahren wurde. Vor Gericht nannten sie es Hate Crime, ein sexistisch motiviertes Verbrechen. Nun kommt Ray Boy Calabrese aus der Haft frei und will nur noch sterben. Duncans Bruder Conway hat Rache geschworen, lernt schießen und trifft nicht. Er ist neunundzwanzig, arbeitet in einem Rite Aid und wohnt bei seinem Vater Pope. Mit Ray Boys Heimkehr in sein altes Viertel reißen die nur leicht übertünchten Risse in der Familie auf, in der er aufgewachsen ist. Während sein Neffe Eugene in ihm ein Idol sieht und bitter enttäuscht ist, dass sein Held zu einem gebrochenen Mann geworden ist. William Boyles "Gravesend" geht der Frage nach, inwieweit wir zur Vergebung fähig sind. Anderen und uns selbst gegenüber. Denn uns selbst gegenüber sind wir unerbittlich, wenn es umm Träume und Hoffnungen geht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
William Boyle
Gravesend
Kriminalroman
Aus dem Amerikanischen von Andrea StumpfHerausgegeben von Wolfgang Franßen
Copyright © 2013 by William BoyleOrginaltitel: Gravesend
Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage 2018Aus dem Amerikanischen von Andrea Stumpf© 2018 Polar Verlag GmbH Hamburgwww.polar-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) oder unter Verwendung elektronischer Systeme ohne schriftliche Genehmigung des Verlags verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Sven Koch, Gabriele WerbeckUmschlaggestaltung: Kerstin Petermann, Robert NethAutorenfoto: © Katie Farrell BoyleSatz/Layout: Martina StolzmannGesetzt aus Adobe Garamond PostScript, InDesignDruck und Bindung: CPI books GmbH, Leck, Deutschland
ISBN: 978-3-945133-55-2eISBN: 978-3-945133-56-9
Dieses Buch würde es ohne die Hilfe, Unterstützung und Ermutigung durch meine Frau Katie Farrell Boyle und unseren Sohn Eamon, meine Mutter Geraldine Chiappetta sowie J. David Osborne, Alex Shakespeare und Jimmy Cajoleas nicht geben.
Für meine Großeltern Joseph und Rosemary Giannini
When a man knows another manIs looking for himHe doesn’t hide.Frank Stanford, »Everybody Who is Dead«
You’ll always end up in this city. Don’t hope for things elsewhere: there’s no ship for you; there’s no road.Now that you’ve wasted your life here, in this small corner, you’ve destroyed it everywhere in the world.C.P. Cavafy, »The City«
Inhalt
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Eins
Es war Mitte September, und Conway hatte sich von McKenna zu einem Schießstand in Bay Ridge mitnehmen lassen, damit er ihm das Schießen beibrachte. McKenna war sechs Jahre lang Cop gewesen, ehe er im Dienst jemanden erschoss und mit drei Viertel seiner Bezüge in Pension geschickt wurde.
»Ich glaub’s nicht, Ray Boy ist draußen«, sagte Conway. »Läuft einfach frei rum.« Er hob die Waffe und schoss auf die Zielscheibe, der Schuss ging weit daneben.
»Conway«, sagte McKenna und nahm seine Ohrstöpsel raus, »du solltest dieses Ding wirklich aufsetzen.« Er hielt ihm Ohrenschützer hin.
»Wieso denn? So schnell werd ich sicher nicht taub.« Conway hörte ein leises Klingeln, wie von einem entfernten Glöckchen.
»Beim Schießen braucht man Selbstvertrauen«, sagte McKenna. »Und du hast gerade kein Selbstvertrauen. So wie du dir den Arm von der Knarre verziehen lässt, wirst du im echten Leben nie was treffen.«
»Wenn ich dem Typen die Waffe an den Bauch halte, werd ich schon treffen«, sagte Conway.
»Ob’s dazu kommen wird?«
Der Schießstand befand sich in einem Lagerhaus neben einer aufgelassenen Textilfabrik und gegenüber einem russischen Nachtclub. Von außen sah das Gebäude aus, als würden dort Snuff-Filme gedreht. Aber Waffennarren, Cops und andere kannten ihn und kamen und ballerten von ihren verdunkelten Ständen auf runde Schießscheiben und Pappkameraden. Auf manchen Schießscheiben waren Fotos von Baseballstars befestigt. Conway hatte auf seine ein altes Zeitungsfoto von Ray Boy getackert. Das Problem war, dass er es noch kein Mal getroffen hatte. Dabei war es groß, eine ganze Doppelseite aus der Daily News. Ray Boy, in Polizeibegleitung auf dem Weg zum Verhör im 62. Mit Sonnenbrille, Arschloch.
McKenna stand neben Conway und zeigte ihm, wie man die Waffe hielt. »Du hast echt Fischflossen, Con. Schließ die Finger.«
Conway griff fester zu und drückte ab. Rechts daneben. »Vielleicht liegt’s ja an der Knarre.«
»Du hast keine Ahnung von Waffen. Glaub mir. Eine Zweiundzwanziger ist genau richtig.«
»Ich brauch eine abgesägte Schrotflinte.«
»So was gibt’s nur im Film. Ich hab dir die hier besorgt.«
Conway schoss noch ein paarmal und traf den äußeren Rand der Schießscheibe, verfehlte aber immer noch das Bild von Ray Boy, und langsam wirkte McKenna genervt.
»Vielleicht sollte ich einfach mitgehen«, sagte McKenna.
»Ich werd dich Marylou nicht wegnehmen«, sagte Conway. »Wenn was schiefgeht, will ich dich nicht in meiner Nähe haben.«
»Und was ist mit Pop? Wer wird sich dann um ihn kümmern?«
»Das lass mal meine Sorge sein.«
»Wann wird Bunker dich anrufen?«
»Heute Nachmittag.«
Bunker war Privatdetektiv in Monticello. McKenna, der ihn über einen pensionierten Cop aus Forestburgh kannte, hatte ihn mit Conway zusammengebracht. Über einen weiteren Kontakt eines State Troopers, der einen Typen kannte, der einen Gefängniswärter in Sing Sing kannte, hatte McKenna erfahren, dass Ray Boy nach seiner Entlassung in die Gegend von Monticello gezogen war. Wo genau, ließ sich nicht herausfinden, aber Bunker hatte gesagt, er würde sich dahinterklemmen.
»Du bist zu ungeduldig. Ich versteh das ja. Aber wenn du das durchziehen willst, solltest du warten. Ein paar Tage. Ein paar Monate. Ein Jahr. Du solltest das nicht unvorbereitet machen.«
»Jeden Tag, den er draußen rumläuft, habe ich einen Tag zu lange gewartet«, sagte Conway. In Wahrheit wollte er überhaupt nicht vorbereitet sein. Das sollte keine Doktorarbeit werden.
»Dann üb weiter.« McKenna wandte sich ab.
Conway hielt die Waffe hoch und stellte sich vor, wie Ray Boy vor ihm davonlief. Ray Boy, der immer kleiner in seinem Fadenkreuz wurde – so würde es nicht sein, aber das musste er sich eben vorstellen, wenn er McKenna beweisen wollte, dass er treffen konnte. Er schoss erneut. Erwischte knapp den äußeren Rand des Fotos. Immerhin ein Anfang.
Bunker rief um drei an. Conway saß im Bus nach Gravesend, die in Handtücher gewickelte Waffe in einer Sporttasche zu seinen Füßen.
»Diesem Ray Boy geht’s prima«, sagte Bunker. »Auch wenn Sie’s nicht gerne hören.«
Conway rutschte auf seinem Sitz hin und her. Stellte sich vor, wie Ray Boy sein Leben genoss. »Was soll das heißen? Hat er Geld? Freundin?«
»Er hockt in einem Haus in Hawk’s Nest. Gehört schon eine halbe Ewigkeit seiner Familie. Macht Push-ups wie eine Nähmaschine. Kriegt von seiner Mutter Schecks geschickt.«
»Hawk’s Nest?«
»Ungefähr zwanzig Minuten von Monticello.«
»Können Sie mich dorthin bringen?«, fragte Conway.
»Jederzeit«, sagte Bunker. »Wir treffen uns an der Rennbahn, sobald Sie hier sind, und ich zeig Ihnen den Weg.«
»Wie weit ist es?«
»Um die drei Stunden. Vielleicht ein bisschen weniger.«
Conway klappte das Handy zu und betrachtete die anderen Fahrgäste im Bus. Eine alte Frau mit Einkaufstaschen. Zwei Schüler von der Our Lady of the Narrows mit prallen Rucksäcken auf dem Schoß und Kopfhörern auf den Ohren. Dieser Hyun – Conway kannte ihn vom Sehen, er trieb für Mr. Natale Geld ein – hielt sich schwitzend und nervös an der Haltestange über seinem Kopf fest, in der anderen Hand einen Packen Papier. Und da war die Obdachlose mit dem Holzbein, die den ganzen Tag mit dem B1 und dem B64 hin und her fuhr und ihren Rollstuhl mit Einkaufstüten behängt hatte. Keiner von ihnen wusste, dass er eine Pistole hatte. Keiner von ihnen wusste, dass er zu seinem Auto wollte, um nach Upstate zu fahren und Ray Boy Calabrese zu erschießen. Wahrscheinlich kannte keiner von ihnen Ray Boy. Oder sie hatten das Gesicht aus der Zeitung vergessen. Die Schüler waren damals noch nicht mal geboren. In sechzehn Jahren floss viel Wasser den Hudson runter. Conway dachte an Duncans Grab: die vielen Papierblumen, die er jede Woche dort ablegte. Er hatte sich hingekniet und ein Versprechen gegeben, von dem keiner im Bus etwas wusste.
Auf dem Heimweg beobachtete Conway die Tauben auf dem Bürgersteig vor Johnny Tomasullos Friseurladen. An den Telefonkabeln baumelte ein Paar Stiefel. So was sah man nur noch selten. Er erinnerte sich, wie er seine Schuhe am letzten Schultag in der Junior-Highschool über die Leitung geworfen hatte. Dann lehnte er sich an eine Parkuhr und überlegte, wie er es Pop beibringen sollte. Samthandschuhe. Lügen.
Als er das Gartentor erreichte, stand Pop schon in der Tür. »Wo warst du?«, fragte Pop.
»Bay Ridge, mit McKenna. Im Fitnesscenter.«
»Du musst mir ein Medikament holen.«
»Jetzt nicht.«
»Wann?«
»Später vielleicht. Mal schauen. Sonst sag ich Stephanie, dass sie es bringen soll.«
»Nein, nein, nein. Keine Umstände. Ich geh selbst. Ist doch albern, Stephanie zu bitten.«
»Mit deinem Bein gehst du nirgends hin, Pop. Stephanie tut das gerne. Wir sind Freunde. Es sind nur vier Blocks. Das macht ihr nichts aus.«
»Albern.«
Conway ging ins Haus und nahm den Autoschlüssel vom Haken in der Küche und eine Rolle Klebeband aus dem Werkzeugschrank. Das Klebeband steckte er in die Sporttasche. Pop folgte ihm auf dem Fuß. »Ich hab zu tun, Pop«, sagte Conway.
»Aber du holst es für mich, ja?«, sagte Pop.
»Vielleicht.«
»Dann geh ich.«
»Okay«, sagte Conway, »ich geh und hol’s.«
Er dachte gar nicht dran. Er verließ das Haus und ging den Block runter, wo sein Civic vor der P.S. 101 stand. Dort klappte er sein Handy auf und rief Stephanie an. Bat sie, seinem Vater das Medikament zu bringen. Sie solle ihn nur zuerst anrufen, damit er keinen Schreck bekomme. Klingel ein paarmal, sagte er. Manchmal hörte Pop die Türklingel nicht. Stephanie erklärte sich einverstanden, sie war froh, aus dem Laden zu kommen. Wenigstens das hatte er erledigt. Und Pop hätte ein bisschen Ablenkung, wenigstens für ein paar Minuten. Stephanie war nicht besonders helle, ihre Haare standen ab wie bei einer Cartoonfigur und sie hatte einen breiten Brooklyner Akzent, aber sie war freundlich, besonders zu älteren Herrschaften.
Conway fuhr die Benson Avenue Richtung Belt Parkway und verscheuchte das Bild von Pop in dem trostlosen Wohnzimmer: das verstaubte Kreuz an der Wand, die Kalender der Sacred Heart Auto League in jeder Ecke und der schon ganz fadenscheinige Lampenschirm. Aber es wollte nicht weggehen: Pop in dem durchgesessenen Fernsehsessel auf einem Haufen Kissen, der nach der Fernbedienung griff und zu verstehen versuchte, was sie im Fernsehen sagten. Pop, der seine Gichtfinger in eine Dose Wick Vaporub steckte und seinen Nacken massierte. Darauf wartete, dass Conway mit dem Medikament nach Hause kam.
Von diesem Moment an hatte Pop nichts und niemanden mehr. Conway wusste, dass er nicht zurückkam. Er war an einem Ende angelangt. Vielleicht würde Tante Nunzia nach Pop sehen, aber sie hatte selbst genug um die Ohren. Ein Bauarbeitersohn, der ihre Sozialhilfe verspielte. Eichhörnchen in den Wänden. Die Schulden ihres Mannes, die sie immer noch abzahlte. Pop hatte nichts. Das Haus und seine Medikamente. Die Fenster, aus denen er starrte. Die Kinder in der Nachbarschaft, denen er die Polizei auf den Hals hetzte. Wenn Conway weg war, würde er womöglich nicht mehr leben wollen. Nicht, dass er sich umbringen würde. Er würde sich still und heimlich davonmachen. Aufhören zu atmen, während er vor dem Fernseher saß.
Plumb Beach lag nicht auf dem Weg, aber Conway fuhr ein Stück auf dem Belt zurück. Dorthin kam man nur über eine nicht ausgeschilderte Ausfahrt auf dem Parkway in Richtung Osten, kurz nach der Knapp Street.
Rechts und links vom Eingangstor gab es Parkplätze. Conway stellte das Auto neben einem kleinen Müllcontainer ab. An dieser Stelle hatte man Duncans Auto gefunden. Conway führte Buch über seine Besuche. Mit einem herumliegenden Stein oder scharfen Gegenstand kratzte er jedes Mal einen Strich auf den Müllcontainer. Seit sechzehn Jahren kam er zwei-, dreimal die Woche. Eine ganze Seite war mit seinen Kratzern bedeckt. Er bückte sich und kratzte mit einem abgebrochenen Fahrradlenker, den er neben seinem Vorderreifen gefunden hatte, einen neuen Strich.
Er stand da und ging im Kopf die nächsten Schritte durch. Er lief an einer Reihe mobiler Klohäuschen vorbei, wo die alten Russen schissen, und umrundete den niedrigen Pavillon, der verlassen und finster dastand. Er war übersät mit Verbotsschildern und Fischabziehbildern, die sich an den Rändern abschälten, dazwischen ein Schild, auf dem stand: SAMMELN Von pfeilschwanzkrebsen Verboten. Zwei Kinderturnschuhe baumelten über dem kaputten Zaun zum Strand. Möwen pickten in dem verdreckten Sand. Leere Corona-Flaschen und Newport-Päckchen und Kondomhüllen hingen in dem Seegras, das die Uferlinie einfasste. Er lief zum Wasser und sah in Richtung Gil Hodges Memorial Bridge, dann in die andere zum Kingsborough Community College. Auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht lagen Fort Tilden und Jacob Riis.
Ray Boy hatte Duncan während der gesamten Schulzeit wegen seines Schwulseins gequält, und eines Nachmittags hatte er ihn angerufen und so getan, als wäre er ein Junge, den er in der Stadt kennengelernt hatte. Er sagte, er wolle ihn am Plumb Beach treffen, und der blöde Duncan ließ sich tatsächlich darauf ein. Einige Monate zuvor hatte er seinen Führerschein gemacht, und jetzt fuhr er zum Plumb Beach, parkte neben dem Müllcontainer, schaltete die Scheinwerfer aus und lief zum Ufer. Zum x-ten Mal spulte sich die Szene in Conways Kopf ab: Ray Boy und sein Gefolge, Teemo und Andy Tighe, fielen wie aus dem Nichts über Duncan her, sie schlugen und traten ihn, Duncan rappelte sich hoch, haute ab, merkte, dass er seine Schlüssel fallen gelassen hatte, rannte an seinem Auto vorbei, sprang über die Leitplanke und auf den Belt, wich Scheinwerfern und Autos aus, überzeugt, dass jemand anhalten und ihm helfen würde.
Vom Strand ging Conway an seinem Auto vorbei zu der Leitplanke. Er stieg hinauf, balancierte mit ausgestreckten Armen darauf, sah zu, wie die Autos auf dem Belt vorbeischossen. Das Auto, das Duncan nicht mehr hatte ausweichen können, war hundertzehn gefahren.
Das Gericht hatte es Hate Crime genannt, ein sexistisch motiviertes Verbrechen. Und Totschlag. Die Lesben- und Schwulenvereinigung hatte Druck ausgeübt, und Ray Boy, Teemo und Andy Tighe bekamen die Höchststrafe. Conway nannte es kaltblütigen Mord und er wusste, dass Ray Boy der Anstifter gewesen war. Conway war jetzt neunundzwanzig und arbeitete in dem beschissenen Rite Aid in der Eighty-Sixth Street, wohnte bei seinem Vater, der nie über Duncans Tod hinweggekommen war, und fragte sich, was aus seiner Mutter geworden war, die sich dem Suff ergeben hatte. Er wollte Rache. Das Schwein verdiente es, tot in einem Kofferraum zu landen, in irgendeinem beschissenen Loch verbuddelt zu werden, ohne Blumen und Grabstein, nur langsam verrottende Haut und Knochen. Er vermied es, sich seinen toten Bruder auf dem Belt vor all den Jahren vorzustellen, ein Bild, das ihn immer wieder heimsuchte. Er sprang von der Leitplanke und ging zu seinem Auto.
Er kam gut durch, auf der Schnellstraße war kein Verkehr, und Conway konnte das Gaspedal durchdrücken. Erst ein paarmal in seinem Leben hatte er die Stadt verlassen. Nach Long Island zum Begräbnis seines Bruders. Jersey zur Konfirmation eines Cousins. Baltimore zu einer öden Hochzeit. Staten Island und die Bronx waren im Grunde die Enden seiner Welt. Er staunte über das, was auf der anderen Seite der George Washington Bridge auf ihn wartete. Der Palisades Parkway. Bear Mountain. Ein Kreisverkehr, bei dem er den Schildern nach Central Valley folgte. Überall Bäume. Blätter, die die Farbe wechselten. Autos mit offenem Dach. Dann kam er auf die 17. Outlets. Einkaufszentren. Ausfahrten zu Städten mit Hundenamen. Monroe. Chester.
Conway traf sich mit Bunker an einer Shell-Tankstelle gegenüber der Rennbahn in Monticello. Er stellte sein Auto hinter Bunkers Citation ab.
Bunker stieg aus, steckte sich einen stinkenden Stumpen an und trat an Conways Fenster. Er sah eher wie ein trauriger Nachhilfelehrer als wie ein Privatdetektiv aus. »Conway?«, fragte er. »Wie wär’s mit einem Kaffee?«
»Ne, danke«, sagte Conway.
»Ray Boy wohnt knapp dreißig Kilometer in diese Richtung. Die Straße heißt Parsonage. Es ist ein großes weißes Haus auf der linken Seite, und wenn wir daran vorbeikommen, blinke ich dreimal und fahr weiter.«
»In Ordnung.«
»Wenn Sie an den Eisenbahngleisen und dem Fluss landen, wissen Sie, dass Sie zu weit gefahren sind. Ich dreh nicht um. Ich fahr eine andere Strecke zurück. Aber wenn Sie aus Versehen an den Fluss kommen, drehen Sie um und fahren auf der Parsonage zurück.«
»Wie viel schulde ich Ihnen?«
»Darum hat sich schon Ihr Freund gekümmert.«
Schweigend nickte Conway.
Bunker ging zu seinem Auto zurück und fuhr los, Kies spritzte vom Straßenrand weg. Conway folgte ihm auf der Route 17B. Sein Handy brummte in der Tasche. Er nahm es heraus und klappte es auf.
»Wo bist du?«, fragte McKenna am anderen Ende.
»Auf dem direkten Weg zu ihm«, sagte Conway.
»Ich hätte mitkommen sollen.«
»Nein.«
»Hör mal, Kumpel, ich hab schlechte Nachrichten. Ich habe gerade erfahren, dass die Village Voice einen Artikel über Ray Boys Entlassung gebracht hat. Irgendwas in Erinnerung an Duncan. Meinten, man hätte sich den Fall damals nicht genau genug angesehen.«
»Und?«
»Das soll heißen, dass sich gerade eine Menge Augen auf Ray Boy richten. Ich sag’s noch mal, ich finde, du solltest warten.«
»Ich kann nicht warten.«
»Sie werden dich einbuchten.«
»Ich geh nicht in den Knast«, sagte Conway.
»Ich sag Marylou, sie soll ihre Marienstatue aufstellen«, sagte McKenna.
Conway klappte das Handy zu. Das machte er nur bei McKenna, einfach aufhören zu sprechen. Das hatte er früher schon gerne gemacht, aber inzwischen verabschiedete er sich nur noch so von ihm, als hätte er das Letzte gesagt, das er zu sagen hatte.
Es war möglich, dass er nach dem Mord an Ray Boy erwischt und im Sullivan Correctional eingebuchtet wurde. Oder er kam damit durch und schaffte es über die Grenze nach Kanada. Nova Scotia hatte er immer schon sehen wollen. Aber vielleicht erwischte Ray Boy auch ihn, der wahnsinnsstarke Ray Boy, der ihm die Waffe im Bruchteil einer Sekunde aus der Hand schlagen und dabei ins Gesicht lachen konnte, weil er so ein Wicht war. Der wahnsinnscoole Ray Boy, grinsend, wie auf dem Weg in den Gerichtssaal, als Conway ihn das erste Mal seit Duncans Tod gesehen hatte und nur dieses Grinsen sehen konnte, das sagte: Ich hab deinen Bruder, die Schwuchtel, umgebracht, Kleiner.
Das letzte Stück zu Ray Boys Haus führte über eine kaputte Straße ohne Seitenstreifen. Die Häuschen am Straßenrand wirkten, als wären sie für alle Zeiten verlassen worden. Holzböcke versperrten die Einfahrten. Fenster mit zerbrochenen Scheiben waren mit Plastikplanen zugenagelt. Die Dächer waren eingesackt und fielen zusammen. Conway schaltete Heizung und Radio aus und konzentrierte sich auf Bunkers linken Blinker, wartete auf das Signal.
Sie bogen nach links in die Parsonage ein. Bunker verlangsamte das Tempo, dann blinkte er und fuhr weiter zum Fluss und zu den Gleisen.
Conway hielt an und sah hinüber: ein weiß geschindeltes Haus am Ende einer langen bergan führenden Einfahrt. Im Garten ein Müllhaufen, ein Fass, in dem Müll verbrannt wurde, und zwei kaputte Pick-ups. Die senffarbenen Jalousien an den Fenstern waren heruntergelassen. Dreckstreifen zogen sich über die weiße Farbe. Die Stufen zur Veranda hingen durch. Auf der Veranda war feuchtes Holz gestapelt. Das Haus stand in einiger Entfernung zu den anderen Häusern in der Straße.
Conway öffnete die Sporttasche und holte das Klebeband und die .22er heraus. Er legte die Waffe auf seinen Schoß und sah noch einmal zu dem Haus. Versuchte die Wände mit seinem Blick zu durchbohren. Stellte sich vor, wie Ray Boy Klimmzüge an einer in den Türrahmen geklemmten Stange machte. Stellte sich vor, wie Ray Boy mit hochgelegten Beinen vor dem Fernseher Kaffee aus einem Styroporbecher trank. Stellte sich Ray Boys im Gefängnis erworbene Härte vor, tausendmal härter als zuvor.
Gelähmt traf sein momentanes Gefühl nicht ganz, aber er konnte sich nicht bewegen. Genau wie damals als Kind, als er der Nächste in der Reihe vorm Beichtstuhl gewesen war. Damals hatte er gehustet und geschnauft, und Schwester Erin oder Schwester Loretta hatte ihn in den Beichtstuhl geschoben, wo er den Priester anschwindelte. »Ich hatte schlechte Gedanken über Alessandra Biagini. Ich habe bei Augie ein Comicheft gestohlen. Ich hab meine Mutter angeschwindelt und gesagt, ich hab meine Hausaufgaben gemacht, dabei hab ich Zeichentrickfilme angeschaut.« Hier gab es keine Nonne, die ihn aus dem Auto schob, aber er wünschte, es wäre eine da.
Die Haustür öffnete sich. Ray Boy trat auf die Veranda, knipste eine trübe Deckenfunzel an und zündete sich eine Zigarette an. Er trug kein T-Shirt. Nur Boxershorts. Er war durchtrainiert und hatte Tätowierungen auf der Brust und den Unterarmen, die stümperhaft wirkten.
Conway bekreuzigte sich und sagte ein Gebet auf. Er wusste, dass man für so etwas nicht beten durfte, und vielleicht glaubte er auch gar nicht, dass Beten irgendetwas nutzte. Wahrscheinlich nicht. Aber er war immer zur Kirche gegangen, hatte immer gebetet, selbst wenn er genauso gut eine alberne Lampe hätte reiben und sich etwas hätte wünschen können. Als Kind hatte er in der Kirche immer Duncan angestarrt, der einen schimmernden Rosenkranz in den Händen hielt und betete und betete, und er war erstaunt gewesen, dass sein Bruder überhaupt an Gott glaubte.
Das Bild des betenden Duncan versetzte Conway einen Stich und er stieg aus dem Auto. Die Waffe vor sich gestreckt und das Klebeband in seiner Jackentasche, rannte er die Einfahrt hoch.
Ray Boy, die Augen zusammengekniffen, schien ihn zu sehen, und Conway war überrascht, dass er nicht losstürzte oder weglief, dass er einfach gegen das Verandageländer gelehnt weiterrauchte.
»Auf den Boden mit dir«, sagte Conway, als er sich mit vorgehaltener Pistole der Veranda näherte.
Ray Boy ging auf die Knie. »Hey«, sagte er.
»Du weißt, wer ich bin, oder?«
»Ich hatte gehofft, dass du kommst.« Ray Boy warf seine Zigarette über das Geländer und legte sich auf den Bauch, die Arme hinter dem Kopf verschränkt.
»Ich hab auch an dich gedacht«, sagte Conway.
Conway beugte sich über Ray Boy und zog ihm den Pistolengriff über den Hinterkopf, wie er es aus Filmen kannte. Es funktionierte nicht. Ray Boy wirkte kein bisschen beeindruckt. Conway sagte ihm, er solle stillhalten, und wickelte das Klebeband um seine Füße und Hände und verklebte ihm den Mund. Ray Boy rührte sich nicht.
Conway drückte die Waffe in Ray Boys Rücken. Noch immer wehrte er sich nicht. Conway wollte, dass er bettelte, wie Duncan in der Nacht am Plumb Beach sicher gebettelt hatte. Diese Vorstellung fand Conway am schlimmsten, Duncan auf allen vieren wie ein Hund, Ray Boy und seine Kumpel, die ihn anspuckten und als schwule Sau beschimpften.
Conway zog ein Stück von dem Klebeband von Ray Boys Mund und sagte: »Sag: ›Tu’s nicht.‹ Sag: ›Bitte tu’s nicht.‹«
Aber Ray Boy sagte nichts. Seine Lippen waren auf die morschen, abgetretenen Verandadielen gepresst.
Conways Blick fiel auf eine der Tätowierungen auf Ray Boys Arm. Duncans Name in zittrigen grünen Buchstaben. Darunter das Datum von Duncans Tod.
»Was ist das denn für ein Scheiß?«, fragte Conway.
Nichts.
»Was hat mein Bruder an diesem Abend zu dir gesagt? Hat er um sein Leben gebettelt?« Conway drückte mit der Waffe fester zu. »Antworte mir. Was hat er gesagt, Scheiße noch mal!«
»Er hat gesagt: ›Wir waren in der Dritten Freunde, weißt du nicht mehr? Tu’s nicht, bitte.‹« Und Ray Boy fing an zu heulen.
Zwei
Das ganze Haus roch wie ein alter Schwamm. Alessandra saß im Wohnzimmer, den Koffer zu ihren Füßen. Sie war mit einem Nachtflug von Los Angeles gekommen und hatte ein Taxi vom Flughafen nach Hause genommen. Sie sah zum Geschirrschrank ihrer Mutter. Er war seit Jahren nicht mehr abgestaubt worden. Ein Puzzle, das sie mit ihrer Mutter gemacht hatte, als sie zehn oder elf gewesen war, lag auf einem Servierwagen neben dem Schrank. Staub wuchs wie Unkraut zwischen den Puzzlesteinen. Ihr Vater kam und setzte sich neben sie. Auch er roch wie ein alter Schwamm. »Ich bin froh, dass du zu Hause bist«, sagte er.
Alessandra stützte das Gesicht in die Hände. »Ich war keine gute Tochter.«
»Du warst immer eine Freude für uns.«
»Wie war die Beerdigung?«
»Die ganze Verwandtschaft war da. Wir haben ihr Leben gefeiert.«
»Es tut mir leid, dass ich nicht dabei sein konnte.«
»Dafür bist du jetzt da. Willst du was trinken? Kaffee?«
Alessandra nickte. »Mit Sambuca und einem Spritzer Zitrone.«
Ihr Vater ging in die Küche und kochte Espresso. Er gab sich keine Mühe, nicht wie ein gebrochener Mann zu wirken. Seine Kleidung war zerknautscht. Er hatte einen Haarschnitt nötig. Seine Brille war verkratzt und das Gestell mit Klebeband umwickelt. An fünf, sechs Stellen hatte er sich beim Rasieren geschnitten. Ohne seine Frau kam er nicht klar.
Mit achtzehn war Alessandra nach Los Angeles gegangen. Sie wollte möglichst weit weg von Brooklyn und sie wollte Schauspielerin werden, daher schien ihr L.A. der richtige Ort zu sein. Ihre Eltern, besonders ihre Mutter, verstanden das nicht. Warum von Brooklyn weggehen? Manhattan war gleich auf der anderen Seite der Brücke, dort konnte man auch Schauspielerin sein. Aber Alessandra wollte nur weg. Die University of Southern California hatte sie genommen, und ihre Eltern zahlten sogar die Studiengebühren, aber sie schmiss nach dem ersten Semester hin und hielt sich mit Fernsehwerbung über Wasser. Hin und wieder bekam sie einen Auftrag, vor allem auf den Homeshopping-Kanälen, und dann fing sie an, in einer Band auf Hochzeiten zu singen, um für ihren Lebensunterhalt aufzukommen. Sie hatte keine besonders gute Stimme, aber weil die anderen Bandmitglieder sie hübsch fanden, ließen sie sie mitmachen. Fast zehn Jahre lang schlug sie sich an der Westküste durch, und als ihre Mutter krank wurde, überlegte sie, aufzugeben und nach Hause zurückzugehen. Aber sie schob die Entscheidung auf, machte weiter wie gewohnt, und ihre Mutter wurde kränker und ihr Vater rief fünfmal am Tag an, aber sie war wie gelähmt. Jetzt, fast zwei Monate nachdem bei ihrer Mutter Metastasen an den Knochen festgestellt worden waren, wogegen selbst die Ärzte im Sloan-Kettering oder im Columbia machtlos waren, und sie gestorben war, kehrte Alessandra nach Gravesend zurück, und es war trostloser, als sie es sich vorgestellt hatte.
Ihr Vater kam mit zwei Espressotassen zurück. Er hatte den Rand ihrer Tasse mit Zitrone eingerieben, so wie sie es mochte, und den Schnitz auf die Untertasse neben den Löffel gelegt. Sie dankte ihm und dann sagte sie, dass sie gerne das Grab ihrer Mutter besuchen würde.
»Wir können jederzeit los«, sagte er.
»Ich pack nur schnell aus und dusche.« Alessandra lutschte an der Zitrone und dann nahm sie einen Schluck Espresso. Sie überlegte, was sie alles tun musste, jetzt, wo sie zurück war. Den größten Teil ihrer Sachen hatte sie schicken lassen, sie sollten morgen oder übermorgen eintreffen. »Ich muss mir Arbeit suchen«, sagte sie.
»Eins nach dem anderen«, sagte ihr Vater.
»Und eine Wohnung.«
»Du bleibst hier. Es ist genug Platz.«
Alessandra stand mit ihrer Tasse auf und ging durch das Zimmer. Sie sah zum Vorderfenster hinaus. Ihr Vater hatte beschlossen, die große Eiche, die über die Einfahrt geragt hatte, fällen zu lassen, und jetzt konnte man sogar beim Nachbarhaus in die Fenster sehen. Sie starrte zu Jimmy’s Deli an der gegenüberliegenden Ecke, wo sie als Kind Limo und Eis gekauft hatte, und dachte daran, dass ihre Mutter sie hinüberbegleitet und bei der Rückkehr die Tomatenpflanzen gewässert hatte. »Wir hätten Mom im Garten begraben sollen«, sagte Alessandra. »Sie hat ihn immer so gemocht.«
Der Gedanke schien ihren Vater zu schockieren. »Holy Garden ist ein sehr schöner Friedhof, genau richtig«, sagte er.
»Man sollte die Leute an ihren Lieblingsplätzen begraben. Oder ihre Asche dort verstreuen. Mom hat den Garten geliebt, ganz bestimmt. Sie war die ganze Zeit draußen. Bei ihren Pflanzen. Oder sie saß einfach da und hörte sich die Übertragung von den Yankees-Spielen an.«
»Deine Mutter mochte Holy Garden«, sagte ihr Vater ungeduldig. »Wir haben den Friedhof zusammen ausgesucht. Rosie DeLuca und Jimmy Licardi liegen auch dort.« Er hielt inne. »Bei uns begräbt man Leute nicht im Garten.«
»Ich dachte nur, es wäre nett gewesen.«
Nachdem sie in ihrem alten Zimmer den Koffer ausgepackt und die Kleider in Schrank und Schubladen verstaut hatte, in denen noch immer ihr Schulabschlusskleid, abgeschnittene Jeans und New-Kids-on-the-Block-T-Shirts waren, stieg Alessandra unter die Dusche. Die Wanne war klein, und ihr Vater hatte an allen vier Seiten Plastikvorhänge angebracht, selbst um den Duschkopf, damit sich der Schimmel in den Fugen nicht ausbreitete. Es war sehr dunkel und eng darin. Sie erinnerte sich, morgens vor der Schule immer mit geschlossenen Augen geduscht zu haben, dann fühlte sie sich wie in einem U-Boot. Das Verdunkeln war – damals schon – das Projekt eines Mannes, der zu oft im Leben auf der Verliererseite gestanden hatte, um sich auch noch dem Schimmel geschlagen zu geben.
Alessandra zog ein friedhoftaugliches schwarzes Kleid an, bürstete sich die Haare und legte an ihrem Schminktisch Makeup auf. Das Zimmer war groß und mädchenhaft, mädchenhafter, als sie sich erinnert hatte, und ganz anders als die Zimmer, in denen sie in Los Angeles gewohnt hatte. Studioapartments, in dem Bett und Kühlschrank direkt nebeneinander standen. Häuser, die sie mit anderen Schauspielerinnen und Schauspielern teilte, die alle erstaunt waren, wie bescheiden sie leben konnte. Sie brauchte tatsächlich nicht viel. Ein paar hübsche Klamotten und Schuhe, anständiges Make-up in der Handtasche, hin und wieder einen Spa-Besuch, Zeit am Strand. An L.A. würde sie besonders die Strände vermissen. Hier gab es in erreichbarer Nähe den Coney und den Manhattan Beach, aber das war nicht dasselbe. Die Strände in New York waren ihr zu verdreckt. Besonders der Coney. Aber vielleicht hatte sich das inzwischen geändert und sie waren sauberer.
Aus dem Autoradio dudelten Oldies, während sie zum Friedhof fuhren und ihr Vater alle paar Minuten etwas fragte. Sie antwortete mit dürren Worten. Er wollte etwas über ihren Freund wissen, den Surfer. Sie sagte, dass das schon Ewigkeiten vorbei sei. Er fragte nach dem Wetter da drüben und dem Verkehr. Warm, sagte sie und dass alle mit dem Auto fahren würden. Er fragte sie nach dem einen großen Film, in dem sie mitgespielt hatte. Sie sagte, sie habe nur eine Nebenrolle gehabt, nichts Besonderes, in der endgültigen Fassung tauche sie nicht einmal mehr auf. Er wollte wissen, warum sie sich nicht für die Gesangsshow gemeldet habe, die mit den Juroren. Sie sagte, das habe sie, vier Mal, und sei nicht genommen worden. Es reiche bei ihr nur für Hochzeiten.
Danach breitete sich Schweigen aus. Alessandra kramte in ihrer Handtasche herum, wünschte, sie hätte ein Päckchen American Spirit. Ihr Vater hatte vor Jahren aufgehört, das wusste sie, dachte aber, dass er irgendwo im Auto ein Päckchen versteckt hatte. Jeder Exraucher hatte Zigaretten im Auto versteckt. »Hast du Zigaretten?«, fragte sie.
»Rauchst du?«
»Gelegentlich.«
»Das ist nicht gut.«
»Ich weiß. Und?«
»Im Handschuhfach.«
Sie klappte das Handschuhfach auf und da lag ein Päckchen Top-Tabak auf einem Stapel alter Esso-Karten, einer abgelaufenen Versicherungskarte und der Zulassung. »Ich kann nicht drehen«, sagte sie.
»Ich hab schon ein paar vorgedreht. Sie sind im Päckchen.«
Sie öffnete das Päckchen und fand die gerollten Zigaretten mit selbstgebasteltem Pappfilter. Ein tabakfleckiges Streichholzheft von Benny’s Fish & Beer war auch darin. Sie zündete eine Zigarette an und öffnete das Fenster. »Willst du auch eine?«
»Nein«, sagte er. »Jetzt nicht. Deiner Mutter hätte das nicht gefallen.«
Alessandra lachte. »Ernsthaft?«
»Es ist respektlos.«
»Ma hat selbst geraucht.«
»Vor vielen Jahren, da warst du noch ein Kind.«
Alessandra blies den Rauch aus dem Fenster. Sie sah an den vorbeifahrenden Autos vorbei auf ein niedriges Einkaufszentrum, das, wie auf einem Schild stand, auf einer Mülldeponie errichtet war. Wo waren sie überhaupt? Das müsste eigentlich der Belt sein, aber sie erkannte nichts wieder. Mitten am Tag war Stoßverkehr. Die Autos schossen an ihnen vorbei. Ihr Vater war ein vorsichtiger, langsamer Fahrer. Obwohl er die erlaubte Geschwindigkeit fuhr, hatte sie den Eindruck, er schlich dahin. Alles nur, damit sie an einem Grab stehen und weinen konnten. Was sollte das überhaupt, über einem Haufen Knochen zu weinen? Sie war nicht da gewesen, als es etwas bedeutet hätte, als ihre Mutter noch gelebt und nach ihr gefragt hatte, aber sie hatte der Pflicht Genüge getan und sich wie die traurige Tochter verhalten, die nur zu viel um die Ohren hatte und es nicht ans Sterbebett ihrer Mutter oder wenigstens zu ihrer Beerdigung schaffte.
Der Friedhof war schlimmer, als Alessandra gedacht hatte. Sie wusste, dass ihre Mutter in St. John’s in Queens hätte begraben werden wollen – dort lag ihre gesamte Familie –, aber ihr Vater hatte sie garantiert zu der billigeren Lösung überredet. St. John’s war ein wunderschöner Friedhof, wenn es so etwas überhaupt gab. Holy Garden dagegen war der Inbegriff von Trostlosigkeit. Graue Gefängnismauern um Grabstellen, die aussahen, als wären sie aus dem Boden gesprengt. Die Grabsteine waren kitschig. Nur Papierblumen waren erlaubt.
»Ist doch hübsch hier, oder?«, sagte ihr Vater. »Friedlich.«
»Mensch, Daddy. Warum habt ihr keine Grabstelle auf dem St. John’s gekauft?«
»Was?«
»Es ist schrecklich«, sagte Alessandra. Sie ging zum Auto zurück, holte eine weitere Zigarette aus dem Handschuhfach, zündete sie an, ging wieder zum Grab ihrer Mutter und beugte sich darüber. Sie klaubte ein paar Kieselsteine aus der Erde und legte sie in einem Kreis auf den Grabstein.
»Was soll denn das sein?«, fragte ihr Vater.
»Ein Opfer.«
»Jesus, Maria und Josef.« Er hielt inne. »Deiner Mutter hat es hier gefallen. Ehrlich.«
»Ihre ganze Familie liegt auf dem St. John’s.«
»Der St. John’s kostet aber ein Vermögen. In dem Familiengrab ist nur noch Platz für einen und darauf hat ihre Schwester Jenny als Ältere ein Anrecht. Deshalb sind wir her. Die Mutter und der Vater von Mikey sind hier begraben. Rosie und Jimmy. Frankies Junge, der, der ermordet wurde.«
»Der Junge von Frankie D’Innocenzio liegt hier? Duncan?«
»Armer Kerl. Ich wusste gar nicht, dass du ihn gekannt hast.«
»Natürlich.« Alessandra drückte die Zigarette aus und steckte den Stummel in die Tasche. »Ich würd gern sein Grab besuchen. Weißt du, wo es ist?«
»Verabschiede dich erst von deiner Mutter.«
Alessandra berührte den Grabstein und tat so, als würde sie beten. Ihr Vater drehte sich weg. »Wir hätten Blumen mitbringen sollen«, sagte er.
»Diese Papierblumen?«
»Sie verkaufen sie im Hauptbüro.«
Alessandra erwiderte nichts. »Wo ist Duncan?«, fragte sie.
Er führte sie auf einem Weg aus Ziegelbruch zu einer Reihe von liegenden Grabsteinen und einer alten Platane, deren Wurzeln die Erde um Duncans Grab hoben. Auf dem verdorrten Gras um den Grabstein lagen Papierblumen, wie sie alte Veteranen samstagmorgens vorm Supermarkt verkauften. Auf dem Stein standen Duncans Name und sein Todestag. Darunter: Unser geliebter Sohn und Bruder. »Sechzehn Jahre«, sagte Alessandra. »Himmel.«
»Schlimm«, sagte ihr Vater. »Ich versteh ja auch nicht, warum einer schwul ist, aber das hat er nicht verdient.«
»Red kein dummes Zeug, Daddy.«
Er drehte sich wieder um und ging den Weg zurück, auf dem sie gekommen waren.
Alessandra starrte auf Duncans Grab. Sie erinnerte sich, dass sie es erst gar nicht hatte glauben können, als sie von seinem Tod erfuhr. Das Schlimmste waren die Umstände. Es war in ihrem ersten Jahr an der Most Precious Blood passiert. Sie ging in eine Klasse mit Duncans Bruder Conway, und er hatte ihr furchtbar leidgetan. Conway hatte hinter ihr gesessen, sein Name kam nach ihrem im Alphabet. Und Ray Boy kannte sie auch. Er war vier Jahre älter und sie hatte ihn oft in der Nachbarschaft gesehen. Er hatte blitzende blaue Augen und trug eine graue Mechanikerjacke mit roten Nähten, und wie alle war sie in ihn verknallt. Diese Augen. Sie wusste, dass er und seine Kumpane Duncan schon lange auf dem Kieker hatten, aber er war der Schlimmste, nur fand sie damals nichts daran. Schwule wurden gemobbt, so war das einfach. Jetzt wusste sie, dass jemand etwas hätte sagen müssen. Der arme Duncan musste ihnen ständig aus dem Weg gehen und dachte wohl, er hätte es geschafft, als er in die Abschlussklasse kam. Aber Ray Boy gab keine Ruhe. Er musste sich Duncan unbedingt noch ein letztes Mal vorknöpfen. Tja, dachte sie, im Knast musste Ray Boy dann Ruhe geben.
Sie verließ das Grab und ging zurück zum Auto. Ihr Vater saß hinterm Lenkrad und rauchte. Er hatte das Radio angestellt und hörte die Nachrichten auf WABC. »Tut mir leid«, sagte er.
»Dir muss doch nichts leidtun«, sagte sie.
»Doch«, sagte er.
»Mach dir keine Sorgen, Daddy«, sagte sie und schnorrte eine letzte Zigarette.
Als sie zurück im Haus waren, aßen Alessandra und ihr Vater zu Abend, Nudeln mit Bratensoße, die er am Nachmittag aus dem Gefrierschrank geholt hatte, und involtini von ihrer Tante Cecilia. Sie hatte vergessen, wie gut so etwas schmeckte. In L.A. hatte es immer nur Hummus und Avocados und Smoothies gegeben, gesundes Zeug, das nicht viel Zeit kostete und das sie nicht vermisste. Die Soße mit einer gehörigen Menge Knoblauch schmeckte samtig und süßlich, und Parmesan wie der von Pastosa war an der Westküste überhaupt nicht zu kriegen. Gemeinsam tranken sie eine selbst abgefüllte Flasche Rotwein aus dem Keller eines Nachbarn, dunkel und herb, den sie kaum hinunterbekam, so trocken war er, aber sie zwang sich dazu, weil sie sich betrinken wollte.
Nach dem Abendessen setzte sich ihr Vater in seinen Fernsehsessel und sah sich ein Yankees-Spiel an. Sie ging nach oben, zog sich um, legte frisches Make-up auf und beschloss, auszugehen und zu schauen, wer noch hier wohnte. Sie überlegte, nach Bay Ridge zu fahren, hatte aber keine Lust, in ein Taxi zu steigen. In der näheren Umgebung gab es, wenn sie sich recht erinnerte, nicht viele Kneipen. Einen finsteren Schuppen namens The Wrong Number, in Graffiti-Schrift auf das Schild gemalt. Und Ralphie’s, eine muffige Sportsbar, die von fetten Cops und aalglatten Italienern mit Rasierwasserfahne besucht wurde. Das war alles gewesen. Aufgestylt ging sie nach unten und fragte ihren Vater, ob irgendwelche neuen Kneipen aufgemacht hätten. Er verstand, dass sie ausgehen wollte, und sagte, ja, diese Kneipen gebe es noch und dazu zwei neue, einen russischen Nachtclub und eine weitere Sportsbar namens Murphy’s Irish. Alessandra überlegte, dass sich der russische Nachtclub nach viel Schweiß und Wodka und Hinterntätscheln anhörte, und in eine Sportsbar würde sie sowieso nicht gehen, also beschloss sie, es mit dem Wrong Number zu versuchen. Sie wünschte, sie hätte mit alten Freundinnen in der Gegend Kontakt gehalten, einer, die sie anrufen und zu einem Treffen überreden könnte, aber auch deswegen war sie nach L.A. gegangen, weil sie keine Lust mehr auf die Leute hatte, mit denen sie aufgewachsen war. Außerdem war sie sowieso nie besonders eng mit ihnen gewesen. Mit den beiden Melissas hatte sie sich ein paarmal getroffen, entweder in Bay Ridge oder in Canarsie, und als sie auf die Kearney High School gegangen war, war sie oft mit Joanne Galbo und Mary DiMaggio unterwegs gewesen, aber das war’s auch schon. Mit Stephanie Dirello, die ein paar Häuser weiter wohnte, war sie zwölf Jahre in dieselbe Klasse gegangen, zuerst an der Most Precious Blood, dann an der Kearney. Sie hatte sie jeden Samstagabend in der Kirche gesehen, und manchmal hatten sie nach der Schule im Bus zusammen Hausaufgaben gemacht, aber besonders eng waren sie nie gewesen, nie mehr als zwei Mädchen, die ein paar Häuser voneinander entfernt wohnten. Aber nett war Stephanie. Sie trug immer ein zu großes Mark-Messier-Trikot. Vielleicht würde sie einfach an Stephanies Tür klopfen und fragen, ob sie noch da wohnte.
Alessandra nahm einen Hausschlüssel, küsste ihren Vater auf den Scheitel und ging die Straße hoch zu dem Haus, in dem Stephanie, wenn sie Glück hatte, immer noch wohnte. Wahrscheinlich war sie vor Jahren ausgezogen, aber das wusste man hier nie. Viele versackten bei ihren Eltern. Beängstigender Gedanke. Alessandra war erst ein paar Stunden zurück und würde schon jetzt am liebsten wieder Reißaus nehmen.
Alessandra ging durch den Vorgarten und klopfte an der Haustür. Auf dem Briefkasten stand immer noch Dirello.
»Wer ist da?«, fragte Stephanies Mutter und öffnete im selben Moment die Tür, als hätte sie darauf gewartet, dass jemand klopfte.
»Hallo, Mrs. Dirello, ich bin Alessandra Biagini. Erinnern Sie sich an mich? Ein paar Häuser die Straße hoch. Ich bin mit Stephanie zur Schule gegangen.«
»Es ist spät.«
»Tut mir leid. Aber es ist doch erst acht. Ich bin heute nach Hause gekommen und wollte mal schauen, ob Stephanie noch hier wohnt.«
»Natürlich wohnt sie hier. Wo sollte sie denn sonst wohnen?«
»Ja, tut mir leid, Mrs. Dirello. Dürfte ich mit ihr sprechen?«
Mrs. Dirello sah sie mit zusammengekniffenen Augen an. Sie trug einen Hausmantel, und Alessandra bemerkte die Leberflecke auf ihren Armen, die vielen kleinen braunen Muttermale, die wie verschrumpelte Würmer von ihrer Haut abstanden, und die Krampfadern, die wie Tattoos ihre Waden überzogen. »Wer bist du?«
»Alessandra, ich stamme aus derselben Straße. Erinnern Sie sich nicht an mich?«
»Stephanie!«, rief Mrs. Dirello über die Schulter. Dann sagte sie zu Alessandra: »Du bleibst vor der Tür.«
»Okay«, sagte Alessandra. »Danke.«
»Willst du uns was andrehen? Ich brauch diese Schokoriegel nicht. Ich kauf meine Schokolade beim Sohn von Chinese Mary.«
»Ich verkaufe keine Schokolade.«
Stephanie tauchte hinter ihrer Mutter auf. Sie trug ein viel zu großes Sweatshirt und abgeschnittene Jeans. Sie sah noch genau wie früher aus, außer dass sie keine Zahnspange mehr trug. Ihre Haare standen ab und sie trug eine Billigbrille, wahrscheinlich aus der Eyeglas Factory in der West Twelfth. Den Damenbart hatte sie auch noch, sie hatte sich nie die Zeit genommen, die Härchen auszuzupfen oder mit Wachs zu entfernen. Vielleicht konnte Alessandra ihr helfen und ihr einen neuen Look verpassen. Vielleicht, vielleicht. »Hi Steph«, sagte Alessandra. »Lang ist’s her.«
»Alessandra?«, sagte Stephanie. »Wow. Was machst du denn hier?«
»Wahrscheinlich will sie uns was andrehen«, sagte Mrs. Dirello.
Stephanie schob sich an ihrer Mutter vorbei. »Lass uns einen Moment allein, Ma«, sagte sie. Schmollend verzog sich Mrs. Dirello und Stephanie öffnete die Tür ganz. »Du siehst toll aus, Alessandra. Wow. Du siehst echt wie eine Schauspielerin aus.«
»Danke. Du siehst auch gut aus. Hast dich kein bisschen verändert.«
Stephanie verdrehte die Augen. »Die Jungs rennen mir die Bude ein, ich werd sie gar nicht mehr los.«
Alessandra lachte. Sie hatte ganz vergessen, wie lustig Stephanie sein konnte. Und dieser Akzent. Mann, Alessandra war froh, ihren verloren zu haben. Er hörte sich derb an. »Ich bin heute erst angekommen. War eine Ewigkeit nicht mehr da.«
»Deine Mutter«, sagte Stephanie. »Mein Beileid.«
»Danke.«
»Ständig hat sie von dir geredet. Ich hab sie im Laden gesehen, wo ich arbeite, wenn sie das Blutdruckmittel für deinen Vater geholt hat, und sie hat ständig von dir geredet. ›Alessandra spielt in dem Film hier mit und ist in der Werbung da zu sehen.‹ Sie war so stolz auf dich. Sie war echt ’ne Nummer. Hat mit ihrem Einkaufswagen alle Leute aus dem Weg gescheucht.«
»Ja, ich vermisse sie sehr. Ich hab sie zwar nicht mehr gesehen, aber wir haben viel telefoniert.«
Stephanie senkte die Stimme. »Meine Mutter ist total bekloppt. Sie kommt nicht mehr aus dem Haus. Dreht echt am Rad.«
Alessandra zuckte mit den Achseln. »Hast du Lust, mit mir was trinken zu gehen?«
»Ich trinke eigentlich nicht.«
»Dann leistest du mir eben Gesellschaft. Ich muss was trinken und du musst mir erzählen, was hier so passiert ist.«
»Wohin willst du?«
»Besonders groß ist die Auswahl ja wohl nicht. Wrong Number?«
»Wow«, sagte Stephanie. »Ich geh nur schnell hoch und zieh mich um. Komm rein und setz dich.«
»Ich warte lieber draußen«, sagte Alessandra.