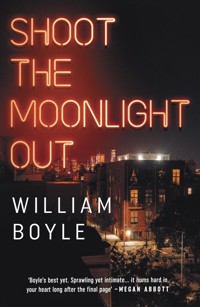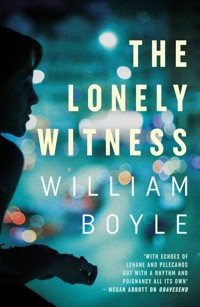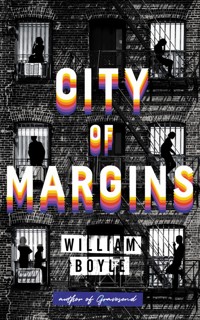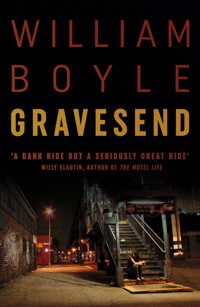15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Polar Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Amy Falconettis Leben könnte so einfach sein, seitdem ihre ihre Freundin Alessandra nach Los Angeles weitergezogen ist und sie verlassen hat. Ihre Bartending- und Party-Tage hat sie hinter sich gelassen lebt in einer Souterrain-Wohnung und geht ganz in der Arbeit für die Kirche auf, indem sie alten Menschen betreut, die die Kommunion Zuhause in Anfang nehmen müssen. Wäre da nicht dieser Mord, den sie mit angesehen hat und nicht nur das, sie hat auch die Tatwaffe entwenden und sie gesäubert. Seitdem fühlt sie sich verfolgt. Als auch noch Alessandra und ihr verschollener Vater wieder in ihren Leben auftauchen, ist es vorbei mit dem Glauben daran, dass sie einfach nur ihr Leben zu wechseln braucht, um mehr Ruhe und Zufriedenheit zu finden. Schließlich gibt es da auch noch einen Mörder und eine Zeugin, die lieber nicht die Polizei gerufen, sich vielmehr daran berauscht hat, eine Mitwisserin zu sein. Nicht genug, als der Mörder sie findet, macht er ihr ein Angebot, dass sie nicht abschlagen will.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
William Boyle
Einsame Zeugin
Kriminalroman
Aus dem Amerikanischen von Andrea StumpfHerausgegeben von Wolfgang Franßen
Copyright by William Boyle 2018Originaltitel: The Lonely WitnessFirst published by PEGASUS BOOKS
Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage 2019
Aus dem Amerikanischen von Andrea Stumpf
© 2019 Polar Verlag Stuttgart e.K.
www.polar-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) oder unter Verwendung elektronischer Systeme ohne schriftliche Genehmigung des Verlags verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Sven Koch, Gariele Wehrbeck
Umschlaggestaltung: Robert Neth, Britta Kuhlmann
Coverfoto @ tony/adobestock
Autorenfoto: © Katie Farrell Boyle
Satz/Layout: Martina Stolzmann
Gesetzt aus Adobe Garamond PostScript, InDesign
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck, Deutschland
ISBN: 978-3-945133-81-1eISBN 978-3-945133-82-8
Für Katie Farrell Boyle. Das Leben an deiner Seite ist wunderbar.
Ich kenne die Akkorde nicht. Sie ändern sich dauernd.Nick Cave in One More Time with Feeling
Bei uns hier geht es nicht darum, die Wahrheit zu finden,sondern zu entscheiden, mit welcher Lüge es sich besser leben lässt.Flannery O’Connor, The Habit of Being: Letters
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Epilog
Danksagung
Kapitel 1
Als Mrs. Epifanio die Tür öffnet, weiß Amy sofort, dass irgendetwas nicht stimmt. Vor dem ersten Besuch ein paar Monate zuvor hatte Monsignore Ricciardi Amy gewarnt, dass Mrs. Epifanio gelegentlich unter Demenzschüben leidet und an manchen Tagen wahrscheinlich sehr verwirrt wirkt und nicht weiß, wo sie ist, welches Jahr geschrieben wird und wo oben und unten ist. Aber solche Ausfälle hat Amy nur ein, zwei Mal bemerkt. Vormittags ist Mrs. Epifanio fast immer aufgeweckt und fröhlich. Zwar sind ihre Schultern gebeugt, doch mit den rosa gefärbten, trotz der Haarklemmen zerzausten Haaren und der verwegen vom Hals baumelnden und am Steg mit Klebeband geflickten Brille steht sie für eine Neunzigjährige flott da.
Anders als sonst trägt sie heute eine Kittelschürze. Normalerweise macht sie sich mit einer geblümten Bluse und langen Hosen für die Kommunion schick. Ihr Blick ist zittrig, so als wäre sie den Tränen nahe, wobei man das bei alten Frauen nie so genau weiß. Sie wirft einen Blick über Amys Schulter und sieht die Straße rauf und runter.
»Geht’s gut, Mrs. E?«, fragt Amy.
»Nein, gar nicht«, sagt Mrs. Epifanio.
»Was ist los?«
»Du kennst doch Diane, die Frau von der Kirche, die mich viermal in der Woche besucht?«
»Ja, vom Sehen.«
»An ihrer Stelle ist gestern und vorgestern ihr Sohn gekommen. Vincent heißt er. Ein widerlicher Mensch. Ich sitz am Küchentisch, spiel Solitär und ess, was mir Meals on Wheels gebracht hat, und er geht einfach in mein Schlafzimmer und kramt rum. Ich ruf ihm hinterher, dass ich die Polizei hole. Worauf er sagt: ›Regen Sie sich ab, ich räum nur ein bisschen auf, Mrs. E‹, so als wären wir beste Freunde.«
»Echt?«, fragt Amy.
»Wenn ich’s doch sage.«
»Vielleicht haben Sie es nur geträumt.«
»Nie im Leben.«
»Was sagt Diane dazu?«
»Sie hat Grippe, hat er gesagt. Ich erreich sie nicht.«
»Um wie viel Uhr besucht sie Sie normalerweise?«
»Zehn.«
»Haben Sie Angst, dass er wiederkommt?«
»Ja.«
»Wie wär’s, wenn ich hierbleibe und mit ihm rede?«
»Ach, das wär nett. Danke, meine Liebe.« Mrs. Epifanio wirkt erleichtert.
Amy deutet auf ihre Tasche. »Ich hab Ihnen die Kommunion mitgebracht.«
»Komm rein, komm nur rein«, sagt Mrs. Epifanio. Sie zeigt den engen Flur hinunter, an dessen Ende sich die Tür zu einer kleinen Küche befindet.
Amy tritt ein.
»Ich hab gerade meinen Enkel Rob angerufen und ihm alles von dir erzählt«, sagt Mrs. Epifanio.
»Ist das Elaines Sohn?«
»Ja, genau der. Sie leben drüben in Metuchen. Angeblich will er mich Sonntag besuchen, mal sehen. ›Amy Falconetti‹, sag ich zu ihm. ›Ist eigentlich aus Flushing. Sie bringt mir die Kommunion. So ein nettes Mädchen. Hübsch. Dunkle Haare. Lauter Tattoos, genau wie du‹, sag ich zu ihm.«
»Da werd ich ja rot.«
Kurz fragt sich Amy, woher Mrs. Epifanio das mit den Tattoos weiß. Sie sind auf ihrem Rücken und ihren Oberschenkeln, Erinnerungen an ihr früheres Leben. Vermutlich hat es sich herumgesprochen. Jemand hat sie zufällig im Sommer in Tanktop und Shorts gesehen und es rumerzählt. Sie schämt sich nicht für ihre Tattoos und bereut auch nicht, dass sie sie sich stechen ließ. Es kommt ihr inzwischen nur so vor, als würden sie zu jemand anderem gehören. Ihre dunklen Haare sind ihr auch fremd. Schon seit ein paar Jahren färbt sie ihre blonden Haare kohlrabenschwarz, aber so ganz hat sie sich noch nicht daran gewöhnt. Manchmal erkennt sie sich selbst nicht im Spiegel. Aber irgendwie fand sie die Veränderung nötig.
»Das ist die reine Wahrheit. Du hättest Immacula sehen sollen, die mir vorher die Kommunion gebracht hat.« Mrs. Epifanio streckt die Arme wie ein Zombie von sich. »Eine lebende Tote. Ein bisschen Spaß hat noch niemand umgebracht, oder? Gut, es gibt Aufregenderes, als einer alten Frau, die nicht mehr aus dem Haus kann, die Kommunion zu bringen, aber deshalb muss man doch nicht immer so ein miesepetriges Gesicht ziehen. Tust du ja auch nicht.«
»Nett, dass Sie das sagen, Mrs. E«, sagt Amy. »Ich bemüh mich. Und ich freu mich immer, wenn ich Sie besuche.«
»Ich bin besser als die anderen, was?«
»Wen meinen Sie?«
»Na, die anderen alten Schachteln, die du besuchst.«
Amy lacht. »Sie sind spitze.«
Mittlerweile haben sie die Küche erreicht. Mrs. Epifanio setzt sich auf ihren gepolsterten Stuhl, Amy ihr gegenüber. Der Tisch ist bedeckt mit Rubbellosen, Kirchenblättchen aus den letzten Monaten, Sudoku-Heften, Rezepten, Werbebroschüren und Tablettenschachteln. Bei jedem Besuch sieht Amy das Foto an der Wand an: Mr. Epifanio als junger Mann, wie er mit einem Klemmbrett in der Hand in einem Subway-Tunnel steht. Amy weiß nicht genau, was er gearbeitet hat – es ist nicht leicht, Mrs. Epifanio eine konkrete Antwort auf eine Frage zu entlocken –, aber sie vermutet, dass er bei der Metropolitan Transport Authority war. Er ist 1986 gestorben, gleich nachdem die Mets die World Series gewonnen hatten, was Amy nie vergessen wird, weil sie damals in der Ersten war und ganz Queens ausflippte. Das ist mehr als dreißig Jahre her. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
Amy hört Mrs. Epifanio gerne zu, wenn sie von ihrem Mann erzählt. Die meisten Geschichten handeln davon, dass er irgendeinen Unsinn in einer Kneipe angestellt oder die ganze Nacht mit einem Schrotgewehr eine kleine Maus gejagt hat.
»Kommen Sie mit den Tabletten zurecht, Mrs. E?«, fragt Amy.
»Meine Tabletten«, sagt Mrs. Epifanio und winkt ab. »Wer weiß das schon? Der Kopf will nicht mehr wie der Rest und umgekehrt.«
»Kommt die Pflegerin noch?«
Mrs. Epifanio lässt das Kinn auf die Brust sinken. »Ja. Aber verstehen tu ich sie mit ihrem russischen Akzent nicht.«
Amy ergreift die Gelegenheit, Mrs. Epifanio die Kommunion zu reichen. Eigentlich soll sie sich nicht unterhalten, bis das Gemeindemitglied die Kommunion empfangen hat, aber das ist fast nicht durchzuhalten, besonders bei Mrs. Epifanio, die sich über ein bisschen Gesellschaft freut. Wie bei allen einsamen Witwen vollzieht Amy die abgekürzte Zeremonie. Sie holt die Bibel, das Kreuz, die Kerze und das weiße Tuch aus ihrer Tasche. Dann beten sie.
Wie sie sich für den Kirchendienst anzieht – blaue Hose, weiße Bluse –, hat so gar nichts mit ihrem früheren Stil zu tun. Jahrelang hat sie ein ziemlich striktes Modediktat befolgt: Rockabilly-Frisur, manchmal mit Tuch in den Haaren, dazu Bleistiftrock oder Tellerrock, Caprihose oder Marlenehose, eine kurzärmlige Bluse, ein rückenfreies Top oder ein Vintage-Pulli oder auch ein Sarong-Kleid. Ausschließlich in Rot, Weiß, Schwarz und Marineblau, mit Punkten, Streifen, Leopardenmuster oder Karos. An Motiven waren Kirschen, Totenschädel, Anker, Hufeisen, Würfel, Schleifen und Pin-up-Girls erlaubt. Als Schuhe Ballerinas oder Pumps. Sie sah immer so aus, als wäre sie auf dem Weg zu einem Social-Distortion-Konzert oder wäre Komparsin in einem Film von John Waters.
Inzwischen blitzen Bilder aus ihrem früheren Leben – eigentlich waren es ja mehrere – nur noch manchmal auf, verschwommene Erinnerungen an Bars, Musik, Tattoos, Saufereien, Frauen. Mit Merrill, ihrer abgestürzten Punker-Freundin, die die Krätze und einen fiesen Köter an einer zerfransten Leine hatte, wurde alles noch düsterer. Dann lernte Amy in der Seven Bar, in der sie jahrelang gearbeitet hat, Alessandra kennen und zog mit ihr nach Brooklyn, genauer gesagt nach Gravesend. Das war vor fünf Jahren. Eigentlich hat Alessandra das Viertel, aus dem sie stammte, von jeher gehasst und wollte immer weg. Gleichzeitig hatte sie ein schlechtes Gewissen, weil sie nach der Highschool nach Los Angeles abgehauen war, um Schauspielerin zu werden, und selbst dann nicht heimgekommen war, als ihre Mutter Krebs bekam und starb. Erst danach beschloss sie, zurückzukommen und sich eine Zeitlang um ihren Vater zu kümmern. Wie fast immer bei Alessandra hatte der Entschluss eher mit einem Wunschbild von sich zu tun als mit der Person, die sie wirklich war.
Eine Weile waren sie glücklich. Amy fuhr mit der Subway in die City und stellte sich hinter den Tresen der Seven Bar, während Alessandra ihrem Vater half und sich hin und wieder beim Film etwas dazuverdiente. Als ihr Vater plötzlich an einer Lungenembolie starb, ließ sie Amy von einem Tag auf den anderen sitzen und ging nach Los Angeles zurück. Amy fiel in eine Depression. Sie überlegte, ob sie Alessandra nachreisen sollte, ließ es aber bleiben. Sie verkaufte ihre Plattensammlung, kündigte in der Seven Bar und aß von da an einsam und verlassen bei ihrem Lieblingschinesen, dem Liu’s Shanghai in der Bath Avenue. Sie blieb zurück. Das konnte sie, zurückbleiben.
Eines Tages hatte sie das Gefühl, dass ein Mann sie verfolgte, seit sie an der Station Bay Parkway aus der Subway gestiegen war, und flüchtete in die Kirche St. Mary. Sofort fühlte sie sich an die Kirche ihrer Kindheit in Queens erinnert. Die Organistin übte gerade. Sie war wunderschön. Sie hieß Katrya und kam aus der Ukraine. Amy fühlte sich in Sicherheit. Von da an ging sie jede Woche in die Kirche, was sie nicht mehr gemacht hatte, seit sie dreizehn war, kurz vor dem Tod ihrer Mutter.
Papst Franziskus war ihr sympathisch. Er schien alles Gute an der katholischen Kirche zu verkörpern. Sie beschloss, etwas Nützliches zu tun und zu helfen. Das andere, das Nichthelfen, hatte sie lange genug gemacht. Sie wurde Kirchendienerin und fing an, alte Leute zu besuchen und ihnen die Kommunion zu bringen, meistens alten Frauen wie Mrs. Epifanio. Jetzt lässt sie sich Geschichten erzählen und heitert sie auf. Es freut sie, dass man sie für so jung hält, wo sie doch schon Mitte dreißig ist und sich langsam alt fühlt.
Nach dem Empfang der Kommunion schließt Mrs. Epifanio die Augen zum stillen Gebet. Sie bekreuzigt sich, dann entfernt sie mit einem Zahnstocher ein Stückchen Oblate aus ihrem Gebiss.
Als sie fertig sind, sagt Mrs. Epifanio: »Möchtest du was trinken? Kaffee? Ich hab auch leckere Sesamkekse. Und gute Brötchen. Außerdem hab ich mindestens hundert von diesen kleinen Orangensaftpackungen von Meals on Wheels. Magst du Orangensaft? Nimm dir welche. Nimm alle. Ich mag keinen Orangensaft.«
»Nein danke, ich hab keinen Durst«, sagt Amy und sieht auf die Uhr. Zehn vor zehn. Diane – oder ihr Sohn – wird bald auftauchen. Amy fragt sich, ob Mrs. Epifanio sich das alles ausdenkt. Wenn Amy ehrlich ist, rechnet sie damit, dass Diane kommt, und wenn sie sie nach Vincent fragt, wird es überhaupt keinen Vincent geben.
»Ich bild mir das nicht ein«, sagt Mrs. Epifanio, als könnte sie Gedanken lesen.
»Nein, natürlich nicht«, sagt Amy.
»Schade, dass Vincent so widerlich ist. Er hat ungefähr dein Alter.«
Viele alte Frauen wollen sie unbedingt mit ihren Enkeln, Neffen, Nachbarn oder sonst wem verkuppeln. Amy wimmelt sie ab. Bei den meisten hätte es keinen Sinn, ihnen die Wahrheit zu sagen. Einer Neunzigjährigen, die ihr ganzes Leben nichts anderes kannte als Vater, Mutter, Kind, kann man so was nicht erklären.
»Hört sich nicht danach an, als wär er mein Typ«, sagt sie zu Mrs. Epifanio.
»Er hat gemeine Augen.«
»Ich weiß nicht, Mrs. E. Vielleicht hatten Sie ja doch nur einen schlechten Traum.«
»Du wirst schon sehen.«
Ein paar Minuten später geht die Tür auf. Das muss er sein. Sie sieht Vincent hereinkommen. Er hat einen Schlüssel. Er ist mindestens fünf Jahre jünger als sie, wahrscheinlich keine dreißig. Er ist dünn und hat gemeine dunkle Augen und dunkle Haare. Mit seinem schwarzen Trenchcoat sieht er aus wie einer dieser Columbine-Amokläufer aus den Neunzigern. Er hat ein unangenehmes Grinsen.
»Und wer bist du?«, fragt er, als er in die Küche kommt und sich ihr gegenüber an den Tisch setzt.
»Siehst du?«, sagt Mrs. Epifanio. »Ich hab’s doch gesagt.«
»Woher hast du den Schlüssel?«, fragt Amy Vincent.
»Von meiner Mom. Sie hat die Grippe und hat gesagt, ich soll Mrs. Epifanio besuchen, weil sie ausfällt.« Vincent deutet auf Mrs. Epifanio, als wäre sie blind oder ein Kleinkind, und hebt die Stimme an, als er sich an sie wendet. »Wie geht’s Ihnen heute, Mrs. E? Erinnern Sie sich noch an mich? Ich war die letzten zwei Tage hier. Ich bin Vincent.«
»Ach ne. Veräppeln kann ich mich selber«, sagt Mrs. Epifanio.
»Sie mag mich nicht besonders«, sagt er zu Amy.
»Mrs. Epifanio hat mir erzählt, dass sie deine Mutter angerufen hat und niemand drangegangen ist«, sagt Amy.
»Meine Mutter schafft’s nicht mal ausm Bett raus. Also, wer bist du?«
»Ich bin von der Kirche. Ich bringe Mrs. E die Kommunion.«
»Na, dann passt ja alles. Hast du eine von diesen kleinen Oblaten übrig? Ich kenn niemand außer mir, dem die Dinger als Kind geschmeckt haben. So wie wenn man die Achselhöhle von einer Nonne leckt. Hey, du bist nicht zufällig Nonne, oder?«
»Nein, ich bin nicht zufällig Nonne.«
»Wenn ich wissen will, ob du lügst, muss ich nur deine Achselhöhle lecken.« Wieder das Lächeln. Gelbe Zähne. Mundgeruch, den sie sogar aus der Entfernung riechen kann.
»In meinem Haus wird nicht so geredet«, sagt Mrs. Epifanio.
»Mrs. E braucht dich heute nicht«, sagt Amy. »Bis es deiner Mutter besser geht, werde ich sie besuchen.«
Vincent reibt die Hände aneinander, ohne etwas zu erwidern.
»Warst du in ihrem Schlafzimmer?«, fragt Amy.
Er seufzt, so als würde ihn die Fragerei ermüden. »Meine Mutter hat gesagt, ich soll da drin abstauben.«
»Mrs. E will das nicht.«
Vincent steht auf. »Hör mal, Lady. Ich hab echt Besseres zu tun. Ich tu meiner Mutter nur einen Gefallen, mehr nicht. Wenn’s dir nicht passt, dass ich hier bin, geh ich eben.«
»Lass den Schlüssel hier.«
»Ne. Der gehört meiner Mutter.«
»Es ist der Schlüssel von der Wohnung von Mrs. E.«
»Ich werd den Schlüssel ganz sicher nicht dalassen.« Vincent macht einen Schritt den Flur hinunter, dann dreht er sich noch mal um. »Ich weiß nicht, was der Scheiß soll. Da will man mal nett sein und wird behandelt wie ein Verbrecher. Meine Mutter wird ziemlich sauer sein, wenn ich ihr das erzähle.« Er geht hinaus, ohne die Haustür ins Schloss zu ziehen.
Amy steht auf und drückt die Tür zu. »Himmel«, sagt sie, als sie zurück zum Tisch geht und sich wieder setzt. Seit einiger Zeit versucht sie sich das Fluchen abzugewöhnen.
»Und, hab ich’s nicht gesagt?«, sagt Mrs. Epifanio.
»Vielleicht sollten wir die Polizei rufen.«
»Die tun doch sowieso nichts.«
»Es gefällt mir nicht, dass er den Schlüssel hat.«
»Mir auch nicht.«
»Ich bleib noch ein bisschen. Wir denken uns was aus. Haben Sie die Nummer von Diane bei der Hand? Dann können wir’s noch mal bei ihr versuchen.«
Mrs. Epifanio stützt sich auf die Armlehnen und stemmt sich hoch. Langsam schlurft sie zur Vorratskammer in der Ecke hinter dem Kühlschrank und kehrt mit einem uralten grünen Adressbuch zurück. »Da drin steht irgendwo ihre Telefonnummer«, sagt sie. Auf dem Weg zurück bleibt sie beim Kühlschrank stehen, holt ein paar kleine Orangensaftpackungen heraus und drückt sie sich an die Brust. Als sie wieder am Tisch ist, schiebt sie das Adressbuch und den Orangensaft zu Amy. »Trink«, sagt Mrs. Epifanio.
»Danke, aber ich hab keinen Durst«, sagt Amy. »Ehrlich. Danke.«
»Jetzt trink schon.«
»Gut, ein bisschen.« Amy blättert durch das Adressbuch, geht die vergilbten Seiten mit Mrs. Epifanios Krakelschrift durch. Viele Namen, Adressen und Telefonnummern sind ausgestrichen. In der Mitte steckt ein Stapel Trauerkarten.
»Neun von zehn Leuten da drin sind tot«, sagt Mrs. Epifanio.
»Traurig«, erwidert Amy.
»Traurig wär’s, wenn ich im Adressbuch von jemand steh und der streicht mich aus, wenn ich krepier, so wie ich ihn ausstreich, wenn er krepiert.« Mrs. Epifanio lacht.
»Wie heißt Diane mit Nachnamen?«
Mrs. Epifanio reibt sich übers Kinn. »Ja, wie heißt sie? Ich nenne sie eigentlich immer nur Diane. Grasso? Nein. Das ist ihre Nachbarin Edna … Marchetti. Sie heißt Marchetti. Genau wie meine Cousine Janet.«
Amy findet Dianes Nummer in der letzten Spalte der Seite unter M. Sie geht zu dem Wählscheibentelefon an der Wand, wählt und lässt es zehnmal klingeln, dann hängt sie ein. »Nichts«, sagt sie. »Einen kurzen Moment hatte ich Angst, Vincent hebt ab.«
»Ich freu mich, dass du da bist, Amy. Ehrlich.«
Amy geht den Flur hinunter und linst durch den Vorhang am Fenster in der Haustür. Vincent steht vor dem Apartmenthaus auf der anderen Straßenseite, pafft an seiner E-Zigarette und geht umhüllt von einer Dampfwolke auf und ab. Er scheint ein Selbstgespräch zu führen.
Sie geht zum Telefon zurück und ruft im Pfarrhaus an. Dort gibt sie Connie Giacchino, der Sekretärin, Bescheid, dass sie an diesem Tag keine weiteren Hausbesuche machen kann. Mrs. Epifanio bräuchte ihre Hilfe. Connie sagt, dass Monsignore Ricciardi das sicher versteht und Immacula sich vielleicht bereit erklärt, sie zu vertreten. Amy dankt ihr und kehrt an den Tisch zurück.
»Ich hol die Karten«, sagt Mrs. Epifanio. »Wir können Rommé spielen.«
»Gute Idee.«
Irgendwas an Vincent macht Amy nervös. Er erinnert sie an jemanden. In ihrem letzten Highschool-Jahr, als sie noch bei ihren Großeltern wohnte, sah sie von ihrem Fenster aus, wie ihr Nachbar Bob Tully in der Einfahrt einen Mann erwürgte und in seine Garage schleifte. Das Gesicht des Mannes war rot, seine Augen traten hervor und er rang um Atem. Bob Tully hatte Riesenpranken. Er war stiernackig und wirkte brutal und verschlagen. Amy beobachtete ihn oft von ihrem Fenster, weil sie angefangen hatte zu rauchen und von dort den Rauch zur Feuertreppe hinausblies. Als er den Mann in die Garage schleifte, blickte er zu ihr hoch und lächelte. Sah er wirklich wie Vincent aus oder verschwammen beide Gesichter nur in ihrem Kopf?
Damals kam ihr Bob Tully alt vor, aber er konnte nicht älter als achtundzwanzig, neunundzwanzig gewesen sein. Sie rief nicht die Cops und auch ihren Großeltern sagte sie nichts. Sie ließ die Jalousien runter und fragte sich, ob sie tatsächlich gesehen hatte, was sie glaubte, gesehen zu haben. Als sie am nächsten Tag zur Schule aufbrach, trat Bob Tully aus dem Haus. Er schälte mit einem Taschenmesser einen Apfel, lächelte, sagte, dass sie sich täuschte, dass sie nichts gesehen hatte und das Ganze einfach vergessen sollte. Wenn nicht, würde sie Probleme kriegen, weil Mädchen, die ihre Klappe nicht hielten, oft am nächsten Baum endeten. Er hielt ihr das Messer unter die Nase. Den Anblick seines Daumens auf dem Messer würde sie nie vergessen. Danach sah sie Bob Tully oft. Er winkte ihr von der Treppe aus zu. Je stiller sie war, desto freundlicher wurde er.
Eines Tages folgte sie ihm von der Werkstatt, in der er arbeitete, zu einer Kneipe, in der er was trank, und dann zum Haus seiner Freundin. Sie suchte in Zeitungen nach Meldungen, dass jemand vermisst wurde – ein Ehemann, ein Sohn. Nichts. Nie erfuhr sie, wen Bob Tully erwürgt hatte. Vielleicht hatte sie es sich ja doch eingebildet, dachte sie. Aber sie folgte Bob Tully weiter. Bis sie sich irgendwann darauf freute. Sie fragte sich, ob er wusste, dass sie ihm folgte. Die katholische Schule war langweilig. Die Nonnen waren langweilig. Ihre Großeltern waren langweilig. Rauchen war langweilig. Sie war nicht sicher, ob sie Bob Tully in der Hoffnung verfolgte, er würde wieder etwas Schreckliches tun oder verhaftet werden oder dass jemand kam und für den Mann Rache nahm, den er getötet hatte.
Nach ihrem Highschool-Abschluss, mit neunzehn, als Amy in einer Bäckerei in der Nachbarschaft arbeitete und überlegte, wie sie es aus Queens schaffen könnte, war Bob Tully im Vollrausch in einen Obstlaster geknallt. Sie hatte den Unfall nicht gesehen, aber es wurde ihr erzählt. Über die ganze Straße verstreut lagen Bananen und Äpfel, und Bob Tully war mit Vollkaracho durch die Windschutzscheibe gesegelt und vor einem Friseursalon auf dem Bürgersteig gelandet.
Er konnte Vincent wohl doch nicht so ähnlich gesehen haben, wie Amy gemeint hatte.
Kapitel 2
Eine Dreiviertelstunde später steht Vincent immer noch auf der anderen Straßenseite. Amy nimmt an, dass er auf sie wartet, um sie zur Rede zu stellen. Aber vielleicht ist er auch so dämlich zu glauben, sie würde ihn nicht bemerken, wenn sie von Mrs. Epifanio weggeht. Inzwischen sieht er, so linkisch, wie er dasteht, Bob Tully immer weniger ähnlich.
Am liebsten würde sie Hilfe rufen. Aber sie kennt kaum jemanden hier. Es sagt viel, dass ihr außer Monsignore Ricciardi, Connie Giacchino und ihrem Vermieter Mr. Pezzolanti niemand einfällt.
Zurück in der Küche berichtet Amy Mrs. Epifanio, dass Vincent immer noch draußen steht.
»Unheimlich, was?«, sagt Mrs. Epifanio.
»Kann ich jemanden anrufen? Vielleicht Elaine?«
»Elaine stören wir lieber nicht.«
»Ich mach mir Sorgen, Mrs. E. Er hat Ihren Hausschlüssel, und wenn ich gehe, kann er einfach hier reinspazieren. Und irgendwann muss ich gehen.«
»Ich weiß.«
»Ich werd rausgehen und mit ihm reden.«
»Sei vorsichtig.«
Amy lässt ihre Tasche in der Küche und geht hinaus. Es ist seltsam, aus der Enge des Hauses ins Freie zu treten. Es scheint wärmer geworden zu sein. Ungewöhnlich warm. Von Winter kann man in diesem Winter sowieso nicht reden. Überrascht stellt sie fest, dass Vincent verschwunden ist. Sie sieht sich um, kann ihn aber nirgends entdecken. Die Bay Thirty-Seven gleicht vielen Straßen in der Gegend: Rechts und links von dem alten grünen Holzhaus Neubauten mit Eigentumswohnungen, gegenüber ein Wohnblock, viele weitere kleinere Häuser. Die Stadt hat spirrelige Bäume gesetzt, an denen traurige weiße Etiketten baumeln, und sie kräftig gemulcht. An einem Februarvormittag wie heute, wenn die Kinder in der Schule sind, hört man die Busse in der Bath Avenue und das Klicken der Ampeln. Sie geht zum Gartentürchen. Vincent hat es offen gelassen und es ragt auf den Bürgersteig. Sie zieht es zu, verriegelt es und sieht sich ein letztes Mal nach Vincent um.
Zurück im Haus sagt sie Mrs. Epifanio, dass er weg ist.
»Sehr gut«, sagt sie.
»Aber ich bin mir nicht sicher, ob er nicht wiederkommt. Ich lasse Ihnen sicherheitshalber meine Nummer da.« Sie zieht ihr altes Samsung-Klapphandy aus der Tasche. Sie ist einer der wenigen Menschen, die sie kennt, die kein Smartphone besitzen. Man kriegt solche Handys eigentlich kaum noch, aber für Alte und Technikfeinde wie Amy führen die Läden noch welche im Sortiment. »Sie können mich jederzeit anrufen, Tag und Nacht. Geben Sie Bescheid, wenn er zurückkommt. Ich wohne ja nur ein paar Straßen weiter.«
»Das ist sehr nett von dir.«
Amy entdeckt einen Notizblock und einen schwarzen Filzstift und schreibt ihren Namen und die Nummer in Druckbuchstaben darauf. »Soll ich den Zettel auf den Tisch legen oder an den Kühlschrank hängen?«
»Auf dem Tisch ist gut.«
»Okay. Haben Sie sich ein bisschen beruhigt?«
»Ja.«
»Hat Vincent etwas aus Ihrem Schlafzimmer mitgenommen?«
»Nicht dass ich wüsste.«
»Haben Sie in den Schubladen nachgesehen?«
»Ich glaube, es fehlt nichts.«
Amy geht noch mal ins Schlafzimmer. Es ist dunkel. Sie tastet an der Wand neben der Tür nach dem Lichtschalter und erspürt einen Drehknopf. In einem Messingkronleuchter leuchten drei Glühbirnen auf. Die Einrichtung stammt aus einer anderen Zeit. Ein Bett mit einer Chenilledecke aus den Fünfzigern. Blumengirlanden. Fransen. Zierdeckchen. Amy blickt zur Decke. Rauputz. Neben ihr an der Wand ein schlichtes goldenes Kreuz. Darunter eine alte Singer mit dem Originalnähmaschinentisch und dem Bänkchen davor. Sie fährt mit dem Finger über die schartige Platte. Gegenüber an der Wand eine ockerfarbene Kommode mit neun Schubladen, auf der ein gerahmtes Hochzeitsbild von Mr. und Mrs. Epifanio steht. Was Vincent hier gewollt haben könnte, ist ihr ein Rätsel. Auf dem Bett scheint seit Jahren niemand auch nur gesessen zu haben. Sie weiß, dass Mrs. Epifanio wie viele ihrer alten Leute auf dem Sessel im Wohnzimmer vor dem laufenden Fernseher schläft.
Sie überlegt, ob sie in den Schubladen nachsehen soll, lässt es aber bleiben. Sie wüsste gar nicht, was fehlen könnte. Hoffentlich hat Mrs. Epifanio keine Geldumschläge darin versteckt – auch das machen viele Alte – und es nur vergessen. Mrs. DiPaola zum Beispiel hat Amy nach der Kommunion einmal gebeten, in den Keller zu gehen und ihre Wäsche aufzuhängen. Auf dem Tisch neben der Waschmaschine stand eine offene Zigarrenkiste, in der massenhaft Geld war. Mindestens zehntausend Dollar. Amy klappte die Kiste zu, hängte die Wäsche auf, ging hoch und sagte Mrs. DiPaola, dass es keine gute Idee sei, so viel Geld offen rumliegen zu lassen.
Sie setzt sich aufs Bett. Etwas erinnert sie an ihren Vater – die Zimmerdecke. Die Wohnung, in der ihr Vater wohnte, nachdem er sie und ihre Mutter verlassen hatte, hatte solche Decken. Nur zweimal war Amy dort, dann hörte er auf, sie fürs Wochenende abzuholen. Sie war zwölf. Im Jahr darauf starb ihre Mutter. Deshalb zog sie zu ihren Großeltern in das Haus neben Bob Tully. Ihr Vater hat sich nie mehr bei ihr gemeldet. Er zog aus Queens weg nach Poughkeepsie. Später fand ihre Großmutter heraus, dass er sich in Kingston und Hudson und ganz Upstate herumtrieb. Aber an die Decken in der Wohnung in Pomonok erinnert sie sich. Sie erinnert sich, wie sie sie angestarrt hat, während er den Abend in der Kneipe verbrachte.
Sie steht auf und streicht den Bettüberwurf glatt.
Mittlerweile hat Mrs. Epifanio in der Küche ein groß gedrucktes Sudoku-Buch aufgeschlagen und knobelt an einem Rätsel.
»Hab nichts Ungewöhnliches bemerkt«, sagt Amy, als sie sich wieder an den Tisch setzt. »Vielleicht probier ich’s noch mal bei Diane.« Mit dem Adressbuch in der Hand wählt sie gleich von ihrem Handy aus, nachdem es schon da liegt, außerdem nervt sie die Wählscheibe des Wandtelefons. Sie lässt es sechsmal klingeln und will schon auflegen, da hebt jemand ab, ohne etwas zu sagen. »Diane?«
»Diane ist krank«, sagt eine Männerstimme. Vincent.
Amy unterbricht die Verbindung und klappt das Handy zu. Augenblicklich bereut sie, unter ihrer Nummer angerufen zu haben. »Es war Vincent«, sagt sie zu Mrs. Epifanio.
Mrs. Epifanio schüttelt den Kopf und senkt ihren Blick. »Ich hoffe nur, dass er seine Mutter nicht umgebracht hat. Wäre nicht der Erste, der heimgeht, um die eigene Mutter auszurauben. Weil die Mutter nichts hat, was man stehlen kann, liegt sie am Ende mit durchgeschnittener Kehle im Bad. Arme Diane.«
»Mrs. E! Sie glauben doch nicht, dass er das getan hat?«
»Wer weiß das heutzutage noch? Die Alten gelten ja nichts mehr.«
»Wo wohnt Diane?«
»Im ersten Stock von dem Backsteinhaus gegenüber von dem Haus mit den Löwen vor der Tür.«
»Das kenn ich.«
»Giorgio Gianfortune. Ihm gehört der Fischladen. Hält sich für Wunder was.«
»Dann werde ich dort mal vorbeischauen.«
»Hältst du das für eine gute Idee?«
»Ich will nur schauen, ob mir etwas auffällt.«
Amy nimmt ihre Tasche und sagt Mrs. Epifanio, dass sie die Küchentür absperren soll. Die Wohnung im ersten Stock steht leer – Mrs. Epifanio vermietet sie seit dem Tod ihres Mannes nicht mehr –, weshalb die Küchentür ein eigenes Schloss hat. Amy ist froh darüber. Mrs. Epifanio verspricht es ihr. Noch einmal deutet Amy auf ihre Telefonnummer und sagt Mrs. Epifanio, sie könne jederzeit anrufen. Wirklich. Dann sagt sie noch, wenn Vincent zurückkommt und an der Tür klopft oder sonst etwas macht, solle Mrs. Epifanio unbedingt die Polizei rufen. Niemand darf ungebeten in ihr Haus kommen, egal warum.
Amy geht in den Flur und wartet, dass Mrs. Epifanio die Küchentür schließt und verriegelt. Mrs. Epifanio schlurft zur Tür und drückt mit der Schulter dagegen. Dann hört Amy, wie der Riegel vorgeschoben wird.
»Okay?«, fragt Mrs. Epifanio.
»Okay. Ich ruf Sie an, sobald ich bei Diane war.«
Das Haus mit den auffälligen Betonlöwen an der Einfahrt ist nur ein paar Blocks entfernt, in der Bay Thirty-Fourth zwischen der Bath und der Benson. Wahrscheinlich stehen solche Löwen auch vor anderen Häusern, aber sie weiß, dass Mrs. Epifanio dieses gemeint hat.
Amy bleibt auf Mrs. Epifanios Treppe stehen, dann geht sie langsam zum Gartentürchen und sieht sich nach Vincent um. Sie tritt auf den Bürgersteig, schließt das Türchen hinter sich, überquert die Straße und geht rechts in die Bath Avenue. In Augie’s Deli holt sie sich einen Kaffee. Sie fragt sich, ob Vincent auf dem Heimweg hier auch einen Halt eingelegt hat.
Zu dieser Tageszeit liegt die Bath Avenue ruhig da. Sie kommt an dem seit kurzem verwaisten Grundstück vorbei, wo einmal Flash Auto war. Als sie und Alessandra eine Zeitlang ein Auto hatten, hatten sie es hierher zum Reparieren gebracht. Das Auto hatte sie schnell genervt – Parkplatzsuche, Winter, Reparaturen. Alessandra war eine grauenvolle Fahrerin und Amy kaum besser. Sie ging sowieso lieber zu Fuß oder nahm den Bus oder die Subway, wenn sie in die City musste. Wenn sie Zeit hatte, konnte sie stundenlang gehen. Oft machte sie lange Spaziergänge nach Bay Ridge und Sunset Park, nach Coney Island und Brighton Beach und hörte Musik dabei. Zwar hatte sie ihre Plattensammlung verkauft, aber ihren Uralt-Walkman und ein paar Kassetten, die sie in der Highschool aufgenommen hatte, besaß sie noch. Liz Phair, Tori Amos, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Nirvana, Hole, Sonic Youth, L7, The Breeders. Zeug, das sie hörte, als sie aus dem Fenster rauchte. Vermutlich könnte sie für wenig Geld einen iPod Touch oder so etwas bekommen, aber sie mag den alten Sony-Walkman, der gut in der Hand liegt. Die Batteriefachabdeckung ist mit Klebeband befestigt, die Kopfhörerkabel sind steif. Aber er zickt nicht rum, und außerdem gefällt es ihr, die Kassetten umzudrehen. Es gefällt ihr, dass die Seiten die Zeit einteilen.
Sie wünschte, sie hätte ihn dabei. Stattdessen schleppt sie die Tasche mit den Kommunionssachen mit sich rum, die sie am liebsten in der Kirche abladen würde, weil sie sie beim Ausspähen von Dianes Wohnung nur stört. Hunderte möglicher Szenarien gehen ihr durch den Kopf. Was, wenn sie Vincent in die Arme läuft? Was, wenn er gerade das Haus verlässt und sie sieht? Was, wenn er sich beim Dampfen zum Fenster rauslehnt und sie beschimpft? Was, wenn er ihr die Cops auf den Hals hetzt? Officer, da steht eine Frau vor dem Haus und verhält sich verdächtig. Was, wenn sie Hinweise entdeckt, dass Diane umgebracht wurde?
Als sie in die Bay Thirty-Fourth Street biegt, hat sie Herzklopfen. Vor ihr schiebt eine alte Frau einen ratternden Einkaufswagen über den rissigen Bürgersteig. Die Frau sammelt leere Flaschen und Dosen. Vor jedem Haus bleibt sie stehen und durchwühlt die Mülltonnen. Sie trägt Gummihandschuhe. Amy grüßt sie beim Vorbeigehen.
Vor dem Haus mit den Löwen bleibt sie stehen, dreht sich um und schaut zu dem Backsteinhaus, das Mrs. Epifanio ihr beschrieben hat. Erster Stock, hat sie gesagt. Es ist ein kleines, gedrungenes Haus. Im ersten Stock drei Fenster mit heruntergelassenen Rollos zur Straße raus und im Erdgeschoss ein Erkerfenster. Auf dem Fensterbrett stehen Pflanzen, dazwischen sitzt eine weiße Katze. Nur eine Eingangstür für beide Wohnungen. Vorne ein kleiner Garten mit einer Statue des heiligen Franz von Assisi und einer Reihe Tomatenpflanzen. Der Zaun ist rot gestrichen, ein schiefes Schild mit der Aufschrift VORSICHT BISSIGER HUND ist mit einem Stück Draht am Gartentürchen befestigt.
Sie überlegt, dass es wahrscheinlich nicht schlau ist, einfach dazustehen, und geht die Straße ein paarmal auf und ab. Nichts tut sich. Müde lehnt sie sich an den Maschendrahtzaun eines Hauses ein Stück weiter und sieht zu Dianes Haus hinüber.
Ein paar Minuten später taucht Vincent dampfend daraus auf. Weil sie hinter einem parkenden Auto steht, bemerkt er sie nicht. Er geht auf der anderen Straßenseite Richtung Benson Avenue. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Zum Haus gehen, die Klingel des ersten Stocks drücken und warten, dass Diane aufmacht? Oder Vincent folgen? Er hat zwar die entgegengesetzte Richtung eingeschlagen, könnte aber trotzdem zu Mrs. Epifanio zurückgehen.
Kurz entschlossen folgt sie ihm, spürt denselben Nervenkitzel wie damals bei Bob Tully.
Vincent biegt unter der Hochbahntrasse nach links in die Eighty-Sixth Street. Er scheint tatsächlich nicht zu Mrs. Epifanio zurückzuwollen. Trotzdem folgt Amy ihm weiter in einem Abstand von einem halben Block. Mit demselben Abstand und immer wieder hinter Telefonmasten und Bäumen Schutz suchend hatte sie auch Bob Tully verfolgt.
Bei Grün überquert Vincent rasch die Eighty-Sixth Street. Die eine Hand hat er in der Tasche seines Trenchcoats und hält irgendetwas fest, in der anderen hält er seine E-Zigarette. Vor der HSBC an der Ecke Twenty-Third Avenue bleibt er stehen und nimmt einen Zug. Amy sieht zu dem Schnapsladen, wo sie mit Alessandra oft Wein und Gin gekauft hat. Nichts Bemerkenswertes daran. Seit Alessandra die Stadt verlassen hat, war sie nicht mehr dort. Sie trinkt fast nichts mehr.
Vincent geht an der Schule St. Peter Catholic Academy vorbei, die früher St. Mary hieß. Die Kirche, die wie seit über hundertfünfundzwanzig Jahren auch heute noch St. Mary Mother of Jesus heißt, liegt gleich am Ende des Blocks. Ein paar Häuser weiter wohnt Amy. Am liebsten würde sie aufgeben und einfach nach Hause gehen. Sie könnte die Kommunionssachen in der Kirche lassen und hätte den Rest des Tages für sich. Im Liu’s Shanghai zu Mittag essen. Mit Xiùlán reden. Lesen. Musik hören. Worauf sie gerade Lust hat.
Amy hat das Gefühl, dass das, was sie hier tut, etwas Endgültiges hat. Vielleicht ist es falsch, sich wieder so etwas anzugewöhnen. Dumm. Immerhin begibt sie sich dadurch vielleicht in Gefahr. Aber der Nervenkitzel treibt sie weiter. Seit Bob Tullys Tod und dem Beginn ihres eigenen Lebens mit der Wohnung in Queens und dem Job in der City vermisst sie das Gefühl, ein Ziel zu haben, das ihr die Verfolgung von Bob Tully gegeben hatte. Eine Zeitlang hat sie eine Domina gedatet, die wollte, dass Amy ihr bei ihren Treffen mit teigigen Geschäftsmännern zusah. Dann hat sie eine Trapezkünstlerin gedatet, die sich nur in der Luft lebendig fühlte und einmal betrunken auf die Brooklyn Bridge geklettert ist, während Amy darunter stand und sich beinah in die Hose pinkelte. Vincent ist ein Widerling, der bei schönstem Sonnenschein im Trenchcoat rumrennt und Mrs. Epifanios Schlafzimmer durchsucht. Diese Augen. Sie will verstehen, was in ihm vorgeht. Sie will wissen, wie sein Leben aussieht.
Von der Twenty-Third Avenue zur Stillwell und zum Kings Highway. Nicht ein einziges Mal sieht Vincent hinter sich. Sie erinnert sich, wie es geht, das Verfolgen. Es ist leicht, ihn im Blick zu behalten und dabei so weit zurückzubleiben, dass sie nicht auffällt. Bob Tully war mit gesenktem Kopf dahingeschlurft, aber Vincent läuft wie aufgezogen. Er wirft beim Gehen die Arme vor und zurück, springt über die Risse in den Bürgersteigen, zieht sein iPhone raus und stolpert, dann wieder bleibt er stehen und fotografiert eine Kritzelei an einem Telefonmast.
Auf dem Kings Highway zwischen West Ninth und West Tenth, aber näher an der West Tenth, verschwindet Vincent im Homestretch. Zweimal war Amy in der Kneipe gewesen, beide Male mit Alessandra. Damals war es eine miefige kleine Sportsbar mit Dartscheiben und einer Pferderennen-Wandmalerei, in der man Quick Draw spielen konnte. Bei einem ihrer samstagabendlichen Besuche gab es ein Ravioli-Büfett. Massenhaft alte, nörgelnde Stammgäste. Einer der Läden, von dessen Fassade Touristen, die sich in die Gegend verirren, Fotos schießen. Ein handgemaltes Kneipenschild: in Schönschrift HOMESTRETCH auf rotem Grund, darunter in Blockbuchstaben schwarz auf weiß BAR & GRILL. Auf der schwarzen Markise steht leicht verrutscht HOMESTRETCH BAR in Weiß, darunter ist auf einem weißen Streifen die Silhouette von Rennpferden zu sehen. Im Fenster hängt eine Budweiser-Leuchtschrift und von der Markise baumelt ein blau-oranges Quick-Draw-Fähnchen. Vor der Bar steht eine verlassene Bank. Links und rechts davon zwei Delis, darüber heruntergekommene Wohnungen mit verbeulten Klimaanlagen in den Fenstern.
Amy überquert den Kings Highway und die Quentin Road und bleibt an der Ecke zur West Tenth vor dem 3-Stars-Waschsalon stehen.
Die meisten Kneipen in der Gegend haben aufgegeben. Sie selbst geht kaum noch aus, aber sie und Alessandra haben oft nach einer Alternative zu den ewigen Pizzerien oder Chinesen gesucht. Alessandra hatte ihr vom Wrong Number erzählt, das jedoch schon dichtgemacht hatte, als Amy hierherzog. Von keiner der vielen Kneipen, die zu ihrer Zeit in der Gegend eröffnet und geschlossen worden waren, kann sie sich an den Namen erinnern. In der Eighty-Sixth Ecke Bay Thirty-Second befindet sich jetzt eine richtig gute georgische Bäckerei in einer ehemaligen Bar. Seit sie selbst keine Kneipen mehr besucht und auch nicht mehr in einer arbeitet, hat sie mehr oder weniger aufgehört, an sie zu denken.
Jedenfalls wird sie Vincent nicht hineinfolgen. Sie sieht auf ihrem Handy nach, wie viel Uhr es ist, und stellt erstaunt fest, dass es erst Mittag ist. Sie fragt sich, ob Vincent den ganzen Tag im Homestretch verbringen wird. Als sie in der Seven Bar arbeitete, gab es vereinzelte Stammgäste, die in der Mittagszeit kamen und blieben, bis um vier Uhr morgens geschlossen wurde. Wenn sie gedurft hätten, wären einige auch dann nicht gegangen. Ein paarmal war Amy so betrunken, dass sie die Tür verriegelte, und die letzten Gäste hielten die Party mit Saufen und Poolspielen am Laufen, bis alle in den Sitznischen schliefen. In einer solchen Nacht hat sie Merrill kennengelernt.
Sie kommt sich dumm vor, wie sie da so steht. Bei jedem vorbeifahrenden Auto denkt sie, die Insassen sehen sie misstrauisch an. Aus dem Waschsalon kommt eine Familie, bepackt mit Taschen voll frischer Wäsche, und mustert sie von Kopf bis Fuß. Ein bärtiger Mann mit losen Schnürsenkeln und einem Pappbecher heißem Kaffee in der Hand zwinkert ihr im Vorbeigehen zu und fragt: »Wie viel?« Sie sieht weg. Er lacht. Früher hätte sie ihn angeschnauzt, gefragt, was er denkt, mit wem er spricht. Früher. So etwas bringt nichts. Der Mann ist es nicht wert.
Wie lange soll sie hier stehen? Das ist die Frage. Bei Bob Tully hatte sie das Gefühl, es könnte jederzeit etwas passieren, aber Vincent kommt ihr langsam wie einer der Spinner vor, wie es sie zuhauf in der Stadt gibt, die nichts Besseres zu tun haben, als einer alten Frau Angst einzujagen. Außerdem hat sie sich verändert. Sie ist zu alt, um sich nur von ihrer Neugier treiben zu lassen.
Vincent tritt aus dem Homestretch und setzt sich dampfend auf die Bank. Ihm folgt ein Mann und nimmt neben ihm Platz. Der andere ist käsig, trägt rote Basketball-Shorts, die ihm bis zu den Knien hängen, Flip-Flops und ein Softball-Trikot mit schwarzen Ärmeln. Die beiden unterhalten sich. Vincent wirkt wütend. Amy versteht kein Wort. Sie dreht sich zum Waschsalon, weil sie genau in Vincents Blickrichtung steht, und lehnt sich gegen die Scheibe. Langsam tun ihre Füße weh. Sie sollte gehen. Aber sie ist wie festgeschraubt.
Vincent gestikuliert wild. Plötzlich steht er auf. Beinah erwartet Amy, dass er im nächsten Moment zuschlägt. Er tut es nicht. Stattdessen stürmt er zurück ins Homestretch. Der andere Mann folgt ihm.
Eine Dreiviertelstunde wartet Amy noch. Ein kleines Mädchen im Waschsalon zieht Grimassen. Amy rollt ihre Zunge und schielt dabei. Das Mädchen lacht. Amy beschließt, dass es Zeit ist zu gehen. Das kleine Mädchen hat sie an etwas erinnert. Vincent ist Zeitverschwendung. Ein Widerling, aber mehr auch nicht. Über einen Umweg geht sie zur Kirche. Ein paarmal dreht sie sich um, um sicherzugehen, dass ihr jetzt nicht Vincent folgt. Einmal glaubt sie ihn zu sehen, stellt aber fest, dass es ein anderer Mann ist, der ihm kein bisschen ähnlich sieht.
Kapitel 3
Amy bringt die Kommunionssachen zurück nach St. Mary und zündet auf dem Weg nach draußen eine Kerze an.
Mindestens einmal in der Woche zündet sie eine Kerze an, immer unter dem Kirchenfenster mit der heiligen Therese. Therese ist der Name, den sie sich für ihre Firmung ausgesucht hatte. Wenn man erwachsen wird und sich nicht mehr für die Kirche interessiert, vergisst man solche Sachen wie den Firmnamen.
Mit vollem Namen heißt sie Amy Lynn Therese Falconetti. Als Kind hat sie die heilige Therese, die kleine Blume, geliebt. Sämtliche Bücher, die es in der Bücherei über sie gab, hat sie verschlungen. Thereses Kindheit, wie jung sie war, als sie Nonne wurde. Ihre Jahre im Karmel von Lisieux. Ihr tragischer Tod mit vierundzwanzig durch Tuberkulose. Auch Thereses Autobiographie, Geschichte einer Seele, hat Amy gelesen. Von ihrer Mutter hatte sie zur Firmung ein Medaillon mit der heiligen Therese bekommen, das sie später im Wohnheim des Colleges verlor. Betrunken war sie mit einer Flasche Gin duschen gegangen, hatte es abgenommen und neben ihre Shampooflasche gelegt und dann auf der Ablage vergessen. Als es ihr am nächsten Morgen wieder einfiel, war das Medaillon weg. Ab und zu fragt sie sich, ob es das Medaillon noch gibt, ob es an jemands Hals hängt oder in einer Nachttischschublade liegt.
Nach der Geschichte mit Alessandra fand Amy zum Glauben zurück und da fiel ihr auch die heilige Therese wieder ein. Besonders was sie zur Wohltätigkeit sagte. Amy wurde klar, wie sehr sie ihr Leben eigennützigen, bedeutungslosen Dingen verschrieben hatte, und sie beschloss, das durch gute Taten wettzumachen. Sie war keine Heilige, klar, aber sie dachte, sie könnte ein bisschen Licht in das Leben anderer bringen: Besuche im Altenheim, Einkäufe für Leute erledigen, die ans Haus gefesselt sind, mit einsamen Menschen beten und reden.
Wie alle Heiligendarstellungen in den Fenstern von St. Mary ist die von der heiligen Therese ziemlich bunt. Der ursprüngliche Kirchenbau von 1889 brannte 1967 ab. Bald darauf wurde an derselben Stelle eine neue Kirche gebaut und 1971 geweiht. Der Bau mit glockenförmigem Grundriss, schmucklosem Altar und psychedelischen Fenstern ist typisch für diese Zeit. Die Kerzen flackern einsam vor sich hin. Jetzt ist die Kirche still und riecht nach Myrrhe. Weil die Gemeinde so stark geschrumpft ist, ist es hier eigentlich immer still. Noch leben alte Italiener in dem Pfarrbezirk, aber die neu Zugezogenen sind Chinesen, Russen und Mexikaner.
Beten fällt ihr nicht leicht. Amy weiß nie, wofür sie beten soll. Als sie sich vor die heilige Therese und die Kerzen kniet, merkt sie, dass ihr Vincent und Bob Tully durch den Kopf schwirren. Sie betet für Mrs. Epifanio und für Diane, für Vincent und Bob Tully und auch für den Mann, den er umgebracht hat. Beten ist etwas Seltsames.
Als sie wieder draußen ist, ruft sie die Anrufliste ihres Handys auf und versucht es noch mal bei Diane. Niemand geht dran. Mrs. Epifanios Nummer hat sie nicht gespeichert, aber sie kann sie auswendig und tippt sie. Mrs. Epifanio sagt, dass alles gut ist, dass sie wie ein Baby ein Mittagsschläfchen gehalten und keine Angst mehr hat. Amy sagt, dass sie das freut und dass Mrs. Epifanio sich melden soll, wenn sie etwas braucht.
Bis zu ihrer Wohnung sind es nur ein paar Schritte. Mr. Pezzolanti, ihr Vermieter, steht vor dem offenen Gartentürchen und blättert durch einen Werbeprospekt von Rite Aid, als sie eintrifft. Amy ist ihm dankbar. Er überlässt ihr die Souterrainwohnung in seinem geräumigen Haus für eine lächerlich kleine Miete. Vierhundert Dollar im Monat. Er ist regelmäßiger Kirchgänger. Früher kannte sie regelmäßige Kneipengänger, heute kennt sie regelmäßige Kirchgänger. Er ist ein netter Mann. Aufrichtig. Bei der Spätmesse am Samstag sammelt er die Kollekte. Für die Kirche zieht er ein Tweedjackett an, trimmt seine Nasenhaare und kämmt sich die Haare zurück. Heute hat er ein fadenscheiniges blaues Arbeitshemd, ein kariertes beretto, dunkle Hosen und Sandalen an. Auf seinen Schultern und Armen sind Leberflecken.