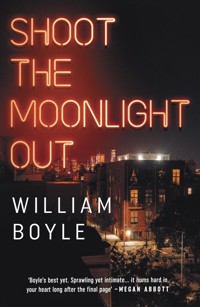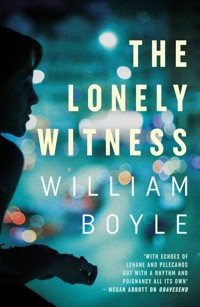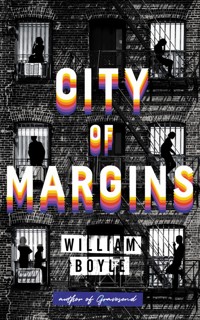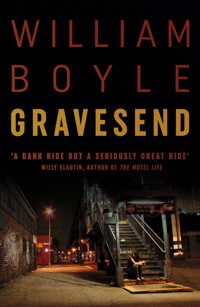21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Polar Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
William Boyle sagt über sich, er versuche, darüber zu schreiben, wie schlechte Menschen gute Dinge und gute Menschen schlechte Dinge tun. Sein neuer Roman "Shoot The Moonlight Out" beginnt im Juli 1996 im Süden Brooklyns und springt dann fünf Jahre voran, in den Sommer 2001. Kurz vor den Anschlägen vom 11. September, nach denen sich das Leben in New York für alle änderte. Der vierzehnjährige Bobby Santovasco wirft mit seinem Freund Zeke zum Zeitvertreib gerne Steine von einer Brücke auf Autos, die vom Belt Parkway fahren. Was als Wette beginnt, ob sie ein offenes Fenster treffen, führt zum Tod einer 19jährigen Fahrerin. Das tragische Ereignis schlägt Wellen in den Familien der Nachbarschaft. Jack Cornacchia, Witwer, Vater der toten Amalia, übt gerne Selbstjustiz und lässt sich von anderen dafür bezahlen. Bobbys und Jacks Wege kreuzen sich fünf Jahre später wieder, als Bobby plant, einen Safe auszurauben, um mit seiner Freundin aus Brooklyn abzuhauen. Ein literarischer Showdown.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
William Boyle
Shoot the Moonlight Out
Aus dem Amerikanischen von Andrea StumpfHerausgegeben von Wolfgang Franßen
Originaltitel: Shoot the Moonlight OutCopyright: © 2021 by William BoyleFirst Pegasus Books cloth edition November 2021
Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage 2023
Aus dem Amerikanischen von Andrea Stumpf
Mit einem Nachwort von Günther Grosser
© 2023 Polar Verlag e.K., Stuttgartwww.polar-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) oder unter Verwendung elektronischer Systeme ohne schriftliche Genehmigung des Verlags verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Gabriele Werbeck, Sven Koch
Umschlaggestaltung: Robert Neth, Britta Kuhlmann
Coverfoto: © Joseph Kirsch / Adobe Stock
Autorenfoto: © Katie Farrell Boyle
Satz/Layout: Martina Stolzmann
Gesetzt aus Adobe Garamond PostScript, InDesign
Druck und Bindung: CPI Books GmbH,Ulm, Deutschland
ISBN: 978-3-948392-77-2eISBN 978-3-948392-78-9
Für Eamon und Connolly JeanKeep the hoping machine running.
Shoot the moonlight outBaby, there ain’t no doubt’Cause tonight we’re gonnaShoot the moonlight out
Garland Jeffreys, »Shoot the Moonlight Out«
Anything you don’t seewill come back to haunt you.
Enid Dame, »Riding the D Train«
Inhalt
Südbrooklyn Juli 1996: Prolog
Bobby
Jack
Juni 2001: Teil 1
Charlie
Lily
Charlie
Jack
Bobby
Francesca
Teil 2
Lily
Francesca
Charlie
Jack
Bobby
Lily
Bobby
Jack
Francesca
Teil 3
Charlie
Jack
Francesca
Charlie
Lily
Bobby
Jack
Francesca
Jack
Lily
Danksagung
Die Zeit nagt an allem
Südbrooklyn Juli 1996
Prolog
Bobby
In diesem Sommer gehen Bobby Santovasco und sein bester Freund Zeke einmal in der Woche zum Belt Parkway und werfen irgendwelches Zeug auf die Autos, die beim Ceasar’s Bay Shopping Center auf den Bay Parkway abfahren.
Bobby ist gerade vierzehn geworden. Zeke ist dreizehn. Nach der Schule klauen sie öfter mal CDs im Sam Goody oder Zigaretten in Augie’s Deli oder spielen Videospiele im Keller von Zeke. Beide sind in Carissa Caruso aus der Stillwell Avenue verknallt. Beide kommen bald in die achte Klasse der St. Mary Mother of Jesus in der Eighty-Fourth Street. Die Dritte musste Bobby wiederholen, weshalb er älter als seine Klassenkameraden ist. Als Lehrerin kriegen sie dann Mrs. Santillo, die Bobby mal während des Treuegelöbnisses furzen gehört hat. Bobby wohnt mit seinem Vater, seiner Stiefmutter Grace und seiner sechzehnjährigen Stiefschwester Lily in einer kleinen Wohnung eine Querstraße von der St. Mary entfernt in der Eighty-Third Street. Er und Lily reden nicht miteinander, und Grace ist nur irgendwie da. Als er sechs war, ist seine Mutter nach Kalifornien gezogen. Seither hat er nichts mehr von ihr gehört. Zeke wohnt in einem großen Haus in der Twenty-Third Avenue. Sein richtiger Name ist Flavio, aber Bobby hat in der Vierten angefangen, ihn Zeke zu nennen, und der Name ist hängen geblieben. Zekes Vater gehört eine Metzgerei. Er hat vier Schwestern und zwei Hunde. Giovanna, eine seiner Schwestern, sieht aus wie eine Mischung aus Jungfrau Maria und Marisa Tomei. Nachts muss Bobby immer an sie denken.
Hierher kommen sie, weil immer was los ist. Autos, die vom Belt abfahren und an der Ampel stehen bleiben. Das Ceasar’s Bay Shopping Center mit einem Toys »R« Us, einem Kmart und anderen Ketten. Der Markt mit den Ständen wurde letztes Jahr geschlossen. Der Shore Parkway Park. Die Tennisanlage. Gravesend Bay, die vom Coney Island Creek bis zu den Narrows reicht. Der Radweg. Dahinter die Verrazano Bridge. Ganz in der Nähe ist auch der Nellie-Bly-Vergnügungspark, wo sie als Kinder hingegangen sind.
Sie haben klein angefangen mit Schälchen voll Ketchup und Senf aus dem Wendy’s an der gegenüberliegenden Ecke.
Weil es das erste Mal so toll war, machen sie es immer wieder. An dem ersten Tag hatten sie synchron zwei Schälchen auf einen Olds fallen lassen, und das Ketchup und der Senf spritzten über die ganze Windschutzscheibe. Der Fahrer legte eine Vollbremsung hin und ließ sein Auto mitten auf der Straße stehen, dann jagte er ihnen an den Tennisplätzen vorbei bis auf den Bay-Radweg hinterher. Er hatte sie erwischt. Schnurrbart. Ein T-Shirt mit einem Aufdruck von L&B Spumoni Gardens. Gebaut wie einer, der Softball spielt, um eine Entschuldigung fürs Biertrinken zu haben. Er packte sie an den Schultern und brüllte sie eine halbe Ewigkeit an, mindestens zwei, drei Minuten, und dabei flog ihm der Speichel wie Vogelscheiße aus dem Mund. Er sagte, dass er Cop sei und sie Glück hätten, weil er sie nicht aufs Revier schleife. Sie nickten und mussten sich zusammenreißen, nicht loszuprusten. Schließlich pressten sie eine Entschuldigung hervor, und er sagte, dass sie ihr Hirn benutzen sollten. Sie drehten sich um und riefen ihm im Wegrennen zu, er solle sich ins Knie ficken. Schnaubend und mit gesträubten Schnurrbartborsten sah er ihnen nach, dann watschelte er zu seiner soßenversauten Schrottkarre zurück.
Danach versuchten sie es mit wassergefüllten Luftballons, die sie in einem Eimer herschleppten, aber das war zu viel Arbeit, und außerdem hielten die Ballons nichts aus. Einige platzten schon beim Hochheben in ihren Händen.
Als Nächstes hatte Zeke die Idee mit den Tennisbällen. Sie lagen zu Dutzenden im Gras hinter dem Zaun an den Tennisplätzen. Das Schöne an Tennisbällen war, dass man sie schnell und hart werfen konnte. Bobby hatte einen besseren Wurfarm als Zeke, aber darauf kam es eigentlich nicht an. Der Nachteil an den Bällen war der Effekt. Sie prallten einfach vom Autoblech ab und waren sofort vergessen. Es hätte schon Tennisbälle regnen müssen, damit es irgendjemand juckte.
Und so kamen sie auf Steine.
Bevor sie heute zu ihrer Stelle gehen, legen sie bei Wendy’s einen Zwischenstopp ein und holen sich was zu trinken. Sie stehen auf dem Gehsteig und trinken die Limo aus kondenswasserfeuchten Pappbechern. Es ist heiß. Juli-in-der-Stadt-heiß. Vom Asphalt steigt Hitze auf. Bobby kann den Schweiß und das Viertel an sich riechen. Er trägt ein Knicks-Tanktop und eine kurze Turnhose, dazu die Basketballschuhe, die er von seinem Cousin Jonny Boy geerbt hat. Keine Socken. Eine umgedrehte Mets-Kappe auf dem Kopf. Zeke hat kein T-Shirt an. Nur eine Bermudashorts und seine teuren neuen Air Jordans.
»Ein Stein«, sagt Bobby, »würd eine Windschutzscheibe glatt killen.«
»Das wär super«, sagt Zeke.
»Aber dann müssen wir sofort weg. Das ist kein Ketchup.«
»Klar.«
»Hab ich dir schon gesagt, was ich zu Carissa gesagt hab?«
»Was denn?«
»Dass ich mal nachts mit einem Stein ihr Fenster einschmeiße, die Regenrinne hochklettere und in ihr Zimmer einsteige.«
»Und was hat sie dazu gesagt?«
»Sie hat gesagt, wenn ich das mache, sägt mich ihr Vater in der Garage in Stücke.«
»In Stücke sägen? Ach du Scheiße. Aber gut, dann bist du mir nicht mehr im Weg, und ich krieg Carissa.«
»Träum weiter. Die gehört mir.«
»Wart’s ab«, sagt Zeke.
»Okay, du kriegst Carissa, dafür nehm ich Giovanna.«
»Die schaut dich nicht mal mit dem Arsch an. Für die bist du nicht mehr als ein Haufen Hundescheiße, Kleiner. Die ist siebzehn. Du solltest mal den Typen sehen, mit dem sie geht. Serge Rossetti. Muskeln ohne Ende. Er geht auf die Bishop Ford. Spielt Baseball. Der ist garantiert auf Steroiden.«
Sie schlürfen den Rest ihrer Limo. Das Eis ist fast geschmolzen, und Bobbys letzter Schluck ist wässrig. Zekes offenbar auch, weil er ihn ausspuckt. Sie lassen die Becher auf den Gehsteig fallen. Eine Alte, die gerade aus dem Wendy’s kommt, schimpft.
Sie schlängeln sich zwischen den Autos über den Bay Parkway und gehen hinter die Tennisplätze, um das braune Gras nach guten Steinen abzusuchen. Bobby findet einen. Er war erst einmal an einem See, das war mit Jonny Boy in Jersey, aber er weiß, dass sich so ein Stein gut zum Hüpfenlassen eignet. Flach und glatt. Liegt gut in der Hand. Leicht rosa. Zeke findet ein paar kleine Steine. Im Grunde bessere Kiesel. Dann entdeckt Bobby den nahezu perfekten Stein, kugelrund, glatt und schwer, aber nicht zu schwer zum Werfen. Zeke lacht. Nicht schlecht! Er selbst sammelt noch ein paar brauchbare Steine auf, auch einen, der gar kein Stein ist, sondern ein Ziegelbrocken.
Zuerst wirft Zeke, aber er trifft nicht. Er hat auf den Bus einer Kirchengemeinde gezielt, aber der Stein fliegt über das Dach und schlittert gegen den orangen Kegel vor der Schutzplanke, die den Parkway und die Abfahrt trennt.
Dann versucht Bobby es und erwischt mit dem ersten Stein die Beifahrertür eines rostroten Chevy Lumina. Er knallt dagegen. Der Fahrer tritt auf die Bremse und hupt panisch. Sie können ihn sehen. Ein Mann mit Bart, der herumschaut, um rauszukriegen, was sein Auto getroffen haben könnte. Sogar von hier oben ist zu erkennen, dass er schwitzt. Er bemerkt sie nicht. Schließlich fährt er weiter und biegt an der Ampel links auf den Bay Parkway.
Bobby und Zeke kriegen sich vor Lachen nicht mehr ein.
»Wie blöd hat der denn geglotzt«, sagt Zeke und äfft den Mann nach.
Sie werfen noch ein paar Steine, treffen Reifen und Motorhauben und Kofferraumdeckel, schaffen es aber nicht mehr, die Fahrer zu erschrecken, was letztlich ihr Ziel ist. Für den Fall, dass einer aussteigt und ihnen hinterherjagt, haben sie ihre Fluchtroute schon festgelegt. Als der Typ mit dem Schnurrbart sie verfolgte, nahmen sie den langen Weg um den eingezäunten Baseballplatz im Shore Parkway Park. Nur deshalb hatte er sie am Radweg erwischt. Inzwischen haben sie ein Loch im Zaun entdeckt, und weil gerade keiner spielt, können sie einfach quer über den Platz laufen und kommen bei einer der Spielerbänke raus. Die perfekte Abkürzung zum Radweg. Gleich nach der Seventeenth Avenue kennt Bobby eine Fußgängerbrücke über den Belt, die zum Bath Beach Park führt. Von dort können sie nach Hause rennen, gedeckt von dem Chaos aus Autos und Bussen und Leuten mit Einkaufswagen und Gettoblastern auf kaputten Gehsteigen und Kids in Hauseingängen.
»Weißt du, was echt lustig wäre?«, sagt Bobby. »Wenn man direkt in ein offenes Fenster trifft. Den Fahrer erwischt. Dafür kriegt man tausend Punkte.«
»Der Erste, der einen Fahrer erwischt, ist für einen Tag der King.«
»Wie, der King?«
»Na ja, wenn ich einen Fahrer treffe, musst du einen Tag lang machen, was ich dir sage. ›Bobby, klau mir im Augie’s eine Dose Bier.‹ Oder: ›Klau mir drei Pornohefte.‹«
»Abgemacht. Wenn ich gewinne, will ich, dass du in den neuen Chinesen in der Bay Thirty-Fourth gehst und eine Frühlingsrolle oder so was vom Teller von jemand isst. Du gehst einfach zu einem Tisch, schnappst dir was und isst es direkt vor der Nase von dem Gast.«
»So einen Scheiß soll ich machen, wenn du King bist und mir alles befehlen kannst?«
»Na klar. Und dann musst du mir noch eine Kissenhülle voll mit Giovannas BHs und Unterhosen bringen. Genug Schnüffelstoff, bis Mrs. Santillo wieder furzt.«
Zeke hält einen Stein in die Höhe. »Der Nächste landet direkt zwischen deinen Augen.«
Bobby hebt die Hände und grinst. »Was denn? Ich liebe Giovanna eben. Kann ich doch nichts dafür. Weißt du, was ich glaube? Wenn sie sich aufs Klo hockt, drückt sie garantiert keine Hasenköttel raus, sondern herrliches, kaltes italienisches Eis. Schokolade, Zitrone, Wassermelone, was du willst. Tu mir einen Gefallen. Schau mal in der Schüssel nach. Ich hab bestimmt recht.«
Zeke tut so, als würde er Bobby einen Magenschwinger verpassen. »Das glaubst auch nur du. Ich war mal nach ihr aufm Klo. Boah, ich sag’s dir. Da könntest du ein Haus mit abfackeln. Ich so: ›G, was hast du denn gegessen?‹ Sie sieht gut aus, aber wie Parfüm riecht sie nicht.«
»Das glaub ich nicht.«
»Du hast ja null Ahnung. Die schönsten Mädchen scheißen die stinkendsten Haufen.«
Hysterisches Gackern. Jetzt sind sie bereit für die nächste Runde. Bobby mit seinem nahezu perfekten Stein. Der von Zeke ist auch gut, nicht ganz so rund und glatt, aber er hat das richtige Gewicht. Die Steine haben mindestens die Wucht eines Baseballs. Bobby stellt sich vor, wie er mit einem genialen Wurf einen Autofahrer am Arm oder an der Brust trifft und dem vor Schreck die Luft wegbleibt. Wie wenn der Batter voll von einem Fastball erwischt wird. Ein dämlicher Ausdruck in einem dämlichen Gesicht. Tja, so ist das, wenn man sich nicht rechtzeitig wegduckt. Bobby hätte in seinem Little League Team erster Pitcher werden können, wenn er weitergemacht hätte. Aber in der Sechsten hat er aufgehört. Er hatte keine Lust mehr auf Training. Mädchen und Prügeleien nach der Schule und Bier und Zigaretten organisieren waren viel interessanter. Das Team war sowieso grottig. Mit diesen albernen quietschblauen Trikots. Wie die verdammten Kansas City Royals. Wer will schon ein Trikot wie das der Royals? Von der Zweiten bis zur Fünften hat Bobby begeistert gespielt, und er war ein guter zweiter Baseman und Hitter, aber eigentlich wäre er am liebsten Pitcher gewesen. Nur ließ ihr Trainer Gene Grady, der samstags in der Kirche das Abendmahl austeilte, die ganze Zeit seine Söhne Jeff und Matt werfen. Sie waren okay. Bobby hat immer davon geträumt, auf dem Mound zu stehen, am Rand seiner Kappe ein bisschen Vaseline, und mit einem schön geschmierten Slider die Batter einen nach dem anderen auszuschalten. Scheiß auf Baseball, denkt Bobby jetzt. Steine auf Autos werfen ist viel lustiger.
Ein verlotterter kirschroter Toyota Corolla nimmt die Abfahrt. Er fährt langsam, als wäre der Motor zu schwach, und schnauft und hustet vor sich hin. Bobby bemerkt ihn zuerst und gibt Zeke ein Zeichen. Die Fenster des Autos sind offen. Eine Frau sitzt rauchend am Steuer. Eigentlich noch ein Mädchen. Wahrscheinlich letzte Highschoolklasse. Sie singt zum Radio mit und mustert sich immer wieder im Rückspiegel.
Als der Corolla es fast bis zur Ampel geschafft hat, die gerade umschaltet, zielen Bobby und Zeke in einer vollkommen synchronen Bewegung auf das Beifahrerfenster und werfen mit aller Kraft die Steine.
Dann passiert alles ganz schnell. Ein Stein trifft genau ins Ziel. Der andere geht weit daneben. Nur erwischt der Stein, der in das Auto zischt, das Mädchen nicht am Arm oder an der Brust. Er erwischt sie an der Schläfe. Sie zuckt zusammen, die Zigarette fällt ihr aus der Hand, und sie verliert die Kontrolle über das Auto, das auf die gelbe Ampel zufährt.
Bobby und Zeke zögern keine Sekunde. Sie lassen die restlichen Steine fallen, wirbeln herum und rennen über den Baseballplatz zum Radweg.
Sie sehen nicht zurück. Bobby hat keine Angst, dass ihnen jemand folgt, er hat Angst, dass hinter ihnen etwas Schreckliches passiert sein könnte.
Es war doch nur Spaß.
Nicht ernst gemeint.
Sie rasen den Weg entlang, weichen den wenigen geistesabwesenden Fußgängern aus, werden von ein, zwei Arschlochradlern links überholt. Es ist verdammt heiß. Schweiß brennt in Bobbys Augen. Von der Bucht her riecht es. Nach Salz. Algen. Undurchdringlicher Finsternis.
Als sie die Bücke erreichen, laufen sie in den Bath Beach Park und bleiben stehen, um zu Atem zu kommen und aus einem Brunnen zu trinken.
»Hast du gesehen, was passiert ist?«, fragt Zeke.
»Nein, ich bin sofort los.«
»Ich auch. Aber hat uns jemand gesehen?«
»Keine Ahnung.«
»Scheiße«, sagt Zeke. »War’s mein Stein oder deiner?«
Bobby stützt den Kopf in die Hände. Das Mädchen ist bestimmt nicht mehr als drei, vier Jahre älter als sie. Auf so jemand hatten sie es nicht abgesehen. Sie ist keins von diesen Arschlöchern. Eine Fremde. Die raucht. Im Auto singt. An einem ganz normalen Nachmittag. Einem Tag wie jedem anderen. Sie fährt an ihrer Abfahrt runter, vielleicht auf dem Weg nach Hause oder sonst wohin. Dann kommen sie an mit ihrem saublöden Spiel. Mehr war es nicht. Ein Spiel. Das schwört er.
»Keine Ahnung«, sagt Bobby zu Zeke und hat ständig das Mädchen vor Augen. »Ich weiß es nicht.«
Jack
In dem Haus in der Bay Thirty-Eighth Street ist Jack Cornacchia aufgewachsen, und er weiß, dass er hier eines Tages auch sterben wird. Er sitzt mit einem kalten Dosenbier auf der morschen vorderen Veranda. Es ist früher Nachmittag. Heute hat er frei. Er ist Kundenbetreuer bei Con Ed, geht von Haus zu Haus und lässt sich in die Untergeschosse und Keller führen, um die Gas- und Stromzähler abzulesen. Den Unterschied zwischen Untergeschoss und Keller hat er nie kapiert. Die einen sagen Untergeschoss, die anderen Keller. Er sagt meistens Keller. Es muss einen Unterschied geben, aber er kennt ihn nicht und ist zu faul nachzusehen. Das könnte er. Irgendwo hier liegt ein Lexikon rum. Aber eigentlich weiß er es gerne nicht. Wie auch immer, jedenfalls hat er durch seinen Beruf Einblick in das Leben anderer und sieht sie in all ihrer Einsamkeit. Man muss sehr diskret sein.
Sein Vater war Mechaniker. Bevor Jack zur Welt kam, hatte seine Mutter bei Woolworth gearbeitet, dann hatte sie sich um ihn gekümmert. Er war ihr einziges Kind. Im Jahr nach ihrer Hochzeit hatten sie das Haus für zehntausend Dollar gekauft, was damals eine Menge Geld war. Es ist zweistöckig und hat ein Schrägdach, vier Schlafzimmer und eine breite vordere Veranda. Die Kiefer im Vorgarten hatten sie von ihren Flitterwochen in New York State mitgebracht. Jack ging in der St. Mary Mother of Jesus in der Eighty-Fourth Street in die Grundschule. Neben der Schule ist die Kirche, in der er getauft wurde und Kommunion hatte und wo er jeden Samstagabend mit seinen Eltern zum Gottesdienst ging, bis er sechzehn wurde und keine Lust mehr hatte. Er glaubt nach wie vor an Gott, aber eben auf seine Art. Seine Highschool war die Our Lady of the Narrows in der Shore Road in Bay Ridge. Eine reine Jungenschule. Er hatte es gehasst. Aufs College ging er nicht. Eine Zeit lang wechselte er ständig die Stellen, eine beschissener als die andere, und überlegte, ob er sich beim öffentlichen Dienst bewerben soll. Vielleicht bei der Post. Zu guter Letzt besorgte ihm sein Vater über Connected Benny, den er von der Werkstatt kannte, den Job bei Con Ed.
Mit einundzwanzig lernte Jack in einem Coffeeshop in der Avenue U Janey kennen. Bis dahin war er schon mit dem einen oder anderen Mädchen ausgegangen, aber es war nie was Ernstes gewesen. Der Verlust seiner Unschuld an Mary Concetta Stallone auf der Rückbank eines geliehenen Autos war eine eher nüchterne Angelegenheit gewesen. Ein paar Monate war er mit Dyana Petrillo zusammen – das war bis dahin die festeste Geschichte. Bei ihr machte er sein Sexdiplom. Sie war eine gute Lehrerin. Zärtlich. Erfahren. Wobei ihn das natürlich fertigmachte. Er wurde eifersüchtig und nannte sie puttana, und damit war es aus. Von da an wusste er, wie man sich nicht aufführen sollte, dass man die Vergangenheit ruhen lassen sollte. Aber mit Janey war es sowieso von Anfang an anders. Er war ruhig und beherrscht. Es war Liebe auf den ersten Blick. Diese braunen Haare. Diese sanften braunen Augen. Sie sah aus wie eine Mischung aus Heiliger und Filmstar. Sie war noch Jungfrau, weil ihre Eltern erzkatholisch waren, sodass es keine Vergangenheit gab, auf die er hätte eifersüchtig sein können. Für einen Katholiken war sie ein Traum. Ein halbes Jahr nachdem sie sich kennengelernt hatten, heirateten sie gegen den Widerstand ihrer Eltern. Seine Familie war entzückt. Jack und Janey zogen bei ihnen ein. Im nächsten Jahr kam Amelia zur Welt, das war im März 1978. Sie waren glücklich. Janey war die perfekte Mutter. Mom und Dad wurden Nonna und Nonno. Amelia war ihr süßes kleines Mädchen. Zehn Jahre zogen ins Land. Sein Leben war schöner als der schönste Traum.
Dann ging es abwärts. Anfangs fast unmerklich. Seine Mutter stürzte auf dem Heimweg vom Einkaufen an einem der Obststände in der Eighty-Sixth Street. Ihr braver alter Einkaufstrolley war ihr ausgekommen, und sie war auf den Gehsteig gefallen und hatte sich die Hüfte gebrochen. Im Nachhinein betrachtet war das der Auslöser, der Moment, von dem an es nicht mehr rundlief. Während sie im Krankenhaus lag, bekam sein Vater einen Husten, der sich schnell zu etwas Schlimmerem entwickelte. Als er schließlich zum Arzt ging, stellte der eine Lungenentzündung fest. Jetzt waren beide eine Zeit lang ans Bett gefesselt, aber sie erholten sich. Dann wurde Janey krank. Krebs. Nach drei Jahren verlor sie den Kampf. Gegen Ende war sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Gott sei Dank waren seine Eltern da und kümmerten sich um Amelia, sorgten für ein gewisses Maß an Normalität in ihrem Leben. Sie nahmen sie mit ins Kino, richteten Geburtstage und Weihnachten für sie aus. Janeys Eltern wollten nichts von ihnen wissen, auch nicht nachdem Jack sie angerufen hatte, um ihnen mitzuteilen, wie schlecht es um sie stand. Sie unternahmen nichts, um sich mit ihrer einzigen Tochter zu versöhnen. Noch bevor es so weit war, wusste Jack, dass Janey im Sterben lag. Er spürte es. Es war eine Katastrophe. Es war zu lange zu schön gewesen. Das musste sich rächen.
Am 13. September 1992 starb Janey. Das war der absolute Tiefpunkt. Amelia verlor ihr strahlendes Lächeln. Ihre Schule riet zu einer Therapie. Sie klammerten sich aneinander. Ohne Nonna und Nonno, für ihn Mom und Dad, hätten er und Amelia diese Zeit nicht überstanden. Erst hatten sie ihm das Leben geschenkt, und jetzt retteten sie es. Die ersten beiden Jahre waren hart. Jeder Tag war so traurig wie der vorhergehende. Amelia kam in die Highschool, die Fontbonne Hall Academy in Bay Ridge, so wie Janey es gewollt hatte. Jack machte seine Touren. Einmal die Woche fuhren seine Eltern nach Atlantic City, um ein bisschen Abwechslung zu haben. Es gefiel ihnen dort. Sie wurden rundum versorgt. Der Bus fuhr morgens am Bay Parkway los und brachte sie abends zurück. Nie blieben sie über Nacht, auch wenn sie möglicherweise sogar eine Gratisübernachtung gekriegt hätten. Das Golden Nugget war ihr Lieblingscasino. Seine Mutter ging am liebsten an die Glücksspielautomaten. Dad spielte Blackjack. Dann glitt seine Mutter einmal beim Aussteigen aus und brach sich die andere Hüfte. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und starb bei der Operation. Drei Monate später starb sein Vater an einem Herzinfarkt. Beide wurden auf einem Friedhof in Long Island beerdigt, den sie zwar nie besucht hatten, aber sein Vater hatte dort viele Jahre zuvor ein günstiges Grab bekommen. Er war schnell zu erreichen, wenn nicht gerade Stau war, aber das war so selten der Fall, dass er und Amelia sich den Stress oft sparten.
Nachdem auch seine Eltern gestorben waren, fühlte sich die Welt für Jack wie ein grausamer Witz an. Die zehn glücklichen Jahre waren nur das Vorspiel für zehn Jahre Tod und Trauer. Er und Amelia schleppten sich weiter. Sie klammerten sich noch fester aneinander. Das Haus war traurig und leer. Es dauerte Monate, bis Jack den Papierkram erledigt hatte. Zum Glück hatte sein Vater ihn schon in die Besitzurkunde für das Haus aufgenommen, aber jetzt musste er Amelia eintragen lassen, und ein Testament und eine Vorsorgevollmacht wollte er auch machen. Er musste die Hinterlassenschaft seiner Eltern durchgehen – Konten, Schließfächer, Versicherungspolicen, kistenweise Zeug. Alle Rechnungen mussten auf seinen Namen laufen.
Inzwischen ist das Haus ziemlich runtergewirtschaftet. Das Dach müsste neu gedeckt werden. Das Verandageländer ist morsch. Die Stufen sind abgetreten. Freche Eichhörnchen haben zwei Dachfenster angenagt. Der Ölkessel im Keller ist fünfzig Jahre alt, und Jack hat Sorge, dass er eines Tages in die Luft fliegt. Das Linoleum in der Küche ist rissig und wirft sich an den Rändern auf. Aus dem Waschbeckenabfluss im Badezimmer scheppert es. Der Wasserdruck im Erdgeschoss und im oberen Stockwerk ist halbwegs gut, aber die Badezimmerfugen sind schimmelig, und es dauert ewig, bis das Wasser abgeflossen ist. Der Boden im oberen Bad ist irgendwo undicht, sodass im Esszimmer im Erdgeschoss die Deckenfarbe abplatzt. Die Decke im Schlafzimmer müsste auch mal wieder gemacht werden.
Amelia ist inzwischen achtzehn. Sie hat gerade ihren Abschluss an der Fontbonne gemacht. Leicht ist es ihr nicht gefallen. Im Herbst wird sie an die Fordham University gehen. Sie will Schriftstellerin werden. Im letzten Jahr hat sie einen Kurs in kreativem Schreiben belegt und ist begeistert gewesen. Sie hat Lehrbücher gelesen, sich an Erzählungen versucht und sogar einen Roman angefangen. Die Highschool ist immer schwer – eine Zeit, in der man sich selbst sucht und sich fragt, wer man sein möchte –, aber wenn noch solche Tragödien dazukommen, ist es tausendmal schwerer. Amelia hat genug Tragödien für ein ganzes Leben erfahren. Mehr als alles andere hofft Jack, dass sie von jetzt an ein friedliches und glückliches Leben führen kann. Er will alles tun, um sie vor Schwierigkeiten zu bewahren, und hofft, dass sie schlau genug ist, sich selbst davon fernzuhalten. Sie ist eine kluge junge Frau. Mit dem Herzen am rechten Fleck. Er ist erst vierzig und hofft, dass er miterlebt, wie sie einen netten Mann heiratet und ein oder mehrere Kinder hat, ihren Roman schreibt, all die Dinge tut, die sie sich erträumt. In ihrem Zimmer hängt an der Wand eine Weltkarte, auf der sie all die Orte, die sie besuchen möchte, mit Nadeln markiert hat. Italien, Jamaika, Brasilien, Hollywood. So vieles will sie sehen. Er sagt ihr nicht, dass sie das vergessen kann, dass sie vielleicht nicht einmal einen der Orte sehen wird. Warum sollte er? Träumen ist etwas Schönes.
Seit Janey hat Jack keine Beziehung mehr gehabt und seiner Tochter keine Freundin oder Stiefmutter angetan, aber Geheimnisse hat er trotzdem. Ein Leben, von dem er seiner Tochter nichts erzählen kann. Niemals erzählen wird. Es hat ihm die letzten Jahre über Amelia hinaus Sinn gegeben.
Das Ganze fing im Wrong Number an, seiner damaligen Stammkneipe. In der Zeit nach Janeys Tod trank er viel. An seinen freien Tagen, wenn Amelia in der Schule war, fing er schon morgens damit an. Sein Kumpel Frankie Modica, mit dem er auf der St. Mary und der Our Lady of the Narrows gewesen war, bat ihn, sich einen Priester, der seinen Sohn betatscht hatte, vorzuknöpfen. Der Sohn war zehn. Der Priester war von der Most Precious Blood. Wie nicht anders zu erwarten, hielt die Diözese ihre schützende Hand über ihn. Es hieß, er würde bald zu einer Gemeinde im Westen von New York State versetzt werden, vielleicht Buffalo, wo niemand von seinen Verbrechen wusste. Sein Name war Pater Pat. Frankie sagte, er habe nicht den Mumm, das zu tun, was er am liebsten tun würde, aber Jack, das wisse er. Er könne ihm etwas Geld geben, leider nicht viel, vielleicht einen Tausender.
»Was soll ich denn tun?«, fragte Jack.
»Du sollst ihm wehtun«, sagte Frankie. »Umbringen musst du ihn nicht. Nur wehtun. Ich will, dass der Kerl leidet. Statt dass er bestraft wird, wird er nur beschützt.«
Jack dachte darüber nach. Er neigte nicht zur Gewalt, aber wenn nötig, war er sicher dazu imstande. Er war schon an Kneipenschlägereien beteiligt gewesen, bei denen es nur um die Ehre gegangen war. Er stellte sich vor, dass so ein Widerling wie Pater Pat mit seinen Untaten davonkam. Ihm wurde schlecht bei dem Gedanken, dass einer wie der einfach so weiterleben durfte und Janey diese Möglichkeit nicht gehabt hatte, dass sie aus dem Leben gerissen worden war. So viel wusste er inzwischen: Die schlechten Menschen hatten oft ein leichteres und besseres Leben als die guten. Sie lebten weiter, während die anderen wie die Fliegen starben. Warum also nicht? Dann hätten seine Wut und seine Traurigkeit wenigstens ein Ziel. Er fragte, wo der Priester sich versteckte.
Da die Sache drängte, weil sie nicht wussten, wann Pater Pat versetzt werden würde, zog er am nächsten Abend mit Baseballschläger und Skimaske auf dem Kopf los und prügelte den Priester halb zu Tode. Es fiel ihm erstaunlich leicht. Er knipste einfach seine Gefühle aus, sodass er nicht mal spürte, was er tat. Er hatte Filme über eiskalte Auftragskiller gesehen, und genauso kam er sich vor. Es war einfach ein Job. Er musste nur rein und raus. Als er fertig war, ließ er den blutenden und stöhnenden Pater Pat auf dem Boden liegen und zog ab. Das Schwein hatte nicht mal protestiert. Wahrscheinlich hatte er mit so etwas gerechnet.
Frankie sagte, er sei ein Heiliger. Jack wollte das Geld nicht nehmen – er wollte sagen, dass er es der Gerechtigkeit wegen gemacht hatte –, aber dann überlegte er, dass er es für Amelia zurücklegen könnte. Er hatte schon längst einen Collegesparvertrag für sie abschließen wollen. Damit für sie gesorgt war, falls auch ihm etwas passierte. Er deponierte das Geld in einem Schließfach bei seiner Bank.
Womit er nicht gerechnet hatte, war, dass die Sache die Runde machte. Alle möglichen Leute kamen mit ihren Problemen zu ihm, erzählten ihm, wer ihnen etwas angetan, sie bestohlen oder einen Familienangehörigen verletzt hatte. Insgesamt waren es bisher fünfzehn Aufträge. Seit dem fünften nimmt er immer einen Revolver mit, den er Slim Helen in der Avenue X abgekauft hat. Er liegt in einen Lappen gewickelt im Keller, in einer Nische der offenen Decke über dem Ölbrenner, die Munition steckt nicht weit davon in einer Keksdose. Beim siebten Auftrag benutzte er die Waffe und tötete einen Mann, der ein Mädchen aus der Gemeinde vergewaltigt hatte. Er ging mit derselben Gefühlskälte vor. Das war ein paar Monate nach dem Tod seiner Eltern, und er empfand die Tat als reinigend. Der Vergewaltiger hatte nicht mal Angst gehabt. Er schien dankbar zu sein. Jack hatte die Welt von einem Übel befreit. Jetzt hat er genug Geld auf der Bank, um Amelia einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Irgendwann wird er damit aufhören. Was, wenn Amelia heiratet und ein Kind kriegt, er das Kind im Arm hält, Großvater ist, alles in dem Wissen, dass er nebenher Leute umbringt oder ihnen wehtut? Klar, es sind schlechte Menschen, aber trotzdem, er wird eine Menge Blut an den Händen haben. Außerdem macht er sich inzwischen Sorgen, dass Amelia es rauskriegt. Bisher konnte er es geheim halten, aber das muss nicht so bleiben. Es muss sich nur einer verplappern und etwas zu seinem Cousin sagen, der die Klappe nicht halten kann. Er hofft, dass Amelia es nicht rausfindet, aber wenn doch, wird er nicht dazu schweigen können. Er wird sich ihr erklären. Er wird ihr sagen, dass er es gemacht hat, damit sie in einer besseren Welt leben kann.
Amelia tritt mit einer Dose Diet Coke auf die Veranda. Sie lebt von Diätcola und isst fast nichts mehr. Toast Melba, eine halbe Grapefruit, ein paarmal die Woche Rührei. Das Mädchen, das früher nichts lieber als Pasta e fagioli, Spedini, Ciabatta und Sfinge gefuttert hat, gibt es nicht mehr. Wie ein Vögelchen essen, aber ständig an einer Diätcola süffeln. Eine Strähne ihrer braunen Haare hat sie pink gefärbt. An der Fontbonne hätten sie das nicht erlaubt. Sie trägt ein schwarzes T-Shirt, abgeschnittene Jeans und rote Chucks. Achtzehn. Wie immer, wenn er sie dieser Tage ansieht, fragt er sich, wie sie so schnell erwachsen werden konnte. Er muss nur kurz blinzeln, und schon ist sie wieder ein Baby in seinen Armen. Mit diesem bezaubernden breiten Lächeln. Den braunen Augen, die sie von ihrer Mutter geerbt hat.
»Wie geht’s, wie steht’s, junge Frau?«, fragt Jack. Ihm gefällt das Geplänkel mit ihr. Ihm gefällt, dass sie gerne mit ihm plänkelt. Viele Kinder wollen von ihren Eltern nichts wissen, aber Amelia hat immer Zeit zum Plaudern.
Sie setzt sich ihm gegenüber auf den klapprigen Stuhl, stellt die Dose auf ihren Oberschenkel, versucht sie zu balancieren. Er sieht einen Kondenswasserring auf der Jeans.
»Passt schon«, antwortet sie.
»Ziemlich heiß«, sagt er.
»Yep.«
»Hast du deinen Stundenplan für den Herbst schon zusammengestellt?«
»Bin noch nicht dazu gekommen.«
»Wann ist diese Orientierungsveranstaltung?«
»Ich glaub, in zwei Wochen. Ich muss den Brief suchen, den sie geschickt haben.«
»Darf ich dir einen Rat geben? Als Vater und als jemand mit etwas Erfahrung?«
»Muss das sein?«
»Ich mein’s ernst. Halt deine Sachen in Ordnung. Das ist mein Rat. Mehr nicht. Halt Ordnung. Leg dir einen Ordner an. Such eine Schublade aus, in die du alles Wichtige steckst. Nutz die Aktenmappe von Nonno, die ich dir gegeben habe. Glaub mir. Ich hab auf die harte Tour lernen müssen, wie wichtig das ist.«
»Was täte ich nur ohne dich und deine Ratschläge, Pop.«
»Schlaumeier. Ich versuche nur, dir beizubringen, was ich mir mühsam erarbeitet habe, damit du nicht dieselben Fehler machst.« Er stupst ihren Fuß an. »Gestern Abend ist es spät geworden, was?« Er hat sie auf der alten Royal-Schreibmaschine seiner Mutter klappern hören. Es war einer der besten Tage überhaupt gewesen, als er die im Keller entdeckt hatte. Ihre Augen hatten geglänzt. Seine Mutter hatte sie gut gepflegt und sorgsam abgedeckt. Es gab einen großen Vorrat an Farbbändern, und sie hatte sie regelmäßig in dem Schreibmaschinenladen in der Stilwell durchchecken lassen. Seine Mutter hatte gerne Briefe darauf geschrieben. Die Maschine ist verdammt schwer. Als sie sie in Amelias Zimmer auf den Schreibtisch gestellt hatten, hatte sie ihn fest umarmt und war sofort zu Genovese gerannt, um Schreibmaschinenpapier zu besorgen.
»Manchmal findet man beim Schreiben kein Ende.«
»Geht’s mit dem Roman voran? Darf ich ihn mal lesen?«
»Vielleicht, wenn er fertig ist.«
»Willst du mir immer noch nicht verraten, worum’s geht?«
»Nö.«
»Kennst du Ron Reddan aus dem Wrong Number? Er hat auch mal geschrieben. Vor ein paar Wochen hat er mir erzählt, dass er massenhaft Kneipenstorys in petto hat. Jahrzehnte von Besoffenen. Typen, die auf den Tresen kotzen oder auf den Boden schiffen. Da war mal einer, genannt Phil the Mustache, der hat auf den Flipperautomaten geschissen. Wahrscheinlich hat er gedacht, er wäre aufm Klo. Die Liebesdramen. Schlägereien. Sancho Stern, der eines Abends Gene Carcaramo erstochen hat. Der Auftragsmord, der dort passiert ist. Die Brancaccios, die Robbie Guttadoro verprügelt haben. Er sagt, dass er eines Tages die Geschichten in einem Buch rausbringen will. Ich hab ihn gefragt, wer so was braucht. Wenn man Kneipengeschichten haben will, geht man in eine Kneipe. Will ich von einem Kerl lesen, der auf einen Flipperautomaten scheißt? Ich will James Clavell, Larry McMurtry, Stephen King. Ich will eine richtige Story. Keinen Tratsch.«
Amelia trinkt ihre Dose aus, schüttelt sie über dem offenen Mund, um ihr auch den letzten Tropfen zu entlocken, und hält sie dann in die Höhe. Die Sonnenstrahlen brechen sich auf der silbernen Oberfläche. »Was würdest du tun, wenn ich die Dose an meinem Kopf zerquetsche?«, fragt sie.
»Wahrscheinlich wäre ich schwer beeindruckt«, sagt er.
Sie brechen in Gelächter aus. Es gibt nichts, was er lieber hört, als wenn sie zusammen lachen.
»Und? Was hast du heute vor?«, fragt Jack.
»Ich hole Miranda ab. Sie hat einen Arzttermin in Bay Ridge, und dann gehen wir Kaffee trinken oder so.« Vor ungefähr einem halben Jahr hat Amelia ein Auto bekommen. Es hat zweitausend gekostet – Flash Auto hat ihm einen guten Preis gemacht. Die Hälfte hat Amelia bezahlt. Das Geld hat sie von ihrem Job bei einem Hautarzt in Dyker Heights gespart, für den sie die Ablage macht. Die andere Hälfte hat er übernommen.
»Du bist eine gute Freundin.«
»Und was hast du vor?«
»Rumsitzen und es mir gut gehen lassen. Vielleicht geh ich später ins Wrong Number und trink was.« Aber das stimmt nicht. Es wartet ein Auftrag auf ihn.
Amelia steht auf, tritt zu ihm und küsst ihn auf den Kopf. Sie zieht die Autoschlüssel aus der Tasche. An ihrem Schlüsselbund hängen eine kleine Pfefferspraydose, die er ihr gekauft hat, und ein roter Golden-Nugget-Anhänger von Nonno. »Bis später, Pop.«
»Hab dich lieb«, sagt er.
»Ich dich auch.« Sie nimmt die leere Coladose, springt die Verandastufen runter und wirft sie in die Mülltonne, als sie durch das Gartentor zu ihrem Auto läuft, das ein Stück die Straße weiter vor dem Haus von Teddy und Sandra Dasaro steht.
Was den Auftrag angeht, ist er hin und her gerissen.
Mary Mucci, die Jack von der West Fourth Street kennt, hat irgendwo aufgeschnappt, dass er solche Aufträge übernimmt, und ihn gefragt, ob er etwas wegen Max Berry in Bay Ridge unternehmen kann. Max hat eine Betrugsmasche am Laufen, mit der er »Investoren« dazu bringt, ihm gegen hohe Zinsen Geld anzuvertrauen. Und jetzt rückt er Marys Geld nicht raus, dabei ist sie deswegen praktisch pleite. Es ist Geld, das sie ihren Kindern und Enkeln geben wollte. Dasselbe ist vielen anderen armen Schluckern in Südbrooklyn passiert. Ausgerechnet die Schwächsten bringt Max um ihr bisschen Erspartes. Deshalb würde er es verdienen. Allerdings ist Jack nicht überzeugt, ob er es wirklich machen soll. Max hat schließlich niemand umgebracht oder vergewaltigt und auch kein Kind missbraucht. Er verdient, vor Gericht zu kommen, aber Selbstjustiz? Mary hat nicht gesagt, was genau er mit Max anstellen soll, und Jack überlegt, ob ein Warnschuss reicht. Damit er weiß, dass sie’s ernst meinen. Damit er weiß, dass er Leben zerstört. Jack könnte ihm die Waffe zeigen. Ihm einen Magenschwinger verpassen. Ein toter Max hilft Mary nämlich auch nicht weiter. Er ist ein Widerling, aber vielleicht muss man ihn nur mal mit der Nase drauf stoßen, was er anrichtet.
Jack geht ins Haus und setzt Kaffeewasser auf. Amelia kriegt bei seiner Art, Kaffee zu kochen, immer zu viel. Er kocht Wasser, gibt ein paar Löffel gemahlenen Kaffee, zerdrückte Eierschale, die er in einer Plastiktüte im Kühlschrank aufbewahrt, und eine Prise Salz hinzu. Das rührt er gründlich durch und gießt es dann durch ein Sieb in einen Becher. Seine Großmutter hat ihm das beigebracht. Sie war eine gute Frau. Groß gewachsen und mit kräftigen Händen. Sie starb, als er siebzehn war, also noch bevor er Janey kennenlernte und sein Leben Gestalt annahm. Jedes Mal wenn er Kaffee kocht, fällt sie ihm ein. Er weiß nicht genau, was er sich unter dem Tod vorstellt, was seiner Meinung nach die Toten mit ihrer Zeit machen. Die meisten Leute glauben, die Toten verbringen ihre Zeit damit, über die Lebenden zu wachen, aber die Vorstellung findet er seltsam, immer schon. Dabei tritt ihm automatisch das Bild vor Augen, wie ein lieber Verstorbener vor einer Wand mit Überwachungsmonitoren sitzt und Liveaufnahmen von der Erde betrachtet. Klar, ab und zu mal reinschauen, das würde er verstehen, aber er hofft, dass man sich als Toter nicht nur nach dem Leben sehnt. Der Gedanke, dass Janey Tag und Nacht über ihn und Amelia wachen muss, ist ihm kein Trost. Lieber stellt er sich vor, dass sie ganz entspannt ist und keine Schmerzen und keine Sorgen hat, nur Frieden, so weit das Auge sehen, das Ohr hören kann. Am liebsten stellt er sich vor, dass sie von Liebe und Glück erfüllt ist, so wie in ihren glücklichsten Momenten: bei ihrer Hochzeitsfeier im Riviera, bei Amelias Geburt im Victory Memorial, bei Amelias ersten Schritten in ebendieser Küche. Er stellt sich gerne vor, dass diese Gefühle ihr Leben nach dem Tod erfüllen.
Im Haus ist es mucksmäuschenstill. Er dreht das Gas ab, damit sich das Kaffeepulver setzen kann. Nachdem der Kaffee ein wenig abgekühlt hat, seiht er ihn vorsichtig über der Spüle in einen Becher ab. Dann wirft er den mit Eierschalen gesprenkelten Satz in den Mülleimer und spült das Sieb aus.
Er setzt sich mit seinem Kaffee an den Tisch und sieht auf die Uhr.
Als er fertig ist, wäscht er den Becher aus und stellt ihn umgedreht auf ein gefaltetes Geschirrtuch auf der Abtropffläche neben der Spüle. Er nimmt die Autoschlüssel von dem Haken an der Küchentür und geht in den Keller, um seine Waffe zu holen. Es ist ein .38er, hat zumindest Slim Helen gesagt. Er selbst hat keine Ahnung von Waffen, hat in seinem Kopf nicht mal Platz für solche Informationen. Jedenfalls tut sie ihren Dienst. Er schiebt sie unter den Hosenbund, verlässt das Haus und schließt ab.
Sein Auto steht ebenfalls auf der Straße. Zum Haus gehört zwar eine Einfahrt, die es mit dem Nachbarhaus teilt, aber die Nachbarn belegen sie inzwischen meistens mit Beschlag, und er hat keine Lust zu streiten, nicht wegen so was. Manchmal muss er ewig nach einer Parklücke suchen, aber das ist weniger unangenehm, als sich mit der jugoslawischen Familie anzulegen, die vor ein paar Jahren nebenan eingezogen ist. Er zieht die Waffe aus dem Hosenbund und legt sie ins Handschuhfach zu seinen Straßenkarten, den verbrauchten Lufterfrischern und den Rechnungen von Flash Auto.
Das Büro von Max Berry ist in Bay Ridge. Um dorthin zu gelangen, nimmt Jack die Bath Avenue bis zum Bay Parkway, dort biegt er links ab und wechselt kurz vor dem Shore Parkway und Ceasar’s Bay auf den Belt Parkway. Es irritiert ihn immer, dass es Ceasar geschrieben wird, aber es ist eben nicht nach Julius Caesar benannt, sondern nach Ceasar Salama, der den Markt 1982 gegründet hat. Damals war es noch ein riesiger Flohmarkt, mittlerweile ist es eine Art Shoppingcenter.
Auf dem Belt ist viel los. Jack schaltet WINS ein, um die Nachrichten und den Wetterbericht zu hören. Als ihn eine schlechte Nachricht auf trübe Gedanken bringt, wechselt er zu WCBS-FM, dem Oldies-Sender. Als junger Mann war er Hendrix- und Doors-Fan, solche Sachen, aber er mag auch Oldies, besonders Dion and the Belmonts, Elvis Presley und alle Mädchenbands. Die Shangri-Las und die Ronettes waren echt gut.
Bis zur Verrazano Bridge kommen sie nur im Schritttempo voran. Danach wird es besser, aber er muss schon die Abfahrt zur Fourth Avenue nehmen. Mit Bay Ridge verbindet ihn seine ganze Kindheit und Jugend, und auch wenn man mit dem Auto nur ein paar Minuten dorthin braucht, kommt es ihm immer wie eine lange Reise vor. Die Our Lady of the Narrows in der Shore Road war seine Highschool. In der Shore Road ist auch die Fontbonne Hall Academy, auf der Amelia war. Sein Vater fuhr oft mit ihm zu Hirsch’s, wo er einen Milchshake gekriegt hat. Einmal hatte er einen Ferienjob in einem Teppichlager in der Colonial Road, als Putzmann. Wie Janey und Amelia war er im Victory Memorial Hospital zur Welt gekommen. Im O’Sullivan’s in der Third Avenue trank er das erste Mal Alkohol. Als Jugendlicher spazierte er von Gravesend hierher, sah sich Schaufenster an und träumte davon, was das Leben alles bieten könnte.
Das Büro von Max liegt an der Ecke Fourth Avenue und Eighty-Fourth Street. Die Kirche St. Anselm ist nur ein paar Querstraßen weiter. Jack erinnert sich, dass er Mitte der Siebziger zu Gary Colkins Trauung dort war, ein Highschoolfreund und ein verdammt guter Dreipunktelinien-Werfer. Gary heiratete ein Mädchen namens Ruby. Jack fragt sich, wie es den beiden geht. An so viele Leute, die einmal eine Rolle in seinem Leben gespielt haben, erinnert er sich nur noch verschwommen. Gary hatte eine Superimitation von Nixon drauf.
In der Eighty-Fourth Street findet man so gut wie nie einen Parkplatz, deshalb parkt Jack bei der St. Anselm und geht das Stück zu Max’ Büro zurück. Als er klopfen will, fällt ihm ein, dass er die Waffe vergessen hat, und er kehrt noch mal um. Er passt auf, dass niemand mitkriegt, wie er sich die Waffe in den hinteren Hosenbund unter das T-Shirt schiebt. Das Letzte, was er braucht, ist irgendein Priester, der ihn von einem versteckten Fenster aus beobachtet und die Cops ruft. Er geht zurück zu dem Büro und klopft laut. Ein lautes Klopfen bedeutet: Da wartet nichts Gutes.
Mary hat Jack erzählt, dass Max auch auf der Our Lady of the Narrows war, aber er ist höchstens Mitte dreißig, deshalb kann er erst nach Jacks Abschluss an die Schule gekommen sein. Seines Wissens hat er Max nie gesehen und erst durch Mary von ihm gehört. Sie hat ihm einen Zeitungsausschnitt über eine Wahlkampfspendenaktion der Republikaner gezeigt, mit einem Foto von Max, der ein Tablett mit Würstchen im Schlafrock hält, während er mit einem weißhaarigen Politschnösel redet. Das Schwarz-Weiß-Foto ist unscharf, vermittelt aber einen halbwegs guten Eindruck: ein schmieriger geldgeiler Sack. Er ist erstaunt, dass Max mit seiner Betrugsmasche durchkommt und die Leute ihn nicht hinhängen. Sie glauben wohl ernsthaft, dass sie durch ihn reich werden. Jack fragt sich, wen Max schmiert oder ob jemand anderes dahintersteckt. Vielleicht die Mafia. Das kann doch keine Solonummer sein.
Max öffnet die Tür. Er ist groß und blass und sieht dämlich aus in seinem kurzärmligen gelben Hemd mit der stiftgefüllten Schutzhülle in der Brusttasche. Er scheint ein Knopfloch ausgelassen zu haben, weil das Hemd schief geknöpft ist. Er hat es in seine Hose gestopft, ein Dockers-Imitat. Die Schnürsenkel seiner abgelatschten Treter sind nicht zugebunden. Seine Brille ist ein eckiges Billigmodell. In der Hand hält er einen kleinen roten Milchkarton, wie ihn Kinder in der Schule kriegen. Aus dem hat er schon getrunken, weil an seiner Oberlippe ein schmaler Milchbart klebt. Seine ungekämmten, schuppigen Haare stehen in alle Richtungen ab. Reich sieht er nicht aus, nicht einmal wie einer, der gut über die Runden kommt. Das Geld, das er Leuten wie Mary Mucci abknöpft, scheint er gleich weiterzuleiten. Oder er versteckt es irgendwo. Vielleicht geht’s ihm nur um den Thrill. Auch danach kann man gierig sein.
»Ja, bitte?«, sagt Max.
»Ich will mit Ihnen reden«, sagt Jack. »Lassen Sie mich rein.«
»Wer sind Sie?«
»Mary Mucci schickt mich.«
»Ach nö. Ich hab Mary schon hundertmal gesagt, dass ich ihr Geld bald hab. Alles Nötige ist veranlasst. Glaubt sie etwa, dass ich sie im Regen stehen lasse? Dann wär mein Ruf hinüber. Ich hab noch mehr Kunden. Wir sitzen alle im selben Boot. Wer denkt, dass ich eine Gelddruckmaschine hab, irrt sich, so einfach läuft das nicht.«
»Lassen Sie uns drinnen weiterreden.«
»Mir passt es hier besser.« Max nimmt einen Schluck Milch.
Jack drängt sich an ihm vorbei in das Büro. Es ist ein wahres Loch. Stapelweise Aktenmappen auf Aktenschränken, die an den Kanten rosten. Ein mit Rechnungen, Berichten und Handbüchern übersäter Schreibtisch, dazwischen noch Computer und Telefon. Statt eines schicken ergonomischen Bürostuhls steht dahinter ein Klappstuhl, wie sie in Kirchenkellern lagern. Der Papierkorb neben dem Schreibtisch quillt von leeren kleinen Milchkartons über. Der dünne Teppich ist an mehreren Stellen so abgetreten, dass die Bodendielen durchscheinen. In dem Licht, das durch die kaputten Jalousien fällt, tanzt Staub. An den Wänden hängen keine Bilder. Nur gerahmte Urkunden. Der Tisch in der Ecke biegt sich unter dem gedrungenen schwarzen Safe in der Größe eines Campingkühlschranks. An den Wänden stapeln sich mannshoch CDs. Es riecht muffig und abgestanden wie in einer Junggesellenbude. Der Raum ist Teil einer größeren Wohnung. Soweit Jack sagen kann, gehört Max das ganze Eckgebäude. Eine ramponierte Tür – an der ungefähr in Augenhöhe ein Pin-up-Kalender aus der Siebzigern hängt – scheint in den nächsten Raum zu führen, aber sie ist geschlossen.
»Das Haus gehört Ihnen, was?«, sagt Jack.
»Ja.« Max bleibt auf der Türschwelle stehen und drückt nervös die Milchpackung zusammen. Er scheint ernsthaft zu überlegen, ob er auf die Straße laufen und nach Hilfe rufen soll.
»Was ist sonst im Haus?«
»Nicht, dass Sie das was angeht, aber es ist ein Lager. Vor allem CDs. Nebenher hab ich einen CD-Vertrieb. Wie BMG. Interessieren Sie sich für CDs? Ich kann Sie in den Verteiler aufnehmen.«
Jack sieht sich um und betrachtet einige der aufgehängten Urkunden. Max’ Diplom von der St. John’s. Ein Buchhaltungszertifikat. Irgendeine notariell beglaubigte Urkunde.
»Wie darf ich Sie nennen?«, fragt Max und mustert Jacks Arbeitsstiefel, die Jeans und sein altes Brooklyn-Battlers-Softballshirt mit den blauen Ärmeln. Mit Mitte zwanzig hatte Jack es sechs Spielzeiten lang getragen, als er dachte, es wäre lustig, am Wochenende auf heißem Asphalt in einer Freizeitliga zu spielen. Das Shirt ist mittlerweile zu eng. »Bei der Hitze lohnt es sich nicht, sich schick zu machen, was? Wie wär’s mit Mr. Blue Sleeves? Ich nenn Sie Mr. Blue Sleeves, okay?«
»Machen Sie die Tür zu und setzen Sie sich.«
»Ich mag solche Spielchen nicht, Mr. Blue Sleeves. Aber wenn Sie mir einen Moment geben, ruf ich meinen Freund Charlie French an und bitte ihn her. Er mag solche Spielchen.«
Vage erinnert sich Jack, den Namen in der Zeitung gelesen zu haben. Eins dieser Arschlöcher aus Bay Ridge. Ein Niemand, der es geschafft hat, dass man ihn wichtig nimmt. Seine Frau hat ihm einen Batzen Geld hinterlassen. Angeblich hat er sie umgebracht. Max und der passen gut zusammen.
»In ein paar Wochen muss Charlie nach Florida«, fährt Max fort. »Geschäftlich. Aber im Moment ist er hier, und ich bin sicher, dass er Sie gern kennenlernen würde.«
»Geht das Geld, um das Sie hart arbeitende alleinerziehende Frauen und kleine alte Ladys bringen, an ihn? Oder stecken Sie mit den Brancaccios unter einer Decke? Weil für die Einrichtung geben Sie es offensichtlich nicht aus. Oder für Klamotten.«
»Ich tu nichts Verbotenes«, sagt Max.
»Schließen Sie endlich die Tür. Ich will nur mit Ihnen reden.«
Max schnaubt, aber dann schließt er die Tür. An seinem Schreibtisch lässt er den Milchkarton in den Papierkorb fallen und setzt sich stöhnend auf seinen windigen Klappstuhl. Er legt die Ellbogen auf den Schreibtischrand und stößt dabei gegen die verstaubte Tastatur. Von der Anstrengung ist seine Brille beschlagen. »Okay, reden Sie«, sagt er. »Ich geb Ihnen fünf Minuten.«
»Sie geben mir so viel, wie ich will«, sagt Jack.
Max verschränkt die Hände und seufzt. Wie er so dasitzt, sieht er aus wie der erschöpfte Rektor einer trostlosen Mittelschule. »Gut.«
Jack zieht die Waffe aus dem Hosenbund. Er zeigt sie Max. »Sie ist nichts Besonderes, aber sie tut, was sie soll.«
»Sie bedrohen mich in meinem eigenen Büro?«, fragt Max.
»Ich sage Ihnen nur, dass Sie Mary ihr Geld wiedergeben sollen. Wahrscheinlich haben Sie Hunderte oder sogar Tausende Leute reingelegt, aber mir geht es nur um Mary.«
»So läuft das System aber nicht.«
»Ich weiß, wie Schneeballsysteme laufen, und Sie werden dafür geradestehen müssen. Persönlich. Zahlen Sie das Geld aus Ihrer eigenen Tasche zurück. Leihen Sie es sich von Ihrer Familie oder einem Freund. Ist mir scheißegal.«
»Sie verstehen das nicht.«
»Kann gut sein. Wo ist die Kohle hin? Für Sie sind das wahrscheinlich nur Zahlen, aber wo ist die richtige Kohle?«
Max seufzt erneut. Er setzt die Brille ab und reibt sich die Augen. »Da sind Leute, denen ich das Geld geben muss«, sagt er.
»Dann sind Sie also nur eine Fassade?«
»Nein, bin ich nicht. Ich hab das Geschäft aufgezogen, alles ganz legal. Aber schauen Sie mich an, viel hab ich nicht davon. Ich hab die Kontrolle verloren.«
Jack glaubt zu verstehen. Max ist in Schwierigkeiten geraten – wie jetzt auch – und hat die Falschen um Hilfe gebeten. Und jetzt wird er sie nicht mehr los. Jedenfalls vermutet er das, und mehr muss er auch nicht wissen.
»Hören Sie zu«, sagt Jack, »Sie haben sich da was ausgedacht, das ziemlich übel ist. Vielleicht weil Sie geldgeil sind. Vielleicht haben Sie auch ernsthaft geglaubt, dass die Sache funktioniert. Egal, jedenfalls ist es Ihnen über den Kopf gewachsen, und jetzt fällt alles wie ein Kartenhaus zusammen. Zu den richtig miesen Arschlöchern gehören Sie nicht, die kenne ich. Sie verdienen es nicht, wie ein Hund zu verrecken, aber so wird es ausgehen. Nicht unbedingt durch mich. Kann irgendjemand sein. Ich bin sicher, dass genügend Leute rumlaufen, die eine Stinkwut auf Sie haben.«
Max ist den Tränen nahe. »Wollen Sie mir was tun? Bitte tun Sie mir nichts, ja? Ich wohne bei meinen Eltern. Sie haben nur mich. Ich muss meiner Mutter heute Abend ihre Medikamente geben. Bluthochdruck. Und meinem Vater bringe ich einmal die Woche ein Twinkie mit. Heute ist wieder Twinkie-Abend. Was soll er denn machen, wenn er heute keins kriegt?«
»Twinkie-Abend?«
»Ja.« Max verliert völlig die Fassung und fängt an zu heulen.
»Hören Sie mit der Heulerei auf«, sagt Jack.
Aber Max hört nicht auf. Er klagt wie eine italienische Großmutter, die sich bei einer Beerdigung auf den Sarg wirft und eine Riesenshow abzieht. Herrgott noch mal, als ob dieser milchtrinkende Jammerlappen einen Oscar gewinnen wollte. Aus seiner Nase baumelt eine Rotzfahne, und in seinen Mundwinkeln sammelt sich Spucke. »Meine Arbeit bedeutet mir alles«, sagt Max.
Jack tritt zu ihm und dreht die Waffe in der Hand. Er wird ihn nicht erschießen, aber er soll wissen, dass er es ernst meint. Wenn er ihm das durchgehen lässt, was wird Max daraus lernen? Nur, dass er mit seiner Heulerei alles erreicht.
Erschrocken will Max auf seinem Stuhl zurückweichen, wenigstens versucht er es. Es ist nicht ganz einfach, das billige Klappteil nach hinten zu schieben, wenn die Beine sich im Teppich verhakt haben. »Bitte«, sagt Max.
Als Max noch etwas sagen und um eine Gnadenfrist betteln will, schlägt Jack mit dem Revolvergriff zu. Er trifft die Nase, volle Breitseite. Max stöhnt auf. Instinktiv legt er seine Linke übers Gesicht, wie ein Schuljunge an seiner Bank, der plötzlich Nasenbluten kriegt. Und Blut ist überall, es tropft vom Kinn auf das gelbe Hemd und in die Stiftschutzhülle, auf die Rechnungen, Berichte und Handbücher auf dem Schreibtisch. Jack bemerkt, dass auch Max’ Brille kaputt ist. Er muss den Nasenrücken getroffen haben. Ein Glas ist rausgefallen, das andere gesprungen. Das Winseln hört nicht auf.
»Du biegst das mit Mary hin, ja?«, sagt Jack und tritt zurück.
Max’ Rechte schießt vor und reißt die rechte Schreibtischschublade auf.
Zuerst denkt Jack, dass er nach einem Taschentuch sucht, aber dann kommt ihm, dass Max eine Waffe dort liegen haben könnte. Jack dreht die Pistole zurück.
Max zieht eine Waffe raus. Nichts Großes, aber ausreichend. Eine dieser fummeligen kleinen Damenpistolen. Max richtet sie auf Jack, auch wenn er durch die kaputte Brille kaum etwas sieht und sich außerdem eine Hälfte seines blutenden Gesichts zuhält. Seine Rechte zittert so stark, dass die Waffe von Jack zum Fenster, zur Wand und wieder zurück fährt. Jack fragt sich, ob Max das Ding überhaupt schon mal in der Hand gehalten hat, von abfeuern ganz zu schweigen. »Glaubst du ernsthaft, dass du hier einfach reinmarschieren und mich bedrohen kannst?«, sagt Max, und seine Stimme ist plötzlich nicht mehr verzweifelt, sondern wütend.
»Immer mit der Ruhe«, sagt Jack. Langsam geht er mit vorgehaltener Waffe auf Max zu. »Leg die Pistole hin.«
»Du zuerst.«
Jack stürzt sich vor und entwindet Max die kleine Pistole. Dann tritt er zurück, wirft einen Blick darauf und prüft, ob sie geladen ist. Nein. Er wirft sie auf den Schreibtisch. Sie landet klappernd wie ein billiges Spielzeug. »Damit hast du es dir endgültig bei mir verscherzt«, sagt Jack.
»Tut mir leid«, sagt Max. »Das war dumm.«
»Bring das mit Mary in Ordnung«, sagt Jack. Er steckt die Waffe zurück in den Hosenbund und geht. Den blutenden Max lässt er am Schreibtisch zurück. Als er aus der Haustür tritt, hört er wieder Stöhnen und Wehklagen. Er stellt sich vor, wie Max einen Stapel Rechnungen an sein Gesicht presst. Auf der anderen Straßenseite kramt eine Frau mit Einkaufswagen leere Flaschen aus einem Mülleimer. Nach dem dunklen, muffigen Büro kommt es ihm an der frischen Luft besonders strahlend vor.
Zurück an seinem Auto, steigt Jack ein und macht es sich hinter dem Lenkrad bequem. Der Oldies-Sender spielt Dions »(I Was) Born to Cry«. Er legt die Waffe zurück ins Handschuhfach und sitzt da und hört Musik. Die Lautstärke ist so hochgedreht, dass die Scheiben vibrieren. Das Johnny-Thunders-Cover des Songs gefällt ihm auch. Die Platte muss irgendwo zu Hause rumliegen. Johnny Thunders and Patti Palladin, Copy Cats. Vielleicht oben im Dachgeschoss. Die muss er bei Zig Zag Records gekauft haben. Wenn eine neue Platte von Lou Reed oder Johnny Thunders rauskam, war er sofort dorthin. Das hörte schlagartig auf, als Janey krank wurde. Plötzlich verlor Musik jede Bedeutung. Aber inzwischen macht es ihm wieder Spaß, Musik zu hören.
Als der Song zu Ende ist und Werbung kommt, fährt er los. Ein paarmal links abgebogen, dann ist er zurück auf der Fourth Avenue, und im nächsten Moment braust er mit offenen Fenstern über den Belt Parkway. Er überlegt, was er jetzt tun soll. Vielleicht ins Wrong Number auf ein Bier. Oder doch heim und unterm Dach nach seinen alten Platten suchen. Allerdings ist fraglich, ob der Plattenspieler überhaupt noch funktioniert – er hat ein großes Stück Stoff darum geschlagen und ihn in den Keller gestellt. Eine neue Nadel wird er auf jeden Fall brauchen. Vielleicht sind in der Werkbank seines Vaters noch welche. In den Siebzigern hat er eine Zeit lang nebenher Plattenspieler repariert. Morgen im Laufe des Tages wird er Mary Mucci einen Besuch abstatten, überlegt Jack, und ihr sagen, dass Max das Geld zurückzahlen wird.
Jetzt kommt wieder Musik. Bill Withers, »Lean on Me«. Einer dieser Songs, die nichts von ihrem Glanz verlieren, egal wie oft man sie hört. Höchstens werden sie besser. Heute bedeutet er ihm viel mehr als damals, als er ihn das erste Mal hörte.
Der bisher ruhig fließende Verkehr fängt an, sich zu stauen, und dann geht plötzlich nichts mehr. Er bereut es, nicht den Schleichweg genommen zu haben. Jetzt steckt er zwischen der Fourteenth Avenue und der Abfahrt zum Bay Parkway fest – wahrscheinlich nicht einmal zwei Kilometer, aber das kann dauern. Wenn er aussteigen und gehen würde, wäre er schneller zu Hause. Immer ist was.
Er dreht das Radio leiser und reckt den Hals, um zu sehen, was weiter vorne passiert. Noch ist nicht Rushhour, es muss also einen Unfall gegeben haben.
Das Aufheulen von Sirenen bestätigt seine Vermutung. Vielleicht ist ein Trottel zu schnell gefahren und hat sich überschlagen. Passiert ständig auf dem Belt. Immer diese Angeber in ihren frisierten Schlitten, die glauben, sie wären auf einer Rennstrecke. Dann passiert so was.