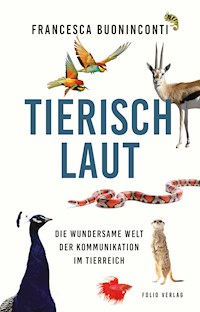Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folio Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Auf den Spuren eines der unglaublichsten Naturereignisse: die abenteuerlichen Reisen der Tiere um den Planeten. Alljährlich wiederholt sich die weltumspannende Migration der Tiere. Nicht nur Zugvögel wechseln in riesigen Schwärmen die Kontinente, auch Milliarden von Säugetieren, Fischen, sogar Insekten gehen auf Wanderschaft. Riesige Wale ziehen von der Polarregion in tropische Gewässer, Meeresschildkröten queren die Ozeane. Selbst Schmetterlinge und die winzige Wanderlibelle legen zigtausende Kilometer zurück. Wie orientieren sich die Tiere, und vor allem: Warum brechen sie zu ihren Wanderungen auf? Spannend und überaus anschaulich erzählt Buoninconti von den Überlebensstrategien dieser Wanderer und davon, wie sehr Klimawandel und Umwelteingriffe jahrtausendealte biologische Zyklen bedrohen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francesca Buoninconti
Grenzenlos
Foto: Michele Soprano
DIE AUTORIN
Francesca Buoninconti hat Naturwissenschaften mit Schwerpunkt Ornithologie studiert und schreibt als Wissenschaftsjournalistin für verschiedene Print- und digitale Medien, u. a. für La Repubblica, Micron und Vanity Fair, und arbeitet für den Rundfunk.
FRANCESCA BUONINCONTI
GRENZENLOS
DIE ERSTAUNLICHEN WANDERUNGEN DER TIERE
Aus dem Italienischen von Werner Menapace
Inhalt
EinleitungVon Reisen, Kompassen und Uhren
Teil I – Ein Leben im Flug
Kapitel 1:Das Versprechen der Wiederkehr
Kapitel 2:Wohin ziehen die Zugvögel?
Kapitel 3:Eine Frage von Generationen
Kapitel 4:Jenseits der Dunkelheit
Teil II – Wasserwege
Kapitel 5:Die magnetische Anziehung der Strände
Kapitel 6:Auf den Routen der Giganten
Kapitel 7:Unterwegs im Ozean
Kapitel 8:Der Geruch von Zuhause
Teil III – Ein langer Marsch
Kapitel 9:Auf dem Eis der Antarktis
Kapitel 10:Der Kreislauf des Lebens
Kapitel 11:Die grüne Welle
Kapitel 12:Nächtliche Spaziergänge
Kapitel 13:Weihnachtsrituale
Kapitel 14:Die Zukunft der Wanderungen
Dank
Einleitung
Von Reisen, Kompassen und Uhren
Frühmorgens an einem heißen Tag Mitte Juni. Hinter dem Kalksteinplateau der Murge in der süditalienischen Basilikata guckt die Sonne hervor. Sie bringt die Luft zum Erröten, lässt die Kornfelder in den unzähligen Farben des Goldes erstrahlen, weckt spärliche Mohnblumen auf und taucht die Sassi, die Höhlensiedlungen von Matera, in ein leuchtendes Rosa, das ins Gelb spielt. Die Stadt schläft noch, doch zwischen den Häusern und unten in den zerklüfteten Schluchten hallt bereits das Gezwitscher der Schwalben wider.
Die Botschafterinnen des Frühlings schießen durch die engen Gassen, deren Steinpflaster vom ständigen Getrappel glatt poliert ist. Sie spielen Verstecken zwischen den porösen Mauern, an denen sich da und dort Kapernsträucher hochranken. Sie stürzen sich ins Tal hinab und gleiten im Tiefflug über den Wildbach Gravina, mit offenem Schnabel, um ein wenig Wasser aufzufangen und ihren Durst zu löschen. Dann steigen sie wieder hoch und machen sich erneut auf die Jagd nach Fliegen und Mücken. Den Schnabel voller geflügelter sechsfüßiger Leckerbissen, fliegen sie zum Nest, wo die kreischenden Jungschwalben sie erwarten. In ein paar Stunden, wenn die Luft sich erwärmt hat, werden die Rötelfalken auf der Suche nach Heuschrecken, Maulwurfsgrillen und Libellen über die vor Kurzem gemähten Kornfelder fliegen. Kleine und elegante Falken mit ziegelrotem Rücken und blassen, messerscharfen Krallen.
Beide kamen zu Beginn des Frühlings nach Europa, die einen etwas früher, die anderen später. Dort trafen sie ihre Partner wieder und bezogen das am Ende des vorigen Sommers aufgegebene Nest. Die anspruchsloseren Rötelfalken begnügten sich mit Spalten in den Kalkmauern, Nischen an Denkmälern und Hohlräumen unter den Dachziegeln, um eine Familie zu gründen. Die akkurateren Schwalben richteten die alte Bleibe wieder her, indem sie Erdkrümel und Grashalme mit Speichel verklebten, um Risse zu reparieren und den Rand des Nestes zu glätten. Dann sammelten sie feinste Federn, um damit das Nestinnere auszukleiden und es für die Eier und den Schwalbennachwuchs weich und behaglich zu machen. Jetzt, zu Beginn des Sommers, richtet sich ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Neugeborenen.
Ende August aber, wenn die jungen Rötelfalken völlig selbstständig und auch die Jungschwalben flügge sind, wird es Zeit, wieder aufzubrechen. Sobald der Abend hereinbricht, sammeln sich die Falken im Schlafsaal einer großen Strandkiefer im Zentrum von Matera. Dasselbe tun die Schwalben, im Röhricht oder auf den Strom- und Telefonleitungen vor den Ställen oder Garagen, in denen sie gebrütet haben. An einem der letzten August- oder ersten Septembertage verlassen sie dann das Land, um über die Sahara hinweg in den tiefen Süden zurückzukehren, wo sie den Winter verbringen. Am Ende des Winters beginnen sie aufs Neue: Sie kehren nach Europa zurück, pflanzen sich fort und fliegen wieder nach Afrika, Jahr für Jahr, ein Leben lang, in einer endlosen Reise: der Migration.
Doch nicht nur Schwalben und Rötelfalken wandern. Über unseren Planeten ziehen Milliarden von Wandertieren: Vögel, Meeres-, Land- und Flugsäugetiere, Fische, Amphibien, Reptilien, Insekten und andere wirbellose Tiere. Die Giganten der Meere, die Wale, wandern ebenso wie einige der anmutigsten Tiere: die Schmetterlinge. Klein oder groß, allein oder in Gruppen, legen sie jedes Jahr Tausende von Kilometern zurück und nehmen dabei auf unsicheren Routen Schwierigkeiten und Gefahren in Kauf, die sie das Leben kosten können. All das, um sich fortzupflanzen und genügend Nahrung zu finden. Doch wie schaffen sie es, ihren Bestimmungsort zu erreichen? Wie orientieren sie sich dabei und wie gelingt es ihnen, jedes Jahr genau an den Ort zurückzukehren, an dem sie geboren wurden? Und vor allem: Warum wandern sie überhaupt?
Auf diese und weitere Fragen suchte der Mensch in seiner Neugier seit jeher eine Antwort. Doch die ersten Hypothesen darüber waren, gelinde gesagt, voll blühender Fantasie.
Bereits im 4. Jahrhundert v. Chr. hatte Aristoteles festgestellt, dass die Schwalben im Winter fortblieben und im Frühling wiederkamen. Doch trotz seines Scharfsinns und der umfassenden Arbeit an der Historia animalium gelang es dem griechischen Denker nie, das Geheimnis zu lüften. Tatsächlich ist er ihm noch nicht einmal nahegekommen.
Die gängigste Auffassung jener Zeit war, die Vögel flögen bis zum Mond, um dann im Frühling auf die Erde zurückzukehren. Oder sie ließen sich im Herbst im Laubwerk der Bäume nieder, um beim Fallen der Blätter auch ihr Federkleid abzulegen und sich in Zweige zu verwandeln. Laut Aristoteles verwandelten sich die Rotkehlchen nach dem Ende des Winters in Rotschwänzchen: Die rötliche Farbe würde von der Brust auf den Schwanz übergehen. Heute wissen wir, dass beide derselben zoologischen Familie, jedoch verschiedenen Arten angehören. Die merkwürdigste und zugleich langlebigste Erklärung betrifft jedoch die Wanderung der Schwalben. Laut Aristoteles ließen sich die Schwalben am Ende des Sommers auf den Schilfrohren der Seen nieder, verlören ihr Gefieder und verwandelten sich in Frösche. Sie verbrächten den Winter als Amphibien, um dann im Frühling wieder mit leuchtend blauen Flügeln aus dem Wasser aufzutauchen.
Heute entlockt uns diese Hypothese ein Lächeln, doch bis ins 18. Jahrhundert hinein waren sogar Wissenschaftler wie Linné und Cuvier bereit, auf den Wahrheitsgehalt dieser Theorie zu schwören, wobei sie sich auf „schlagende Beweise“ stützten: die Erzählungen von ein paar Fischern, die „erstarrte“ lebendige Schwalben unter der gefrorenen Oberfläche eines Sees gesehen haben wollten. Das einzig Wahre an der Geschichte ist, dass sich die Schwalben, bevor sie nach Afrika ziehen, zu Tausenden in kleinen Grüppchen versammeln und oft auf Schilfrohren niederlassen, um dort gemeinsam die Nacht zu verbringen und im Morgengrauen loszufliegen.
Aristoteles hat sich freilich nicht nur für die Zugvögel interessiert. Er hatte auch über den Roten Thun eine Theorie: Im Winter versteckten sich diese Fische in eiskalten und sehr tiefen Gewässern, um sich im Frühling wieder den Küsten zu nähern. Plinius der Ältere hingegen beschreibt einige Jahrhunderte später in seiner Naturalis historia die Wanderung der Kraniche, einer Vogelart, die zu jener Zeit gejagt wurde. Er bewundert die V-Form des Schwarms, die hilfreich ist, um die Luft zu durchschneiden. Aber auch hier vermischen sich Wissenschaft und Fantasie. Nach Plinius gibt es im Schwarm einen „Wächter“, der die Aufgabe hat, die Gefährten während des Fluges wach zu halten und sie vor einer etwaigen Gefahr zu warnen, wenn sie zum Rasten anhalten. Dazu muss der Wächter mit dem Fuß einen Stein festhalten: Wenn er einschläft, wird er ihn fallen lassen, und die anderen Kraniche merken dann, dass er seine Pflicht vernachlässigt hat.
Wir müssen weitere 1.000 Jahre warten, um genauere Kenntnisse zu erhalten, zumindest über den Vogelzug. Bis nämlich der Stauferkönig Friedrich II. in seinem De arte venandi cum avibus – einer Abhandlung über die Falknerei mit über 500 Illustrationen – etwa 80 Vogelarten, das Verhalten der Schwärme, die zeitlichen Abläufe der Wanderung und einige Besonderheiten des Gefieders und des Fluges beschreibt.
Die ersten Fragen der Wissenschaft zum Phänomen der Wanderungen gibt es jedoch erst Ende des 19. Jahrhunderts. Angefangen mit der wichtigsten: Warum unternehmen die Wandertiere eine so lange und gefährliche Reise? Wäre es nicht besser für sie, immer am gleichen Ort zu bleiben?
Die meisten wandernden Tierarten leben an Orten mit wechselnden Jahreszeiten. Und sehr oft bringt es der Wechsel der Jahreszeiten und der Produktionszyklen mit sich, dass die günstigen, auch im Winter nahrungsreichen Gegenden nicht die besten sind, um sich fortzupflanzen. Der beste Ort, um sich zu ernähren, ist also nicht unbedingt der beste, um die neue Generation zur Welt zu bringen, und umgekehrt. So sind die Wandertiere zum Ziehen gezwungen, um extremer Hitze oder Kälte zu entfliehen und um ideale Bedingungen für die Fortpflanzung und genügend Nahrung für sich selbst und den Nachwuchs zu finden.
Für die Zugvögel, die im Frühling in Europa eintreffen, ergeben sich zwei große Vorteile. Zum einen finden sie in dieser Zeit in unseren Breiten eine Fülle von Blüten, Früchten und Insekten. Zum anderen werden die Tage länger: Sie haben also mehr Stunden Tageslicht zur Verfügung, um Nahrung zu sammeln. Das heißt, sie können in kurzer Zeit mehr Nahrung finden und dadurch vielleicht sogar mehr als eine Brut aufziehen. Würden sie dagegen in Afrika bleiben, hätten sie diesen ganzen Überfluss nicht. Wenn in Europa der Sommer zu Ende geht und der Winter naht, ziehen sie es vor, nach Afrika zurückzukehren, wo sie einen neuen „Frühling“ vorfinden. Dasselbe gilt für viele andere Arten, die in andere Kontinente ziehen.
Man reist also, weil die Vorteile, die sich aus der Ankunft am Zielort ergeben, den Aufwand rechtfertigen: Man könnte sagen, dass die Wandertiere den wahrscheinlichen Tod in Kauf nehmen, um dem sicheren Tod zu entgehen.
Manchmal ist die Wanderung obligatorisch, weil die idealen Bedingungen für die Fortpflanzung in Gebieten herrschen, die dem Habitat der Tiere diametral entgegengesetzt sind. Denken wir nur an die Meeresschildkröten, die ihr Leben im Ozean verbringen, ihre Eier aber an Stränden ablegen, auf dem Trockenen. Oder die Lachse, die zum Laichen aus dem Meer die Flüsse hinaufziehen müssen.
Kurzum, die Wandertiere sind – ein Leben lang oder auch nur einmal, wie etwa die Lachse – zum Pendeln gezwungen. Sie wandern zyklisch und in regelmäßigen Abständen, stets entlang der gleichen Routen, eine Generation nach der anderen, zwischen einem genau festgelegten Ausgangspunkt und einem ebensolchen Ankunftsort hin und her. Die Wanderung definiert sich also nicht über die zurückgelegte Entfernung, die überschrittenen Grenzen oder die für den Ortswechsel benötigte Zeit. Sie ist lediglich ein jahreszeitliches und zyklisches Pendeln vom Fortpflanzungsgebiet in eine Gegend, in der sie gewöhnlich die restliche Zeit verbringen.
Wann es jedoch den ersten wandernden Tieren in den Sinn kam, kreuz und quer über den Planeten zu ziehen, weiß man noch nicht. Der Ursprung der Wanderungen verliert sich im Dunkel der Vorzeit. Den plausibelsten Theorien zufolge sei das Phänomen der Wanderung im Neogen aufgekommen, jenem Abschnitt der Erdgeschichte, der vor über 2,5 Millionen Jahren zu Ende ging, und habe sich in den darauffolgenden Glazialphasen des Quartärs voll entwickelt. Seit der letzten Eiszeit, der Würm-Kaltzeit, die vor ungefähr 12.000 Jahren endete, seien die Routen dann mit der Konsolidierung des Klimas weitgehend gleich geblieben. Weitgehend – aber nicht völlig –, weil sie sich heute noch weiterentwickeln. Auch die Wandertiere müssen nämlich mit den jüngsten Klimaveränderungen fertigwerden, die das Gesicht der Erde verändern. So sind sie häufig gezwungen, ihr angestammtes Areal zu wechseln oder die Routen zu ändern, oder sie werden von der Temperatur in die Irre geführt und starten zu früh oder zu spät. Und das hat schwere Auswirkungen auf ihr Überleben.
Wir können aber sagen, dass das Phänomen der Wanderungen sehr wahrscheinlich schrittweise aufgetreten ist, in Etappen, und dass die Vorfahren der heutigen Wandertiere demnach sesshaft waren. Aus irgendeinem Grund – Klima oder Nahrung – haben wohl einige Populationen zu wandern begonnen und dabei nach den günstigsten Bedingungen gesucht, und die natürliche Auslese hat das ihre getan und sie unterstützt.
Die am besten untersuchte Tierklasse sind zweifellos die Vögel. Wohl deshalb, weil es Tausende von Arten gibt, viele mit vergleichbarem Verhalten, leicht zu sehen, zu beobachten und für Forschungszwecke zu züchten. Trotz allem konnte man noch nicht herausfinden, in welchem Teil der Erde die „sesshaften Vorfahren“ der heutigen Zugvögel beheimatet waren. Dazu gibt es zwei gegensätzliche Theorien. Einigen Wissenschaftlern zufolge hätten sie in den Tropen gelebt und ihre Brutareale dann allmählich nach Norden verschoben, vielleicht nach dem Ende der Eiszeit. Für andere dagegen ist genau das Gegenteil eingetreten: Die Vorfahren hätten in gemäßigten Breiten gelebt und seien allmählich nach Süden gezogen.
Dieser Ansicht sind Forscher wie Benjamin Winger und Richard Ree von der Universität Chicago, die die Entwicklungsgeschichte der Ammern – einer Familie von kleinen Sperlingsvögeln, die Zugvögel und Standvögel umfasst – untersuchten, wobei sie sich auf die amerikanischen Arten konzentrierten. Sie kamen zu dem Schluss1, dass die Familie ursprünglich aus Nordamerika stamme. Dann habe sie begonnen, immer weiter nach Süden zu fliegen, bis nach Südamerika, wohl um der kalten Jahreszeit zu entfliehen. Und so habe sie einerseits wandernde Arten, die Tausende Kilometer zwischen den beiden Kontinenten zurücklegen, und andererseits sesshafte Arten hervorgebracht.
Viele Zugvogelarten schaffen es, in wenigen Generationen zu Standvogelarten zu werden oder umgekehrt, was eine Regulierung auf genetischer Basis voraussetzt. Es gilt aber zum Beispiel keineswegs für die Meeresschildkröten. Dem bekannten amerikanischen Herpetologen Archie Carr zufolge sei bei der Wanderung der Grünen Meeresschildkröte (Chelonia mydas) von Brasilien zur Insel Ascension, wo sie ihre Eier ablegt, sogar die Kontinentaldrift im Spiel. In seiner im Wissenschaftsmagazin Nature veröffentlichten Untersuchung2 vertrat Carr die Ansicht, dass vor Millionen Jahren, als die Vorfahren der Grünen Meeresschildkröten ihre Wanderungsmuster entwickelten, Afrika und Südamerika sehr viel näher beieinander lagen als jetzt. Einige Populationen ernährten sich bevorzugt in Südamerika und pflanzten sich an den Stränden Afrikas fort. Während des allmählichen Auseinanderdriftens der Kontinente zu Beginn des Tertiärs waren diese Meeresreptilien gezwungen, immer größere Entfernungen zurückzulegen, wobei ihnen vielleicht die Insel Ascension zunächst als Zwischenetappe und dann als Endstation diente. Diese Theorie wurde jedoch nicht validiert und die Wanderung der Schildkröten bleibt weiterhin ein Rätsel.
Wir wissen also nicht viel darüber, wann und wie die Wanderungen begonnen haben; viel muss noch erforscht und verifiziert werden. Andererseits gibt es eine Menge Fragen, auf die wir zufriedenstellende Antworten gefunden haben.
Wie wissen die Wandertiere, wann es Zeit zum Aufbruch ist? Und wie schaffen sie es, sich zu orientieren und auf Kurs zu bleiben? Sie haben weder Navigationssoftware noch Kompass oder Uhr … oder vielleicht doch? Sie haben etwas sehr Ähnliches, einzigartige Systeme, die im Lauf der Evolution und der Generationen verfeinert wurden.
Viele reisen allein oder in kleinen Gruppen, und in Gesellschaft zu reisen ist eine große Hilfe: Es verringert die Wahrscheinlichkeit, von Raubtieren angegriffen zu werden. Der Zeitplan dagegen wird hauptsächlich durch den Tag-Nacht(Zirkadian)- und den Jahresrhythmus reguliert, aber auch durch die Temperatur und hormonelle Faktoren, die alle zusammenspielen. Die Epiphyse, eine endokrine Drüse, die im Gehirn aller Wirbeltiere vorhanden ist, reagiert zum Beispiel sensibel auf die Fotoperiode. Das ist wesentlich, weil die Epiphyse das Hormon Melatonin produziert, das den zirkadianen Schlaf-Wach-Rhythmus regelt und die Tätigkeit der Eierstöcke beeinflusst. Eine andere Drüse, die Hypophyse, produziert hingegen Hormone, die von entscheidender Bedeutung für das Körperwachstum, die Fortpflanzung und das Funktionieren des Stoffwechsels sind. Dazu gehören die Gonadotropine und das Prolaktin, ein Hormon, das unter anderem bei den Wanderungen von Amphibien, wie den Salamandern und Molchen, eine Rolle spielt. Auch die Tätigkeit der Hypophyse wird durch Lichtreize reguliert, also durch die Tageslänge, sowie durch Temperaturschwankungen.
Dank der hormonellen Reize, die durch den Wechsel der Jahreszeiten und die Tageslichtdauer reguliert werden, wissen die Wandertiere also, wann es Zeit zum Aufbruch ist. Sie wissen aber auch, wie sie ihr Ziel erreichen. Der Bestimmungsort ist meistens der Strand, der Fluss, das Gebüsch oder der Meeresabschnitt, an dem sie geboren sind. Sie besitzen also eine ausgezeichnete Fähigkeit, „nach Hause“ zurückzukehren: ein Prozess, den man homing nennt. Das heißt, sie prägen sich einige Faktoren ein, etwa den Geruch, die Position im Erdmagnetfeld oder auch optische Elemente, die – in nächster Umgebung – ihr Zuhause kennzeichnen. Und das tun sie unmittelbar, nachdem sie geboren wurden. Sie haben also eine Art Prägung (imprinting) im Hinblick auf den Geburtsort. Ein bisschen wie wir Menschen: Sobald wir unsere Haustür sehen, sind wir sicher, dass wir zu Hause angelangt sind, weil wir sie uns visuell eingeprägt haben. Auch den Geruch unseres Zuhauses erkennen wir sofort wieder. Würden wir aber eines Tages an unserem Treppenabsatz ankommen und eine neue Tür vorfinden, würden wir sicher einen Moment zögern. So ergeht es vielen Wandertieren: Wenn man optische Bezugspunkte in der Umgebung verschiebt, sind sie desorientiert und kontrollieren beharrlich, was da nicht stimmt. Das passiert sogar den Grabwespen, die keine Wandertiere sind, aber eine erstaunliche Fähigkeit zum homing haben.
Die Wandertierarten kennen also die Koordinaten ihres Zuhauses, dessen Aussehen und Geruch. Aber dorthin zu gelangen, indem sie der besten Route folgen, die in Jahren der Evolution optimiert wurde, ist ein anderes Paar Schuhe.
Wir können eine erste große Unterscheidung treffen, und zwar zwischen denen, die allein, und denen, die in Gruppen reisen. Einzelwanderer wie etwa viele Vögel brauchen den Kurs, dem sie folgen müssen, nicht zu lernen. Ihre Routen sind genetisch vorbestimmt: Richtung und Entfernung, die bei jeder Etappe zurückzulegen sind, sind in die Gene „eingeschrieben“. Kurz gesagt, das Wissen, wann sie „abbiegen“ müssen, ist ihnen angeboren. Andere dagegen müssen die richtige Route lernen und tun dies kurz nach der Geburt, auf der ersten Reise gemeinsam mit den Eltern.
Um sich auf der langen Reise zu orientieren, nutzen Wandertiere verschiedene Anhaltspunkte. Hauptsächlich sind das die Sonne, die Sterne und das Erdmagnetfeld, mal nur einen davon oder auch alle zusammen. Erst wenn sie in die Nähe ihres Zuhauses kommen, vertrauen sie ihrem Seh- und Geruchssinn. Ein bisschen wie wir Menschen: Wenn wir in eine neue Straße kommen und die Hausnummer suchen, die man uns angegeben hat, tun wir das mit den Augen, auch wenn wir uns bis dahin mithilfe anderer Mittel orientiert haben. Oder wir merken zum Beispiel, dass wir uns einer Bäckerei nähern, wenn uns der köstliche Duft von frisch gebackenem Brot in die Nase steigt.
Vor allem die Vögel verwenden die visuelle Erinnerung auf der Reise manchmal wie eine Art double check. Die Route wird ständig anhand einer Reihe von optischen Anhaltspunkten überprüft: Zu ihnen zählen nicht nur Gebirgsketten und andere natürliche Landmarken, sondern auch von Menschen errichtete Bauwerke. Ein Beispiel: In Europa nistende Zugvögel nutzen die Autobahn A1 Mailand-Neapel in dieser Weise.
Wer tagsüber wandert und dabei die Sonne sehen kann, orientiert sich meist mithilfe eines Sonnenkompasses. Das bedeutet jedoch, dass er die scheinbare Bewegung der Sonne berücksichtigen und den Kurs entsprechend korrigieren muss. Wollte ein Tier im Morgengrauen, wenn die Sonne am Horizont steht, nach Norden aufbrechen, wäre seine Richtung durch einen Winkel von 90° zur Senkrechten des Gestirns bestimmt. Im Lauf des Tages ändert die Sonne aber infolge der Erdumdrehung ihre Position: Sie verschiebt sich scheinbar jede Stunde um 15°. Darum würde das Tier, wenn es einen Winkel von 90° zur Sonne beibehielte, ganz woandershin gelangen. Doch die Wandertiere, die auf den Sonnenkompass vertrauen, wie die Monarchfalter, sind hundertprozentig in der Lage, diese Variable zu berücksichtigen und den Kurs zu korrigieren, und kalibrieren den Kompass gemäß dem Tag-Nacht-Zyklus. Denn nur wenn sie die Tageszeit kennen, können sie sich genau orientieren.
Wer dagegen nachts reist, nutzt das Himmelsgewölbe, so wie die meisten Zugvögel, die Meister in dieser Kunst sind. Seit 1970 testete eine Reihe von Forschern wie Gwinner, Sauer, Emlen3 und Wilitschko4 die Fähigkeiten dieser Vögel anhand von Käfigen mit künstlichen Planetarien. Sie entdeckten dabei, dass die Vögel sich anhand der Gestirne und Konstellationen orientierten, genau wie erfahrene Seeleute. Wurde das Planetarium um 180° gedreht, orientierten sich die Vögel genau in die Gegenrichtung. Wenn man also den Himmel statt um den Polarstern um Beteigeuze im Sternbild Orion kreisen ließ, wurde Beteigeuze zu ihrem Norden. Wurden aber die zirkumpolaren Sternbilder in der Nähe des Polarsterns, wie Großer und Kleiner Bär, Drache, Kepheus und Kassiopeia abgeschaltet, waren sie nicht mehr imstande, sich zu orientieren. Das bedeutet, dass sich die Vögel nicht die Anordnung der Sterne – die wir Konstellationen oder Sternbilder nennen – einprägen, sondern sich anhand der Bewegung der Sterne um einen Mittelpunkt orientieren. Sie wissen also nicht, dass er Polarstern heißt, doch sie wissen ganz genau, dass der Stern, der den Norden anzeigt, derjenige ist, um den alle Sternbilder kreisen. Das lernen sie in den ersten Lebenswochen, in den Sommernächten, wenn sie noch im Nest hocken, einfach indem sie mit himmelwärts gerichtetem Schnabel die scheinbare Bewegung des Firmaments beobachten.
Außerdem stützen sich die Vögel und andere Wandertiere, zum Beispiel die Meeresschildkröten, auf das Magnetfeld der Erde, das vor allem bei spärlichem Licht verwendet wird: unter Wasser oder nachts5. Man könnte tatsächlich sagen, dass sich die Erde wie ein großer Magnet verhält, ein Dipol mit zwei magnetischen Polen, die etwas abseits von den geografischen Polen liegen. Die von den beiden Polen erzeugten magnetischen Kraftlinien bilden das Erdmagnetfeld, das für die Polarlichter und die Nordausrichtung unserer Kompassnadeln verantwortlich ist. Doch die Meeresschildkröten übertreffen unsere Kompasse noch: Sie können nicht nur die Nordrichtung bestimmen, sondern sind auch in der Lage, den Breitengrad zu berechnen.
Das Erdmagnetfeld ist nämlich räumlich nicht gleichmäßig stark. An den Polen ist es stärker und am Äquator schwächer, und diese Reptilien können seine unterschiedliche Intensität wahrnehmen. Sie sind zudem imstande, den Neigungswinkel (Inklination) des Magnetfeldes zu bestimmen und somit den Breitengrad zu berechnen, an dem sie sich befinden, denn je nach Entfernung von den Polen treffen die Magnetfeldlinien in unterschiedlichen Winkeln auf die Erdoberfläche. Auf diese Weise verfügen sie über eine regelrechte Landkarte: Jeder Punkt auf dem Globus wird durch das Wertepaar Intensität und Neigung eindeutig ermittelt.
Wohin auch immer sie unterwegs sind, mit einem Magnet-, Sonnen- oder Sternenkompass wissen die Wandertiere mit Sicherheit, wie sie an ihr Ziel kommen. Ob in der Luft, zu Wasser oder zu Lande spielt keine Rolle: Es ist Zeit zum Wandern.
_________________
1Benjamin M. Winger et al., Temperate origins of long-distance seasonal migration in New World songbirds, in „Proceedings of the National Academy of Sciences“, 2014, 111 (33), S. 12115–12120.
2Archie Carr und Patrick J. Coleman, Seafloor spreading theory and the odyssey of the green turtle, in „Nature“, 1974, 249, S. 128–130.
3Stephen T. Emlen, Celestial rotation: Its importance in the development of migratory orientation, in „Science“, 1970, 170, S. 1198–1201; Id., The ontogenetic development of orientation capabilities, in „Animal Orientation and Navigation“, S. 191–210. NASA SP-262, U.S. Gov. Print. Office, Washington D.C. 1972.
4Peter Berthold, Vogelzug: Eine Gesamtübersicht, Darmstadt 2017.
5Susanne Åkesson und Anders Hedenström, How migrants get there: migratory performance and orientation, in „BioScience“, 2007, 57, S. 123–133.
Teil I
Ein Leben im Flug
Kapitel 1
Das Versprechen der Wiederkehr
Am Ende des Winters unternehmen Millionen von Zugvögeln eine lange und gefährliche Reise und brechen in großer Eile in Richtung Norden auf. Sie starten vom Süden der Erde, von Afrika, wo sie die kalte Jahreszeit verbrachten, um im Frühling nach Europa zu ziehen oder nach Russland, ja bis nach Sibirien: in die sogenannte paläarktische Region. Von Süd- oder Mittelamerika bis hinauf in die Gebiete der Vereinigten Staaten und Kanadas. Oder auch vom Südosten Asiens, um nach Zentralasien zu gelangen oder bis zum nördlichen Polarkreis vorzustoßen.
Viele von ihnen sind kleine Singvögel, die kaum mehr als zehn Gramm wiegen und mehr als 10.000 Kilometer im Flug zurücklegen. Andere haben ein beträchtliches Gewicht und eine stattliche Körpergröße: Gänse, Greifvögel, Kraniche, Störche und Seevögel. Alle aber haben das Ziel, ein Versprechen zu halten, das „Versprechen der Wiederkehr“6: jedes Jahr an denselben Ort zurückzukehren, an dem sie geboren wurden, um ihrerseits zu nisten. Am Ende der Brutsaison starten sie dann erneut nach Süden, diesmal etwas gemächlicher, um an die Orte zurückzukehren, an denen sie den Winter verbringen: ihre Winterquartiere.
Die Wanderung der Vögel ist wahrscheinlich eine der eindrucksvollsten und seit jeher am besten untersuchten. Gerade deshalb haften ihr noch immer anthropozentrische Vorurteile an. Seit Aristoteles wurde sie als jahreszeitliche Erscheinung betrachtet, die jeweils im Frühling und im Herbst auftritt. Doch gemeint sind die Jahreszeiten der nördlichen Erdhalbkugel, also März bis Juni und September bis November; sie treffen auf die westliche Welt zu, in der auch die moderne Wissenschaft entstanden ist. In Wirklichkeit gibt es Arten, die bereits im Februar in den Brutquartieren eintreffen oder im August wieder wegziehen. In unserer eurozentrischen Sicht bezeichnet man den nach Norden gerichteten Vogelzug vor der Paarung, den man im Frühling beobachten kann, auch gern als „Heimkehr“ oder „Rückwanderung“, da die Vögel zum Nisten nach Europa zurückkehren. Wenn die Vögel im Herbst nach der Paarung südwärts ziehen, sagt man dagegen, sie „zögen fort“, eben weil sie Europa verlassen. Doch nur in unseren Breiten kann man dieses titanische Unternehmen zu diesen Zeiten beobachten: In Wahrheit sind die Zugvögel fast das ganze Jahr über unterwegs, praktisch ihr ganzes Leben lang.
Wie zum Beispiel der Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris), ein kleiner Sperlingsvogel, der sich in Europa fortpflanzt, in Sumpfgebieten und dichtem Schilf, den Winter aber im Süden Afrikas verbringt, zwischen der südafrikanischen Provinz Ostkap und Sambia. Wie lange ist er zwischen den beiden Kontinenten unterwegs? Nicht weniger als neun von zwölf Monaten des Jahres. Dabei muss er beim Hin- und Rückflug 20.000–25.000 Kilometer zurücklegen; nicht schlecht für eine Handvoll Federn und Flaum, die etwa 13 Gramm wiegt. Doch damit nicht genug: Um nach Europa zu gelangen, braucht er drei Monate, während er für die Rückkehr ins südliche Afrika nach der Brutzeit genau doppelt so lange braucht, nämlich sechs Monate. Obwohl die Strecke mehr oder weniger dieselbe ist. Warum also dieser große Unterschied? Die Antwort ist einfach: Im Frühling, bei der Wanderung vor der Paarung, hat er es eilig. Er hat keine Zeit zu verlieren, muss schnell fliegen und nur wenn unbedingt nötig kurze Pausen machen. Mit den Ersten einzutreffen bedeutet, sich den besten Nistplatz zu sichern, der mehr Nahrung bietet oder strategisch besser gelegen ist. Und man hat größere Chancen, einen Partner zu erobern. Kurzum, es gibt gute Gründe, sich zu sputen. Aufgrund dieser Hektik kann die „Heimkehr“ sogar nur ein Drittel der Zeit in Anspruch nehmen wie die Reise in die entgegengesetzte Richtung. Ist nämlich die Brutzeit vorbei, besteht keine Eile mehr, in die Winterquartiere zu gelangen. Daher kann man bei den Wanderungen nach der Paarung längere Pausen machen und es (verhältnismäßig) gemütlich angehen lassen: Wir sprechen hier immerhin von einer der längsten, unvorhersehbarsten und gefährlichsten Reisen, die Lebewesen in Angriff nehmen.
Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die Männchen es bei der Wanderung in die Brutgebiete noch eiliger haben als die Weibchen. Männchen und Weibchen – oder auch junge und erwachsene Tiere – der gleichen Art wandern also nicht unbedingt gemeinsam und halten auch nicht dieselben Zeitpläne ein. Wir haben es mit einer differenziellen Migration zu tun. Im Frühjahr wollen die Männchen so früh wie möglich ankommen, um ein Territorium zu erobern und es zu verteidigen. Die Weibchen treffen etwas später ein. Am Ende der Brutzeit sind es dagegen die Weibchen, die als Erste starten, während die Männchen noch einige Tage im Brutareal bleiben und ihr Territorium so lange wie möglich beschützen. Der Unterschied in den Ankunfts- und Abflugzeiten ist so auffallend, dass der Buchfink schon seit den Zeiten Linnés mit dem Namen Fringilla coelebs bedacht wurde: coelebs steht für „ledig“, weil die Weibchen am Ende des Sommers zuerst starten und die Männchen allein lassen.
Die Protogynie, die vorgezogene Wanderung der Weibchen am Ende der Brutzeit, ist aber weniger häufig als die Protandrie, die frühzeitige Ankunft der Männchen im Frühling. Doch wie gelingt es den Männchen, die Brutquartiere vor den Weibchen zu erreichen? Sie fliegen nicht schneller und benutzen auch keine Abkürzungen. Ganz einfach: Sie „schummeln“, indem sie eine kürzere Strecke reisen. Ihre Winterquartiere liegen nämlich näher an jenen für die Fortpflanzung, während die Weibchen weiter entfernt überwintern. In der Praxis verteilen sich die Vögel, die eine differenzielle Migration durchführen, in den Winterquartieren auf drei Zonen, und zwar nach Alter und Geschlecht. Die erwachsenen Männchen besetzen den nördlichsten Streifen, der dem Brutareal am nächsten liegt; sodann folgen die erwachsenen Weibchen und die jungen Männchen, die einen dazwischenliegenden Streifen besetzen; das südlichste und am weitesten entfernte Areal schließlich wird von den Jungweibchen besetzt. Die erwachsenen Männchen sind also diejenigen, die insgesamt am wenigsten weit reisen, und so schaffen sie es, zuerst anzukommen und später abzufliegen. Kurz und gut, sie haben ihre Tricks.
In der Einleitung haben wir erklärt, dass die Migration eine jahreszeitliche, periodische und sich wiederholende Bewegung zwischen zwei verschiedenen Gebieten ist, in denen unterschiedliche Lebensfunktionen ablaufen. Und dass sie nicht anhand der zurückgelegten Entfernung definiert wird. Doch jede Regel hat ihre Ausnahme. Die Zugvögel kann man nämlich gerade im Hinblick auf die zurückgelegten Kilometer in zwei große Gruppen einteilen. Und zwar deshalb, weil das „Wandervolk“ aus Tausenden von Arten besteht und man deshalb in den verschiedenen Untersuchungen versucht hat, jene mit ähnlichen ökologischen Merkmalen zusammenzulegen. Man unterscheidet daher in Langstrecken- und Kurzstreckenzieher. Langstreckenzieher sind Vögel, die zwischen 5.000 und 15.000 Kilometer pro Wanderung zurücklegen und dabei 100–200 Kilometer am Tag fliegen können. Zu dieser Gruppe von Ausnahmeathleten gehören jene Arten, die unterhalb der Sahara überwintern: die sogenannten Transsaharazieher wie die bereits erwähnten Schwalben und der Sumpfrohrsänger. Doch die Spitzenkönner dieser Kategorie sind die Seevögel, die bis zu 300 Kilometer am Tag herunterspulen, und ein kleiner europäischer Sperlingsvogel, der Gleiches zu leisten imstande ist: der Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe). Der Name mag zwar komisch klingen, doch dieser Vogel mit schwarz-weiß gefärbtem Schwanz und einem Gewicht von gerade einmal 25 Gramm unternimmt eine schier unglaubliche Reise. Von Subsahara-Afrika, wo er den Winter verbringt, zieht ein Teil der Vögel nach Nordosten, um in Sibirien und Alaska zu nisten; dabei überqueren sie den gesamten asiatischen Kontinent. Der andere Teil fliegt nach Europa und teilt sich dann erneut in zwei Gruppen. Die eine bleibt in Europa, um dort zu nisten, die andere zieht nach Nordwesten 3.500 Kilometer über den Atlantik bis nach Grönland und in den Nordosten Kanadas7. Der Steinschmätzer nimmt keine Abkürzungen und bewältigt im Flug hin und zurück bis zu 30.000 Kilometer.
Das Leben der Kurzstreckenzieher ist etwas leichter: Sie legen „nur“ eine Strecke von 3.000–5.000 Kilometern zurück, pro Tag um die 50. Einen Sonderfall stellen jene dar, die in der Paläarktis nisten und zwischen Südeuropa und Nordafrika überwintern, ohne die Sahara zu überqueren. Wie der Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), das Schwarzkehlchen (Saxicola torquatus) und das berühmte Rotkehlchen (Erithacus rubecula).
Vielleicht haben Sie bemerkt, dass sich im Winter in italienischen Gärten und öffentlichen Parks viele Rotkehlchen tummeln, während sie im Sommer dort kaum zu sehen sind?
Das Rotkehlchen nistet vorwiegend in Nordwesteuropa und überwintert im Mittelmeerbecken, einschließlich Italien. Darum ist es dort im Winter so zahlreich anzutreffen. Am Ende der kalten Jahreszeit geschieht dann das Unglaubliche: Der größte Teil der Rotkehlchen, der den Winter in Italien verbracht hat, bricht zum Nisten wieder nach Norden auf. Viele andere bleiben, genießen weiterhin den italienischen Sommer und nisten geradewegs im Belpaese. Wieso? Sie sind nicht nur Kurzstreckenzieher, sondern auch Teilzieher und gehören damit zu einer Kategorie von Vögeln, bei der ein Teil der Population Zugvögel und der andere Standvögel sind. Und damit nicht genug: Die Teilzieher können in wenigen Generationen entweder zu obligatorischen Zugvögeln oder zu totalen Standvögeln werden. So können sie, wenn sich die Umweltbedingungen ändern, von Mal zu Mal die passende Strategie wählen: bleiben oder ziehen. Dasselbe gilt für die Amsel (Turdus merula), die in unseren Breiten weitgehend zu einem Standvogel wurde. Ihr Wandertrieb ist aber weiter im Erbgut verankert. So sind über 60 Prozent der europäischen Amseln Teilzieher, und wenn sie es nicht sind, tragen sie mit großer Wahrscheinlichkeit in ihrem Genotyp die Merkmale, um zu solchen zu werden.
Bei ihren Reisen in alle Himmelsrichtungen sind die Vögel erstaunlich pünktlich. Einige halten Abflugzeiten oder Zieleinlauf so präzise ein, dass man sie zu Recht mit dem Beinamen „Kalendervögel“ bedacht hat. Ein Beispiel ist der Dunkle Wasserläufer (Tringa erythropus), ein hochbeiniger Wasservogel mit langem Schnabel, der zwischen Afrika und dem südlichen Asien überwintert und im hohen Norden Europas und Asiens brütet8: In 24 aufeinanderfolgenden Jahren tauchte er immer zwischen dem 1. und 8. Mai im finnischen Helsinki auf. Oder die Gartengrasmücke (Sylvia borin), ein kleiner Sperlingsvogel, der im tropischen Afrika überwintert, in Europa nistet und 38 Jahre in Folge um den 1. Mai in Mitteleuropa eintraf9. Fast auf den Tag genau.
Trotz dieser enormen Präzision gibt es kein Signal, das allein den Startschuss zur Wanderung gibt. Es sind vielmehr eine Reihe von umweltbedingten und hormonellen, häufig voneinander abhängigen Faktoren, die die Zugunruhe auslösen, ein Begriff, der sogar in der amerikanischen Fernsehserie Heroes zitiert wurde.10 Die Zugunruhe ist ein unruhiges Verhalten, das gut zu beobachten ist, wenn man einen Vogel am Wandern hindert: Hält man einen Zugvogel im Käfig, wenn er eigentlich auf Reisen sein sollte, schlägt er die ganze Nacht mit den Flügeln und versucht sogar zu fliegen und dabei den richtigen Kurs zu halten.
Doch können wir auch den genauen Zeitpunkt bestimmen, an dem, wie in einem Dominoeffekt, die Serie der physiologischen Ereignisse beginnt, die schließlich die Wanderung auslöst? Nicht ganz. Wir wissen, wie schon gesagt, dass einige der zentralen Hormone für die Regulation des Zugdrangs von der Hypophyse und der Epiphyse produziert werden, zwei Drüsen, die sensibel auf die Fotoperiode reagieren. Daher können wir annehmen, dass die Sonnenwenden der Schlüssel sind: der kürzeste und der längste Tag des Jahres. Im Winter (21./22. Dezember, je nach Jahr) beginnt das Tageslicht zuzunehmen und gibt den Anstoß zu den hormonellen und physiologischen Reaktionen, die dann mit der Wanderung zum Brutgebiet enden. So wie zu Beginn des nördlichen Sommers (am 20. oder 21. Juni) die Tage wieder kürzer werden und damit auf das Nahen des Winters hinweisen. Ein Zyklus, der sich Jahr für Jahr wiederholt.
Ob Kurz- oder Langstreckenzieher, ob Teilzieher oder obligatorische Zieher, ob zuverlässig wie eine Schweizer Uhr oder nicht – um die Migrationsreise in Angriff zu nehmen und das Versprechen der Wiederkehr einzuhalten, brauchen die Zugvögel eine Strategie. Alle, ohne Ausnahme. Sie müssen sich genügend Energiereserven aneignen, die Brustmuskeln für den langen Flug trainieren, die Route, der sie folgen wollen, berechnen und anpassen, Raubtieren entkommen, Gefahren ausweichen und allenfalls von Zeit zu Zeit eine Rast einlegen. Zum Glück übernimmt fast alle diese Berechnungen das Erbgut, das Millionen Jahre Evolution geformt haben.