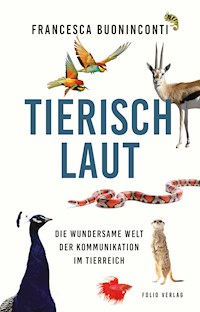
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folio Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Warum zirpen Grillen, machen Echsen Liegestütze und wechseln Oktopusse ihre Farbe? Und sind Fische wirklich stumm? Tiere kommunizieren mit den unterschiedlichsten Mitteln: mit Lauten, Gesten und Mimikry, mit Licht- und Duftsignalen, Tänzen und dem Farbenspiel ihrer Federn. Elefanten verständigen sich mit Infraschall und unterscheiden so über große Distanzen zwischen Freund und Feind. Auch unter Wasser herrscht keineswegs Stille, wie die Gesänge der Wale zeigen, aber auch Piranhas sind echte Plaudertaschen – wie übrigens auch Krokodile. Tiere kommunizieren, um sich zu umwerben, Feinde abzuschrecken, Artgenossen zu warnen oder auf Futter hinzuweisen. Ihr Leben hängt vom permanenten Austausch von Signalen ab und sie können dabei auch lügen und sich verstellen … Buoninconti enthüllt uns außerdem die Wechselwirkungen zwischen Lebensräumen, für die wir häufig kein Ohr und Auge haben. Lebensräume, die es dringend zu schützen gilt! "Eine faszinierdende Welt!" La Stampa "Eine vielförmige Welt aus Tönen, aus optischen, chemischen und taktilen Botschaften!" La Scienza
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Foto: Michele Soprano
DIE AUTORIN
Francesca Buoninconti hat Naturwissenschaften mit Schwerpunkt Ornithologie studiert und schreibt als Wissenschaftsjournalistin für verschiedene Print- und digitale Medien, u. a. für La Repubblica, Micron und Vanity Fair, und arbeitet für den Rundfunk.
Bei Folio erschien: Grenzenlos. Die erstaunlichen Wanderungen der Tiere (2021).
DIE ÜBERSETZERIN
Karin Fleischanderl übersetzt aus dem Italienischen und Englischen, u. a. Gabriele D’Annunzio, Pier Paolo Pasolini, Giancarlo De Cataldo. Österreichischer Staatspreis für literarische Übersetzung.
FRANCESCA BUONINCONTI
TIERISCH LAUT
DIE WUNDERSAME WELTDER KOMMUNIKATIONIM TIERREICH
Aus dem Italienischen von Karin FleischanderlIllustriert von Federico Gemma
Für Pietro Greco,den unersetzbaren Lehrer undgroßartigen Wissenschaftsjournalisten,in ewiger Dankbarkeit
Das ganze Problem ist also folgendes: wie die eigene Einsamkeitdurchbrechen, wie mit anderen kommunizieren.
Cesare Pavese, Das Handwerk des Lebens,deutsch von Maja Pflug, Frankfurt a. M. 1990
Inhalt
Prolog
Einführung – Verschlüsselte Botschaften
Teil I – Das Auge isst mit
Kapitel 1Meisterhafte Tänzer
Kapitel 2Bleib mir fern
Kapitel 3Die Bedeutung der Farbe
Kapitel 4Meister der Tarnung
Kapitel 5Dance me to the End of Love
Teil II – Gaumenzäpfchen, Ohren und Geigen
Kapitel 6Eine Arie auf der sechsten Handschwinge
Kapitel 7Das Geheimnis des Vogelgesangs
Kapitel 8Jenseits der Laute
Kapitel 9Nachtigallen und Kanarienvögel mit Flossen
Kapitel 10Nicht nur Gebrüll
Kapitel 11Wie macht es das Krokodil?
Kapitel 12Stumm wie ein Fisch, fleißig wie eine Ameise
Teil III – Feine Nasen und zarte Berührungen
Kapitel 13Bestialischer Gestank
Kapitel 14Tödliche Düfte
Kapitel 15Stallgeruch
EpilogEine Sache der Vibrationen
Danksagung
Prolog
Die Vögel sind daran schuld. Wenn Sie wissen wollen, warum ich ein Buch über die Kommunikation der Tiere geschrieben habe, dann lautet meine persönliche Antwort: Die Vögel sind daran schuld. Sie sind der Grund, warum ich mehr über die Kommunikation der Tiere herausfinden wollte. Ich kann mich nicht erinnern, wann genau ich diesen Wunsch zum ersten Mal verspürte, doch bereits bei den ersten Birdwatching-Exkursionen habe ich mir ein paar Fragen gestellt: Warum tauschen Haubentaucher Algen und Wasserpflanzen aus und tanzen dabei? Warum führen alle Enten einen ähnlichen Tanz auf? Warum singen Vögel? Singen sie aus Instinkt oder müssen sie es lernen? Was teilen sie sich mit? Seit gut zehn Jahren gehe ich diesen Fragen nach und versuche zugleich, mehr über die tierische Kommunikation ganz allgemein in Erfahrung zu bringen.
Mein Beruf hat sich seitdem verändert: Ich arbeite nicht mehr rein wissenschaftlich, sondern als Wissenschaftsjournalistin. Deren Aufgabe ist es zu erzählen, zu erklären, bisweilen Behauptungen zu entkräften und Zweifel zu zerstreuen; dies mit unterschiedlichen Methoden und in einer Sprache, die dem Thema ebenso gerecht wird wie dem Publikum: kurz, eine Gratwanderung zwischen wissenschaftlicher Disziplin und Verständlichkeit. Ich hoffe sehr, mit meinem Buch einen gelungenen Mittelweg gefunden zu haben, um zu erklären, was Tiere sagen, wie sie kommunizieren und warum.
In diesem Buch habe ich nicht nur über bekannte und weniger bekannte Strategien geschrieben, die Tiere anwenden, um mithilfe visueller, auditiver, olfaktorischer und taktiler Signale zu kommunizieren, sondern auch versucht, die Geschichte dieses Wissenschaftszweigs oder zumindest seiner wichtigsten Wegmarken zu erzählen. Die Wissenschaft von der Kommunikation der Tiere ist eng mit Verhaltensforschung, Anatomie und Genetik verbunden, sie stützt sich auf Erkenntnisse aus der Embryonalforschung, Chemie und Physik und natürlich auf alles, was wir über Evolution wissen.
Und nein, ich stelle keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nicht nur, weil die Kommunikation der Tiere ein unendlich weites Feld ist, sondern auch, weil alle Arten (wir sprechen von fast 1,4 Millionen bekannten Arten) kommunizieren, und zwar auf unterschiedlichste Weise. Oft können wir ihre Sprache nicht „lesen“ oder entziffern, einfach, weil sie nur von den Tieren selbst verstanden wird, und das ist auch gut so. Und längst wissen wir auch nicht alles darüber, wie die Kommunikation der einzelnen Arten funktioniert. Doch das ist der vergnüglichste Teil, denn es bedeutet, dass wir uns weiterhin Fragen stellen, neugierig sein, forschen und beobachten müssen.
Einführung
Verschlüsselte Botschaften
Seien wir ehrlich, wir, der Homo sapiens, sind eine Gattung, die keine Minute schweigen kann. Auch wenn wir nichts sagen, kommunizieren wir dennoch über Gesten, Mimik und Körperhaltung. Sogar mit dem Parfum, das wir auflegen. Wir kommunizieren ständig, mit unterschiedlichen Personen, die entweder weit weg oder ganz nah sind. Wir kommunizieren in unterschiedlichen Sprachen, mithilfe von Handys und Apps, wir verwenden ein elaboriertes System von Gesten, Mimik, Phonemen und Worten, die wir aneinanderreihen, um Sätze mit genauen Grammatikregeln zu bilden, die wir uns in der Schule mühsam angeeignet haben. Doch selbst wenn der Satz korrekt formuliert ist oder die Emoticons richtig gewählt wurden, kann einiges schiefgehen. Unser Gesichtsausdruck oder Tonfall kann dem Gesagten widersprechen, wir zögern oder verhaspeln uns, und schon droht ein Missverständnis. Das ist wohl jedem von uns schon einmal passiert. Und wenn Sie glauben, dass dem nicht so ist … dann haben Sie es wahrscheinlich nicht bemerkt.
Und die Tiere? Haben Vögel, Insekten, Amphibien und andere Säugetiere dieselben Schwierigkeiten beim Kommunizieren wie wir? Können sie lügen? Wie erkennen sie ihre Gefährten? Wie erkennen zum Beispiel Bienen oder soziale Wespen, dass ihre Schwestern in das Nest zurückkehren und nicht fremde Eindringlinge? Was für eine Sprache sprechen die sprichwörtlich „stummen“ Fische? Warum singen Vögel und warum sind wir uns eigentlich sicher, dass es sich immer um Gesang handelt? Wir könnten uns noch eine Menge solcher Fragen stellen, doch die grundlegende Frage lautet: Sind Tiere imstande zu kommunizieren?
Diese Frage haben sich Wissenschaftler seit jeher gestellt, auch Charles Darwin, einer der bedeutendsten Naturforscher der Geschichte. Am 26. November 1872 veröffentlichte er The Expression oft the Emotions in Man and Animals (dt. Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei Menschen und Tieren). Wie seine früheren Werke wurde auch dieses Buch augenblicklich ein Bestseller mit mehr als 5.200 verkauften Exemplaren.1 Darwin fand heraus, dass beim Menschen jeder Gesichtsausdruck und jede Haltung eine eigene Bedeutung hat und mit einem Gefühl, einem Gemütszustand einhergeht. Das ist auch bei vielen Tieren der Fall. Außerdem gibt es eine „Universalität“ des Ausdrucks. Oft ähnelt der Gesichtsausdruck von Tieren jenem der Menschen und umgekehrt. „Jugendliche und Alte unterschiedlicher Rassen, sowohl bei den Menschen als auch bei den Tieren, bringen ein und dieselbe Stimmung mit denselben Bewegungen zum Ausdruck (…) Die Tatsache, dass so mancher Gesichtsausdruck bei unterschiedlichen, wenn auch verwandten Gattungen ein und derselbe ist (…) wird verständlich, wenn wir uns eingestehen, dass sie dieselben Vorfahren haben.“2 Der englische Naturwissenschaftler hat zwar die Vorstellung widerlegt, die Arten hätten sich nicht entwickelt, blieb jedoch einem anderen, seinerzeit weitverbreiteten Gedanken treu: Selbst für den Vater der Evolutionstheorie war die Kommunikation der Tiere untrennbar mit Gefühlen verbunden. Oder besser gesagt, Darwin zufolge hatten die Tiere kein Kommunikationssystem im eigentlichen Sinn, sondern ihre Stimmen und Haltungen waren Ausdruck ihrer Emotionen. Eine Amsel zum Beispiel, die einen Raubvogel kommen sieht, fliegt aus Angst davon und gibt das typische Tixen von sich, um die anderen Vögel in der Nähe unwillkürlich zu warnen. Heute weiß man, dass es sich in Wirklichkeit anders verhält, doch das herauszufinden hat lange gedauert. Und vor allem hat es lange gedauert, zu definieren, was Kommunikation eigentlich ist. Ein einfaches Beispiel: Erröten ist eine menschliche Verhaltensweise, die einem Betrachter genaue Hinweise auf unseren Gefühlszustand gibt. Doch wenn wir erröten, kommunizieren wir nicht: Wir wollen nicht erröten. Spontan und unwillkürlich teilen wir jedoch etwas über unseren Gefühlszustand mit. Die Vorsätzlichkeit3 ist also das einzige Kriterium, um zwischen Botschaft und Kommunikation zu unterscheiden. Dasselbe gilt auch für Tiere: Von Kommunikation spricht man nur, sofern es eine Absicht gibt, doch zu diesem Ergebnis ist die Wissenschaft erst nach vielen Überlegungen, Untersuchungen und Studien gekommen.
Darwins Text geriet nach der Veröffentlichung bald in Vergessenheit, und erst mit der Verhaltensforschung wurde der Faden wieder aufgenommen. Dank Konrad Lorenz, Nikolaas Tinbergen und Karl von Frisch, die 1973 den Nobelpreis erhielten, wurde die Vergleichende Verhaltensforschung nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer eigenen wissenschaftlichen Disziplin. In den 1950er- und 1960er-Jahren prägte dieses dream team mithilfe eleganter Experimente Begriffe wie „Instinkt“, „angeborenes und erlerntes Verhalten“ und „Reiz“. Und legte den Grundstein für die Wissenschaft, die sich mit der Kommunikation der Tiere befasst: Welche Sprachen sind angeboren, welche erlernt; in welchem Ausmaß und in welcher Zeitspanne werden sie erlernt; welche Signale lösen eine Reaktion aus, was fungiert als Schlüsselreiz und so weiter.
So entstand die Wissenschaft von der tierischen Kommunikation: Karl von Frisch beschäftigte sich vor allem mit der Kommunikation der Bienen und ihrem „Tanz“, während Nikolaas Tinbergen den Charakter eines Reizes definierte und vor allem vier Fragen formulierte, die man sich bei der Untersuchung jeglichen Verhaltens, auch der Kommunikation, stellen müsse: Als erstes muss der physiologische Mechanismus verstanden werden (welche Reize verurschen eine Reaktion?); dann die Phylogenese des Verhaltens (hat es sich im Verlauf der Stammesgeschichte verändert?); worin besteht der unmittelbare Nutzen des Verhaltens für das Individuum (inwiefern dient es dem Individuum zum Überleben oder zur Fortpflanzung?); und schließlich, wie ist das Verhalten im Verlauf der Individualentwicklung entstanden?
Die Frage, ob Tiere kommunizieren oder nicht, stellt man sich also systematischer erst seit gut 50 Jahren. Und wie so oft in der Wissenschaft ist die Antwort nicht sofort gefunden worden. Nehmen wir das von Darwin zitierte Beispiel: Eine Amsel sitzt auf einem Zweig und sieht, wie ein Sperber, ein Raubvogel, geflogen kommt. Sie fliegt augenblicklich davon, doch beim Davonfliegen stößt sie einen Warnschrei aus, einen Ton, der sich mithilfe von Schallwellen in der Luft verbreitet. Warum macht sie das? Wäre es nicht besser, still und heimlich davonzufliegen, ohne aufzufallen? Die einfachste Antwort darauf wäre natürlich Ja. Doch die Amsel stößt ihren typischen Warnschrei aus, weil sie sehr konkrete Empfänger hat: ihre Artgenossen, die ebenfalls davonfliegen. Allerdings stößt die Amsel den Alarmschrei nicht aus reiner Großzügigkeit aus: Wenn mehrere Vögel davonfliegen, stürzt sich der Raubvogel vielleicht auf einen anderen und lässt sie in Frieden. Sie hat also einen Vorteil.
Dieses Beispiel sagt bereits eine Menge über Kommunikation aus: Ein Sender, die Amsel, sendet mithilfe eines Mediums (Luft) eine Botschaft. Die Botschaft ist standardisiert, kodifiziert: Der Warnschrei ist immer gleich, verändert sich nicht im Lauf der Zeit. Und es gibt mindestens einen Empfänger, einen Adressaten derselben Art, der imstande ist, die Botschaft zu empfangen und zu reagieren, indem er seinerseits flüchtet. Also einen Empfänger, der einen Vorteil aus der erhaltenen Information zieht und sein Verhalten ändert. Anders als Darwin dachte, stößt die Amsel ihren Schrei also nicht nur aus Angst aus. Sicher, bei Warnrufen spielt immer auch eine Empfindung eine Rolle, doch nicht deshalb gibt ein Tier diese Art von Signal ab. Wüsste unsere Amsel, dass sie ganz allein ist, würde sie angesichts eines Raubtiers gar keinen Laut von sich geben, sondern still und leise davonfliegen.
Diese unterschiedlichen Verhaltensweisen sind nicht zufällig und liefern uns zwei wesentliche Hinweise. Erstens, das Verhalten der Amsel ändert sich, wenn Publikum vorhanden ist. Zweitens, ihre Botschaft ist für einen Empfänger bestimmt und somit vorsätzlich. Die Aufgabe der Verhaltensforscher bestand also mehr oder weniger darin nachzuweisen, dass es sich bei der tierischen Kommunikation um das vorsätzliche Senden einer Botschaft handelt, und dass genau diese Botschaft eine Reaktion, eine Antwort bewirkt. Natürlich nicht nur in Gefahrensituationen, sondern immer.
Tiere kommunizieren also, lassen einander vorsätzlich sehr unterschiedliche Botschaften zukommen: visuelle, auditive, olfaktorische und taktile Botschaften, die nicht nur mithilfe von Berührungen, sondern auch mithilfe von Schwingungen, sogar elektrischen, wahrgenommen werden. Die Art der Botschaften hängt natürlich vom Habitat des Tieres ab: Wenn es in der Dunkelheit lebt und blind ist, macht es keinen Sinn, bunt zu sein, sich auf optische Reize zu verlassen wäre keine gute Idee. Wenn es hingegen im Dunkeln lebt und sehr gut sieht, ist es eine hervorragende Idee, wie ein Glühwürmchen Lichtblitze zu produzieren. Die Art der Signale hängt also vom Habitat der Art, aber auch von deren bisheriger Anpassung ab. Hat man einen Kehlkopf und Ohren, ist ein Geräusch ein ideales Signal. Hat man hingegen keine Ohren, doch einen gut entwickelten Geruchssinn, sind olfaktorische Signale besser geeignet, und so weiter.
In Gianni Rodaris Worten ist das Studium der tierischen Kommunikation ein „Akt der Fantasie“: Wir Menschen sehen keine UV-Strahlen, wir hören keinen Infra- und keinen Ultraschall. Und wir haben auch keinen besonders gut entwickelten Geruchssinn. Deshalb bleibt uns ein Großteil der tierischen Kommunikation verborgen. Doch die Fähigkeit, mit anderen Individuen effizient zu kommunizieren, spielt für alle Lebewesen eine äußerst wichtige Rolle. Und wir können uns diese Fähigkeit zunutze machen, wenn wir Tiere einer bestimmten Art zählen oder Schädlinge verjagen wollen. Wie man noch sehen wird, beruhen viele Methoden, für die Landschaft oder den Menschen schädliche Insekten zu vertreiben, auf Gerüchen und olfaktorischen Tricks. Und das Studium der tierischen Kommunikation dient auch dazu, neue Erkenntnisse über die Evolution zu erhalten, und hin und wieder kann man so auch Arten unterscheiden: Jede Art hat ihre eigene, aus Tönen, aber auch aus visuellen und olfaktorischen Signalen bestehende „Stimme“.
Genau wie wir kommunizieren Tiere auf unterschiedliche Art und Weise und in verschiedenen Situationen: um einander zu erkennen, um Konflikte zu lösen, um das Revier zu markieren und vor Rivalen zu schützen, indem man seine Präsenz kundtut. Natürlich gibt es auch zahlreiche Botschaften, die die Sexualität betreffen: Man teilt einem potenziellen Partner mit, dass man paarungsbereit ist, oder umwirbt ihn. Hin und wieder sogar mit ritualisierten Tänzen. Man kommuniziert, um eine Familie zu gründen und die Nachkommen aufzuziehen, und sogar die Jungen sind hervorragend beim Kommunizieren: Sie teilen ihren Eltern mit, dass sie hungrig sind und ihr Magen knurrt. Für soziale Arten ist es fundamental, eine gute Beziehung zur Gruppe aufrechtzuerhalten, der soziale Zusammenhalt muss gewährleistet, die Beziehungen müssen gefestigt werden, unter Umständen muss man den anderen mitteilen, dass man eine Futterquelle gefunden hat; oder man kommuniziert mit der Gruppe, um bei Ortswechseln beisammenzubleiben oder beim Jagen die Manöver zu synchronisieren, oder um die Bewegungen eines fliegenden Schwarms zu koordinieren. Oder man will wie die Amsel seine Artgenossen auf eine Gefahr hinweisen. Und außerdem gibt es Signale aus der Sphäre der sogenannten Autokommunikation: etwa die Echoortung der Fledermäuse und der Wale (und manch anderer Tiere), die ein Signal, eine Schallwelle, senden, die reflektiert wird und Informationen zur unmittelbaren Umgebung liefert.
In all diesen Fällen handelt es sich immer um Kommunikation zwischen Individuen ein und derselben Art bzw. um innerartliche Kommunikation. Doch die Ausnahme bestätigt die Regel. Vögel zum Beispiel verstehen sehr gut den Warnschrei vieler anderer Arten, nicht nur den eigenen. Das verschafft ihnen einen Vorteil; ihre Chancen, von einer Gefahr zu erfahren und davonzufliegen, erhöhen sich. Auch Mobbing – die Gesamtheit der aggressiven und drohenden Verhaltensweisen – wird von allen Tieren verstanden: ebenfalls ein Beispiel zwischenartlicher Kommunikation. Blumen – damit befinden wir uns allerdings im Pflanzenreich – tragen Markierungen oder Muster auf den Blütenblättern, die für Menschen nur im UV-Licht zu sehen sind. Solche „Nektarführer“ helfen Bienen und anderen Bestäubern, den Nektar zu finden, und dabei zugleich Pollen zur nächsten Blüte zu transportieren. Nektarführer erhöhen die Chancen der Bienen, sich zu stärken, aber auch die der Blüten, bestäubt zu werden. Man kommuniziert also mit Artgenossen, aber auch mit Individuen anderer Arten, und zwar in einer Vielzahl unterschiedlicher Situationen. Kurz und gut kann man sagen, Tiere kommunizieren, um zu leben und zu überleben.
Vor allem ist klar: Mithilfe von Kommunikation verschafft man sich wechselseitige Vorteile. Beide Partner müssen davon profitieren, sonst rentiert es sich nicht, ein Kommunikationssystem zu entwickeln. Und damit es einen wechselseitigen Vorteil gibt, muss das Signal ehrlich sein: Der Sender muss die Wahrheit über seinen Gesundheitszustand, sein Alter, seinen Aufenthaltsort und seine Absichten sagen. Ein Paradiesvogel mit dichtem, auffälligem Gefieder fliegt zum Beispiel viel langsamer, ist unbeholfener und somit verwundbarer. Ein Raubvogel wird ihn im dichten Gebüsch sicher leichter ausmachen. Dasselbe gilt für Duftmarken und Laute: Man riskiert, ein potenzielles Raubtier auf sich aufmerksam zu machen.
Amotz Zahavi4 ist der Meinung, die lange, bunte Federnschleppe des männlichen Pfaus sei im Falle des Falles ein Handicap, ein Aufwand im Dienst der sexuellen Auslese: Das Rad des Pfaues sei deutlich sichtbar und ziehe die Aufmerksamkeit der Raubtiere auf sich, es sei eine schwere Last, die der Pfau hinter sich herschleppen müsse, und erschwere die Flucht. Deshalb habe nur ein gesunder, starker männlicher Pfau mit guten Genen eine lange Schleppe und könne sich zugleich vor Raubtieren in Sicherheit bringen. Laut Zahavi ist die Schleppe somit ein ehrliches Signal, ein Indikator für die „Qualität“ des Männchens. Inzwischen weiß man jedoch, dass sich die Sache nicht ganz so verhält: Die Schleppe macht den Pfau aufgrund des höheren Energieverbrauchs nicht schwerfällig, sondern ist sogar ein Vorteil. Sie besteht aus ungefähr 150–200 Deckfedern, die, bis zu eineinhalb Meternlang, am unteren Ende des Rückens angewachsen sind und den eigentlichen Schwanz bedecken: 20 kurze braune Federn, die Steuerfedern genannt werden. Wenn der Pfau seinen eigentlichen Schwanz hebt, heben sich auch die Deckfedern und er schlägt ein Rad. In seiner sexuell aktiven Zeit, in der die Schleppe voll entwickelt ist, braucht er für die Fortbewegung sogar weniger Energie als im Rest des Jahres, wenn ihm die Federn ausfallen, wie neuere Forschungen herausfanden. Die Stoffwechselkosten sind also möglicherweise andere und haben vielleicht mit der Entwicklung dieser Eigenschaft oder einer besseren Sichtbarkeit für Feinde zu tun.5 Ein Signal zu entwickeln ist immer kostspielig, denn damit geht ein größerer Energieverbrauch einher und Gefahren müssen in Kauf genommen werden. Die mit der Kommunikation verbundenen Vorteile müssen also die Nachteile überwiegen. Es muss der Mühe wert sein, eine Botschaft, ein Signal zu senden. Und zwar nicht nur für den Sender, sondern auch für den Empfänger. Bevor wir klären, wie Kommunikation funktioniert, wozu sie gut ist und warum es sinnvoll ist, sie zu untersuchen, müssen wir jedoch einen grundlegenden Punkt klären: Was genau ist ein Signal?
Dazu müssen wir einen feinen Unterschied beachten: den zwischen den eigentlichen Signalen und den Cues6 oder Schlüsselreizen, wie der Österreicher Konrad Lorenz, der Vater der Verhaltensforschung, sie 1939 definierte. Cues sind nicht vorsätzlich gesendete Signale, die dem Empfänger dennoch eine Information übermitteln und ihm oft einen Vorteil verschaffen. Das Kohlenstoffdioxid, das wir ausatmen, ist ein Cue: Es erlaubt den Mücken, uns zu finden und eine Blutmahlzeit zu nehmen. Cues sind auch unser Erröten in einem emotionalen Augenblick, graue oder weiße Haare, Falten im Gesicht. Sie offenbaren Scham, die wir gern verbergen würden, oder das Alter eines Menschen. Sie sind Reize, die wir nicht unter Kontrolle haben, nicht willentlich steuern können: Wir können nicht verhindern, rot zu werden, wir können die Haare nicht daran hindern, weiß zu werden, und auch nicht die Kohlenstoffdioxidmenge verringern. Signale im eigentlichen Sinn hingegen unterliegen der vollen Kontrolle des Senders, sie können verändert oder sogar moduliert werden: z. B. Töne, deren Lautstärke, Höhe, Frequenz usw. verändert werden kann, oder Duftmarken, die viele Insekten und Säugetiere hinterlassen, um ihr Revier zu markieren. Wichtig ist jedoch, dass sowohl Sender als auch Empfänger davon profitieren. Signale sind im Lauf der Evolution eigens entwickelt worden, um das Verhalten der anderen zu beeinflussen, und unterliegen noch immer einem sehr starken Selektionsdruck.
Signale unterscheiden sich von den Cues insofern, als Letztere nicht entstanden, um zu kommunizieren und eine Reaktion auszulösen, während Erstere im Lauf der Evolution genau zu diesem Zweck entwickelt wurden: um eine Reaktion auszulösen, das Verhalten des anderen zu beeinflussen. Und zweifellos hat sich ein derart ausgefeiltes und vielfältiges Kommunikationssystem nicht von einem Tag auf den anderen herausgebildet. Auch Signale haben sich mit der Evolution und aufgrund wechselseitiger Anpassung entwickelt und je nach der jeweiligen Art und deren Habitat perfektioniert. Aber wie? Das herauszufinden war ebenfalls ein wissenschaftliches Abenteuer.
Gleich zu Beginn müssen wir feststellen, dass bei Sender wie Empfänger – wie schon gesagt – bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ein Signal entwickelt und über längere Zeit beibehalten wird. Um ein Lautsignal zu senden, braucht man ein Organ wie den Kehlkopf, Stimmbänder, ein Atemsystem und einen Mund, in dem der Ton widerhallt. Der Empfänger hingegen braucht ein Gehör, gut entwickelte Ohren, um die Nachricht zu empfangen. Dasselbe gilt für Farbsignale: Man braucht Licht und Augen. Jedes Signal benötigt sozusagen spezifische Voraussetzungen zur Wahrnehmung. Doch damit nicht genug: Um sich zu entwickeln und im Lauf der Zeit zu bewähren, muss ein Signal in gewisser Weise die Aufmerksamkeit des Empfängers wecken, etwa indem es von einer angeborenen Vorliebe profitiert sowie von einem bereits existierenden Sinnessystem, das zu einem anderen Zweck als dem der Kommunikation entwickelt wurde.
Michael Ryan hatte 1990 als Erster diese Idee, die in der Folge als „Hypothese von der Nutzbarmachung des Sinnesapparats“7 bezeichnet wurde. Ryan zufolge hat der Empfänger latente Vorlieben, die vom Sender genutzt werden, um vor allem bei der sexuellen Auslese neue Signale zu schaffen. Wasserläufer zum Beispiel sind dank ihrer langen Beine imstande, aufgrund der Oberflächenspannung über das Wasser zu gleiten. Ganz allgemein profitieren Wasserläufer von den Vibrationen des Wassers, um herauszufinden, ob Beutetiere in der Nähe sind. Doch in der Paarungszeit nutzen die Männchen gerade diesen Sinnesapparat, der eigentlich der Nahrungssuche dient, um mit den Weibchen zu kommunizieren und sie zu umwerben. Sie ziehen ihre Aufmerksamkeit auf sich, indem sie sie mit Nahrung locken. Dasselbe machen Hähne, wenn sie um ein Huhn balzen: Sie machen tidbitting (vom englischen tidbit: Leckerbissen). Sie picken am Boden, bis sie einen Leckerbissen finden, tun aber oft auch nur so, als würden sie einen finden. Dann lassen sie ihn fallen und geben dabei ein rhythmisches Schnalzen von sich: eine an die Henne gerichtete Aufforderung. Als ob sie sagten: „Hallo, Schöne, schau, was ich esse!“ Mithilfe von tidbitting ziehen sie die Aufmerksamkeit der Henne auf sich, indem sie sich die typischen Gesten und Laute der Nahrungssuche zunutze machen. Es reicht jedoch nicht, dass ein Sender ein Sinnesorgan oder eine Vorliebe seines Artgenossen für eine x-beliebige Nachricht nutzt. Und auch nicht, dass der Empfänger reagiert. Um zu gewährleisten, dass sich ein Signal entwickelt und über eine längere Zeitspanne behauptet, also immer denselben Effekt hervorruft, muss es ritualisiert, zu einem unverwechselbaren Code werden. Der Warnschrei der Amsel klingt immer gleich, ist kodifiziert, hat sich im Lauf der Zeit herausgebildet und wird seit Jahrtausenden von allen Artgenossen und nicht nur ihnen verstanden. Dasselbe gilt auch für uns: Unsere Sprache ist kodifiziert, sie befolgt bestimmte grammatikalische und phonetische Regeln. Wenn ein verliebter Mann zu seiner Angebeteten „Liebe dich ich“ sagte und nicht „Ich liebe dich“, würde er gewiss nicht den gewünschten Effekt erzielen. Es sind also Zeit, Geduld und zahlreiche Versuche vonnöten. Das Signal muss auch nicht unbedingt neu sein. Es kann eine Vereinfachung oder Übertreibung eines bereits vorhandenen Verhaltens oder einer Pose sein, die Wiederholung einer Geste oder eines Lauts. Damit die Chancen, beim Empfänger eine Reaktion zu bewirken, möglichst hoch sind, muss es jedoch mit Nachdruck vorgetragen und öfter in gleicher Weise wiederholt werden. Und der Empfänger seinerseits muss sich an diese spezielle Kommunikation erinnern. Damit also ein neues Signal beibehalten wird, muss es die Regeln der natürlichen Auslese befolgen: Es muss sowohl dem Sender als auch dem Empfänger einen Vorteil bei der Flucht vor einem Raubtier, der Nahrungssuche, der Fortpflanzung, der Brutpflege oder dem Leben im Rudel verschaffen. Sowohl das Signal als auch die Reaktion darauf unterliegen dem Prozess der Koevolution: Jedem Signal folgt eine entsprechende Reaktion. Der Wahrheit zuliebe müssen wird jedoch hinzufügen, dass vor allem beim Balzen nicht jedes Signal eine unmittelbare Reaktion auslöst. Bei vielen Arten lässt sich der Empfänger des Signals jede Menge Zeit, um abzuwägen und erst dann zu antworten, und das hat das Leben der Wissenschaftler sehr kompliziert gemacht. Ein Beispiel: Haben Sie schon einmal die Kommunikation der Türkentauben (Streptopelia decaocto) beobachtet? Das Männchen muss seinem Täubchen oft stundenlang Avancen machen: Es gurrt, plustert sich auf, verbeugt sich mehrmals, läuft immer wieder mit aufgefächertem Schwanz auf und ab und scharrt am Boden. All das in einem anhaltenden Zustand nervöser Erwartung.
In diesem Fall ziert das Taubenweibchen sich jedoch nicht, sondern das Balzritual des Männchens hat die Funktion, das Weibchen für die Begattung vorzubereiten. Der visuelle und auditive Reiz des balzenden Männchens aktiviert den Hypothalamus des Weibchens, seine Hypophyse produziert Gonadotropine. Diese stimulieren die Eierstöcke, die ihrerseits Östrogen produzieren, und unter dem Einfluss dieser Hormone erfolgt der Eisprung. Nach ungefähr einem Tag werden die Geduld und die Hartnäckigkeit des Männchens vielleicht belohnt: Wenn das Weibchen der Paarung zustimmt, sucht das frischgebackene Paar sich einen Ort für den Nestbau und nistet. Doch das Balzen des Männchens ist damit noch lange nicht beendet, sondern wird während des Nestbaus und der Paarung fortgeführt.
Nach diesem kurzen Ausflug ins mühevolle Liebesleben der Tauben müssen wir jedoch noch einen anderen Aspekt klären. Bevor ein Signal ritualisiert, wiederholt, verfeinert, vom Empfänger verstanden und an die nachfolgenden Generationen weitergegeben wird, muss es erst einmal entstehen. Die Frage ist, wie? Warum werden ausgerechnet dieser Laut und jene Körperhaltung zum Signal? Manche Rufe, Gesänge oder Displays – Ausdrucksverhalten wie eine Darbietung, Pose oder ein von einem Tier aufgeführter Tanz – sind derart elaboriert oder bizarr, dass kaum nachvollziehbar ist, wie genau diese Abfolge von Lauten oder Schritten entstanden ist. Es lässt sich jedoch beobachten, dass bei unterschiedlichen, allerdings eng miteinander verwandten Arten die Displays sehr ähnlich sind und kaum Varianten aufweisen, und das hilft uns, die Geschichte ihrer Entwicklung zumindest teilweise zu rekonstruieren. Die Drohgebärden vieler Huftiere gehen auf mehr oder weniger identische Weise mit einer Präsentation der „Waffen“, Hörner oder Stoßzähne, einher. Manche Bewegungen, die bei Drohgebärden oder Balztänzen eingefügt werden, stammen jedoch aus einem anderen Repertoire: Bewegungen, die in anderen Kontexten ausgeführt werden, etwa die Gefiederpflege, leiten manche Balzrituale ein. Die Gefiederpflege ist mittlerweile ein kodifiziertes Verhalten, doch ursprünglich war es eine reine Ersatzhandlung bzw. ein unangemessenes Verhalten, das in dem gegebenen Kontext völlig fehl am Platz war. Wenn man sich paaren will, ist es mitunter keine gute Idee, sich das Gefieder oder das Fell zu putzen, außer man besitzt ein perfektes Federkleid, und wenn man sich ablenken lässt, wird man auch schnell mal von einem anderen verdrängt. Wenn dieses Verhalten jedoch in das Balzverhalten integriert und kodifiziert ist, dient es vielleicht dazu, dem Weibchen das Gefieder zu zeigen, damit es überprüfen kann, wie sauber und frei von Parasiten es ist, und anhand dessen es auf den Gesundheitszustand des Anwärters schließen kann.
Hin und wieder wird auch eine neurovegetative Reaktion wie die Piloerektion – das sich Aufstellen von Härchen oder Federn – zu einem Signal oder einem Teil eines Signals: Das balzende Taubenmännchen plustert sein Gefieder auf, um es zur Schau zu stellen und größer und gesund zu wirken. In diesem Fall ist die sogenannte „Gänsehaut“ eine absichtliche, nicht von einer Empfindung ausgelöste Aktion, das heißt Federn und Flaumfedern werden auf immer dieselbe Weise aufgeplustert, unabhängig vom Wunsch des Männchens, sich fortzupflanzen, und auch unabhängig von der positiven oder negativen Reaktion des Weibchens. Die – ursprünglich unwillkürliche – Piloerektion wird zu einer absichtlichen Aktion, zum Teil eines stilisierten und stereotypen Signals, und deshalb gibt sie keinen Aufschluss über den Gemütszustand des Senders. Bereits 1957 hat Desmond Morris8 die These aufgestellt, dass stark ritualisierte Signale sich vielleicht genau deshalb entwickelt haben, weil sie Informationen über den Gefühlszustand verbergen. Mithilfe eines ritualisierten Signals manipuliert der Sender den Empfänger, ohne allzu viel über sich preiszugeben. Kommunikation ist wirklich eine schwierige Angelegenheit, dennoch ist sie für ausnahmslos alle Lebewesen sehr wichtig. Sogar unsere Zellen kommunizieren: Leben bedeutet unter anderem zu kommunizieren. Wir bestehen aus Botschaften, chemischen Signalen, aus Atemzügen, die sich in Worte verwandeln, aus Lauten und Melodien, die in uns entstehen oder von außen an unser Ohr gelangen, unser Gehirn stimulieren und eine Reaktion hervorrufen. Und das gilt für alle Lebewesen. Ein einziges Signal kann gleichzeitig mehrere Botschaften transportieren. Es kann die Identität, den Aufenthaltsort, das Geschlecht, das Alter des Kommunizierenden preisgeben. Und ein und dasselbe Signal kann je nach Kontext eine andere Bedeutung annehmen. Das Brüllen des Löwen ist ein soziales Signal, innerhalb des Rudels trägt es zum Zusammenhalt der Gruppe bei und lockt Löwinnen an. Außerhalb dieser spezifischen Gruppe hat es die Funktion, das Revier zu markieren, den Gesundheitsstatus zu bestätigen und andere Rudel zu vertreiben.
Signale entwickeln sich auch durch wechselseitige Anpassung, werden im Lauf der Zeit selektiert und unterscheiden sich je nach Gattung. Und bei diesem Prozess ist Angeborenes genauso wichtig wie Erlerntes. Viele Grundzüge der Kommunikation werden in den ersten Lebensphasen erlernt und manchmal kann Erfahrung sogar eine genetische „Prägung“ modifizieren.
Manchmal werden auch mehrere Signale kombiniert, um ein anderes Ergebnis zu erzielen. Wenn eine Zebrastute drohend dreinschaut, gleichzeitig aber einem Hengst das Hinterteil darbietet, ist das keine Drohung, sondern eine Aufforderung zur Paarung.
Mehrere Signale zu kombinieren kann sich aus vielen Gründen lohnen. Der Sender muss keine neuen erfinden und der Empfänger muss keine neuen lernen. Man fügt einfach zwei alte zusammen und fertig. Dasselbe gilt für Doppelsignale: Für gewöhnlich ist Kommunikation nicht eindimensional, besteht nicht nur aus optischen Reizen oder aus Klängen, taktilen oder olfaktorischen Reizen. Und so werden akustische Signale oft mit speziellen Haltungen kombiniert, bzw. bei speziellen Displays spielen auch Geräusche eine Rolle. Wie beim Pfauenrad: Die Pfauenhenne achtet nicht nur auf die Größe des Rades, auf die Anzahl der „Augen“ und somit der Federn, wie bunt und ob sie symmetrisch sind, sondern lauscht auch einer Melodie mit einer Frequenz zwischen 22 und 28 Hertz, die vom Rasseln der Pfauenfedern verursacht wird, die wie bunte und gefiederte Saiten einer Lyra vibrieren und widerhallen, während das Männchen … sich spreizt wie ein Pfau.9 Doch wie kann der Empfänger eines Signals sichergehen, dass der Sender es ehrlich meint und es sich nicht um eine – vielleicht tödliche – Falle handelt? Wie kann man die eigenen Zweifel besiegen und dem Sender vertrauen? Das ist wahrhaftig ein Dilemma, doch für gewöhnlich beruht jede Kommunikation auf einer Annahme: der Vertrauenswürdigkeit des Signals.
Ein Signal ist für gewöhnlich kostspielig, deshalb empfiehlt es sich, aufrichtig zu sein. Ein Vogel singt nicht einfach so, denn damit setzt er sich der Gefahr aus, einem Raubtier zum Opfer zu fallen. Damit ein Signal entwickelt wird und sich im Lauf der Evolution bewährt, muss es vertrauenswürdig sein, denn sonst würde der wechselseitige Vorteil hinfällig werden, der der Evolution der tierischen Kommunikation zugrunde liegt. Zwei Nachtigallen zum Beispiel singen nicht mit identischer Lautstärke, und in diesem Fall hat der Empfänger, also das Weibchen, die Möglichkeit, das bessere Signal und somit den Partner zu wählen, der ihm besser gefällt. Im Allgemeinen sind die Gesänge aller Arten aufwendige und ehrliche Signale, Indikatoren für Größe und Gesundheitszustand des Tiers. Deshalb kann man einem Sender mit Fug und Recht Vertrauen schenken. In der tierischen Kommunikation siegt Aufrichtigkeit.
Ausnahmen bestätigen jedoch die Regel, und wie es so schön heißt, ist nicht alles Gold, was glänzt. Auch bei Tieren gibt es Bluffer: Arten oder Individuen, die lügen oder vorgeben zu sein, was sie nicht sind. So wie ein einfaches Gespräch zwischen Menschen eine unvermutete Wendung nehmen kann, ist auch die tierische Kommunikation bisweilen kein Honiglecken und kann den Empfänger teuer zu stehen kommen.
1978 haben Richard Dawkins und John Krebs als Erste Zweifel an der bedingungslosen Aufrichtigkeit eines Signals geäußert.10 Tatsächlich gibt es viele betrügerische Signale, bei denen die Interessen des Senders nicht mit jenen des Empfängers übereinstimmen, sondern diesen im Gegenteil völlig zuwiderlaufen. Eine Kommunikation wie eine Einbahnstraße, bei der der Sender absichtlich eine falsche Botschaft sendet und so einen oder mehrere Empfänger zu seinem Vorteil manipuliert: Der andere soll nicht informiert, sondern manipuliert werden. In diesem Fall handelt es sich um ein Wettrüsten zwischen manipulativen Sendern und misstrauischen Empfängern, zwischen Raub- und Beutetier, zwischen Wirt und Parasit, einen Wettlauf, der auch und vor allem mithilfe von Kommunikation funktioniert. Bei manchen Arten beruht die Fortpflanzungsstrategie auf Täuschung und List, die sich entwickelt haben, um das Verhalten des Empfängers ausschließlich zum eigenen Vorteil zu manipulieren. Es gibt mickrige Männchen, die sich mit kräftigen Männchen umgeben, um eine potenzielle Partnerin anzulocken, und manche tun so, als wäre ein Raubtier im Anflug, und versetzen das ganze Rudel in Aufruhr, um zu einer Gratismahlzeit zu kommen. Manche geben sich als ein anderer aus: Mithilfe von Geräuschen, Gerüchen oder dem Aussehen ahmen sie einen anderen nach und täuschen den Artgenossen. Und auch die, die sich um jeden Preis fortpflanzen wollen, bluffen manchmal: Hähne melden manchmal einen interessanten Leckerbissen, obwohl sie der zukünftigen Partnerin gar keinen anzubieten haben.11 Doch sie gehen auf Nummer sicher: Die Henne muss weit genug entfernt sein, um den Betrug nicht zu bemerken, um nicht zu sehen, dass es gar kein Maiskorn zu picken gibt. Damit der Bluff funktioniert, muss er weniger häufig angewandt werden als die ehrliche Kommunikation. Man kann die Karten nicht offen auf den Tisch legen. Ja, auch die tierische Kommunikation beruht auf Tricks und Bluffs. Auch Tiere können lügen; vor allem bei der Fortpflanzung und beim Fressen ersparen sie einander nichts. In der Liebe und … bei Tisch ist alles erlaubt, und Tiere stellen oft unter Beweis, dass ihre soziale Kompetenz unserer in nichts nachsteht. Willkommen also in einer Welt aus Ehrlichen, Lügnern, Egoisten und Angebern.
1K. Francis, Charles Darwin and The Origin of Species, Westport (CT) 2007.
2„Ausdruck der Gemüthsbewegungen bei dem Menschen und den Thieren“, aus dem Englischen übersetzt von J. Victor Carus, Stuttgart 1877, S. 11.
3Menschliche Vorsätzlichkeit darf man jedoch nicht mit jener der Tiere verwechseln.
4A. Zahavi, Mate Selection – A Selection for a Handicap, in “Journal of Theoretical Biology”, 53, 1975, S. 205–214.
5N. K. Thavarajah et al., The Peacock Train Does Not Handicap Cursorial Locomotor Performance, in “Scientific Reports”, 6, 2016, https://doi.org/10.1038/srep36512.
6M. E. Laidre und R. A. Johnstone, Animal Signals, in “Current Biology”, 23, 2013, S. 829–833, https://doi.org/10.1016/j.cub.2013.07.070.
7M. J. Ryan, Sexual Selection, Sensory Systems and Sensory Exploitation, http://biology.nekhbet.com/ss_textbook.pdf; M. J. Ryan et al., Sexual Selection for Sensory Exploitation in the Frog Physalaemus pustulosus, in “Nature”, 343, 1990, S. 66–67.
8D. Morris, “Typical Intensity” and Its Relation to the Problem of Ritualisation, in “Behaviour”, 11, 1957, S. 1–12, https://doi.org/10.1163/156853956X00057.
9R. Dakin et al., Biomechanics of the Peacock’s Display: How Feather Structure and Resonance Influence Multimodal Signaling, in “Plos One”, 2016, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152759.
10R. Dawkins und J. R. Krebs, Animal Signals: Information or Manipulation?, in J. R. Krebs und N. B. Davies (Hrsg.), Behavioural Ecology, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1978, S. 282–309; M. S. Dawkins und T. Guilford, The Corruption of Honest Signalling, in “Animal Behaviour”, 41, 1991, S. 865–873.
11M. Gyger und P. Marler, Food Calling in the Domestic Fowl, Gallus gallus: The Role of External Referents and Deception, in “Animal Behaviour”, 36, 1988, S. 358–365, https://doi.org/10.1016/S0003-3472(88)80006-X.
Teil IDas Auge isst mit
Kapitel 1Meisterhafte Tänzer
Sie singen wunderbar, schwingen sich in den Himmel auf oder fliegen mit kräftigem Flügelschlag davon. Sie stürzen, wie der Wanderfalke, mit über 300 Stundenkilometern herab, und im Wasser können sie lange die Luft anhalten und tauchen. Auf ihrer Wanderung legen sie Zehntausende Kilometer im Flug zurück, trotzen Wind und Wetter und überqueren die höchsten Gipfel der Welt. Sie haben ein auffälliges buntes Gefieder, und außerdem können sie auch noch tanzen. Als im Lauf der Evolution die Anmut verteilt wurde, standen die Vögel in der ersten Reihe. Uns gewöhnlichen Sterblichen bleibt nichts übrig, als ihre Schönheit und Eleganz zu bewundern.
Vielleicht kommt ihnen hin und wieder jemand nahe. Erinnern Sie sich an die wunderbaren Stepptänze von Ginger Rogers und Fred Astaire, die Anfang der 1930er-Jahre zuerst Amerika und dann Europa bezauberten? Es wird Sie vielleicht wundern, aber auch Vögel steppen. Nein, das ist kein Scherz, in der Natur gab es den Stepptanz schon lange, bevor er nach Hollywood kam.
Die Prachtfinken der Uraeginthus-Gattung sind die Ginger Rogers und Fred Astaires unter den Vögeln: eine winzige Gruppe kleiner afrikanischer Vögel mit himmelblauem oder violettem Bauch und bräunlichem Rücken, Verwandte der bekannteren Zebrafinken (Taeniopygia guttata), die in jeder Tierhandlung zu finden sind. Trotz ihres bunten Gefieders und ihrer Anmut tragen diese Vögel im Englischen einen lächerlichen Namen: Cordon bleu. Ja, wie das mit Schinken und Käse gefüllte Schnitzel. Doch ungeachtet seines Namens steppt der Blaukopfastrild (Uraeginthus cyanocephalus), der ungefähr zehn Zentimeter groß ist und auch Blaukopfschmetterlingsfink genannt wird, wenn er ein Weibchen erobern möchte. Mit bloßem Auge erscheint uns das Balzen der Prachtfinken wie banales Hüpfen, doch wenn man ihren Tanz in Zeitlupe betrachtet, auf Aufnahmen mit mehr als 300 Bildern pro Sekunde, stellt man fest, dass sie einen trippelnden Tanz aufführen. Beim Balzen setzt sich das Männchen neben das Weibchen auf einen Zweig, mit einem kleinen Ast für den zukünftigen Nestbau im Schnabel, und beginnt zu singen und zu hüpfen. Bei jedem Sprung trippelt es drei- bis viermal auf dem Zweig, und zwar alle 65 Millisekunden. Diesen Stepptanz wiederholt es 25- bis 50-mal in der Sekunde, und dazu singt es wie in einem Musical.12 Und das Weibchen antwortet: Es singt und tanzt gemeinsam mit dem Männchen. Die beiden Tänzer, Männchen wie Weibchen, steppen paarweise und trippeln auf dem Ast und produzieren dabei nicht vokalische Laute,13 genau wie wir Menschen, wenn wir mit Tanzschuhen mit verstärkten Absätzen und Spitzen steppen. Es handelt sich um ein multimodales Signal, das sich in der Familie der Prachtfinken14 mehrmals und unabhängig voneinander entwickelt hat und sich vor allem visuelle Reize – Tanz und buntes Gefieder – und in zweiter Linie akustische – Gesang und Rhythmus der Schritte – zunutze macht. Das Tüpfelchen auf dem i ist die Anwesenheit eines Publikums: Als geübte Tänzer geben sowohl das Männchen als auch das Weibchen vor Publikum eine Reihe von Zugaben. Und zwar nicht, um von den Anwesenden bemerkt zu werden, sondern um dem eigenen Partner zu verstehen zu geben, dass er/sie bereits vergeben ist: eine direkte Kommunikation in eigener Sache.15 Blaukopfastrilden nehmen die Monogamie ernst.
Doch nicht nur afrikanische Prachtfinken erinnern an menschliche Balletttänzer. Auf der anderen Seite des Atlantiks, in den Urwäldern Zentralamerikas und im Norden Südamerikas, gibt es ebenfalls einen hervorragenden gefiederten Tänzer: den Gelbhosenpipra (Ceratopipra mentalis) aus der Familie der Schnurrvögel (Pipras). Um zu verstehen, warum dieser ca. zehn Zentimeter große Sperlingsvogel berühmt geworden ist, müssen wir einen Schritt zurück in die legendären 1980er-Jahre machen.
Am 25. März 1983 brachte der US-amerikanische Sänger Michael Jackson eine Single heraus, die in die Musikgeschichte eingehen sollte: Billie Jean. In schwarzem Sakko, Hochwasserhose, weißen Socken und straßbesetztem Handschuh auf der linken Hand steigt Michael Jackson im Civic Auditorium in Pasadena auf die Bühne der Emmy Awards, wo die TV-Spezialsendung Motown 25: Yesterday, Today, Forever aufgenommen wird. Zum ersten Mal führt er seinen Moonwalk auf: einen Tanzschritt, bei dem die Beine Vorwärtslaufen simulieren, während sie sich in Wirklichkeit rückwärts bewegen. Der Sänger schien sich über die Schwerkraft hinwegzusetzen, als ob er sich auf einer unsichtbaren Rolltreppe bewegte. Der Moonwalk wird augenblicklich berühmt und Michael Jackson zum Idol. Sogar Fred Astaire, der die von der NBC – National Broadcasting Company – ausgestrahlte Sendung sieht, bezeichnete Jackson als „größten Tänzer aller Zeiten“. Aus dem Mund Astaires, der ebenfalls mit einem großen Ego gesegnet war, ein riesengroßes Kompliment.
Sechs Jahre später schrieben Gary Stiles und Alexander F. Skutch in A Guide to the Birds of Costa Rica, dass ein kleiner tropischer Sperlingsvogel, der nur 15 Gramm wog, „ohne die Beine zu bewegen rückwärtsging“,16 um ein Weibchen zu umwerben. So wurde das Gelbhosenpipra-Männchen zum „Vogel, der den Moonwalk tanzt“.
Die Männchen dieser Art, mit samtigem schwarzem Gefieder, strahlend rotem Kopf und kanariengelb gefiederten Beinen, wenden eine einzigartige Methode an, um die olivgrünen Weibchen zu umwerben. Sie tanzen auf einer regelrechten Bühne. Jedes Männchen hat eine eigene Bühne in einem bestimmten Abstand von der der anderen Männchen, die es jedoch nie aus den Augen verliert. Dem Gelbhosenpipra-Männchen reicht ein Zweig oder ein gut sichtbarer blattloser Ast. Nach einem S-förmigen Flug lässt es sich darauf nieder, schlägt die Flügelspitzen aneinander und führt den Moonwalk auf, das heißt, er erweckt den Eindruck rückwärtszugehen, ohne sich von der Stelle zu rühren. Manchmal auch seitlich.17 So trippeln die Männchen mehrmals vor den Weibchen auf und ab, die die Darbietung beurteilen und den besten Tänzer auswählen. Diese Art der Balz – bei der eine bestimmte Anzahl von Männchen sich auf eine Balzarena aufteilt, dabei in Blick- und Hörkontakt bleibt und vor den Weibchen ein Ritual vollführt, die daraufhin ihren Partner wählen – bezeichnet man als Lek, was auf Schwedisch Spiel bedeutet. Als Lek bezeichnet man sowohl die Balzarena als auch die Methode der Werbung, die viel weiter verbreitet ist, als man glauben möchte, und nicht nur von Vögeln, sondern auch von Säugetieren, Amphibien, Fischen und sogar Insekten praktiziert wird.
In der Balzarena häufig anzutreffen ist eine Gruppe berühmter gefiederter Tänzer aus den Regenwäldern Neuguineas. Das ist die Heimat einer großen Vogelfamilie mit auffälligem, luftigem Gefieder und schillernden Federn: der Paradiesvögel, zu denen außergewöhnliche Tänzer gehören wie die Strahlenparadiesvögel (Parotia). Es handelt sich um insgesamt sechs Arten, die zwischen 25 und 40 Zentimeter groß werden. Die Männchen vollführen hoch ritualisierte und komplexe Tänze und tragen dabei ein „Tutu“.
Weibliche Paradiesvögel haben ein unscheinbares rötlich-braunes Gefieder. Die Männchen hingegen sind tiefschwarz, mit einem Band irisierender Federn auf der Stirn, im Nacken und am Hals, die in blaugrünen bis bronzefarbenen Tönen schillern. Die Farben werden von den Nanostrukturen der Federn erzeugt. Hinter jedem Auge befinden sich auf der Höhe der Ohrdecken Federohren aus verlängerten, spitz zulaufenden Federn (Strahlen) wie lange Wimpern, nach denen die Art benannt ist. Die Männchen tanzen bei der Balz. Ihre Balztänze sind die einfachste und wirkungsvollste Art und Weise, sich darzubieten, sie erlauben es den Weibchen, ihre Statur und die Qualität ihres Gefieders zu beurteilen. Der Tanz der Paradiesvögel besteht jedoch nicht einfach in der Wiederholung eines einzigen Schrittes, ihm liegt eine wahre Choreografie mit mehreren Figuren und Posen zugrunde. Nichts wird dem Zufall überlassen oder improvisiert, jeder einzelne Schritt wird in einer genau festgelegten Abfolge aufgeführt.
Als Erstes muss jedoch eine geeignete Bühne gefunden werden. Die Männchen der Strahlenparadiesvögel oder Arfak-Paradiesvögel (Parotia sefilata) suchen die Bühne, auf der sie sich darbieten – ein kleiner Platz auf dem Boden –, sehr sorgfältig aus. Vor jeder Darbietung säubern sie ihn auf geradezu manische Weise: Sie entfernen kleine Äste, Wurzeln, Blumen und Blätter, die auf den Boden gefallen sind, oft sogar – man glaubt es kaum – mit einem Blatt oder Zweiglein im Schnabel. Sie ebnen alle Löcher ein und entfernen jedes Hindernis, über das sie stolpern könnten, was ihre Darbietung und die daraus folgenden sexuellen Genüsse zunichtemachen würde. Sie glätten sogar den Ast „in der ersten Reihe“, über dem Balzplatz, auf dem das Weibchen Platz nehmen wird, um sie zu beurteilen.
Sobald alles fertig ist, warten sie. Kaum ist das Weibchen da, beginnt die Show. Das Männchen beginnt seine Darbietung mit einer tiefen Verbeugung, dreht den Kopf zur Seite und betrachtet mit seinen lapislazuliblauen Augen das Weibchen. Dann verändert sich plötzlich die Farbe der Augen, sie werden gelb, und der Tanz beginnt. Das Männchen schüttelt den Kopf, was die Schmuckfedern in Schwingung versetzt, und streift das Tutu über: Die schwarzen Brust- und Flankenfedern sträuben sich und schließen sich ringförmig über dem Rücken, sodass sie tatsächlich wie das Tutu einer Ballerina wirken. Mit seinem neuen Röckchen beginnt das Männchen nun auf dem Platz hin und her zu trippeln: ein paar Schritte nach links, ein paar nach rechts, und das mehrmals. Eine Szene, die weniger an Schwanensee denn an das Torkeln eines Betrunkenen erinnert. Aus der privilegierten Perspektive des Weibchens wirkt das tanzende Männchen jedoch wie ein Ring aus schwarzen Federn, mit einem irisierenden Streifen auf dem Nacken und sechs hypnotisierenden schwarzen Punkten, die sich kreisförmig bewegen: den Endpunkten der sechs hinter den Augen angewachsenen Federn. Nun zeigt das Männchen seinen glänzenden Halsspiegel aus schillernden Federn. Es ruckelt mit dem Kopf wie der große Komiker Totò, zeigt die Federn auf der Kehle, und hin und wieder geht es in die Knie, sträubt und breitet sein Tutu aus und streckt die schillernden Federn auf seiner Kehle nach oben. Von oben gesehen wird der schwarze Kreis so von einem hellen Lichtfleck durchbrochen. Wenn der Tanz gut aufgeführt wird, ist das Weibchen fasziniert und gestattet die Paarung.
Raffiniert ist auch die Choreografie des männlichen Kragenparadiesvogels (Lophorina superba). Auch er ist völlig schwarz, nahezu unsichtbar. 2018 hat man festgestellt, dass seine dunklen Federn aufgrund ihrer Struktur 99.95 Prozent des Lichts absorbieren.18 Dieses gefiederte „schwarze Loch“ ist jedoch mit zwei schillernden Lichtpunkten versehen: zwei himmelblau schimmernden erbsenförmigen Erhebungen auf dem Kopf und einem Fleck auf der Kehle.
Nachdem der Paradiesvogel sorgfältig den Balzplatz gesäubert hat, auf dem er sich präsentieren wird, beginnt das Männchen die Weibchen anzulocken, es reißt den Schnabel auf, wobei es dessen zitronengelbes Innere zeigt, und sträubt sein schillerndes Brustgefieder. Sobald das Weibchen da ist, beginnt das Männchen seinen Tanz. Es schließt den Schnabel und hebt einige Brust- und Rückenfedern, sodass diese einen Kranz um seinen Kopf bilden. Von vorne betrachtet wirkt der Kranz wie ein schwarzes Oval, mit zwei Höckern und einem hellblau leuchtenden Band. Nun beginnt der Tänzer mit angelegten Flügeln und nach oben gesträubtem Schwanzgefieder nach rechts und links zu hüpfen. Er nähert sich immer mehr dem Weibchen und schnalzt dabei mit den Flügeln.19 Die sehr wählerischen Weibchen sehen sich ungefähr 15 bis 20 Darbietungen an, bevor sie sich hingeben.20
Es ist unmöglich, jede einzelne Choreografie zu beschreiben. Es gibt ungefähr 40 Paradiesvogelarten, die genauso viele Tänze und Varianten aufführen. Oft ist es extrem schwierig, diese Vögel und ihre Choreografien zu studieren, und man stellt erst nach vielen Jahren fest, dass eine Art mit einem einzigen Tanz in Wirklichkeit zwei Arten sind, die einander jedoch so ähneln, dass man sie für eine hielt und dass sich ihr Tanz nur in einigen winzigen Details unterscheidet. Dies ist der Fall beim Vogelkop-Paradiesvogel (Lophorina niedda), der lange als Unterart der Lophorina superba galt und erst 2018 eben aufgrund seines in einigen Details abweichenden Tanzes in den Rang einer eigenen Art erhoben wurde.21
Einen der romantischsten Tänze kann man allerdings auch hierzulande beobachten: Haubentaucher (Podiceps cristatus) führen einen leidenschaftlichen Tanz auf dem Wasser auf.
Balztanz des männlichen Strahlenparadiesvogels (Parotia)
Die Vögel aus der Familie der Lappentaucher (Podicipedidae) sind ca. 40 Zentimeter große Wasservögel, die in fast allen europäischen Seen anzutreffen sind. Sie sind begabte Taucher, die lange unter Wasser schwimmen können, und ernähren sich zum Großteil von Fischen, die sie als Ganzes, samt Schuppen und Gräten, fressen, und dann als kleinen trockenen Pfropfen wieder hervorwürgen. In dieser Beschreibung wirken sie nicht sehr faszinierend, doch die Vögel mit der äußerst eleganten Silhouette führen einen wunderbaren Hochzeitstanz mit wahrlich königlichen Posen auf, die von den Farben des Gefieders noch verstärkt werden.
Bauch und Vorderseite des langen Halses der Haubentaucher sind strahlend weiß, die Flanken rot und der Rücken ist braunschwärzlich. Zwischen dem zarten, scharfen Schnabel und dem rotumrandeten Auge liegt ein dünner schwarzer Streifen. Der Kopf ist von einem Kragen rot-braun-schwarzer Federn umgeben. Im Frühling, in der Paarungszeit, bietet ihr Tango auf dem Wasser ein außergewöhnliches Schauspiel. Zuerst ruft das Männchen krächzend das Weibchen, die Rufe werden croaking calls genannt. Sobald das Weibchen sich interessiert zeigt, beginnt der Tanz. Die Partner beäugen sich abwechselnd: Sie tauchen unter und wieder auf und beobachten den anderen, der gerade mit gebogenem Hals und gehobenen Flügeln die „Katzenpose“ einnimmt, und schlagen dabei mit ihren Füßen mit den lappenartigen Häuten auf das Wasser. Nach der ersten Kontaktaufnahme beginnt eine komplexere Phase: Die beiden nähern sich einander, für gewöhnlich nimmt das Männchen nun mit herausgestreckter Brust die „Pinguinpose“ ein und hebt sich fast vollständig aus dem Wasser, um sich dann auf die Höhe des Weibchens herabzusenken. Die beiden blicken einander an, strecken ihre schwarz-roten Hälse, stoßen Rufe aus und schütteln sehr lange die Köpfe, als wollten sie Nein sagen, hin und wieder putzen sie das Gefieder, wobei eine oder zwei Flügelfedern nach oben gezogen, geputzt und poliert werden. Diese Phase dauert mitunter sehr lange. Mehr als zehn Minuten sind die beiden Haubentaucher ganz mit ihrem Liebestanz beschäftigt und achten nicht auf ihre Umgebung. Wenn jeder Schritt korrekt ausgeführt wurde, besiegeln die beiden Partner schließlich ihren Liebespakt: Sie schwimmen Seite an Seite, tauchen unter und sammeln am Boden des Sees Algen und Wasserpflanzen. Sobald sie mit dem Material im Schnabel wieder aufgetaucht sind, schwimmen sie aufeinander zu, bis sie sich, flach auf der Wasseroberfläche treibend, einander gegenüber befinden. Sobald sie einander ganz nah sind, erheben sie sich in die „Pinguinpose“ und präsentieren dem anderen beim weed dance, dem Algentanz, ein Büschel Wasserpflanzen. So verharren sie, aufrecht, einander gegenüber, schlagen mit den lappenartigen Schwimmhäuten, sodass das Wasser schäumt. Sie schütteln den Kopf und zeigen stolz ihr Algenbüschel, als wäre es eine rote Rose, wie Tangotänzer sie einander schenken, schütteln die „Beute“, bis sie sie zerfetzt haben, und oft tauschen sie sie aus: Diese Geste besiegelt ihr Versprechen auf Monogamie, ist eine Art Verlobungsring.
Viele Haubentaucher vollführen komplexe Balzrituale, ihre Tänze unterscheiden sich von Art zu Art nur wenig. Beim Ohrentaucher (Podiceps auritus) zum Beispiel, einer Art, die in nördlicheren Breiten, von Nordamerika bis Asien brütet und nur den Winter im Nordosten Italiens verbringt, endet der weed dance mit einem weed rush.22 Nachdem die Ohrentaucher einander ihr Algenbüschel gezeigt haben, verharren sie nicht einander gegenüber, sondern schwimmen ca. zehn Meter Seite an Seite auf der Wasseroberfläche. Den spektakulärsten weed dance, allerdings ohne Wasserpflanzen im Schnabel, führen der Renntaucher (Aechmophorus occidentalis) und der Clarktaucher (Aechmophorus clarkii) auf, zwei nordamerikanische Arten, deren Balzritual so beginnt: Aufrecht, mit gut sichtbarem Hals, stoßen beide raue Rufe aus und blicken einander in die Augen; in dieser Phase scheint der Blickkontakt ein wichtiger Teil der komplexen Choreografie zu sein. Dann nähern sich die Partner mit gesenktem Kopf, schütteln den Kopf und bespritzen einander mit dem Schnabel. Und schließlich beginnt der Lauf übers Wasser. Mit Trippelschritten, in einem Rhythmus von 16 bis 20 Schritten in der Sekunde, tauchen die Renntaucher völlig aus dem Wasser auf, mit nach oben gerecktem Hals und aufgerichtetem Schnabel, als wollten sie den Himmel berühren, hoch gereckten, aber nicht gespreizten Flügeln. So laufen sie nebeneinander auf der Wasseroberfläche, zeigen ihre strahlend weiße Brust, rund um sie spritzt das Wasser. Sie legen auf diese Weise ungefähr 20 Meter zurück, dann tauchen sie unter. Nun folgt ihre Version des „Algentanzes“. Hin und wieder nähert sich dem zukünftigen Paar ein dritter Renntaucher und man sieht eine laufende Dreierformation. Oder auch zwei Männchen: Vielleicht versuchen sie auf diese Weise, den noch unentschlossenen Weibchen die eigene Fitness zu beweisen.23
Eine weitere, viel komplexere Variante dieses Tangos auf dem Wasser, doch diesmal ohne rote Rose oder Algen im Schnabel, wird vom südamerikanischen Cousin der hiesigen Haubentaucher aufgeführt: dem Goldscheiteltaucher (Podiceps gallardoi). Mit Ausnahme des dunklen Rückens ist er völlig weiß, ein schwarzes Band bedeckt Hals, Wangen und Kopf, auf dem ein roter Schopf sitzt. Der Goldscheiteltaucher ist der wahre Champion unter den Tangotänzern. Und es gibt keinen schöneren Ort zum Tangotanzen als die Vulkanseen in der Steppe Patagoniens, die zwischen 500 und 1.200 Meter über dem Meeresspiegel liegen.
Der Goldscheiteltaucher lebt zwar in abgelegenen Regionen und wurde erst 1974 als eigene Art entdeckt und beschrieben, wird aber dennoch von der IUCN, der Weltnaturschutzunion, als gefährdet eingestuft. Er wird von invasiven Arten – vor allem vom amerikanischen Nerz, der Eier und Küken frisst – und von der Klimaerwärmung bedroht, infolge derer sich der Wasserspiegel der Seen ändert. Was hat der Wasserstand damit zu tun? Nun, er darf nicht zu hoch, aber auch nicht zu niedrig sein. Er muss genau in der Mitte liegen, damit das Tausendblatt (Myriophyllum), eine Süßwasserpflanze aus der Familie der Haloragaceae, über die Wasseroberfläche hinauswachsen und die Nester der Goldscheiteltaucher tragen kann. Vom Wasserspiegel und diesen Pflanzen hängt somit die Fortpflanzung ganzer Kolonien ab: Wenn das Wasser zu hoch steht, gehen die Nester samt Eiern und Küken unter oder werden vom Wind oder der Strömung umgekippt. Vor 40 Jahren, in den 1980er-Jahren, wurden noch zwischen 3000 und 5000 erwachsene Goldscheiteltaucher gezählt, mittlerweile gibt es nur noch zwischen 650 und 800.24
Der „Balztango“ des Haubentauchers
Doch zurück zum argentinischen Tango: zum Jawort des Goldscheiteltauchers, einer innigen und leidenschaftlichen Abfolge von zackigen und impulsiven Bewegungen. Am auffälligsten ist die „Katzenpose“ mit gespreizten Flügeln: Während der eine sich verbeugt, sich aufplustert und die Flügel spreizt, taucht der andere auf groteske Weise unter, legt den Kopf nach hinten, bis er den Rücken berührt, als ob er vor dem Untertauchen einen Anlauf nähme. Darauf folgt die merkwürdige head-shaking ceremony: Die beiden Partner stehen Brust an Brust und werfen abwechselnd Kopf und Hals nach hinten, bis sie mit dem Nacken den Rücken berühren, worauf sie wieder in die aufrechte Position zurückschnellen. Das machen sie abwechselnd und so schnell, als wären sie verrückt geworden. Dann richten sie sich, noch immer Brust an Brust, im Wasser auf, nehmen die „Pinguinpose“ ein und drehen wie zwei professionelle Tangotänzer mehrmals den Kopf nach rechts und links, perfekt synchron, während sie mit den gelappten Füßen auf das Wasser schlagen.
Das Beispiel der Haubentaucher und Paradiesvögel hat klar gezeigt: Balztänze – innerhalb ein und derselben Gruppe, Art oder Familie – weisen alle dieselben Elemente auf, die sich zwar manchmal etwas unterscheiden oder anders angeordnet, aber doch sehr, sehr ähnlich sind. Das war auch Konrad Lorenz aufgefallen, als er das Balzritual einiger Schwimmenten untersuchte: das der Stockenten (Anas platyrhynchos), der Schnatterenten (Mareca strepera) und der Krickenten (Anas crecca).25 Im Winter legen die männlichen Stockenten kollektive Balzrituale an den Tag, bei denen sie spezielle Posen einnehmen und sich dabei um die beste Position streiten, um den Weibchen zu imponieren. Sie beginnen den Tanz, indem sie den Schnabel schütteln und den Kopf heben, schütteln den Schwanz, heben sich aus dem Wasser und stoßen einen Pfeifton aus, dann schlagen sie mit dem Schnabel auf das Wasser und spritzen das Weibchen an: grunt-whistle. Dann heben sie den Schwanz, plustern sich auf, nehmen die sogenannte head-up-tail-up-Pose ein und drehen sich zum Weibchen um. Dasselbe Verhalten legen auch die Schnatterente und die Krickente an den Tag. Doch es gibt noch viele andere Posen, die von vielen Entenarten bei der Balz eingenommen werden, zum Beispiel das preening behind wing, also Gefiederputzen hinter dem Flügel, oder mehrmaliges Kopfschlagen auf das Wasser, oder so zu tun, als würde man trinken. Was einzig und allein bedeutet: Die gemeinsame Choreografie ist der Beweis der Koevolution.
Dennoch stellt sich die Frage: Warum haben sich ausgerechnet diese Tänze und speziellen Posen im Verlauf der Evolution entwickelt? Woher kommt die Bemühung um derart genaue und stereotype Choreografien? In all diesen Fällen handelt es sich nicht nur um einen Beweis körperlicher Fitness, und gewiss nicht um eine eitle Darbietung. Was also? In Wirklichkeit transportieren alle diese Tänze ganz genaue Botschaften. Um das Warum zu verstehen, müssen wir uns in Erinnerung rufen, dass tierische Kommunikation sehr sparsam ist: Wenn es bereits eine wohlbekannte Geste gibt, die zu einem anderen Zweck eingesetzt wurde, braucht man keine neuen Gesten erfinden, es reicht, die alten weiterzuverwenden. Und wenn sich diese Geste im Lauf der Evolution bewährt, wird sie zu einem kodifizierten Standardsignal, das dem zukünftigen Partner viele Informationen liefert. Doch die Evolution hat kein Ziel, keine Absicht und schon gar kein Ende: Sie ist eine äußerst komplizierte Geschichte, die aus Zufällen und auch aus Irrtümern besteht, aus Aufwand und Vorteilen, aus Abzweigungen, die glücklicherweise im richtigen Augenblick genommen wurden. Und deshalb sind auch die komplizierten Tanzrituale, die Auslese ihrer Eigenschaften, Schritte und deren wechselseitige Kombination ein Ergebnis des Zufalls: Bewegungen, die sich aufgrund der natürlichen und der sexuellen Auslese mit der Zeit herausgebildet haben.26 Eigenschaften und Bewegungen haben bei einem oder mehreren Weibchen Gefallen gefunden, die Männchen profitierten von der angeborenen Vorliebe des Weibchens für Farben27 und Bewegungen, oder vielleicht erleichterten sie den Weibchen die Beurteilung der Männchen, die sie vor sich hatten.
Das Sammeln von Wasserpflanzen oder das Vortäuschen von Trinken könnte ein Indikator für die Fähigkeit sein, Nahrung für sich und die zukünftige Nachkommenschaft zu besorgen. Es könnte ein Indikator dafür sein, wie sehr die Männchen zur Brutpflege bereit sind. Das preening und das Radschlagen der Parotia-Paradiesvögel wurden möglicherweise übernommen, weil sie den Weibchen erlauben, aufmerksam den Zustand des Gefieders des Männchens in Augenschein zu nehmen: ob es sauber oder schäbig und verschlissen ist, ob nach der Mauser schon neue Federn und Flaumfedern gewachsen sind, wie leuchtend die Farben sind (was oft auch von der richtigen Ernährung abhängt28), ob es Parasiten hat oder nicht. Der Zustand des Gefieders lässt aufgrund der Mauser Rückschlüsse nicht nur auf das Alter des Anwärters, sondern auch auf dessen Körperbau und den augenblicklichen Gesundheitszustand zu29: ein hervorragender Personalausweis. Und es ist kein Zufall, dass Enten ausgerechnet die Federn hinter dem Flügel pflegen und sich somit zwingen, ihn zu heben: Alle oben genannten Gattungen weisen den sogenannten Flügelspiegel auf, eine besondere Gefiederpartie – die Schwungfedern – mit lebhaften Farben und aufgrund der Struktur des Gefieders oft metallischen Reflexen.30 Jede Entenart hat dabei eine charakteristische Farbe: Bei Stockenten ist der Flügelspiegel metallisch blau mit schwarzweißem Rand, bei Krickenten ist er grünschwarz, mit einem breiten weißen Streifen darüber, und bei Schnatterenten ist er weiß; bei der Spiessente (Anas acuta) ist er schwärzlich-grün mit weißem Rand und einem rötlichen Streifen darüber; bei der Löffelente (Spatula clypeata) ist er dunkelgrün, während der obere Teil des Flügels himmelblau ist; bei der Pfeifente (Mareca penelope) ist er grün.
Balztanz der Stockente, samt Posen, die allen Enten gemeinsam sind
Nicht immer sind komplexe Rituale und Töne vonnöten, um zu kommunizieren. Hin und wieder „steht uns ins Gesicht geschrieben“, was wir sagen möchten, und dasselbe passiert auch in der Welt der Vögel, vor allem der Sperlinge, denen es „auf die Brust geschrieben steht“. Aber was? Diese Frage haben sich Ornithologen seit Jahrzehnten gestellt. Das Folgende ist ein Paradebeispiel, wie kompliziert es wirklich ist, die Signale der Tiere zu verstehen, und außerdem ein gutes Beispiel dafür, wie Wissenschaft funktioniert. Zuvor müssen wir jedoch klären, wovon wir eigentlich sprechen, denn wenn man einfach Sperling sagt, macht man es sich zu einfach. Insgesamt gibt es fast 30 Sperlingsarten, doch wir beschränken uns fürs Erste auf den Haussperling (Passer domesticus), auch Hausspatz genannt, der in Europa weitverbreitet ist.
Bei genauerer Betrachtung hat der männliche Hausspatz einen schwarzen Brustlatz, der unterhalb des Schnabels beginnt und bis tief auf die Brust reicht. Im Winter wird dieser Brustlatz teilweise von schwarzen Federn mit schmutzig weißen Rändern verdeckt, die nach der Mauser gewachsen sind: Der helle Rand fällt auf die schwarzen Federn darunter, bis das Schwarz fast völlig verdeckt ist. Im Sommer ist der helle Rand jedoch abgetragen und der schwarze Brustlatz zeigt sich in seiner ganzen Größe. Über die Ausmaße dieses badge oder bip, wie der Latz auf Englisch genannt wird, hat man sich lange den Kopf zerbrochen. Manche Männchen haben im Sommer einen kleinen Brustlatz, bei manchen nimmt er die ganze Brust ein, und bei anderen wiederum ist er mittelgroß.
Seitdem dieses spezielle Merkmal und seine Varianten das Interesse der Ornithologen geweckt hatten, galten die Badges als Statussymbol. Ein großer, tiefschwarzer Brustlatz galt als ehrliches Dominanzsignal,31 das sehr aufwendig herzustellen ist und mit dem Alter und der Nährstoffversorgung korreliert: Ältere Tiere hatten einen größeren Brustlatz als junge; Nährstoffunterversorgung während der Mauser und der Entwicklung des Latzes sorgten für einen kleineren badge.32 Man glaubte, ein gutgenährter Spatz mit einem schönen großen Latz würde im Frühling früher eine Gefährtin finden und könne bessere Nistplätze mit tieferen und sichereren Nestern beziehen, aus denen die Küken nicht herausfallen können.33 Und er hätte ein aktiveres Sexualleben, könne sich im Vergleich zu seinen Artgenossen mit kleinerem Brustlatz öfter mit seiner Gefährtin paaren und sich hin und wieder auch einen kleinen Seitensprung erlauben.34
Lange Zeit galt der Brustlatz der Hausspatzen also als Paradebeispiel, wie ein Gefiedermerkmal die Rangordnung innerhalb einer Population widerspiegelt. Doch nach der Jahrtausendwende begann man langsam an diesem scheinbar so perfekten Modell zu zweifeln, das in jedem Lehrbuch der vergleichenden Verhaltensforschung zu finden war. Genauere Studien an einer größeren Anzahl von Tieren zeigten, dass etwas nicht stimmte. Beim Vergleich von





























